|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Dörzbach (Hohenlohekreis)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version see Hohebach)
In
dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts reichsritterschaftlichen (seit 1605
Herren von Eyb) Dorf Dörzbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1907. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurück. Erstmals
werden 1627 sechs jüdische Familien in Dörzbach genannt. 1688 wurden die Juden
ausgewiesen; 1752 konnten sich - zunächst zwei jüdische Familien aus Hohebach
(des Wolf Jacob und Simon Abraham) - wieder am Ort niederlassen. 1782 waren
acht jüdische Familien am Ort.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1807 75 jüdische Einwohner, 1824 98, 1831 131, 1843 169 (Höchstzahl),
1854 156, 1869 58, 1886 27, 1894 25 (in sechs Familien), 1895 23 (in fünf
Familien), 1897 23 (in sechs Familien), 1898 16 (in vier Haushaltungen), 1899 14
(in vier Haushaltungen), 1900 13, 1910 3.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten auch
die wenigen noch in Laibach und Altkrautheim
lebenden Juden zur Dörzbacher Gemeinde.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule und ein rituelles Bad (im Untergeschoss eines Hauses 'links der
Brücke über den Goldbach, zur Hälfte auf dem Klepsauer Tor', gemeint Alte
Klepsauer Str. 11 s.u.). Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden
zunächst auf den jüdischen Friedhöfen in Unterbalbach,
Laibach und Berlichingen,
nach 1852 in Hohebach beigesetzt. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,
der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Unter den Lehrern sind
bekannt: Moses Kallmann, der sich ab 1828 Moses Rosenthal nennt (geb. 1790,
1863 pensioniert, gest. 1869 in Dörzbach), 1864 war Dörzbach unbesetzt, um 1868
Lehrer Frei. Um
1894/1898 erteilte Lehrer B. Sahm aus Hohebach
den noch fünf bzw. 1898 vier jüdischen Kindern in Dörzbach den
Religionsunterricht.
Die Gemeinde wurde 1832 dem Rabbinat
Weikersheim zugeteilt.
Von den Vereinen und Stiftungen werden genannt: um 1896 die Oser Bär'sche
Stiftung (unter Leitung von J. Strauß), 1898 vier Jahrzeitstiftungen.
Seit den 1850er-Jahren ging die Zahl der Juden am Ort
durch Aus- und Abwanderung stark zurück, bis die Gemeinde aufgelöst und die hier noch
lebenden Juden der Hohebacher Gemeinde
zugeteilt wurden.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1871 Herr Igersheimer, um 1894/1895 J. Heß, H. Strauß
und H. Sänger, um 1896 H. Heß, H. Sänger und Tierarzt H. Rothschild, um
1898/1903 J. Heß und Tierarzt H. Rotschild. Als Rendant (Rechnungsführer
der Gemeinde) wird 1896 genannt: H. Strauß.
An ehemaligen, bis um 1920/30 bestehenden jüdischen Gewerbebetrieben sind
bekannt: Tierarzt H. Rothschild (Hauptstraße 20), Kurzwaren- und Stoffgeschäft
Hugo Sänger (Hauptstraße 28, Wohnhaus Hauptstraße 32). Eine
Altmaterialiensammlung betrieb Albert Fleischhacker.
Von den in Dörzbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"):
Mathilde Andersch geb. Rothschild (1891), Albert Fleischhacker (1882), Therese (Theres)
Fleischhacker geb. Strauss (1878), Lina (Karolina) Kaiser geb. Strauss (1856),
Berta Roller geb. Rothschild (1884), Moritz Rothschild (1883), Otto Rothschild
(1885), Charlotte Schulheimer geb. Rothschild (1887).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeine Berichte
"Die Juden in Dörzbach" (Beitrag von
Oberlehrer Wallrauch, 1929)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1929: "Die Juden in
Dörzbach. Von Oberlehrer Wallrauch. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1929: "Die Juden in
Dörzbach. Von Oberlehrer Wallrauch.
Da Dörzbach ein reichsunmittelbares Ritterdorf ist, darf es uns nicht
verwundern, wenn die Juden schon frühzeitig hier auftreten. Die Ritterschaft
nahm sie in Schutz, ließ sich aber dafür bezahlen. Meist wurde ihnen eine
besondere Gasse angewiesen, weshalb heute noch in Orten, welche längst keine
Juden mehr beherbergen, deren Vorhandensein unter den Namen wie Judenbad,
Synagoge, Judengasse oder Viertel weiter lebte. Die Juden nannte man
Schutzjuden. Als Einfahrtsgeld hatten sie 6 fl. zu bezahlen. Das Schutzgeld
betrug 6 fl. Außerdem hatten sie 1 fl. und 15 Kreuzer zu bezahlen, um von
den Fronlasten befreit zu sein.
Wenn wir die Orte, in denen Juden überhaupt vorkommen, näher betrachten, so
finden wir, dass es meist uralte Dörfer mit stark parzellierten Feldern und
Täler mit altem Weidebetrieb sind. In diesen Siedlungen gedieh der Vieh-
sowie der Güterhandel, welcher von den Juden mit Erfolg in die Hand genommen
wurde. Heute noch sind die Vieh- und Pferdemärkte ohne die Juden nicht
denkbar.
Durch die unglückselige Parzellierung infolge der Vermehrung der Besitzer
entstand in den Dörfern eine Menge 'kleiner Leute' und mit ihr auch
'kleiner' Juden. Was die Weber in Heimarbeit anfertigten, brachten die Juden
mit ihrem Zwerchsack in den Handel. Die Maschine nahm beiden das Brot. Die
'Neue Welt' nahm die Verarmten auf, denn es hieß: 'Dort finde man das Geld
auf der Straße'. In den Jahren 1840-1870 wanderten 70 Prozent der damaligen
Juden aus und ihnen schlossen sich viele christliche Gemeindemitglieder an.
Dörzbach hatte einst eine blühende Judengemeinde. Im Jahre 1861 hatte
Dörzbach eine eigene Synagoge und 156 Juden, zu denen von
Laibach noch 10 und von Altkrautheim 3
kamen. Heute zählt sie noch 3 Glieder, deren Stamm bereits 200 Jahre hier
seinen Sitz hat. Zottig Löw und seine Frau Frade Israel leben fort in der
Familie Optiker Stern und deren letztem weiblichen Gliede 'Julie Stern' aus
der Linie Sam. Zottig. Die weibliche Linie Jette lebt fort in den Nachkommen
der Lehrerfamilie und Optiker Rosenthal. Die zweite Linie Mayer Zottig nennt
sich Waldstein und lebt fort in den bekannten Optikerfamilien, die nach
München, Wien und Venedig auswanderten. Die dritte Linie Israel Zottig
nannte sich Geiger, ist aber frühzeitig ausgestorben.
Der schon 1755 genannte Schutzjude Wolf Jakob lebt fort in der
letzten Einwohnerin 'Therese Strauß' verehelichte Fleischhacker. Der
Schutzjude Baruch lebt weiter unter dem Namen 'Weichsel'. 1760 sind auch
hier schon die Rothschild unter 'Jakob Anselm" vertreten, deren Nachkommen
heute überall sind und dessen würdiger Vertreter der allbeliebte und
tüchtige Tierarzt Heinrich (Herz) Rothschild noch in guter Erinnerung ist.
Die begabtesten und angesehensten Glieder der Dörzbacher Gemeinde stellte
Sim. Abraham und dessen Gattin Zerrle David in ihren Nachkommen, den
weit verzweigten Gutmann, Sänger, Steiner, Levi und Waldstein. Abraham
Gutmann, genannt 'Awerle', leistete als Gemeinderat der Gemeinde treffliche
uneigennützige Dienste, indem er in den 50er Jahren die Verträge und
Beschlüsse zwischen Gemeinde und Herrschaft, sowie Realgemeinde
herbeiführte. Außer den genannten Familien treten noch auf: Altinger, Böhm,
Bär, Ehrlich, Heß, Haas, Kahn, Igersheimer, Lichtenberg, Neuburger, Stein,
Wertheimer, Weinstock.
Auch das kleine Laibach hatte seine
eigene Judengemeinde. Ihr in idyllischer Waldeinsamkeit gelegener
Judenfriedhof wird von den ersten Morgenstrahlen gegrüßt. Wie ich aus alten
Urkunden ersah, verdankt die Laiibacher Gemeinde ihre Entstehung den
deutschen Freiheitskriegen. Die Einfahrtsgelder werden meist 1812—1817
entrichtet. An Namen werden genannt: Bär, Koch, Besig, Neuburger, Schlom
Jakob, Isak Abraham, Mayer Strauß, Friedenheimer sowie Abraham Löwental.
Lazarus Bär und Jakob Schleisinger aus
Unterschwandorf sind vom 15. bis
25. Juni 1815 als russische Dolmetscher tätig und erhalten für 10 Tage (à 40
Kreu- |
 zer)
400 Kreuzer = 6 fl. 40 Kreuzer. Aaron Mayer (Vater des Optikers Waldstein)
lieferte den Offizieren Arak für 6 fl. 30 Kreuzer. Die Laibacher Juden kamen
auf keinen grünen Zweig. Sie verarmten in dem Notjahr 1817 und wurden einige
Jahre darnach in Armut vergantet, und meist besorgte eine mildtätige Hand
ein ehrliches Begräbnis. Heute erinnert nur noch der
Judenfriedhof sowie die sogenannte
Judengasse an die vor 100 Jahren dort blühende Gemeinde. ' zer)
400 Kreuzer = 6 fl. 40 Kreuzer. Aaron Mayer (Vater des Optikers Waldstein)
lieferte den Offizieren Arak für 6 fl. 30 Kreuzer. Die Laibacher Juden kamen
auf keinen grünen Zweig. Sie verarmten in dem Notjahr 1817 und wurden einige
Jahre darnach in Armut vergantet, und meist besorgte eine mildtätige Hand
ein ehrliches Begräbnis. Heute erinnert nur noch der
Judenfriedhof sowie die sogenannte
Judengasse an die vor 100 Jahren dort blühende Gemeinde. '
Mit der Landflucht der Juden ging auch das Leben in dem blühenden
Marktflecken Dörzbach zurück. Eine sympathische Figur aus der Erinnerung ist
der im ganzen Lande bekannte Optiker Heß. Der große hagere, allzeit
zufriedene, ehrliche Mann trug jahraus, jahrein seinen Kasten von Ort zu
Ort. Er war für viele ein Berater nicht nur für schwache, sondern auch für
kranke Augen. Groß war meine Freude, als er mich eines Tages im Donautal
aufsuchte, er, der erfahrene Mann und ich, der blutjunge Lehrer. Immer hatte
er in seinen letzten Jahren etwas für gute Kinder in seiner Tasche. Sein
Vater hatte von ihm gesagt, wie mir Mathilde Böhm (die verewigte beste
Trägerin der Dörzbacher Erinnerungen) erzählt: 'Joseph, du bist und bleibst
ein Pechvogel, dein Leben lang.'
Als er bei der Musterung die Losnummer Nr. 1 herauszog, sagte sein Vater:
'Joseph, wenn die Nr. 0 drinnen gewesen wäre, du hättest sicherlich auch die
0 gezogen." Joseph wurde ein tüchtiger Soldat, blieb aber doch ein
Pechvogel. Eine Frau starb nach der andern. 4 Frauen hatte er. Im Jahre 1905
durfte er seine müden Augen schließen, er, der so vielen müden Augen Hilfe
und Glanz verliehen hatte.
Vom Saufwolf erzählt man sich folgende Geschichte. Wolf Levi Wertheimer war
ein schneidiger Soldat gewesen, nun aber tüchtiger Metzger. Die 1848er
Freiheitsbewegung gliederte auch ihn in die Bürgerwehr ein. Weil er gerne
trank, so nannte man ihn 'Saufwolf'. Am 13. März hatte Wertheimer die Wache
am Regenshäuser Tor. Sein Nachbar, Schreiner Reuß, welcher angeheitert war,
gedachte dem Wertheimer Judenangst einzujagen. In der Dunkelheit schlich er
sich immer näher an ihn heran. Wertheimer ruft ihn 3 Mal an. Der Geist im
Bettlaken gibt keine Antwort. Saufwohl legt an, und der betrunkene Wolf
bricht, zu Tode getroffen, zusammen. Vor seinem Tode bezeugt er: 'Wertheimer
ist unschuldig, ich wollte ihm Angst einjagen.' Wegen der stündlich
zunehmenden Gefahr wurde eine Soldatenabteilung nach Dörzbach entstandt. Sie
ziehen Mitte durch die Straßen. In ihrer Mitte führen sie 'Wolf Wertheimer'.
Niemand ihm Darf hats ihm nachgetragen.
Im Umgang mit den Kindern fanden viele hebräische Wörter Eingang im
Frankenlande. Nur haben sie meist einen mundartlichen Anstrich: Ich nenne:
Schoufet, Gallach, Bornes, Mackes, Duches, Gediwer, Kaffruse, Schicker,
Brauches, Schaute, Schlamassel, Massemate, Schlemil, Schmußer, Pleite, Uleno,
Mores, Brauges, Rauges, meschuke, achle, ganfe, schofel, kappores, Messumes.
Im Fränkischen hat man viel Wert darauf gelegt, von den 'Juden' die
Saatfrucht zu erhalten, weil man derselben, sobald sie unter jüdischem Dache
gelagert hatte, größere Keimfähigkeit zuschrieb.
Aber auch umgekehrt haben die Juden den Christen manches nachgemacht.
Mathilde Böhm, im Jahre 1840 geboren, erzählte, dass sie als Kind einen
unendlich feinen Faden spinnen konnte. Sie habe die ganze Freundschaft mit
versehen. Die daraus gefertigten Hemden haben bei den Musterungen Glück
gebracht und vom Militärdienste befreit, indem die Träger solcher Hemden
unbedingt eine hohe Losnummer zogen.
Auf enge Fühlungnahme der israelitischen Jugend mit den lebhaften
Frankenkindern deutet auch das Deklamationsspiel vom Jokel, der alle
Schicksale durchkostet, eine Nachbildung des Chad-Godje am Pessachabend.
Schließlich holt der Teufel den Metzger. Der Schluss lautet sodann im
Fränkischen:
No schickt der Herr de Daifel naus
Er soll de Metzger hole,
Metzger duet des Oechsle schlachte,
Oechsle duet des Wässerli saufe,
Wässerli duet des Feuer lösche,
Feuer duet des Prügeli brenne,
Prügeli duet des Hundle schloche,
Hundle duet des Jockeli beiße,
Jockeli duet a Bire schüttle,
Bire duen a falle.
Man ersieht ganz deutlich, dass das Kind das ganze chaldäische Lied
verbildet hat. Aber man darf nicht verkennen, wie rasch dies Lied von
Kindern aufgenommen und durch Jahrhunderte weitergegeben wurde." |
Die Dörzbacher jüdische Gemeinde zählt nur
noch drei Personen (1930)
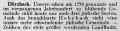 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1930: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1930: |
Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge
Zunächst benutzten die Dörzbacher
Juden die Einrichtungen in Hohebach. 1685
wurden sie allerdings dafür bestraft, dass sie ohne Erlaubnis die Gottesdienste
im Nachbarort besuchten. Dort bestand zu dieser Zeit ein Betsaal in einem
Privathaus. Drei Jahre später wurden die Dörzbacher Juden ausgewiesen. Nach
der Wiederaufnahme 1752 erhielt Judenvorsteher Israel von Dörzbach mit den
Seinen die Erlaubnis, die Schule des Judenschulmeisters Jakob in Hohebach für jährlich
zwei Gulden zu besuchen.
Ein erster Betsaal in Dörzbach wurde 1782 von den
inzwischen acht jüdischen Familien eingerichtet (Standort unbekannt). Sie
hatten hierfür von der Ortsherrschaft die Erlaubnis bekommen. 1807 lebten
bereits 17 jüdische Familien (75 Personen) in Dörzbach. Sie benutzten nach
einem Bericht des Kreisamtmannes aus Öhringen eine Synagoge
"in einem Miethaus", wobei es sich vermutlich immer noch um den 1782
eingerichteten Betsaal gehandelt hat.
Um 1810/15 wurde eine (neue) Synagoge erbaut.
Jedenfalls geht aus einem Bericht des Oberamtes Künzelsau vom 1. Juni 1822
hervor, dass die damals 20 jüdischen Familien "erst vor wenigen Jahren
eine Synagoge erbaut haben, auf welche sie noch eine bedeutende Kapitalsumme
schuldig sind". In diesem Synagogengebäude war im unteren Stock die jüdische
Schule, im oberen Stock der Betsaal. Bei einer Medizinalvisitation der Oberamtes
Künzelsau im September 1836 wurden jedoch die beengten und ungesunden Verhältnisse
im Schulraum beanstandet. Die Schule mit damals 44 Kindern sei in einem engen
und relativ niederen Raum, der nur von einer Seite durch zwei Fenster Licht
erhielt. Die jüdische Gemeinde wurde zur schnellen Veränderung dieser
unhaltbaren Situation aufgefordert. Doch ließ sich weder das Zimmer erhöhen
noch konnte ein weiteres Fenster eingebaut werden. Auch war im Ort kein anderes
Zimmer für die Schule anzumieten. Die Gemeinde plante daraufhin zunächst,
einen neuen Betsaal an das Gebäude anzubauen und die Schule in den oberen
Stock, wo bislang der Betsaal war, zu verlegen. Kreisbauinspektor Roth hatte
gegenüber diesem Plan jedoch erhebliche Bedenken, von denen sich die jüdischen
Gemeindevertreter überzeugen ließen.
Im Frühjahr 1838 beschloss die jüdische Gemeinde
daraufhin den Bau einer neuen Synagoge, in dem Betsaal und Schule sowie
ein Zimmer für den Synagogenrat untergebracht werden konnten. Die Entscheidung
fiel aus finanziellen Gründen nicht leicht, zumal nach einem Bericht von 1839
damals mehrere jüdische Familien Dörzbachs in "gänzlicher Armut"
lebten, die anderen nur ein "geringes Vermöge" hatten. Im März 1838
konnte ein Grundstück außerhalb des Ortes an der Straße nach Hohebach gekauft
werden. Oberamt und Kreisregierung erklärten sich einverstanden, dass die
Schule bis zur Fertigstellung im alten Schullokal verbleiben könne, zumal die
Schülerzahl auf 26 zurückgegangen war. Im November 1838 wurden die Baupläne für
das neue Synagogen- und Schulgebäude von der Israelitischen Oberkirchenbehörde
und dem evangelischen Konsistorium genehmigt. In einem Bericht der Behörden
wird die Begründung für den Bau der neuen Synagoge übrigens so beschrieben:
"In Folge des in neuerer Zeit auch bei den Israeliten vermerkten Sinnes für
die Würde des Gottesdienstes sieht sich auch die israelitische Gemeinde Dörzbach
durch den schlechten Zustand ihrer Synagoge und Schule veranlasst, ein neues Gebäude
für den Gottesdienst und den Schulunterricht zu erbauen...". Die Kosten
wurden vor Baubeginn auf 5.303 Gulden hochgerechnet. Einen Teil hatte die
Gemeinde bereits angespart, sodass von der Gesamtsumme zunächst noch 3.675
Gulden fehlten. Am 18. April 1839 wurde ein Staatsbeitrag in Höhe von 350
Gulden genehmigt. Nach einem Bericht vom Mai 1839 war damals der Bau "im
vollen Lauf". Noch 1839 oder spätestens 1840 wurde die Synagoge
eingeweiht.
Die jüdische Gemeinde erhält einen Staatsbeitrag zum
Bau der Synagoge und des Schulhauses (1839)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911:
"Die israelitischen Konfessionsschulen (Elementarschulen) in
Württemberg.
Von Rabbiner Dr. Schweizer in Weikersheim (Schluss).
Vergleicht man die Staatsbeiträge, die auf Grund dieses Artikels
des Gesetzes von 1836 den israelitischen Gemeinden zu Schulhausneubauten
damals gewährt wurden, mit den heute noch bewilligten Beiträgen zu
Schulzwecken, so ergeben sich, besonders wenn man den höheren Wert der
damaligen Geldwährung mitberücksichtigt, ungeheure Summen, die mit denen
von heute stark kontrastieren. Dabei ist noch zu bemerken, dass die
damalige Bevölkerungszahl der Israeliten keine höhere war, und was die
Steuerkraft derselben betrifft, viel geringer als heute anzuschlagen
ist.
Nach den Regierungsblättern des betreffenden Jahrganges wurden
bewilligt:
der israelitischen Gemeinde Hohebach
zur Erbauung einer Synagoge und eines Schulhauses (beide zusammen bilden 1
Haus) [17. Juli 1839] 250 Gulden
der israelitischen Gemeinde Dörzbach zur Erbauung einer Synagoge
und eines Schulhauses (beide bilden 1 Haus) [17. Juli 1839] (Gemeinde ist
nun aufgelöst) 350 Gulden." |
Etwa ein halbes Jahrhundert war die neue Dörzbacher
Synagoge der Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens am Ort. In den
1890er-Jahren war jedoch immer weniger ein regelmäßiger Gottesdienst möglich,
da die Zehnzahl der jüdischen Männer nicht mehr erreicht wurde. Nach 1900
besuchten die Dörzbacher Juden die Synagoge in Hohebach. Das Synagogengebäude
wurde verkauft; das Inventar fiel an die Hohebacher Gemeinde.
Das Gebäude der Synagoge ist als Wohnhaus erhalten
(Hohebacher Straße 4).
Fotos
Historische Fotos:
Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle
Hinweise bitte an den
Webmaster von "Alemannia Judaica", Adresse siehe Eingangsseite |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
|
|
 |
 |
 |
| Die ehemalige Synagoge in Dörzbach |
Seitenansicht |
Eingangstor |
| |
|
|
Fotos 2003/04:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 22.9.2003;
erstes Foto oben links am 1.8.2004) |
|
 |
 |
 |
| Die ehemalige Synagoge an der
Hohebacher Straße |
Seitenansicht |
| |
|
 |
 |
 |
Eingang von der
Straßenseite |
Blick von der Gartenseite
auf
das Gebäude |
Eingang von der Gartenseite.
Über der Tür
könnte eine Inschrift gewesen sein. |
| |
|
|
| |
|
|
|
2022: Ausgrabungen
der ehemaligen Mikwe (rituelles Bad)
Im Dezember 2022 wurde die ehemalige Dörzbacher Mikwe im Zusammenhang mit
der Wohnhaussanierung des Gebäudes Alte Klepsauer Straße 11 ausgegraben. Das
Becken war gefüllt mit nassem Schlamm, der mit Steinen, Mauerziegelstücken,
Dachziegelstücken und Holzstücken durchsetzt war. Sehr auffallend war, dass
eine Holztreppe und keine steinerne Treppe ins Becken führte
(Fotos erhalten von Jörg Waterstraat). |
 |
 |
 |
|
Bericht zu den Ausgrabungsarbeiten der Mikwe
im Dezember 2022: Die Arbeiten begannen am 6. Dezember 2022. Zuerst wurde
der Estrich und die darauf platzierte Wand im Süden des Raumes
herausgenommen. Darunter konnten bereits bauliche Reste erkannt werden. Am
7. Dezember wurde zuerst südlich des Baubefundes die Untersuchung angesetzt,
um die vermutete Fortführung der Mikwe in diesem Bereich ausschließen zu
können. Mittags begannen die Arbeiten an der eigentlichen Mikwe und deren
Verfüllung fortgesetzt und intensiviert werden. Hierbei wurde die
Verfüllung, welche im Zuge der Aufgabe der Mikwe eingebracht wurde, im Laufe
der folgenden beiden Tage gänzlich entnommen. Das eintretende Wasser (vgl.
Foto rechts) machte den Einsatz einer Pumpe bereits seit am 7. Dezember
notwendig. Am 9. Dezember wurde eine leistungsstärkere Pumpe angeliefert und
eingesetzt. Die Mikwe konnte damit vollständig geleert werden. An diesem Tag
begannen auch die Dokumentationsarbeiten an der Mikwe. Diese zeigt einen
Einbau, welcher den eigentlichen Wasserbereich verkleinert. Besonders ist
eine hölzerne Leiter mit drei erhaltenen Stufen, welche auf einem ebenfalls
hölzernen Podest stehen, anzuführen. |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und
Hohenzollern.
1968. S. 68-69. |
 | Jürgen Hermann Rauser: Dörzbacher Heimatbuch. 1980. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 | Spuren Wege Erinnerung. Orte des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation. Hrsg. Landratsamt
Hohenlohekreis. Redaktion Thomas Kreuzer (Kreisarchiv Hohenlohekreis).
Künzelsau 2021. 82 S. (pdf-Datei
ohne zugänglich) |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|