|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Eislingen (Kreis
Göppingen)
Jüdische Geschichte
Übersicht:
Zur jüdischen
Geschichte in Eislingen
In Eislingen waren jüdische Personen im 16. und 20. Jahrhundert wohnhaft.
Es kam jedoch zu keiner Zeit zur Bildung einer jüdischen Gemeinde.
Im 16. Jahrhundert werden nach 1530 im Ortsteil Großeislingen unter dem
Schutz der Herren von Rechberg genannt: die Juden Cappelmann (beziehungsweise
Coppelmann, Kapellman, aus Erlangen 1530 aufgenommen, gestorben vor 1554), Schmul (Sohn von Cappelmann, war nach 1554 in Ichenhausen),
Joseph (1546 genannt, evtl. auch Sohn von Cappelmann), Abraham (aus Worms,
aufgenommen 1551), Israel Wolff (aus Pfreimd
in der Oberpfalz, aufgenommen 1551,
nach 1554 in Ichenhausen), Hirsch (1544 genannt), Merlin (1551 genannt), Witwe
Sarah mit Tochter Ruth (1554 genannt). 1551 lebte Jud Israel im "meir hauss
zu understen im dorff", gemeint vermutlich die spätere "Untere
Gasse" (heutige Ebertstraße). Hier lagen 1554 drei jüdische
Wohnhäuser. In diesem Jahr wurden die Großeislinger Juden auf Druck von Herzog
Christoph von Württemberg ausgewiesen, was zu jahrelangen Verhandlungen vor dem
Reichskammergericht führte.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es am Ort mehrere Gewerbebetriebe im
Besitz jüdischer Unternehmer:
- Papierfabrik Moritz Fleischer (1892 übernahm Moritz Fleischer die Firma
"Krafft & Stapf", die u.a. Seidenpapier erstellte, seitdem "Firma
Moritz Fleischer". Sie wurde sehr erfolgreich vor allem als
Zigarettenpapierfabrik von Moritz Fleischer betrieben. Im Juni 1938 verließ die
Fabrikantenfamilie Fleischer nach massivem Zwang, persönlichen Bedrohungen,
Einschüchterungen und Repressalien Deutschland, die Firma wurde
"arisiert". Im April 1940 wurde sie unter der Bezeichnung
"Papierfabrik Fritz Kiehn" neu eröffnet. Nach 1945 kam die Firma 1957 an die Zellstofffabrik
Waldhof, 1961 nach Angliederung Hermann Krebs von Mannheim: "Papierfabrik
Fleischer-Krebs"); Firmengrundstück zwischen Schillerstraße,
Rudolf-Straße und Hindenburgstraße. Die teilweise fünf- bis sechsstöckigen
Fabrikgebäude wurden von Februar bis April 1988 abgebrochen. Auf dem Gelände
wurden nach der Sanierung 70 Eigenheime für etwa 250 Einwohner erstellt
(Wohngebiet Hölderlinstraße). Seit April 2007 erinnert eine Gedenktafel
an die Familie Fleischer und ihre Papierfabrik (siehe Fotos unten).
Unternehmensgeschichte siehe
http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen1/firmadet11065.shtml
vgl. Presseartikel von Elke Berger vom 2. März 2013 in den "Göppinger
Kreisnachrichten" (NWZ): "Papierfabrik
adieu".
- Mechanische Strickwarenfabrik Brüder Krämer & Co. (Carl und Simon Krämer,
Göppingen, bis um 1928).
- Mechanische Strickwarenfabrik Willy Böhm AG (vor 1924
Mechanische Strickerei Carl Böhm AG in Kleineislingen).
- Kalikofabrik Netter
& Eisig (Göppingen, von 1928 bis 1938): Nathan Netter und Sigmund Eisig
(aus Göppingen) wollten mit ihrer 1886 in Göppingen gegründeten
Kunstlederfabrik expandieren und erwarben die Mehrheit der Eislinger Firma
"Greiner & Lemppenau AG". Sie stellten in der Firma einen
Bucheinbandstoff her, der auch unter dem französischen Begriff "Calicot"
bekannt war. Dazu wurde eine Weberei betrieben (1930 170 Webstühle). In der
NS-Zeit waren Netter und Eisig gezwungen, das Unternehmen zu verkaufen. Die
beiden Inhaber emigrierten. 1938 fusionierte die "arisierte" Firma mit
einer Fabrik in Kötitz bei Coswig in Sachsen und nannte sich nun
"Göppinger Kaliko- und Kunstlederfabrik". Nach 1945 entwickelte sich
"Göppinger Kaliko" zu einer bedeutenden Zulieferer-Firma in der
Autoindustrie. Der Umsatz verlagerte sich mehr und mehr nach Eislingen.
Zunehmend wurde Plastik verarbeitet. 1993 Zusammenschluss der Göppinger Kaliko
mit der Firma J.H. Benecke aus Hannover zu "Benecke-Kaliko AG.".
2011 wurde eine neue Fertigungsanlage in Eislingen erstellt. In diesem Jahr
konnte auch das 125-jährige Bestehen des Werkes Eislingen gefeiert werden.
vgl. die Seite
zu "Benecke-Kaliko seit 1718" in der Website von www.benecke-kaliko.com
vgl. Presseartikel von Axel Raisch vom 1. Juli 2011 in den "Göppinger
Kreisnachrichten" (NWZ): "Eislingen.
Ein Himmel aus Eislingen..."
In Eislingen wohnte die Familie Moritz Fleischer sowie seit 1928 die Familie Dr. Bernhard Plawner (Prokurist bei
Fa. Fleischer, Richard-Wagner-Straße 26/1).
Von den in Eislingen geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Dr. Bernhard Plawner
(geb. 1898 in Oswiecim - Auschwitz, später wohnhaft in Eislingen und
Göppingen, 28. Oktober 1938 nach Polen abgeschoben, im August 1942 deportiert
und umgekommen), Minna Plawner geb. Gruber (geb. 1897 in Oswiecim -
Auschwitz, später wohnhaft in Eislingen und Göppingen, wie ihr Mann nach Polen
abgeschoben und nach Deportation umgekommen), Pnina Plawner (geb.
1926 in Haifa / Palästina, später wohnhaft in Eislingen und Göppingen,
dasselbe Schicksal wie ihre Eltern), Dina Plawner (geb. 1934 in
Stuttgart, wohnhaft in Eislingen und Göppingen, dasselbe Schicksal wie ihre
Eltern).
Zur Erinnerung an das Schicksal der Familie Plawner wurden im April 2007 "Stolpersteine"
in der Richard-Wagner-Straße verlegt (zwischen den Gebäuden 24 und 26).
Informationen und Fotos:
https://stolpersteine-goeppingen.de/eislingen/plawner-mina-pnina-rachel-dina-und-wolf-bernard/
 Weiter ist der in Eislingen gebürtige Otto Nobert Julius Tugendhat umgekommen
(geb. 10. November 1896 in Großeislingen als Sohn von Bronislaw Arthur Tugendhat und
Friedricke geb. Geiringer, Schulbesuch u.a. in
Aalen [Schubart-Gymnasium]; wohnhaft in Eislingen und Berlin; verheiratet in
Hamburg seit 19. Mai 1923, am 1. Januar 1939 nach Frankreich emigriert; ab Drancy
am 31. Juli 1944 nach Auschwitz deportiert, von dort am 28. Oktober 1944 in das
KZ Stutthof, dann nach Hailfingen [Außenkommando KZ Natzweiler], wo er am 16.
Dezember 1944 umgekommen ist). Für Norbert Tugendhat wurde im Juli 2019 in
Aalen ein "Stolperstein" verlegt
(siehe Foto links). Weiter ist der in Eislingen gebürtige Otto Nobert Julius Tugendhat umgekommen
(geb. 10. November 1896 in Großeislingen als Sohn von Bronislaw Arthur Tugendhat und
Friedricke geb. Geiringer, Schulbesuch u.a. in
Aalen [Schubart-Gymnasium]; wohnhaft in Eislingen und Berlin; verheiratet in
Hamburg seit 19. Mai 1923, am 1. Januar 1939 nach Frankreich emigriert; ab Drancy
am 31. Juli 1944 nach Auschwitz deportiert, von dort am 28. Oktober 1944 in das
KZ Stutthof, dann nach Hailfingen [Außenkommando KZ Natzweiler], wo er am 16.
Dezember 1944 umgekommen ist). Für Norbert Tugendhat wurde im Juli 2019 in
Aalen ein "Stolperstein" verlegt
(siehe Foto links).
Zu Familie Tugendhat: Bronislaw Arthur Tugendhat (1870 - 1957) war
Generaldirektor der Papierfabrik Unterkochen; seine Frau Friedericke geb.
Geiringer (geb. 1872) starb am 18. Februar 1910 in Wien. Das Ehepaar hatte noch
eine Tochter Stefanie (geboren um 1874, lebte 1920 in New York). Bronislaw Arthur
Tugendhat übernahm 1895 die technische Leitung der Papierfabrik Fleischer in
Großeislingen. 1899 wurde er dort abgeworben und zum Direktor der Papierfabrik
Unterkochen berufen (bis 1930). Tugendhat wurde später Ehrenbürger in Unterkochen.
Obige Informationen nach Angaben des Gedenkbuches des Bundesarchivs sowie vom
Standesamt Eislingen, den Recherchen von Volker Mall, Gedenkstätte Hailfingen
und den Recherchen von Winfried Vogt aus Unterkochen. Genealogische Angaben vgl.
https://www.geni.com/people/Norbert-Tugendhat/6000000068543327825.
Berichte aus der
jüdischen Geschichte in Eislingen
Berichte zu einzelnen Personen
60. Geburtstag von Fabrikant David Fleischer und seine
Ernennung zum Ehrenbürger Eislingens (1927)
 Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden Württembergs" vom
16. Oktober 1927: "Eislingen
(Württemberg). Am 7. September feierte der Fabrikant David Fleischer,
der Seniorchef der Firma Seidenpapierfabrik Moritz Fleischer, seinen 60.
Geburtstag. Fleischer, der zum Vorstand der jüdischen Gemeinde Göppingen
gehört, wurde aus Anlass seines Geburtstages in dankbarer Würdigung seiner
Verdienste um die Gemeinde Groß-Eislingen von dieser zum Ehrenbürger
ernannt. Die kunstvoll ausgeführte Ehrenbürgerurkunde wurde ihm durch den
Gemeindevorstand überreicht." Artikel
in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden Württembergs" vom
16. Oktober 1927: "Eislingen
(Württemberg). Am 7. September feierte der Fabrikant David Fleischer,
der Seniorchef der Firma Seidenpapierfabrik Moritz Fleischer, seinen 60.
Geburtstag. Fleischer, der zum Vorstand der jüdischen Gemeinde Göppingen
gehört, wurde aus Anlass seines Geburtstages in dankbarer Würdigung seiner
Verdienste um die Gemeinde Groß-Eislingen von dieser zum Ehrenbürger
ernannt. Die kunstvoll ausgeführte Ehrenbürgerurkunde wurde ihm durch den
Gemeindevorstand überreicht." |
Dr. Bernhard Plawner referiert über den Dichter Scholom
Alechem in Göppingen (1938)
Anmerkung: zu Scholem Alechem siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Scholem_Alejchem
 Artikel im
"Jüdischen Gemeindeblatt für die israelitischen Gemeinden Württembergs" vom
16. März 1938: "Göppingen. 'Scholom Alechem, ein jüdischer
Humorist; sein Leben und sein Werk', so lautete das Thema des Vortrags,
welchen Dr. B. Plawner, Eislingen/Fils, am 22. Februar auf Veranlassung des
Israelitischen Vorsteheramts hielt. Der Redner schilderte den Lebenslauf des
Dichters, der in den 57 Jahren seines Lebens gar weit in der Welt
herumgekommen und zum fröhlichen Darsteller des Ghettos geworden ist. Nicht
umsonst wird Scholom Alechem 'der jüdische Marc Twain' genannt. Sein Humor
ist ein wahrhaft goldener und echter. Plastisch stellt er alle Gestalten in
ihrer Umgebung vor uns hin. So vereint er uns mit diesen Menschen und führt
uns in die Dörfer und Städte, in denen sie leben und von einem
unverwüstlichen Lebensmut beseelt sind. Bei Scholom Alechem kommt es in uns
nicht zu dem bittern Nachgeschmack, der das heitere Lachen in seiner
befreienden Wirkung einschränkt. Mit wundernetten Kostproben aus dem
Schaffen des Dichters illustrierte Dr. Plawner seine treffliche
Charakterisierung und erntete warmen Beifall. Dem herzlichen Dank für den
wohlgelungenen Abend gab abschließend Dr. Wallach Ausdruck." Artikel im
"Jüdischen Gemeindeblatt für die israelitischen Gemeinden Württembergs" vom
16. März 1938: "Göppingen. 'Scholom Alechem, ein jüdischer
Humorist; sein Leben und sein Werk', so lautete das Thema des Vortrags,
welchen Dr. B. Plawner, Eislingen/Fils, am 22. Februar auf Veranlassung des
Israelitischen Vorsteheramts hielt. Der Redner schilderte den Lebenslauf des
Dichters, der in den 57 Jahren seines Lebens gar weit in der Welt
herumgekommen und zum fröhlichen Darsteller des Ghettos geworden ist. Nicht
umsonst wird Scholom Alechem 'der jüdische Marc Twain' genannt. Sein Humor
ist ein wahrhaft goldener und echter. Plastisch stellt er alle Gestalten in
ihrer Umgebung vor uns hin. So vereint er uns mit diesen Menschen und führt
uns in die Dörfer und Städte, in denen sie leben und von einem
unverwüstlichen Lebensmut beseelt sind. Bei Scholom Alechem kommt es in uns
nicht zu dem bittern Nachgeschmack, der das heitere Lachen in seiner
befreienden Wirkung einschränkt. Mit wundernetten Kostproben aus dem
Schaffen des Dichters illustrierte Dr. Plawner seine treffliche
Charakterisierung und erntete warmen Beifall. Dem herzlichen Dank für den
wohlgelungenen Abend gab abschließend Dr. Wallach Ausdruck." |
Anzeigen
Anzeige für Toilettenpapier der Papierfabrik Fleischer in
einer jüdischen Zeitschrift (1935)
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 17. Januar 1935:
"Hausfrauen sind sparsam. Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 17. Januar 1935:
"Hausfrauen sind sparsam.
Der Preis allein sagt aber nicht Immer, ob eine Ware billig ist. Gerade bei
Toilette-Papier sind die 'scheinbar" Billigen, häufig die Teuersten.
Anders bei Dalli.
Der Gesundheit wegen 2-fach sterilisiert. Dalli ist tatsächlich
billig, denn auf jeder Rolle sind garantiert 444 Abrisse. Aber nicht nur
das: Dalli Ist welch, saugfähig, zäh. Er ist eine Wohltat für Empfindliche.
1 Rolle kostet 25 Pfg.
Bezugsquellen - Nachweis durch Papierfabrik Fleischer o.H.G.,
Eislingen/Fils." |
Hochzeitsanzeige von Walther Fleischer und Ruth Magdalene geb. Lorch (1936)
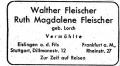 Anzeige in
der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 12. März 1936: Anzeige in
der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 12. März 1936:
"Walther Fleischer Ruth Magdalene Fleischer geb.
Lorch
Vermählte
Eislingen a.d.Fils - Stuttgart, Dillmannstr. 12 -
Frankfurt am Main, Rheinstr. 27
Zur Zeit auf Reisen" |
Fotos
Enthüllung einer
Gedenktafel für
die Familie Fleischer im April 2007
(Quelle: Artikel
in eislingen-online.de) |
 |
 |
| |
Bürgermeister
Günther Frank enthüllt den Gedenkstein in Anwesenheit des Vertreters der
Familie Fleischer, Prof. Mayer Tasch |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Stefan Lang: Ausgrenzung und
Koexistenz. Judenpolitik und jüdisches Leben in Württemberg und im
"Land zu Schwaben" (1492-1650). Reihe: Schriften zur
Südwestdeutschen Landesbunde. Band 63. Sigmaringen 2008.
|
 | Martin Mundorff / Walter Ziegler
(Hrsg.): Eislingen und seine Fabriken. Rainer Weiler zum Siebzigsten. Hrsg.
im Auftrag der Stadt Eislingen. Weißenhorn 2001. |
 | Heinz Schmidt-Bachem: Aus Papier:
eine Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der papierverarbeitenden Industrie in
Deutschland. De Gruyter. Berlin/Boston 2011. S. 868-869. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|