|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht 'Synagogen in der Region'
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Gochsheim (Stadt Kraichtal,
Kreis Karlsruhe)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als württembergisches
Lehen zeitweise den Grafen von Eberstein gehörenden Gochsheim bestand eine jüdische
Gemeinde bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Ihre Entstehung geht in Zeit des
15./16. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1427, dann wieder 1524/25 Juden am
Ort genannt. Für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts berichtet Merian
in seiner 'Topographia Sueviae' (Frankfurt
1643 S. 43) zu Gochsheim: 'Gibt viel Juden da'.
| Matthäus Merian: Topographia Sueviae.
Frankfurt am Main 1643.S. 83 |
Zu Gochsheim: 'Gochsheim / Gochzheim.
Ist ein Statt im Creichgöw / so die Grafen von Eberstein / vom Hertzog zu Würtenberg zu Lehen tragen. Ligt anderthalb Stund von Bretta. Es ligen nahend herumm deren von Mentzingen / vnnd Gemmingen / Stammhäuser / vnd der Herrn Göler Schloß Ravenspurg. Die Herren von Mentzingen haben auch ein Hauß zu Gochsheim / so ein Marggräfisch Badisch Lehen. Der Herren Graffen von Eberstein Monatlich einfacher ReichsGebür ist 16. Gulden / vnd zum CammerGericht jährlich 6. Gulden / 42. Kreutzer / 5. Heller: Wie ich in einer geschriebenen Verzeichnuß gelesen. Gibt viel Juden da / vnd ist ein Bergichter Ort.' |
| |
In Geleitzahlungen in Pforzheim
(Quelle GLA 171/1979; Rechnung des Untervogts in Pforzheim 1636/37 S.
9-10) werden genannt: am 12.8.1636 und am 3.9.1636 die Juden Beyfueß und
Heyumb, beide aus Gochsheim, am 11.9.1636 Liebmann von Gochsheim, am
18.10.1636 Löb und Jacob, beide aus Gochsheim; (Quelle GLA 171/1981;
Rechnung des bayerischen Untervogts in Pforzheim, 6.1.1639-6.1.1640, S.
9-10) am 23.2.1639 Libman von Gochsheim, am 23.6.1639 Faiß und sein
Knecht von Gochsheim, am 19.9.1639 Abraham und Kauffman von Gochsheim und
Steinbach, am 9.11.1639 Veit von Gochsheim, am 23.11.1639 Liebmann von
Gochsheim
Literatur: Friedrich R. Wollmershäuser: In: Südwestdeutsche Blätter
für Familien- und Wappenkunde. Jahrbuch 2017. |
Im 18. Jahrhundert
wurde die höchste Zahl jüdischer Einwohner 1769 erreicht, als zwölf jüdische
Familien mit zusammen 67 Personen am Ort wohnten. Als die Zahl der jüdischen
Einwohner in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert stark zurückging, wurden
die hier noch wohnhaften Juden der Gemeinde in Bauerbach zugeteilt. 1826 wurden
noch 27 jüdische Einwohner gezählt, 1864 17, 1871 fünf.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge und eine
Religionsschule, vermutlich auch ein rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser
Aufgaben der Gemeinde war im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zeitweise ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter
(und Schochet) tätig war (vgl. die Ausschreibungen der Stelle in den
1840er-Jahren unten). Die Toten der jüdischen
Gemeinde wurden vermutlich in Flehingen beigesetzt. Die
Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Bretten (vgl. Ausschreibungen der
Lehrerstelle).
1875 lebte bereits
kein Jude mehr in Gochsheim.
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers und
Vorsängers (1840 / 1843 / 1844 / 1845)
 Anzeige im
'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' von 1840 S. 730 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
'Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die Lehrstelle für den
Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 50 Gulden nebst freier Kost und
Wohnung sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach
erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden.' Anzeige im
'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' von 1840 S. 730 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
'Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die Lehrstelle für den
Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 50 Gulden nebst freier Kost und
Wohnung sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach
erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden.' |
| |
 Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 29. Juli 1843 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag.] In diesseitigem Bezirke sind
folgende Dienste erledigt:
Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 29. Juli 1843 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag.] In diesseitigem Bezirke sind
folgende Dienste erledigt:
1) Bei der israelitischen Gemeinde zu Bauerbach,
die Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein Gehalt
von 160 fl. sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen
Gefällen verbunden ist:
2) Bei der israelitischen Gemeinde zu Gochsheim
die Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 50 fl. nebst freier Wohnung und Kost, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist
-
und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Bretten zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden.'
Bretten, den 24. Juli 1843. Großherzogliche Bezirkssynagoge.' |
| |
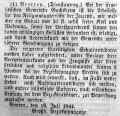 Anzeige im
'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 24. Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag]. Bei der israelitischen Gemeinde
Gochsheim ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen. Anzeige im
'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 24. Juli 1844 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Bretten. [Dienstantrag]. Bei der israelitischen Gemeinde
Gochsheim ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden.
Bretten, den 16. Juli 1844.
Großherzogliche Bezirkssynagoge. ' |
| |
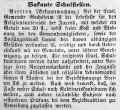 Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 29. November 1845 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Vakante Schulstellen.
Anzeige im 'Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis' vom 29. November 1845 (Quelle: Stadtarchiv
Donaueschingen): 'Vakante Schulstellen.
[Bekanntmachung.]. Bei der israelitischen Gemeinde Gochsheim ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 50 fl., nebst freier Kost und Wohnung bei den
Gemeindemitgliedern, sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen. Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Bretten zu melden. Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden.' |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Über den Juden Eberlin aus Gochsheim (Beitrag von
1926)
 Beitrag
von Berthold Rosenthal im 'Israelitischen Familienblatt' vom 15. Juli 1926: 'Eberlin,
der Jude von Gochsheim. Beitrag
von Berthold Rosenthal im 'Israelitischen Familienblatt' vom 15. Juli 1926: 'Eberlin,
der Jude von Gochsheim.
In dem Hügellande zwischen Schwarzwald und Odenwald, im Kraichgau, liegt das
Städtchen Gochsheim, früher Gospoltzheim. Nach wechselvollen Schicksalen,
ursprünglich gehörte es zur Kurpfalz. die im 15. Jahrhundert den Grafen von
Eberstein damit belehnte, kam es zu Württemberg und seit 1606 ist es
badisch. Als starke Festung, deren Spuren heute noch sichtbar sind, war
Gochsheim während des 30 jährigen Krieges eine Zufluchtsstätte der
Bevölkerung aller umliegenden Dörfer. Bis vor etwa 50 Jahren wohnten auch
einige jüdische Familien im Städtchen. Die erste geschichtliche Nachricht
von der Anwesenheit von Juden in Gochsheim stammt aus dem Jahre 1427. Es ist
eine für die Stellung der Juden und für die damalige Rechtsauffassung höchst
lehrreiche Urkunde, die von dem Juden Eberl in in Gochsheim berichtet.
Obwohl seit Anfang des 15. Jahrhunderts die Kurpfalz ihre Juden vertrieben
und Ruprecht III., der gleichzeitig deutscher Kaiser war, angeordnet hatte,
dass ewiglich kein Jude in Schlössern und Ländern der Pfalz wohnen, oder
sesshaftig sein soll, hatte Eberlin in Gochsheim 'zu disen zyten' (1427)
pfälzischen Schutz erhalten und scheint zu Wohlstand gelangt zu sein. Graf
Wilhelm von Eberstein war aber eines schönen Tages in seine Behausung
eingedrungen und setzte ihn unter Mitnahme wertvollen Hausrats und anderer
Kostbarkeiten gefangen, wegen einer Missetat, die er 'an einre frowe, die
des egenanten grave Wilhelms ist,' d.h. an einer Leibeigenen des
Ebersteiners, verübt hatte. Welcher Art diese Missetat war, geht aus der
Urkunde nicht hervor. Sicher ist aber, dass Graf Wilhelm den Fall zu seinen
Gunsten ausnützte. Der Jude wurde durch die Haft, womöglich auch durch
Androhung oder Anwendung der Folter — wie ähnliche Fälle aus jener Zeit
bekunden — mürbe gemacht, sodass er schließlich zu allen Zugeständnissen
bereit war, alles, wessen man ihn zieh, zugab und jede an ihn gestellte
Schadensersatzforderung bewilligte. Nachdem der Ebersteiner und der Vogt des
Kurfürsten von der Pfalz, unter dessen Schutz der Jude Eberlin stand, 'getedingt'
hatten (in Verhandlung eingetreten waren), kam eine Entscheidung zustande,
die sowohl der Leibeigenen, als auch ihrem in ihr geschädigten Herrn volle
Genugtuung gewährte. Eberlin erklärte sich bereit, der Frau bis zur
nächsten Fastnacht 42 Gulden Schmerzensgeld sowie den Ersatz ihrer Kosten
und den Schadens, den er ihr verursachte, zu zahlen.
Größer waren aber die Verpflichtungen, die Eberlin dem Grafen gegenüber
eingehen musste, und zwar wendete der Ebersteiner ein Mittel an, das vor ihm
Kaiser Wenzel mit großer Meisterschaft gebraucht hatte. Wenn dieser nämlich
in Geldverlegenheit war, gab er — selbstverständlich gegen Gewinnbeteiligung
— den Reichsstädten die Befugnis, sämtliche Ausstände der Juden an sich zu
ziehen und sie für die Stadt ganz oder teilweise zu erheben. Die
Judengläubiger mussten froh sein, wenn ihnen ein geringer Teil ihrer
Schuldforderungen erstattet wurde. So musste auch Eberlin in unserem Falle
zugestehen: Was auch Graf Wilhelm oder seine Armenleute, es seien Frauen
oder Männer, in oder außerhalb der Stadt Gochsheim, mir schuldig sind, das
soll an den Grafen, oder wen er damit beauftragt, gegeben und bezahlt
werden. Und mir und meinen Erben sollen sie nichts mehr schuldig sein, da
ich die Schuldner und ihre Bürgen durch diesen Brief gänzlich quitt, ledig
und los sage. Alle Schuldscheine und Pfänder, die ich über die bezeichneten
Schulden besitze, will ich dem Grasen oder seinen Amtleuten unverzüglich
überantworten. Alles, was der Graf, als er wegen der Angelegenheit in wein
Haus eindrang, wegnahm, 'des han ich mich begeben und vertzigen' und entsage
mich dessen für mich, meine Erben und jedermann, sodass niemand mehr
Ansprüche oder Forderungen hieraus erheben kann. Außerdem will ich noch dem
Grafen Wilhelm oder seinen Erben zur 'Besserung' vor der nächsten Fastnacht
50 Gulden geben sowie ihm jeglichen Schaden ersetzen. Wie ich in dieser
Angelegenheit meines Schutzherrn Gnade genossen habe, so will ich auch für
mich, meinen Erben und jeden von uns, dem Grafen von Eberstein, seinen Erben
den Seinen und jedermann, keinen ausgenommen, er sei Christ oder Jude,
vergeben und verzeihen, also dass ich und meine Erben keinerlei Forderungen
oder Ansprüche aus meiner Gefangennahme und dem Gerichtsverfahren erheben
können.
Zum Schlüsse versichert Eberlin noch: Ich habe einen jüdischen Eid 'uf Hern
Moyses buch' getan, die vorgeschriebenen Stücke und Artikel zu halten und
nie dagegen zu handeln bei Ausschaltung aller 'argeliste und geverde'. Und
das zu Urkunde habe ich den Junker von Vemingen, den kurpfälzischen Vogt,
gebeten, für mich sein Insiegel an diesen Brief zu hängen, mich und meine
Erben damit aller vorgeschriebenen Dinge verpflichtend. Der Junker bekundet
zum Schlüsse, dass er auf Bitten Eberlins sein Jnsiegel zur Bekräftigung für
den Juden und seine Erben beigefügt habe, dass aber die Urkunde für ihn und
die Seinen. unschädlich sei.
Es würde den ganzen Reiz dieses kultur- und rechtgeschichtlich wertvollen
Dokuments, dem noch der Duft des Mittelalters unverfälscht anhaftet,
verwischen, wenn man ihm noch weitere Erklärungen beifügen wollte. Es
spricht für sich selbst. Höchstens dürften einige Worte über den von Eberlin
geleisteten 'jüdischen Eid' angebracht sein: Bis in die Mitte des
vorigen Jahrhunderts war für die Juden eine eigene Form und Formel der
Vereidigung vorgesehen, die allerwärts verschieden waren und sich in manchen
Gegenden in recht entehrender Weise vollzog. Über die Art des Judeneids, den
Eberlin zu leisten hatte, sind wir ziemlich zuverlässig unterrichtet. Die
Eidesleistung des Juden in Gochsheim dürfte sich in derselben Weise
vollzogen haben, wie sie im benachbarten
Wimpfen zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Stadtrecht niedergelegt wurde,
Über die Form der Eidesleistung ist hier angeordnet: 'Also soll ein Jude um
ein jeglich Sach vereidigt werden: Primo soll ein Jude, der einen Eid
schwören soll, ein Buch bei sich haben, das sie ein 'Hummas' (Chomesch)
heißen. Das sind die fünf Bücher Moses, worin auch die 10 Gebote begriffen
sind, die Gott Mose auf dem Berge Sinai gab. Dies Buch soll der Schwörende
auftun und seine rechte Hand darein legen bis an das Rist und soll einem
nachsprechen, der ihm den Eid gibt und soll gleichzeitig in den Eid nehmen,
dass er den richtigen 'Humbas' gebracht hat.'
Die Eidesformel selbst lautete: 'Du Jude, der dir beschieden ist.
dass du wahr schwörest, also helfe dir der Gott, der geschaffen hat Laub und
Gras, Geheuer und Ungeheuer und alle Kreatur. Und dass du wahr habest und
recht schwörest, also helfe dir der Gott adonai und seine gewaltige Gottheit
und Herrlichkeit. Und dass du wahr und recht habest, also helfe dir der Gott
Jakobs, Jsaks, Abrahams und Moses. Und dass du wahr und recht habest, also
helfe dir das Gesetz, das Gott Mose gab auf dem Berge Sinai. Und wenn du
nicht wahr und recht hast und deine Sache (falsch ist), dann müssen die fünf
Bücher Mose dir an Leib und Seele ewiglich ein Fluch sein und das jüngste
Gericht muss ewiglich über dich und deinen Samen ergehen.' Beachtenswert ist
auch, dass der Jude, als Nichtebenbürtiger, nicht befugt war, sein Jnsiegel
der Urkunde beizufügen. B. Rosenthal, Mannheim.'" |
Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge
Eine Synagoge wird bereits
1662 genannt, wobei es sich um einen einfachen Betsaal gehandelt haben wird. Als
1728 bis 1733 Gochsheim der Gräfin von Würben gehörte, erlaubte sie in ihrem
Schutzbrief vom 17. April 1731 den Bau beziehungsweise das weitere Bestehen
einer Synagoge in Gochsheim. 1764 wurde von dem reichen Schutzjuden Baruch Dessauer eine
neue Synagoge
mit jüdischer Schule erbaut. Spätestens um 1860/70 konnten auf Grund der zu
geringen Zahl jüdischer Einwohner keine regelmäßigen Gottesdienste mehr
gefeiert werden, zumal die Juden Gochsheim schon einige Zeit offiziell zur Bauerbacher
Synagogengemeinde gehörten. 1882 wurde das Gebäude verkauft und zu einem bis
heute erhaltenen Wohnhaus umgebaut (Hauptstraße 70). Der Platz beim ehemaligen
Synagogengebäude trug die Bezeichnung "Synagogenhof".
Fotos
Historische Fotos:
|
Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle
Hinweise bitte an
den Webmaster, E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |
Fotos nach 1945:
Fotos aus den
1980er Jahren
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum
im April 1987) |
 |
 |
| |
Die ehemalige
Synagoge macht einen unbewohnten Eindruck (1987) |
| |
|
Fotos 2003
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 15.9.2003) |
|
 |
 |
 |
 |
Die ehemalige Synagoge, das
Gebäude wurde inzwischen renoviert; rückwärtige Ansicht aus:
Wikipedia-Artikel 'Jüdische
Gemeinde Gochsheim' |
Schlussstein von 1764
über
dem Toreingang |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 110-111. |
 | Germania Judaica II,1 S. 443. |
 | Rudolf Herzer/Heinrich Käser: Sippenbuch der Stadt Gochsheim.
Grafenhausen bei Lahr 1968. |
 | Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe. 1990. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: 'Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...'. Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: 'Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...'. Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007.
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|