|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Gießen"
Londorf
mit Geilshausen, Kesselbach und Rüddingshausen (Gemeinde
Rabenau, Kreis Gießen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Londorf bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts
zurück. Der Ort gehörte - wie auch die Filialgemeinden (s.u.) - bis Anfang des
19. Jahrhunderts zum Gebiet der Herren Nordeck zur Rabenau. Diese hatten
seit 1650 das Recht zur Aufnahme von Juden in ihrem Herrschaftsbereich. Vermutlich wurden von ihnen noch im
17. Jahrhundert jüdische Familien in der "Rabenau" aufgenommen.
Darauf weist unter anderem der spätestens um 1720 angelegte jüdische Friedhof
in Londorf hin. Außer dem Schutzgeld hatten die aufgenommenen Juden von jedem
geschlachteten Stück Vieh die Zunge an die Ortsherrschaft abzuliefern; diese
Naturalverpflichtung wurde später in einer Jahresabgabe umgewandelt. Die
Patrimonialrechte der Herren Nordeck zur Rabenau bestanden bis 1822.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: in Londorf 1828 103 jüdische Einwohner (13,3 % von insgesamt 770 Einwohnern), 1836
86 (8,9 % von 961), 1850 93, 1860 74 (von 899 Einwohnern), 1861 68 (7,4 % von 917), 1871 82 (9,2 % von 896),
1880 72 (8,5 % von 848), 1889 68 (von 699), 1905 61, 1910 62 (6,7 % von 920).
Zur jüdischen
Gemeinde Londorf gehörten auch die in Kesselbach, Geilshausen
und Rüddingshausen lebenden jüdischen
Personen:
In Kesselbach wurden gezählt: 1830 24 jüdische Einwohner,
1905 30, 1932 11.
In Geilshausen wurden gezählt: 1830 4 jüdische Einwohner, 1905 25, 1932 28.
In Rüddingshausen wurden gezählt: 1830 38 jüdische Einwohner,
1905 30, 1932 22.
Die jüdischen Familienvorsteher verdienten den Lebensunterhalt als
Viehhändler, als Metzger oder als Kleinkaufleute und lebten mit ihren Familien
in durchweg einfachen Verhältnissen.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule,
ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung
religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als
Vorbeter und Schochet tätig war. Bis 1893 war ein in diesem Jahr verstorbener Lehrer Rothschild
am Ort (siehe Ausschreibung der Stelle von 1893; Rothschild war vermutlich seit
1885 in der Gemeinde); er
unterrichtete auch die jüdischen Kinder in Nordeck.
Um 1900 war ein Lehrer Schiff am Ort, danach Lehrer Urias Banda (oder Bandess,
gestorben 1926, siehe Bericht unten), der lange Jahre auch den Gesangverein des
Ortes dirigierte. Nach seiner Pensionierung kam Hermann Bethmann als Lehrer und
Kantor nach Londorf. Er wurde später Direktor des Waisenhauses
in Diez/Lahn. Die Gemeinde gehörte zum Liberalen Provinzialrabbinat mit Sitz in
Gießen.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde: aus Londorf Sally
Kares (geb. 8.7.1890 in Londorf, gef. 27.8.1916), aus Geilshausen Emanuel
Baum (geb. 1.6.1873 in Geilshausen, gef. 4.10.1918), aus Kesselbach
Friedrich Schönfeld (geb. 27.7.1888 in Kesselbach, gef.
17.12.1915).
Um 1924, als noch 58 jüdische Personen in Londorf gezählt wurden (6,1 %
von 955 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Adolf Joseph, Mark. Rothschild
und Leopold Jonas (in Kesselbach). Als Rechner der Gemeinde war Isaak Simon
tätig. Religionsunterricht durch den Lehrer der Gemeinde erhielten damals 12 Kindern den
Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen bestanden ein Synagogenverein
(1924 unter Leitung von Julius Jonas mit 25 Mitgliedern). Kesselbach hatte -
zumindest zeitweise - einen eigenen Israelitischen Frauenverein (Frauen-Chebra,
siehe Bericht von 1889 unten). 1932 waren die Gemeindevorsteher Adolf
Joseph (1. Vors.), Markus Kares (2. Vors.), Leopold Eckstein (in Kesselbach, 3.
Vors.). Inzwischen unterrichtete die jüdischen Kinder Lehrer Otto Grünebaum
aus Gießen; im Schuljahr 1931/32 waren ihm 11 Kinder anvertraut. Als
Vorbeter wird 1932 der im Verzeichnis von 1924 noch als Rechner der Gemeinde
aufgeführte Isaak Simon genannt.
1933 lebten noch 40 jüdische Personen in Londorf (3,8 % von insgesamt 1.041
Einwohnern, in 11 Familien). Unter den jüdischen Familienvorsteher gab es noch
vier Manufakturwarenhändler, vier Viehhändler und drei Metzger. Auf Grund der
Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien ist ein Teil der jüdischen Einwohner in den folgenden Jahren weggezogen beziehungsweise ausgewandert.
Unter denen, die emigrierten, war um 1935 auch Adolf Joseph, der letzte
Gemeindevorsteher. Zwei Personen konnten nach Palästina auswandern, andere in
die USA, eine Familie im Sommer 1938 nach England. Bis 1938 versah Isaak Simon
denn Vorbeterdienst und erteilte den jüdischen Kindern noch den
Religionsunterricht. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der
Synagoge zerstört. 1941 wurden noch 15 jüdische Einwohner in Londorf gezählt;
die letzten 11 wurden 1942 deportiert.
Vorbeter Isaak Simon emigrierte nach Holland, wurde jedoch über Bergen-Belsen
im Januar 1944 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Aus dem Ghetto
Theresienstadt kam er im Oktober 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz, wo er
ermordet wurde.
Von den in Londorf geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Abraham Adler (1897),
Bernhard Adler (1875), Heinemann (Heimann) Blumenthal (1881), Jenny (Fany)
Dreifus geb. Stern (1895), Berta Hahn geb. Katz (1893), Elli Jonas (1910),
Julius Jonas (1878), Rosa Jonas geb. Stiebel (1881), Karoline Joseph geb.
Weinberg (1857), Betty Kares geb. Stern (1876), Frieda Kares (1876), Markus
Kares (1880), Hilda von Korzebock geb. Adler (1872), Isaak Simon (1871), Johanna
Simon geb. Joseph (1882), Lina Simon (1868), Markus Simon (1873), Nanny Simon
geb. Katz (1882), David Stern (1866), Ferdinand Stern (1879), Karoline Stern
geb. Stern (1845), Karoline Stern geb. Jakob (1874), Meyer Stern (1875), Rosa
Stern geb. Baum (1878), Betti Strauß geb. Kares (1884), Betty Weinberg (1884),
Alfred Wertheim (1920), Emma Wertheim geb. Stern (1896), Ingeborg Wertheim
(1923), Johanna Wertheim geb. Jacob (1866), Leopold Wertheim (1891), Rikchen
Wertheim geb. Speier
(1893).
Aus Kesselbach sind umgekommen: Nathan Baum (1883),
Settchen Blumenthal geb. Katten (1855), Minna Eckstein geb. Stern (1882),
Sidonie (Toni) Eckstein (1918), Julius Jonas (1878), Bertha Kugelmann geb.
Eckstein (1903), Martin Manela (1928), Siegbert Manela (1926), Sophie Manela
(1925), Sophie Nachmann geb. Jonas (1873), Klara Rosenberg geb. Simon (1888),
Martin Rosenberg (1919), Margareta (Grete) Schönfeld geb. Katz (1909), Walther
Isidor Schönfeld (1906), Rebekka Simon geb. Schönfeld (1863).
Aus Rüddingshausen sind umgekommen: Hilda Friedmann geb. Stiefel
(1882), David Theo Jacob (1887), Leopold Jacob (1884), Sally Joseph (1893),
Recha Katz geb. Simon (1888), Bertha Mayer geb. Joseph (1886), Frieda Meyer geb.
Stiefel (1884), Hilda (Henel) Simon geb. Eckstein (1861), Johanna (Hannchen)
Stern (1878), Joseph Stern (1873), Karoline Stern geb. Jakob (1874), Johanna
(Hanna) Stiefel (1882), Alfred Wertheim (1920), Johanna Wertheim geb. Jacob
(1866), Leopold Wertheim (1891), Ludwig Wertheim (1923), Rikchen Wertheim geb.
Speier (1893), Minna Wetzstein geb. Joseph (1882).
Aus Geilshausen sind umgekommen: Alexander Baum (1877), Bertha Baum geb.
Adler (1873), Hedwig Toni Baum (1897), Hermann Baum (1869), Auguste Bock geb.
Baum (1875), Bertha Lamm geb. Baum (1877), Rosa Stern geb. Baum
(1878).
Anmerkung: einzelne Doppelnennungen zwischen den obigen Orten erklären sich dadurch,
dass z.B. mehrere Angehörige der Familie Wertheim in Rüddingshausen oder Rosa
Stern in Geilshausen geboren sind,
später aber in Londorf lebten.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters / Schochet 1882 / 1885 / 1893
/ 1924
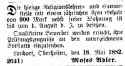 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Mai 1882: "Die
hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem jährlichen fixen
Gehalt von 900 Mark nebst freier Wohnung ist bis zum 1. August dieses
Jahres zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Mai 1882: "Die
hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle mit einem jährlichen fixen
Gehalt von 900 Mark nebst freier Wohnung ist bis zum 1. August dieses
Jahres zu besetzen.
Qualifizierte Bewerber werden ersucht, ihre Prüfungszeugnisse an den
unterzeichneten Vorstand einzusenden.
Londorf, Oberhessen, den 18. Mai 1882. Moses Adler." |
| |
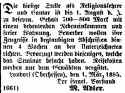 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März
1885:
"Die hiesige Stelle als Religionslehrer und Kantor ist bis 1. August
dieses Jahres zu besetzen. Gehalt 700-800 Mark mit einem bedeutenden
Nebeneinkommen und freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse in
beglaubigten Abschriften binnen 4 Wochen an den Unterzeichneten richten.
Bevorzugt werden diejenigen, welche das Seminar besucht haben. Reisekosten
werden nur dem Gewählten vergütet. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März
1885:
"Die hiesige Stelle als Religionslehrer und Kantor ist bis 1. August
dieses Jahres zu besetzen. Gehalt 700-800 Mark mit einem bedeutenden
Nebeneinkommen und freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse in
beglaubigten Abschriften binnen 4 Wochen an den Unterzeichneten richten.
Bevorzugt werden diejenigen, welche das Seminar besucht haben. Reisekosten
werden nur dem Gewählten vergütet.
Londorf (Oberhessen), den 1. März 1885.
Der israelitische Vorstand M. Adler." |
| |
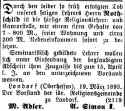 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. März 1893:
"Durch den leider so früh erfolgten Tod unseres seligen Lehrers
Herrn Rothschild ist die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle, mit
einem fixen Gehalte von 7-800 Mark, freier Wohnung und circa 200 Mark
Nebeneinkommen sofort zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. März 1893:
"Durch den leider so früh erfolgten Tod unseres seligen Lehrers
Herrn Rothschild ist die hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle, mit
einem fixen Gehalte von 7-800 Mark, freier Wohnung und circa 200 Mark
Nebeneinkommen sofort zu besetzen.
Seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich unter Einsendung der
beglaubigten Abschrift ihrer Zeugnisse bis zum1 5. April laufenden Jahres
an den unterzeichneten Vorstand wenden.
Londorf (Oberhessen), 19. März 1893. Der Vorstand der
israelitischen Religionsgemeinde zu Londorf.
M. Adler. A. Simon I." |
| |
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. Juli 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 3. Juli 1924:
"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines
Kantors und Religionslehrers
sofort zu besetzen. Gefällige Offerten nebst Gehaltsansprüchen
und Zeugnisabschriften sind zu richten an den
1. Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde Londorf. Adolf Joseph." |
Zum Tod des Lehrers a.D. Urias Banda (1926)
 Artikel
in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung")
vom 5. Februar 1926: "Am 8. Januar starb in Schömberg im Schwarzwald
der Lehrer a.D. Urias Banda aus Londorf (Oberhessen). Der Verewigte
hatte eine fruchtbare Tätigkeit in seiner Gemeinde entfaltet. Juden und
Christen verehrten ihn gleichermaßen, und die Früchte seiner Wirksamkeit
zeigen sich heute noch in dem harmonischen Verhältnis der Konfessionen
zueinander." Artikel
in der Zeitschrift des "Centralvereins" ("CV-Zeitung")
vom 5. Februar 1926: "Am 8. Januar starb in Schömberg im Schwarzwald
der Lehrer a.D. Urias Banda aus Londorf (Oberhessen). Der Verewigte
hatte eine fruchtbare Tätigkeit in seiner Gemeinde entfaltet. Juden und
Christen verehrten ihn gleichermaßen, und die Früchte seiner Wirksamkeit
zeigen sich heute noch in dem harmonischen Verhältnis der Konfessionen
zueinander." |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zwei Hinweise bei Arnsberg Bd. I S. 500 (Berichte sind noch nicht
vorhanden):
 | Daniel Isaak (bzw. Gedalya Isaak; geb. 1840 in
Kesselbach, war nach dreijähriger Ausbildung am jüdischen Lehrerseminar in
Hannover seit 1864 als Lehrer an der Talmud-Tora-Schule in Hamburg tätig,
gest. 1914 in Hamburg. Er wird genannt in einem HaGalil-Artikel
zur Talmud-Tora-Schule in Hamburg. |
 | Dr. Ebo Rothschild (geb. 1902 in Londorf, gest.
1977 in Rechovot): emigrierte 1933/34 über Holland und Paris
nach Spanien, 1939 über Frankreich nach Chile, 1955 nach Israel. Palästina und war als Rechtsanwalt in Tel Aviv tätig.
Ausführliche Informationen im Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Ebo_Rothschild |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Bericht über die in Kesselbach wohnenden und zur Gemeinde Londorf gehörenden
jüdischen Familien (1889)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Kesselbach
(Oberhessen), 24. März (1889). Während in früheren Zeiten die
jüdischen Familien auf dem Lande häufig in Zank und Streit lebten und
nicht zusammen verkehrten, freue ich mich, Ihnen von hier gerade das
Gegenteil zu berichten, ein Beweis, dass Fortschritt und Bildung sich
immer mehr ausdehnen. Es wohnen hier nur 7 Familien, die alle einige sind
und wie zu einer Familie gehörig sich gegenseitig zu Gefallen zu leben
suchen, wie es nicht schöner gewünscht werden kann. Neben diesem Sinn
für Geselligkeit ist aber auch der für Wohltätigkeit ein sehr
ausgeprägter; so haben sich die hiesigen Frauen zusammengefunden und eine
Frauen-Chebra gegründet, deren Tätigkeit darin bestehen soll, den Armen
bei Krankheit und Trauerfällen hilfreich beizustehen; da aber Kesselbach,
gottlob, keine Familie hat, die davon Gebrauch machen wird, so ist das Augenmerk
auf die nächsten Umgebung gerichtet: Kesselbach gehört mit noch zwei
Dörfern (sc. Geilshausen und Rüddingshausen) zur Synagoge Londorf; in letzterem Orte ist leider
bis jetzt noch nicht eine Frau dem Vereine beigetreten, ja der dortige
Synagogenvorstand wollte sogar der Chebra Schwierigkeiten bereiten, indem
er das anfangs erlaubte Geloben in dieselbe beim Aufruf zur Thora später
wieder verbot; man wollte in Anbetracht der wenigen Mitglieder die Mitte
der Chebra auf diese Weise vergrößern. Doch der hiesige
Wohltätigkeitssinn ruhte nicht und so ist es ihm Dank der Intervention
des Herrn Rabbiner Dr. Levi zu Gießen gelungen, dass Großherzogliches
Kreisamt* entschieden hat: man könnte niemandem verbieten, beim Aufrufe
zur Tora für einen Verein Spenden zu geloben, wovon an dem
darauffolgenden Samstag einige Herren Gebraucht machten. Von den hiesigen
Familien sind der Chebra anlässlich von Familienfestlichkeiten,
Jahrzeitstagen usw. bereits ganz hübsche Geschenke zugegangen und wenn es
weiter so der Fall ist, wird die Chebra recht bald ihre Tätigkeit
aufnehmen können, worüber ich Ihnen später gerne weitere Nachrichten
zukommen lasse. J.W.N." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Kesselbach
(Oberhessen), 24. März (1889). Während in früheren Zeiten die
jüdischen Familien auf dem Lande häufig in Zank und Streit lebten und
nicht zusammen verkehrten, freue ich mich, Ihnen von hier gerade das
Gegenteil zu berichten, ein Beweis, dass Fortschritt und Bildung sich
immer mehr ausdehnen. Es wohnen hier nur 7 Familien, die alle einige sind
und wie zu einer Familie gehörig sich gegenseitig zu Gefallen zu leben
suchen, wie es nicht schöner gewünscht werden kann. Neben diesem Sinn
für Geselligkeit ist aber auch der für Wohltätigkeit ein sehr
ausgeprägter; so haben sich die hiesigen Frauen zusammengefunden und eine
Frauen-Chebra gegründet, deren Tätigkeit darin bestehen soll, den Armen
bei Krankheit und Trauerfällen hilfreich beizustehen; da aber Kesselbach,
gottlob, keine Familie hat, die davon Gebrauch machen wird, so ist das Augenmerk
auf die nächsten Umgebung gerichtet: Kesselbach gehört mit noch zwei
Dörfern (sc. Geilshausen und Rüddingshausen) zur Synagoge Londorf; in letzterem Orte ist leider
bis jetzt noch nicht eine Frau dem Vereine beigetreten, ja der dortige
Synagogenvorstand wollte sogar der Chebra Schwierigkeiten bereiten, indem
er das anfangs erlaubte Geloben in dieselbe beim Aufruf zur Thora später
wieder verbot; man wollte in Anbetracht der wenigen Mitglieder die Mitte
der Chebra auf diese Weise vergrößern. Doch der hiesige
Wohltätigkeitssinn ruhte nicht und so ist es ihm Dank der Intervention
des Herrn Rabbiner Dr. Levi zu Gießen gelungen, dass Großherzogliches
Kreisamt* entschieden hat: man könnte niemandem verbieten, beim Aufrufe
zur Tora für einen Verein Spenden zu geloben, wovon an dem
darauffolgenden Samstag einige Herren Gebraucht machten. Von den hiesigen
Familien sind der Chebra anlässlich von Familienfestlichkeiten,
Jahrzeitstagen usw. bereits ganz hübsche Geschenke zugegangen und wenn es
weiter so der Fall ist, wird die Chebra recht bald ihre Tätigkeit
aufnehmen können, worüber ich Ihnen später gerne weitere Nachrichten
zukommen lasse. J.W.N."
Kritische Anmerkung der Redaktion: "*) Ist das die
gerühmte Einigkeit, Bildung, Forschritt, dass man die Behörde mit
solchen Dingen belästigt? Es ist in vielen Gemeinden wohlbegründeter
Gebrauch, dass nur für bestimmte, notwendige Zwecke beim Aufruf zur Tora
Spenden gelobt werden dürfen und wird der Gemeinde-Vorstand von Londorf
wohl seine guten Gründe gehabt haben." |
Bildung eines gemeinsamen Verbandes "Jeschurun" (1905)
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April 1905:
"Am 26. vorigen Monats wurde aus den Synagogengemeinden Londorf,
Allendorf a.L., Treis
a. L. und Nordeck ein Verband
gebildet, der bezweckt, die idealen Interessen des Judentums zu fördern,
und zwar durch Verbreitung der jüdischen Geschichte und Literatur, durch
die Pflege der Geselligkeit in den einzelnen Gemeinden und durch die
Ausübung der werktätigen Nächstenliebe. Der Verband führt den Namen 'Jeschurun'." Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April 1905:
"Am 26. vorigen Monats wurde aus den Synagogengemeinden Londorf,
Allendorf a.L., Treis
a. L. und Nordeck ein Verband
gebildet, der bezweckt, die idealen Interessen des Judentums zu fördern,
und zwar durch Verbreitung der jüdischen Geschichte und Literatur, durch
die Pflege der Geselligkeit in den einzelnen Gemeinden und durch die
Ausübung der werktätigen Nächstenliebe. Der Verband führt den Namen 'Jeschurun'." |
Maßnahmen gegen den Wiegemeister in
Londorf wegen geschäftlichen Beziehungen zu Max Rosengarten in
Allendorf (1935)
 Artikel in "Die neue Welt" vom 11. Oktober 1935: "Der 'Grüneberger Anzeiger'
(Oberhessen) berichtet aus Londorf, dass
der Gemeindevorsteher folgendes bestimmt habe: '1. Der seitherige
Wiegemeister wird seines Amtes enthoben, weil er seine geschäftlichen
Beziehungen zu dem Juden Max Rosengarten (Allendorf)
nicht abbrechen konnte. Als neuer Wiegemeister wird Parteigenosse Ernst
Boeger ernannt. 2. Die Benutzung der Gemeindeviehwaage wird den Juden
und den Judenknechten untersagt. 3. Jedem Landwirt und
Kleintierzüchter, welcher mit Juden verkehrt und handelt, steht das
Gemeindefaselvieh (= Zuchttiere wie Farren/Bullen und Eber) nicht
mehr zur Verfügung. 4. Sämtliche Handwerker und Betriebe, welche mit Juden
Geschäfte treiben, werden bei Vergebung von Gemeindearbeiten ausgeschlossen.
5. Die Gemeinde-Backhäuser und -Bleichen dürfen nur von deutschen
Volksgenossen benutzt werden. Jedem wird es zur Pflicht gemacht,
Verstöße gegen vorstehende Anordnungen der Bürgermeisterei zu melden."
Artikel in "Die neue Welt" vom 11. Oktober 1935: "Der 'Grüneberger Anzeiger'
(Oberhessen) berichtet aus Londorf, dass
der Gemeindevorsteher folgendes bestimmt habe: '1. Der seitherige
Wiegemeister wird seines Amtes enthoben, weil er seine geschäftlichen
Beziehungen zu dem Juden Max Rosengarten (Allendorf)
nicht abbrechen konnte. Als neuer Wiegemeister wird Parteigenosse Ernst
Boeger ernannt. 2. Die Benutzung der Gemeindeviehwaage wird den Juden
und den Judenknechten untersagt. 3. Jedem Landwirt und
Kleintierzüchter, welcher mit Juden verkehrt und handelt, steht das
Gemeindefaselvieh (= Zuchttiere wie Farren/Bullen und Eber) nicht
mehr zur Verfügung. 4. Sämtliche Handwerker und Betriebe, welche mit Juden
Geschäfte treiben, werden bei Vergebung von Gemeindearbeiten ausgeschlossen.
5. Die Gemeinde-Backhäuser und -Bleichen dürfen nur von deutschen
Volksgenossen benutzt werden. Jedem wird es zur Pflicht gemacht,
Verstöße gegen vorstehende Anordnungen der Bürgermeisterei zu melden."
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von Frau S. Schönfeld I in Kesselbach
(1908)
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. Juni 1908:
"Junges Mädchen, das 2 Jahre in einem bekannten Institut in
allen Zweigen des Haushalts besonders im Kochen gründliche Ausbildung
genossen und 1 Jahr im Dienst war, sucht, gestützt auf recht gute
Zeugnisse, Stellung in einem besseren Hause. Gefällige Offerten an Frau
S. Schönfeld I, Kesselbach bei Londorf." Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. Juni 1908:
"Junges Mädchen, das 2 Jahre in einem bekannten Institut in
allen Zweigen des Haushalts besonders im Kochen gründliche Ausbildung
genossen und 1 Jahr im Dienst war, sucht, gestützt auf recht gute
Zeugnisse, Stellung in einem besseren Hause. Gefällige Offerten an Frau
S. Schönfeld I, Kesselbach bei Londorf." |
Anzeige von Isaak Simon
(1924)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1924: "Suche
für meine 16-jährige Tochter, die in allen häuslichen Arbeiten gut
angelernt ist und Sekundareife hat, Stelle zur Erlernung des Haushalts
in nur gutem Hause (rit.) bei Familienanschluss ohne gegenseitige
Vergütung. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Juni 1924: "Suche
für meine 16-jährige Tochter, die in allen häuslichen Arbeiten gut
angelernt ist und Sekundareife hat, Stelle zur Erlernung des Haushalts
in nur gutem Hause (rit.) bei Familienanschluss ohne gegenseitige
Vergütung.
Isaak Simon, Londorf (Oberhessen)." |
Verlobungsanzeige von Hilde Simon und Simon Eisenmann (1937)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1937: "Gott
sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1937: "Gott
sei gepriesen.
Hilde Simon - Simon Eisenmann. Verlobte.
Londorf (Hessen) / Amsterdam van Breestraße 76 - Amsterdam -
Beethovenstraße 95. Kislew 5698 / November 1937". |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge war im Obergeschoss eines alten, dreistöckigen
Fachwerkhauses an der (früheren) Allendorfer Straße eingerichtet. Im Betsaal gab es 80 bis
100 Plätze. Im Erdgeschoss befand sich die Lehrerwohnung. Im Hof der Synagoge
- zur Lumda hin - war ein kleines Badhaus mit der Mikwe vorhanden. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde
das Synagogengebäude renoviert. Im Toraschrein wurden sieben oder acht
Torarollen aufbewahrt.
Im Sommer 1938 war die Auflösung der jüdischen Gemeinde absehbar. Isaak Simon,
der bereits mehrere Jahre als Vorbeter tätig war, gab einer im Sommer 1938 nach
England emigrierenden Familie zwei der Torarollen aus der Synagoge
mit.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
durch SA-Leute geschändet und verwüstet. Die Inneneinrichtung und die
Ritualien wurden verbrannt. Wenig später kam das Gebäude in Privatbesitz und
wurde nach 1945 abgebrochen. Auf dem Synagogengrundstück wurde später ein
Lebensmittelgeschäft erstellt, das bis in die 1980er-Jahre bestand. Danach
wurde im Gebäude eine Wohnung eingebaut.
Adresse/Standort der Synagoge: Gießener
Straße 76 (ehemalige Allendorfer
Straße in Londorf)
Fotos
(Quelle: sw-Fotos: Altaras s.Lit. 1988, 1994 und 2007)
| |
Historische Fotos
/ Abbildungen der Synagoge sind noch nicht vorhanden;
über Hinweise oder
Zusendungen freut sich der Webmaster der "Alemannia Judaica";
Adresse siehe Eingangsseite. |
| |
|
|
| Nach 1945 |
 |
| |
Blick auf den an
Stelle der ehemaligen Synagoge erbauten, eingeschossigen Lebensmittelmarkt
(Foto vom September 1984); 1992 war hier eine Wohnung
eingebaut. |
| |
|
|
Reste des ehemaligen
rituellen Bades |
 |
| |
Im früheren
Synagogenhof war das Badhaus (Foto vom April 1992): beim Badehaus (Fläche
7,5 m x 3,5 m) handelt es sich um das kleine Gebäude mit der Türöffnung
zum Garten; darunter wurde später ein Vorbau aus Hohlblocksteinen
erstellt. |
| |
|
| |
Neuere Fotos der
aktuellen Situation werden noch erstellt. |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
November 2019:
Erinnerungstafel wird
angebracht |
| Auf Initiative des Vereins für Heimat- und
Kulturgeschichte wurde im November 2019 am alten Backhaus in der Londorfer
Kirchgasse eine Erinnerungstafel angebracht mit der Inschrift: "Zur
Erinnerung an unsere Bürger jüdischen Glaubens und zum Gedenken an ihr in
den Jahren 1933-1945 durch Unrecht und Gewalt erlittenes Schicksal".
|
| |
|
Februar 2022: Ein
Presseartikel erinnert an die jüdische Geschichte in Londorf
|
Artikel von Thomas Brückner in der "Gießener
Allgemeinen" vom Februar 2022: "Wenig erinnert an Londorfs Juden
300 Jahre wohnten, arbeiteten, feierten Londorfs Juden in meist guter
Nachbarschaft mit den Christen. Zum Pessachfest teilten Kinder die
ungesäuerten Fladen (Matzen) mit ihren Freunden. Mit der 'Machtergreifung'
der Nazis aber war’s damit vorbei: Entrechtung, Boykott, Verwüstung der
Synagoge, Deportation, Mord. Wenig erinnert an dieses Kapitel. Darunter
Reste der Mikwe.
Erst seit einem Novembertag 2019 erinnert eine schlichte Tafel an die
jüdische Gemeinde Londorf. Eine Initiative aus dem Verein für Heimat- und
Kulturgeschichte. Erinnert sei an die Worte Pfarrer Leislers bei der
Enthüllung der Plakette am alten Backhaus: Dass die Massenvernichtung
möglich gewesen sei, so der evangelische Geistliche, liege sehr wohl auch an
den Menschen, die ganz einfach nichts getan hätten. 'Die Stillschweigen
bewahrt, die billigend in Kauf genommen hatten, was mit ihren Nachbarn
geschah.' Nicht im fernen Berlin, sondern eben auch in Londorf. Dass es so
lange gedauert habe, die Tafel mit ihrem recht neutralen Text aufzuhängen -
für den Pfarrer 'eine peinliche Nummer'. Das aber soll sich ändern: Eine
Gruppe um Jens Hausner möchte, dass die Geschichte der Londorfer Juden vor
dem Vergessen bewahrt wird. Mag sein, die wenig sagende Tafel wird durch
eine ersetzt, die auch die Namen jener Familien nennt, die unter den Nazis
leiden mussten, von ihnen vertrieben, gefoltert, ermordet wurden. Darunter
die Familie von Leopold Wertheim. 1891 in Rüddingshausen geboren, hatte er
später in Londorf einen Viehhandel betrieben. Mit Ehefrau Emma und den
Töchtern Ingeborg und Ruth lebte er in der heutigen Kirchgasse 12. Im Ersten
Weltkrieg hatte er einen Arm verloren, was ihm den Dorfnamen 'Earm'
bescherte. Wie der Vater war auch Leopold in der Sängervereinigung
'Frohsinn' aktiv. Unter den Nazis aber war es bald vorbei mit der Harmonie.
Wie dem Beitrag von Artur Rothmann für das Festbuch '1250 Jahre Londorf',
erschienen 2008, weiter zu entnehmen, 'erkalteten die zuvor gut
nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Juden und Christen durch die
zunehmende Hetz- und Drohpropaganda.' Und so musste auch Leopolds Tochter
Ruth, 1934 eingeschult, nicht nur unter Hänseleien leiden. 1935 schickten
sie ihre Eltern daher auf eine jüdische Schule in Offenbach. Allerdings, so
weiter Zeitzeugen, habe es auch jene gegeben, die den verarmten Juden
heimlich Brot oder einen Sack Mehl zusteckten. Die gesamte Familie von
Leopold Wertheim, einschließlich Mutter Johanna, wurde 1942 deportiert und
ermordet. Einzig Ruth überlebte. 1945 kehrte sie nach Londorf zurück - die
jüdische Gemeinde existierte nicht mehr, ihre Angehörigen waren ermordet
worden. 1946 emigrierte sie in die USA, wo sie im Alter von 67 Jahren starb.
An das Schicksal der Wertheims wie aller Londorfer Juden erinnert heute
wenig. Besagte Gedenktafel etwa. Oder der
Judenfriedhof. Dessen Grabsteine hatte vor einigen Jahren ein örtlicher
Steinmetz restauriert, wie Gerd Schönhals, ehemals Vorsitzender des Vereins
für Heimat- und Kulturgeschichte, dieser Zeitung berichtete.
Verschwunden ist dagegen die Synagoge. Das dreistöckige Fachwerkgebäude
(heute Gießener Straße 76) beherbergte einen großen Betraum, Schulsaal und
Lehrerwohnung. Beim Novemberpogrom 1938 zerstörten Nazis die
Inneneinrichtung, verbrannten einige der Thorarollen. Nach dem Krieg wurde
das Haus abgerissen, im Neubau befand sich einige Jahre ein Lebensladen. An
die Synagoge, zur Lumda hin, schloss die Mikwe an. Ein kleines Badehaus,
dessen Wasser der Erlangung ritueller Reinheit dienen soll. Was kaum einer
weiß: Die Außenmauern sind bis heute erhalten - ein vergessener Ort.
Die Geschichte auch dieser Gemeinschaft mosaischen Glaubens dokumentiert hat
die 'Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im
süddeutschen und angrenzenden Raum' (Alemannia Judaica)...'"
Link zum Artikel |
| |
|
September 2022:
Einweihung der Gedenkstätte für
die deportierten jüdischen Familien aus Londorf
|
| Am 14. September 2022 wurde in Anwesenheit
mehrerer Nachkommen jüdischer Familien aus Londorf eine große Gedenkstätte
mit Stelen zur Erinnerung an die deportierten jüdischen Familien eingeweiht.
Vgl. Bericht im "Gießener Annzeiger" vom vom 15. September 2022:
https://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/jetzt-sind-sie-alle-hier-91788992.html
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 499-501. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 86. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 70-71. |
 | dies.: Neubearbeitung der genannten Bücher. 2007. S.
205-206. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.
47. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 228. |
 | Verein für Heimat- und Kulturgeschichte der Rabenau e.V.:
Chronik zur 1250-Jahre-Feier von Londorf. 2008. Darin Beitrag von Artur
Rothmann zur jüdischen Geschichte. |
 | Marion Davies: The Bock Family from Lich. 1700s to
1874/75. Researched and compiled by Marion Davies 2023 (mit Bezügen zu
Londorf).
Eingestellt zum Download als pdf-Datei. |
 |
 Hanno
Müller: Juden in Rabenau. Geilshausen - Kesselbach - Londorf -
Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg. Hrsg. von
der Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. 2023. ISBN 978-3-96049-11-9. 240
S. zahlr. Abb. Kontakt zum Autor: Hanno Müller
HGM.1948@gmx.de Website
http://www.fambu-oberhessen.de/ Hanno
Müller: Juden in Rabenau. Geilshausen - Kesselbach - Londorf -
Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg. Hrsg. von
der Ernst Ludwig Chambré-Stiftung in Lich. 2023. ISBN 978-3-96049-11-9. 240
S. zahlr. Abb. Kontakt zum Autor: Hanno Müller
HGM.1948@gmx.de Website
http://www.fambu-oberhessen.de/
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Londorf
Hesse. Jews first settled in 1650 and numbered 103 (12 % of the total) in
1828. The community was affiliated with Giessen's Liberal rabbinate. Of the 40
Jews living there in 1933, 21 emigrated before 1939. On Kristallnacht
(9-10 November 1938) the synagogue was burned down and the remaining 15 Jews
perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|