|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberbayern"
Rosenheim (kreisfreie
Stadt, Oberbayern)
und Orten der Umgebung (u.a.
Niedernburg, Gemeinde Prutting)
Jüdische Geschichte
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte
in Rosenheim
In Rosenheim bestand zu keiner Zeit eine
selbständige jüdische Gemeinde. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
sind jedoch mehrere jüdische Familien / Personen in der Stadt zugezogen. Sie
gehörten zur jüdischen Gemeinde in München, wo auch die in Rosenheim
verstorbenen Juden beigesetzt wurden.
Im 19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: 1910 56 jüdische Einwohner (0,4 % von insgesamt 15.696 Einwohner), 1925
39 (0,2 % von insgesamt 17.998).
Um 1900 beantragten die Rosenheimer Juden die Gründung eines eigenen
israelitischen Kultusvereins, was jedoch vom Stadtmagistrat mit Hinweis auf die
Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde in München abgelehnt wurde.
An Einrichtungen gab es möglicherweise in einem der jüdischen Häuser einen
Betraum.
Die jüdischen Familien eröffneten mehrere jüdische Geschäfte in der Stadt.
1933 gab es elf jüdische Geschäftsinhaber.
1933 lebten 38 jüdische Personen in Rosenheim. In
den folgenden Jahren sind fast alle von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits im März 1933
starb ein älteres jüdisches Ehepaar an Suizid. Zwischen 1933 und 1939
emigrierten 14 der jüdischen Einwohner (fünf in die USA, je drei nach Holland
und in die Tschechoslowakei, zwei nach England, einer nach Palästina), 14
verzogen in andere deutsche Orte (u.a. acht nach München und vier nach Berlin).
Bis 1937 gaben sechs der elf jüdischen Geschäftsinhaber in der Innenstadt ihr
Geschäft auf. Beim Novemberpogrom 1938 wurden in den frühen Morgenstunden des
10. November 1938 die letzten beiden jüdischen Läden durch SA-Männer
überfallen und völlig demoliert. 1939 gab es noch sieben jüdische Einwohner
in der Stadt. Weitere drei jüdische Personen zogen 1941 nach München. Am 28.
Februar 1942 wurden zwei ältere Frauen in das Lager Milbertshofen
verbracht.
Anmerkung: Hinweis auf die "Zusammenstellung
aller vor und während des letzten Krieges in Rosenheim ansässig gewesenen Juden" (pdf-Datei
der an den International Tracing Service (über die Regierung von Oberbayern in
München) und an Yad Vashem Jerusalem vom Einwohnermeldeamt der Stadt Rosenheim
am 24. April 1962 mitgeteilten Liste mit 57 Namen aus Rosenheim).
Von den in Rosenheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Antonie Taube
Fichtmann geb. Delfin (1874), Klara Fichtmann (1912), Max Fischer (1913), Franz
Kohn (1895), Hugo Kohn (1880), Julius Kohn (1886), Babette Mayer geb. Dreyfuss
(1862), Adele Obernbreit (1895), Rosa (Rosalie) Obernbreit geb. Heilbronner
(1866), Konrad Scherer (1891), Alexander Wiener (1873), Frieda Wiener geb. Selz
(1873).
Aus Niedernburg (Gemeinde Prutting) sind umgekommen: Elisabeth (Ella
Elsa) Block (1923), Friedrich (Fritz) Block (1892), Gertrud Block (1927),
Johannes Arno Block (1928), Marie (Maria, Mirjan, Miriam) Block geb. Frensdorff
(1896).
Hinweise: Im Frühjahr 2014 wurde in Rosenheim angeregt, in der Stadt "Stolpersteine"
für die Opfer des NS-Zeit zu verlegen (Pressemitteilungen von Ende April
2014). Im Juni 2015 wurde eine Initiative "Stolpersteine für
Rosenheim" gegründet. Die Diskussion zog sich über mehrere Jahre hin (siehe
unten).
In Niedernburg wurden am 16. Juli 2018 fünf Steine für die jüdische Familie Block verlegt.
Fritz Block und Mirjam geb. Frensdorff (beide stammten aus Hannover) hatten drei Kinder und betrieben
in Niedernburg seit 1921 eine Gärtnerei. Die ganze Familie wurde 1942 (über
das "Judenlager" Milbertshofen) nach Piaski deportiert und ermordet. Das Tagebuch von Tochter Elisabeth blieb erhalten und wurde nach seiner Veröffentlichung 1993 auch überregional bekannt.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Block.
Nach Elisabeth Block ist in Niedernburg eine Straße benannt.
Nach Kriegsende kam eine Anzahl jüdischer Displaced Persons (Überlebende von
Konzentrationslagern und weitere jüdische Flüchtlinge) nach Rosenheim. Von den früheren jüdischen
Einwohnern kam jedoch niemand in die Stadt zurück. Seit Herbst 1946 bestand in
Rosenheim ein zentrales Auffanglager für jüdische Waisenkinder sowie
für Jungen und Mädchen, die in der NS-Zeit von ihren Eltern getrennt worden
waren ("Children Center"). Etwa 1.600 Kinder lebten zeitweise in dem
Aufnahmelager in Rosenheim, das in der früheren Rosenheimer Pionierkaserne
untergebracht wurde. In den ehemaligen Soldatenunterkünften herrschte eine
qualvolle Enge, da in jeden Wohnblock durchschnittlich 400 Jungen und Mädchen
eingewiesen wurden. Zu den Kindern kamen noch zahlreiche Erwachsene, sodass sich
zeitweise 2.250 Bewohner in der Pionierkaserne drängten. Im Heim wurde eine
eigene Volksschule mit zeitweise über 1.000 Schülern eingerichtet sowie ein
Kindergarten und Ausbildungswerkstätten. Im April 1947 wurde das
Kinderheim aufgelöst. Die Mehrheit der Jungen und Mädchen übersiedelten in
einer der Kinderheime innerhalb der US-Zone wie etwa nach Indersdorf, Aschau
oder Lindenfels. Nach Gründung des Staates Israel wurde das DP-Lager in
Rosenheim 1948/49 geschlossen.
Berichte aus der
jüdischen Geschichte in Rosenheim
Berichte zu einzelnen Personen
Kriegsauszeichnung für Siegfried Kurzmann (1916)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September
1916: "Nürnberg. Das Eiserne Kreuz erster Klasse
erhielt Pionierhauptmann der Reserve Siegfried Kurzmann, Bauamtmann
in Rosenheim. Er besitzt bereits das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, den
bayerischen Militärverdienstorden mit Schwertern und das österreichische
Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration". Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September
1916: "Nürnberg. Das Eiserne Kreuz erster Klasse
erhielt Pionierhauptmann der Reserve Siegfried Kurzmann, Bauamtmann
in Rosenheim. Er besitzt bereits das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, den
bayerischen Militärverdienstorden mit Schwertern und das österreichische
Militärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration". |
Zur Geschichte von Alexander und Frieda Wiener
vgl.
http://www.stolpersteine-rosenheim.de/alexander-wiener/ und
https://www.stadtarchiv.de/stadtgeschichte/rosenheim-im-3-reich/schicksale-rosenheimer-juden/;
die dortigen Angaben konnten mit Hilfe der Dokumente aus Yad Vashem, Jerusalem
ergänzt werden. Foto: Stadtarchiv Rosenheim.
Die Geschichte von Alexander und Frieda Wiener steht hier
exemplarisch für
die Geschichte und das Schicksal der anderen jüdischen Einwohner Rosenheims, die
in der NS-Zeit verfolgt und vertrieben wurden. Weitere Biographien siehe über
www.stolpersteine-rosenheim.de
und die anderen Quellen (Presseartikel, Website des Stadtarchives usw.).
 Alexander
Wiener ist am 13. August 1873 in Bratislava (Preßburg, Pozsony) geboren
als Sohn des Schneiders Samuel Wiener und seiner Frau Charlotte geb. Walter.
Er war von Beruf Kaufmann, lebte bis 1892 in Preßburg, dann in Memmingen,
Regensburg und München. Am 6. März 1899 kam er nach Rosenheim, wo er in der
Folgezeit ein Textil- und Modegeschäft in der Innstraße 22 (bis 1928) und
ein weiteres in der Münchnerstraße 28 betrieb (ab 1933 unter ständigen
Repressalien und Boykottaufrufen durch die Nationalsozialisten bis zur
zwangsweisen Schließung im Oktober 1938; vgl.
Seite zum Haus Münchnerstraße 28 in der Website Stadtarchiv Rosenheim).
Alexander Wiener war seit 26. August 1912 (in Rosenheim) verheiratet mit
Frieda geb. Selz verwitwete Reichner (geb. 21. November 1873 in Nürnberg
als Tochter von Armin Selz und und Kathi geb. Eichmann, vgl.
Familienblatt Selz Family). Die beiden
hatten eine gemeinsame Tochter Charlotte (geb. 21. Dezember 1914 in Rosenheim). In der NS-Zeit
ist Charlotte im September 1936 als erste der Familie nach Prag verzogen
(Weiteres siehe unten). Frieda geb. Selz hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem
Kaufmann Ignaz Reichner (geb. 4. September 1874 in Preßburg) eine Tochter
Katharina (Käthe, geb. 18. März 1905 in Rosenheim) mitgebracht, die nun
gleichfalls in der Familie Wiener aufgewachsen ist. Alexander
Wiener ist am 13. August 1873 in Bratislava (Preßburg, Pozsony) geboren
als Sohn des Schneiders Samuel Wiener und seiner Frau Charlotte geb. Walter.
Er war von Beruf Kaufmann, lebte bis 1892 in Preßburg, dann in Memmingen,
Regensburg und München. Am 6. März 1899 kam er nach Rosenheim, wo er in der
Folgezeit ein Textil- und Modegeschäft in der Innstraße 22 (bis 1928) und
ein weiteres in der Münchnerstraße 28 betrieb (ab 1933 unter ständigen
Repressalien und Boykottaufrufen durch die Nationalsozialisten bis zur
zwangsweisen Schließung im Oktober 1938; vgl.
Seite zum Haus Münchnerstraße 28 in der Website Stadtarchiv Rosenheim).
Alexander Wiener war seit 26. August 1912 (in Rosenheim) verheiratet mit
Frieda geb. Selz verwitwete Reichner (geb. 21. November 1873 in Nürnberg
als Tochter von Armin Selz und und Kathi geb. Eichmann, vgl.
Familienblatt Selz Family). Die beiden
hatten eine gemeinsame Tochter Charlotte (geb. 21. Dezember 1914 in Rosenheim). In der NS-Zeit
ist Charlotte im September 1936 als erste der Familie nach Prag verzogen
(Weiteres siehe unten). Frieda geb. Selz hatte aus ihrer ersten Ehe mit dem
Kaufmann Ignaz Reichner (geb. 4. September 1874 in Preßburg) eine Tochter
Katharina (Käthe, geb. 18. März 1905 in Rosenheim) mitgebracht, die nun
gleichfalls in der Familie Wiener aufgewachsen ist.
Am
19. November 1938 - also nach den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 sind
Alexander und Frieda Wiener von Rosenheim nach Prag geflüchtet (siehe
Arolsen-Liste), wo sie in der Ve Smeckach E21 wohnten (Liste Arolsen).
Von Prag aus verzog Alexander Wiener (wann?) in seine Heimat Preßburg/Bratislava. Bis
zu seiner Deportation am 17. April 1942 wohnte er in Trnava nordöstlich von
Bratislava in der Sv. Jakobua 47. Vermutlich wurde er dorthin von Bratislava
aus zwangseingewiesen (nach
https://www.jüdische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/s-t/2422-tyrnau-trnava-slowakei
wurden nach Trnava etwa 1200 Juden aus Bratislava zwangsweise umgesiedelt).
Am 17. April 1942 wurde Alexander Wiener nach der "List of Jews from
Slovakia deported from Trnava to the Lublin Region 17. April 1942" nach
Lublin deportiert. Nach der "List of Inmates in Majdanek who were murdered
18/05 - 29/09/1942" ist er am 6. September 1942 umgekommen bzw. wurde er
ermordet.
Alexanders Frau Frieda Wiener ist gleichfalls umgekommen bzw.
wurde ermordet. Sie ist nicht mit ihrem Mann von Prag nach Bratislava
gezogen. Am 28. April 1942 wurde sie nach den Angaben des Gedenkblattes von
Yad Vashem von Prag aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert (Transport
370; vgl. Gedenkbuch des Bundesarchives zu
Frieda Wiener), von dort aus am 30. April 1942 entweder direkt nach Auschwitz oder
(wahrscheinlicher) in das Ghetto Zamość (das
Ghetto wurde im Oktober 1942 "liquidiert"). Vgl.
Seite in der Website des United States Holocaust Memorial Museum und
Seite im
Nürnberger Gedenkbuch.
Tochter (aus der ersten Ehe von Frieda geb. Selz) Katharina
(Käthe)
Reichner (Kate) war in Rosenheim als Stenotypistin tätig und
lebte bis zum 25. August 1939 bei der jüdischen Familie Obernbreit in
Rosenheim (Konfektionsgeschäft bis 1938 am Max-Josef-Platz). Danach konnte
sie in die USA emigrieren (Dokument siehe unten); später war sie verheiratet
mit Harry Kohn (geb. in Rosenheim als Heinrich Kohn, Sohn von Hermann
und Henriette Kohn, gest. 4. September 1976). Sie starb am 21. November 1992
in Virginia Beach/USA (Sterbeurkunde siehe unten).
Tochter Charlotte Wiener konnte von Prag aus nach Manila/Philippinen
emigrieren, wo sie während der Kriegszeit bleiben konnte. 1946 wanderte sie
in die Vereinigten Staaten aus, zunächst nach Seattle, später lebte sie wohl
(nach Angaben der
Arolsen-Liste) einige Zeit in Hayattsville/Maryland, dann in
Norfolk/Virginia. Sie arbeitete in verschiedenen Funktionen als Sekretärin
für die U.S.-Regierung und war Mitglied in der jüdischen Gemeinde
Ohef Sholom in Norfolk. Sie war in
erster Ehe mit einem Herrn Hermann verheiratet, in zweiter Ehe (seit 17.
April 1950 in Alexandria/Virginia) mit Henry Heinz Moos (geb. 29. Dezember
1912 in Ulm als Sohn von Carl Moos und
Hilda geb. Hirsch). Sie starb am 17. November 2000 in Norfolk/Virginia und
wurde beigesetzt im Forest Lawn Cemetery in Norfolk (Foto des Grabsteines
und Informationen
https://de.findagrave.com/memorial/65637301/charlotte-moos; ihr Mann
Henry starb am 26. Januar 2009 ebd.). Die beiden hatten keine Kinder. |
Dokumente aus Yad
Vashem
zur Geschichte von Alexander
und Frieda Wiener
https://yvng.yadvashem.org/
|

|

|
 |
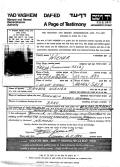 |
| |
Dokument 1942 mit der
Adresse
von Alexander Wiener in Trnava |
Liste der nach Lublin
aus Trnava
1942 deportierten Personen (Nr. 215) |
Liste der in Majdanek
"gestorbenen"
(ermordeten) Personen (Nr. 4869) |
Gedenkblatt Yad Vashem
für Frieda Wiener geb. Selz |
| |
|
|
|
|
Weitere Dokumente
(Quelle: privat) |

|
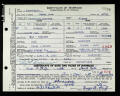 |
 |
 |
| |
Einwanderung in die USA
für
Charlotte Hermann geb. Wiener |
Heiratsurkunde für Henry Moos
und
Charlotte Hermann geb. Wiener 1950 |
Dokument zur Ankunft
von
Katharina Reichner in New York |
Sterbeurkunde für Kate
(Katharina) Kohn geb. Reichner |
| |
|
|
(1939) |
gest. 1992 Virginia Beach/USA
|
| Anzeigen im "Aufbau"
|
|
 |
|
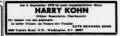 |
| |
|
Heiratsanzeige Henry und
Charlotte Moos im "Aufbau" vom 21.04.1950 |
|
Anzeige zum Tod von
Harry Kohn im "Aufbau" vom 17.09.1976 |
| |
|
|
|
|
Fotos
Hinweis: im Fotoarchiv
des United States Holocaust Museum Washington (USHMM) findet sich eine
Anzahl von Fotos zur Geschichte des Lagers für Displaced Persons aus den Jahren
1946 bis 1948; die beiden Fotos - © USHMM, das linke im Original im Stadtarchiv
Rosenheim - entstammen der online-Präsentation von USHMM.
 |
 |
|
NS-Boykott am 1. April
1933
vor einem jüdischen Geschäft in Rosenheim |
Neujahrskarte, versandt von
einer Familie
aus dem DP-Lager Rosenheim 1947 |
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
Juli 2015:
Diskussion um die
Erinnerungsarbeit vor Ort |
Artikel in
ovb-online.de vom 11. Juli 2015: " 'Erinnerung braucht Orte'.
Persönlich, ortsbezogen, nachhaltig: Dass ein Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus diese Kriterien erfüllen soll, darüber herrscht Konsens
im Stadtrat. Doch stellt die Verlegung von 'Stolpersteinen', die an die
letzten Wohnorte Rosenheimer Juden vor ihrer Vertreibung, Flucht oder
Deportation erinnern, einen würdevollen Weg dar?
Darauf gab es auch in der Sondersitzung nach der Anhörung von sechs Experten
keine schnelle Antwort.
Rosenheim - 'Eine adäquate Erinnerung stellen all jene Formen des
Gedenkens dar, die im Sinne einer Aufklärung funktionieren', findet
Professor Dr. Edgar Wolfrum. 'Vergeben und Vergessen': Von diesem Prinzip
der Vergangenheitsbewältigung habe sich die moderne Gesellschaft abgewendet
- in der Gewissheit, dass aus der Vergangenheit gelernt werde für die
Zukunft, so der Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität
Heidelberg. Die Erinnerung geschieht nach Überzeugung von Albert Knoll,
Archivar an der Gedenkstätte Dachau, am besten, wenn individuelle Schicksale
von Opfern lebendig werden. 'Erinnerung braucht Orte', betonte Knoll auch im
Namen von anderen Opfergruppen. Eine Rosenheimer Initiative sieht in der
Verlegung der vom Künstler Gunter Demnig entwickelten Stolpersteine auf den
Gehwegen vor Häusern, in denen bis zur Verfolgung Juden wohnten, eine
Chance, den Blick auf ihre Schicksale zu schärfen. 54000 Steine liegen
bereits in 1300 Kommunen in 20 Ländern, berichtete Terry Swartzberg,
Vorsitzender der Initiative 'Stolpersteine für München' über das 'weltweit
größte Gedenkprojekt'. Doch die Stolpersteine sind in der jüdischen Gemeinde
umstritten. Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer verlas einen Brief von Dr.
Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, der
diese Form des Gedenkens 'mitten unter uns' begrüßt. Im Herzen der Städte
würden die Steine mit den Namen der Opfer darauf hinweisen, dass hier einmal
jüdisches Leben stattgefunden hat, diese Mitbürger später den
Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Aaron Buck als Sprecher der
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern bekräftigte im Auftrag
der Vorsitzenden Dr. Charlotte Knobloch die ablehnende Haltung seiner
Gemeinde. Durch die in den Gehweg eingelassenen Steine würden die Opfer 'ein
zweites Mal mit Füßen getreten'. Dies sei 'unwürdig und pietätlos. 'Stolpern
und Gedenken: Das passt nicht zusammen', findet Buck, der ein 'Erinnern auf
Augenhöhe' forderte. Es gebe vielfältige andere Möglichkeiten des
individuellen und dezentralen Gedenkens. Die Steine seien vor allem eins:
bequem. Sie stellen nach Ansicht von Swartzberg jedoch nur einen Anfang dar
- eine Anregung, die zum Nachdenken auffordere. Zur Verfügung gestellte
Recherchemöglichkeiten würden eine intensive Beschäftigung ermöglichen, wies
er den Vorwurfs Bucks zurück, die Stolpersteine mit den Namen würden die
Situation der Opfer nur verkürzt darstellen, also durch Masse statt Qualität
überzeugen. Die Stolpersteine sind, wie die Diskussion zum Erstaunen des
SPD-Fraktionsvorsitzenden Robert Metzger zeigte - im doppelten Sinne Steine
des Anstoßes: Sie regen zur Auseinandersetzung mit der Tatsache an, dass
Juden und andere Opfer des Nationalsozialismus denunziert, verfolgt,
deportiert und ermordet wurden - und sind eine Form des Gedenkens, an der
sich Gegner und Befürworter reiben. Wie sehr, zeigte auch die Debatte um die
Frage, ob die Angehörigen wirklich immer in die Entscheidung zur Verlegung
einbezogen werden, was Swartzberg beteuerte, Buck bestritt. Stadträte
wollten auch wissen, ob es zu Schändungen von Steinen kommt. Nur etwa 100
Fälle pro Jahr gebe es, so Swartzberg. Er verwies darauf, dass sich 60000
Paten um die Pflege kümmern würden. Die Rosenheimer Historikerin Dr. Isabel
Leicht, die eine Doktorarbeit zur Erinnerungskultur in Rosenheim geschrieben
hat, sieht grundsätzlich in der Debatte um die Form der Gestaltung ein
positives Signal. Am Beispiel des Denkmals im städtischen Friedhof, das
ursprünglich zum Gedenken an alle Kriegsopfer entwickelt worden war und in
dieser Aufgabenstellung 'unsichtbar' geworden sei, zeigte sie
Erinnerungswege ohne nachhaltige Wirkung auf. Dies möchte der Stadtrat
verhindern. Intensiv soll das Gedenken im öffentlichen Raum wirken - Ansätze
für die Zukunft aufzeigen, wie CSU-Fraktionsvorsitzender Herbert Borrmann
formulierte. Das durch die Darstellung der Orte der Gewalt, wie von Franz
Lukas (Grüne) gefordert, eine ständige Konfrontation im Alltagsleben
ausgelöst wird, begrüßte Historiker Wolfrum. Einig waren sich die Fraktionen
mit Dr. Beate Burkl von der Freien Wählern/UP, dass es an der Zeit ist, die
Verdrängungs- durch eine Erinnerungskultur abzulösen. Buck als Vertreter der
Israelitischen Kultusgemeinde plädierte in der vom Historischen Verein sowie
vom Arbeitskreis christlicher Kirchen mit vorbereiteten Sitzungen jedoch
dafür, eine Form zu finden, welche die Jugend nicht mit einer Diskussion
rund um Schuld und Schande belaste."
Link zum Artikel |
| |
|
Dezember 2015:
Initiative für die Verlegung von
"Stolpersteinen" in Rosenheim |
Artikel in
"Rosenheim24.de" vom 17. Dezember 2015: "Initiative nun auch in Rosenheim
aktiv. "Stolpersteine" sollen an NS-Opfer erinnern
Rosenheim - In München ist der erste NS-Stolperstein, der in
individualisierter Form an die Opfer der Nazi-Zeit erinnern soll, bereits im
Jahr 2007 verlegt worden. Jetzt gibt es eine solche Initiative auch in
Rosenheim. Wie das Oberbayerische Volksblatt berichtet, sprach der Initiator
der Rosenheimer Aktion 'Stolpersteine für Rosenheim', der Kinderarzt Dr.
Thomas Nowotny aus Stephanskirchen, von einem 'bewegenden Erlebnis', als er
vor acht Jahren in der Landeshauptstadt bei der Zeremonie dabei war. Das sei
das erste Mal gewesen, dass er sich intensiv mit der Geschichte des
jüdischen Teils seiner Familie auseinandergesetzt habe. Die Initiative in
Rosenheim, die aus etwa 20 Personen besteht, hat es sich laut OVB zur
Aufgabe gemacht, die Angehörigen aller rund 30 um 1930 in Rosenheim lebender
jüdischen Familien aufzuspüren und sie von der Stolperstein-Bewegung zu
überzeugen. Hinter jedem Namen verberge sich eine Geschichte, die dann bei
Zustimmung der Angehörigen in Kurzfassung auf dem Stein veröffentlicht
werden soll, der dann auf einem öffentlichen Platz in Rosenheim angebracht
werden soll. Das Vorhaben stößt laut OVB aber nicht nur auf Zustimmung: Die
israelitische Kultusgemeinde in Oberbayern sieht die Gefahr, dass die Opfer
mit den in den Boden eingelassenen Steinen 'ein zweites Mal mit Füßen
getreten' werden. Ein Arbeitskreis der Stadt hat nun einen Kompromiss
vorgeschlagen: Zusätzlich zum Stolperstein soll für jedes Opfer ein
vertiefendes und individualisiertes Mahnmal entstehen."
Link zum Artikel
Vgl. dazu Artikel im "Oberbayerischen Volksblatt" vom 17. Dezember 2015:
"Verneigung vor den Opfern
'Es war ein bewegendes Erlebnis', bringt Dr. Thomas Nowotny seine
Erinnerungen an die Verlegung des ersten Stolpersteines für ein NS-Opfer in
München im Jahr 2007 auf den Punkt. Für den Kinderarzt aus Stephanskirchen
war diese individualisierte Form des Gedenkens an Heinrich Oesterreicher,
den im KZ Theresienstadt ermordeten Neffen der Urgroßmutter, der Anlass,
sich zum ersten Mal intensiv mit der Geschichte des jüdischen Teils seiner
Familie auseinanderzusetzen. Heute gehört Nowotny zu den Initiatoren der
Aktion 'Stolpersteine für Rosenheim'. Rosenheim– Als 'belastend' empfand
Nowotny das Schweigen der Nachkriegsgenerationen, wenn es um die
Aufarbeitung der NS-Zeit ging. Auch in der eigenen Familie wurde lange nicht
über die Tatsache gesprochen, dass Mitglieder wie der Großvater von Nowotny,
Berthold Walter, nach der Entrechtung aus Verzweiflung vom siebten Stock
eines Gebäudes am Hamburger Gänsemarkt in den Tod sprangen, dass viele
emigrierten und nie wieder nach Deutschland zurückkehrten, deportiert und
ermordet wurden.
Brief an die Oberbürgermeisterin. Auch heute gebe es noch Angehörige,
die nicht über diese Zeit sprechen wollen, unterstreicht Claudia
Bultje-Herterich, die im Auftrag des Historischen Vereins Rosenheim die
Biografiearbeit für die Aktion Stolpersteine im Raum Rosenheim begleitet.
Bei ihren Nachforschungen ist sie auch auf viele Nachkommen gestoßen, die
eine Verlegung für ihre Angehörigen ausdrücklich begrüßen. Der Historiker
Professor Dr. Manfred Treml, der ebenso wie Dr. Peter Miesbeck
Dokumentationen zur jüdischen Geschichte in Rosenheim verfasst hat,
vermittelte beispielsweise den Kontakt zu einer in London lebenden Cousine
von Elisabeth Block. Das Mädchen lebte mit seiner Familie in Prutting und
wurde im Alter von 19 Jahren im Vernichtungslager ermordet. Die Nachfahrin
stimmte einer möglichen Verlegung des Stolpersteines sofort zu – ebenso wie
ein in Israel lebender Verwandter in einem persönlichen Brief an
Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer. Einmal kam bereits eine halbe Stunde
nach der ersten E-Mail eine Antwort – von Nachkommen einer jüdischen
Familie, die in die USA geflohen war und sich über die Nachfrage aus der
alten Heimatstadt, aus der die Vorfahren vertrieben worden waren, sehr
gefreut hatten. Neue Kontakte sind zur Freude von Initiativenmitglied
Karl-Heinz Brauner auf diese Weise entstanden, die die jüdischen Bürger 70
Jahre nach Kriegsende wieder ein wenig mit ihrer alten Heimat verbunden
haben. Doch noch lange sind nicht alle Angehörigen der gut 30 jüdischen
Familien, die in Rosenheim um 1930 lebten, gefunden. Viele Nachfahren
emigrierten, ihre Spuren verloren sich in den USA, in Brasilien oder in der
Schweiz, berichtet Claudia Bultje-Herterich. Sie ist zwar auf hilfreiche
Datenbanken gestoßen, doch oft lassen sich über alte Rosenheimer Namen
verschollene Nachkommen, die einen anderen Namen tragen, nur noch schwer
ermitteln. Das ist jedoch notwendig, denn die vom Kölner Künstler Gunter
Demnig ins Leben gerufene Stolperstein-Bewegung, der sich die Rosenheimer
Initiative angeschlossen hat, hält sich an klare Regeln: Ein Stein wird nur
dann verlegt, wenn die Nachfahren, die ermittelt werden, diesem Schritt
zustimmen. Die 20 aktive Mitglieder umfassende Initiative hat sich außerdem
vorgenommen, das individuelle Gedenken am letzten freiwillig gewählten
Wohn-, Arbeits- oder Schulort auf alle Opfer des Nationalsozialismus zu
erweitern. Auch in der Region Rosenheim sind neben Bürgern jüdischen
Glaubens Gewerkschaftler, Kommunisten, Behinderte, Sinti und Roma sowie
Homosexuelle verfolgt, vertrieben, ermordet oder in den Tod getrieben
worden. Der DGB hat bereits angekündigt, die Patenschaft für fünf Steine zu
übernehmen – egal, für welche Opfergruppen sie verlegt werden.
Eine Geschichte hinter jedem Namen. Hinter jedem Namen verbirgt sich
eine Geschichte, die in Kurzfassung auf dem Stein und ausführlich in
Dokumentationen veröffentlicht werden soll. Geschichte vermitteln über
persönliche Geschichten: Das ist nach Überzeugung von Geschichtslehrer
Brauner der beste, weil nachhaltigste Weg der Vermittlung der Historie.
'Niemand kann sich heute den Massenmord an Millionen unschuldiger Menschen
wirklich vorstellen. Aber das Schicksal von Familien und Einzelpersonen, die
in unserer Nachbarschaft gelebt".
Link zum Artikel
|
| |
|
Juli 2018:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Niedernburg |
Artikel im
"Oberbayerischen Volksblatt" (ovb-online.de) vom 17. Juli 2018: "Zehn
Zentimeter gegen Unrecht
Prutting/Stephanskirchen – Als Nikola David, der Kantor der
Jüdisch-liberalen Gemeinde in München, gestern über den fünf eben verlegten
Stolpersteinen für die Familie Block aus Niedernburg in der Gemeinde
Prutting auf Hebräisch das Totengebet spricht, ist die Stimmung für die
Anwesenden nur noch schwer erträglich. Zu lebendig war in den vergangenen
Minuten das Schicksal von Fritz, Mirjam und ihren Kindern Elisabeth, Gertrud
und Arno geworden; nicht zuletzt deshalb, weil während der gestrigen
Verlegungsfeier Schülerinnen der Städtischen Mädchenrealschule Rosenheim aus
dem Tagebuch von Elisabeth Block vorgelesen haben, die dort bis 1938
Schülerin war. In einem der letzten Einträge spricht sie von ihrer
'entsetzlichen Angst um dieses kleine bisschen Leben'. Damit zeigt sich aber
ganz unmittelbar der Sinn der sogenannten Stolpersteine. Eigentlich sind sie
unscheinbar, kleine Steinwürfel von gerade einmal gut zehn Zentimetern
Kantenlänge, die bündig in den Boden eingelassen werden. Und doch
entfalteten sie von Anfang an große Wirkung, brachten etwas in Bewegung. Das
fing banal an, denn die Verlegung der Steine auf öffentlichem Grund musste
von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde genehmigt werden. Auch wenn die
Gemeinderäte in Stephanskirchen und Prutting keine Einwände hatten, sondern
schnell und fast einhellig für die Verlegung von Steinen für den
Stephanskirchener Johann Vogl und die Niedernburger Familie Block waren, so
kam doch auch hier eine Diskussion darüber auf, was Erinnerungskultur ist,
ob und welche Bedeutung sie haben soll oder vielleicht sogar haben muss. Für
den Initiator der Aktion, Dr. Thomas Nowotny von der Initiative
Erinnerungskultur, geht es genau darum: Unrecht und damit verbundenes Leid
vor Verdrängung und dem Vergessenwerden zu bewahren, indem man es in der
Diskussion hält. Seit er auf die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig
gestoßen ist, hat er das ideale Mittel dazu gefunden. Gunter Demnig übrigens
sagt, dass es ihm mit seinen Steinen nicht um einen Zwang zur Erinnerung
gehe, wie ihm Kritiker bisweilen unterstellen, sondern eher um ein Angebot:
'Stolpern über diese Steine tut man sowieso nur mit dem Herzen'. Damit wäre
das Erinnern in erster Linie eine Folge einer sehr noblen menschlichen
Regung, der Fähigkeit des Mitleidens; eine Eigenschaft, die vor allem Kinder
und Jugendliche noch ganz unverstellt haben. Deswegen waren nicht nur Gunter
Demnig, sondern auch Thomas Nowotny sehr dankbar für das Engagement der
Städtischen Realschule Rosenheim und auch der Mittelschule Stephanskirchen.
Dort hatten sich Mitglieder des Schulradios ganz intensiv mit der Person des
Stephanskircheners Johann Vogl auseinandergesetzt, der im
Konzentrationslager ermordet wurde, weil er ein aufrechter Charakter und der
Meinung war, Unrecht müsse – ungeachtet aller persönlicher Gefahren – auch
als solches benannt werden. Für Bürgermeister Rainer Auer ein Beispiel an
Zivilcourage eines Gemeindebürgers, das einfach nicht in Vergessenheit
geraten darf. Dass die Verlegung der Stolpersteine für die jüdische Familie
Block und für den aus der Kirche ausgetretenen Katholiken Johann Vogl
sozusagen gleichzeitig stattfand, ist für Auer ein wichtiges Signal. Nicht
nur die Juden wollte man im Dritten Reich ausrotten, sondern auch Schwule,
Lesben, Pfarrer, Sinti, Roma und Freigeister; kurzum alle, die nicht in das
eigene Bild vom 'guten Deutschen' passten. Alle Beteiligten der Aktion waren
sich einig, dass sich solches Unrecht niemals wiederholen darf. Tenor: Für
dessen Verhin derung müsse man mit vielen Mitteln kämpfen – und sei es nur
mit kleinen Stolpersteinen. Mit einer Gedenkstunde im Stephanskirchener
Rathaus wurde die Verlegung der Stolpersteine abgerundet."
Link zum Artikel |
| |
|
September
2019: Diskussion um
Stolpersteine und Denkmale in Rosenheim |
Artikel im "Oberbayerischen
Volksblatt"
vom 17. September 2019: "Lücken im Gedenken: Wie will Rosenheim mit
Opfern des Nationalsozialismus umgehen?
In der Erinnerung leben Menschen fort. Auch jene, deren Leben im
Nationalsozialismus als unwert galt. Die getötet wurden, weil sie den
gesellschaftlichen und politischen Idealen des Dritten Reichs nicht
entsprachen. Doch welche Form der Erinnerung ist die passende? Eine Frage,
die ein Bündnis in Rosenheim aufgreifen und diskutieren möchte – nachdem die
Idee der Stolpersteine in der Stadt bislang keine Zustimmung findet.
Rosenheim – 'Stolpersteine für Rosenheim' heißt das Büchlein, das
entstanden ist, um mit Texten und Bildern an die sechs Stolpersteine zu
erinnern, die der Künstler Gunter Demnig im vergangenen Jahr im Landkreis
Rosenheim gelegt hat. Die passenden Texte und Fotos haben die Mitglieder des
Historischen Vereins Rosenheim und die 'Initiative Erinnerungskultur –
Stolpersteine für Rosenheim' zusammengetragen.
Israelische (sc. Israelitische) Kultusgemeinde gegen
Stolpersteine. Sie sind es auch, die sich Gedanken darüber machen, wie
in der Stadt selbst der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden kann –
über die bereits bestehenden Formen hinaus. Denn seit sich die Stadt vor
einigen Jahren gegen das Konzept der Stolpersteine entschieden hat, klafft
nach Einschätzung der Initiatoren eine Lücke im individuellen Gedenken an
die Stadtbewohner, die während der Zeit des Nationalsozialismus zunächst
systematisch ausgegrenzt worden waren, dann, wenn sie konnten, flohen,
später verfolgt, deportiert und getötet wurden. Diese Lücke im öffentlichen
Gedenken könnten womöglich Stelen oder auch Erinnerungstafeln füllen, wie
sie in München seit dem vergangenen Jahr aufgestellt und angebracht werden.
Auf diese beiden Formen des Gedenkens hatte sich der Kulturausschuss der
Stadt verständigt, nachdem seit Jahren kontrovers über das Konzept der
Stolpersteine gestritten worden war. Nicht zuletzt die Israelische
Kultusgemeinde hatte sich wiederholt gegen die kleinen vergoldeten Steine im
Asphalt ausgesprochen.
Design-Entwurf eines Rosenheimer Professors. Die vom Münchner
Designer Kilian Stauss entworfenen Stelen sind rund 1,80 Meter hoch, aus
Edelstahl geformt und jeweils mit einer goldenen Hülse versehen. Die Tafeln
wiederum haben eine Höhe und Breite von etwa zwölf Zentimeter. Auf
vergoldetem Edelstahlblech finden sich je ein Text und ein Porträtbild zu
einem der Opfer. Sowohl die Tafeln als auch die Stelen hat Stauss entworfen.
Er ist in Rosenheim kein Unbekannter, lehrt als Professor für Interior
Design an der Fakultät für Innenarchitektur an der Hochschule. Mit ihm habe
man das Gespräch gesucht, sagt Karl-Heinz Brauner, Vorsitzender des
Historischen Vereins Rosenheim und zugleich Mitglied in der 'Initiative
Erinnerungskultur – Stolpersteine für Rosenheim'.
Die gesamte Familie Block deportiert und ermordet. In Folge sei die
Idee entstanden, beide Möglichkeiten für Rosenheim zu diskutieren. Und
zugleich noch einmal die Idee der Umbenennung der Rosenheimer
Mädchen-Realschule aufzugreifen. Ihr in Erinnerung an Elisabeth Block den
Namen 'Städtische Realschule für Mädchen Elisabeth Block' zu geben, hatte in
der Schulfamilie ebenfalls keine Zustimmung gefunden. Elisabeth Block war
dort in den 1930er-Jahren zur Schule gegangen. Sie war die älteste Tochter
von Mirjam und Fritz Block. Ein jüdisches Ehepaar, das in Niedenburg eine
Gärtnerei betrieb. Zur Familie gehörten zudem Elisabeths Geschwister Arno
und Gertrud. 1942 wurde die gesamte Familie deportiert und ermordet.
Erhalten aber blieb das Tagebuch von Elisabeth, das im Jahr 1993
veröffentlicht wurde. An das junge Mädchen, das nur 19 Jahre alt wurde,
erinnert zudem ein Fenster in der Rosenheimer St. Nikolauskirche.
Hoffnung auf parteiübergreifenden Antrag im Stadtrat. Ihre Geschichte
und das Nachdenken über Erinnerungsformen im öffentlichen Raum wollen die
Initiatoren nicht nur wieder aufgreifen, sondern miteinander verbinden. Im
Oktober sei eine Diskussionsrunde an der Schule geplant, sagt Brauner. Ein
Abend, an dem alle Beteiligten, vor allem die Jugendlichen, darüber sprechen
sollen, wie das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt
gestaltet werden kann. Am Ende, so hofft Brauner, könnte ein
parteiübergreifender Antrag der Stadtratsfraktionen stehen, in dem ein
Konzept für eine weitreichendere Erinnerungskultur formuliert ist. Das
Anliegen in die Hand nehmen und die Kommunikation mit den Stadträten anderer
Fraktionen auf den Weg bringen, das will Karl-Heinz Brauner gerne
übernehmen. Dann aber in seiner Funktion als Stadtrat der Grünen."
Link zum Artikel |
| |
|
März 2024:
Weitere Informationen zu
Schicksalen in der NS-Zeit werden gesucht |
Pressemitteilung der
Stadt Rosenheim vom 25. März 2024: "Aufruf: Gemeinsam an NS-Verfolgte
erinnern – Hilfe der Bevölkerung ist gefragt
Rosenheim. Seit einiger Zeit erinnern Gedenkzeichen in Form von
Möbiusbändern auf öffentlichen Flächen und 'Stolpersteine' auf Privatgrund
an das Schicksal von NS-Verfolgten. Egal welche Form das Mahnmal hat,
lebendig werden sie erst durch die Geschichten der Menschen. Ein Beispiel
hierfür ist das Schicksal der jüdischen Schülerin Elisabeth Block. Ihr Leben
ist bereits gut erforscht, doch über andere Schicksale ist nur wenig
bekannt. Es ist davon auszugehen, dass es Verfolgte in Rosenheim und
Umgebung gegeben haben muss, die komplett in Vergessenheit geraten sind, bei
denen mitunter nicht einmal der Name bekannt ist. Selbst die überlieferten
historischen Quellen und die darauf basierenden Untersuchungen erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deshalb möchte die Stadt Rosenheim,
gemeinsam mit der Initiative für Erinnerungskultur und Stolpersteine, mit
einem Aufruf zur Partizipation an die Erinnerungskultur einladen. Jede
Information über bislang unbekannte Opfer und Überlebende der NS-Verfolgung
in Rosenheim und Umgebung kann mitgeteilt werden. Denn damit kann das Wissen
über die lokale und regionale Geschichte des NS-Terrors erweitert und die
Erinnerung an Einzelschicksale aktiv gepflegt werden. Dr. Christian Höschler,
Leiter des Stadtarchivs: 'Wissen Sie, vielleicht auch mit Blick auf
Erzählungen aus der Generation ihrer Eltern oder Großeltern, von Menschen,
die in der NS-Zeit verfolgt wurden? Auch wenn nur wenige Details bekannt
sind – ein Name oder ein Verfolgungsgrund – jeder Hinweis ist wertvoll.'
Selbst Einzelinformationen können Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein,
die weiteres Wissen über individuelle Schicksale zutage fördern. 'Helfen Sie
mit, die Erinnerung an die Verfolgten und damit an die Geschichte der
NS-Verfolgung wach zu halten. Dies ist, auch und gerade in unserer heutigen
Zeit, eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder Beitrag zählt',
betont der Stadtarchivar. Wer sich erinnern kann oder über Informationen
verfügt und diese gerne mitteilen möchten, kann sich per E-Mail an
archiv@stadtarchiv.de oder telefonisch unter 08031 - 365 1439 melden."
Link zur Pressemitteilung |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 62-63. |
 | Rosenheim im Dritten Reich. Beiträge zur
Stadtgeschichte. Hrsg. vom Kulturamt der Stadt Rosenheim
1989. |
 |  Beitrag
von Jim G. Tobias in "Aufbau" vom 18. März 2004: "Das
vergessene Kinderlager von Rosenheim. Auf ein Leben im Kibbuz vorbereitet -
nach Kriegsende fanden 1.600 jüdische Kinder in der oberbayerischen Stadt
Rosenheim ein vorübergehendes Zuhause.." Beitrag
von Jim G. Tobias in "Aufbau" vom 18. März 2004: "Das
vergessene Kinderlager von Rosenheim. Auf ein Leben im Kibbuz vorbereitet -
nach Kriegsende fanden 1.600 jüdische Kinder in der oberbayerischen Stadt
Rosenheim ein vorübergehendes Zuhause.."
Link
zum Artikel im Archiv des "Aufbau"
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
diese Links sind noch nicht aktiviert
|