|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"
St. Moritz (Kanton
Graubünden, Schweiz)
Jüdische Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis um 1930 (bzw. bis
zur Gegenwart)
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte
in St. Moritz
In St. Moritz gab es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch
jüdische Kurgäste, bis Anfang der 1880er-Jahre allerdings keine Einrichtung,
in der eine rituelle Verpflegung möglich war. Eine solche gab es erst seit 1882,
als Josef Bermann aus Meran eine koschere Restauration eröffnete (siehe Anzeige unten). Konkreter Anlass hierzu war der
an Josef Bermann herangetragene Wunsch des Baron Willi von Rothschild, der nach
St. Moritz zur Kur wollte, doch nicht auf eine koschere Verpflegung verzichten
wollte. Zunächst eröffnete Bermann seine Restauration im bisherigen "Hotel
Zentral". 1886 verkaufte Bermann das "Hotel Zentral" und
erwarb die ehemalige Villa Gartmann Schaumann, aus der die Pension und später
das Hotel Edelweiss entstand (Eröffnung 1890). Das Hotel stand in der Via dal
Bagn 12.
In den folgenden Jahrzehnten war die Pension / Hotel Edelweiß
Mittelpunkt des jüdischen Lebens in St. Moritz. Josef Bermann hatte in ihm auch
eine Haussynagoge
eingerichtet.
Das Hotel Edelweiss wurde von der Familie Bermann über vier Generationen bis
zur Sommersaison 2010 geführt. In diesem Jahr ist die Familie Bermann nach
Israel ausgewandert.
Presseberichte aus den vergangenen Jahre:
- Artikel "Ein Kapitel St. Moritzer Hotelgeschichte geht zu
Ende".
In: "südostschweiz.ch" vom 4.12.2010: Link
zu diesem Artikel
- Pressemitteilung: Ein Kapitel St. Moritzer Hotelgeschichte
geht zu Ende.
In: "Die jüdische Zeitung.ch" vom 10. Dezember 2010
Link zu
diesem Artikel
- Peter Bollag: Nach dem Beten auf die Piste. Schweiz: Koschere
Winterferien in den Alpen sind nicht billig, aber beliebt.
In: "Jüdische Allgemeine" vom 7.2.2008 Link
zu diesem Artikel.
- Adam Wills: A Swiss Family Bind - No Hotel Heirs.
In: "JewishJournal.com vom 24.3.2005". Link
zu diesem Artikel.
- Nadine Kin: Hotel im biblischen Alter.
In: "Tachles.ch" vom 19.12.2003. Link
zu diesem (kostenpflichtigen) Artikel.
Hinweis auf einen Dokumentarfilm über das Hotel Edelweiß:
- Amit Breuer (Regie): Shacharit, Mincha, Maariuv. The Story of
the Edelweiss. 2003. Nähere
Informationen
| Filmbeschreibung: 1886 gründete Leopold Berman in St. Moritz das koschere Hotel Edelweiss. Schon zuvor hatte er sein Hotel Bellaria in Meran zu einem der ersten Häuser am Platz gemacht, als Pionier einer damals prosperierenden jüdischen Hotelkultur. Bis heute ist das Hotel Edelweiss in Familienbesitz. Amit Breuers Dokumentarfilm vereint die Geschichte des Hotels und der Familie mit einem Kaleidoskop jüdischer Orthodoxie in den Alpen – eine sehr persönliche Hommage an den Enkel des Gründers, Leopold Bermann junior, der noch heute das Hotel führt. Das Edelweiss ist immer noch ein Zentrum des jüdisch-orthodoxen Tourismus in Graubünden, auch wenn es längst nicht mehr das einzige koschere Hotel in den Bergen ist. Bettina Spoerri, Literaturwissenschaftlerin in Zürich, hat für die Ausstellung
'Hast Du meine Alpen gesehen?' die Geschichte der koscheren Hotels in Graubünden recherchiert und führt in die Geschichte dieser nicht ganz alltäglichen jüdischen Lebenswelt ein. Sie arbeitet als Redaktorin der Neuen Zürcher Zeitung (Film/Literatur/Theater) und als Dozentin. |
Berichte aus der
jüdischen Geschichte in St. Moritz
Josef Bermann aus Meran eröffnet eine Restauration in
St. Moritz (1882)
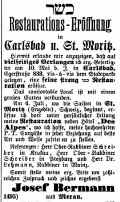 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1882: "Koscher. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1882: "Koscher.
Restaurations-Eröffnung in
Karlsbad und St. Moritz.
Hiermit erlaube mir anzuzeigen, dass auf vielseitiges Verlangen ich
erg. Gefertigter am 10. Mai dieses Jahres in Karlsbad, Egerstraße
833, vis-à-vis dem Stadtparke gelegen, eine feine streng koschere
Restauration eröffne.
Das komfortable Lokal ist mit einem großen Garten verbunden.
Am 4. Juli, wo die Saison in St. Moritz (Engadin), Schweiz,
beginnt, eröffne ich dort unter persönlicher Leitung meine Restauration
neben Hôtel 'Des Alpes', wo ich hoffe, meine hochgeehrten P.T.
Kurgäste in jeder Beziehung auf beste Art und Weise zufrieden zu
stellen.
Referenzen: Herr Ober-Rabbiner Schreiber in Krakau, Herr Ober-Rabbiner
Schreiber in Preßburg und Herr Dr. Lehmann, Rabbiner in Mainz.
Somit stelle meine ergebene Bitte um zahlreichen Zuspruch und zeichen
ergebenst
Josef Bermann aus Meran."
|
Anzeige der Pension Edelweiss (1906)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 11. Mai 1906: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 11. Mai 1906:
"St. Moritz-Bad. Ober-Engadin (Schweiz).
Koscher Pension Edelweiß Koscher. Neu und
elegant eingerichtete Zimmer.
Schöne Speisesäle und Veranda. Eröffnet am 5. Juni.
Besitzer: L. Bermann." |
Reisebrief aus der Schweiz - über St. Moritz (1909)
Anmerkung: die Reisebrief aus St. Moritz enthält nur wenige Angaben zum
"jüdischen Leben" in St. Moritz. Aus dem Grund, dass hier auch sehr
viele Rabbiner unterschiedlichen (konservativen und liberalen) Gepräges ihre
Kur beziehungsweise ihren Urlaub verbringen, denkt der Briefautor über die
geistliche Prägung des von einem Mosche-Geist geführten Gottesmannes
nach.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1909: "Reisebriefe
aus der Schweiz. III. St. Moritz bedeutet auch für die
jüdische Hautevolee das rauschende Paris, wo die Pracht und Eleganz der
Toiletten in glänzenden Soireen sich entfaltet. Zwar ist der reizende
Höhepunkt durch die Schienenstränge, welche raffinierte Technik auch
dorthin führte, für poetisch veranlagte Naturen etwas seines idyllischen
Taubers entkleidet worden. Die alte Postkutsche, welche den schwierigen,
kostspieligeren Höhenweg mit den langweiligen Postgäulen erst nach Stunden
zurücklegte, sorgte dafür, dass das die Eisenbahn bevölkernde Proletariat
fernblieb und ermöglichte hier die erwünschte Isolierung. So blieb es
der Mensch, auf dem Wege des Vergnügens, von Romantik umweht, möglichst
lange zu verweilen, und selbst Hindernisse erscheinen ihn dabei klein.
Gilt es aber, den Weg der Pflicht zu beschreiben, erwachsen auch kleine
Hindernisse zu unüberwindlicher Größe. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1909: "Reisebriefe
aus der Schweiz. III. St. Moritz bedeutet auch für die
jüdische Hautevolee das rauschende Paris, wo die Pracht und Eleganz der
Toiletten in glänzenden Soireen sich entfaltet. Zwar ist der reizende
Höhepunkt durch die Schienenstränge, welche raffinierte Technik auch
dorthin führte, für poetisch veranlagte Naturen etwas seines idyllischen
Taubers entkleidet worden. Die alte Postkutsche, welche den schwierigen,
kostspieligeren Höhenweg mit den langweiligen Postgäulen erst nach Stunden
zurücklegte, sorgte dafür, dass das die Eisenbahn bevölkernde Proletariat
fernblieb und ermöglichte hier die erwünschte Isolierung. So blieb es
der Mensch, auf dem Wege des Vergnügens, von Romantik umweht, möglichst
lange zu verweilen, und selbst Hindernisse erscheinen ihn dabei klein.
Gilt es aber, den Weg der Pflicht zu beschreiben, erwachsen auch kleine
Hindernisse zu unüberwindlicher Größe.
Die düstere, sonnenarme Zeit, welche diesmal ganz den Charakter der drei
Wochen trägt, lässt auch in ST. Moritz die sonst pünktlich und
regelmäßig eintreffenden Gäste bis zur Stunde noch vermissen. Ein nicht
kleines Kontingent stellen für gewöhnlich die geistigen und geistlichen
Führer unserer Gemeinden, die Rabbinen. Die nationale Trauerzeit der drei
Wochen genießt man am behaglichsten dort oben in der freien, würzigen
Luft der Berge, wo der gesunde Jodler Tischo-Beaf-Stimmung nicht aufkommen
lässt. Gar mancher von ihnen sieht auch gar nicht so sehr
erholungsbedürftig aus, wenigstens sehen wir auf dem Antlitz jene charakteristische,
wie Sonnenglanz leuchtende Inschrift 'sinne darüber bei Tag und Nacht'
nicht gerade hervorstechend eingegraben; die besagte Pflicht die, die 'wenn
du gehst auf deinem Weg' (5. Mose 6,7) einschließt, hat ja gegenüber
den Sorgen und Forderungen des Tages an Größe und Bedeutung
begreiflicherweise verloren. Dafür hat der Humor seine Geltung behauptet.
Jedes Mal, wenn ein gelungener Kalauer die Runde macht, erdröhnt der
Konversationssaal von einer Lachsalve. Auch routinierte Bergsteiger sind
unter ihnen, die ihre Kunst nicht nur in den Alpen praktizieren. Wenn es
sich darum handelt, eine von der 'bösen Orthodoxie' entsandte Berglawine
aus dem Wege zu räumen, beweisen unsere neologen Brüder Meisterschaft,
sie aus dem Wege zu räumen. Religiöse Gewissensskrupel sind in unserer
Zeit der Aufklärung ein überwundener Standpunkt. Wie das Luftschiff den
blauen Äther durchquert, so wissen sie jede Richtung einzuschlagen im
Luftkreis ihres jüdischen Denkens! Und das ist da der Jammer der ganzen
Zeit. Mit fürchterlicher Anklage trifft sie das Talmudwort, welches in
diesen Tagen ihr Herz verwunden und - aufrütteln müsste. 'Jerusalem
wurde nur deshalb zerstört, weil man einander nicht zurechtwies.'
Wer bei der table d'hote die Herren sich etwas genauer ansieht und an
ihren Diskussionen teilnimmt, der sieht wie in einem Spiegel das Bild der
Gemeinde, die ihrer Wirksamkeit anvertraut ist. Da gewahrt man
Physiognomien, die von der blitzenden Schneide des Rasiersäbels ihres
schönsten Bartrahmens entkleidet sind und infolgedessen ganz pastoral
anmuten, wie auch das Wirken und Handeln ganz pastoral und salbungsvoll
ist. Viele Worte, wenig Taten. In der Erbauung ihrer Schutzbefohlenen
leisten sie allerdings großes durch die Predigt. Wir bemerkten Herren,
die wir Generalleutnants die Kanzel beherrschen, befehlend und ihre
Getreuen mit scharfem Auge mustern; andere spielten ausgezeichnet, mit
wahrer Schauspielergewandtheit ihre Rolle, wenn die 'Seelenfeier'
angestimmt wird.
'Ja' sagt mein Nachbar bedeutungsvoll, 'diesen Mann sollten Sie bei der
Seelenfeier sehen. Das ganze Auditorium ist in Tränen
aufgelöst'.
'Ich habe mir die Sache auch angesehen', bemerke ich, 'aber ich könnte
nicht behaupten, dass ich von sonderlicher Wärme durchflutet worden
wäre. Ich lasse mich von großen Worten nicht bestechen. Wer sind diese
Herren, welche die Gräber zu sprengen und die Gestalten der
unvergesslichen Dahingeschiedenen herauf zu beschwüren suche? Auch ich
halte Haskarat Neschamot (gemeint das Kaddisch-Gebet) für eines
unserer innigsten und weihevollsten Gebete. Aber der geistige Führer der
Gemeinde, der sich gedrungen fühlt, diesen Weiheakt rednerisch zu
erklären, muss seinen Zuhörern sagen, dass das schönste Denkmal für
teure Dahingeschiedene die Erfüllung göttlicher Pflichtgebote
ist |
 dass dies für die Seelen eine Befriedigung ist, eine bis in die
uns verhüllte Welt reichende Labe und Erquickung ist. Aber da haben wir's
wieder: Wer andere überzeugen will, muss es selbst sein; er darf nicht in
schmeichlerischer Larve vor das Volk treten und selbst diejenigen mit dem
Mantel schonender Liebenswürdigkeit decken, welche öffentlich die
göttlichen Vorschriften gewissenlos missachten. Ewig vielsagend und
schön ist der letzte Wunsch des sterbenden Moscheh, der auf uns wirkte,
als sei er in gegenwärtiger Stunde uns gesagt worden: Möge doch der Allgütige
einen Mann über die Gemeinde setzen, einen ganzen Mann, der sie
aus- und einführt, damit die Gemeinde Gottes nicht umherirre wie eine
Herde, die keinen Hirten besitzt. Männer brauchen wir, die mit
Moscheh-Geist getränkt, an ihre Aufgabe herantreten, und die mit
unwandelbarer Liebe zu ihrem Volke sie zu erfüllen suchen. Die Liebe
zwischen Führer und Volk muss den Kontakt bilden, und überstrahlt muss
sie werden, wie es bei Moses war, von der Liebe zu seinem Schöpfer. Dann
wird es nicht mehr nötig sein, die jeweiligen wissenschaftlichen Tages-ergebmiese
der Ethik von der Tribüne herab mit oratorischem Glanze zu entfalten,
sondern es genügt, in das Meer des Talmud zu tauchen, um Perlen des Geistes
und Gemütes in reichster Fülle hervorzuholen."
dass dies für die Seelen eine Befriedigung ist, eine bis in die
uns verhüllte Welt reichende Labe und Erquickung ist. Aber da haben wir's
wieder: Wer andere überzeugen will, muss es selbst sein; er darf nicht in
schmeichlerischer Larve vor das Volk treten und selbst diejenigen mit dem
Mantel schonender Liebenswürdigkeit decken, welche öffentlich die
göttlichen Vorschriften gewissenlos missachten. Ewig vielsagend und
schön ist der letzte Wunsch des sterbenden Moscheh, der auf uns wirkte,
als sei er in gegenwärtiger Stunde uns gesagt worden: Möge doch der Allgütige
einen Mann über die Gemeinde setzen, einen ganzen Mann, der sie
aus- und einführt, damit die Gemeinde Gottes nicht umherirre wie eine
Herde, die keinen Hirten besitzt. Männer brauchen wir, die mit
Moscheh-Geist getränkt, an ihre Aufgabe herantreten, und die mit
unwandelbarer Liebe zu ihrem Volke sie zu erfüllen suchen. Die Liebe
zwischen Führer und Volk muss den Kontakt bilden, und überstrahlt muss
sie werden, wie es bei Moses war, von der Liebe zu seinem Schöpfer. Dann
wird es nicht mehr nötig sein, die jeweiligen wissenschaftlichen Tages-ergebmiese
der Ethik von der Tribüne herab mit oratorischem Glanze zu entfalten,
sondern es genügt, in das Meer des Talmud zu tauchen, um Perlen des Geistes
und Gemütes in reichster Fülle hervorzuholen." |
Brief aus der
Schweiz - aus dem winterlichen St. Moritz (1920)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Aus
den Graubündner Bergen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Aus
den Graubündner Bergen.
Auf fest gefrorenem Schnee die Wintersonne! Seit morgens 9 Uhr scheint sie
so warm, dass der Mantel dem Wanderer lästig fällt. Er legt sich in den
tiefen Schnee und lässt sich sonnen. Das Behagen, das er dabei empfindet
hier oben, in der reinen Luft, hoch über das schale Alltagsleben
hinausgehoben, ist unbeschreiblich. Bis gegen 3 Uhr kann man die
Wintersonne genießen, erst dann fängt es an, kalt zu werden.
Jeden Tag zieht es uns hinaus ins Freue. Uns? Das unzertrennliche deutsche
Kleeblatt. So nennt man uns schon seit dem Herbst, seitdem wir dem Minjan
in St. Moritz an den Jomim Nauroim (hohe Feiertage im Herbst) den
deutschen Stempel aufgedrückt, die Sucko (Laubhütte) in unserer
Art aufgeputzt und an den Freitagabenden unsere Semiraus (Melodien)
eingeführt haben. Damals waren wir noch zu Dreien. Wir wir im November zu
unserem vierten Mitgliede gekommen sind, das eben will ich heute
erzählen.
Sitzen wir da eines Mittags in der Nähe des Hahnensees an einer
Bergeshalde im Schnee, von zwei Felsen auf beiden Seiten verdeckt und von
den warmen Sonnenstrahlen geradezu durchglüht, um nach reichlichem
Mittagessen, das wir aus St. Moritz im Rucksacke mitgenommen hatten, zu
benschen. Meine Freunde hatten mir gerade 'Boruch scheochalnu mischelau'
geantwortet, als von der anderen Seite laut gerufen wurde 'Uwtuwau chojinu'.
Wir konnten kaum vor Neugierde das Ende des Tischgebetes erwarten. Warum
der Rufer nicht zu uns kam? Das sollten wir bald erfahren. Er hatte
sich beim Schneeschuhlaufen den Fuß ein wenig verstaucht und dazu noch
beim Ausruhen einen Krampf bekommen, der ihm das Erheben unmöglich
machte. Tatsächlich war das Angstgefühl das Hauptziel gewesen. Wir
nahmen uns natürlich seiner an und brachten ihn durch einen Schluck
Kognak und die Reste unseres Mahles bald wieder auf die
Beine.
Er aber ist der festen Überzeugung., dass seine unjüdische Lebensweise
ihn schon die Schatten des Todes hätte sehen lassen, und seitdem gehört
er voll und ganz zu uns. Er freut sich jetzt schon damit, dass uns nun die
Eröffnung der Wintersaison ein ständiges Minjan ermöglichen wird, und
er ist ernstlich bestrebt, sein ganzes Leben nach den Satzungen unserer
Heiligen Religion einzurichten." |
Bericht eines jüdischen Kurgastes aus St. Moritz
(1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925: "St.
Moritz. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925: "St.
Moritz.
Wer hoch gekommen ist, will immer noch höher hinaus und hinauf. Das ist
Gesetz im Leben unten, wie draußen in den bergen. Darum ist es
feststehende Sitte, dass, wenn jemand in Schuls drei Wochen lang genügend
gebadet, getrunken, gewacht und gewartet hat, auf der Rückfahrt für ein
paar Tage oder wenigstens Stunden mit der rhätischen Bahn über Bevers
noch 500 Meter weiter hinauf fährt, nach St. Moritz.
Im Grund sieht man in St. Moritz nicht viel mehr als 'unten' in Schuls.
Viele Berge, viele Frankfurter und Berliner. Aber hier ist alles höher,
die Berge, die Preise und auch die Berliner und Frankfurter. St. Moritz
ist im Gegensatz zu Schuls, das ein Heilbad ist und neun Monate im Jahre
zwischen den Bergen eingebettet seinen müden Winterschlag hält, ein
ausgesprochenes Luxusbad, mit allen Attributen und Kriterien eines
solchen, im Sommer und noch mehr im Winter, da der turmhohe Schnee alljährlich
neue Möglichkeiten des weißen Sportes eröffnet.
Jetzt aber spiegelt sich der Schnee der Höhen im schönsten Grün von
Wiese und Wasser. Man nimmt vom Bahnhof durch die Reihen Doppelspalier
bildender Hotelportiers links den Weg am ungemein lieblichen blauen See
entlang nach dem sogenannten Kurviertel. Rechts auf der Anhöhe liegt das
Dorf. Über bescheidene, rotbedachte Bauernhäuser ragt protziger Stuck
neuer Hotels und Sanatorien hinaus. Ein Autobus verbindet angeblich Dorf
und Kurpromenade. Er fährt aber, wann und wohin er will, als sähe die
Postdirektion ihre Aufgabe darin, für bessere Bewegung der Kurgäste und Touristen
zu sorgen. Wer beispielsweise vom Bahnhof zum Kurhaus fahren will, muss
erst den Berg zum Dorf hinaufklettern, bis zur Post wandern und dann -
warten. Heil dem Harrenden! Einmal wird das Vehikel erscheinen, sich in
Bewegung setzen und zu einem Preise, gegen den man in einer deutschen Stadt
einen ganzen Tag Gast der Straßenbahn sein kann, den Mann an das Ziel
bringen. Soviel nur zur Warnung.
Da wir uns nun links halten und den herrlichen Autobus nur von außen und
unten bewundern, sind wir in gut zwanzig Minuten zu den Sehenswürdigkeiten
des Höhenortes gelangt. Die erste, vielleicht bedeutendste, ist das
jüdische Hotel, genannt 'Edelweiß', dessen Fassade, wie übrigens
die meisten der so geheißenen Höhenblumen, weder edel noch weiß anmutet.
Ein altes Haus im Vergleich zu der strahlenden 'Viktoria' in Schuls. Aber
es birgt guten Geist, dieses Haus; verkörpert durch einen Hotelier, der,
ein Bild des Friedens und der Abgeklärtheit, in feierlichem langem
Schwarz auf seinem Sessel, die lange Pfeife im Munde, sitzt und von diesem
sicheren Port aus mit einer Ruhe und Festigkeit die großen täglichen
Schlachten der Hauptsaison leitet, die jedem Feldherrn Ehre machen würde.
Reklamationen, wenn solche bei Vater Bermann überhaupt möglich
wären, scheiterten schon am ruhigen Lächeln, mit der sie vom Sessel aus
entgegengenommen würden. 'Sie haben recht', ist der stereotype Satz, an
dem alles wie an einem Eisenpanzer zurückprallt. Dieser jüdische Wirt
könnte, im Garten unter einer mächtigen Linde oder Palme, so wie er da
in der Vorhalle mit der Pfeife im Munde sitzt, einem Rembrandt ein
herrliches Modell für 'Abraham, der unter dem Baume seine Gäste
bewirtet', abgeben. Es mag sein, dass die Rechnungen im Eschel-Hotel des
Abraham weniger üppig ausfielen. Aber so ist auch unser Bermann nicht. Er
hat Verständnis für die gute Nachbarschaft von Herz und Magen und
er |
 zählt
gern von den prominenten Persönlichkeiten, die hier und in Meran schon
seine Gäste waren. Sein Auge leuchtet, wenn ein schönes jüdisches Wort
an sein Ohr dringt. Ja, es soll sich schon ereignet haben, dass er von
einem Durchwanderer ein solch schönes Wort als Vollgeld in Zahlung nahm -
für ein gutes reichliches Abendessen. zählt
gern von den prominenten Persönlichkeiten, die hier und in Meran schon
seine Gäste waren. Sein Auge leuchtet, wenn ein schönes jüdisches Wort
an sein Ohr dringt. Ja, es soll sich schon ereignet haben, dass er von
einem Durchwanderer ein solch schönes Wort als Vollgeld in Zahlung nahm -
für ein gutes reichliches Abendessen.
Und eine zweite Sehenswürdigkeit von St. Moritz. In der schönen neuen
Straße zum Kurhaus leuchtete mir an einem Hause am Briefkasten ein bekannter
Name entgegen. Ich stieg hinauf und fand - einen alten Freund im
schönsten Dreiwochenbarte an dem ausgebreiteten Pergamente einer
Thorarolle schreibend. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, sich selbst mit
eigener Hand seine Thorarolle zu schreiben und benutzt den
Ferienaufenthalt auf 2.000 Meter Höhe dafür. Natürlich ist es ein Frankfurter.
Draußen leuchtet der See, Ein Regenbogen, von den Bergen kommend, legt
sich tief und quer über das blaugrüne Wasser. Rechts schimmert und
glitzert es von den weißen Spitzen herab. Von der Straße dringt der dröhnende
Schritt von Kurgästen und Touristen. Heimische Burschen im Sonntagswichs
mit kühner Pfauenfeder auf dem Hut singen. Vom Kurhause, wo vier oder
fünf Musikanten auf einer Tribüne Kurkapelle 'spielen', kommen die
wiegenden Töne einer dünnen Jazzmusik. Oben sitzen zwei Menschen und
forschen und grübeln mit Eifer danach - warum das eine Efron in der Thora
mit und das andere ohne Wow geschrieben wird.
Freilich gibt es noch andere Segenswürdigkeiten in St. Moritz außer dem
jüdischen Wirt und dem Frankfurter Liebhaber-Thoraschreiber. Ich habe
aber nur von respektvoller Ferne zu ihnen hinaufgeschaut, zu den weißen
Spitzen wie zu den dahinterschimmernden Gletschern, wiewohl Wege und Straßen
genug und auch Zahnradbahnen hier zu den höchsten Höhen hinaufführen.
Die Versuchung war groß. Allein noch gerade rechtzeitig fiel mit ein
schöner Satz ein, den ein östlicher Brüder auf der höchsten Bergspitze
in den Lettern und der Sprache seiner Heimat in das Album geschrieben hat.
'Horim u'Gwoaus, Viel Hauzaus Und wenig Hanoaus. ---'
Nachdem dieser Spruch schon geschrieben steht, hatte ich da oben nichts
mehr zu tun und fuhr noch am gleichen Abend ein paar hundert Meter tiefer
nach dem herrlichen Filisur hinunter, um am folgenden Tage mit dem
Frühzuge nach Davos zu gelangen." |
Zum Tod von Leopold Bermann (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1928: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1928:
"Leopold Bermann - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen.
Meran, 30. Januar (1928). Der Heimgang des wohl in den jüdischen
Kreisen der ganzen Welt bekannten Hoteliers von Meran und St. Moritz,
Leopold Bermann, dürfte bei all denen, die ihm im Leben näher getreten
sind, ein Gefühl persönlicher Teilnahme auslösen. Die Sonne, die von
diesem ehrwürdigen Greis ausstrahlte, die Liebenswürdigkeit, mit der er
jeden empfing und die väterliche Fürsorge, mit der er Alte und Junge gleichermaßen
betreute - wer könnte dies alles vergessen. Aus Ungarn stammend, jenem
Kreis, in dem unsere Tora fest verankert liegt, zog er mit seinen
Eltern Anfang der achtziger Jahre nach Meran, wo der Vater ein Hotel
eröffnete. Als im Jahre 1883 der Baron Willi von Rothschild - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - zur Kur nach St. Moritz
wollte, wo man koschere Verpflegung noch nicht kannte, ersuchte er Leopold
Bermann mit ihm zu reisen und für diese zu sorgen. Bermann folgte dieser
Aufforderung und gelegentlich dieses Aufenthaltes in St. Moritz erwarb er
auf Anraten des Barons von Rothschild das Haus, das als Hotel Edelweiß
heute überall bekannt ist. Dieses sowie das Hotel Bellaria in Meran
wusste er zu Heimstätten der Erholung zu machen, für arm und reich.
Manch einer speiste wochenlang an der Tafel mit, an dem er sich die Mizwe
(religiöse Weisung) von Gastfreundschaft im wahrsten Sinne
verdiente. Und in jedem dieser Häuser hatte er sich eine Synagoge
eingerichtet und mit der Liebe ausgestattet, die aus seiner tiefen Gottesfurcht
strömte. Dort stand er bis vor wenigen Jahren als Kantor und Vorleser
und als Schofarbläser und es war eine Freude, diesen damals schon
Siebzigjährigen zu hören und in seiner Andacht zu beobachten. Und
in seinen Mußestunden saß er über einem Sefer (Torarolle), sich
freuend, wenn einer seiner Gäste ihm Gesellschaft leistete oder gar mit
ihm disputierte. Nun ist er in Meran am 19. Tewet (= 12. Januar
1928) nach einigen Monaten schweren Leidens hinübergegangen in das ewige
Leben, die ehrwürdige Gattin, die ihm im Leben treu zur Seite stand
und drei Kinder zurücklassend. Möge Gott ihnen Trost sein und die
Kraft geben, den Geist des Heimgegangenen in seinen Häusern lebendig zu
erhalten. Seine Seele sei eingebunden im Bund des Lebens." |
 Ferner
wird uns aus Meran geschrieben: Ferner
wird uns aus Meran geschrieben:
Heute verschied hier nach langem mit Geduld und Vertrauen auf Gott
ertragenem schweren Leiden das Seniormitglied unserer Gemeinde und
Eigentümer der allerorts rühmlich bekannten Hotels Bellaria, Meran, und Edelweiß,
St. Moritz, Leopold Bermann, im Alter von 74 Jahren.
Der Verblichene leitete Jahrzehnte hindurch das von seinem Vater Josef
Bermann seligen Andenkens gegründete rituelle Hotel Starkenhof und
gründete später, vor ca. zwei Dezennien das Hotel Bellaria, welches
eines der vornehmsten Etablissements in seiner Art ist. - Sein schlichtes
Wesen, Zuvorkommenheit, wahre Frömmigkeit und bedeutendes jüdisches
Wissen verschafften ihm die Freundschaft aller, die mit ihm in Berührung
kamen.
Er leitete seine Institutionen, welche allen rituellen Verlangen Rechnung
tragen, in streng traditionellem jüdischen Sinne und wirkte auch selbst
in seinen eigenen Bethäusern als Vorbeter. Er hat auch zum Emporblühen
unserer jungen Kultusgemeinde, der einzigen im Alto Adige, eifrigst
beigetragen und ist stets Förderer aller jüdischen Bewegungen und
Institutionen, Unterstützer aller Bedürftigen gewesen, die niemals sein
Haus unbefriedigt verließen.
Schon schwer leidend, hat er die Leitung des Gottesdienstes stets besorgt
und sein Unternehmen in Bezug auf rituelles Gebaren gewissenhaft
beaufsichtigt.
Er hinterlässt eine tief gebeugte Familie, seine Gemahlin, die ihm
jederzeit in unermüdlicher Arbeit zur Seite stand, seinen Sohn, dem er
die Leitung des Unternehmens in seinem Sinne einschärfte und zwei
Töchter.
Wir alle, die sein Wesen und Wirken kannten, werden seiner stets in Ehre gedenken.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Werbung für St. Moritz, insbesondere das Hotel
Edelweiß und die Villa Heimat (1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Mai 1930: "St. Moritz, das einzige Bad in einer
Höhe von 1800 Meter im trockensten Teil des Alpengebietes, vereinigt mit
seinem strahlenreichen Alpenklima die heilsamen Wirkungen seiner drei
natürlichen kohlesauren Stahlbäder. Unter den modern und bequem
eingerichteten Hotels ist besonders zu nennen das Hotel Edelweiß
mit der sehr schön und ruhig gelegenen Dependance Villa Heimat.
Das Hotel Edelweiß wird nach gründlichen Renovierungsarbeiten und einer
Vergrößerung der Gesellschaftsräume am 12. Juni wieder eröffnet. Neben
seiner überaus günstigen Lage in der Nähe der Wälder, des Sees und der
Bäder und seiner rituellen Küche besitzt es auch sonst alle Mittel und
Annehmlichkeiten, um eine sehr empfehlenswerte Erholungsstätte zu
sein." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Mai 1930: "St. Moritz, das einzige Bad in einer
Höhe von 1800 Meter im trockensten Teil des Alpengebietes, vereinigt mit
seinem strahlenreichen Alpenklima die heilsamen Wirkungen seiner drei
natürlichen kohlesauren Stahlbäder. Unter den modern und bequem
eingerichteten Hotels ist besonders zu nennen das Hotel Edelweiß
mit der sehr schön und ruhig gelegenen Dependance Villa Heimat.
Das Hotel Edelweiß wird nach gründlichen Renovierungsarbeiten und einer
Vergrößerung der Gesellschaftsräume am 12. Juni wieder eröffnet. Neben
seiner überaus günstigen Lage in der Nähe der Wälder, des Sees und der
Bäder und seiner rituellen Küche besitzt es auch sonst alle Mittel und
Annehmlichkeiten, um eine sehr empfehlenswerte Erholungsstätte zu
sein." |
Weitere
jüdische Einrichtungen in St. Moritz und Umgebung
Anzeige des "Hochalpinen Jüdischen Kinderheimes und
Internates Celerina bei St. Moritz (1934)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. April 1934: "Schwester Eva Lewenstein. Leiterin des Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. April 1934: "Schwester Eva Lewenstein. Leiterin des
Hochalpinen Jüdischen Kinderheimes und Internates
Celerina bei St. Moritz. 1750 M.ü.M.
ist ab Sonntag den 29. April bei Dr. Ernst Freimann Frankfurt am Main,
Friedberger Anlage 13, Tel. 47715 zu erreichen. Ganzjährig geöffnet.
Schulunterricht auch nach Heimatpensum. Kindertransporte ab
Deutschland." |
Fotos
(Quelle: o.g. Presseartikel in "südostschweiz.ch")
| Das "Hotel Edelweiss"
in St. Moritz |
 |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Siehe Presseartikel oben |

zur ersten Synagoge
|