|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Drove (Gemeinde
Kreuzau, Kreis Düren)
Jüdischer Friedhof
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Siehe Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_Drove
Zur Geschichte des Friedhofes
Der jüdische Friedhof in Drove wurde spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
belegt. Vermutlich ist er jedoch älter. 1852 ließ die Drover
Synagogengemeinde den in der damals sogenannten Flur "Judendriesch"
gelegenen Friedhof neu einfrieden. Auch die in Kreuzau und Nideggen verstorbenen
jüdischen Personen wurden hier beigesetzt. Der Friedhof wurde zuletzt 1941 belegt (letzte Beisetzung
von Gustav Roer am 4. Juni
1941).
Auf dem Friedhof sind etwa 60 Grabsteine erhalten. Die Gesamtzahl der
Beigesetzten ist höher. In dem 1910 angelegten Drover "Lagerbuch über die
Grabstätten und Begräbnisse des israelitischen Kirchhofes zu Drove"
(Archiv der Gemeinde Kreuzau) wurden seit 1910 51 Beerdigungen eingetragen; 19
Beerdigungen aus der Zeit zwischen 1889 und 1910 wurden nachgetragen. Am 27.
Dezember 1905 wurde der Begräbnisplatz in das Grundbuch von Drove eingetragen
(Eigentümerin: Synagogengemeinde Düren).
In der NS-Zeit kam der Friedhof für einen Betrag von 150 Reichsmark an
die Ortsgemeinde Drove. Damals bestand das Friedhofsgrundstück aus dem
eigentlichen Begräbnisplatz und einer kleinen Ackerparzelle. Zwischen 1938 und
1945 wurden zahlreiche Grabsteine gewaltsam beziehungsweise durch
Kriegseinwirkungen beschädigt oder zerstört. 1953 wurde der Friedhof
geschändet.
Im September 1962 wurde ein
2,50 m hohes Mahnmal aufgestellt mit der Inschrift: "Für die Opfer des
Nationalsozialismus". Das Mahnmal wurde durch Anton Egloff (Kunstakademie
Düsseldorf) angefertigt. Der Friedhof steht in der Denkmalliste der Gemeinde
(Flur 4 Nr. 29/1).
Heinrich Böll beschreibt den
jüdischen Friedhof in Drove (1984)
Aus "Die Juden von Drove" aus Heinrich Böll: Ein- und
Zusprüche. Schriften, Reden und Prosa 1981-1983.
Kölner Ausgabe Bd. 22: 1979-1983 Hrsg. von Jochen Schubert © 2007, Verlag
Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG Köln.
Der Sonderdruck unten wurde herausgegeben von der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V., Berlin, als Jahresgabe für ihre Förderinnen und
Förderer (o.J.).
Für das Abdruckrecht auf dieser Internetseite liegt die Genehmigung
des Verlages Kiepenheuer & Witsch vor; eine Übernahme ist nur mit
Verlagsgenehmigung möglich. |
 S. 4-5 im o.g. Sonderdruck: "Der Judenfriedhof von Drove ist wohlerhalten; er wird von der Gemeinde gepflegt, das Eingangstor ist durch ein Vorhängeschloss gesichert. Er liegt außerhalb des Dorfes am Rand einer idyllischen Mulde zwischen Wald und Feldern. Der
Bach Drove, der durch diese Mulde herankommt, gab dem Ort den Namen. Seitdem der Straßenverkehr von Kreuzau über Nideggen, Heimbach, Schleiden in die Eifel hinein über eine Umgehungsstraße führt, ist es
ruhiger dort, fast ruhig. Die letzte Beerdigung auf dem Judenfriedhof in
Drove fand im Jahr 1940 statt: Jetta Leiser, das Alter ist nicht genannt.
S. 4-5 im o.g. Sonderdruck: "Der Judenfriedhof von Drove ist wohlerhalten; er wird von der Gemeinde gepflegt, das Eingangstor ist durch ein Vorhängeschloss gesichert. Er liegt außerhalb des Dorfes am Rand einer idyllischen Mulde zwischen Wald und Feldern. Der
Bach Drove, der durch diese Mulde herankommt, gab dem Ort den Namen. Seitdem der Straßenverkehr von Kreuzau über Nideggen, Heimbach, Schleiden in die Eifel hinein über eine Umgehungsstraße führt, ist es
ruhiger dort, fast ruhig. Die letzte Beerdigung auf dem Judenfriedhof in
Drove fand im Jahr 1940 statt: Jetta Leiser, das Alter ist nicht genannt.
Es wird wohl keine jüdische Beerdigung in Drove mehr stattfinden. Einmal im Jahr kommt eine Überlebende aus England und besuchte das Grab der Familie Dahl-Pollack. Ihr Vater, Robert Dahl, war ein beliebter Mitbürger in
Drove, Vorsitzender und Förderer des Sportvereins 'Columbia'. 1935, als er starb, war er 52 Jahre alt, Kriegsteilnehmer 1914-18. An seiner Beerdigung
nahm noch das ganze Dorf teil, obwohl die Teilnahme verboten war. Integration und Normalität lassen sich wohl kaum besser ausdrücken! Das ganze Dorf verehrte Robert Dahl. Kein Sportler im Dorf, dem er nicht zur Anschaffung seiner Kluft beigetragen und nach Fußballspielen mehrere Bier spendiert hatte. An der Beerdigung nahmen auch
die Drover teil, die schon in der SA waren. Sie wurden registriert, bestraft, einige in Ausbildungslager ins ferne Pommern beordert.
Ich stelle mir vor das ein Junge in Drove, 1983 geboren, im Jahr 2000 17 Jahre alt, am Gedenkstein für die jüdischen Mitbürger stutzig wird, nachzudenken beginnt, den so romantisch stillen Judenfriedhof entdeckt; vielleicht ist er einer, der wissen möchte, wo erlebt, wissen möchte, was alles im Dorf und ums Dorf herum geschehen ist. Geschichte also beginnt ihn zu interessieren, und er beginnt zu fragen und nachzuforschen. Wer war das, warum wohnen sie nicht mehr hier,
wo sind sie geblieben, die Juden? Israelis, die mag er kennen. Waren die etwa hier, hatten eine Kolonie hier oder waren gar als Besatzung hier? Wenn der Junge zu fragen beginnt, wird kaum noch jemand leben, der noch einen
Drover Juden gekannt hat, und doch kannte hier, wie in den Dörfern üblich, jeder jeden. Auf diesem idyllisch gelegenen, im Jahr 2000 wahrscheinlich romantisch versunkenen Friedhof kann der Junge 59 Gräber zählen. So wenige Juden können das also nicht gewesen sein. Wo sind sie geblieben? War da eine Art Rattenfänger am Werk, hat sie betört und verzaubert, weggeführt, und man hat nie wieder von ihnen gehört?
Die meisten Gräber auf dem Judenfriedhof von Drove sind in gutem Zustand, sechs tragen hebräische Inschriften,
an sieben sind die Inschriften ausgekratzt, an einem verwittert, von einem Grabstein steht nur noch der Sockel. Das rostige Vorhängeschloss wäre leicht zu
knacken, noch leichter wäre durch das gelichtete Gebüsch, das den Friedhof umgrenzt, einzudringen. Kaum anzunehmen, dass ein
Drover versucht hätte, diese Gräber zu schänden. Gräber schänden? Wird der Junge je erfahren, was das bedeutet, und was es bedeutet, dass
sich einer in eine bedenkliche, wenn nicht gar gefährliche Situation begibt, der an der Beerdigung eines beliebten Mitbürgers teilnimmt? Möglich, dass die beiden über 80-jährigen, der ehemalige Schuldirektor Nolden und der Architekt Richter, im Jahr 2000 noch leben und es dem Jungen erzählen. Möglich auch, dass die dann fast 100-jährige, energische und herzliche, direkte Frau Klinkenberg noch lebt, die dem Jungen erzählen könnte,
wer die Juden waren, wie sie lebten und was mit ihnen geschehen ist. Alle werden bezeugen, was auch die überlebenden Jungen aus den Nachbargemeinden bezeugen, die zum Gottesdienst in die Synagoge nach
Drove ginge: Das Dorf Drove war nicht judenfeindlich..." |
| |
| Epitaphien auf dem jüdischen
Friedhof Drove |
1 Ludwig Treu, Drove 1857-1923
2 Frau Ludwig Treu geb. Imdorf, Drova 1860-1924 (Mutter)
3 Josef Treu, Drove 1826-1901
4 Frau Josef Treu geb. Henriette Pollack 1824-1896
5 Hermann Leiser von Kerpen 1818-1892 Drove
6 Frau Hermann Leiser geb. Tauba Roer, Drove 1814-1886
7 Ester Leiser, Drove 1855-1937
8 Lazarus Leiser zu Drove 1853-1899
9 Frau Lazarus Leiser geb. Julia Kaufmann zu Drove 1857-1934
10 Sophie Leiser geb. Herz 1860-1938
11 Jutta Leiser, gest. 1940 Drove
12 Frau Isaac Kaufmann geb. Rosette Roer, Drove 1809-1892
13 Bernhard Kaufmann 1803-1889
14 Simon Kaufmann 1832-1917
15 Abraham Kaufmann 1847-1928
16 Leopold Kaufmann 1843-1919
17 Hermann Kaufmann zu Drove 1853-1911
18 Siegfried Kaufmann 1880-1894
19 Sara Roer, starb den 4.8.1868
20 Frau Helene Roer geb. Vohsen 1818-1888 |
21 Josef Roer 1844-1930
22 Sibilla Roer geb. Wolf 1853-1932
23 Leopold Roer in Kreuzau 1854-1938 und
Julia geb. Kaufmann aus Schiefbahn
1868-1932
24 Sara Roer 1863-1921
25 Emil Roer 1884-1925
26 Jonas Roer, starb 38-jährig
27 Karl Daniel 1843-1921 (Gatte, Vater)
28 Josef Pollack 1834-1913
29 Helene Pollack geb. Imdorf
30 Moses Pollack, Drove 1850-1932 und
Eva Leiser, Drove 1831-1926
31 Helen Imdorf 1861-1928
32 Philipp Levy zu Kreuzau 1863-1924 und
Rosalie Kaufmann
33 Robert Dahl aus Geilenkirchen 1883-1935
34 Dina de Vries geb. Kamp 1834-1910
35 Bernhard de Vries 1874-1935
36 Frau Isaac Kahn gb Treu 1865-1924 (Tante)
37 David Schlächter zu Nideggen 1842-1931 |
38 Frau David Schlächter geb. Levy 1845-1916
(Mutter)
39 Emma Schlächter, Nideggen 1877-1936
40 Salomon Kratz zu Nideggen 1842-1923
41 Regina Kratz geb. Schlächter zu Nideggen 1842-1920 (Mutter)
42 Karl Kratz, Nideggen 1888-1931 (ledig)
43 Fräulein Julia Kratz, Nideggen 1855-1928
44-50 hebräische Inschriften
51 verwittert
52 nur noch Sockel erhalten
53-59 alle Inschriften sind verkratzt
nachträglich Grabsteine erstellt (nicht bei Schulte genannt):
60 Gustav Roer (1856-1941)
61 Simon Carl (1865-1940)
62 Ludwig Hirschberg (1923)
Quelle: Klaus H.S. Schulte: Dokumentation zur Geschichte der Juden am
linken Niederrhein seit dem 17. Jahrhundert. Düsseldorf 1972 |
| |
Lage des Friedhofes
Der Friedhof liegt zwischen Drove und Thum an der Landesstraße 250 am
Bruchberg.
Fotos
(Fotos von 2009 von Dieter Peters, Aachen)
 |
 |
 |
Das Eingangstor
mit dem von Heinrich Böll
beschriebenen Vorhängeschloss |
Teilansicht des
Friedhofes
mit neueren Gräbern (rechts) |
Teilansicht
des Friedhofes |
| |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Grabstein für
Sara Roer gest. 1868 (Nr. 19) |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Verwitterte
- überwiegend hebräische - Grabsteine / Inschriftenplatten |
|
| |
|
|
 |
 |
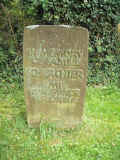 |
| Grabstein
verwittert - mit "Schild Davids" (Davidstern) |
Gedenkstein
links "In Memory of Familie Schlächter: Emil, Kunegunde,
Veronika" |
| |
|
|
 |
 |
 |
"Zum Gedenken
an Norbert Kratz *10.7.1887
Seine Gattin Emma Kratz geb. Moses * 15.6.1892 und
Tochter Ingeburg Kraft * 25.12.1924.
Sie wurden 1942 ermordet, |
"In
liebevoller Erinnerung an Alexander Daniel
Klara Daniel geb. Scheuer. Ums Leben gekommen
in Polen 1942. Die Kinder und Enkelkinder."
|
Gedenkstein
"Für die Opfer des Nationalsozialismus"
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Gedenkstein
für die Opfer des Nationalsozialismus, aufgestellt von der Gemeinde Drove
1962, mit Menora (Foto rechts). Der Gedenkstein wird auch im Text von
Heinrich Böll beschrieben. |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein des 1935
unter großer Anteilnahme
beigesetzten Robert Dahl (1883-1935) |
Grabstein für
Gustav Roer (1856 - 1941 in Drove,
letzte Beisetzung am 1.6.1941, Nr. 60) |
Grabstein für
Moses Pollack, Drove (1850-1932)
und Eva geb. Leiser (1831-1926; Nr.
30) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein für
Jutta Leiser
(gest. 1940; Nr. 11)
|
Grabstein für Simon
Carl (1865-1940) mit Gedenkinschrift
für die in der NS-Zeit ermordeten Berta Carl,
Johanna und Hermann Leiser mit Edith (Nr. 61) |
Grabstein für
Julie Roer geb. Kaufmann
(1868-1932) und Leopold Roer
(1854-1938, Nr. 27) |
| |
|
|
 |
 |
 |
Grabstein für
Sibilla Roer geb. Wolf
(1853-1932, Nr. 22)
|
Grabstein für
David Schlächter
(1842-1931, Nr. 37)
|
Grabstein für
Ludwig Hirschberg (gest. Dez. 1923, Nr. 62)
mit Gedenkinschrift für Ida Hirschberg geb. Kaufmann
(umgekommen in Polen 1942) |
| |
|
|
 |
 |
|
Grabstein für
Abraham Kaufmann
(1847-1928, Nr. 15) |
Grabstein für
Karl Daniel
(1843-1921, Nr. 27) |
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
diese Links sind noch nicht aktiviert
|