|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Osterberg (Landkreis Neu-Ulm)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Osterberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1896. Ihre Entstehung geht
in die Zeit um 1800 zurück.
Bereits im 16./17. Jahrhundert waren mindestens zwei
jüdische Familien am Ort. Erstmals werden 1524 Juden am Ort genannt.
Weitere Nennungen liegen aus dem 16. Jahrhundert bis 1574 vor.
Im Jahre 1614 gab Samuel Friedrich Brenz (Name erst nach Taufe),
späterer höchgräflicher Diener zu
Oettingen, geboren aus einer der jüdischen Familien in Osterberg als
Jud Löw, getauft in Feuchtwangen
1599 mit Frau Oedelein und zwei Kindern, eine Schrift unter dem Titel heraus: ‚Jüdischer
abgestreifter Schlangenbalg’, worin er seine früheren Glaubensgenossen und
ihre Religionsschriften von der schändlichsten Seite darstellte. Salomon Zebi (Zvi,
Hirsch) in Aufhausen nahm den literarischen Kampf mit ihm auf (weiteres auf der Seite zu
Aufhausen).
1802 beschloss der regierende Herr der Herrschaften
Osterberg, Weiler und Bühl, Reichsfreiherr Anselm, in einem Bereich südlich
des Marktfleckens Osterberg die Ansiedlung von jüdischen Familien zu erlauben.
Die jüdischen Familien bauten sich hier im Bereich von drei
"Judengassen" (heute heißen alle drei Gassen "Judengasse")
ihre Häuser, eine Synagoge und ein Schulhaus. Gleichfalls wurde ein Friedhof
angelegt. Zur Besorgung der religiösen
Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schächter tätig war. Bei anstehenden Neubesetzungen war die Stelle immer wieder
ausgeschrieben. Zwei Ausschreibungstexte aus den Jahren 1862 und 1871 liegen vor
(siehe unten). 1867 wird ein Lehrer Bloch genannt (Israelit 15.5.1867),
1888 Lehrer M. Kahn (Statistisches Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen
Gemeindebundes 1888 S. 37).
1811/12 wurden 111 jüdische
Einwohner in Osterberg gezählt (19 % der Einwohnerschaft). 1811 wird
"Löb, Handelsjude von Osterberg" zusammen mit den Handelsjuden März und Gerstle
von Fellheim auf dem Markt in Salzburg genannt.
Um 1835/40 lebten in den Häusern im Bereich der Judengasse(n) folgende Familien
(nach heutiger Anschrift der Häuser, oft wohnten je in Häuserhälften zwei
Familien; einige Familien lebten in nicht mehr bestehenden Häusern wie Israel
Ullmann, Handelsjude):
Hauptstraße 19: Pragers Kinder
Hauptstraße 23 mit 3 Häusern: Isaak Behr (Musikant), Abraham Einstein, Samson
Kahn (Metzger), David Schwarz (Handelsjude), Leopold Einstein (Handelsjude)
Hauptstraße 25: Isaak Bacharach (Lohnbäcker) und Samuel Bacharach
(Handelsjude)
Hauptstraße 27: Samson Uhlmann (Roßhändler)
Judengasse 3: Isaak Ullmann (Viehhändler) sowie Samuel Weil (Handelsjude)
Judengasse 4: Witwe Minetta Lengsfelder sowie Heinrich Rößnitz, Sohn des Judas
Jonas
Judengasse 5: Samuel Weil (Handelsjude)
Judengasse 6: Jakob Guggenheimer sowie Samuel Guggenheimer
Judengasse 7: Nathan Laupheimer (Handelsjude)
Judengasse 8: Abraham Steppacher (Lederhändler)
Judengasse 9: Michael Gumper
Judengasse 11: Benjamin Kronheimer (Handelsjude)
Judengasse 12: Isaak Harburger sowie Regina Laupheimer
Judengasse 13: Lazarus Guggenheimer (Viehhänder) sowie Jonas Weil (Handelsjude)
Judengasse 17: Jakob Wolf sowie Moses Bacharach (Schuhmacher)
Judengasse 21: Marx Hanauer (Handelsjude)
Judengasse 22 mit 2 Häusern: Salomon Guggenheimers Relikten sowie Moses
Binswanger (Handelsjude) und Samon Bacharach (Handelsjude)
Judengasse 24: Israelitisches Schulhaus.
1857 wurden in der
jüdischen Schule noch 26 Schüler unterrichtet. Die jüdischen Gemeinden
Osterberg und Altenstadt bildeten ein gemeinsames Rabbinat. Von 1837 an wirkte
Rabbiner Mayer s.A., dann Rabbiner Schwab s.A.; nach dessen Tod wurde Osterberg
dem Rabbinat Augsburg angeschlossen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung (Memmingen,
Augsburg) schnell zurück. 1881 wird als Gemeindevorsteher J. Kahn genannt. 1895
waren es noch elf jüdische Einwohner (in drei Familien). Im Jahr darauf - 1896
- löste sich die Gemeinde auf. Die letzte
jüdische Familie war Familie Liebmann Guggenheimer. Guggenheimer war auch der
letzte jüdische Gemeindevorsteher.
Weitere Angaben zur Geschichte siehe unten im Artikel
von Lehrer Hermann Rose.
Aus der
Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und
Schochet 1862 / 1871
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Dezember 1862:
"Die Israelitische Kultusverwaltung Osterberg, Bezirksgericht
Illertissen in Bayern, sucht einen Schächter (Schochet uBodek =
Schächter und Fleischbeschauer), der sich zugleich als Privatlehrer
eignet, auch in der französischen und englischen Sprache - nötigenfalls
in einer dieser Sprachen - Unterricht erteilen kann; und wird
hauptsächlich auf Religiosität und soliden Charakter gesehen. -
Demselben wird nebst freier Kost und Logis jährlich 150 Gulden
zugesichert. Bewerber um diese Stelle, wollen ihre Gesuche mit
Qualifikationsnoten und Zeugnissen portofrei anher einsenden. Osterberg,
den 6. November 1862. Die israelitische Kultusverwaltung. Der Vorstand:
J.B. Guggenheimer, Jacob Binswanger, Wolf Springer". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Dezember 1862:
"Die Israelitische Kultusverwaltung Osterberg, Bezirksgericht
Illertissen in Bayern, sucht einen Schächter (Schochet uBodek =
Schächter und Fleischbeschauer), der sich zugleich als Privatlehrer
eignet, auch in der französischen und englischen Sprache - nötigenfalls
in einer dieser Sprachen - Unterricht erteilen kann; und wird
hauptsächlich auf Religiosität und soliden Charakter gesehen. -
Demselben wird nebst freier Kost und Logis jährlich 150 Gulden
zugesichert. Bewerber um diese Stelle, wollen ihre Gesuche mit
Qualifikationsnoten und Zeugnissen portofrei anher einsenden. Osterberg,
den 6. November 1862. Die israelitische Kultusverwaltung. Der Vorstand:
J.B. Guggenheimer, Jacob Binswanger, Wolf Springer". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1871:
"In der israelitischen Gemeinde Osterberg an der Illerbahn, Bayern,
wird ein Elementar-, Religionslehrer und Kantor mit einem jährlichen
Gehalt von Gulden 400, freier Wohnung und Schulholz gesucht. Könnte
derselbe auch die Schächterstelle (Schochet) versehen, so würde sich
durch den Naturalbezug des Schächtens der Gehalt wenigstens um Gulden 100
erhöhen. Hiezu Befähigte wollen sich mit Franco-Einsendung ihrer
Zeugnisse, sowie Angabe des Alters und Familienstandes an die hiesige
Kultusverwaltung wenden. Eintritt könnte schon nächsten Monat erfolgen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1871:
"In der israelitischen Gemeinde Osterberg an der Illerbahn, Bayern,
wird ein Elementar-, Religionslehrer und Kantor mit einem jährlichen
Gehalt von Gulden 400, freier Wohnung und Schulholz gesucht. Könnte
derselbe auch die Schächterstelle (Schochet) versehen, so würde sich
durch den Naturalbezug des Schächtens der Gehalt wenigstens um Gulden 100
erhöhen. Hiezu Befähigte wollen sich mit Franco-Einsendung ihrer
Zeugnisse, sowie Angabe des Alters und Familienstandes an die hiesige
Kultusverwaltung wenden. Eintritt könnte schon nächsten Monat erfolgen.
Osterberg, den 14. April 1871. Die Vorstände." |
Über
die Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg (Artikel von Lehrer Hermann
Rose, 1932)
 1. In der
"Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" schrieb der jüdische Lehrer Hermann Rose am 1.12.1932 einen
kurzen Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg: 1. In der
"Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" schrieb der jüdische Lehrer Hermann Rose am 1.12.1932 einen
kurzen Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Osterberg:
"Altenstadt in Schwaben. Über die
frühere jüdische Gemeinde Osterberg schreibt uns Herr Hauptlehrer Rose
in Altenstadt in Schwaben: Zu den einstigen, jetzt aber aufgelösten jüdischen
schwäbischen Landgemeinden gehört auch das von hier (sc. Altenstadt) nur 1 1/4
Wegstunden entfernt gelegene Osterberg. Das Alter dieser jüdischen Gemeinde ist
nicht bedeutend. Wohl wird schon in Miedels 'Geschichte der Juden von Memmingen'
im Jahre 1550 ein Jude namens Michel von Osterberg erwähnt, doch ist erst 1802
die Entstehung einer Gemeinde nachweisbar. Damals entschloss sich der
Reichsfreiherr Anselm von Osterberg unterhalb des gleichnamigen Marktfleckens
'eine Ortschaft anzulegen und darin Juden zu etablieren und in Schutz zu
nehmen', Es sollten bis zu 30 Judenehen Aufnahme finden, die aber bis 1811 schon
auf 39 angewachsen waren. Die aufgenommenen Familien kamen aus verschiedenen
Gemeinden, darunter aus den Nachbargemeinden Altenstadt und Fellheim und dem
entfernteren Deggingen (sc. Mönchsdeggingen), welches auch längst als Gemeinde
aufgehört hat. Nach wenigen Jahrzehnten hatte sich ein blühendes jüdisches
Gemeinwesen mit eigener Volksschule entwickelt, das mit der hiesigen jüdischen Gemeinde
zusammen bis 1870 ein Distriktsrabbinat bildete. Doch schon ab 1862 verzogen die
ersten Juden von Osterberg nach dem nahegelegenen Memmingen und mit dem Eintritt
der vollen Freizügigkeit, da der Ort vom Verkehr zu sehr abgelegen war, schmolz
die Gemeinde mehr und mehr zusammen, bis 1905 der letzte israelitische Bürger
zu Grabe getragen wurde, nachdem schon 1896 die Vereinigung mit Altenstadt
stattgefunden hatte. Die Synagoge war verkauft und abgebrochen worden. Der am
Hügelabhang nahe am Ort gelegene Friedhof wurde von der hiesigen Gemeinde in
Obhut genommen.
Über den Friedhof aber war bei Gründung der Osterberger Gemeinde folgender
Punkt im Judenschutzbrief enthalten: 'Ihre Toten dürfen sie auf einem
unentgeltlich anzuweisenden, 40 Quadratschuh großen Platz begraben, den sie
einzäunen müssen. - Wer an dem Friedhof einen Frevel begeht, soll bestraft
werden, wie wenn er sich an einem christlichen vergangen hätte." Dieser
Satz sollte nun in diesem Jahre seine Aktualität erhalten. Obzwar schon fast
drei Jahrzehnte in Osterberg keine Israeliten mehr wohnten, blieb der Ruheplatz
der Toten unbehelligt bis zum verflossenen Frühjahre. Da hatten auch hier 'rohe
Kräfte sinnlos gewaltet'. Sechs größere Grabdenkmäler waren mit Gewalt
umgeworfen worden und zwei waren zerbrochen. Obwohl die Polizei sofort von der
hiesigen Kultusverwaltung verständigt wurde, konnte bis heute der Täter nicht
ausfindig gemacht werden. Da aber auch im Laufe der Jahre die hölzerne
Umfriedung recht schadhaft geworden war, sorgte die hiesige Gemeinde unter
finanzieller Beihilfe der bayerischen israelitischen Gemeindeverbandes für
Herstellung eines dauerhaften Drahtzaunes sowie für Wiederaufrichtung und Ausbesserung
der Grabsteine. Es ist wohl nun zu hoffen, dass dieser geheiligte Ort der Toten
von weiterer Verunglimpfung verschont bleibt. |
|
2. Der Osterberger Judenschutzbrief
(Quelle: Rose: Geschichtliches der Israelitischen
Kultusgemeinde Altenstadt 1931 S. 90-92)
- Zu den schwäbisch jüdischen Landgemeinden gehörte auch die nur 1 1/2
Wegstunden von hier (sc. Altenstadt-Illereichen)
entfernt gelegene zu Osterberg. Sie war aber viel jüngeren Datums als die
hiesige, wenn auch schon nach Miedel zur Mitte und gegen Ende des 16.
Jahrhunderts in den Memminger Akten Juden aus Osterberg genannt werden.
Jedenfalls kann man in dieser Zeit von keiner Gemeinde sprechen und es findet
sich auch unter den hiesigen Urkunden keinerlei Hinweis auf deren Existenz,
während im hiesigen Memorbuch der Rabbiner Abraham Meyer aufgeführt wird als
"einer von den Gründern Osterbergs". Die eigentliche Gründung ist
nach dem vorliegenden Schutzbriefe erst 1802 unter dem Reichsfeiherrn Anselm von
Osterberg erfolgt. Sowohl aus der Nähe, wie von hier und Fellheim, als auch aus
der Ferne, so aus Oberdorf, fanden Familien in
Osterberg Aufnahme. Die Ansiedelung wuchs schnell an, sodass 1811 nach Miedel
schon 39 Familien genannt wurden. Osterberg bildete mit Altenstadt zusammen ein
Distriktsrabbinat bis 1870, in welchem Jahre nach dem Tode des sel. Rabbiners
Schwab der Schluss an das zu Augsburg erfolgte. Der vom 7. Juli 1802 datierende
Judenschutzvertrag lautete:
- Die Juden dürfen sich des Schutzes solange versichert halten, als im
Reich Juden geduldet werden.
- Sie dürfen ungehindert ihre Religion ausüben. Streitigkeiten außer
Verbal- und Realinjurien unterstehen ihrer eigenen Gerichtsbarkeit, ebenso
Schuldklagen Jud gegen Jud. Über 5 Fl. darf ohne Genehmigung der
Ortsobrigkeit nicht gestraft werden und dann gebührt dieser die Hälfte der
Strafe. Für eigene Bedürfnisse dürften sie Gelder eingeben, ihre Parnosen
(Vorstände) erwählen, usw.
- Sie dürfen christliche Sabbatmägde dingen, eine eigene Synagoge
erbauten, für die sie einen jährlichen Grundzins von 4 fl. zu zahlen
haben; wenn sie die Zahl von 50 Ehen überschritten haben, dann hat jeder
Neuaufgenommene 25 fl. an die Judengemeindekasse anzuliefern. Ein Platz für
die Synagoge wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Ihre Toten dürfen sie auf einem unentgeltlich anzuweisenden, 40
Quadratschuh großen Platz begraben, den sie einzäunen müssen. Zu einer
Vergrößerung lässt die Herrschaft den Grund um 1 1/2 fl. für den
Quadratschuh ab. Wer an dem Friedhof einen Frevel gehet, soll bestraft
werden, wie wenn er sich an einem christlichen vergangen hätte.
- Sollte es sich ereignen, dass ein Totenfall an einem Feiertag geschieht,
wo auch Christen zugleich Feiertag haben, so sollen die Christen die
Erlaubnis haben, die Totenbahre und das Grab gegen Bezahlung zu machen.
- Für das Lauber- oder Pfingstfest bekommen sie das nötige Laub durch den
herrschaftlichen Holzwart gegen Belohnung angewiesen.
- Zur Dauch (Mikwe) der Judenweiber, die auf Kosten der Juden herzustellen
ist und für die der Quadratschuh um 1 1/2 fl. abgegeben wird und ein
jährlicher Grundzins von 3 fl. bezahlt werden muss, soll ein Bronnenwasser
hergeleitet werden; das lässt die Herrschaft besorgen, aber die
Unterhaltungskosten haben die christlichen und jüdischen Wasserbenützer
gemeinschaftlich zu tragen nach der Zahl der Haushaltungen.
- Sie dürfen mit allem handeln außer Bier und Branntwein, doch ohne
Erlaubnis keine christlichen Häuser oder Grundstücke kaufen noch besitzen
und haben sich des Memminger Gewichts und Maßes zu bedienen.
- Sie dürfen ihren Rabbiner und Schulmeister selbst wählen oder einen
benachbarten kommen lassen. Diese sollen von Bezahlung des Schutzgeldes
befreit sein, müssen aber alle Sabbat für die Ortsherrschaft das
gewöhnliche Gebet verrichten.
- Die Judenweiber genießen ihre Freiheit, selbst wenn ihr Mann aus der
Religion austreten sollte.
- Sie dürfen in der neuen Tafern in der Judengasse Musikanten halten außer
in den Zeiten, da bei den Christen Tänze usw. verboten sind.
- Die Judenschaft ist von der Gemeinde ganz unabhängig, hat also weder
Bürger- noch Weiderecht, kann aber auch nicht zu Steuern, Rekrutierung usw.
herangezogen werden.
- Die Juden dürfen im herrschaftlichen Wald durch einen eigenen Hirten an
unschädlichen Orten gegen ein jährliches Weidegeld von 1 fl. von jeder Ehe
Pferde und Hornvieh weiden lassen und zwar bis zu 20 Stück.
- Die Herrschaft wird die Wohnungen selbst bauen lassen und nach Vollendung
den Bau den Juden überlassen, wofür die Hälfte des Kaufschillings, von
dem bei der Aufnahme gleich eine später abzuziehende Kaution von 60 fl. zu
hinterlegen, bar gegeben, die andere in Zielen zu 5 Prozent verzinslich mit
jährlich 20 fl. abgetragen werden muss. Wer selbst bauen will, bekommt den
Quadratschuh für Grund und Hofraithung um 1 fl., die Ziegel und das Holz zu
gleichem Preis wie die Christen; dafür müssen sofort 40 fl., nach einem
Jahr weiter 20 fl., der Rest in Zielen abgetragen werden mit je 25 fl. und 5
Prozent Verzinsung. Auswärtige Handwerksleute dürfen nur unter besonderen
Verhältnissen genommen werden. In Christenhäusern dürfen sie nur so lange
wohnen, bis ihr Haus erbaut ist.
- Die Judenschaft ist der Herrschaft gleichwie de Christen untertan, getreu
und gerichtbar.
- Jeder Schutzjude und jeder Judensohn oder -Tochter, die sich verheiraten,
haben an die gnädige Frau und Fräulein 11 fl. Handschuhgeld zu entrichten,
für Protokollierung der Aufnahme 2 fl. nebst einem Hemd oder dafür 1 fl.,
Die Kanzleytaren sind für sie die gleichen wie für die Christen.
- Es sollen bis zu 30 Judenehen bestehen dürfen, bei weiteren Aufnahmen
wird vor allem auf guten Leumund gesehen; das Schutzgeld beträgt 11 fl. und
ist vierteljährlich abzuliefern. Eine Witwe zahlt nur 5 1/2 fl., ein elternloser
Sohn unter 18 Jahren ist frei, muss aber den Schutz der Herrschaft einholen,
bis zur Verheiratung oder zum 24 . Jahr bezahlt er dann das halbe
Schutzgeld. Jeder Besitzer einer Wohnung steuert als Grundzins 2 fl. und
eine Gans oder dafür 30 kr.; das Gleiche gilt, wenn eine Wohnung in zwei
Partien geteilt werden sollte. Wer über 75 Jahre alt ist, ist von allen
Abgaben frei.
- Will ein Lediger in eine andere Herrschaft ziehen, so hat er 12 fl.
Nachsteuer zu entrichten, ein Verheirateter aus dem Erlös der Wohnung 10
Prozent.
- Die Schutzjuden sind in Osterberg zollfrei, andere haben Zoll zu bezahlen.
- In Sterbefällen ist an die Ortsherrschaft bei Kindern unter 15 Jahren 1
fl., bei älteren 2 fl. zu entrichten. Grabgelder für fremde Juden bestimmt
die Herrschaft; Betteljuden sind frei.
- Die Juden dürfen Vieh schlachten und haben von jedem Stück die Zunge
oder 12 kr, von Kälbern oder Schafen 3 kr. abzuliefern.
- Bier, Essig oder Branntwein müssen sie in der neuen Tafern oder im
herrschaftlichen Bräuhaus abnehmen, wie sie überhaupt die Osterberger
Geschäfte in erster Linie berücksichtigen und gute Eintracht mit den
Christen halten sollen, damit die Nahrungszweige in der Herrschaft vermehrt
werden. Koscherer Wein soll von einem aus der Judenschaft eingelegt werden;
dafür ist die 13. Maß mit dem Preis, wie der Wein ausgeschenkt wird, an
die Herrschaft zu verumgelten (zu versteuern).
- Wer sich in seinen Rechten beeinträchtigt glaubt, soll sich nicht an eine
andere Herrschaft wenden, sondern bei der Kanton Donauischen Ritterschaft um
gütige Vermittlung einkommen. Wird hier kein Ausgleich gefunden, so soll
der Kaiser oder das Reichsgericht entscheiden. Klagen gegen Christen müssen
bei der herrschaftlichen Beamtung vorgebracht werden.
- Wer auswärts etwas begeht, das die Osterbergische Judenschaf in üblen
Ruf bringt, der wird des Schutzes entlassen oder gebührend gestraft.
- Der Schutzbrief ist alljährlich vorzulesen, wobei jeder, der über 13
Jahre alt ist, zugegeben sein muss. Von demselben sind zwei Abschriften zu
fertigen, von denen eine die Herrschaft, die andere die Judenschaft
ausgehändigt erhält.
|
Auswanderungen aus Osterberg und anderen Gemeinden in Bayerisch-Schwaben (1840)
 Artikel
in "Israelitische Annalen" vom 21. Februar 1840: "Aus Schwaben,
Februar 1840. ... Artikel
in "Israelitische Annalen" vom 21. Februar 1840: "Aus Schwaben,
Februar 1840. ...
Die Auswanderungslust ist bei den Israeliten unseres Kreises noch
immer im Zunehmen begriffen, und scheint ihren Höhepunkt erreichen zu
wollen. Fast in jeder Gemeinde schicken sich Mehrere an, auf das nächste
Frühjahr ihr Vaterland zu verlassen, und jenseits des Weltmeers ihr Glück zu
suchen, am meisten in Ichenhausen,
der größten israelitischen Gemeinde in Schwaben, mit ungefähr 200 Familien.
Wenn ich anders recht berichtet bin, sollen an diesem Orte allein 60
Personen an die Reise denken, denen sich die Auswanderer von Osterberg
(einer zum Rabbinate Altenstadt
gehörigen kleinen und armen Gemeinde von kaum 25 Familien) etwa 20 an der
Zahl anschließen wollen.
Das Auswandern ist bei uns eigentlich nichts Neues, obwohl es freilich nie
so stark und allgemein gewesen. Man war längst daran gewöhnt, dass
Jünglinge, die mit dem Wanderstab in der Hand in die Welt hinausgegangen
waren, zuletzt aus Mangel an Aussicht auf ein Etablissement in ihrem
Geburtsorte (da abgesehen von dem harten Zunftzwang, in Flecken und Dörfern
die Professionen so leicht übersetzt werden), in verschiedenen fremden
Ländern sich niederließen. Auch zogen seit undenklicher Zeit unbemittelte
Mädchen (bisweilen alljährlich) in ganzen Scharen (vom bessern Verdienste
gelockt) nach Italien, wo sie sich in den jüdischen Gemeinden als
Dienstmädchen verdungen, und manche auch verblieben. Jetzt hingegen ist
Nordamerika, woher von den früher Eingewanderten die vorteilhaftesten
Berichte kommen, zum Teil begleitet von gewichtigen klingenden Zeugnissen
ihres Wohlstandes zur Erfreuung ihrer zurückgelassenen Angehörigen, das
einzige Ziel Aller, die dem Heimatlande 'Lebewohl' sagen wollen, und der Weg
dahin ist so geebnet, und die Zuversicht, dort gesicherten Unterhalt zu
finden, so groß, dass nicht bloß Verlobte und junge Leute, die einander zu
heiraten gedenken, sondern auch bejahrte Eheleute, ja Familien mit
zahlreichen Kindern sich getrost auf die Reise vorbereiten, ihre Realitäten
verkaufen usw. und auf den Ozean und den fernen Weltteil ihre Hoffnung
setzen.
Ob aber Allen, die sich mit dieser Idee herumtragen, eine alsbaldige
Übersiedelung zu raten wäre, ist eine andere Frage, die ich nicht sofort
bejahen möchte. Es scheint mir sogar die Furcht nicht unbegründet, dass die
schmeichelhafte Aussicht in Amerika ein Eldorado zu finden, die manche junge
Leute sich so gern vorhalten, ihnen sehr nachteilig werden, und ihrem Eifer,
sich hier zu brauchbaren und tüchtigen Mitgliedern der bürgerlichen
Gesellschaft zu qualifizieren, Eintrag tun dürfte. Für diese wird daher
vielleicht die Ermahnung nicht überflüssig sein, dass wer in der neuen Welt
seinen Zustand verbessern, d. h. von seinen Kräften und Fertigkeiten einen
freien ungehinderten Gebrauch machen will (mehr darf Niemand erwarten!),
diese zuvor in der alten brav ausgebildet haben muss, und wer hier nicht
viel taugt, auch dort auf kein solides Glück zu rechnen hat.—
Vor kurzem erhielt (der nunmehr verstorbene Herr H. Löwenstein in
Altenstadt vom Rabbiner zu
Richmond in Virginien (wo die meisten Israeliten, die aus
Altenstadt ausgewandert, sich
befinden) ein Schreiben, worin er ersucht wurde, zwei Gesetzrollen (=
Torarollen), eine Megillah, einen Schofar und Machsorim dorthin zu
schicken. (Die Gesetzrollen sind auch schon bestellt). Es hat sich nämlich
daselbst vor einiger Zeit unter |
 den
deutschen Israeliten, die früher die portugiesische Synagoge besucht, ein
Verein gebildet, welcher ein eigenes Gotteshaus mit deutschem Ritus zu
gründen beabsichtigt. — Die Berichte der Eingewanderten stimmen alle überein
in der Klage über den argen Indifferentismus der amerikanischen Juden. Einer
drückt sich darüber folgendermaßen aus: 'Unsere Religion hat sich nicht der
besten Anhänglichkeit zu erfreuen, und sehr viele unserer Glaubensgenossen
in Amerika sind es bloß dem Namen nach und ihr ganzer Lebenslauf
widerspricht dem eines Israeliten.' Eine Hauptursache davon liegt wohl in
der fehlenden oder mangelhaften Gemeindeverfassung, da Leute, die aus den
verschiedensten Ländern durch bloßen Zufall an einen Ort geworfen worden,
sich nicht leicht vereinigen und über die zu treffenden Einrichtungen
verstehen, und so müssen denn bald in Ermangelung aller geistlichen Leitung
und öffentlichen Religionsunterrichts Unwissenheit und Lauheit in religiösen
Dingen einreißen. (Übrigens muss man wissen, dass auch die Christen in den
Vereinigten Staaten mit Gotteshäusern und Geistlichen sehr schlecht versehen
sind.) Mögen die Deutschen, die jetzt in größeren Gesellschaften einwandern,
auch im Lande der Freiheit zusammenhalten, und die treue Anhänglichkeit an
den Glauben der Väter bewahren, aber nicht bloß für die äußern Requisiten
des Kultus, sondern mehr noch und hauptsächlich für die eigentlichen Hebel
des religiösen Lebens, für einen gediegenen Volks- und Jugendunterricht in
Synagoge und Schule Sorge tragen! den
deutschen Israeliten, die früher die portugiesische Synagoge besucht, ein
Verein gebildet, welcher ein eigenes Gotteshaus mit deutschem Ritus zu
gründen beabsichtigt. — Die Berichte der Eingewanderten stimmen alle überein
in der Klage über den argen Indifferentismus der amerikanischen Juden. Einer
drückt sich darüber folgendermaßen aus: 'Unsere Religion hat sich nicht der
besten Anhänglichkeit zu erfreuen, und sehr viele unserer Glaubensgenossen
in Amerika sind es bloß dem Namen nach und ihr ganzer Lebenslauf
widerspricht dem eines Israeliten.' Eine Hauptursache davon liegt wohl in
der fehlenden oder mangelhaften Gemeindeverfassung, da Leute, die aus den
verschiedensten Ländern durch bloßen Zufall an einen Ort geworfen worden,
sich nicht leicht vereinigen und über die zu treffenden Einrichtungen
verstehen, und so müssen denn bald in Ermangelung aller geistlichen Leitung
und öffentlichen Religionsunterrichts Unwissenheit und Lauheit in religiösen
Dingen einreißen. (Übrigens muss man wissen, dass auch die Christen in den
Vereinigten Staaten mit Gotteshäusern und Geistlichen sehr schlecht versehen
sind.) Mögen die Deutschen, die jetzt in größeren Gesellschaften einwandern,
auch im Lande der Freiheit zusammenhalten, und die treue Anhänglichkeit an
den Glauben der Väter bewahren, aber nicht bloß für die äußern Requisiten
des Kultus, sondern mehr noch und hauptsächlich für die eigentlichen Hebel
des religiösen Lebens, für einen gediegenen Volks- und Jugendunterricht in
Synagoge und Schule Sorge tragen!
Derselbe neue Amerikaner schreibt (in einem Briefe von etwas älterem Datum)
aus Philadelphia, wo eine deutsche und eine portugiesische
Gemeinde, dass die erste in ihrer Synagoge noch sehr viele Missbräuche habe,
letztere hingegen in ihrem neuen Gotteshause (das mit dem israelitischen
Tempel zu Wien viele Ähnlichkeit hat) einen wohlgeordneten und ansprechenden
Gottesdienst halte, dass sie dennoch nur einen Chasan hat, und es dort weder
ein Rabbinat noch eine Religionsschule gibt. Ich hoffe, bald im Stande zu
sein. Ihnen von dorther für die Annalen genauere Nachrichten mitteilen zu
können.". |
Zu einzelnen
Personen aus der jüdischen Gemeinde
Über die aus Osterberg stammende Familie
Binswanger
80. Geburtstag von Sophie Kahn geb. Weil aus Osterberg
(in München 1932)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934: "80. Geburtstag. Am 12. September dieses Jahres kann
Frau Sophie Kahn, geb. Weil, München, Frauenhoferstraße 2, geboren am
12. September 1854 in Osterberg, in seltener Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag
begehen. Wir wünschen der bescheidenen und gütigen alten Dame einen langen
sorgen- und beschwerdelosen Lebensabend." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1934: "80. Geburtstag. Am 12. September dieses Jahres kann
Frau Sophie Kahn, geb. Weil, München, Frauenhoferstraße 2, geboren am
12. September 1854 in Osterberg, in seltener Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag
begehen. Wir wünschen der bescheidenen und gütigen alten Dame einen langen
sorgen- und beschwerdelosen Lebensabend." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
S. Kahn sucht eine Haushaltshilfe
(1879)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Mai 1879: "Ein schon bejahrtes
Frauenzimmer, anständig, welches gut im Kochen und auch im Häuslichen
bewandert ist, findet ein gutes Unterkommen zur Verpflegung eines ganz
alleinstehenden Mannes gegen gute Belohnung (Eintritt möglichst sogleich)
bei S. Kahn, Osterberg in Schwaben, Bayern, Post Kelmünz a. d.
Iller." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Mai 1879: "Ein schon bejahrtes
Frauenzimmer, anständig, welches gut im Kochen und auch im Häuslichen
bewandert ist, findet ein gutes Unterkommen zur Verpflegung eines ganz
alleinstehenden Mannes gegen gute Belohnung (Eintritt möglichst sogleich)
bei S. Kahn, Osterberg in Schwaben, Bayern, Post Kelmünz a. d.
Iller." |
Zur Geschichte der Synagoge
Die Synagoge der jüdischen Gemeinde wurde
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Nach Auflösung der
jüdischen Gemeinde 1896 wurde sie - wie auch das Gebäude der jüdischen Schule
- verkauft. Die ehemalige Synagoge wurde zwischen 1910 und 1920 abgebrochen.
Standort: Judengasse (die Synagoge hatte die
frühere Hausnummer 114).
Darstellung / Pläne
Historische Darstellung:
 |
Historischer Stich von
Osterberg (19. Jahrhundert). Mit Pfeil markiert: die ehemalige Synagoge
inmitten der Häuser in der
jüdischen Wohnsiedlung "Judengasse"
(Quelle: G. Römer, Schwäbische Juden S. 26) |
| |
 |
 |
Plan des südlichen Teiles von
Osterberg 1823.
Schwarz markiert die jüdischen Häuser im
Bereich von
Judengasse / Hauptstraße. |
Ausschnitt aus dem Plan links.
Eingetragen sind
die Synagoge und das Israelitische Schulhaus |
| |
Quelle: P. Fassl
/ D. Pfister: Dokumentation zur Geschichte und Kultus der Juden in
Schwaben.
Band II. Hausbesitz um 1835/40. Augsburg 1993. |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
 |
 |
|
Straßenschild
"Judengasse" |
Judengasse 24: hier stand die
jüdische Schule. |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Teilansichten der
"Judengasse(n)". Die älteren Gebäude stammen noch aus der Zeit
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und wurden von jüdischen Familien
erbaut. |
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
Dezember 2019:
Presseartikel zu den Spuren der
jüdischen Geschichte vor Ort
|
Artikel
von Ralph Manhalter in der "Augsburger Allgemeinen" vom 5.
Dezember 2019:
"Wo die jüdische Gemeinde in Osterberg Spuren hinterlies
Nicht nur in Altenstadt, auch in
Osterberg, hatten sich Juden niedergelassen. Wie es dazu kam und warum die
Gemeinde wieder verschwand.
Die Häuserzeile entlang der Hauptstraße mutet fremd an, so gar nicht typisch
schwäbisch. Die Gebäude stehen mit der Traufseite zur Gasse, nicht mit dem
First, so wie die Höfe der Bauernschaft. Eine ähnliche Ansicht kennt man aus
Altenstadt und Illereichen. Auch dort,
wie im benachbarten Fellheim, bemerkt
der aufmerksame Beobachter, dass diese Anwesen vom ansonsten
landwirtschaftlich geprägten Ortsbild abweichen. Schließlich hatte auch
Osterberg eine jüdische Bevölkerung mit all ihren dazugehörenden kultischen
Einrichtungen beheimatet. Charakteristisch für die Bauweise sind die
zahlreichen Mansarddächer, welche bis dahin in den rein
bäuerlich-schwäbischen Dörfern größtenteils unbekannt waren.
Die Juden zahlten Schutzgeld an den Freiherren. Zunächst waren es vor
allem jüdische Viehhändler, die im 16. Jahrhundert nach Osterberg kamen.
Durch Repressionen, die eine freie Berufswahl unmöglich machten, blieben den
Juden nur wenige Tätigkeiten, die sie ausüben durften. Und die lagen vor
allem im Bereich Handel und Geldwesen. Allerdings kann von einer Ansiedlung
größeren Ausmaßes erst mit der Anwerbung der Israeliten durch den örtlichen
Reichsfreiherrn Anselm von Osterberg 1802 gesprochen werden. Schutz gegen
Steuer lautete dann die Devise. Denn von den Abgaben, welche die Juden zu
begleichen hatten, konnte der Freiherr seine Kasse erheblich aufbessern. Um
1830 waren ungefähr 20 Prozent der Einwohner israelitischen Glaubens. Damit
war jedoch der Zenit erreicht. Gleichzeitig ging der bisher vorherrschende
Hausierhandel zugunsten des Großhandels zurück. Ebenso wirkten die jüdischen
Geschäftetreibenden wesentlich am Marktaustausch zwischen
landwirtschaftlichen und industriellen Gütern mit: Sensen und Dreschflegel
gegen Getreide und Feldfrüchte.
In den Folgejahren entstanden Synagoge, Schule und
Friedhof. Zuvor mussten die Toten der
Judenherrschaft entweder in
Altenstadt oder in Fellheim
bestattet werden. Die letzte Beisetzung auf dem am Hang gelegenen jüdischen
Friedhof fand 1906 statt. Nicht mehr
erhalten ist die ehemalige Synagoge, die mit ihrer welschen Haube auf dem
gemauerten Türmchen sicherlich einen äußerst malerischen Anblick geboten
hatte. Auch ein jüdisches Ritualbad, eine sogenannte Mikwe wird in der Nähe
vermutet. Mit dem Tod des letzten Rabbiners 1870 wurde Osterberg dem
größeren Rabbinat Altenstadt
zugeordnet. Das Schulhaus der Kultusgemeinde hingegen besteht in veränderter
Form bis heute. Aus der Frühzeit der Einrichtung sind noch die Lehrernamen
Bloch, Seligmann und Kahn überliefert, wie in der ausführlichen Haus- und
Hofbeschreibung Osterbergs von Ingeborg und Ferdinand Magel nachzulesen ist.
Was heute noch von der jüdischen Gemeinde in Osterberg übrig ist.
Auch den idyllischen Friedhof im Südwesten des Ortes gibt es noch. Dessen 45
Grabsteine erinnern noch an jene ferne Kultur, deren Koexistenz mit der
christlichen Bevölkerung im 20. Jahrhundert ein furchtbares Ende fand. Dabei
waren die Jahrzehnte vor den nationalsozialistischen Gräueln durchaus
vielversprechend: Die in der Zeit um die Deutsche Reichsgründung 1871
verabschiedeten Gesetze billigten den Juden eine vollkommene
Gleichberechtigung neben den christlichen Staatsbürgern zu. Da gleichzeitig
die Industrialisierung verbunden mit einer Verbesserung der Infrastruktur
(man denke hier vor allem an den Eisenbahnbau) in unserer Region einen
steilen Aufstieg nahm, entschlossen sich immer mehr Osterberger Israeliten,
in die nahegelegenen Städte Memmingen und Ulm umzusiedeln. 1908 war
lediglich noch eine Familie jüdischen Glaubens im Ort gemeldet. In der Folge
wurden Schulhaus und Synagoge, die bald darauf abgerissen wurden, verkauft.
Die Jahre überdauert haben Flurnamen wie 'Am Judengraben' oder 'Am Judenweg'
sowie die drei Judengassen, die immer noch von der südlichen Hauptstraße
nach Osten abzweigen – dort wo sich vor mehr als zweihundert Jahren eine
eigene Gemeinde mit einer heute so fremd anmutenden Kultur gebildet hatte. "
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 |
(Hauptlehrer) Hermann Rose: Geschichtliches der
Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt 1931 S. 90-92 (er beruft sich
mehrfach auf Miedel: Geschichte der Juden in Memmingen).
|
 |
Gernot Römer: Schwäbische Juden.
Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. Augsburg 1990.
|
 |
Israel Schwierz: Steinerne
Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. A 85. München 1988 S. 261.
|
 |
Michael Trüger: Der jüdische
Friedhof in Osterberg / Schwaben. In: Der Landesverband der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern. 15. Jahrgang Nr. 84 vom Dezember 2000 S. 13.
|
 |
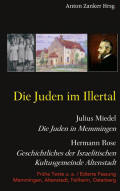 Anton
Zanker (Hrsg.): Die Juden im Illertal. Darin auch: Julius Miedel:
Die Juden in Memmingen. Hermann Rose: Geschichtliches der
Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt. Frühe Texte u.a./ Edierte Fassung
Memmingen, Altenstadt, Fellheim, Osterberg. Hardcover 688 S. Anton
Zanker (Hrsg.): Die Juden im Illertal. Darin auch: Julius Miedel:
Die Juden in Memmingen. Hermann Rose: Geschichtliches der
Israelitischen Kultusgemeinde Altenstadt. Frühe Texte u.a./ Edierte Fassung
Memmingen, Altenstadt, Fellheim, Osterberg. Hardcover 688 S.
Verlag BoD - Books on Demand. Norderstedt 2021. ISBN 978-3-7534-2473-6.
Informationsseite des Verlages mit Leseprobe
Anmerkung: Neben zwei frühen Texten, die vor dem Drama der Intoleranz
entstanden, nämlich von Julius Miedel und Hermann Rose, werfen auch heutige
Autoren auf die Geschichte vor der Geschichte der Juden im Illertal, in der
Region zwischen Kempten und Altenstadt / Iller. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|