|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"
Dinkelsbühl (Kreis
Ansbach)
Jüdische Geschichte / Betsaal (Synagoge)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem seit 1274 als
Reichsstadt bezeichneten Ort Dinkelsbühl lebten Juden bereits im Mittelalter.
1298 waren die hier ansässigen Juden von der sogenannten "Rindfleisch-Verfolgung"
betroffen, bei der insgesamt mehrere zehntausend Juden im fränkischen Bereich
ermordet wurden. 1325 wird ein Salman von Dinkelsbühl in Augsburg
genannt. Zu einer erneuten Judenverfolgung kam es im Zusammenhang mit der Pestzeitverfolgung
1348/49.
1372 erlaubte Kaiser Karl IV. der Stadt erneut die Aufnahme von Juden,
doch kam es erst seit 1376, sicher seit 1384 zu einer Wiederansiedlung. In den
folgenden Jahrzehnten werden Juden aus Dinkelsbühl in Nürnberg (1398, 1407)
und im Erzstift Mainz (1384) sowie in Zürich (1385) genannt. Die Juden lebten
insbesondere vom Geldverleih. Zwischen der Stadt und dem König kam es bis zum
Anfang des 15. Jahrhunderts immer wieder zum Streit über die Einnahme der
Judensteuer. 1401 beschlagnahmte die Stadt gewaltsam die Schuldbriefe und Pfänder
der Juden, worauf diese offenbar die Stadt verließen.
Im 17. Jahrhundert lebten in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges Juden
in der Stadt, die vermutlich aus Landgemeinden hierher geflohen waren. 1648
wurden sie wieder aus der Stadt gewiesen.
Erst nach 1861 konnten jüdische Personen wieder in Dinkelsbühl
zuziehen. In der Zeitschrift "Der Israelit" wird erstmals 1862 von einem
jüdischen Ereignis in der Stadt berichtet, nämlich von der "Hochzeit des M.
Gutmann in Dinkelsbühl" ("Der Israelit" vom 6.8.1862). In einer Spendensammlung
der jüdischen Gemeinde Schopfloch wird 1869 "S. Hamburger in Dinkelsbühl"
genannt ("Der Israelit" vom 10.3.1869), in einer Sammlung 1872 werden zwei
Familien in Dinkelsbühl als Mitspender erwähnt ("Der Israelit" vom 28.2.1872).
Ab 1879 werden die Spenden für Kollekten aus den jüdischen Gemeinden erstmals
separat aus Dinkelsbühl ausgewiesen ("Der Israelit" vom 23.4.1879 und vom
30.4.1879).
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich bis zu
Beginn der NS-Zeit wie folgt: 1867 11 jüdische Einwohner (0,2 % von insgesamt
5.192), 1880 49 (0,9 % von 5.286), 1899 59 in sieben Haushaltungen (von
insgesamt 4577 Einwohnern), 1900 49 (1,1 % von 4.573), 1910 56 (1,2 % von
4.800), 1925 54 (1,1 % von 5.067), 1933 64 (1,2 % von 5.155).
An Einrichtungen hatte die jüdische (Filial-)Gemeinde in Dinkelsbühl
einen Betsaal (s.u.) und einen Raum für den Religionsunterricht. Die Toten der
jüdischen Gemeinde wurden auf dem Friedhof
in Schopfloch beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war
ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter tätig war. 1889 wird
ein Herr Zimmermann als Lehrer und Kantor genannt. 1895/1901 erteilte M.
Rosenstein aus Schopfloch den
Religionsunterricht in Dinkelsbühl; 1895 waren sechs Kinder der Gemeinde in
Religion zu unterrichten, 1898 fünf Kinder.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1892/1898 R. Hamburger.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Gustav Künzelsauer
(geb. 4.3.1894 in Unterdeufstetten, gef. 30.8.1918), Julius Künzelsauer (geb.
25.2.1893 in Unterdeufstetten, gef. 17.7.1918) und Louis Künzelsauer (geb.
27.7.1897 in Unterdeufstetten, gef. 14.2.1917).
Um 1925 bildeten die in Schopfloch
und Dinkelsbühl lebenden jüdischen Personen eine gemeinsame Gemeinde (Israelitische
Kultusgemeinde Schopfloch-Dinkelsbühl). Damals waren Vorsteher der
Gemeinde die Herren Samuel Herz, Siegfried Rosenfeld, David Levite, Herrmann
Rosenfeld (letzterer aus Schopfloch). Jüdischer Lehrer und Kantor der Gemeinde
war Mayer (Meier) Rosenstein. Er unterrichtete an öffentlichen Schulen in
Schopfloch elf Kinder in Religion, vier weitere im gesonderten
Religionsunterricht, dazu fünf Kinder in Dinkelsbühl. Um 1932 war
1. Gemeindevorsteher Samuel Herz (Schopfloch) und 2. Gemeindevorsteher David
Levite (Dinkelsbühl; vgl. Artikel zu den Gemeindewahlen am 2.1.1927 unten). Die
Gemeinde bewahrte ihren konservativen Charakter und war seit 1920 Mitglied des
Bundes gesetzestreuer israelitischer Gemeinden Bayerns. Die Gemeinde
Schopfloch-Dinkelsbühl gehörte zum Bezirksrabbinat Ansbach.
Erst 1929 bildete sich in Dinkelsbühl eine selbständige, von Schopfloch
unabhängige Gemeinde. 1932 bekam die jüdische Gemeinde in Dinkelsbühl
den Status einer offiziellen Gemeinde. 16 der damals in der Stadt lebenden 21 jüdischen
Haushaltungsvorständen betätigten sich im Handel, einige hatten Läden in der
Stadt eröffnet. Erster Vorsteher der unabhängig gewordenen Gemeinde war Adolf
Hamburger. Als Lehrer, der zugleich als Kantor fungierte, wurde Karl Krebs angestellt.
Er wurde immer wieder durch den Gemeindevorsitzenden vertreten.
1933 lebten 64 jüdische Personen in Dinkelsbühl. Bereits in der zweiten
Märzhälfte 1933 wurden mehrere Juden in Dinkelsbühl verhaftet. Auf Grund
der zunehmenden Repressalien und der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts verließen
bis November 1938 45 von ihnen die Stadt: 17 wanderten aus (sieben nach
Holland, sechs in die USA, zwei nach Luxemburg und je einer nach Palästina und
Ungarn), 28 verzogen innerhalb Deutschlands. 1936 richtete die jüdische
Gemeinde noch eine besondere Schulklasse ein, nachdem den jüdischen
Kindern der Besuch der allgemeinen Schulen verboten worden war. Am 11. November
1938 wurden 18 jüdische Einwohner gezählt. Sie wurden im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom
1938 aus der Stadt vertrieben und zogen insbesondere nach Frankfurt am Main,
Ansbach, Mannheim und München.
Liste der 18 Personen, die nach den Vorfällen
beim Novemberpogrom 1938 fluchtartig die Stadt Dinkelsbühl verließen
und sich am 10. November 1938 abmeldeten (Adolf Hamburger und Ehefrau Klaire meldeten sich am 11.11.1938 ab)
- Liste wurde erstellt von Angelika Brosig, Schopfloch:
1. Ascher, Amalie, Nördlinger Strasse 8 (starb in israelitischem Altersheim in
München); 2./3./4. Birk, Willi, Ehefrau Saly und Sohn Kurt, Elsassergasse 18 (Vater und Sohn USA, Saly Opfer der
Shoa); 5./6. Hamburger, Adolf und Ehefrau Claire, Klostergasse 5 (Tochter Martha war vorher weggezogen) -
alle Opfer der Shoa; 7./8./9./10. Hamburger, Benno, Bruder Emil und Ehefrau Lina, Schwester Luise, Lange Gasse 28 (Luise Opfer der
Shoa, andere nach Palästina/Israel); 11. Künzelsauer, Felix, Elsassergasse 18 (starb in
München in israelitischem Altenheim); 12./13./14./15./16./17. Schlossberger, Sigmund und Sohn Josef mit Ehefrau Martha und den drei kleinen Kindern Jost, Max und Beatrix, Segringer Strasse 44 (Sigmund starb in Frankfurt, Josef mit Frau und Kindern Opfer der
Shoa), 18. Weinberger, Emma, Elsassergasse 18 (Opfer der Shoa).
|
Mitte November 1938 war somit die Stadt Dinkelsbühl in der nationalsozialistischen Sprache
"judenfrei". Die Tageszeitung "Der Wörnitzbote" berichtete
am 11. November 1938: "Auch Dinkelsbühl ist judenfrei! Die berechtigte Empörung über den jüdischen Meuchelmord in Paris, die sich spontan im ganzen Reiche Luft machte, hat sich gestern auch auf unsere Stadt übertragen, so dass es zu Demonstrationen gegen die wenigen noch hier ansässigen Juden kam. Daraufhin haben sich bis zum Abend auch die letzten Juden beim Einwohneramt abgemeldet und sind von hier fortgezogen, so daß nunmehr auch Dinkelsbühl zu den judenfreien Städten zählt".
Von den in Dinkelsbühl geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945 sowie weiteren Recherchen von
Angelika Brosig, Schopfloch): Heinz J. Ansbacher (1925), Gertrud Bär
(1888), Sally Birk geb. Weinberger (1900), Amalie Frank geb. Levite (1871),
Klara Gutmann (1866), Adolf Hamburger
(1876), Moritz Hamburger (1865), Claire (Kläre) Hamburger geb. Adler (1884), Louise Hamburger (1876), Martha
Hamburger (1922), Isaak Künzelsauer (1895), Adolf
Levite (1873), Heinrich Levite (1877), Heinz Josef Levite (1924), Julius
Levite (1910), Max Levite (1878), Sara Levite geb. Mayer (1885), Sara Sophie
Levite geb. Heumann (1882), Sidonie (Tonie) Levite geb. Strauß (1886), Beatrixe
(Beatrice) Schlossberger (1935), Blümle Schlossberger (1936), Jakob Schlossberger (1933), Josef
(Zwi) Schlossberger (1899), Jost Schlossberger (1933), Martha Schlossberger geb. Strauß (1904),
Max Schlossberger (1934), Mosche
Schlossberger (1934), Palma (Betty) Schlossberger (1894), Fanny Weil geb.
Dochenbach (1869), Emma Weinberger geb. Katzauer (1866).
Anm.: In verschiedenen Listen ist Sigmund Schlossberger (geb. 1863) unter den
Opfern eingetragen. Dieser starb jedoch nach Auskunft seines Enkelsohnes Manfred
noch vor der Deportation in Frankfurt.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der
Stelle des Religionslehrers, Vorbeters und Schochet für Dinkelsbühl 1876 /
1885 / 1887 /1930
In den ersten Jahren wurde die in Dinkelsbühl zugezogenen jüdischen Familien teilweise vom
württembergischen Unterdeufstetten
aus betreut, wie aus einer Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Mai 1876 geschlossen werden kann:
 "Unterdeufstetten,
D.-A. Crailsheim, Württemberg, den 26. März 1876. Da unser
bisheriger Lehrer nach der größeren israelitischen Gemeinde Pflaumloch
berufen worden, so ist die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und
Schächter sofort wieder zu besetzen. Fester Gehalt 550 Mark nebst
üblichen Emolumenten, freier Wohnung und Heizung. Das Schächter-Amt wird
extra bezahlt und dürfte mehr als 100 Mark abwerfen. Da nur einige
Schüler vorhanden sind, so könnte in der 1 Stunde entfernten bayerischen
Stadt Dinkelsbühl durch Privatreligionsunterricht noch ein schöner
Nebenverdienst erzielt werden. Geeignete Bewerber, weche sich über
ihre Fähigkeiten und religiös sittliches Betragen auszuweisen vermögen
und bei unserm Bezirksrabbiner in Religionsfächern und Schächterfunktion
einer Prüfung unterwerfen können, haben Aussicht, wie schon mehrere
Vorgänger, eine bleibende Stätte und ihr Glück in Württemberg zu
finden und wollen hierauf Reflektierende unter Vorlegung ihrer Zeugnisse
sich direkt wenden an den israelitischen Vorstand Samson Ballenberger." "Unterdeufstetten,
D.-A. Crailsheim, Württemberg, den 26. März 1876. Da unser
bisheriger Lehrer nach der größeren israelitischen Gemeinde Pflaumloch
berufen worden, so ist die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und
Schächter sofort wieder zu besetzen. Fester Gehalt 550 Mark nebst
üblichen Emolumenten, freier Wohnung und Heizung. Das Schächter-Amt wird
extra bezahlt und dürfte mehr als 100 Mark abwerfen. Da nur einige
Schüler vorhanden sind, so könnte in der 1 Stunde entfernten bayerischen
Stadt Dinkelsbühl durch Privatreligionsunterricht noch ein schöner
Nebenverdienst erzielt werden. Geeignete Bewerber, weche sich über
ihre Fähigkeiten und religiös sittliches Betragen auszuweisen vermögen
und bei unserm Bezirksrabbiner in Religionsfächern und Schächterfunktion
einer Prüfung unterwerfen können, haben Aussicht, wie schon mehrere
Vorgänger, eine bleibende Stätte und ihr Glück in Württemberg zu
finden und wollen hierauf Reflektierende unter Vorlegung ihrer Zeugnisse
sich direkt wenden an den israelitischen Vorstand Samson Ballenberger." |
| Es ist nicht bekannt, ob in den folgenden
Jahren tatsächlich der Lehrer aus Unterdeufstetten zum Unterricht der
jüdischen Kinder nach Dinkelsbühl gekommen ist. Spätestens neun Jahre
danach suchten die jüdischen Familien in Dinkelsbühl einen eigenen Religionslehrer: |
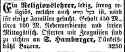 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1885:
"Ein Religionslehrer, ledig, streng religiös, welcher auch Baal Kore
(Vorbeter) ist, wird für einige Familien gesucht. Gehalt 450 Mark, circa
100 Mark Nebenverdienste und freien Mittagstisch. Offerten mit Zeugnissen
sind zu richten an S. Hamburger, Dinkelsbühl,
Bayern". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1885:
"Ein Religionslehrer, ledig, streng religiös, welcher auch Baal Kore
(Vorbeter) ist, wird für einige Familien gesucht. Gehalt 450 Mark, circa
100 Mark Nebenverdienste und freien Mittagstisch. Offerten mit Zeugnissen
sind zu richten an S. Hamburger, Dinkelsbühl,
Bayern". |
| |
| Zwei Jahre später musste die Stelle erneut
ausgeschrieben werden. Nun wurde von ihm auch eine Ausbildung im
Schächten gefordert: |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November 1887:
"Ein lediger, streng religiöser Religionslehrer, Schächter und
Vorbeter wird zum sofortigen Eintritt gesucht. Gehalt jährlich Mark 450,
ca. Mark 100 Nebenverdienste und freie Mittagskost. Bewerber mit Abschrift
der Zeugnisse wollen sich wenden an R. Hamburger in Dinkelsbühl
(Bayern)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. November 1887:
"Ein lediger, streng religiöser Religionslehrer, Schächter und
Vorbeter wird zum sofortigen Eintritt gesucht. Gehalt jährlich Mark 450,
ca. Mark 100 Nebenverdienste und freie Mittagskost. Bewerber mit Abschrift
der Zeugnisse wollen sich wenden an R. Hamburger in Dinkelsbühl
(Bayern)." |
| |
 Anzeige
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. August
1930: "Die Kultusgemeinde Schopfloch-Dinkelsbühl sucht für
Dinkelsbühl einen jüngeren Beamten als Religionslehrer, Vorbeter und
Schochet. Eventueller Antritt im Oktober 1930. Bewerbungen wollen unter
Angabe von Referenzen und Lebenslauf gesandt werden an: David Levite,
Dinkelsbühl, Elsässergasse." Anzeige
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. August
1930: "Die Kultusgemeinde Schopfloch-Dinkelsbühl sucht für
Dinkelsbühl einen jüngeren Beamten als Religionslehrer, Vorbeter und
Schochet. Eventueller Antritt im Oktober 1930. Bewerbungen wollen unter
Angabe von Referenzen und Lebenslauf gesandt werden an: David Levite,
Dinkelsbühl, Elsässergasse." |
Einführung von Lehrer Karl Krebs in sein Amt (1931)
 Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
1. September 1931: "Dinkelsbühl, 2. August 1931. Heute Vormittag 11
Uhr fand durch Seine Ehrwürden, Herrn Bezirksrabbiner Dr. Munk, Ansbach,
die feierliche Einführung des neu angestellten Lehrers Karl Krebs statt.
Herr Krebs, dessen Eltern es vergönnt war, diesen Ehrentag ihres Sohnes
mitzufeiern, stammt aus einem frommen Ansbacher Haus und hat seine
Ausbildung auf dem Würzburger Seminar genossen.
Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
1. September 1931: "Dinkelsbühl, 2. August 1931. Heute Vormittag 11
Uhr fand durch Seine Ehrwürden, Herrn Bezirksrabbiner Dr. Munk, Ansbach,
die feierliche Einführung des neu angestellten Lehrers Karl Krebs statt.
Herr Krebs, dessen Eltern es vergönnt war, diesen Ehrentag ihres Sohnes
mitzufeiern, stammt aus einem frommen Ansbacher Haus und hat seine
Ausbildung auf dem Würzburger Seminar genossen.
Die Feier versammelte die Gemeinde in den schon seit Jahrzehnten von Herrn
Adolf Hamburger unentgeltlich zur Verfügung gestellten Beträumen und
wurde durch Wechselvortrag der Psalmen 91 und 100 eingeleitet.
Hierauf begrüßte Herr David Levite den Herrn Rabbiner, den Herrn Lehrer,
seine Eltern und die Gemeinde. In bewegten Worten, die allen Teilnehmern
zu Herzen gingen, feierte er den heutigen Tag als eine Tat wahrhaften
Mutes der Gemeinde. Dank und Freude erfülle uns alle, dass wir diese
Feier abhalten können.
Und nun ergriff Herr Rabbiner Dr. Munk das Wort zu seiner Festpredigt, die
tief in den Herzen widerklang. Den Dankpsalm 100 nahm er zum
Ausgangspunkt. Dank dem allgütigen Gott, der in solch schwerer Zeit
innerer und äußerer Not das Werk einer Gemeindegründung und die
Anstellung eines Lehrers und geistigen Führers zur Ausführung kommen
ließ. Dank dem scheidenden Lehrer Herrn Rosenstein, Schopfloch,
der jahrzehntelang in treuer Pflichterfüllung für die religiösen
Bedürfnisse der seitherigen Filialgemeinde Dinkelsbühl sorgte und sein Bestes
gab, den Kindern die heilige Lehre zu vermitteln. Dank besonders Herrn
Benno Hamburger, der in solch uneigennütziger Weise lange Jahre hindurch
die Vorbeterdienste versah. Dank Herrn Adolf Hamburger für die
Bereitstellung der Beträume. Dank all denen, die in tatkräftiger Weise
am Aufbau der Gemeinde wirkten und Dank der Gemeinde selbst für ihren
Mut, ihr Bekenntnis und den unerschütterlichen Willen über alle
Hemmnisse hinweg diese Weihestunde zu ermöglichen.
Als unser großer Lehrer Moses den Schauplatz seines irdischen Wirken
verlassen sollte, hat er seinem Schüler und Nachfolger aus dem reichen
Schatz seiner Erfahrungen nicht etwa einzelne Anweisungen gegeben. Nur
zwei Worte sprach er zu ihm: Chasak weemoz! Sei stark und fest! Das
sei auch als Mahnruf dem neuen Lehrer wie auch der Gemeinde zugerufen.
Stark sein und fest, nicht abweichen vom rechten Weg, der zu Gott führt,
sei die Aufgabe des Lehrers. Stark sein und fest sei die Aufgabe der
jüdischen Gemeinde, um bestehen zu bleiben in dem Sturm und der Not, die
das Judentum umbrauen und bedrängen, besonders aber in Dinkelsbühl, das
schon an sich eine exponierte Stelle einnehme. Lehrer und Gemeinde haben
die gleiche Aufgabe, den gleichen Kampfruf, einig und mit engster
gegenseitiger Unterstützung zusammenzugehen.
In den Sprüchen der Väter (I,2) heißt es, dass die Welt auf drei Dingen
steht: Tora, Awoda (Gottesdienst) und Gemilus Chasodim (Wohltätigkeit).
Je größer die Not und die wirtschaftliche Bedrängnis sei, umso mehr
müssen wir uns zur Erhaltung unserer selbst in die Geistigkeit der Tora
hineinversenken. Unser Stolz muss es sein, die Tora wieder so zu unserem
geistigen Eigentum zu machen, wie es unsere Väter und Mütter taten und
wie es seit jeher der Stolz unserer Vorfahren war. Alles lässt sich
leichter tragen, wenn das Vertrauen auf Gott uns tragen hilft, denn Gott
verlässt uns nicht; je größere Orgien der Materialismus feiere, umso
größer muss die Herrlichkeit des Torageistes, der Torageistigkeit
werden.
Und Awoda ist nicht nur der Gottesdienst in der Synagoge. Es ist
die Tat jüdischer Pflichterfüllung. Als wichtigstes der Sabbat, die
jüdische Küche und die Reinheit der Familie.
Gemilus Chasodim, das jüdische Lev (Herz), das niemanden leiden
sehen soll. Glaubet nicht, dass die Wohltätigkeit nachlassen darf, wenn
man selbst finanziell schwächer wird. Im Gegenteil, denn alle guten Taten
werden belohnt, und wir armseligen Menschen kennen die Vorsehung des
göttlichen Willens nicht. - Hierzu führte der Herr Rabbiner als
Gleichnis die Erzählung von der Tochter des Rabbi Akiba an, die an ihrem
Hochzeitstage durch eine Liebestat vor dem Tode errettet wurde.
Aus diesem Willen zu Gemilus Chasodim müsse die Opferbereitschaft
erwachsen auch der Gemeinde gegenüber, damit das erhalten und ausgebaut
werden könne, was unter so großen Mühen geschaffen worden ist. Man
opfere so oft und so viel für andere Dinge und man müsse sich auch ein
Beispiel nehmen an unseren Feinden, die Unsummen opfern zu Zwecken, die
doch zum größten Teil gerade gegen uns gerichtet sind. Deshalb sei es
heiligste Pflicht jedes einzelnen, alles zu tun zur Erhaltung einer
jüdischen Gemeinde und ihrer Institutionen. Was bleibe denn von unserem
Judentum noch als die uns umgebende Kultus, wenn wir diese drei
Grundsäulen der Welt nicht zu unserem Eigentum machen. Tora, Awoda,
Gemilus Chasodim.
Dann werde auch der allsabbatliche Segen, der nach der Toravorlesung
ergeben werde, in Erfüllung gehen. - In tiefster Andacht sprach dann Herr
Rabbiner vor der geöffneten Lade den sabbatlichen Mischeberach, und
erflehte den Segen Gottes für die Gemeinde. Amen.
Herr Lehrer Krebs dankte dann für das Vertrauen, das man ihm durch seine
Berufung entgegenbringe und gelobte, dasselbe zu rechtfertigen, damit an
der Gemeinde das Wort der gestrigen Sidrah wahr werde: Er wird dich
lieben, dich segnen und dich vermehren (5. Mose 7,13). Mit dem Vortrag
eines Abschnittes aus dem Hallelgebet endete die Feier, die ein Beweis
dafür war, was jüdischer Wille zu leisten vermag in einer Zeit tiefster
Not, da jeder einzelne die schwersten Kämpfe um seine Existenz ausfechten
muss. Wie mache Träne wird geflossen sein und manches Herz gezuckt haben
in dem Gefühl, dass doch nicht alles verloren ist, wenn wir einige sind,
zusammenstehen und Gott mithelfen lassen, das schwere Los zutragen, unter
dem wir alle seufzen. Und in aller Not trotz alledem: Gepriesen sei
der, der uns das Leben geschenkt hat, der uns erhalten hat und uns
erreichen ließ diese Zeit". |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. August
1931: "Dinkelsbühl, 2. August (1931). Heute Vormittag
11 Uhr fand durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Munk,
Ansbach, die feierliche Einführung des neu angestellten Lehrers Karl
Krebs statt. Herr Krebs, dessen Eltern es vergönnt war, diesen Ehrentag
ihres Sohnes mitzufeiern, stammt aus einem frommen Ansbacher Haus und hat
seine Ausbildung auf dem Würzburger Seminar genossen.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. August
1931: "Dinkelsbühl, 2. August (1931). Heute Vormittag
11 Uhr fand durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Munk,
Ansbach, die feierliche Einführung des neu angestellten Lehrers Karl
Krebs statt. Herr Krebs, dessen Eltern es vergönnt war, diesen Ehrentag
ihres Sohnes mitzufeiern, stammt aus einem frommen Ansbacher Haus und hat
seine Ausbildung auf dem Würzburger Seminar genossen.
Die Feier versammelte die Gemeinde in den schon seit Jahrzehnten von Herrn
Adolf Hamburger unentgeltlich zur Verfügung gestellten Beträumen und
wurde durch Wechselvortrag der Psalmen 91 und 100 eingeleitet.
Hierauf begrüßte Herr David Levita den Herrn Rabbiner, den Herrn Lehrer,
seine Eltern und die Gemeinde. In bewegten Worten, die allen Teilnehmern
zu Herzen gingen, feierte er den heutigen Tag als eine Tat wahrhaften
Mutes der Gemeinde. Danke und Freude erfülle uns alle, dass wir diese
Feier abhalten können.
Dann ergriff Herr Rabbiner Dr. Munk das Wort zu seiner Festpredigt, die
tief in den Herzen widerklang.
Herr Lehrer Krebs dankte für das Vertrauen, das man ihm durch seine
Berufung entgegenbringe und gelobte, dasselbe zu rechtfertigen, damit an
der Gemeinde da Wort der gestrigen Sidrah wahr werde: Er wird dich lieben,
dich segnen und dich vermehren. (V. 7,13).
Mit dem Vortrag eines Abschnittes aus dem Hallel-Gebet endete die Feier,
die ein Beweis dafür war, was jüdischer Wille zu leisten vermag in einer
Zeit tiefster Not, da jeder Einzelne die schwersten Kämpfe um seine
Existenz ausfechten muss." |
Weitere Mitteilungen aus dem Gemeindeleben
Wahl des Gemeindevorstandes (1927)
 Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
9. Februar 1927: "Schopfloch - Dinkelsbühl. Am 2. Januar
(1927) wurde in der hiesigen Kultusgemeinde die Neuwahl der
Verwaltungsmitglieder vorgenommen, welche keinerlei Änderung ergab. Von
den 76 Wahlberechtigten haben 44 ihre Stimme abgegeben. Mit 43 Stimmen
wurde Samuel Herz (Schopfloch) als Kultusvorstand wiedergewählt, der
Kassier Siegfried Rosenfeld (Schopfloch) erhielt 23 Stimmen. Als Beisitzer
fungieren Herrmann (Schopfloch, 24 Stimmen), David Levite (Dinkelsbühl,
19 Stimmen) und Ludwig Ansbacher (Dinkelsbühl, 12 Stimmen).
Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
9. Februar 1927: "Schopfloch - Dinkelsbühl. Am 2. Januar
(1927) wurde in der hiesigen Kultusgemeinde die Neuwahl der
Verwaltungsmitglieder vorgenommen, welche keinerlei Änderung ergab. Von
den 76 Wahlberechtigten haben 44 ihre Stimme abgegeben. Mit 43 Stimmen
wurde Samuel Herz (Schopfloch) als Kultusvorstand wiedergewählt, der
Kassier Siegfried Rosenfeld (Schopfloch) erhielt 23 Stimmen. Als Beisitzer
fungieren Herrmann (Schopfloch, 24 Stimmen), David Levite (Dinkelsbühl,
19 Stimmen) und Ludwig Ansbacher (Dinkelsbühl, 12 Stimmen).
|
Die jüdische Gemeinde Dinkelsbühl wird gegründet
(1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1931: "Dinkelsbühl,
24. Mai (1931). Seit ca. 50 Jahren ist Dinkelsbühl Filiale der
Kultusgemeinde Schopfloch gewesen.
Rund 20 jüdische Familien wohnen in Dinkelsbühl, und der Wunsch, eine
selbständige Kehilla zu sein, führte zu der am Sonntag, den 24. Mai
erfolgten Gründung einer jüdischen Kultusgemeinde. In einer gut
besuchten Gründungsversammlung wurden in Einmütigkeit alle Punkte
beschlossen, so auch die Anstellung eines Lehrers ab 1. Juli 1931. Die
ministerielle Genehmigung wird durch den Verband bayrischer jüdischer
Gemeinden, dem auch an dieser Stelle für seine Mitarbeit gedankt sei,
beantragt. - Das seitherige Ausschussmitglied, Herr David Levite, wurde in
Anerkennung seiner bisher geleisteten Dienste für die Interessen der
Israeliten Dinkelsbühls einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Die
Wahlen ergaben weiter: 2. Vorstand: Herr Adolf Hamburger; Schriftführer:
Herr Felix Klau und Kassier Herr Max Sommer. Es wurde beschlossen, dass
das Gründungsprotokoll zum ewigen Andenken von allen
Versammlungsteilnehmern unterschrieben werden soll. Möge der jungen
Gemeinde Gottes Segen nicht fehlen zum Ruhm unseres heiligen Glaubens. J.B." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1931: "Dinkelsbühl,
24. Mai (1931). Seit ca. 50 Jahren ist Dinkelsbühl Filiale der
Kultusgemeinde Schopfloch gewesen.
Rund 20 jüdische Familien wohnen in Dinkelsbühl, und der Wunsch, eine
selbständige Kehilla zu sein, führte zu der am Sonntag, den 24. Mai
erfolgten Gründung einer jüdischen Kultusgemeinde. In einer gut
besuchten Gründungsversammlung wurden in Einmütigkeit alle Punkte
beschlossen, so auch die Anstellung eines Lehrers ab 1. Juli 1931. Die
ministerielle Genehmigung wird durch den Verband bayrischer jüdischer
Gemeinden, dem auch an dieser Stelle für seine Mitarbeit gedankt sei,
beantragt. - Das seitherige Ausschussmitglied, Herr David Levite, wurde in
Anerkennung seiner bisher geleisteten Dienste für die Interessen der
Israeliten Dinkelsbühls einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Die
Wahlen ergaben weiter: 2. Vorstand: Herr Adolf Hamburger; Schriftführer:
Herr Felix Klau und Kassier Herr Max Sommer. Es wurde beschlossen, dass
das Gründungsprotokoll zum ewigen Andenken von allen
Versammlungsteilnehmern unterschrieben werden soll. Möge der jungen
Gemeinde Gottes Segen nicht fehlen zum Ruhm unseres heiligen Glaubens. J.B." |
Gemeindeglieder helfen in Mönchsroth bei einer Beerdigung mit, um die
Minjanzahl zu erfüllen (1933)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,
30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige
Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.
Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das
Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin
fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am
Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem
ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In
ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen
der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl
nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl
mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu
ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,
30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige
Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.
Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das
Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin
fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am
Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem
ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In
ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen
der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl
nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl
mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu
ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Berichte / Anzeigen zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Anzeigen des Manufaktur-, Modewaren- und Damenkonfektionsgeschäfte J. W. Waker
(1903 / 1907)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Juni 1903: "Für mein Manufaktur-, Modewaren- und
Damenkonfektionsgeschäft suche ich per Mitte Juli - Anfang August
eine durchaus tüchtige Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Juni 1903: "Für mein Manufaktur-, Modewaren- und
Damenkonfektionsgeschäft suche ich per Mitte Juli - Anfang August
eine durchaus tüchtige
Verkäuferin
bei gutem Gehalt, angenehmer und dauernder Stellung. Offerten mit
Zeugnissen, Photographie, Gehaltsansprüchen erbeten.
J. W. Waker, Dinkelsbühl, Bayern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1907:
"Tüchtige erste Verkäuferin
suche zum baldigen Eintritte für mein
Manufaktur-, Modewaren-, Damenkonfektionsgeschäft bei gutem Salaire.
Offerten mit Zeugnissen, Photographie, Gehaltsangabe.
J. W. Waker,
Dinkelsbühl (Bayern)." |
Zum Tod von Lina Hamburger geb. Heymann (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1915:
"Dinkelsbühl, 30. November (1915). Unsere kleine Gemeinde hat leider
den Verlust einer ihrer besten Frauen zu beklagen. Frau Lina Hamburger
geb. Heymann hat nach langer Krankheit, die sie mit wahrer Gottergebenheit
ertrug, das Zeitliche gesegnet. Um sie trauert ihre Familie und die
Gemeinde. Hat sie es ja verstanden, ihr Haus zu einem echt jüdischen zu
gestalten, durch ihr liebevolles Wesen und durch mildtätige Handlungen
gegen Arme sich viele Freunde zu erwerben. Auf dem Friedhof zu Schopfloch
entwarf Herr Rabbiner Dr. Kohn, Ansbach ein getreues Lebensbild der so
früh Dahingeschiedenen, die es verdient habe, den Namen einer Eschet
Chajal (tüchtigen Frau) zu führen. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Dezember 1915:
"Dinkelsbühl, 30. November (1915). Unsere kleine Gemeinde hat leider
den Verlust einer ihrer besten Frauen zu beklagen. Frau Lina Hamburger
geb. Heymann hat nach langer Krankheit, die sie mit wahrer Gottergebenheit
ertrug, das Zeitliche gesegnet. Um sie trauert ihre Familie und die
Gemeinde. Hat sie es ja verstanden, ihr Haus zu einem echt jüdischen zu
gestalten, durch ihr liebevolles Wesen und durch mildtätige Handlungen
gegen Arme sich viele Freunde zu erwerben. Auf dem Friedhof zu Schopfloch
entwarf Herr Rabbiner Dr. Kohn, Ansbach ein getreues Lebensbild der so
früh Dahingeschiedenen, die es verdient habe, den Namen einer Eschet
Chajal (tüchtigen Frau) zu führen. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." |
Zum Tod des Gemeindegründers Robert Hamburger (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. März 1921:
"Dinkelsbühl, 29. März (1921). Einen schweren Verlust erlitt unsere
Gemeinde. Hochbetagt im 70. Lebensjahre schied Robert Hamburger aus dem
leben. Er hatte in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Minjan
in Dinkelsbühl begründet und dasselbe durch seine Bemühungen aufrecht
erhalten. Bis zu seinem Tode war er als Sch"tz (sc.
ehrenamtlicher Vorbeter) tätig. Seine Tätigkeit und Liebe galt vor allem
Erez Jisrael. Mit ihm trugen wir einen frommen und geradsinnigen
Mann zu Grabe, dessen vorbildliche Bescheidenheit und Menschenliebe
alle Herzen gewann. Möge Gott den Kindern seinen Trost schenken.
In Dinkelsbühl und auf dem altehrwürdigen Friedhof zu Schopfloch
sprach Herr Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach tief empfundene Worte
des Gedenkens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. März 1921:
"Dinkelsbühl, 29. März (1921). Einen schweren Verlust erlitt unsere
Gemeinde. Hochbetagt im 70. Lebensjahre schied Robert Hamburger aus dem
leben. Er hatte in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Minjan
in Dinkelsbühl begründet und dasselbe durch seine Bemühungen aufrecht
erhalten. Bis zu seinem Tode war er als Sch"tz (sc.
ehrenamtlicher Vorbeter) tätig. Seine Tätigkeit und Liebe galt vor allem
Erez Jisrael. Mit ihm trugen wir einen frommen und geradsinnigen
Mann zu Grabe, dessen vorbildliche Bescheidenheit und Menschenliebe
alle Herzen gewann. Möge Gott den Kindern seinen Trost schenken.
In Dinkelsbühl und auf dem altehrwürdigen Friedhof zu Schopfloch
sprach Herr Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach tief empfundene Worte
des Gedenkens." |
Verlobungsanzeige für Johanna Hamburger und Sigmund Reutlinger sowie Else
Hamburger und Louis Reutlinger (1922)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1922: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1922:
"Johanna
Hamburger - Sigmund Reutlinger / Else Hamburger - Louis Reutlinger.
Verlobte.
Dinkelsbühl (Bayern) - Pforzheim / Königsbach.
Marcheschwan 5683 / November 1922." |
Hochzeitsanzeige für Louis Reutlinger und Else geb.
Hamburger (1923)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Mai 1923: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Mai 1923:
"Statt Karten. Louis Reutlinger - Else Reutlinger geb.
Hamburger
- Vermählte -
Pforzheim - Dinkelsbühl.
Trauung - so Gott will - am Dienstag, 21. Siwan (5. Juni 1923) in
Ansbach, Hotel Zirkel". |
Übernachtungsmöglichkeiten bei Emma Weinberger
(1936)
 Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Juli 1936: Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
15. Juli 1936:
"Dinkelsbühl.
Übernachtungsmöglichkeit bei
Frau Emma Weinberger, Elsassergasse 18. Über die Sommermonate wird eine
Dame aufgenommen.
Garage steht zur Verfügung." |
Zur Geschichte der Synagoge
Über mittelalterliche Einrichtungen ist nichts
bekannt.
Die jüdische Gemeinde
des 19./20. Jahrhunderts hat sich in privaten Räumen zu Gottesdiensten
getroffen. Bereits 1885 wird ein solcher Raum vorhanden gewesen sein, da
in oben zitierter Anzeige vom Religionslehrer auch der Dienst als Vorbeter
erwartet wurde. 1923 stellte der spätere Gemeindevorsitzende Adolf
Hamburger in seinem Privathaus ein Zimmer zur Einrichtung eines Betsaales zur
Verfügung. Das Haus ist als Wohnhaus erhalten.
Am 22. April 2007 wurde am Haus des Betsaales eine Gedenktafel
angebracht (siehe Bericht und Fotos unten).
 Bericht
und Foto von Jürgen Binder, Fränkische Landeszeitung Dinkelsbühl
vom 11. April 2007 im Blick auf die Anbringung der Gedenktafel: Bericht
und Foto von Jürgen Binder, Fränkische Landeszeitung Dinkelsbühl
vom 11. April 2007 im Blick auf die Anbringung der Gedenktafel:
"Auch in Dinkelsbühl soll künftig eine Gedenktafel an die jüdische
Tradition erinnern. Zu klein für eigene Synagoge. Israelitische
Gemeinde hatte maximal 64 Angehörige - Betsaal in einem Privathaus.
Dinkelsbühl. Dinkelsbühl zählt nicht zu den Orten im südlichen
Landkreis, die an erster Stelle genannt werden, wenn es um das Thema
jüdische Tradition geht. So gab es beispielsweise in den benachbarten Dörfern
Schopfloch und Mönchsroth insbesondere im 19. Jahrhundert große
israelitische Gemeinden mit deutlich über 150 Angehörigen und Anteilen
von 15 bis 30 Prozent an der Gesamtbevölkerung, während in der
Wörnitzstadt zwischen 1880 und 1900 lediglich um die 50 Personen dieses
Glaubens lebten. Bis der nationalsozialistische Wahn alles zerstörte, war
das Nebeneinander der Kulturen aber auch hier Normalität gewesen - Grund
genug, in angemessener Weise daran zu erinnern. Dies geschieht am Sonntag,
22. April, mit der Anbringung einer Gedenktafel an jenem Gebäude in der
Klostergasse, das bis 1938 die Synagoge beherbergt hatte.
Die Initiative dazu ging aus von der Schopflocherin Angelika Brosig, die
seit einem Jahr an einer Dokumentation des jüdischen Friedhofs der
Marktgemeinde arbeitet und im Rahmen ihrer Recherchen feststellte, dass
auch viele in Dinkelsbühl wohnhafte Juden dort begraben wurden. Ein
separates Synagogengebäude gab es nicht in Dinkelsbühl. Bekannt ist
aber, dass von 1923 an im Privathaus Klostergasse 5 ein von den Gemeindemitgliedern
genutzter Betsaal bestanden hatte. Angelika Brosig nahm Kontakt auf mit
der Eigentümerfamilie. Diese erklärte sich sofort bereit, die Anbringung
eines Gedenktafel zu ermöglichen.
Deren Enthüllung wird am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr erfolgen.
Grußworte wollen Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer sowie Michael
Trüger vom Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern
sprechen, bevor Angelika Brosig in ihrem Gedenkvortrag an jene jüdischen
Familien erinnern wird, die in den Jahren der Verfolgung zwischen 1933 und
1938 aus Dinkelsbühl wegziehen mussten. Einzeln verlesen wird die
Schopflocherin auch die Namen der einstigen Bewohner dieses Hauses, von
denen bekannt ist, dass sie in Konzentrationslagern umgekommen sind.
Ihre Fortsetzung findet die Veranstaltung ab 14.30 Uhr im Konzertsaal der
benachbarten Berufsfachschule für Musik, die den Festakt auch mit Instrumentalstücken
begleitet. Michael Trüger wird über die israelitischen Kultusgemeinden
in Bayern referieren. Danach spricht Barbara Eberhardt, wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Universität Erlangen, über den Stand der Arbeiten an
einem umfassenden Synagogen-Gedenkband für den Bereich Bayern.
Der Geschichte der jüdischen Gemeinden in Bayern widmen sich auch die
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 'Alemannia Judaica' intensiv. So sind
über die Internetseiten dieses Kreises Informationen über die meisten
mittelfränkischen Orte mit jüdischer Tradition abrufbar. ...
In den folgenden Abschnitten werden die Informationen der Seite von
Alemannia Judaica zu Dinkelsbühl zusammengefasst.
|
Unten: Bericht in der Fränkischen
Landeszeitung Dinkelsbühl vom 23. April 2007
über die Anbringung der
Gedenktafel am 22. April 2007 (bitte längere Ladezeit auf Grund der
Dateigrüße beachten) |
Unten: Bericht im "Sonntagsblatt
Bayern" - Regionalausgabe Mittelfranken -
vom 22. April 2007 |
|

|

|
Adresse/Standort des Betsaales: Klostergasse 5
Fotos
(Fotos: Hahn; obere Zeile vom September 2006; weitere Fotos:
Aufnahmedatum 22.4.2007)
 |
 |
|
Das frühere
Wohnhaus der Familie Hamburger, in dem 1923 bis 1938 ein
Betsaal
eingerichtet war. |
|
| |
|
Anbringung der Gedenktafel
für die
ehemalige Synagoge am 22. April 2007 |
 |
 |
| |
Blick auf die
Teilnehmenden der Gedenkveranstaltung |
| |
|
 |
 |
 |
Ansprache von
Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer
(Mitte) |
Michael Trüger vom
Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden
in Bayern |
Angelika Brosig liest die
Namen der
in der NS-Zeit umgekommenen
jüdischen Dinkelsbühler |
| |
|
|
 |
 |
 |
Anbringung der
Gedenktafel |
von links: Oberbürgermeister
Dr. Christoph
Hammer, Angelika Brosig, Michael Trüger |
Die Gedenktafel |
| |
| |
|
|
 |
 |
|
Programmblatt der
Veranstaltung |
Gebäude der ehemaligen
Synagoge - vom
Turm des Münsters St. Georg aus gesehen |
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
|
November 2007:
Über die Geschichte der jüdischen Familie
Ansbacher
|
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. November 2007:
"Manfred Anson und dessen Schwester Sigrid sind heute die letzten
Überlebenden der jüdischen Gemeinde Dinkelsbühls. Das Heimatgefühl
überdauerte alle Schrecken. Nazis blockierten den Tuchladen der
Ansbachers am Altrathausplatz - Angelika Brosig erforschte die Geschichte
der Familie. Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. November 2007:
"Manfred Anson und dessen Schwester Sigrid sind heute die letzten
Überlebenden der jüdischen Gemeinde Dinkelsbühls. Das Heimatgefühl
überdauerte alle Schrecken. Nazis blockierten den Tuchladen der
Ansbachers am Altrathausplatz - Angelika Brosig erforschte die Geschichte
der Familie.
Zum Lesen: bitte Textabbildung links anklicken (etwas längere Ladezeit
beachten!) |
| |
| Oktober 2008:
"Stolpersteine" für die Dinkelsbühler Nazi-Opfer geplant |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 31. Oktober 2008:
"'Stolpersteine' für die Dinkelsbühler Nazi-Opfer geplant. Wider
das Vergessen. Stadtrat geschlossen dafür - Bürger will Kosten
übernehmen. Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 31. Oktober 2008:
"'Stolpersteine' für die Dinkelsbühler Nazi-Opfer geplant. Wider
das Vergessen. Stadtrat geschlossen dafür - Bürger will Kosten
übernehmen.
Dinkelsbühl (mk/ai) - In Dunkelsbühl sollen künftig 'Stolpersteine' an
Nazi-Opfer erinnern. Angeregt wurde dies durch einen Dinkelsbühler
Bürger, seine Zustimmung gab der Stadtrat jetzt einstimmig.
Zum Lesen: bitte Textabbildung links anklicken |
| |
| November
2008: Zum Vortrag von Angelika
Brosig am 5. November 2008 |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 3. November 2008:
"Im Rahmen des Evangelischen Bildungswerkes referiert Angelika Brosig
am 5. November über das Schicksal jüdischer Dinkelsbühler. Mahnung und
Gedenken auch für die Jüngeren...." Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 3. November 2008:
"Im Rahmen des Evangelischen Bildungswerkes referiert Angelika Brosig
am 5. November über das Schicksal jüdischer Dinkelsbühler. Mahnung und
Gedenken auch für die Jüngeren...."
Zum Lesen: bitte Textabbildung links anklicken (etwas längere Ladezeit
beachten!) |
 Plakat
zur Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes Dinkelsbühl: Plakat
zur Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes Dinkelsbühl:
Gedenken an 70 Jahre Reichspogromnacht - "Sigrids
Geschichte".
Das Schicksal der jüdischen Dinkelsbühler.
Am Mittwoch, den 5. November 2009
im Gemeindesaal St. Paul, Beginn um 19 Uhr.
Lesung und Vortrag: Angelika Brosig - www.juden-in-schopfloch.de |
| |
| Über den Vortrag
zu "Sigrids Geschichte" von Angelika Brosig |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. November 2008:
"An der Gedenktafel für die ehemalige Dinkelsbühler Synagoge
erinnert morgen ein Windlicht an die Reichspogromnacht 1938. Bewegende
Erinnerungen einer Zeitzeugin. Die in Dunkelsbühl geborene Sigrid
Ansbacher-Strauss überlebte fünf Konzentrationslager und Zwangsarbeit. Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. November 2008:
"An der Gedenktafel für die ehemalige Dinkelsbühler Synagoge
erinnert morgen ein Windlicht an die Reichspogromnacht 1938. Bewegende
Erinnerungen einer Zeitzeugin. Die in Dunkelsbühl geborene Sigrid
Ansbacher-Strauss überlebte fünf Konzentrationslager und Zwangsarbeit.
Dinkelsbühl (mm/mk) - Morgen, anlässlich des Gedenktages zur 70.
Wiederkehr der Reichspogromnacht 1938, wird vor der ehemaligen
Dinkelsbühler Synagoge in der Klostergasse 5 ein Windlicht leuchten.
Über das Schicksal einer jüdischen Dinkelsbühlerin, Sigrid
Ansbacher-Strauss, die den Holocaust überlebt hat und heute in den
Vereinigten Staaten zuhause ist, berichtete Angelika Brosig im Rahmen des
Evangelischen Bildungswerkes"
Zum Lesen: bitte Textabbildung anklicken (etwas längere Ladezeit
beachten!) |
| |
| "Stilles
Gedenken" am 70. Gedenktag des Novemberpogroms 1938 (2008) |
| Foto von Angelika Brosig,
Schopfloch |
 |
 |
|
| |
| |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 18. Dezember 2008:
"Nach Vortrag koscher gekocht. Dinkelsbühl - Über das
'Judentum früher und heute' referierte Angelika Brosig aus Schopfloch in
der Hans-von-Raumer-Hauptschule. Bei ihrem Vortrag vor den fünften bis
siebten Klassen ging sie auch auf die Frage 'Was ist koscher?' ein. Im
Anschluss an den interessanten und informativen Vortrag, kochte Angelika
Brosig mit der Fachlehrerin Anja Scherb und der Schülerfirma jüdische
Speisen koscher..." Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 18. Dezember 2008:
"Nach Vortrag koscher gekocht. Dinkelsbühl - Über das
'Judentum früher und heute' referierte Angelika Brosig aus Schopfloch in
der Hans-von-Raumer-Hauptschule. Bei ihrem Vortrag vor den fünften bis
siebten Klassen ging sie auch auf die Frage 'Was ist koscher?' ein. Im
Anschluss an den interessanten und informativen Vortrag, kochte Angelika
Brosig mit der Fachlehrerin Anja Scherb und der Schülerfirma jüdische
Speisen koscher..." |
| |
| |
|
Januar 2009:
Verleihung
des "Rotarischen Meilensteins 2008" des Rotary Clubs Dinkelsbühl-Feuchtwangen
am 13. Januar 2009 an Angelika Brosig
|
|
 |
 |
 |
| Auszeichnung
für Angelika Brosig: "Rotarischer Meilenstein 2008" mit
Urkunde: "In Anerkennung und dankbarer Würdigung der humanitären
und kulturellen Verdienste um den jüdischen Friedhof in Schopfloch
verleiht der Rotary Club Dinkelsbühl-Feuchtwangen den Rotarischen
Meilenstein 2008 an Angelika Brosig, Schopfloch" |
Eintreffen der
Gäste im Konzertsaal
der Stadt Dinkelsbühl im Spitalhof |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Von links:
Rabbiner Jakov Ebert (Würzburg),
Präsidentin Charlotte Knobloch,
Angelika Brosig |
Gastgeber und
Ehrengäste
bei der Preisverleitung |
Von links:
Präsidentin Charlotte Knobloch,
Angelika Brosig und Rabbiner Jakov Ebert |
| |
|
|
 |
 |
 |
Die Laudatorin
Helga Deininger
aus Feuchtwangen |
Verleihung des
Preises durch
Dr. Wolfgang Langer (Rotary Club) |
Charlotte
Knobloch, Präsidentin des
Zentralrates der Juden in Deutschland |
| |
|
|
 |
 |
 |
| |
Eine
Schülergruppe aus Dinkelsbühl
bereitete den anschließenden Imbiss vor |
Gespräch und
Imbiss
nach der Preisverleihung |
| |
|
|
|
 Presseartikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" am 15. Januar 2009 (bitte
auf Grund der Dateigröße die etwas längere Ladezeit beachten):
"Der 'Rotarische Meilenstein 2009' ging an die Schopflocherin
Angelika Brosig. Hartnäckige Erinnerungspflege. Intensiver Einsatz für
Sanierung und Bewahrung der Gräber des jüdischen Friedhofs. Presseartikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" am 15. Januar 2009 (bitte
auf Grund der Dateigröße die etwas längere Ladezeit beachten):
"Der 'Rotarische Meilenstein 2009' ging an die Schopflocherin
Angelika Brosig. Hartnäckige Erinnerungspflege. Intensiver Einsatz für
Sanierung und Bewahrung der Gräber des jüdischen Friedhofs.
Dinkelsbühl / Schopfloch (bi). - Charlotte Knobloch, Präsidentin des
Zentralrats der Juden in Deutschland, gehört zu den gefragtesten Personen
des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik. Mit ihrem Besuch in
Dinkelsbühl unterstrich sie am Dienstabend die Bedeutung der
ehrenamtlichen Arbeit einer Frau, die sich mit großem Nachdruck und hohem
persönlichen Krafteinsatz der fränkisch-jüdischen Erinnerungspflege
widmet: Angelika Brosig wurde für ihr Engagement zugunsten der
Restaurierung und Bewahrung des jüdischen Friedhofs in Schopfloch mit dem
'Meilenstein 2009' des Rotary-Clubs Dinkelsbühl-Feuchtwangen
ausgezeichnet. Charlotte Knobloch dankte der Gruppe für die Wahl dieser
Preisträgerin, die wahrhaft Großartiges leiste."
Zum
weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.
|
| |
|
|
|
 Presseartikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" am 15. Januar 2009 (bitte
auf Grund der Dateigröße die etwas längere Ladezeit beachten):
"Charlotte Knoblich, Präsidentin des Zentralrats der Juden, über
die Lage im Gazastreifen. Ende der Raketenüberfälle Voraussetzung für
Frieden. Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war wegen
einer Ehrung nach Dinkelsbühl gekommen. Presseartikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" am 15. Januar 2009 (bitte
auf Grund der Dateigröße die etwas längere Ladezeit beachten):
"Charlotte Knoblich, Präsidentin des Zentralrats der Juden, über
die Lage im Gazastreifen. Ende der Raketenüberfälle Voraussetzung für
Frieden. Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war wegen
einer Ehrung nach Dinkelsbühl gekommen.
Dinkelsbühl. - Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentralrats der
Juden in Deutschland, nahm am Dienstagabend an einer Veranstaltung in
Dinkelsbühl teil, in der die Schopflocherin Angelika Brosig vom
Rotary-Club Dinkelsbühl-Feuchtwangen für ihr Engagement bei der Pflege
des jüdischen Friedhofs in ihrem Wohnort ausgezeichnet wurde. Am Rande
des Feierstunde hatte die Fränkische Landeszeitung Gelegenheit, den
Ehrengast aus München unter anderem zur aktuellen Situation im
Gazastreifen zu befragen."
Zum Lesen des Interviews bitte Textabbildung anklicken.
|
| |
|
Mai 2009:
Nachfahren des jüdischen Arztes Dr. Moritz
Mannheimer auf Spurensuche |
|
 Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 14. Mai 2009:
"Erinnerung an den jüdischen Arzt in Dinkelsbühl bis 1861: Dr.
Moritz Mannheimer - Nachfahren waren jetzt auf Spurensuche. Einen Platz
im Haus der Geschichte gefunden. Marsha und Bob Wilt waren auch auf
Schopflochs jüdischem Friedhof und beim Gedenkstein in
Mönchsroth. Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 14. Mai 2009:
"Erinnerung an den jüdischen Arzt in Dinkelsbühl bis 1861: Dr.
Moritz Mannheimer - Nachfahren waren jetzt auf Spurensuche. Einen Platz
im Haus der Geschichte gefunden. Marsha und Bob Wilt waren auch auf
Schopflochs jüdischem Friedhof und beim Gedenkstein in
Mönchsroth.
Dinkelsbühl (pm) - Auf den Spuren ihrer jüdischen Vorfahren waren
dieser Tage Marsha und Bob Wilt aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie begaben sich auf Spurensuche in Dinkelsbühl, Mönchsroth und
Schopfloch.
Marsha und Ehemann Bob Wilt kamen aus Arizona, USA, zur Familienforschung
nach Deutschland, insbesondere nach Dinkelsbühl. Marsha ist eine Enkelin
fünften Grades des jüdischen Arztes Dr. Moritz Mannheimer, der von 1853
bis kurz vor seinem Tode am 28. Mai 1861 im damaligen Dinkelsbühler
Hospital praktizierte. Moritz (Moshe) Mannheimer war 1808 in Schopfloch
geboren, er hatte in München studiert. Erst praktizierte er als
praktischer Arzt in Mönchsroth, dann zog er mit seiner Familie nach
Dinkelsbühl, nachdem er dort eine Stelle als Hospitalsarzt erhalten
hatte..." Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.
|
|
|
|
Juni 2009:
Dinkelsbühler Hauptschüler besuchen Charlotte
Knobloch im jüdischen Zentrum Münchens |
|
 Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 19. Juni 2009: "Eine
beeindruckende Begegnung. Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 19. Juni 2009: "Eine
beeindruckende Begegnung.
Präsidentin des Zentralrates der Juden hatte die Jugendlichen im Januar eingeladen.
Dinkelsbühl / München (pm). Kontakte zu jüdischen Jugendlichen
knüpften Dinkelsbühler Hauptschüler in München. Sie hatten auf
Einladung der Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland,
Charlotte Knobloch, das neue jüdische Zentrum im Herzen der Stadt
besucht..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.
|
| |
| Oktober
2009: Die Verlegung von
"Stolpersteinen" in Dinkelsbühl verlief nicht für alle
befriedigend |
 Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 15. Oktober 2009:
"Verlegung von 'Stolpersteinen' mit den Namen jüdischer Bürger
hat ein Nachspiel. Angelika Brosig bereut Mitarbeit. Dem OB fehlt für die
Kritik jegliches Verständnis - Auch Hans Rosenfeld schüttelt den
Kopf. Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 15. Oktober 2009:
"Verlegung von 'Stolpersteinen' mit den Namen jüdischer Bürger
hat ein Nachspiel. Angelika Brosig bereut Mitarbeit. Dem OB fehlt für die
Kritik jegliches Verständnis - Auch Hans Rosenfeld schüttelt den
Kopf.
Dinkelsbühl (bi) - Für Diskussionen sorgt Gunter Demnigs 'Stolperstein'-Projekt,
seit es der Künstler vor einigen Jahren in großem Stil startete.
Inzwischen hat der Kölner Bildhauer in über 400 Städten und Gemeinden
mehr als 25.000 Messingplatten gesetzt. in die die Namen von Opfern des
Naziterrors eingraviert sind. Anfang Oktober verlegte er 25 dieser persönlichen
Erinnerungssymbole auch in der Dinkelsbühler Altstadt - vor Häusern, in
denen später deportierte und ermordete Juden gewohnt hatten (wir
berichteten). Die erforderlichen biografischen Daten hatte ihm Angelika
Brosig zur Verfügung gestellt, die sich seit Jahren für den Schopflocher
Judenfriedhof engagiert. Das sei ein Fehler gewesen, sagt Angelika Brosig
jetzt und kritisiert sowohl die Standorte der Steine als auch deren
Intention..."
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
| Juni
2011: Auf den Spuren der Vorfahren in
Dinkelsbühl und Schopfloch |
 Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 17. Juni 2011: "US-amerikanische
Historikerin besuchte Dinkelsbühl und Schopfloch - Vorfahr war einst als
Spitalarzt tätig gewesen. Auf den Spuren des Ururgroßvaters unterwegs.
Vor 150 Jahren verstorben - Angelika Brosig hilft der Frau seit Jahren bei
familiengeschichtlichen Recherchen. Artikel
aus der "Fränkischen Landeszeitung" vom 17. Juni 2011: "US-amerikanische
Historikerin besuchte Dinkelsbühl und Schopfloch - Vorfahr war einst als
Spitalarzt tätig gewesen. Auf den Spuren des Ururgroßvaters unterwegs.
Vor 150 Jahren verstorben - Angelika Brosig hilft der Frau seit Jahren bei
familiengeschichtlichen Recherchen.
Dinkelsbühl / Schopfloch (pm/bi) - Seit Jahren steht Angelika Brosig,
Initiatorin des Schopflocher Judenfriedhof-Projekts, in engem Kontakt mit
der im US-Bundesstaat Wisconsin lebenden Historikerin und Genealogin
Francis Loeb-Luebke, deren Ururgroßvater Dr. Moritz Mannheimer von 1853
bis zu seinem Tod 1861 als Arzt in Dinkelsbühl tätig gewesen war. Nun
kam es in Schopfloch zu einem persönlichen Treffen. Francis Loeb-Luebke
nutzte den Aufenthalt, um ihre Familienforschungen zu vertiefen....
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
| Januar
2012: Zum Tod von Manfred Ansbacher (Familienname
in den USA: Anson) |
 Links:
Nachruf in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 9. Januar 2012
mit Todesanzeige von Angelika Brosig (Schopfloch). Der in Dinkelsbühl
geborene Manfred Ansbacher war einer der letzten überlebenden
Dinkelsbühler der Judenverfolgung der NS-Zeit. Links:
Nachruf in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 9. Januar 2012
mit Todesanzeige von Angelika Brosig (Schopfloch). Der in Dinkelsbühl
geborene Manfred Ansbacher war einer der letzten überlebenden
Dinkelsbühler der Judenverfolgung der NS-Zeit. |
 Links:
Manfred Ansbacher (Anson) wurde in den USA als Schöpfer eines kunstvollen
Chanukka-Leuchters und als Sammler von Judaika bekannt. Foto links
(erhalten von Angelika Brosig, Schopfloch): Chanukkiah (Chanukka-Leuchter)
mit den Freiheitsstatuen. Links:
Manfred Ansbacher (Anson) wurde in den USA als Schöpfer eines kunstvollen
Chanukka-Leuchters und als Sammler von Judaika bekannt. Foto links
(erhalten von Angelika Brosig, Schopfloch): Chanukkiah (Chanukka-Leuchter)
mit den Freiheitsstatuen.
Vgl. hierzu den blog.skirball.org:
"The Statue of Liberty and the hanukkah Lamp It Inspired" (posted
on Dec. 22, 2011 by Grace Cohen Grossman).
Weiterer Link zu einem Presseartikel von Jay Levin in Northjersey.com vom
7. Januar 2012: "Grateful immigrant prized his faith, country.
Manfred Anson of Bergenfield was a staunch Zionist, proud American and
creative spirit. Those traits are reflected in his Statue of Liberty
Hanukkah menorah...". Link
zum Artikel.
Weiterer Artikel zum Leuchter im "Münchner Sonntagsblatt"
(Kirchenkreis Ansbach-Würzburg" vom 23. November 2014: "Obama
gedenkt Dinkelsbühler Juden. Eine sehr gut besuchte Veranstaltung zur
Pogromnacht". . |
| März 2012: Veranstaltung zur
"Woche der Brüderlichkeit" 2012 |
 60 Jahre Woche der Brüderlichkeit
60 Jahre Woche der Brüderlichkeit
Ökumenische Veranstaltung der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg und
der Evangelischen Kirchengemeinde Dinkelsbühl
Manfred Ansbacher - Kind der Stadt Dinkelsbühl -
Ein jüdisches Schicksal.
Vortrag, Lesung mit Bildern
mit Angelika Brosig, Friedhofsprojekt www.juden-in-schopfloch.de
Donnerstag, 15. März 2012, 19.30 Uhr
Katholische Pfarrzentrum St. Georg, Großer Saal. |
| |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" (Lokalausgabe) vom 10. März
2012: "Gedenkveranstaltung zur Woche der Brüderlichkeit: Erinnerung
an Manfred Ansbacher-Anson. Sorglose Kindheit ermöglichte Leben ohne
Hass. Angelika Brosig berichtet aus der Biografie des gebürtigen
Dinkelsbühlers und liest aus seinen Jugenderinnerungen..." Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" (Lokalausgabe) vom 10. März
2012: "Gedenkveranstaltung zur Woche der Brüderlichkeit: Erinnerung
an Manfred Ansbacher-Anson. Sorglose Kindheit ermöglichte Leben ohne
Hass. Angelika Brosig berichtet aus der Biografie des gebürtigen
Dinkelsbühlers und liest aus seinen Jugenderinnerungen..."
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
 Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" (Lokalausgabe) vom 18. März
2012: "Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit erinnerte Angelika
Brosig an Manfred Ansbacher-Anson. Sehnsucht nach Heimat nie gestillt.
Initiatorin des SChopflocher Friedhofsprojektes berichtete auch über
Aktionen in den kommenden Monaten..." Artikel
in der "Fränkischen Landeszeitung" (Lokalausgabe) vom 18. März
2012: "Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit erinnerte Angelika
Brosig an Manfred Ansbacher-Anson. Sehnsucht nach Heimat nie gestillt.
Initiatorin des SChopflocher Friedhofsprojektes berichtete auch über
Aktionen in den kommenden Monaten..."
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken. |
| |
|
|
|
Erinnerung an Manfred
Ansbacher
(Fotos und Text zusammengestellt von
Gerhard Gronauer, Dinkelsbühl
November 2014) |
 |
 |
 |
DINKELSBÜHLER FERTIGTE CHANUKKA-LEUCHTER FÜRS WEISSE HAUS.
Der ehemalige Dinkelsbühler Manfred Ansbacher (1922-2012), der sich in den USA Anson nannte, hat einen besonderen
Chanukka-Leuchter hergestellt, der in den USA zu hohen Ehren gekommen ist. Unbemerkt von
den Dinkelsbühlern wurde dieser am 5. Dezember 2013 bei der White House Hanukka Reception verwendet und von Präsident Obama gewürdigt
(Foto links).
Manfred Ansbacher/Anson (Foto in der Mitte mit seinem Leuchter kurz vor seinem Tod) wohnte als Kind am Altrathausplatz 11. Das
Foto rechts zeigt ihn 1932 als Mitglied des Knabenbattallions bei der Kinderzeche. 1936 ging er nach Norddeutschland in die Lehre und konnte - er war Jude - rechtzeitig nach England fliehen, während seine Familie viele Jahre KZ durchleiden musste. Seine Eltern überlebten, starben aber in den USA an den gesundheitlichen Folgen, bevor Manfred zu ihnen kommen konnte. Manfreds Bruder Heinz wurde 16-jährig im KZ Majdanek
ermordet. Heinz Ansbacher wurde in Dinkelsbühl ein
"Stolperstein" verlegt.
Manfred Ansons Leuchter besteht aus Freiheitsstatuen. Für ihn war dies
ein Zeichen von Dankbarkeit: Während er in Deutschland verfolgt wurde,
fand er eine neue Heimat in den USA.
Präsident Obama sagte bei der White House Hanukka Reception: "America, a place where no matter who you are, you can always celebrate your faith. And that same spirit is reflected in the menorah that we’re about to light.
It was designed by Manfred Anson, who was born in Germany in 1922. And as a child he lived through the horrors of Kristallnacht, and later lost a brother to the Holocaust. But Manfred escaped. And like the Maccabees at the center of the Hanukkah story, he fought against tyranny, serving in the Australian army during World War II. And like the Maccabees, after the war was over he sought a place where he could live his life and practice his religion free from fear. So for Manfred and millions like him, that place was ultimately
America. And Manfred passed away last year, but during his life he designed this special menorah, with a model of the Statue of Liberty at the base of each candle -- I don’t know if you've noticed that. In a few moments, all nine lady liberties will be shining, a reminder that our country endures as a beacon of hope and of freedom wherever you come from, whatever your
faith." |
Artikel zum Leuchter im
"Münchner Sonntagsblatt" (Kirchenkreis Ansbach-Würzburg"
vom 23. November 2014: "Obama
gedenkt Dinkelsbühler Juden. Eine sehr gut besuchte Veranstaltung zur
Pogromnacht".
Link zum der Chanukka-Zeremonie 2013 im Weißen Haus: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/12/05/president-obama-speaks-afternoon-hanukkah-reception
|
| November
2013: Jugendliche gedenken an den
Novemberpogrom 1938 |
Artikel in der
"Fränkischen Landeszeitung" (Lokalausgabe) vom 12. November
2013: "9. November: Jugendliche gedachten der Verfolgung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger Dinkelsbühls
DINKELSBÜHL – Die 46 Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Dinkelsbühl haben am 9. November des 75. Jahrestages der Novemberpogrome 1938 gedacht. Begleitet von den Pfarrern Dr. Gerhard Gronauer und Gerhard Roth sowie der Dekanatsjugendreferentin Evelyn Walter gingen die Jugendlichen zu den Wohnhäusern der fast 20 jüdischen Personen, die am 9. November 1938 noch in Dinkelsbühl lebten. Von ihnen kam über die Hälfte bis Kriegsende um oder wurde in Tötungslagern ermordet. Über 40 Dinkelsbühler Juden hatten bereits zwischen 1933 und 1938 die Stadt aufgrund der Repressalien verlassen.
In den Rundgang der Jugendlichen waren die aus Messing hergestellten 'Stolpersteine' maßgeblich einbezogen, die der Künstler Gunter Demnig 2009 in Dinkelsbühl verlegt hatte und welche die Namen der ihrer Heimat und ihres Lebens beraubten jüdischen Dinkelsbühler tragen. Die Konfirmanden legten an den Stolpersteinen Rosen ab, an denen selbstbeschriftete Papierstreifen befestigt waren. Dort hatten die Jugendlichen zuvor Sätze darauf geschrieben wie:
'Das darf nie wieder passieren.' Durch diese 'Stolperrosen' zogen die im Alltag nicht immer beachteten Stolpersteine für einen Tag wieder die Aufmerksamkeit der Anwohner und Passanten auf sich.
Bei dem Novemberpogrom am 9. November 1938, auch 'Reichspogromnacht' oder 'Reichskristallnacht' genannt, drangen in den frühen Morgenstunden SA-Leute in die Wohnungen der noch in Dinkelsbühl lebenden Juden ein, demütigten sie, schlugen und verletzten sie zum Teil und zerstörten Fensterscheiben, Möbel, Gläser und anderes Inventar. Am Tag darauf wiederholten die Nazis ihren Rundgang der Gewalt und schändeten zudem den Synagogenraum in der Klostergasse 5: Sie warfen die Thorarollen und Gebetbücher auf die Straße und verbrannten sie unter den Blicken tatenlos herumstehender Dinkelsbühler. Besonders perfide war, dass der Bürgermeister Fritz Lechler höchstpersönlich die Schläger anführte und selbst mit Hand anlegte. In den nächsten beiden Tagen verließen alle jüdischen Bürger wegen der massiven Bedrohung Dinkelsbühl. Als die Stadt am 13. November im Schrannenfestsaal den stellvertretenden Gauleiter Karl Holz empfing, wurde Bürgermeister Lechler von ihm auf die Bühne gebeten und mit Handschlag beglückwünscht, dass nun auch Dinkelsbühl
'judenfrei' sei.
Beim Gedenkgang bewegte die Jugendlichen zum Beispiel das Schicksal der Familie Schloßberger in der Segringer Straße 44. Josef und Martha Schloßberger wurden mit ihren drei Kindern Jost, Maximilian und Beatrix 1942 im Tötungslager Reval in Estland ermordet.
Entsetzt waren die Konfirmanden, als sie in der Elsassergasse 18 erfuhren, dass hier der Bürgermeister Frau Saly Birk, ihren Sohn Kurt und ihre Schwiegermutter Emma Weinberger frierend im Nachthemd auf die Straße trieb, um sie fotografieren zu lassen und sich über sie lustig zu machen. Zudem wurde der zwölfjährige Kurt verprügelt. Kurt konnte später in die USA fliehen; Saly Birk und Emma Weinberger kamen 1942 und 1943 in Lagern um. In der Langen Gasse 28 hörten die Jugendlichen, dass die Dinkelsbühler Schläger Emil Hamburger in einen Spiegel warfen, wodurch sein eines Auge für immer verloren war. Mit nur einem Auge konnte sich Hamburger 1939 nach Palästina retten, wo neun Jahre später der Staat Israel gegründet werden sollte.
Pfarrer Gronauer erklärte abschließend, dass alle diese Gewalttaten mitten unter uns, ja in unserer Stadt geschahen. Was hier passiert war und als Schuld zu bezeichnen ist, dürfe nicht verdrängt werden. In einem Gebet fügte er hinzu:
'Wir bitten, dass Wunden und Verletzungen heilen, die Christen den Juden zugefügt haben. Wir bitten für die Überlebenden der Deportationen und Konzentrationslager, dass sie leben können mit ihren Wunden. Und wir bitten für die Nachkommen, die trauern und nicht vergessen können, dass sie Linderung finden in ihrem Schmerz und Vertrauen möglich
wird.'" |
| |
|
|
|
Fotos von der
Gedenkveranstaltung
(erhalten von Gerhard Gronauer,
Dinkelsbühl) |
 |

|
 |
| November 2014:
Rundweg entlang der "Stolpersteine" in
Dinkelsbühl |
Artikel von Dieter Reinhardt in der
"Fränkischen Landeszeitung" vom 11. November 2014: "Über
'Stolpersteine' gegen das Vergessen. Heute vor 76 Jahren mussten die
letzten 19 Dinkelsbühler Juden die Stadt verlassen - Ein Rundgang der
besonderen Art..."
Link
zum Artikel (eingestellt als pdf-Datei) |
| |
| Mai 2015:
Gesprächsabend zum Kriegsende mit Dr. Gerhard
Gronauer |
 links: Artikel in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. Mai
2015: "Zeitzeugen schilderten Bewegendes. Gesprächsabend zum
Kriegsende vor 70 Jahren im Gemeindehaus - Hinweis auf
'Stolpersteine...'
links: Artikel in der "Fränkischen Landeszeitung" vom 8. Mai
2015: "Zeitzeugen schilderten Bewegendes. Gesprächsabend zum
Kriegsende vor 70 Jahren im Gemeindehaus - Hinweis auf
'Stolpersteine...'
Zum Lesen des Artikels bitte Abbildung links
anklicken. |
| |
| November 2015:
Rundgang auf den Spuren der jüdischen
Geschichte |
Artikel in der "Fränkischen
Landeszeitung" vom 14. November 2015: "Fackelrundgang auf
jüdischen Spuren in der Altstadt. Rund 30 Interessierte hatten sich mit
Pfarrer Dr. Gronauer auf den Weg
gemacht..."
Link zum
Artikel (eingestellt als
pdf-Datei) |
| |
|
Mai 2020:
Die "Stolpersteine" werden
durch die "Grüne Jugend Dinkelsbühl" geputzt |
Artikel im "Fränkischer.de" vom 10. Mai
2020: "Dinkelsbühl: Gegen das Vergessen – Grüne Jugend Dinkelsbühl putzt
Stolpersteine und gedenkt der ermordeten Juden.
Vor 75 Jahren kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Am 8. Mai wird jährlich
der Sieg über Nazi-Deutschland und den Nationalsozialismus gefeiert. Um ein
Zeichen der Erinnerung zu setzen, säuberte die Grüne Jugend Dinkelsbühl zum
Tag der Befreiung Stolpersteine in der Dinkelsbühler Altstadt und legte
anschließend an jedem Standort weiße Rosen nieder. 'Die Stolpersteine
lehren uns, die Opfer des Nationalsozialismus niemals zu vergessen',
erklärten die GJ-Sprecher Katharina Sparrer und David Schiepek. 'Jeder
einzelne Stein steht für ein Menschenleben, das unter der grausamen Diktatur
verfolgt, vertrieben, deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben
wurde. Wir alle tragen die Verantwortung, dass sich so etwas niemals
wiederholt'. Weiter erklärten sie: 'Diese Steine geben den Ermordeten ihren
Namen und somit ihre Menschenwürde wieder. Sie erinnern uns daran, dass die
Menschen Nachbarn oder Freunde waren.' Die rund 15 Stolpersteine in
Dinkelsbühl wurden im Jahr 2009 gesetzt. Sie befinden sich in der Segringer
Straße, in der Klostergasse an der ehemaligen Synagoge, am Altrathausplatz
und an zwei Standorten in der Langen Gasse. Durch Wetter, Wind und Verkehr
oxidiert die Messingoberfläche der rund 15 Stolpersteine in Dinkelsbühl,
wird dadurch dunkel und ist somit leicht im Pflaster zu übersehen. Mit der
Aktion der Grünen Jugend wurde allen Steinen wieder neuer Glanz verliehen.
Sie sollen die Dinkelsbühler weiterhin 'zum Stolpern' bringen und Mahnmal
sein. Auch mahnte die Grüne Jugend, dass der 8. Mai 1945 nicht das Ende
antisemitischer, nationalsozialistischer und rassistischer Ideologie in
Deutschland sei. Faschistische Taten jüngster Vergangenheit zeigen, dass der
Kampf gegen Faschismus und rechten Hass jeden Tag weitergeführt werden
müsse. Das Sprecherduo sprach sich außerdem dafür aus, den 8. Mai zum Feier-
und Gedenktag zu erklären."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,1 S. 165-166; III,2 S. 234-235. |
 | Ludwig Schnurrer: Zur Geschichte der Juden in der
Reichsstadt Dinkelsbühl. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für
Mittelfragen Bd. 84 Ansbach 1967/68. S. 170-184. |
 | August Gabler: Die letzte Judengemeinde in
Dinkelsbühl (bis 1938). In: Genealogie 1973 Heft 11. S. 731-738. |
 | Wolfgang Hammerl: Juden in Dinkelsbühl von
1862-1938. In: Jahrbuch des Historischen Vereins
"Alt-Dinkelsbühl" für 1980/82 S. 51-81. Dinkelsbühl 1982. |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 168-169. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 150. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 294-295.
|
 |  "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010. "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010.
Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu.
ISBN 978-3-89870-448-9. Abschnitt zu Dinkelsbühl S.
175-179. |
 |
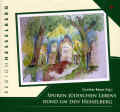 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,
Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Dinkelsbuehl Middle
Franconia. Jews were victims of the Rindfleisch massacres of 1298, maintaining a
community until expelled in 1400. Jews arriving in Dinkelsbuehl during the
Thirty Years War (1618-1648) were expelled in 1648. The community formed on the
late 19th century numbered 49 (total 5.286) in 1880. Of the 64 Jews present in
1933, 17 emigrated and 28 left for other German cities before November 1938. The
last 18 were expelled shortly after Kristallnacht (9-10 November 1938).



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|