|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"
Mönchsroth (Kreis
Ansbach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
I)
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde:
A)
Darstellung von Gunther Reese, Pfarrer in Mönchsroth (2006)
B)
Zusammenstellung von einzelnen Fakten aus der Geschichte
II)
Berichte aus der Geschichte der Gemeinde
- Aus
der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
- Mitteilungen
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
- Aus
dem jüdischen Gemeindeleben
- Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
- Weitere Dokumente
- Sonstiges
III Zur Geschichte der Synagoge
Adresse/Standort
der Synagoge
IV Fotos
V)
Einzelne Presseartikel
VI) Links und Literatur
I) Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
A)
Darstellung von Gunther Reese, Pfarrer in Mönchsroth (2006):
1. Die Anfänge und die Herrschaftsverhältnisse. Die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Mönchsroth
liegen im Dunkeln.
Ein erster Beleg für Mönchsrother Juden
findet sich in einem Nördlinger Messe-Begleitbuch aus dem Jahr 1593
. Diese Register verzeichneten seit 1587 sämtliche Juden, die sich zum
Besuch der Nördlinger Pfingstmesse einfanden. Der Bildung des schwäbisch- fränkischen
Landjudentums vorangegangen war die bereits im 15. Jahrhundert beginnende Zeit
der Vertreibung der Juden aus den Reichsstädten Süddeutschlands. Mit der
Aufhebung des Zinsverbotes und den damit verbundenen neuen wirtschaftlichen
Perspektiven für die christlichen Unternehmer ging die Monopolstellung der
Juden im Geldgeschäft und damit ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage verloren.
Zu Neid und Missgunst, religiöser und sozialer Ausgrenzung kam nun
wirtschaftliches Konkurrenzdenken hinzu, begünstigt durch die Vorbehalte des
traditionellen christlichen Antijudaismus. Aufnahme fanden die Juden bei den
kleineren Herrschaften, so auch bei der seit 1522 über Mönchsroth regierenden
evangelischen Linie der Grafen von Oettingen-Oettingen. Bereits im Jahr 1331
hatten die Oettinger Grafen vom Kaiser das Judenregal erhalten. Die in den
Territorien ansässigen Juden waren zunächst vorwiegend als Gesinde auf den
herrschaftlichen Schlössern tätig. Nach der Vertreibung der Juden aus Nördlingen
1507 wuchs der Anteil der Juden in den ländlichen Gemeinden rasch an.
Vielleicht war diese Vertreibung auch der Ausgangspunkt für eine Besiedelung in
Mönchsroth. Der nächste Hinweis
findet sich dann erst wieder nach dem 30jährigen Krieg in
einem Schreiben des Oberamts Mönchsroth vom 24. Dezember 1655, in
welchen Schuldrückzahlungen an die Erben des verstorbenen Juden Abraham Hänle
untersagt werden. Nach dem Tod des kinderlosen Fürst Albrecht Ernst II
(1669-1731) fiel der Mönchsrother Besitz an die Linie Oettingen-Spielberg. Der
Landesherr ließ sich den über
Schutzbriefe geregelten Judenschutz mit einer ganzen Reihe von Abgaben gut
bezahlen. Der erste Gesamtschutzbrief für die Judenschaft im Fürstentum
Oettingen-Oettingen ist vom 28.08.1697 datiert, ein Separatschutzbrief für
Mönchsroth existiert für das Jahr 1757. Sämtliche Lebensbereiche
wurden in diesen Schutzbriefen detailgenau geregelt: Schutzaufnahme- und
Beendigung, Abgabenzahlung, Erwerbstätigkeit, Teilhaben an den Gemeinderechten,
rabbinische Gerichtsbarkeit und "gute Policey”, d.h. die Einrichtung eines
Zustands guter Ordnung im Gemeinwesen. Dadurch unterlagen die Juden in den
Landgemeinden im Vergleich zu ihren christlichen Nachbarn mehr und vielfältigeren
Einschränkungen. Es war ihnen weder die Ausübung eines Handwerks noch die
Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebs gestattet. Sie durften
allenfalls eine Sölde besitzen, ohne jedoch einen landwirtschaftlichen Grund zu
bearbeiten.
2. Die Etablierung und Blüte der Gemeinde im 18. Jahrhundert. Nach dem
Dreißigjährigen Krieg stieg die Zahl der in Mönchsroth und auch im
benachbarten württembergischen Regelsweiler (Gemeinde Stödtlen) ansässigen
Juden, vor allem dann im 18. Jahrhundert, kontinuierlich an.
Während 1701 drei Haushaltsvorstände verzeichnet sind, waren es
1758 bereits 17. Fünf Jahre später werden für 24 Haushalte 111 Personen
aufgelistet. Am 29. August 1761 erfolgte die feierliche Einweihung der
neuen Synagoge mit Mikwe, Schulraum und Lehrerwohnung (weitere Angaben
siehe unten - Abschnitt zur Synagoge).
3. Die Veränderungen im 19. Jahrhundert. Die
zunehmende Emanzipation und die sich durch das Judenedikt von 1813 neu ergebende
Rechtslage im neu entstandenen Königreich Bayern brachten ab dem ersten Viertel
des 19. Jahrhunderts auch für die Mönchsrother Gemeinde grundlegende
Veränderungen mit sich.
Auswanderungen und Landflucht in die Städte reduzierten die Gemeinde
erheblich. Wirtschaftliche Not und der erst 1861 aufgehobene Matrikelzwang
verhinderten ein weiteres Anwachsen in den ländlichen Gemeinden. Zählte Mönchsroth
1833 noch bei einer Gesamteinwohnerzahl von 1010 Personen 208 Juden, so waren es
1898 nur noch 108 Personen. Ein Auswandererbeispiel ist der am 10. September
1819 in Mönchsroth geborene Abraham Kohn. 1842 verließ er seine
Heimat in Richtung Amerika fasste nach seinen Wanderjahren
in Chicago Fuß und wurde 1847 zum Mitbegründer der dortigen jüdischen
Gemeinde Kehillat Anshe Ma’ariv (Gemeinschaft der Männer des Westens), als
deren Präsident er seit 1853 vorstand. Berühmt
wurde er, als er 1861 dem neu gewählten Präsident Abraham Lincoln eine
amerikanische Fahne schickte, bestickt mit hebräischen Worten aus dem Buch
Josua, 1,4-9: "Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost
und unverzagt (V.5)". Er verstarb 1871 im Alter von 52 Jahren in Chicago.
1813, im Jahr der Matrikelerfassung, geben
von den 42 Haushaltsvorständen 18 Viehhandel an, 7 Hausierhandel, 5 Handarbeit
(Knechte), 8 Leder-, Alteisen- und Güterhandel. Bis auf zwei lebten bei der
Steuerveranlagung alle an der Armutsgrenze. Vier jüdische Einwohner waren als
Lehrer für den Unterricht der Kinder abgestellte "Brödlinge” der
Kultusgemeinde. David Morum Hirsch, seit 1786 als David Zwi in Mönchsroth
nachweisbar, leitete als "Unterrabbiner"
ein kleines Lehrhaus. Dies zeigt den geistigen Reichtum und einen relativ hohen
Bildungsstand der Mönchsrother
Judenschaft mit einer für das schwäbisch-fränkische Landjudentum typischen,
stark ausgeprägten Religiosität. Bereits vor Einführung der allgemeinen
Schulpflicht und der Errichtung einer von 1826 bis 1890 betriebenen
israelitischen Elementarschule gab es ein organisiertes Schulwesen auf
der Basis von mehreren Privatlehrern. Ein weiterer Beleg für einen den
Stadtgemeinden nicht nachstehenden hohen kulturellen Stand der Gemeinde sind die
beiden erhaltenen prachtvollen Thoraufsätze des Frankfurter Goldschmieds
Jeremias Zobel von ca. 1720 und ein nach 1675 entstandenes Thoraschild des Nürnberger
Meisters Thomas Ringler, heute im
Jewish Museum in New York. Dass solche, zu den Spitzenwerken jüdischen Kultgeräts
gerechneten Objekte aus einer Landsynagoge stammen, widerspricht den Angaben über
die alles dominierende Armut im Landjudentum und seinem daraus resultierenden
geringen kulturellen Stand. Mit der
zunehmenden Emanzipation der Judenschaft im Königreich Bayern und dem Zugeständnis
der vollen bürgerlichen Rechte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
entwickelte sich ein ausgeprägtes Miteinander im öffentlichen Leben des
Dorfes. So hielt zum Beispiel der
hoch angesehne jüdische Arzt Dr. Goldschmidt
bei der Einweihung des Kriegerdenkmals von 1870 die "Rede auf Kaiser und
Reich" und im Gefallenendenkmal des 1. Weltkrieges im Chorraum der Klosterkirche
St. Peter und Paul sind mit Simon Mayer und Leopold Schulmann zwei jüdische
Mitbürger genannt, die für ihr
Vaterland ihr Leben ließen.
Für den seit 1889 in Mönchsroth wirkenden Pfarrer
Georg Bickel gab es nicht unbedingt strenge Grenzen für seinen Seelsorgebezirk
Als am 8. Oktober 1900 die 2 Tage alte Tochter des jüdischen Viehhändlers
Simon Behr verstarb, war er einer der ersten, der zu den Behrs ins Haus kam, um
seine Anteilnahme zu bekunden.
4. Die Zeit
nach dem 1. Weltkrieg bis zum Ende
der jüdischen Gemeinde im Jahr 1938. Ein Dokument für
ein gesellschaftlich tolerantes, friedliches Miteinander im Dorf in der Zeit der
Weimarer Republik ist die Aufnahme vom Tanzkränzchen 1919, auf dem inmitten der Tanzpaare auch acht
Mönchsrother jüdischen Glaubens abgebildet sind. Der Viehhändler Moritz Behr
kaufte zur Beschäftigung für die Kinder in der Wirtschaftskrise
den ersten Fußball im Dorf, war als
Vorstand im Gemütlichkeitsverein tätig und unterstützte 1931 Bau des
Sportplatzes. Mit der
Errichtung des Gefallenendenkmals für die Opfer des 1. Weltkriegs im Jahr 1920
durch den Mönchsrother Malerpfarrer Georg Bickel (1862-1924) im Chorraum der
Klosterkirche St. Peter und Paul wird allerdings bereits eine aufziehende
nationalistisch - antijüdische
Stimmung deutlich. Die Gedenkstätte zeigt einen Ausschnitt der Kopie eines Gemäldes
von Wilhelm von Kaulbach "Die Zerstörung Jerusalems", eingerahmt von den 80
Namen der im Ersten Weltkrieg Gefallenen der
Pfarrei. Rechts die Namen aus den Außenorten, links in alphabetischer
Reihenfolge nummeriert 43 Namen aus dem Kirchdorf Mönchsroth. Auf den beiden
letzten Positionen kann man die Namen der israelitischen Soldaten der Gemeinde Mönchsroth
lesen: Simon Mayer und Leopold Schulmann. Georg Bickel hat mit seinem Gemälde
die in konservativen Kreisen populäre Dolchstoßlegende
dargestellt: Die oben in den brennenden Ruinen des Tempels stehenden Verräter
des Volkes, Kommunisten und Juden, sind mit der Revolution 1918 dem Heer in den
Rücken gefallen und haben mit der Errichtung der Republik die alte Werteordnung
von Thron und Altar zerstört. Im Original bei Kaulbach ist unten links die
Vertreibung des ewigen Juden dargestellt.
Das Aufkommen des Nationalsozialismus
fiel auch in Mönchsroth auf fruchtbaren Boden und erhöhte Ende der 20er,
Anfang der 30er Jahre massiv den Auswanderungsdruck auf die noch verbliebene jüdische
Bevölkerung. Wesentlich dazu beigetragen haben auch seit 1928 die
Veranstaltungen der NSDAP auf dem Hesselberg. Die Bilder eines Umzugs, wohl aus dem Jahr 1937, noch vor der Schändung der Hochzeitssteins,
belegen, wie sehr sich eine antisemitische Stimmung und
Menschenverachtung in Teilen der Bevölkerung etabliert hatte.
Zu den örtlichen antisemitischen Akteuren gehörte auch der evangelische
DC- Pfarrer Karl Brunnacker, seit 1925 Pfarrer in Mönchsroth. Bereits 1924 war
er der NS-Bewegung beigetreten und maßgeblich an der Gründung der Mönchsrother
NSDAP- Ortsgruppe im April 1932 beteiligt. Wegen seiner parteipolitischen
Aktivitäten geriet er zunehmend in Konflikt mit seiner Kirchengemeinde,
Beschwerdebriefe gingen an die Kirchenleitung in München. In seiner
Rechtfertigung gibt er den ortsansässigen Juden die Schuld an seinen
innergemeindlichen Problemen. Im einem Schreiben vom 20. Juli 1933 teilt er dem
Landeskirchenamt mit, dass die Kreisleitung im Übrigen plane, endlich einmal "reinen
Tisch ‚in dem verseuchten Judennest’ Mönchsroth zu schaffen".
Die Formulierung vom "judenverseuchten Mönchsroth" gebraucht Brunnacker
ein zweites Mal in einem Brief vom 4. Dezember 1934 an Julius Streicher. Am 8.
Januar 1935 nahm er sich im Brunnen des Pfarrgartens das Leben. Die Pogromnacht
vom November 1938 löschte das Leben der jüdischen
Gemeinde endgültig aus. Neben
Familie Levite wurde Frieda Schulmann von SA-Männern drangsaliert, Geschäfts-
und Wohnungseinrichtung wurden geplündert und verwüstet, noch verbliebenes
Synagogeninventar entwendet. Im
November 1939 ging das Gebäude in Gemeindebesitz über und wurde als Turnraum
und Rathaus genutzt. Insgesamt 27 aus Mönchsroth gebürtige Bürger jüdischen
Glaubens wurden in der Shoah ermordet.
Im Beisein von Arno Hamburger, 1.
Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und dem Landesbischof
der Evangelisch - Lutherischen Kirche in Bayern, Dr. Johannes Friedrich, fand am
23. November 2006 die Widmung eines Gedenksteins für die ehemaligen Mönchsrother
Bürger jüdischen Glaubens statt. Der
von der Steinmetzmeisterin Birgit Hähnlein - Häberlein, Feuchtwangen,
entworfene Stein hat seinen Platz schräg
gegenüber der ehemaligen Synagoge an der Einmündung Rathausstraße/Sägweiherstraße.
Er trägt die Umschrift: "Zum Gedenken an die jüdischen
Bürger Mönchsroths mit ihrer 1761 erbauten und bis 1938 genutzten Synagoge. Im
Nationalsozialismus ihrer Heimat beraubt, verfolgt, ermordet" . In
der Mitte des liegenden, zur ehemaligen Synagoge hin aufsteigenden Krensheimer
Muschelkalksteins befindet sich das Davidsschild, das mit den drei hebräischen
Buchstaben an den früheren Hochzeitsstein an der Westseite der Synagoge
erinnert. In deutscher und hebräischer Schrift ist das Wort aus 4. Mose 10, 9b
zu lesen: "Dass Euer gedacht werde vor dem Herrn".
B)
Zusammenstellung von einzelnen Fakten aus der Geschichte
Erste Nennungen von jüdischen Einwohnern
in Mönchsroth: 1593 wird
der Jude Löw (bzw. Leo) genannt, 1595 Jud Seligmann, 1598: Mosse. Auch aus dem
17. Jahrhundert liegen regelmäßig Erwähnungen jüdischer Einwohner vor (1621,
1622, 1625, 1657, 1659).
Zahlen jüdischer Gemeindeglieder im 19. Jahrhundert: 1811/12 194 jüdische
Einwohner (22,9 % von insgesamt 848), 1837 190 (18,7 % von insgesamt 1.015),
1867 173 (17,6 % von insgesamt 981), 1871 194 (18,4 % von insgesamt 1.054),
1890 130 (13,1 % von insgesamt 992), 1900 90 (10,7 % von insgesamt 845).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
Israelitische Konfessionsschule (Volksschule) und ein rituelles Bad. Die
Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Schopfloch
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
(Elementar- beziehungsweise Religionslehrer) angestellt, der (zumindest nach 1885) auch als Vorsänger und
Schächter tätig war (vor 1885 hatte die Gemeinde auch mehrere Kultbeamte
anstellen können, so noch in den 1860er-Jahren mit Lehrer Maier Braunschweig und
Vorsänger Max (Marx, Mordechai, Markus) Ansbacher, der im Juli 1856 aus Veitshöchheim
gekommen war und nach seiner Zeit in Mönchsroth noch in Würzburg als Lehrer
tätig war).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Simon
Mayer (geb. 3.11.1896 in Mönchsroth, gef. 8.1.1917), Unteroffizier Benjamin
Schloß (geb. 28.9.1889 in Giebelstadt, gef. 22.9.1914) und Leopold Schulmann
(geb. 6.3.1884 in Mönchsroth, gef. 10.6.1916).
Um 1925, als noch 52 Personen der jüdischen Gemeinde
angehörten (in 12 Haushaltungen; 6,5 % von insgesamt etwa 800 Einwohnern),
waren die Vorsteher der Gemeinde Simon Koch und Simon Behr. Als Religionslehrer,
Kantor und Schochet wirkte Gustav Erlebacher. Er unterrichtete damals noch drei
jüdische Kinder in Religion. Die jüdische Gemeinde gehörte zu folgenden
Distriktsrabbinaten: bis 1857 Oettingen, ab
1860 Wallerstein (Sitz ab 1876 in Kleinerdlingen),
ab 1888 Ichenhausen, ab 1922 Ansbach. 1932
wurden noch 42 jüdische Gemeindeglieder gezählt. Inzwischen waren die
Vorsteher Ernst Levite (1. Vors.) und Hermann Behr. Lehrer war weiterhin Gustav
Erlebacher. An jüdischen Vereinen bestanden die Chewra Kadischa (Ziel:
Unterstützung Hilfsbedürftiger, Förderung des Torastudiums, 1932 fünf Mitglieder
unter Gustav Erlebacher) und der 1818 gegründete Jüdische Frauenverein (Ziel:
Wohlfahrtsdienst innerhalb der Gemeinde; Vorsitzende Frau des Sanitätsrates Dr.
Goldschmidt, 7 Mitglieder).
1933 lebten noch 23 jüdische Personen in Mönchsroth (3,2 % von
insgesamt 715). Auf Grund der zunehmenden Repressalien und der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts verzogen bis Anfang Januar 1939 alle in andere Städte
(Würzburg, Augsburg, Oettingen) oder wanderten aus (fünf in die USA, drei nach
Palästina). Im August 1938 wurde die Gemeinde offiziell für aufgelöst
erklärt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde in die Häuser der vier
noch in Mönchsroth wohnhaften Juden eingebrochen, ihr Hausrat zerstört. Aus
dem Geschäft eines jüdischen Gemeindemitglieds wurde der gesamte Warenbestand
gestohlen.
Von den in Mönchsroth geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Moritz (Moses) Eppstein (1861),
Gustav D. Erlebacher (1878), Amalie Frank geb.
Levite (1871), Elsa Goldschmidt (1900), Friedel Goldschmidt (1898), Dr. Josef
Goldschmidt (1865), Max
Goldschmidt (1906), Ricka Goldschmidt geb. Frank (1868), Jette Gutmann geb. Elkan (1867), Willy Gutmann (1901), Rosa Hirschmann
geb. Levite (1880), Emil Koch (1867), Hugo Koch (1875), Justin Koch (1899), Simon
Koch (1867), Adolf Levite (1873), Heinrich Levite (1877), Max Levite (1878),
Sara Levite geb. Mayer (1885), Siegfried Levite (1884), Kathi Loeb (1883),
Sophie Mayer (1862), Fanny Oettinger geb. Mayer (1856), Hanna Pfeiffer geb.
Schumann (1880), Rosalie Rosenheimer (?), Berta Schulmann (1874), David Schulmann (1877), Frieda
Schulmann
geb. Freimann (1875), Ludwig Schulmann (1880), Jenny Wolf geb. Elkan (1871).
II) Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1885 /
1907 / 1911 / 1921
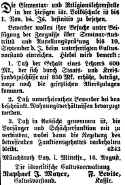 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 20. August 1885: "Die Elementar- und
Religionslehrerstelle in der hiesigen israelitischen Volksschule ist bis
1. November dieses Jahres (1885) definitiv zu besetzen. Bewerber wollen
ihre Besuche unter Beifügung der Zeugnisse über Seminar-Austritts und
Anstellungsprüfung bis 10. September dieses Jahres beim unterfertigten
Kultusvorstand einreichen. Hierbei wird bemerkt: Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 20. August 1885: "Die Elementar- und
Religionslehrerstelle in der hiesigen israelitischen Volksschule ist bis
1. November dieses Jahres (1885) definitiv zu besetzen. Bewerber wollen
ihre Besuche unter Beifügung der Zeugnisse über Seminar-Austritts und
Anstellungsprüfung bis 10. September dieses Jahres beim unterfertigten
Kultusvorstand einreichen. Hierbei wird bemerkt:
1. Dass der Gehalt eines Lehrers 600 Mk., der sich durch Staats- und
Kreisfondszuschüsse auf 850 Mk. erhöht, beträgt, wozu noch die
gesetzlichen Alterszulagen kommen.
2. Dass unverheiratete Bewerber bei den beschränkten Wohnungsverhältnissen
bevorzugt werden.
3. Dass in Aussicht genommen ist, die Vorsänger- und Schächterfunktion ist zu verbinden, wobei dann die Regelung des betreffenden
Funktionsgehaltes vorhalten bleibt.
Mönchsroth Bayern in Mittelfranken, 16. August. Die Israelitische
Kultusverwaltung: Raphael J. Mayer, Kultusvorstand und F. Levite
Kassier". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 12. September 1907: "In unserer Gemeinde
soll die Stelle des Vorsängers, Schächters und Religionslehrers per 1.
November 1907, eventuell 1. Januar 1908 besetzt werden. Anzeige in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 12. September 1907: "In unserer Gemeinde
soll die Stelle des Vorsängers, Schächters und Religionslehrers per 1.
November 1907, eventuell 1. Januar 1908 besetzt werden.
Gehalt 1000 Mark, 5-600 Mark Nebenbezüge und freie Dienstwohnung im
Synagogengebäude. Streng religiöse Bewerber, welche seminaristisch
gebildet sein müssen, wollen ihr Gesuch unter Beifügung von
Zeugnisabschriften bis 1. Oktober an den Unterzeichneten einsenden.
Geschenke sind in obigen Nebenbezügen nicht eingeschlossen. Ausländer
ausgeschlossen.
Mönchsroth, Bayern, den 8. September 1907.
Julius Mayer, Kultusvorstand." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911:
"In der hiesigen Gemeinde soll die Stelle des Vorsängers,
Schächters und Religionslehrers per 1. eventuell 15. April 1912
besetzt werden. Gehalt 1.000 Mark und Nebenbezüge ca. 500 Mark (Geschenke
nicht eingeschlossen), freie Dienstwohnung mit großem Gemüsegarten.
Streng religiöse Bewerber wollen ihre Gesuche unter Beifügung von
Zeugnisabschriften bis 13. Januar 1912 an die unterfertigte Verwaltung
einsehen. Mönchsroth in Mittelfranken Israelitische
Kultusverwaltung. Mayer." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1911:
"In der hiesigen Gemeinde soll die Stelle des Vorsängers,
Schächters und Religionslehrers per 1. eventuell 15. April 1912
besetzt werden. Gehalt 1.000 Mark und Nebenbezüge ca. 500 Mark (Geschenke
nicht eingeschlossen), freie Dienstwohnung mit großem Gemüsegarten.
Streng religiöse Bewerber wollen ihre Gesuche unter Beifügung von
Zeugnisabschriften bis 13. Januar 1912 an die unterfertigte Verwaltung
einsehen. Mönchsroth in Mittelfranken Israelitische
Kultusverwaltung. Mayer." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:
"Die Stelle eines Vorbeters, Schächters und Religionslehrers ist per
1. April dieses Jahres zu besetzen. Gehalt mit Nebeneinkommen Mark 6.000.-
und außerdem freie Wohnung mit Gärten. Kultusgemeinde Mönchsroth
(Mittelfranken)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:
"Die Stelle eines Vorbeters, Schächters und Religionslehrers ist per
1. April dieses Jahres zu besetzen. Gehalt mit Nebeneinkommen Mark 6.000.-
und außerdem freie Wohnung mit Gärten. Kultusgemeinde Mönchsroth
(Mittelfranken)." |
Lob des Lehrers Maier Braunschweig und des Vorsängers Ansbacher (1864)
 Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 7. Dezember 1864: "In dem nahen
Mönchsroth ist besonders der Fleiß und die Tätigkeit des daselbst
wirkenden Herrn Lehrers Braunschweig hervorzuheben; indes der Herr
Vorsänger Ansbacher - der streng orthodoxen Richtung zugetan - auch in
diesem Sinne daselbst zu wirken sucht, worin er von dem Herrn Vorsteher
Marx vielseitig unterstützt wird." Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 7. Dezember 1864: "In dem nahen
Mönchsroth ist besonders der Fleiß und die Tätigkeit des daselbst
wirkenden Herrn Lehrers Braunschweig hervorzuheben; indes der Herr
Vorsänger Ansbacher - der streng orthodoxen Richtung zugetan - auch in
diesem Sinne daselbst zu wirken sucht, worin er von dem Herrn Vorsteher
Marx vielseitig unterstützt wird." |
Zum Tod von Lehrer Maier Braunschweig, ca. 50 Jahre
Lehrer in Mönchsroth (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juli 1901: "Eine
Krone des Schmuckes ist das greise Haupt (Sprüche 16,31). Ein langes,
tatenreiches Leben fand am 23. Dieses Monats dahier seinen Abschluss. Der
pensionierte Elementarlehrer, Herr Maier Braunschweig, verlebte den
größten Teil seiner 55-jährigen Dienstzeit in Mönchsroth in Schwaben.
Seinen späten Lebensabend wollte er hier im israelitischen Kranken- und
Pfründnerhause verbringen und zog vor etwa 8-10 Jahren hierher. Er
erreichte ein Alter von nahezu 95 Jahren. Der ehrwürdige Kreis war in
diesem seinem hohen Alter eine wunderbare Erscheinung. Nichts hatte der
gelehrte, gebildete Mann an Geistesfrische, an Klarheit des Denkens, fast
nichts an Geistesstärke bis zum letzten Momente verloren. Er war noch
Herr seiner Sinne und nahm noch Anteil am Leben und an den Tagesfragen,
indem er täglich die Tagesblätter noch las, so dass man wie vor einem
Phänomen stand. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juli 1901: "Eine
Krone des Schmuckes ist das greise Haupt (Sprüche 16,31). Ein langes,
tatenreiches Leben fand am 23. Dieses Monats dahier seinen Abschluss. Der
pensionierte Elementarlehrer, Herr Maier Braunschweig, verlebte den
größten Teil seiner 55-jährigen Dienstzeit in Mönchsroth in Schwaben.
Seinen späten Lebensabend wollte er hier im israelitischen Kranken- und
Pfründnerhause verbringen und zog vor etwa 8-10 Jahren hierher. Er
erreichte ein Alter von nahezu 95 Jahren. Der ehrwürdige Kreis war in
diesem seinem hohen Alter eine wunderbare Erscheinung. Nichts hatte der
gelehrte, gebildete Mann an Geistesfrische, an Klarheit des Denkens, fast
nichts an Geistesstärke bis zum letzten Momente verloren. Er war noch
Herr seiner Sinne und nahm noch Anteil am Leben und an den Tagesfragen,
indem er täglich die Tagesblätter noch las, so dass man wie vor einem
Phänomen stand.
Zu seinem 94. Geburtstage verfasste er noch ein herrliches, sinnreiches
Gedicht, das in seiner hiesigen Zeitung veröffentlicht wurde. Bis an sein
Ende dichtete er korrekt und beschäftigte sich mit Ausarbeitungen und
Betrachtungen über Stellen in Bibel und Talmud sowohl, als auch über
pädagogische und sonst vorherrschende Ideen aus dem Leben. Es war ein
Hochgenuss, sich mit dem Manne wissenschaftlich zu unterhalten und man
konnte nicht genug seine geistige Verfassung bewundern. Im Umgang war er
äußerst leutselig, anspruchslos und anständig.
So erfreute er sich auch während seines hiesigen Aufenthaltes allgemeiner
Beliebtheit, und wer mit ihm in Berührung kam, der brachte dem
hochbetagten Greise Achtung und Liebe entgegen. In seiner Berufstätigkeit
galt er als ein gewissenhafter, berufsfreudiger Lehrer und erfreute sich
stets der Anerkennung seiner Vorgesetzten und seiner Gemeinde. Sein Ende
war schön wie sein langer Lebensgang, eine sanfte, leichte Auflösung.
Wenn unter diesen Umständen sein Heimgang auch keine schmerzliche Trauer
verursachen konnte, so war doch die Teilnahme eine sehr rege; davon zeugte
auch die starke Beteiligung bei seinem Leichenbegängnisse. (Auch uns hat
der Heimgegangene vor noch ganz kurzer Zeit einige sehr nette Gedichte
gesandt. Red. d. 'Israelit')." |
25-jähriges Amtsjubiläum von Lehrer D. J. Krämer (1900)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1900:
"Mönchsroth, Marcheschwan 5661. Unser allverehrter Herr Lehrer D. J.
Krämer feiert am Schabbat Paraschat Wajeze - so Gott will - sein
25-jähriges Amtsjubiläum, worauf wir Freunde und Kollegen aufmerksam
machen wollen. R." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1900:
"Mönchsroth, Marcheschwan 5661. Unser allverehrter Herr Lehrer D. J.
Krämer feiert am Schabbat Paraschat Wajeze - so Gott will - sein
25-jähriges Amtsjubiläum, worauf wir Freunde und Kollegen aufmerksam
machen wollen. R." |
| |
| Hinweis auf einen
Sohn von Lehrer D. J. Krämer: der langjähriger Heilbronner Oberlehrer
Isac / Isy Krämer |
 Oberlehrer
Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth, gest. 16. April
1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als Lehrer und
Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den höheren
Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem jeweiligen
Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der "Heilbronner
Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"), war zeitweise in
der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt Heilbronn. Nach 1933 hat
er sich um die Auswanderung seiner Glaubensgenossen Verdienste erworben.
Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich, später nach Amerika. Er war
verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb. 12. April 1888 in Heilbronn).
Krämer war eng befreundet mit dem späteren Bundespräsidenten Dr.
Theodor Heuss. Oberlehrer
Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth, gest. 16. April
1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als Lehrer und
Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den höheren
Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem jeweiligen
Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der "Heilbronner
Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"), war zeitweise in
der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt Heilbronn. Nach 1933 hat
er sich um die Auswanderung seiner Glaubensgenossen Verdienste erworben.
Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich, später nach Amerika. Er war
verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb. 12. April 1888 in Heilbronn).
Krämer war eng befreundet mit dem späteren Bundespräsidenten Dr.
Theodor Heuss. |
Lehrer Erlebacher verkauft Torarollen und
übernimmt auch die Reparatur von Torarollen und Tefillin (1926)
 Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September
1926: "Zwei sehr gut erhaltene Seferim (Torarollen) sind zu verkaufen.
Anfragen an Lehrer Erlebacher (Mönchsroth, Mittelfranken). Dieser übernimmt
auch die Reparatur von Sefer Thoros und Tefillin". Anzeige
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September
1926: "Zwei sehr gut erhaltene Seferim (Torarollen) sind zu verkaufen.
Anfragen an Lehrer Erlebacher (Mönchsroth, Mittelfranken). Dieser übernimmt
auch die Reparatur von Sefer Thoros und Tefillin". |
Zum Tod der Frau von Lehrer Erlebacher (1936)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Mönchsroth,
10. März (1936). Frau Lehrer Erlebacher aus Mönchsroth wurde, ihrem
Wunsche gemäß, neben ihren Eltern und Geschwistern auf dem
altehrwürdigen Friedhofe in Wallerstein
zur letzten Ruhe gebettet. Es war eine selten fromme Frau, die den
Traditionen der Eltern treu blieb. Wie ihr ganzes Leben eine Rüstung zum
ewigen Sabbat war, ging sie am Erew Schabbat (Freitag) von dannen,
nachdem sie noch alles für den Sabbat gerichtet hatte. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1936: "Mönchsroth,
10. März (1936). Frau Lehrer Erlebacher aus Mönchsroth wurde, ihrem
Wunsche gemäß, neben ihren Eltern und Geschwistern auf dem
altehrwürdigen Friedhofe in Wallerstein
zur letzten Ruhe gebettet. Es war eine selten fromme Frau, die den
Traditionen der Eltern treu blieb. Wie ihr ganzes Leben eine Rüstung zum
ewigen Sabbat war, ging sie am Erew Schabbat (Freitag) von dannen,
nachdem sie noch alles für den Sabbat gerichtet hatte.
Möge sie, die nun zum ewigen Sabbat eingezogen ist, eine rechte
Fürsprecherin sein für alle, die ihr im Leben nahe standen. Ihre
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
60. Geburtstag von
Lehrer Gustav Erlebacher (1938)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember 1937:
"Mönchsroth bei Dinkelsbühl, 26. Dezember. Am 2. Januar 1938
vollendet Herr Gustav Erlebacher in körperlicher und geistiger Frische
sein 60. Lebensjahr. Seit über 35 Jahren wirkt er als Kantor und Lehrer
unermüdlich auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums. In seinem
überragenden Gottvertrauen und seiner tiefen religiösen Gläubigkeit
liegt seine Stärke. All die Jahrzehnte gab es für ihn nur ein Ziel, die
Jugend wie das Alter dem orthodoxen Judentum zu erhalten. Möge es ihm
noch lange vergönnt sein, weiter in diesem Sinne zu wirken. (Alles Gute)
bis 120 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember 1937:
"Mönchsroth bei Dinkelsbühl, 26. Dezember. Am 2. Januar 1938
vollendet Herr Gustav Erlebacher in körperlicher und geistiger Frische
sein 60. Lebensjahr. Seit über 35 Jahren wirkt er als Kantor und Lehrer
unermüdlich auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums. In seinem
überragenden Gottvertrauen und seiner tiefen religiösen Gläubigkeit
liegt seine Stärke. All die Jahrzehnte gab es für ihn nur ein Ziel, die
Jugend wie das Alter dem orthodoxen Judentum zu erhalten. Möge es ihm
noch lange vergönnt sein, weiter in diesem Sinne zu wirken. (Alles Gute)
bis 120 Jahre." |
Mitteilungen
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers, Beschneiders und ehrenamtlichen
Vorbeters Hirsch Marx (1865)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. November 1865:
"Wittelshofen (Bayern), 18. Oktober (1865). Ein frommes, von
tief-innerlicher Religiosität durchwehtes Leben hat am jüngsten
Sukkot-Feste, in unserer biederen Nachbargemeinde Mönchsroth, durch den
Hintritt des allverehrten Kultus-Vorstandes Herrn Hirsch Marx zum
größten Leidwesen Aller, die ihn näher gekannt, schnell geendet,
wodurch überraschend plötzlich die freudig bewegte, festlich gehobene
Stimmung in eine wehmutsvoll, tief betrübte umgewandelt
wurde! Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. November 1865:
"Wittelshofen (Bayern), 18. Oktober (1865). Ein frommes, von
tief-innerlicher Religiosität durchwehtes Leben hat am jüngsten
Sukkot-Feste, in unserer biederen Nachbargemeinde Mönchsroth, durch den
Hintritt des allverehrten Kultus-Vorstandes Herrn Hirsch Marx zum
größten Leidwesen Aller, die ihn näher gekannt, schnell geendet,
wodurch überraschend plötzlich die freudig bewegte, festlich gehobene
Stimmung in eine wehmutsvoll, tief betrübte umgewandelt
wurde!
Eine flüchtige Skizze des Lebens dieses Mannes verdient gewiss in einem
Blatt registriert zu werden, dessen Tendenzen mit den seinigen so genau
harmonierten, und deren Förderung und Unterstützung ihm zeitlebens
eifrigst am Herzen lag. Zugleich dürfte hierdurch den nächsten
Anverwandten und Freunden des Verewigten einiger Trost gespendet werden,
sowie seine Gesinnungsgenossen und Freunde sich aufgemuntert fühlen, eine
ähnliches segensreiches Leben und Streben zu betätigen.
H. Marx, den das Vertrauen seiner Gemeinde seit einer langen Reihe von
Jahren zu ihrem Vorstand berief, wurde von frühester Jugend zum
Toralernen angehalten, worin er auch ein gediegenes, vielseitiges Wissen
bekundete. Gewiss hat kein Anderer in ähnlichen Verhältnissen bei seinem
vielverzweigten ausgedehnten Geschäftsbetriebe dem talmudischen Worte
Rechnung getragen: 'drei Dinge bleiben dem Menschen aus seinen Jahren
für die Ewigkeit: ein Drittel Bibel, ein Drittel Mischna und ein Drittel
Talmud' (frei wiedergegeben). Denn nicht leicht gönnte er sich nach
den vielfachen, mitunter sehr mühevollen Anstrengungen seines weit
verbreiteten Geschäftes den erquicklichen Schlummer, bevor er nicht
in noch später Abendstunde einen Mischna-Abschnitt oder eine talmudische
Abhandlung 'gelernt' hätte. Besonders rühmlich ist jedoch der Umstand
hervorzuheben, dass er im Geschäftsverkehr die strengste
Gewissenhaftigkeit und Treue betätigte! Eine lange Reihe von Jahren
widmete sich der Verewigte dem Dienste der Religion als Geschickter Mohel
(Beschneider) - und als entsprechender Baal Tefilla (ehrenamtlicher
Vorbeter). -
Dass er stets seinen Posten als Vorsteher seiner Gemeinde würdig und
höchst uneigennützig verwaltet, bewies das unerschütterliche Vertrauen
derselben, sowie deren aufrichtige, ungeheuchelte allgemeine Trauer um
seinen viel zu frühen Hingang.
Möge dieser Fromme in den Gefilden des ewigen Friedens für seine
vielseitigen, großen Verdienste reichen Lohn empfangen, und ihm jene
erhabenen Pforten eröffnet werden, auf welchen die goldene Inschrift
strahlte: 'Dies ist das Tor zum Herrn - Gerechte gehen durch es hinein.
Amen'." |
Nekrolog für Sophie Eppstein geb.
Regensburger (1878)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1878:
"Nekrolog. (Unliebsam verspätet). Mönchsroth, den 4. April 1878.
Der 4. vorigen Monats versetzte alle israelitischen Einwohner hiesigen
Ortes in tiefe Trauer; denn unerwartet schnell, wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, wurde von dem unerbittlichen Tode eine Person aus ihrer Mitte
genommen, die sowohl durch ihre echte Religiosität und aufopfernde
Menschenliebe, als auch durch ihre Wohltätigkeit, Dienst- und
Friedfertigkeit, wie nicht minder durch ihre Klugheit,
Menschenfreundlichkeit und Geschicklichkeit sich rühmlich auszeichnete
und eben durch diese Eigenschaften sich die Achtung aller hiesigen
Einwohner, ohne Unterschied des Glaubens, im hohen Grade erworben. Es ist
die viel zu früh heimgegangene Sophie Eppstein, geborene Regensburger aus
Sulzbürg, gewesene Ehefrau des
dahier ansässigen Sofer (Torarollenschreibers), Herrn Simon Eppstein. -
Am Morgen noch nicht ahnend, wie verhängnisvoll der Abend für sie und
ihre Familie sein werde; im Entferntesten nicht daran denkend, dass sie
ihrem Lebensende schon so nahe stehe, arbeitete sie den ganzen Tag über
mit gewohnter Geschäftigkeit im Hause herum, verzehrte Nachmittags noch
mit Appetit ihr Vesperbrot, klagte dann später über ungewöhnlich
heftige Kopfschmerzen, und stürzte nachdem sie sich zu ihrer Erholung auf
einen Sessel ein wenig niedergelassen - leblos zu Boden. Alle
Belebungsversuche des alsbald herbeigerufenen und herbeigeeilten Arztes
waren ohne Erfolg. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1878:
"Nekrolog. (Unliebsam verspätet). Mönchsroth, den 4. April 1878.
Der 4. vorigen Monats versetzte alle israelitischen Einwohner hiesigen
Ortes in tiefe Trauer; denn unerwartet schnell, wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, wurde von dem unerbittlichen Tode eine Person aus ihrer Mitte
genommen, die sowohl durch ihre echte Religiosität und aufopfernde
Menschenliebe, als auch durch ihre Wohltätigkeit, Dienst- und
Friedfertigkeit, wie nicht minder durch ihre Klugheit,
Menschenfreundlichkeit und Geschicklichkeit sich rühmlich auszeichnete
und eben durch diese Eigenschaften sich die Achtung aller hiesigen
Einwohner, ohne Unterschied des Glaubens, im hohen Grade erworben. Es ist
die viel zu früh heimgegangene Sophie Eppstein, geborene Regensburger aus
Sulzbürg, gewesene Ehefrau des
dahier ansässigen Sofer (Torarollenschreibers), Herrn Simon Eppstein. -
Am Morgen noch nicht ahnend, wie verhängnisvoll der Abend für sie und
ihre Familie sein werde; im Entferntesten nicht daran denkend, dass sie
ihrem Lebensende schon so nahe stehe, arbeitete sie den ganzen Tag über
mit gewohnter Geschäftigkeit im Hause herum, verzehrte Nachmittags noch
mit Appetit ihr Vesperbrot, klagte dann später über ungewöhnlich
heftige Kopfschmerzen, und stürzte nachdem sie sich zu ihrer Erholung auf
einen Sessel ein wenig niedergelassen - leblos zu Boden. Alle
Belebungsversuche des alsbald herbeigerufenen und herbeigeeilten Arztes
waren ohne Erfolg.
Groß, unendlich groß und unersetzlich ist der Verlust des greisen, tief
gebeugten und trauernden Gatten, der 18 Jahre lang mit ihr in der
glücklichsten Ehe lebte; namenlos der Schmerz der fünf verwaisten
Kinder, denen sie in unbegrenzter Liebe eine treue, sorgsame Mutter stets
gewesen; groß auch der Verlust ihrer Verwandten und zahlreichen Freunde,
denen sie ein Herz voller Liebe stets entgegentrug; nicht minder groß
aber auch ist der Verlust sowohl mancher Hilfsbedürftigen, als auch aller
hiesigen israelitischen Bewohner, die wohl oft bei freudigen und traurigen
Gelegenheiten die selig Entschlafene schmerzlich vermissen werden.
Möge der Allgütige lindernden Balsam in die tief geschlagene Wunde
träufeln; möge er auch der frommen Pilgerin dort den Lohn ihres
tugendhaften Wandels hienieden in reichem Maße zuteil werden lassen und
möge er ihr gewähren, dass mit den anderen gerechten Frauen, die im
Garten Eden sind, ihre Seele eingebunden sei in den Bund des Lebens. Amen." |
Zum Tod von Emilie Mayer (1903)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1903:
"Mönchsroth, 1. Februar (1903). Der Hintritt gottesfürchtiger
Personen in die Ewigkeit lässt gleichgesinnte Kreise niemals unberührt,
soll sie wenigstens nicht unberührt lassen. Darum ist es nur löblich,
dass die jüdischen Blätter über den Tod frommer Männer und Frauen
unserer Glaubensgemeinschaft berichten, um so teilnehmende Freunde zu
stillem Mitgefühl und ernstem Nachstreben aufzufordern. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1903:
"Mönchsroth, 1. Februar (1903). Der Hintritt gottesfürchtiger
Personen in die Ewigkeit lässt gleichgesinnte Kreise niemals unberührt,
soll sie wenigstens nicht unberührt lassen. Darum ist es nur löblich,
dass die jüdischen Blätter über den Tod frommer Männer und Frauen
unserer Glaubensgemeinschaft berichten, um so teilnehmende Freunde zu
stillem Mitgefühl und ernstem Nachstreben aufzufordern.
Hier ist am 10. Teweth eine der besten und edelsten Frauen unseres Ortes,
Frau Emilie Mayer, Gattin des seiner Frömmigkeit und Wohltätigkeit wegen
geschätzten Herrn Raphael Mayer, kurz vor Eintritt des Sabbat zur Ruhe
des ewigen Lebens eingegangen. Die Verstorbene, vom Geiste unserer
erhabenen Religion beseelt, war stets bemüht, die Vorschriften derselben
gewissenhaft zu erfüllen und deren lehren im Leben zu verwirklichen. In
ihrem Hause walteten Liebe und Zuvorkommenheit in schönstem Maße. Darum
war sie auch eine von Allen geachtete Persönlichkeit. Bei ihrer
Beerdigung, welche am 11. Januar stattfand, fand sich fast die gesamte
Bevölkerung des Ortes - darunter auch der Pfarrer - ein, um ihr die
letzte Ehre zu erweisen und den beredten Worten zu lauschen, mit welchen
Herr Rabbiner Dr. Deutsch aus Fürth den Empfindungen der Trauer und der
Verehrung Ausdruck gab. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Zum Tod von Breindele Koch (1879)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober
1879 (abgekürzt wiedergegeben):
"Nekrolog. Mönchsroth (Kreis Mittelfranken des Königreiches
Bayern), den 19. Oktober (Unlieb verspätet). Die hiesige israelitische
Kultusgemeinde hat wieder einen schmerzlichen Verlust erlitten durch das
Hinscheiden einer Person, die sich sowohl durch strenge Religiosität, als
auch durch anderweitige hervorragende Tugenden rühmlichst auszeichnete.
Es war dies die, von allen Einwohnern hiesigen Ortes, ohne Unterschied des
Glaubens, besonderes geachtete und geschätzte Breindele Koch,
gewesene Ehefrau des dahier ansässigen Geschäftsmannes Herrn Israel
Koch, welche den würdigsten der hiesigen Frauen beigezählt zu werden
verdiente und die nach einem kurzen, aber schmerzvollen Krankenlager am
17. dieses Monats sanft und selig hinüberschlummerte in das jenseitige
bessere Leben. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober
1879 (abgekürzt wiedergegeben):
"Nekrolog. Mönchsroth (Kreis Mittelfranken des Königreiches
Bayern), den 19. Oktober (Unlieb verspätet). Die hiesige israelitische
Kultusgemeinde hat wieder einen schmerzlichen Verlust erlitten durch das
Hinscheiden einer Person, die sich sowohl durch strenge Religiosität, als
auch durch anderweitige hervorragende Tugenden rühmlichst auszeichnete.
Es war dies die, von allen Einwohnern hiesigen Ortes, ohne Unterschied des
Glaubens, besonderes geachtete und geschätzte Breindele Koch,
gewesene Ehefrau des dahier ansässigen Geschäftsmannes Herrn Israel
Koch, welche den würdigsten der hiesigen Frauen beigezählt zu werden
verdiente und die nach einem kurzen, aber schmerzvollen Krankenlager am
17. dieses Monats sanft und selig hinüberschlummerte in das jenseitige
bessere Leben.
Weit entfernt, in diesem engen Rahmen ein vollständiges Charakterbild
ihres Seelenlebens aufstellen zu wollen, sollen hier bloß mit einigen,
flüchtig hingeworfenen Farbenstrichen die Grundzüge ihres Charakters
angedeutet werden. Mit Umgehung aller ihrer anderweitigen guten
Eigenschaften wird deshalb hier nur dies hervorgehoben, dass echte
Religiosität, in Verbindung mit Leutseligkeit, Menschenfreundlichkeit und
außerordentlicher Friedensliebe der Grundzug ihres Wesens war, dass diese
gleichsam den roten Faden bildete, der sich durch ihr ganzes Leben
hindurchzog und in allen Phasen desselben, in ihrem tätigen Wirken,
frommen Dulden und ruhigen Sterben, deutlich genug zu erkennen war. Ihren
Schöpfer innigliebend, erfüllte sie die ihr obgelegenen
Religionsvorschriften mit der größten Gewissenhaftigkeit, machte sie sich's
zur Pflicht, jeden Tag ihr Morgen- und Abendgebet zur gehörigen Zeit zu
verrichten, jeden Sabbat den Toraabschnitt in deutscher
Übersetzung zu Hause nachzulesen und nie etwas zu genießen, selbst in
ihrer Krankheit nicht, ohne vorher das vorgeschriebene Segenswort
darüber gemacht zu haben.
Als würdige, fromme Gattin war sie während der 49 Jahre, da sie mit
ihrem Manne in der glücklichsten Ehe lebte, eifrigst bestrebt, seinen
Wünschen immer zuvor zu kommen, ihn durch freundliche Begegnung und
liebevolle Behandlung das Leben zu versüßen, und Alles das ihm zu
verheimlichen und zu verschweigen, was nur im Entferntesten ihn unangenehm
hätte berühren können. Ja, ihre zärtliche Fürsorge für ihn
erstreckte sich noch über ihr Grab hinaus, indem sie auf ihrem
Krankenlager noch Anordnungen traf, wie es nach ihrem Tode gehalten werden
solle, damit seine gewohnte Bequemlichkeit durch ihr Ableben nicht allzu sehr
beeinträchtigt werden. ...
Ihre irdischen Überreste wurden heute unter zahlreicher Leichenbegleitung
der Erde übergeben. Sanft ruhe ihre Asche! - Möge die Seligentschlafene
dort den Lohn ihrer Frömmigkeit und Tugend empfangen! Möge sie der Seligkeit
teilhaftig werden, die der Herr seinen Frommen verheißen und beschieden!
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. M. Braunschweig,
deutscher Schul- und israelitischer Religionslehrer." |
Zum 80. beziehungsweise 85. Geburtstag des Ehepaares
Salomon Schulmann (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925: "Mönchsroth,
19. Januar (1925). Herr Salomon Schulmann und dessen Gemahlin, die voriges
Jahre ihre goldene Hochzeit feierten, begingen dieser Tage ihren 80.
beziehungsweise 85. Geburtstag. Das streng religiöse Ehepaar erfreut sich
aller Beliebtheit. Herr Schulmann ist jeden Morgen bei Wind und Wetter immer
einer der ersten im Gotteshause, der Jugend ein nachahmenswertes Beispiel
gegeben. (Alles Gute) bis 100 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925: "Mönchsroth,
19. Januar (1925). Herr Salomon Schulmann und dessen Gemahlin, die voriges
Jahre ihre goldene Hochzeit feierten, begingen dieser Tage ihren 80.
beziehungsweise 85. Geburtstag. Das streng religiöse Ehepaar erfreut sich
aller Beliebtheit. Herr Schulmann ist jeden Morgen bei Wind und Wetter immer
einer der ersten im Gotteshause, der Jugend ein nachahmenswertes Beispiel
gegeben. (Alles Gute) bis 100 Jahre." |
Zum Tod von Luis Levite (1926)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September
1926: "Mönchsroth. Durch den unerwartete Tod des Herrn Luis Levite,
hier, erhielt unsere altehrwürdige Kultusgemeinde einen unersetzlichen
Verlust. Obgleich wegen des heiligen Sabbats, an dessen Abend der sanfte
Tod erfolgte, eine Todesanzeige in der Lokalzeitung nicht erfolgen konnte,
verbreitete sich die Schmerzensnachricht wie ein Lauffeuer von Mund zu
Mund. Und jeder, der davon Kenntnis erhielt, ließ es sich nicht nehmen,
den edeln Verblichenen die Beweise der Liebe und Anhänglichkeit zu
bekunden. Von nah und fern versammelte sich eine unzählige Menge vor dem
Trauerhause. Herr Rabbiner Dr. Munk, welcher noch vor Abfahrt nach der
letzten Ruhestätte eingetroffen war, schilderte in meisterhaften Worten
das vorbildliche Leben des teuren Verblichenen. Lehrer Erlebacher gab in
treffenden Worten dem Schmerze Ausdruck, den er selbst und die gesamte
jüdische Gemeinde erlitten hat, als ob ein Glied aus dem eigenen Körper
gerissen wäre. Im Gottes- und Lehrhause, wo er stets einer der ersten
war, verursacht sein Hinscheiden eine dauernde Lücke. Ein Stück
Geschichte unserer berühmten Kultusgemeinde ist mit ihm leider allzu früh
ins Grab gesunken." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. September
1926: "Mönchsroth. Durch den unerwartete Tod des Herrn Luis Levite,
hier, erhielt unsere altehrwürdige Kultusgemeinde einen unersetzlichen
Verlust. Obgleich wegen des heiligen Sabbats, an dessen Abend der sanfte
Tod erfolgte, eine Todesanzeige in der Lokalzeitung nicht erfolgen konnte,
verbreitete sich die Schmerzensnachricht wie ein Lauffeuer von Mund zu
Mund. Und jeder, der davon Kenntnis erhielt, ließ es sich nicht nehmen,
den edeln Verblichenen die Beweise der Liebe und Anhänglichkeit zu
bekunden. Von nah und fern versammelte sich eine unzählige Menge vor dem
Trauerhause. Herr Rabbiner Dr. Munk, welcher noch vor Abfahrt nach der
letzten Ruhestätte eingetroffen war, schilderte in meisterhaften Worten
das vorbildliche Leben des teuren Verblichenen. Lehrer Erlebacher gab in
treffenden Worten dem Schmerze Ausdruck, den er selbst und die gesamte
jüdische Gemeinde erlitten hat, als ob ein Glied aus dem eigenen Körper
gerissen wäre. Im Gottes- und Lehrhause, wo er stets einer der ersten
war, verursacht sein Hinscheiden eine dauernde Lücke. Ein Stück
Geschichte unserer berühmten Kultusgemeinde ist mit ihm leider allzu früh
ins Grab gesunken." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 22. Juli 1926: "Mönchsroth, 5. Juli. Einer
unserer Besten, Herr Luis Levite, wurde uns am letzten Freitag abend im
Alter von 64 Jahren jäh entrissen. Sein Leben war ein dauernder
Gottesdienst, besonders ein reelles Geschäftsleben erwarb ihm das
Vertrauen seiner Kundschaft aus nah und fern. Soweit die Nachricht ohne
Zeitungsmeldung hinausdrang, waren seine Freunde herbeigeeilt, um ihm in
unzähliger Menge die letzte Ehre zu erweisen. Herr Rabbiner Dr. Munk aus
Ansbach verstand in meisterhafter Weise, die Tugenden des Verstorbenen zu
würdigen. In schmerzdurchdrungenen Worten gab Lehrer G. Erlebacher der
Trauer Ausdruck, die die gesamte Gemeinde wie eine Familie betroffen hat.
Ein Stück Geschichte unserer altehrwürdigen Gemeinde ist mit ihm allzu früh
ins Grab gegangen. Möge Gott die Wunde, die er uns geschlagen, heilen und
den Hinterbliebenen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 22. Juli 1926: "Mönchsroth, 5. Juli. Einer
unserer Besten, Herr Luis Levite, wurde uns am letzten Freitag abend im
Alter von 64 Jahren jäh entrissen. Sein Leben war ein dauernder
Gottesdienst, besonders ein reelles Geschäftsleben erwarb ihm das
Vertrauen seiner Kundschaft aus nah und fern. Soweit die Nachricht ohne
Zeitungsmeldung hinausdrang, waren seine Freunde herbeigeeilt, um ihm in
unzähliger Menge die letzte Ehre zu erweisen. Herr Rabbiner Dr. Munk aus
Ansbach verstand in meisterhafter Weise, die Tugenden des Verstorbenen zu
würdigen. In schmerzdurchdrungenen Worten gab Lehrer G. Erlebacher der
Trauer Ausdruck, die die gesamte Gemeinde wie eine Familie betroffen hat.
Ein Stück Geschichte unserer altehrwürdigen Gemeinde ist mit ihm allzu früh
ins Grab gegangen. Möge Gott die Wunde, die er uns geschlagen, heilen und
den Hinterbliebenen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens." |
Zum Tod von Frau Behr (1927)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. März
1927: "Mönchsroth. Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige
Gemeinde durch das unerwartete Ableben der Frau Behr, einer Frau die
jedermann mit Rat und Tat beistand. Ihr Haus stand offen für jeden
Hilfesuchenden." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8. März
1927: "Mönchsroth. Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige
Gemeinde durch das unerwartete Ableben der Frau Behr, einer Frau die
jedermann mit Rat und Tat beistand. Ihr Haus stand offen für jeden
Hilfesuchenden." |
Der 2. Vorstand Jul. Schulmann übersiedelt nach Ansbach (1927)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1927: "Mönchsroth,
4. Juli (1927). Herr Julius Schulmann, 2. Vorstand und Kassier der
hiesigen Kultusgemeinde übersiedelte dieser Tage nach Ansbach.
Er war stets ein eifriges Mitglied unserer Gemeinde und versah mit großer
Umsicht und Gewissenhaftigkeit sein Ehrenamt. Zu seinem Nachfolger wurde
Herr Ernst Levite einstimmig gewählt. Die streng-religiöse Gesinnung
auch dieses Herrn berechtigt zu der Hoffnung, dass unsere mustergültigen Gemeindeeinrichtungen
unter seiner Mitwirkung, trotz des Rückganges der Familienzahl erhalten
werden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1927: "Mönchsroth,
4. Juli (1927). Herr Julius Schulmann, 2. Vorstand und Kassier der
hiesigen Kultusgemeinde übersiedelte dieser Tage nach Ansbach.
Er war stets ein eifriges Mitglied unserer Gemeinde und versah mit großer
Umsicht und Gewissenhaftigkeit sein Ehrenamt. Zu seinem Nachfolger wurde
Herr Ernst Levite einstimmig gewählt. Die streng-religiöse Gesinnung
auch dieses Herrn berechtigt zu der Hoffnung, dass unsere mustergültigen Gemeindeeinrichtungen
unter seiner Mitwirkung, trotz des Rückganges der Familienzahl erhalten
werden." |
Zum Tod von Sophie Stern in Schopfloch und zum 83. Geburtstag von Salomon Schulmann
(1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,
15. Januar (1928). In Schopfloch
starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch
Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,
15. Januar (1928). In Schopfloch
starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch
Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens."
Mönchsroth, 15. Januar (1928). Herr Salomon Schulmann, der Senior
der Israelitischen Kultusgemeinde hier, feierte dieser Tage seinen 83.
Geburtstag in voller geistiger und körperlicher Frische. Trotz der Kälte
und dem Regen ist Herr Schulmann stets der erste im Gotteshause und fastet
noch alle Fasttage ohne Beschwerden. vor 5 Jahren konnte er mit seiner in
gleicher Verfassung lebenden Gattin die goldene Hochzeit
feiern." |
Zum 80. Geburtstag von Jette Levite (1928)
 Artikel
im "Bayerischen Israelitischen Gemeindeblatt" vom 1. Mai 1928:
"Mönchsroth. Ihren 80. Geburtstag feierte vor wenigen Tagen
in seltener körperlicher und geistiger Frische Frau Jette Levite
(Mönchsroth). Wir wünschen der heute noch rüstig tätigen Frau, die ein
Leben in Gottesfurcht und Frömmigkeit führt, einen recht langen und
glücklichen Lebensabend." Artikel
im "Bayerischen Israelitischen Gemeindeblatt" vom 1. Mai 1928:
"Mönchsroth. Ihren 80. Geburtstag feierte vor wenigen Tagen
in seltener körperlicher und geistiger Frische Frau Jette Levite
(Mönchsroth). Wir wünschen der heute noch rüstig tätigen Frau, die ein
Leben in Gottesfurcht und Frömmigkeit führt, einen recht langen und
glücklichen Lebensabend." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928: "Mönchsroth,
8. März (1928). Dieser Tage feierte Frau Jette Levite ihren 80. Geburtstag
in bewundernswerter körperlicher und geistiger Frische. Ohne jegliche
Hilfe versieht sie ihren Haushalt. In der Synagoge ist sie stets die Erste
und verrichtet mit inniger Andacht ihre Gebete. (Alles Gute) bis 120
Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928: "Mönchsroth,
8. März (1928). Dieser Tage feierte Frau Jette Levite ihren 80. Geburtstag
in bewundernswerter körperlicher und geistiger Frische. Ohne jegliche
Hilfe versieht sie ihren Haushalt. In der Synagoge ist sie stets die Erste
und verrichtet mit inniger Andacht ihre Gebete. (Alles Gute) bis 120
Jahre." |
Zum Tod von Berta Schulmann (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1928: "Mönchsroth,
1. Oktober (1928). Am Ausgang des Jaum Kippur (= 24. September 1928)
hauchte Frau Berta Schulmann, Gattin des Salomon Schulmann, mit dem sie
vor fünf Jahren ihre goldene Hochzeit feierte, ihre reine Seele aus. Mit
Rücksicht auf die Zwischentage zum Sukkosfest (Laubhüttenfest) musste
eine berechtigte Klage über den herben Verlust unterbleiben. Die beiden
Redner schilderten am Hause und am Grabe darauf die Verstorbene als eine
echte jüdische Frau, die nicht nur ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln
stets mahnende Worte ans Herz legte, sondern auch allen, die mit ihr
verkehrten. Unstimmigkeiten suchte sie stets auf gütlichem Wege
auszugleichen, um den Frieden in unserer kleinen Gemeinde zu
erhalten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1928: "Mönchsroth,
1. Oktober (1928). Am Ausgang des Jaum Kippur (= 24. September 1928)
hauchte Frau Berta Schulmann, Gattin des Salomon Schulmann, mit dem sie
vor fünf Jahren ihre goldene Hochzeit feierte, ihre reine Seele aus. Mit
Rücksicht auf die Zwischentage zum Sukkosfest (Laubhüttenfest) musste
eine berechtigte Klage über den herben Verlust unterbleiben. Die beiden
Redner schilderten am Hause und am Grabe darauf die Verstorbene als eine
echte jüdische Frau, die nicht nur ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln
stets mahnende Worte ans Herz legte, sondern auch allen, die mit ihr
verkehrten. Unstimmigkeiten suchte sie stets auf gütlichem Wege
auszugleichen, um den Frieden in unserer kleinen Gemeinde zu
erhalten. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Artikel
in der "Deutschen Israelitischen Zeitung" (Regensburg) vom 8.
November 1928: Artikel
in der "Deutschen Israelitischen Zeitung" (Regensburg) vom 8.
November 1928: |
Zum Tod von Charlotte Bauer geb. Siegbert
(1930)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1930:
"Mönchsroth, 24. November 1930. Unter überaus zahlreicher
Beteiligung aus nah und fern wurden am Sonntag, den 9. November, die
sterblichen Reste der Frau Charlotte Bauer geb. Siegbert aus Nördlingen
zur letzten Ruhe bestattet. Herr Lehrer Strauß schilderte am Grabe in
ergreifenden Worten die hervorragenden Tugenden dieses wackeren Frau.
Nicht nur Ihrer zahlreichen Familie wurde diese edle und tugendhafte Frau
und Mutter unerwartet und jäh entrissen, sondern auch allen Armen und
Dürftigen. Keiner ging leer und ungetröstet von ihrer gastlichen Schwelle.
Möge ihr Verdienst auch uns vor dem göttlichen Richterstuhle
beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1930:
"Mönchsroth, 24. November 1930. Unter überaus zahlreicher
Beteiligung aus nah und fern wurden am Sonntag, den 9. November, die
sterblichen Reste der Frau Charlotte Bauer geb. Siegbert aus Nördlingen
zur letzten Ruhe bestattet. Herr Lehrer Strauß schilderte am Grabe in
ergreifenden Worten die hervorragenden Tugenden dieses wackeren Frau.
Nicht nur Ihrer zahlreichen Familie wurde diese edle und tugendhafte Frau
und Mutter unerwartet und jäh entrissen, sondern auch allen Armen und
Dürftigen. Keiner ging leer und ungetröstet von ihrer gastlichen Schwelle.
Möge ihr Verdienst auch uns vor dem göttlichen Richterstuhle
beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Salomon Schulmann (1933)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,
30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige
Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.
Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das
Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin
fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am
Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem
ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In
ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen
der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl
nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl
mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu
ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1933: "Mönchsroth,
30. August (1933), Am 1. Elul (= 23. August 1933) hauchte der ehrwürdige
Senior unserer Gemeinde, Salomon Schulmann, seine reine Seele im 90.
Lebensjahre aus. Vor zehn Jahren feierte er noch mit seiner Gattin das
Fest der Goldenen Hochzeit, nun folgte er seiner treuen Lebensgefährtin
fünf Jahre nach deren Tod ins Grab. Herr Lehrer Erlebacher schilderte am
Grabe vor der großen Trauergemeinde, wie dieser Schulmann mit seinem
ganzen Leben Schule machte, mustergültig und beispielgebend wirkte. In
ergreifender Weise nahm dann ein Enkel aus Fürth vom Großvater im Namen
der Familie Abschied. Da die einst blühende Gemeinde über die Minjanzahl
nicht mehr verfügt, kamen morgens und abends die Männer aus Dinkelsbühl
mit der Bahn ins Trauerhaus, um die Gottesdienste mit Schiurim zu
ermöglichen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod des aus Mönchsroth stammenden
Adolf Eppstein (1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1837:
"Mönchsroth, 15. März (1837). Auf unserem altehrwürdigen
Bezirksfriedhof (gemeint: Friedhof in
Schopfloch) haben wir kürzlich Adolf Eppstein aus Feuchtwangen
im Alter von 77 Jahren zur letzten Ruhe bestattet. Er stammte aus einer
Familie, wo nicht nur Tora und Gebote gewissenhaft geübt werden, sondern
in der sich die Glieder heute noch mit 'Himmelarbeit'
beschäftigen. Sein Vater übte in Mönchsroth den
verantwortungsvollen Beruf eines Sofer (Toraschreibers) aus, wie es sein
Bruder heute noch tut. In gleicher Weise betätigte sich der
Dahingeschiedene im Zusammenwirken mit seiner gleichgesinnten Gattin, die
ihm vor einigen Jahren im Tod vorausging, zum Segen. - Am Grabe schilderte
Herr Lehrer Neumann aus Feuchtwangen die vorbildliche Lebensführung des Verblichenen.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1837:
"Mönchsroth, 15. März (1837). Auf unserem altehrwürdigen
Bezirksfriedhof (gemeint: Friedhof in
Schopfloch) haben wir kürzlich Adolf Eppstein aus Feuchtwangen
im Alter von 77 Jahren zur letzten Ruhe bestattet. Er stammte aus einer
Familie, wo nicht nur Tora und Gebote gewissenhaft geübt werden, sondern
in der sich die Glieder heute noch mit 'Himmelarbeit'
beschäftigen. Sein Vater übte in Mönchsroth den
verantwortungsvollen Beruf eines Sofer (Toraschreibers) aus, wie es sein
Bruder heute noch tut. In gleicher Weise betätigte sich der
Dahingeschiedene im Zusammenwirken mit seiner gleichgesinnten Gattin, die
ihm vor einigen Jahren im Tod vorausging, zum Segen. - Am Grabe schilderte
Herr Lehrer Neumann aus Feuchtwangen die vorbildliche Lebensführung des Verblichenen.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Über Jette Behr (1897-1971) - Artikel von Angelika Brosig
im Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Mönchsroth vom Mai 2009
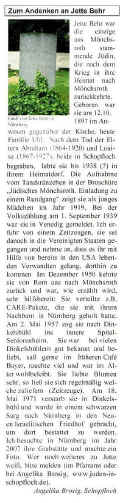 Artikel
"Zum Andenken an Jette Behr. Mit Foto: Grab von Jette
Behr in Nürnberg. Artikel
"Zum Andenken an Jette Behr. Mit Foto: Grab von Jette
Behr in Nürnberg.
Jette Behr war die einzige aus Mönchsroth stammende Jüdin, die nach dem
Krieg in ihre Heimat nach Mönchsroth zurückkehrte. Geboren war sie am
12.10.1897 im Anwesen gegenüber der Kirche, heute Familie Uhl. Nach dem
Tod der Eltern Abraham (1864-1920) und Louisa (1867-1927), beide in
Schopfloch begraben, lebte sie bis 1938 (?) in ihrem Heimatdorf. Die
Aufnahme vom Tanzkränzchen in der Broschüre 'Jüdisches Mönchsroth.
Einladung zu einem Rundgang' zeigt sie als junges Mädchen im Jahr 1919.
Bei der Volkszählung am 1. September 1939 war sie in Venedig gemeldet.
Ich erfuhr von einem Zeitzeugen, sie sei danach in die Vereinigten Staaten
gegangen und nehme an, dass es ihr mit Hilfe von bereits in den USA
lebenden Verwandten gelang, dorthin zu kommen. Im Dezember 1950 kehrte sie
von Rom aus nach Mönchsroth zurück und war, wie erzählt wird, sehr
hilfsbereit: Sie verteilte z.B. CARE-Pakete, die sie mit ihrem Nachbarn in
Nürnberg geholt hatte. Am 2. Mai 1957 zog sie nach Dinkelsbühl ins
innere Spital-Seniorenheim. Sie war bei vielen Dinkelsbühlern gut bekannt
und beliebt, saß gerne im früheren Cafè Bayer, rauchte viel und war im
Alter wohlbeleibt. Sie liebte Blumen sehr, so ließ sie sich regelmäßig
welche zuliefern (Zeitzeuge). Am 19. Mai 1971 verstarb sie in Dinkelsbühl
und wurde in einem schwarzen Sarg nach Nürnberg in den Neuen
Israelitischen Friedhof gebracht, um dort bestattet zu werden. Ich
besuchte in Nürnberg im Jahr 2007 ihre Grabstätte und machte ein Foto.
Wer noch weiteres zu Jette weiß, bitte melden (im Pfarramt Mönchsroth
oder bei Angelika Brosig, www.juden-in-schopfloch.de). |
Hinweis zu Lehrer Max Levite (geb. 1878 in Mönchsroth -
umgekommen nach Deportation 1942)
(Quelle: Seite der
Stephani-Volksschule Gunzenhausen)
 Lehrer
Max Levite (links mit seiner Schulklasse in Gunzenhausen)
ist am 28. Oktober 1878 in Mönchsroth geboren. Seine Eltern waren
Feis Levite, Handelsmann in Mönchsroth in Lina Leiter aus Dinkelsbühl.
Am 9. Dezember 1907 heiratete er Selma geb. Herz aus Mittelsinn.
Levite war bis 1922 in Forth, danach in Gunzenhausen
als Lehrer tätig. Das Ehepaar hatte fünf Kinder (eines früh
verstorben). Erst im November 1938 verließ die Familie Levite (Söhne
Hans und Ludwig sowie später auch Tochter Suse sind nach Palästina
ausgewandert; das Schicksal von Fritz ist ungeklärt) Gunzenhausen und zog
nach Stuttgart, von wo sie 1940 oder 1941 nach Buttenhausen
eingewiesen wird. Am 22. August 1942 erfolgte die Deportation in das
Ghetto Theresienstadt. Selma und Max Levite sind beide umgekommen (für
tot erklärt). Sohn Ludwig Levite ist 1943 als Soldat der britischen Armee
bei der Bombardierung eines Schiffes durch deutsche Flugzeuge
umgekommen. Lehrer
Max Levite (links mit seiner Schulklasse in Gunzenhausen)
ist am 28. Oktober 1878 in Mönchsroth geboren. Seine Eltern waren
Feis Levite, Handelsmann in Mönchsroth in Lina Leiter aus Dinkelsbühl.
Am 9. Dezember 1907 heiratete er Selma geb. Herz aus Mittelsinn.
Levite war bis 1922 in Forth, danach in Gunzenhausen
als Lehrer tätig. Das Ehepaar hatte fünf Kinder (eines früh
verstorben). Erst im November 1938 verließ die Familie Levite (Söhne
Hans und Ludwig sowie später auch Tochter Suse sind nach Palästina
ausgewandert; das Schicksal von Fritz ist ungeklärt) Gunzenhausen und zog
nach Stuttgart, von wo sie 1940 oder 1941 nach Buttenhausen
eingewiesen wird. Am 22. August 1942 erfolgte die Deportation in das
Ghetto Theresienstadt. Selma und Max Levite sind beide umgekommen (für
tot erklärt). Sohn Ludwig Levite ist 1943 als Soldat der britischen Armee
bei der Bombardierung eines Schiffes durch deutsche Flugzeuge
umgekommen. |
Hinweis zu Salomon Elkan
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Kunstfärberei und Druckerei für Ritualien seit
1851
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Dezember 1851:
"Aus Bayern, im November (1851). In Mönchsroth bei Dinkelsbühl hat
ein Herr Maier aus Würzburg, Schwager des Rabbinen Ettlinger in Altona,
eine Kunstfärberei und Druckerei etabliert, die besonders Gegenstände
für den jüdischen Kultus, als : Vorhänge vor die heilige Lage,
Altardecken und dergleichen fertigt; wir empfehlen den kunstsinnigen
Unternehmer der Beachtung der Kunstliebhaber." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Dezember 1851:
"Aus Bayern, im November (1851). In Mönchsroth bei Dinkelsbühl hat
ein Herr Maier aus Würzburg, Schwager des Rabbinen Ettlinger in Altona,
eine Kunstfärberei und Druckerei etabliert, die besonders Gegenstände
für den jüdischen Kultus, als : Vorhänge vor die heilige Lage,
Altardecken und dergleichen fertigt; wir empfehlen den kunstsinnigen
Unternehmer der Beachtung der Kunstliebhaber." |
Lehrreicher Gemeindebesuch des Rabbiners
Nowak aus Frankfurt (Ende 1926)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Mönchsroth. Kürzlich weilte hier Herr Rabbiner Nowak aus
Frankfurt am Main. Neben einzelnen erbaulichen Tora-Schiurim hielt er einen sehr
interessanten Vortrag über 'Die Geschichte der Juden und die Aufgaben der
Gegenwart.' Er überzeugte die gesamte Gemeinde, dass schon die Tora zu Urzeiten
die wichtigste Quelle unserer Religion war und die beste Waffe, die feindlichen
Angriffe von außen abzuwehren. In sehr anschaulicher Weise überzeugte er die
Anwesenden, dass das berufliche Leben in Verbindung mit Torastudium seine segensreiche
Aufgabe erfüllt. In seiner Begrüßung wies Lehrer Erlebacher darauf hin, dass
in hiesiger Gemeinde das Toralernen von jeher auf hoher Blüte stand, was die in
den verlassenen Ständern vorhandenen abgegriffenen Werke beweisen und sprach
den Wunsch aus, dass diese auch in unserer an Torawissen so armen Zeit wieder
fleißig benutzt würden. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Mönchsroth. Kürzlich weilte hier Herr Rabbiner Nowak aus
Frankfurt am Main. Neben einzelnen erbaulichen Tora-Schiurim hielt er einen sehr
interessanten Vortrag über 'Die Geschichte der Juden und die Aufgaben der
Gegenwart.' Er überzeugte die gesamte Gemeinde, dass schon die Tora zu Urzeiten
die wichtigste Quelle unserer Religion war und die beste Waffe, die feindlichen
Angriffe von außen abzuwehren. In sehr anschaulicher Weise überzeugte er die
Anwesenden, dass das berufliche Leben in Verbindung mit Torastudium seine segensreiche
Aufgabe erfüllt. In seiner Begrüßung wies Lehrer Erlebacher darauf hin, dass
in hiesiger Gemeinde das Toralernen von jeher auf hoher Blüte stand, was die in
den verlassenen Ständern vorhandenen abgegriffenen Werke beweisen und sprach
den Wunsch aus, dass diese auch in unserer an Torawissen so armen Zeit wieder
fleißig benutzt würden.
Herr Nowak begab sich dann am Sonntag in die zwei Stunden entfernte
Nachbargemeinde Wittelshofen, wo seine
Ausführungen und Anregungen auf fruchtbaren Boden fielen." |
Verhandlung gegen den "Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in
Mönchsroth" (1927)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September
1927: "Dinkelsbühl. Vor dem Amtsgericht Dinkelsbühl fand
kürzlich die Verhandlung gegen den Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in Mönchsroth
statt. Der Tatbestand war folgender: Der vor über fünfzig Jahren nach
Amerika ausgewanderte Samuel Elkan hat seiner früheren Heimatgemeinde 200
Dollar zur Verteilung testamentarisch zugewiesen und seinen Bruder Julius
Elkan mit der Vollstreckung des Testamentes betraut, dieser sandte den
ganzen Betrag an den früheren Kultusvorstand, welcher denselben nach
beigefügter Anweisung weitergab. Der oben erwähnte Angeklagte behauptete
nun, in später Nachtstunde eine geheime Versammlung belauscht zu haben,
wonach die Juden von Mönchsroth die Hälfte der Erbschaft unterschlagen wollten.
In der Verhandlung entpuppte sich die Sache als böswillige Verleumdung,
der jede Grundlage fehlte. Für diese Heldentat wurde der Beklagte zu 60
Mark Geldstrafe eventuell 6 Tage Haft verurteilt. Auch der Schriftleiter
des 'Stürmer', Organ für Wahrheit und Recht, welcher diese aus der Luft
gegriffene Anschuldigung zu einer großen antisemitischen Hetze in
Versammlungen und in seinem Wochenblatt ausgeschlachtet hatte, wird sch
wegen dieses Geistesproduktes zu verantworten haben. - Herr Julius
Schulmann übersiedelte vor kurzem nach Ansbach. Mit großer
Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit versah er den Posten eines zweiten
Vorstandes und Kassiers. Zu seinem Nachfolger wurde Herr E. Levite
einstimmig gewählt. Möge unter seiner Mitwirkung die klein gewordenen Gemeinde
segensreich gedeihen." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September
1927: "Dinkelsbühl. Vor dem Amtsgericht Dinkelsbühl fand
kürzlich die Verhandlung gegen den Hakenkreuzler und Schuhmacher Bach in Mönchsroth
statt. Der Tatbestand war folgender: Der vor über fünfzig Jahren nach
Amerika ausgewanderte Samuel Elkan hat seiner früheren Heimatgemeinde 200
Dollar zur Verteilung testamentarisch zugewiesen und seinen Bruder Julius
Elkan mit der Vollstreckung des Testamentes betraut, dieser sandte den
ganzen Betrag an den früheren Kultusvorstand, welcher denselben nach
beigefügter Anweisung weitergab. Der oben erwähnte Angeklagte behauptete
nun, in später Nachtstunde eine geheime Versammlung belauscht zu haben,
wonach die Juden von Mönchsroth die Hälfte der Erbschaft unterschlagen wollten.
In der Verhandlung entpuppte sich die Sache als böswillige Verleumdung,
der jede Grundlage fehlte. Für diese Heldentat wurde der Beklagte zu 60
Mark Geldstrafe eventuell 6 Tage Haft verurteilt. Auch der Schriftleiter
des 'Stürmer', Organ für Wahrheit und Recht, welcher diese aus der Luft
gegriffene Anschuldigung zu einer großen antisemitischen Hetze in
Versammlungen und in seinem Wochenblatt ausgeschlachtet hatte, wird sch
wegen dieses Geistesproduktes zu verantworten haben. - Herr Julius
Schulmann übersiedelte vor kurzem nach Ansbach. Mit großer
Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit versah er den Posten eines zweiten
Vorstandes und Kassiers. Zu seinem Nachfolger wurde Herr E. Levite
einstimmig gewählt. Möge unter seiner Mitwirkung die klein gewordenen Gemeinde
segensreich gedeihen." |
Weitere Familien verlassen Mönchsroth (1928)
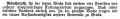 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli
1928: "Mönchsroth. In der letzten Woche sind weitere vier
Familien aus unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde weggezogen. Auch unser
beliebter Vorstand verließ uns. In der gleichen Woche trugen wir ein
treues Vorstandsmitglied unserer Gemeinde zu Grabe." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli
1928: "Mönchsroth. In der letzten Woche sind weitere vier
Familien aus unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde weggezogen. Auch unser
beliebter Vorstand verließ uns. In der gleichen Woche trugen wir ein
treues Vorstandsmitglied unserer Gemeinde zu Grabe." |
Besuch des
Distriktrabbiners Dr. Munk aus Ansbach (1932)
 Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 6. Oktober 1932: "Mönchsroth, 26. September
1932. Ein hoher Genuss war unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde
beschieden. Gelegentlich seines alljährlichen Besuches erfreute uns Herr
Distriktsrabbiner Dr. Munk aus Ansbach mit einer Predigt, die aus der Zeit
heraus für die Zeit angepasst, viel zu unserer Erbauung und geistigen
Kräftigung beitrug." Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 6. Oktober 1932: "Mönchsroth, 26. September
1932. Ein hoher Genuss war unserer altehrwürdigen Kultusgemeinde
beschieden. Gelegentlich seines alljährlichen Besuches erfreute uns Herr
Distriktsrabbiner Dr. Munk aus Ansbach mit einer Predigt, die aus der Zeit
heraus für die Zeit angepasst, viel zu unserer Erbauung und geistigen
Kräftigung beitrug." |
Anzeigen /
Dokumente jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Verlobungsanzeige von Jenny Süss und Ernst Levite (1925)
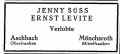 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. August 1925:
"Jenny Süss - Ernst Levite. Verlobte.
Aschbach Oberfranken - Mönchsroth
Mittelfranken." |
Verlobungsanzeige
von Selma Mayer und Karl Sondheim (1930)
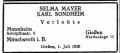 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1930:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1930:
"Selma Mayer - Karl Sondheim. Verlobte.
Mannheim Schöpflinstraße 6 - Mönchsroth in Bayern
- Gießen Nordanlage 11.
Gießen, 1. Juli 1930". |
Weitere Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |
Rechnung
der
Firma W. J. Gutmann
in Mönchsroth (1868) |

|

|
| |
Rechnung
der Firma W. J. Gutmann vom 8. Juni 1868,
geschickt von Mönchsroth nach Bergheim; nach den Angaben auf der Rechnung war
W. J. Gutmann Inhaber eines Lagers "in Tuch, Buckskin, Seiden, Wollen- & Baumwollenwaren" sowie von
"Colonial-Waren - Tabak & Cigarren". |
| |
|
|
Rechnung
des Arztes
Dr. Josef Goldschmidt
(1898) |
 |
| Die
Rechnung von Dr. Goldschmidt wurde am 31. Dezember 1898 ausgestellt. Dr.
Goldschmidt ist bereits mehrfach auf dieser Seite genannt (siehe oben). Zu
seinen Lebensdaten: Dr. Josef Goldschmidt (geb. 29. November 1865
in Westheim) war verheiratet mit Ricka geb. Frank (geb. 3. März
1868 in Heidingsfeld). Er genoss
höchstes Ansehen in Mönchsroth. 1892 hielt er anlässlich der Einweihung
des Kriegerdenkmals von 1870/71 die Rede auf Kaiser und Reich. Seine Frau
war um 1925 die Vorsitzende des bereits 1818 gegründeten Jüdischen
Frauenvereins. Die beiden hatten drei Kinder: Friedel (geb.
1898 in Mönchsroth, später Krankenschwester in Würzburg), Else
(Elsa, geb. 1909 in Mönchsroth), Max (geb. 1906 in Mönchsroth).
In der NS-Zeit lebte die Familie in Würzburg (Theresienstraße 6), von wo
alle Familienmitglieder 1941 beziehungsweise 1942 nach Riga
beziehungsweise nach Theresienstadt deportiert wurden. Alle fünf sind
umgekommen beziehungsweise wurden ermordet: Josef und Ricka Goldschmidt im
Ghetto Theresienstadt. |
| |
|
|
Rechnung
von
Elkan Levite (1891) |
 |
 |
| |
Rechnung
des Tuch- und Schnittwarengeschäftes von Elkan Levite (geb. 1821 in
Mönchsroth, gest. 1889) ist unterschrieben von Louis Levite (1861-1926).
Weiteres zur Familiengeschichte siehe auf der Seite Levite
Family of Moenchsroth (von Rolf Hofmann, pdf-Datei, interner
Link). |
| |
|
|
Einschreibbrief
an
Handelsmann Simon Mayer
in Mönchsroth (1912) |
 |
| |
Der
Einschreibbrief des Königlichen Grundbuchamtes Thannhausen an den
Handelsmann Simon Mayer wurde am 26. September 1912 verschickt. |
| |
|
|
| Visitenkarte von Emma Levite
|
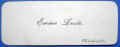 |
| |
|
|
Sonstiges
Nichtjüdische
Frauen bei der Beerdigung von Frau werden im "Stürmer" denunziert (1936)
Anmerkung: es handelt sich um eine typische Zuschrift an den "Stürmer"
("Lieber Stürmer!"), mit dem nicht parteitreue Personen, die in irgendwelcher
Weise eine Verbundenheit zu jüdischen Einwohnern zum Ausdruck brachten, in
hässlicher Weise denunziert wurden.
 Aus der NS-Propagandazeitschrift "Der Stürmer" vom April 1936: "Die
Judenklageweiber von Mönchsroth. Lieber Stürmer! In Mönchsroth,
der früheren Hochburg jüdischer Viehschacherer und Bauernwürger, starb eine
alte Jüdin namens Erlenbacher. Bei der Überführung der Leiche am 14.
Februar 1936 zum Judenfriedhof nach Wallerstein konnte man alle
ortsansässigen Juden hinter dem Sarge gehen sehen. Den Schluss des Zuges
aber bildeten fünf deutsche Frauen aus Mönchsroth. Ihre Namen sind:
Frl. Lindenmayer, Mönchsroth, Nummer 29, Frau Katharina Möbus,
Mönchsroth, Nummer 44, Frau Graule, Mönchsroth, Nummer 69,
Frau Wilhelm, Mönchsroth, Nummer 70. Die Gemeinschaftsschwester
Hermann, Mönchsroth, Nr. 72. E." .
Aus der NS-Propagandazeitschrift "Der Stürmer" vom April 1936: "Die
Judenklageweiber von Mönchsroth. Lieber Stürmer! In Mönchsroth,
der früheren Hochburg jüdischer Viehschacherer und Bauernwürger, starb eine
alte Jüdin namens Erlenbacher. Bei der Überführung der Leiche am 14.
Februar 1936 zum Judenfriedhof nach Wallerstein konnte man alle
ortsansässigen Juden hinter dem Sarge gehen sehen. Den Schluss des Zuges
aber bildeten fünf deutsche Frauen aus Mönchsroth. Ihre Namen sind:
Frl. Lindenmayer, Mönchsroth, Nummer 29, Frau Katharina Möbus,
Mönchsroth, Nummer 44, Frau Graule, Mönchsroth, Nummer 69,
Frau Wilhelm, Mönchsroth, Nummer 70. Die Gemeinschaftsschwester
Hermann, Mönchsroth, Nr. 72. E." . |
III) Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betsaal vorhanden. Am 29. August 1761 erfolgte die feierliche Einweihung einer neuen
Synagoge mit Mikwe, Schulraum und Lehrerwohnung. Als bauliches Vorbild diente die 1755 errichtete Leutershausener Synagoge. Kennzeichnend sind die an beiden Längswänden sich befindenden Rundbogenfenster, die einfache Gliederung des längsrechteckigen Saalraumes mit einem umlaufenen Kämpfergesims und einem Spiegelgewölbe über einer Voute, eines dreieckförmig abgeschrägten Auflagers. Das Oberamt begründete das Ansinnen der jüdischen Gemeinde zum Bau einer Synagoge mit Schreiben vom 26. August
1758 damit, dass die "Cammer", in der die Juden im Haus des Lazarus Simon ihre Schule haben, wegen der anwachsenden Zahl an Leuten zu klein, sehr finster und so baufällig sei, "dass bei Regen die Leute dortselbsten kaum mit trockenem Fuß stehen können". Mit Vertrag vom 15. September
1760 erwarb die Judenschaft vom Schneider- und Zunftmeister Adam Loehr ein am damaligen Ortsrand gelegenes Grundstück. Kurz zuvor hatten sich einige Mönchsrother Juden mit der Bitte an den Fürst gewandt, zur Finanzierung des Synagogenbaus mit Kosten in Höhe von 2.200 Gulden eine Kollekte bei anderen jüdischen Gemeinden durchführen zu dürfen und ihnen dafür die üblichen Abgaben an den Landesherren zu erlassen. Was die Vermögensverhältnisse der damaligen Zeit betrifft, so sind 500 fl. als das auf ein Jahr bezogene Existenzminimum einer Familie anzusehnen. In der Vermögensklassifikation von 1770 wurde das Vermögen von 13 jüdischen Haushalten über 1.000 fl. geschätzt, das von 6 über 500 fl. 3 Haushaltsvorstände hatten zwischen 150 und 500 fl., lebten also unter dem Existenzminimum, 9 waren mittellos. Die reichsten Juden waren der Barnosse Hirsch Levi mit 23.000 fl. Vermögen und Lazarus Simon mit 7.900 fl. 57 % der Familien lebten somit unter dem Existenzminimum. An der Westseite der für eine Landgemeinde wie Mönchsroth durchaus stattlichen Synagoge befanden sich die beiden jeweils für Frauen und Männer getrennten Eingänge. Der linke Eingang, die Frauenseite, führte hinauf auf die Empore, die rechte Tür führte ins Erdgeschoss und war den Männern vorbehalten. Über der mit schlichten, gleichfarbigen Füllungen versehenen Brüstung der Frauenempore befand sich ein rund 1m hohes Holzgitter mit diagonal in Rautenmustern angebrachten Holzstäben, zur Beleuchtung diente ein Kronleuchter. Die Decke war blau, mit goldenen Sternen bemalt. An der Frontseite war bis zu seiner Schändung im Jahr
1937 ein ca. 60 x 60 cm großer Hochzeitsstein angebracht. Die Mikwe befand sich ursprünglich im Keller der Synagoge, später dann in einem Nebengebäude, betrieben mit Hilfe eines Regenwasserspeichers. In diesem bis zum
Sommer 1938 gottesdienstlich genutzten Gebäude, heute Rathausstraße 1, konnte im Jahr 1988 unter den Brettern des Dachbodens im Ziegelschutt der neben Veitshöchheim zweitgrößte fränkische Genisafund geborgen werden. Der Fund umfasste insgesamt 5 Zentner Material mit zahlreichen Einzelblättern und Buchfragmenten aus religiöser Gebrauchsliteratur, Thorawimpel, Gebetsriemen, Gebetsmäntel, 4 Stoffhauben und einen Stoffhut. Im Rahmen der Gebrauchsliteratur fand sich ein unverziertes, stark Wasser geschädigtes Esterrollen-Fragment aus der Zeit um 1800, vermutlich in Mönchsroth hergestellt, ein Sulzbacher Gebetsbuch sowie Korrespondenz des Bezirksrabbiners von Oettingen mit seinen Mönchsrother Gemeindegliedern.
Artikel aus der Geschichte der Synagoge
Schäden an der Synagoge durch ein Unwetter (1929)
 Artikel aus der "Bayerische
Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1929: "Mönchsroth. Das
am 4. Juli (1929) niedergegangene Unwetter hat auch die altehrwürdige
Kultusgemeinde schwer betroffen. Die eiergroßen Hagelkörner zertrümmerten an
der im Jahre 1760 erbauten Synagoge und an dem Schulhaus sämtliche Fenster der
Westfront und eine Menge Ziegel, sodass die Dächer umgedeckt werden müssen.
Die Feld- und Gartengewächse wurden vernichtet."
Artikel aus der "Bayerische
Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1929: "Mönchsroth. Das
am 4. Juli (1929) niedergegangene Unwetter hat auch die altehrwürdige
Kultusgemeinde schwer betroffen. Die eiergroßen Hagelkörner zertrümmerten an
der im Jahre 1760 erbauten Synagoge und an dem Schulhaus sämtliche Fenster der
Westfront und eine Menge Ziegel, sodass die Dächer umgedeckt werden müssen.
Die Feld- und Gartengewächse wurden vernichtet."
|
Adresse/Standort der Synagoge:
Rathausstraße 1
IV) Fotos
Um 1930:
Historische Aufnahmen -
Ritualien in der Synagoge
(Aufnahmen von 1927/30 durch Th. Harburger, veröffentlicht in ders.:
Die Inventarisation jüd. Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern Bd. 3 S.
394-396). |
|
 |
 |
 |
Tora-Aufsatz
(Rimmon) aus dem
Besitz
von Ernst Levite, Anfang 18. Jahrh.,
Meister Johannes Weiss,
Nürnberg
(bis 2015 bei der Israelitische Kultusgemeinde
Nürnberg, vgl. Foto und Presseartikel unten) |
Tora-Aufsatz
(Rimmon) aus dem
frühen
18. Jahrhundert
(heute im Jewish Museum New York) |
Toraschild (Tass) aus der
2.
Hälfte des 17. Jahrhunderts
(heute im Jewish Museum New York) |
| |
|
| |
|
|
Hochzeitsstein
(Bildarchiv Günter Deininger) |

|
| |
Der Hochzeitsstein
an der Synagoge
|
| |
|
Nach 1945:
Die Synagoge als Rathaus |
 |
| |
Presseartikel aus den
1950er-Jahren (Bildarchiv Günter Deininger): "Mönchsroths
Rathaus war einst eine Synagoge. Mönchsroth. Das dem Baustil nach
zweifellos eigenartigste Rathaus im Landkreis ist das der Gemeinde
Mönchsroth. Die Rundbogenfenster im hinteren Abschnitt dieses
Satteldachgebäudes erinnern noch heute daran, dass es, im 18. Jahrhundert
erbaut, bis 1937 als Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde
diente"
|
| |
|
|
| Bergung der Genisa 1988 |
|
|
 |
 |
 |
| Die Bergung der
Genisa mit Prof. Dr. Mosche Rosenfeld, London (Fotoarchiv Jüdisches
Museum Franken, Fürth) |
| |
| |
 |
|
| |
Material aus der Genisa
Mönchsroth
(Aufnahme: Jüdisches Museum Franken, Fürth) |
|
| |
|
|
|
Die ehemalige
Synagoge 2005/06 |
|
|

|

|

|
| Unterschiedliche
Ansichten der ehemaligen Synagoge (Fotos: U. Metzner, Feuchtwangen über www.synagogen.info) |
| |
 |
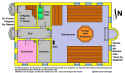
|
|
Ansicht der ehemaligen
Synagoge,
Aufnahme März 2006 (Gunther Reese) |
Der Grundriss der ehemaligen
Synagoge
(Rekonstruktion: Günter Deininger) |
|
| |
|
|
2006: Der am
23. November 2006
eingeweihte Gedenkstein |
 |
 |
| |
"Zum Gedenken an
die jüdischen Bürger Mönchsroths mit ihrer 1761 erbauten und bis 1938
genutzten Synagoge im Nationalsozialismus ihrer Heimat beraubt, verfolgt,
ermordet" sowie deutsch und hebräisch aus 4. Mose 10,9b: "Dass
Euer gedacht werde vor dem Herrn" (Aufnahmen Georg Hornberger /
Gunther Reese) |
| |
|
| |
|
Presseartikel zur
Einweihung
des Gedenksteines |
|
|
 |
 |
 |
| Fränkische Landeszeitung vom
24.11.2006 |
ebd. vom 25./26.11.2006 |
ebd. vom 27.11.2006 |
| |
|
|
| Einige erhaltene Gegenstände
/ Ritualien aus der Genisa |
|
 |
 |
 |
 |
Holzmodel zur Herstellung von
Tefillin
(19. Jahrhundert) - aus der Genisa
Mönchsroth (Fotoarchiv
Jüdisches Museum
Franken, Fürth) |
Tora-Aufsatz (Rimmon) aus dem
Besitz von
Ernst Levite, Anfang 18. Jahrh., Meister
Johannes Weiss,
Nürnberg (Aufnahme:
Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg, siehe Presseartikel unten) |
Hölzerner Zeigestab (Jad) aus
der
Mönchsrother Genisa, 18. Jh. (Jüdisches
Museum Franken,
Fürth, Aufnahme links:
Gunther Reese; rechts: Hahn) |
| |
|
|
Die folgenden sechs Fotos zeigen Fundgegenstände aus der Genisa
Mönchsroth im Jüdischen Museum Franken (Fotos von Annette Kradisch,
Nürnberg)
|
|
 |
 |
 |
Keter Tora (Torakrone)
aus
dem 19. Jahrhundert |
Tora-Wimpel aus
dem 17.
Jahrhundert |
Mesusa und Pergamentrollen
aus
dem 19. Jahrhundert |
| |
|
|
 |
 |
 |
Öllämpchen aus
dem 17.
Jahrhundert
|
Jad, Torazeiger aus dem 18.
Jahrhundert
es handelt sich um denselben Zeiger wie zwei Fotozeilen weiter oben,
rechts) |
Chanukka-Leuchter aus dem
18.
Jahrhundert (Keramik,
teilweise rekonstruiert) |
| |
|
|
Ehemalige jüdische Häuser
in
Mönchsroth |

|

|
| |
Anwesen Hauptstraße 9, ehemals
Salomon
Schulmann. Aufnahme aus den 1920er-
Jahren (Bildarchiv Deininger) |
Scheune Anwesen Sägweiherstraße
1, ehemals
Viehhändler Adolf und Moritz Behr, Hausname
"Keiam"
(Foto Gunther Reese, 2005) |
| |
|
|
Die Toten der jüdischen
Gemeinde
Mönchsroth wurden in Schopfloch
beigesetzt |

|

|
| |
Grabmal Leopold Strauß, geb.
11.2.1856
in Gissigheim, gest. 19.11.1934
in Dinkelsbühl |
Grabmal Gustav Mayer, geb.
8.9.1903,
gest. 18.6.1915 (abgebrochene Säule
für viel zu frühen Tod) |
Einzelne Presseartikel
| Dezember 2015:
Rimon geht nach Cincinatti |
Artikel von Olaf Przybilla und Susanne
Hermanski in der "Süddeutschen Zeitung" vom 28. Dezember 2015:
"Rimon geht nach Cincinatti. Heikler Beutekunstfall: Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg gibt einen Thoraaufsatz zurück
Dieser Moment am Prinzregentenufer in Nürnberg schien vor vier Monaten noch gar nicht denkbar zu sein. Und nun hat es also doch geklappt: Das Brüderpaar Norman und Ed Frankel ist aus Cincinatti nach Nürnberg gekommen und hat in einer Anwaltskanzlei in der Nähe der Wöhrder Wiese das überreicht bekommen, worum die beiden seit 2008 leidenschaftlich gekämpft haben: einen Rimon, also einen jener kunstvoll verzierten Aufsätze, die in der Synagoge zu jeder Thorarolle gehören.
'Wir sind beide sehr glücklich jetzt', sagt Ed Frankel. Sein Bruder nickt.
Der Rimon, gefertigt 1750, gehörte ursprünglich dem Großvater der beiden, Ernst Levite. Er war Rabbiner in der mittelfränkischen Gemeinde Mönchsroth und musste vor den Nazis fliehen. Rimonim sind liturgisch nur als Pärchen von Wert, beide wurden dem Rabbiner von Schergen der SA geraubt. Wie sie später in den Besitz der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg gekommen sind, ist nicht klar. Dass Levite sie der Gemeinde geschenkt hat, wie lange gemutmaßt wurde, dürfte aber ausgeschlossen sein. Der erste der beiden Thoraaufsätze war auch schon längst wieder bei der Familie Frankel, die in den USA lebt, als das Ringen um den zweiten entbrannte...."
Link
zum Artikel |
VI) Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann:
Die jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörtung.
1979. S. 198-199. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse
jüdischen Lebens in Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. A 85. 1988. S. 166. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of
Jewish Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 316-317. |
 | Johannes Mordstein: Selbstbewusste
Untertänigkeit. Obrigkeit und Judengemeinden im Spiegel der Schutzbriefe
der Grafschaft Oettingen 1637-1806. Epfendorf 2005. |
 |
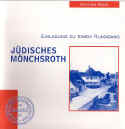 Gunther Reese: Jüdisches Mönchsroth. Einladung zu einem Rundgang.
Verlag Medien und Dialog. Haigerloch 2006.
Gunther Reese: Jüdisches Mönchsroth. Einladung zu einem Rundgang.
Verlag Medien und Dialog. Haigerloch 2006. |
 | ders.: Skizzen zur Geschichte der jüdischen
Gemeinde Mönchsroth. Rieser Kulturtage. Dokumentation Bd. XVI/2006.
Erscheint Nördlingen 2007. |
 |  "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010. "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010.
Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu.
ISBN 978-3-89870-448-9. Abschnitt zu Mönchsroth S.
422-433. |
 |
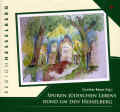 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,
Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Moenchsroth Middle Franconia.
Jews were present in the late 16th century. A synagogue was built in 1760 and
the Jewish population reached 194 (total 848) in 1912. In 1933, 23 Jews were
left. By April 1938, eight had emigrated and 12 had left for other German cities.
On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue was vandalized and
by January 1939 the remaining Jews had left the town.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|