|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Kleinwallstadt (VG
Kleinwallstadt, Kreis
Miltenberg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Kleinwallstadt bestand eine jüdische Gemeinde bis
1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1719
wird erstmals ein Jude aus Kleinwallstadt genannt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: 1803 acht jüdische Familien, 1814 52 jüdische Einwohner (4,3 % von
insgesamt 1.212 Einwohnern), 1867 66 (4,9 % von 1.359), 1880 54 (3,8 % von
1.425), 1892 72 (in 12 Familien), 1893 69 (in elf Familien), 1900 81 (5,5 % von 1.477).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Kleinwallstadt 12
Familien genannt. Die Namen der Matrikelinhaber fehlen jedoch (für den
Bereich des ehemaligen Landgerichtes Kleinwallstadt)
vollständig.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(s.u.), eine Religionsschule (von 1899 an für einige Jahre Elementarschule in
einem dazu neu erbauten jüdischen Schulhaus) und
ein rituelles Bad (im Untergeschoss der Synagoge). Die Toten der Gemeinde wurden
im jüdischen Friedhof Schweinheim bei
Aschaffenburg beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war
ein Religionslehrer (nach 1899 für einige Jahre ein Elementarlehrer, s.u. bei
Lehrer Simon Grünfeld) angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet
tätig war.
Um 1871 wird Lehrer Kleiner genannt (siehe unten); zum "angehörigen
Schulsprengels" von Kleinwallstadt gehörten damals
Großwallstadt,
Sulzbach,
Hofstetten und
Hausen (siehe Angabe in der Kollekte 1871). Um 1888/1889 war Lehrer Halle am Ort; er unterrichtete damals auch die jüdischen
Kinder in Hofstetten. 1892 war S. Kahn
Lehrer, Kantor und Schochet in Kleinwallstadt. Es gab in diesem Jahr in der
Religionsschule der Gemeinde 14 Kinder zu unterrichten. Zur jüdischen Gemeinde
Kleinwallstadt gehörten nach dem "Statistischen Jahrbuch des
Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" von 1892 auch die Gemeinden in
Hofstetten und
Großwallstadt beziehungsweise
wurden von ihr mitbetreut. 1893 wird als Lehrer, Kantor und Schochet Simon
Grünfeld genannt. Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Aschaffenburg.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: Um 1871 Max Freund, um 1879/1899 Liebmann Freund.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Moritz Freund (geb.
14.11.1889 in Kleinwallstadt, vor 1914 in Aschaffenburg wohnhaft, gef.
26.2.1916).
Um 1924, als noch 50 jüdische Einwohner gezählt wurden (3,0 % von
insgesamt 1.656), war Gemeindevorsteher Richard Grünebaum. Als Lehrer der
damals nur noch zwei schulpflichtigen jüdischen Kinder kam Lehrer Leopold
Lehmann aus Eschau nach Kleinwallstadt. Er war
auch Schochet in Kleinwallstadt. 1932 waren die Gemeindevorsteher Richard
Grünebaum (1. Vors.), Max Stern (2. Vors.) und Sally Reis (3. Vors.). Als Lehrer
war Julius Stern tätig. Er unterrichtete im Schuljahr 1931/32 fünf jüdische
Kinder in Religion.
1933 wurden noch 45 jüdische Einwohner gezählt (2,3 % von
insgesamt 1938 Einwohnern). Noch in diesem Jahr kam es zu ersten
Anschlägen auf die Synagoge und die jüdischen Wohnhäuser, wo (mehrfach in der
Folgezeit) die Fenster eingeworfen wurden. Zwischen 1934 und 1935 verließen
fünf der jüdischen Einwohner den Ort, weitere 16 zwischen 1936 und 1938. 1938
wurden die letzten jüdischen Einwohner der Gemeinde Aschaffenburg
angegliedert. Insgesamt verließen bis 1938 38 der jüdischen Einwohner
den Ort; von ihnen emigrierten 16 in die USA, vier nach Holland, je zwei nach
Frankreich und Palästina. Die anderen verzogen in andere deutsche Orte (11 nach
Frankfurt am Main).
Von den in Kleinwallstadt geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ricka Bender geb. Grünebaum
(1887, vgl. Kennkarte unten), Hedwig Eckstein
geb. Grünebaum (1889), Emma Eggener geb. Oppenheimer (1884), Rosalie Frank geb.
Grünebaum (1896), Karoline Freitag geb. Reis (1882), Heinrich (Hayum) Freund
(1868), Max Freund (1885), Adolf Grünebaum (1885), Jacques Grünebaum (1880),
Kurt Grünebaum (1924), Bertha Kahn geb. Grünebaum (1885), Zippora Landsberg
geb. Grünebaum (1895), Karolina Lehmann geb. Freund (1878, Tochter des Gemeindevorstehers
Liebmann Freund), Josef Oppenheimer (1866), Regina Oppenheimer (1875), Berta
Rosenzweig geb. Grünebaum (1889), Karoline Schmidt geb. Stern (1863), Johanna
Schönmann geb. Stern (1870), Bernhard Stern (1859), Ida Sulzbach geb.
Grünebaum (1883, vgl. Kennkarte unten)), Jenni Wertheim geb. Oppenheim (1879).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /
1879 / 1889 / 1892 / 1920
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:
"Zur sofortigen Besetzung ist die Stelle eines Religionslehrers und
Vorbeters mit einem fixen Gehalt von 265 Gulden bei freier Wohnung nebst
50-60 Gulden jährlichem Einkommen in loco für Schächterdienst, wenn
solcher mitversehen werden kann, vakant. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1872:
"Zur sofortigen Besetzung ist die Stelle eines Religionslehrers und
Vorbeters mit einem fixen Gehalt von 265 Gulden bei freier Wohnung nebst
50-60 Gulden jährlichem Einkommen in loco für Schächterdienst, wenn
solcher mitversehen werden kann, vakant.
Reflektanten wollen sich gefälligst an den hiesigen Kultusvorstand
wenden.
Kleinwallstadt bei Aschaffenburg, den 10. Juni 1872." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1879:
"Offene Lehrerstelle. Die hiesige Stelle eines Kantors und
Religionslehrers, verbunden mit Schächterdienst, ist vom 1. September
1879 ab zu besetzen. Gehalt Mark 500-600 und freue Wohnung.
Nebenverdienste ca. 200 (?) Mark. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1879:
"Offene Lehrerstelle. Die hiesige Stelle eines Kantors und
Religionslehrers, verbunden mit Schächterdienst, ist vom 1. September
1879 ab zu besetzen. Gehalt Mark 500-600 und freue Wohnung.
Nebenverdienste ca. 200 (?) Mark.
Bewerber wollen sich an den Unterzeichneten wenden.
Klein-Wallstadt (Bayern), 6. August 1879. Der Kultusvorstand: L.
Freund." |
| |
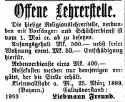 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1889:
"Offene Lehrerstelle.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1889:
"Offene Lehrerstelle.
Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden
mit Vorsänger- und Schächterdienst ist vom 1. Mai dieses Jahres ab zu
besetzen.
Anfangsgehalt Mark 500.- nebst freier Wohnung eventuell Mark 50.-
Entschädigung hierfür.
Nebenverdienste circa Mark 400.-
Reisekosten werden nur demjenigen vergütet, der die Stelle erhält.
Kleinwallstadt am Main (Bayern), 25. März 1889. Kultusvorstand: Liebmann
Freund." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1892:
"Offene Lehrerstelle. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1892:
"Offene Lehrerstelle.
Die hiesige Stelle eines Religionslehrers,
Kantors und Schochets ist sofort zu besetzen. Gehalt Mark 650. -
Nebenverdienste ca. Mark 400. - Verheiratete Lehrer mit kleiner Familie
werden bevorzugt.
Kleinwallstadt am Main, 29. Juli 1892. Kultusvorstand Liebmann
Freund." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1920:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle als Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1920:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle als
Elementarlehrerverweser,
Vorbeter und Schächter
auf 15. März oder 1. April zu besetzen. Festes
Gehalt 3.000 Mark und 1.000 Mark Nebeneinkommen garantiert, sehr schöne,
freue Wohnung. Erwünscht wäre ein Selbstverköstiger. Angebote nimmt
entgegen der Kultusvorstand der Gemeinde Kleinwallstadt in Bayern." |
Spendensammlung für das neue jüdische
Schulhaus
Anmerkung: Am Bau des neuen Schulhauses beteiligten sich zahlreiche
Spender. In der Zeitschrift "Der Israelit" wurden diese Spenden immer
wieder quittiert:
 Aus
einer Spendenliste in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September
1899: "An Herrn Vorstand L. Freund in Kleinwallstadt: zum Bau des
Schulhauses daselbst....10.- (Mark)". Aus
einer Spendenliste in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September
1899: "An Herrn Vorstand L. Freund in Kleinwallstadt: zum Bau des
Schulhauses daselbst....10.- (Mark)". |
Die Einweihung des neuen jüdischen Schulhauses am 26.
September 1899
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1899:
"Kleinwallstadt (Unterfranken). Es ist gewiss eine erfreuliche
Erscheinung, wenn eine kleine Landgemeinde der Bildungsstätte ihrer
Jugend besondere Pflege angedeihen lässt, wie dies bei der Kultusgemeinde
Kleinwallstadt der Fall ist. Sie hat im verflossenen Jahre ihre
Religionsschule in eine Elementarschule umgewandelt und in Befolgung der
behördlichen Anordnung, einen Schulhaus-Neubau errichtet. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1899:
"Kleinwallstadt (Unterfranken). Es ist gewiss eine erfreuliche
Erscheinung, wenn eine kleine Landgemeinde der Bildungsstätte ihrer
Jugend besondere Pflege angedeihen lässt, wie dies bei der Kultusgemeinde
Kleinwallstadt der Fall ist. Sie hat im verflossenen Jahre ihre
Religionsschule in eine Elementarschule umgewandelt und in Befolgung der
behördlichen Anordnung, einen Schulhaus-Neubau errichtet.
Zur
Einweihungsfeier dieses neu erbauten Schulhauses hatten sich am Schmini
Azzeret (= 26. September 1899) Nachmittags 3 Uhr die gesamte
Kultusgemeinde und viele Auswärtige in dem festlich dekorierten Lehrsaale
der neu erbauten Schule versammelt, woselbst sich auch auf Einladung der
Kultusgemeinde Herr königlicher Bezirksamtmann Fischer aus Obernburg,
Herr königlicher Lokalschulinspektor Pfarrer Löffler, Herr
Bezirkstechniker Haas, der Herr Bürgermeister, Herren Gemeinderäte und
die Herren Lehrer des Ortes einfanden. Nach feierlichem Absingen eines
Weiheliedes durch die Schüler, trug eine Schülerin in wirkungsvoller
Weise ein sinnvolles Gedicht vor. In seiner Ansprache, die hierauf Herr
Lehrer Grünfeld an die Versammlung richtete, brachte er dem himmlischen
Vater unter Anwendung des Psalmistenwortes: 'Wenn Gott nicht hilft ein
Haus zu bauen, vergebens bemühen sich seine Erbauter damit', Lob und Dank
dar. Dank zollte er hierauf den Schulbehörden für das Wohlwollen, das
sie der Kultusgemeinde bei ihrem Unternehmen entgegenbrachten, der
gesamten Kultusgemeinde mit ihrem tatkräftigen Vorstand, für ihre
Opferwilligkeit und Hingebung zur Sache. Des Weiteren hob er hervor, dass
ein sittlich religiöser Geist das ganze Schulleben durchzieht, dass aber
auch die Schule eine Pflanz- und Pflegestätte einer vernünftigen Bildung
und der Liebe zu König und Vaterland sein müsse. Mit einem begeistert
aufgenommenen Hoch auf den Landesregenten, Seiner königlichen Hoheit
Prinz Luitpold von Bayern, schloss der Redner seine Ausführungen. Herr
königlicher Lokalschulinspektor Pfarrer Löffler verlas hierauf ein
Schreiben des königlichen Distriktsschulinspektors Pfarrer Grünewald aus
Mömlingen, der in freundlicher Weise für die Einladung dankte, sein
Bedauern aussprach, infolge dringender Amtsgeschäfte an der Teilnahme
verhindert zu sein und dem Wunsche Ausdruck gab, dass Gottes reichster
Segen sich auf das neue Haus ergießen möge. In gleicher Weise hatte Herr
königlicher Bezirksamtsassessor Grill in einem Schreiben an den
Kultusvorstand, der Kultusgemeinde die Glück- und Segenswünsche
übermitteln lassen. Hierauf richtete Herr Pfarrer Löffler an den Lehrer
Worte der Begeisterung, ermunterte ihn zur Berufsfreude und treuer
Pflichterfüllung, ermahnte die Schüler zu Fleiß, Aufmerksamkeit und
Gehorsam und bat die Eltern, die Schule in jeder Weise zu unterstützen.
Herr Bezirksamtmann gratulierte der Kultusgemeinde, rühmte ihre
Opferwilligkeit und äußerte den Wunsch, dass der bisherige gute Stand
der Schule auch in das neue Haus übertragen werden möge. Herr
Bürgermeister Rohe dankte der Kultusgemeinde für das schöne Haus, das
eine Zierde des ganzen Ortes sei, betonte das gute Einvernehmen der
politischen mit der Kultusgemeinde. Hierauf dankte Herr Kultusvorstand
Liebmann Freund allen Teilnehmern der Eröffnungsfeier und empfahl die
Schule dem ferneren Wohlwollen der Behörde. Nachdem noch an die Schüler
Lebkuchen verteilt worden waren, besichtigte man die Räume, über welche
volle Befriedigung allerseits herrschte. Mit Stolz kann die Kultusgemeinde
auf ihr vollbrachtes Werk und ihre heutige Feier, die sich einem Kiddusch
Haschem (Heiligung Gottes) im wahrsten Sinne des Wortes gestaltete,
zurückblicken. Und wenn wir auch bei einer gewissen Seite, von der man
gerade eine Beihilfe hätte erwarten sollen, aus naheliegenden Gründen
merkwürdigerweise, einen grundsätzlichen Gegner fanden, so gedieh unser
Werk doch vortrefflich, wobei uns |
 die
Zuwendungen zahlreicher Glaubensgenossen, die uns die Ausführungen
unseres Unternehmens ermöglicht hatten, wesentlich zustatten kam. Den
edlen Spendern sei an dieser Stelle nochmals der wärmste Dank zum
Ausdruck gebracht. Noch ist die Kultusgemeinde mit dem Ausbau ihrer
Gemeinde-Institutionen nicht zu Ende. Es ist ihr sehr daran gelegen, ein
zweckdienlicheres Betlokal und entsprechenderes Ritualbad als die
bisherigen neben dem Schulgebäude auszuführen, sobald die geeigneten
Mittel zur Verfügung stehen. Möge Gott, der mit seiner hilfreichen Hand,
bei Errichtung unserer Schule, uns so sichtbar beigestanden, auch unserem
neuen heiligen Werke seinen Schutz und Beistand angedeihen lassen." die
Zuwendungen zahlreicher Glaubensgenossen, die uns die Ausführungen
unseres Unternehmens ermöglicht hatten, wesentlich zustatten kam. Den
edlen Spendern sei an dieser Stelle nochmals der wärmste Dank zum
Ausdruck gebracht. Noch ist die Kultusgemeinde mit dem Ausbau ihrer
Gemeinde-Institutionen nicht zu Ende. Es ist ihr sehr daran gelegen, ein
zweckdienlicheres Betlokal und entsprechenderes Ritualbad als die
bisherigen neben dem Schulgebäude auszuführen, sobald die geeigneten
Mittel zur Verfügung stehen. Möge Gott, der mit seiner hilfreichen Hand,
bei Errichtung unserer Schule, uns so sichtbar beigestanden, auch unserem
neuen heiligen Werke seinen Schutz und Beistand angedeihen lassen." |
Lehrer Simon Grünfeld wird "definitiver Lehrer" an
der jüdischen Schule mit "definitivem Charakter" (1900)
 Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1900:
"Kleinwallstadt bei Aschaffenburg. Die königliche Kreisregierung
verlieh unserer Volksschule den definitiven Charakter unter Ernennung des
derzeitigen Stelleninhabers, Herrn Grünfeld, zum definitiven Lehrer an
derselben." Meldung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1900:
"Kleinwallstadt bei Aschaffenburg. Die königliche Kreisregierung
verlieh unserer Volksschule den definitiven Charakter unter Ernennung des
derzeitigen Stelleninhabers, Herrn Grünfeld, zum definitiven Lehrer an
derselben." |
Anmerkung: bei Lehrer Grünfeld
handelte es sich um Simon Grünfeld: geb. 1872 in Tauberrettersheim,
Ausbildung zum Lehrer an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in
Würzburg, Examen 1892. Er war Lehrer u.a. in Kleinwallstadt, ab 1913
Lehrer, Hauptlehrer an der einklassigen israelitischen Volksschule in Heidingsfeld; 1925 erkrankt, wenig später im Ruhestand; emigrierte im Mai
1939 nach Tel Aviv. Er war verheiratete mit Lea geb. Jameson aus
London.
Die Tochter Betty ist 1908 in Kleinwallstadt geboren und ließ sich
später zur Erzieherin ausbilden; heiratete den Lehrer Selig Wolf (geb.
1908), Lehrer in Siegburg; nach Emigration in Jerusalem wohnhaft (noch in
den 1980er-Jahren).
(Quelle: Strätz, Biographisches Handbuch der Würzburger Juden Bd. I S.
213). |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Bekanntgabe einer Kollekte "für die
Notleidenden im Heiligen Lande" (1871)
 Bekanntgabe
in "Der Israelit" vom 15. Februar 1871 für die Kultusgemeinde Kleinwallstadt
und "dem angehörigen Schulsprengel
Großwallstadt, Sulzbach,
Hofstetten und Hausen": "Für die Notleidenden im Heiligen Lande. Bekanntgabe
in "Der Israelit" vom 15. Februar 1871 für die Kultusgemeinde Kleinwallstadt
und "dem angehörigen Schulsprengel
Großwallstadt, Sulzbach,
Hofstetten und Hausen": "Für die Notleidenden im Heiligen Lande.
Sammlung in der Kultusgemeinde Kleinwallstadt und des angehörigen
Schulsprengels, Großwallstadt,
Sulzbach,
Hofstetten und
Hausen, durch den Kultusvorstand Max
Freund in Kleinwallstadt: Lazarus Alexander in Kleinwallstadt 24 kr.,
Herz Stern 3 fl. 30 kr., Josef Feldmann 4 fl., Abraham Oppenheimer 24 kr.,
Abraham Stern 1 fl., Max Freund 1 fl., Josef Oppenheimer und Karolina
Oppenheimer Witwe 1 fl. 30 kr., Moses und Salomon Philipp 1 fl. 45 kr.,
Lehrer Kleiner 1 fl., ungenannt durch Lehrer Kleiner 1 fl., ungenannt durch
denselben 12 kr., ungenannt durch denselben 1 fl., ungenannt durch denselben
1 fl. 30 kr., Joseph Siegel 36 kr., Philipp Freund 1 fl., Heyum Oppenheimer
1 fl., Josef Stern 1 fl. 45 kr., Jeanette Stern 1 fl., aus der ständig zu
diesem Zweck aufgestellten Sammelbüchse 7 fl. 32 kr., Abraham Grünebaum in
Großwallstadt 1 fl.,
Lippmann Stern 1 fl. 30 kr., Samuel Stern 1 fl., 30 kr., Moses Strauß in
Hausen zwölf, Leopold Reis in
Hofstetten 12, David Grünebaum 24 kr,
Löb Reiß 24 kr. Zusammen 36 fl. 20 kr.. Abzüglich Porto 36 fl. 5 kr." |
Zur Gemeinde Kleinwallstadt gehören nun auch die in
Hofstetten lebenden jüdischen Personen (1931)
 Bekanntmachung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
April 1931: "Bekanntmachung über die Erweiterung des Gebietes der
Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt. Die Israelitische
Kultusgemeinde Kleinwallstadt hat beschlossen, ihr Gebiet auf die Gemeinde
Hofstetten auszudehnen. Es ergeht hiermit die Aufforderung an alle
Religionsgenossen, die in dem von der Ausdehnung betroffenen Gebiete
wohnen oder unabhängig vom Wohnsitz steuerpflichtig sind, etwaige
Einsprüche gegen die Gebietserweiterung bis spätestens 15. Mai 1931 bei
dem Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt schriftlich
oder mündlich einzulegen. Bekanntmachung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
April 1931: "Bekanntmachung über die Erweiterung des Gebietes der
Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt. Die Israelitische
Kultusgemeinde Kleinwallstadt hat beschlossen, ihr Gebiet auf die Gemeinde
Hofstetten auszudehnen. Es ergeht hiermit die Aufforderung an alle
Religionsgenossen, die in dem von der Ausdehnung betroffenen Gebiete
wohnen oder unabhängig vom Wohnsitz steuerpflichtig sind, etwaige
Einsprüche gegen die Gebietserweiterung bis spätestens 15. Mai 1931 bei
dem Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Kleinwallstadt schriftlich
oder mündlich einzulegen.
München, den 10. April 1931. Verband Bayerischer Israelitischer
Gemeinden. Dr. Neumeyer." |
Berichte zu einzelnen Personen
aus der Gemeinde
Silberne Hochzeit des Gemeindevorstehers Liebmann Freund
(1902)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1902:
"Kleinwallstadt, im März. Am 30. dieses Monats feiert Herr Kaufmann
Liebmann Freund dahier das Fest des silbernen Ehejubiläums. Der geehrte
Jubilar, der sich in den weitesten Kreisen besonderer Hochachtung und
Wertschätzung erfreut. ist gleichzeitig seit 24 Jahren Vorstand der
israelitischen Kultusgemeinde, welches Ehrenamt er in selten umsichtiger
Weise bekleidet, wie die unter seiner Leitung geschaffenen Institutionen
beredtes Zeugnis ablegen. Möge es dem Jubelpaare vergönnt sein, noch
lange im frohen Familienkreise Tage der Freude, der Gesundheit und des
Glückes zu verbringen!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1902:
"Kleinwallstadt, im März. Am 30. dieses Monats feiert Herr Kaufmann
Liebmann Freund dahier das Fest des silbernen Ehejubiläums. Der geehrte
Jubilar, der sich in den weitesten Kreisen besonderer Hochachtung und
Wertschätzung erfreut. ist gleichzeitig seit 24 Jahren Vorstand der
israelitischen Kultusgemeinde, welches Ehrenamt er in selten umsichtiger
Weise bekleidet, wie die unter seiner Leitung geschaffenen Institutionen
beredtes Zeugnis ablegen. Möge es dem Jubelpaare vergönnt sein, noch
lange im frohen Familienkreise Tage der Freude, der Gesundheit und des
Glückes zu verbringen!" |
Zum 80. Geburtstag von Karoline Grünebaum geb. Schmidt (1933)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei
Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,
und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt
bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in
voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei
Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,
und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt
bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in
voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." |
Hinweis zur Familie des amerikanischen Politikers Henry
Morgenthau jun. (1891-1967)
| Lazarus Morgenthau (geb. 1815 in
Kleinwallstadt) war verheiratet mit Barbara geb. Guggenheim (geb.
1826). Das junge Ehepaar zieht 1843 nach Mannheim, wo Lazarus Morgenthau
eine Zigarrenfabrik erfolgreich aufbaut (Informationen
auf einer Seite des Stadtarchivs Mannheim). Die beiden haben 13
Kinder, von denen zwei früh gestorben sind. Als 1865 die Tabakpreise
verfallen, wandert die Familie Morgenthau in die USA aus. Hier war Lazarus
Morgenthau wiederum erfolgreicher Unternehmer. Später macht er sich als
Wohltäter einen Namen (Artikel in der "New York Times" vom
13.11.1896 (pdf-Datei). |
| |
| Von den Kindern des Ehepaares Morgenthau
wird Sohn Heinrich Morgenthau (Henry Morgenthau sen., 1856-1946)
erfolgreicher Diplomat als Botschafter der USA in der Türkei. |
| Der Enkel Henry Morgenthau jun. (1891-1946)
war amerikanischer Finanzminister 1934-1945. Er trat 1944 durch den nach
ihm benannten Plan hervor ("Morgenthau-Plan"), Deutschland zu
verkleinern und zu entindustrialisieren und zu einem reinen Agrarstaat
machen (Schrift 'Germany is our problem', 1945). |
| |
 Literatur:
Henry Morgenthau: Mostly Morgenthaus: A Family History.
1991. (amazon.de) Literatur:
Henry Morgenthau: Mostly Morgenthaus: A Family History.
1991. (amazon.de) |
Weitere Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; Erläuterungen
gleichfalls von P.K. Müller)
Ansichtskarte
aus Kleinwallstadt
an Flora Adler in Laudenbach (1910) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte aus Kleinwallstadt wurde
im September 1910 an Fräulein Flora Adler in Laudenbach
per Adresse Herrn Samuel Adler II verschickt (nicht zu verwechseln mit dem Lehrer Samuel
Adler). Samuel Adler II war der Kaufmann Samuel Adler aus Laudenbach
(verheiratet mit Fanny geb. Landauer aus Urspringen). Flora Adler war eine Tochter des Ehepaars. Leider erschließt sich aus dem Text nicht wer die Absenderin
in Kleinwallstadt ("Freundin Martha") war.
vgl. Quellen: http://www.stolpersteine-wuerzburg.de/wer_opfer_lang.php?quelle=wer_paten.php&opferid=380. |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Kleinwallstadt geboren sind |
 |
 |
|
| |
KK (Dieburg 1939) für Ricka
Bender geb. Grünebaum
(geb. 2. Juni 1887 in Kleinwallstadt), wohnhaft in Dieburg und
Frankfurt; am 11./12. November 1941 deportiert ab Frankfurt
in das Ghetto Minsk, umgekommen |
KK (Mainz7 1939) für
Ida Sulzbach geb. Grünebaum
(geb. 21. November 1883 in Kleinwallstadt), wohnhaft in
Mainz
und Hungen, am 25. März 1942 deportiert ab Mainz - Darmstadt
in das Ghetto Piaski, umgekommen |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal oder eine erste Synagoge
vorhanden. Eine (neue) Synagoge wurde 1827 erbaut. Offenbar war bereits
1841 eine größere Reparatur nötig in einem Umfang, dass dies die
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überstieg. Daher wurde bei der Regierung
die Durchführung einer Kollekte in den Gemeinden des Landes beantragt. Diese
wurde im Januar
1844 genehmigt und in den folgenden Wochen durchgeführt. Es konnten 140 fl.
28 Kr.
gesammelt werden. Vermutlich alsbald nach Abschluss der Sammlung wurde die
Reparatur der Synagoge durchgeführt. Zur Kollekte selbst liegen drei Artikel aus dem
"Intelligenzblatt von Unterfranken..." vor:
Kollekte zur Reparatur der Synagoge in Kleinwallstadt (1841)
 Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern 3. April 1841: "31. März 1841.
(Das Gesuch der Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer
Kollekte zur Reparatur ihrer Synagoge betreffend). Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern 3. April 1841: "31. März 1841.
(Das Gesuch der Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer
Kollekte zur Reparatur ihrer Synagoge betreffend).
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Majestät der König haben allerhuldreichst zu gestatten geruht,
dass zur Zahlung der Kosten für die Reparatur der Synagoge zu
Kleinwallstadt eine Kollekte bei den Israeliten des Regierungs-Bezirkes
vorgenommen werden dürfe. die Polizei-Behörden haben daher diese Sammlung
durch die Kultus-Vorsteher vornehmen zu lassen und das Ergebnis binnen 4
Wochen hieher einzusenden resp. Fehlanzeige zu erstatten.
Würzburg, 25. März 1841. Königliche Regierung von Unterfranken
und Aschaffenburg, Kammer des Innern. Graf Fugger. Hübner."
|
| |
 Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern vom 19. Oktober 1841: "12. Oktober 1841. Das Gesuch der
Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer Kollekte zur
Reparatur ihrer Synagoge betreffend). Artikel
im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs
Bayern vom 19. Oktober 1841: "12. Oktober 1841. Das Gesuch der
Israeliten zu Kleinwallstadt um Bewilligung einer Kollekte zur
Reparatur ihrer Synagoge betreffend).
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Aus nachstehender Übersicht ist der Ertrag der von Seiner Majestät dem
Könige zur Herstellung der Synagoge zu Kleinwallstadt, königlichen
Landgerichts Obernburg, bei den israelitischen Glaubensgenossen in den
Regierungsbezirken von Ober-, Mittel- und Unterfranken und Aschaffenburg
allergnädigst bewilligten Kollekte zu ersehen.
Würzburg den 7. Oktober 1841.
Königliche Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer des Innern.
Graf Fugger.
Hübner."
Aus der Übersicht gehen die Erträge der Sammlung der einzelnen
Behörden/Ämter hervor. |
| Hinweis: die oben gezeigten Dokumente
beziehen sich nur auf die Sammlung in Unterfranken und Aschaffenburg.
Weitere Erträge gab es aus den anderen Regierungsbezirken Bayerns und der
Pfalz. |
Bei der Einweihung des
jüdischen Schulhauses in Kleinwallstadt 1899 wurde der Wunsch nach einem
"zweckdienlicheren Betlokal und entsprechendem Ritualbad" geäußert,
die neben dem Schulgebäude ausgeführt werden sollten (siehe oben Bericht).
In der NS-Zeit war die Synagoge mehrfach Ziel von Anschlägen durch
Nationalsozialisten. Am 11. Juli 1933 wurde die große farbige Scheibe
der Synagoge eingeworfen. 1934 wurde nach einem Bericht des
Regierungspräsidenten von Unterfranken ein Brandanschlag auf die Synagoge
geplant. Da im angrenzenden Garten ein mit Petroleum gefüllte Flasche gefunden
wurde, an der ein kleines Bündel dürres Reisig befestigt war, konnte der
Anschlag noch rechtzeitig verhindert werden. In den Folgejahren wurde auch
nachts in die Synagoge eingebrochen und Ritualien gestohlen. 1936 drangen
SS-Leute während eines Gottesdienstes in die Synagoge ein und verhinderten,
dass dieser zu Ende geführt werden konnte (Angaben von Achim Albert in www.synagogen.info
zu Kleinwallstadt).
Nachdem die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder stark zurückgegangen war, wurde
die Synagoge am 29. März 1938 an nichtjüdische Privatpersonen verkauft. Dadurch entging das Gebäude
einer Schändung beim Novemberpogrom 1938. Das Gebäude wurde in der
Folgezeit zu einem Wohnhaus umgebaut und ist als solches (mehrfach umgebaut und
erneuert) bis heute erhalten.
Eine Gedenktafel wurde im Herbst 1986 am Rathaus der Gemeinde angebracht. Sie wurde
am 24. Dezember 1986 gestohlen. Eine neue Gedenktafel wurde daraufhin angebracht
(siehe Foto unten).
Adresse/Standort der Synagoge: Rathausstraße
11
Fotos
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.3.2008)
Das ehemalige
Synagogengebäude
Rathausgasse 11 |
 |
 |
| |
Das ehemalige
Synagogengebäude wurde zum Wohnhaus umgebaut. |
| |
|
Erinnerung an die jüdische
Gemeinde
/ Synagoge |
 |
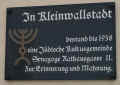 |
| |
Rathaus von
Kleinwallstadt mit Erinnerungstafel an der Nordseite: "In
Kleinwallstadt bestand bis
1938 eine Jüdische Kultusgemeinde. Synagoge
Rathausgasse II. Zur Erinnerung und Mahnung". |
| |
|
|
Das ehemalige jüdische
Schulhaus
Hauptstraße 29 |
 |
 |
| |
Das ehemalige
jüdische Schulhaus, das am 26. September 1899 feierlich eingeweiht wurde
(siehe Bericht oben) |
| |
|
| |
 |
 |
| |
Eingang zum
ehemaligen jüdischen Schulhaus mit Jahreszahl: hebräische Buchstaben
ergeben
die Inschrift: 'im Jahr 659 nach der kleinen Zählung"
(gemeint 5659 = 1898/99);
bzw. nach christlicher Zählung
"1899". |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| März 2017: Achim
Albert erforscht die jüdische Geschichte in Kleinwallstadt
|
Artikel von Christel Ney im
"Main-Echo" vom 24. März 2017: "Spurensuche bis in die USA.
Achim Albert erforscht jüdische Geschichte in Kleinwallstadt
Kleinwallstadt. Bis zum Jahr 1938 gab es in Kleinwallstadt eine jüdische Kultusgemeinde. An sie erinnert hat Achim Albert vom Heimat- und Geschichtsverein in seinem Vortrag am Donnerstag in der Zehntscheune. Er selbst recherchiert bereits seit seiner Schulzeit über das jüdische Leben im Ort, denn dies war das Thema seiner Facharbeit im Rahmen der Abiturprüfung- und es
fasziniert ihn noch immer.
'Es ist ein schwieriges Unterfangen, denn seit 1939 gibt es keine jüdische Familie mehr und deshalb auch keine Zeitzeugen mehr im Ort', erläuterte Albert. Hauptinformationsquellen waren für ihn daher die Biografische Datenbank Jüdisches Unterfranken, die Register in Kleinwallstadt und Würzburg, aber auch private Ahnenforschungen und Erzählungen von Bürgern. So wohnten ursprünglich viele Juden im Ortsteil Hofstetten und siedelten sich erst später in Kleinwallstadt an.
'Viele betrieben Handel und mit dem Bau der Eisenbahnlinie im Maintal mit Halt in Kleinwallstadt war dies der bessere Ort, um ihren Geschäften nachzugehen', vermutet Albert.
Auf einem Ortsplan von 1920 konnten 14 Wohn- und Geschäftshäuser von jüdischen Mitbürgern identifiziert werden. Sie arbeiteten als Metzger, Viehhändler oder betrieben sonstige Handelsgeschäfte. Handwerkliche Tätigkeiten waren ihnen nur eingeschränkt erlaubt. Zu jedem dieser Häuser konnten Auskünfte gegeben werden. Und immer wieder taucht der Name Grünebaum auf.
Kontakt zu Nachkommen. Zu den Nachkommen des in Kleinwallstadt geborenen Siegfried Grünebaum, der 2004 als Fred Greenbaum in New Jersey/USA starb, hat Albert persönlichen Kontakt. Sein Sohn Don war 2016 zu Besuch in Kleinwallstadt und hat einen weiteren Besuch im Herbst angekündigt.
Das Leben der Juden in Kleinwallstadt war geprägt vom Bestreben nach Integration sowie nach Wahrung ihrer eigenen Identität und Kultur. Es gab lange Zeit im Ort eine jüdische, religiöse Schule und eine Synagoge, in der sie Traditionen und Religion leben konnten. Albert präsentierte eine Feldpostkarte an einen Herzlöb Grünebaum aus dem Ersten Weltkrieg, als es selbstverständlich war, dass jüdische Soldaten für ihr deutsches Vaterland kämpften.
Größeren Raum widmete Albert in seinem Vortrag der Zeit von 1933 bis 1945. Hier kam es zu vielfachen Angriffen auf das Hab und Gut, aber auch auf Leib und Leben der verbliebenen Juden, zu Verfolgungsmaßnahmen und Internierung in Konzentrationslagern. Im Juli 1933 begannen die Brandanschläge und das Einwerfen von Fensterscheiben. In die Synagoge wurde eingebrochen, Drohbriefe wurden geschrieben. Es kam zu zunehmender Isolation, zu Berufsverboten, zu direkten und indirekten Boykottaufrufen. Auf entsprechende Beschwerden beim Bezirksamt Obernburg gab es den Ratschlag, einfach weg zu ziehen. Dann sei das Problem gelöst. Im November 1935 fasste der Gemeinderat den Beschluss, keine Mitarbeiter mehr zu beschäftigen, die noch bei Juden einkaufen. Ein trauriger Höhepunkt wurde 1938 erreicht, als auf Antrag des zweiten Beigeordneten Fecher der Zuzug von Juden nach Kleinwallstadt für alle Zeit verboten wurde und sämtliche Gemeinderäte zustimmten.
29 Schicksale recherchiert. Den letzten Teil seines Vortrages widmete Albert dem Thema Erinnern. Für einige Juden, die Kleinwallstadt verließen, konnten die neuen Aufenthaltsorte ermittelt werden. Diese waren neben Orten in Deutschland auch Frankreich, Holland, Österreich, Südafrika, Palästina oder die USA, wo anhand von Passagierlisten die ankommenden Personen nachweisbar sind. Aber besonders die Aufenthaltsorte in Europa waren nicht sicher, so dass viele später deportiert wurden und in Internierungs- und Konzentrationslagern ums Leben kamen. 29 dieser Schicksale konnte Albert identifizieren. Jede Person und deren persönliche Daten und Schicksale zeigte er in einer beeindruckenden Power-Point-Präsentation zu dem traurig-klassischen Musikstück Adagio for Strings Op. 11 von Samuel
Barber.
Achim Albert dankte Oded Zingher, der die Informationen aus der biografischen Datenbank zusammengetragen hat und ebenso Katrin Diehl, die die altdeutschen Schriftstücke in die deutsche Schrift übersetzte.
Für weiteres Material zur Unterstützung bei den Recherchen zum Themenkreis Jüdische Kultusgemeinde sei der Heimat- und Geschichtsverein jederzeit dankbar, so Albert."
Link
zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 342-343. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 61. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 555-556.
|
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 181. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Kleinwallstadt Lower
Franconia. A Jewish community existed in the early 18th century. A new
synagogue was built in 1900, when the Jewish population stood at 81 (total
1.477). In 1933, 45 Jews remained. Windows in the synagogue and Jewish homes
were smashed in 1933-34 and in 1936 rioters broke up prayer services. All the
Jews left in 1934-1938, including 16 to the United States and 11 to Frankfurt.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|