|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Markt Giebelstadt (Kreis
Würzburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Überblick:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Giebelstadt bestand eine jüdische Gemeinde bis 1941.
Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1757
stellte der Lehrer in Aub beziehungsweise in Fürth Arje ben Mosche
Baiersdorf ein Memorbuch für Giebelstadt fertig.
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden auf insgesamt 20
Matrikelstellen in Giebelstadt 20
Matrikeln die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit bereits neuem
Familiennamen): Seligmann Mayer, Nathan Krämer, Löb Feiffer, Seligmann Kahn, Samuel
Bloch, Wolf Kuhn, Moses Straus, Mayer Kuhn, Salomon Groß, Baruch Groß,
Seligmann Mayer, Hirsch Mayer, Marx Groß, Seligmann Krämer, Menlein Pfeiffer,
Raphael Schmitt, Löb Kuhn, Abraham Rosenbusch und Aron Sommer. Nicht in die
Matrikel wurden aufgenommen Mendlein (Menke) Sommer (Viktors Witwe) und Löb
Pfeifer.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl jüdischer Einwohner
wie folgt:
1814 103 jüdische Einwohner (17,3 % von insgesamt 597), 1867 72 (10,2 % von
706), 1880 58 (7,5 % von 774), 1898 54 (in elf Haushaltungen), 1900 48 (6,3 % von 765),
1901 53 (in 12 Haushaltungen, von insgesamt 765 Einwohnern), 1910 42 (5,1 % von 824).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter wirkte. An Namen
sind bekannt: 1844 bis um 1863 Lehrer S. Samfeld, danach bis 1866 Lehrer Maier Mayer (siehe unten),
um 1867/1885 Lehrer Asser
Stein (siehe unten), um 1887/1890 Lehrer Stein; um 1891/1908 Lehrer E. Schloss
(Lehrer Schloss unterrichtete um 1896 auch die Kinder in
Kirchheim und
Geroldshausen). 1896/1898 besuchten die
Religionsschule der Gemeinde 13 Kinder, 1899 noch neun Kinder, 1901/1903 zehn
Kinder. Seit 1906 oder etwas später
wurde der Unterricht von dem in
Gaukönigshofen angestellten Julius Bravmann versehen (siehe Bericht auf der
Seite in Gaukönigshofen), auch 1931
wurde die Stelle in Gaukönigshofen so ausgeschrieben, dass der Stelleninhaber
auch den Unterricht in Giebelstadt zu versehen hat (siehe unten).
Im Krieg 1870/71 starb aus der jüdischen Gemeinde Hirsch Neumann (siehe
Bericht unten). Im Ersten Weltkrieg fiel
Siegbert Heinemann
(geb. 20.4.1895 in Höchberg, gef. 2.10.1917). Sein Name steht auf dem Kriegerdenkmal für die
Gefallenen der Weltkriege aus Giebelstadt im Friedhof des Ortes an der
Flugplatzstraße. Außerdem ist gefallen: Unteroffizier Benjamin Schloß (geb.
28.9.1889 in Giebelstadt, vor 1914 in Mönchsroth wohnhaft, gef.
22.9.1914).
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1871 Nathan Sommer, um
1894/1901 A. Heinemann, um 1909/1921
Hirsch Schmidt.
Die jüdischen Einwohner waren bis 1933 in das Gemeindeleben
völlig integriert. Sie waren Mitglieder in den örtlichen Vereinen und der
Feuerwehr und wirkten auch bei den Florian-Geyer-Festspielen mit
(Freilichtspiele in Giebelstadt seit 1925). Um 1930 war Samson Heinemann
Gemeindeschreiber und -kassier. Jüdischen Einwohnern gehörten mehrere für das
wirtschaftliche Leben des Dorfes wichtige Gewerbebetriebe: Eisenwarenhandel der
Familie Solinger, Viehhandlungen Otto Mannheimer und Max Pfeuffer sowie
Schnitt-, Kolonial- und Gemischtwarengeschäfte.
Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde noch 48 Personen
gehörten (in 10 Familien, 6,85 % von insgesamt ca. 700 Einwohnern), waren die Vorsteher
der Gemeinde Max Pfeuffer und Rudolf Schmidt. Den Religionsunterricht der damals
vier (1932: drei) schulpflichtigen jüdischen Kinder erteilte Lehrer Julius
Bravmann aus Gaukönigshofen. Die jüdische Gemeinde gehörte zum
Distriktsrabbinat Kitzingen (ab 1937 Distriktsrabbiner Würzburg). 1932 waren
die Vorsteher weiterhin Max Pfeuffer (1. Vors.) und Rudolf Schmidt
(Schatzmeister). Damals gab es 44 jüdische Gemeindeglieder (von 810
Einwohnern).
1933 lebten noch 38 jüdische Personen am Ort. Infolge des einsetzenden
wirtschaftlichen Boykotts verarmten die jüdischen Familien, sodass im April
1937 ein Drittel der Gemeindemitglieder unterstützungsbedürftig war. Beim Novemberpogrom
1938 wurden Wohnungen der jüdischen Familien von SS- und SA-Männern aus
dem benachbarten Goßmannsdorf am Main überfallen. Der Hausrat einer der
Wohnungen wurde zerstört.
In einem Lebensmittelgeschäft wurden die Waren vernichtet. Ein jüdischer
Einwohner wurde schwer verprügelt, ein anderer festgenommen, ein dritter auf
einem Lastauto zur Schau durch die Nachbarorte gefahren. Bis 1941 konnten
16 der jüdischen Einwohner emigrieren (sechs nach Palästina, auch der
Gemeindevorsteher Max Pfeiffer war vom örtlichen NS-Funktionär. einem
ehemaligen Schulkameraden zur Auswanderung gedrängt worden; fünf nach
Argentinien, vier in die USA, einer in die Schweiz), neun sind nach Würzburg
verzogen, zwei in andere deutsche Städte. Am 21. März 1942 wurden die letzten
fünf jüdischen Einwohner über Kitzingen und Würzburg nach Izbica bei Lublin
deportiert.
Von den in Giebelstadt geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben bei Reiner Strätz:
Biographisches Handbuch Würzburger Juden [zu Fam. Pollack S. 442-443]): Berthold Baumann (1934), Hedwig Baumann geb.
Heinemann (1901), Leo Baumann (1906), Meta Erlanger geb. Gross (1860), Henriette
Krämer (1864), Ida (Jette) Mannheimer geb. Neumann (1878),
Sally (Sali) Mannheimer (1926), Erna Mayer geb. Schmidt (1893), Karl Günther Pollak (1926), Klara Pollak geb. Günther (1889),
Manfred Pollak (1928), Margot Pollak (1929), Selma Pollak (1887), Betty Schmidt geb.
Weinmann (1897), Rudolf Schmidt (1892), Rosa Schwarzenberger geb. Schmidt
(1889), Adolf Stern (1880), Sofie Wannbacher geb. Schmidt (1888), Flora Wilmersdörfer geb. Schmidt (1885).
Von den früheren jüdischen Einwohnern kamen nach 1945 Leopold Pollak und Otto
Mannheimer wieder zurück. Pollak verließ Giebelstadt alsbald wieder, Otto
Mannheimer blieb bis zu seinem Tod 1967 am Ort. Er wurde in Allersheim
beigesetzt (siehe Geschichte
zur Familie Mannheimer unten).
Nach 1945 lebten vorübergehend nochmals zahlreiche jüdische Personen am
Ort. Als das noch mit 1.700 jüdischen Displaced Persons (darunter 600 Kinder)
belegte DP-Camp im oberpfälzischen Vilseck im Frühjahr 1948 geschlossen werden
sollte, wurden sie ab April 1948 in ein in Giebelstadt aufgebautes DP-Camp
übergesiedelt. Das 'Jüdische Komitee Giebelstadt" unterhielt u.a. eine
Synagoge, einen
Kindergarten, einen Theatersaal, eine Berufsschule sowie eine Bibliothek. Vom
Frühjahr 1948 bis Sommer 1949 lebten in Giebelstadt knapp 1.700 jüdische
Männer, Frauen und Kinder und warteten auf die Übersiedlung nach Israel,
Kanada, Australien oder in die USA. Im Juli 1949 konnte das Lager
Giebelstadt wieder aufgelöst werden.
Zwischen 1948 und 1951 gab es in Würzburg Prozesse gegen 21 der
an den Ausschreitungen beim Novemberpogrom Beteiligten. 13 wurden zu
Gefängnisstrafen von drei Monaten bis zu einem Jahr und acht Monaten
verurteilt.
Hinweis auf einen "virtuellen Friedhof" der aus Giebelstadt stammenden
jüdischen Personen:
https://www.findagrave.com/virtual-cemetery/1907330. Viele der hier
genannten Personen sind auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim beigesetzt,
andere nach der Emigration in den USA usw.
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer
Lehrer Samuel Samfeld wird nach
Giebelstadt berufen (1844)
(Frdl. Hinweis von Erich Naab, Eichstätt mit ergänzenden Mitteilungen): Samuel
Samfeld und seine Frau Rosa [bat Moshe] lebten zuletzt in
Eichstätt. Vor seiner Zeit in Giebelstadt
war Samuel Samfeld als Lehrer in
Marktsteft tätig. Nach Giebelstadt war Samfeld Lehrer vermutlich ab 1864 bis
mindestens 1877 in Urspringen ("Der
Israelit" 25.4.1866 S. 305; "Der Israelit" 16.10.1872 S. 911). Danach lebte
er mit seiner Frau in
Eichstätt, wo der Schwiegersohn Hermann Schaalmann
als Lehrer tätig war. Samuel Samfeld starb am 24. März 1880 [12. Nissan 5640],
seine Frau Rosa am 1. Dezember 1878 [5. Kislew 5639]. Beide wurden in
Pappenheim beigesetzt.
Ein
Sohn von Samuel und Rosa Samfeld war Max Samfeld, der noch in
Marktsteft am 23. Januar 1844
geboren ist und dort nach dem Standesregister von seinem Vater beschnitten
wurde: StA Würzburg Jüdische Standesregister 74, S. 14. Max Samfeld ließ sich an
der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg als Lehrer ausbilden, war
um 1861 Lehrer in Estenfeld ("Der Israelit"
vom 14.8.1861 S. 400). Er wanderte 1867 nach Amerika aus, wo er
später Führer der Reformrabbiner wurde (als Max Samfield), vgl.
https://memphislibrary.contentdm.oclc.org/digital/collection/p13039coll1/id/339.
Er starb am 28. September 1915: Grab und weitere biographische Angaben siehe
https://de.findagrave.com/memorial/126332402/max-samfield.
Samuel Samfelds Tochter Fanny heiratete Hermann (Herz) Schaalmann
(Heirat wird genannt "Der Israelit" vom 19.2.1868 S. 140; 1837-1904), der
zunächst um 1863/64 in Ellingen, danach -
spätestens ab 1868 - in Eichstätt als
Lehrer tätig war. Hermann und Fanny Schaalmann sind die Großeltern von Herman
Schaalman (1916-2017, vgl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaalman). Fanny Schaalmann starb 1908
in Eichstätt ("Neue jüdische Presse" 20.3.1908).
 Mitteilung im "Intelligenzblatt für Unterfranken und Aschaffenburg" vom
5. Juli 1844: "Notizen. praes. 5. Juli 1844. Mittels Entschließung der
königlichen Regierung vom 11. Juni ward die israelitische Religionslehrers-
und Vorsängers-Stelle zu Giebelstadt dem geprüften Lehramts-Kandidaten
Samuel Samfeld übertragen." Mitteilung im "Intelligenzblatt für Unterfranken und Aschaffenburg" vom
5. Juli 1844: "Notizen. praes. 5. Juli 1844. Mittels Entschließung der
königlichen Regierung vom 11. Juni ward die israelitische Religionslehrers-
und Vorsängers-Stelle zu Giebelstadt dem geprüften Lehramts-Kandidaten
Samuel Samfeld übertragen." |
Zum Tod von Lehrer Maier Mayer (1927; um 1865 wenige Jahre Lehrer in
Giebelstadt, seit 1866 in Schnaittach)
Anmerkung: im Artikel wird die Feier der
diamantenen Hochzeit von Lehrer Maier Mayer erwähnt (weiteres auf der Seite zu
Themar); Lehrer Maier Mayer war verheiratet
mit Karoline geb. Eisenfresser aus Oberthulba
(geb. 29. Januar 1847 als Tochter von Moses und Fanni Eisenfresser).
Genealogische Informationen
https://www.geni.com/people/Karoline-Mayer/6000000100246837854
Genealogische Informationen zu Maier Mayer siehe
https://www.geni.com/people/Meier-Mayer/6000000100245189394.
 Artikel
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Personalien. In Themar, wo ihm kindliche Dankbarkeit
und Liebe ein freundliches Heim geschaffen und einen sorgenfreien,
heiteren Lebensabend bereitet hatten, verstarb am 24. November (18.
Kislew) der Nestor und Mitbegründer unseres Vereins, Maier Mayer, im
Alter von 86 Jahren und 7 Monaten. Er wurde am 22. April 1839 in
Aschbach
geboren, erhielt seine Ausbildung in
Höchberg und
Würzburg und wurde
nach mehrjähriger Tätigkeit als Religionslehrer in Oberthulba und
Giebelstadt in die damals noch blühende Gemeinde Schnaittach berufen, wo
er nahezu ein halbes Jahrhundert in Schule und Gemeinde wirkte, bis er im
Jahre 1914 in den wohlverdienten Ruhestand trat und nach
Themar
übersiedelte. Auch in dieser Gemeinde machte er sich besonders verdient,
indem er in gottbegnadeter, körperlicher und geistiger Rüstigkeit in den
Jahren 1916-1918, als sein Schwiegersohn, Lehrer Levinstein, zum
Kriegsdienste eingerufen wurde, dessen anstrengenden Dienst versah. Noch
als 86jähriges fungierte er am Rochhaschanah (Neujahr) und Jomkippur
als Scheliach Zibbur (Vorbeter). Die hohe Verehrung und Liebe, die
ihm aus allen Kreisen entgegengebracht wurde, fand noch besonderen
Ausdruck, als er im Vorjahre mit seiner Gattin unter Teilnahme der ganzen
Gemeinde, ohne Unterschied des Glaubens, der Vertreter aus seinem
vieljährigen Wirkungsorte und der Behörden - der Verband Bayerischer
Israelitischer Gemeinden sei hierbei eigens genannt - das seltene Fest der
diamantenen Hochzeit feiern konnte. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg in Neumarkt
verlieh ihm anlässlich dieser Feier den Chower-Titel. Um den
Heimgegangenen trauern mit der Gattin 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter.
An seiner Bahre hielt der Schwiegersohn die Trauerrede, der älteste Sohn,
Lehrer Moses Mayer, widmete dem Vater tief ergreifende Worte des
Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik zum Segen sein!
Blumenthal, Neustadt a.d.A." Artikel
in der "Bayrischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7. Januar
1927: "Personalien. In Themar, wo ihm kindliche Dankbarkeit
und Liebe ein freundliches Heim geschaffen und einen sorgenfreien,
heiteren Lebensabend bereitet hatten, verstarb am 24. November (18.
Kislew) der Nestor und Mitbegründer unseres Vereins, Maier Mayer, im
Alter von 86 Jahren und 7 Monaten. Er wurde am 22. April 1839 in
Aschbach
geboren, erhielt seine Ausbildung in
Höchberg und
Würzburg und wurde
nach mehrjähriger Tätigkeit als Religionslehrer in Oberthulba und
Giebelstadt in die damals noch blühende Gemeinde Schnaittach berufen, wo
er nahezu ein halbes Jahrhundert in Schule und Gemeinde wirkte, bis er im
Jahre 1914 in den wohlverdienten Ruhestand trat und nach
Themar
übersiedelte. Auch in dieser Gemeinde machte er sich besonders verdient,
indem er in gottbegnadeter, körperlicher und geistiger Rüstigkeit in den
Jahren 1916-1918, als sein Schwiegersohn, Lehrer Levinstein, zum
Kriegsdienste eingerufen wurde, dessen anstrengenden Dienst versah. Noch
als 86jähriges fungierte er am Rochhaschanah (Neujahr) und Jomkippur
als Scheliach Zibbur (Vorbeter). Die hohe Verehrung und Liebe, die
ihm aus allen Kreisen entgegengebracht wurde, fand noch besonderen
Ausdruck, als er im Vorjahre mit seiner Gattin unter Teilnahme der ganzen
Gemeinde, ohne Unterschied des Glaubens, der Vertreter aus seinem
vieljährigen Wirkungsorte und der Behörden - der Verband Bayerischer
Israelitischer Gemeinden sei hierbei eigens genannt - das seltene Fest der
diamantenen Hochzeit feiern konnte. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg in Neumarkt
verlieh ihm anlässlich dieser Feier den Chower-Titel. Um den
Heimgegangenen trauern mit der Gattin 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter.
An seiner Bahre hielt der Schwiegersohn die Trauerrede, der älteste Sohn,
Lehrer Moses Mayer, widmete dem Vater tief ergreifende Worte des
Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik zum Segen sein!
Blumenthal, Neustadt a.d.A." |
| |
 Artikel
in "Der Israelit" vom 23. Dezember 1926: "Neustadt an der
Aisch, 13. Dezember. Ein alter Lehrerveteran, der Nestor und
Mitbegründer des israelitischen Lehrervereins in Bayern, Lehrer M. Mayer,
verschied im hohen Alter von beinahe 87 Jahren in
Themar (Thüringen), wo er seit 1914 im
Ruhestand lebte. Er stammt aus Aschbach
in Oberfranken und erhielt seine berufliche Ausbildung in
Höchberg und Würzburg. Nach
mehrjähriger aus Wirksamkeit in den Gemeinden
Oberthulba und Giebelstadt
wurde er nach Schnaittach bei
Nürnberg berufen, wo er beinahe 50 Jahre in vorbildlicher Weise segensreich
sich betätigte. Im Jahre 1914 trat er in den wohlverdienten Ruhestand,
gleichzeitig nach Themar übersiedelnd. An
dem stets lebensfrohen Greis, der stets in den Wegen der Thora wandelte,
erfüllte der sich des Psalmisten Wort. Bis zu den letzten Tagen seines
Lebens konnte er sich in körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische
erfreuen. In den Kriegsjahren 1916 bis1918 versah er in noch rüstiger Weise
das anstrengende Amt seines zum Heere einberufenen Schwiegersohnes, des
Lehrers Levinstein in Themar und noch als
86-jähriger Greis versah er in der dortigen Gemeinde den Dienst des
Schaliach Zibbur (Vorbeter). Sein Leben war reich an Arbeit und Last,
aber auch viele Tage der Freude und des Glückes waren dem Verlebten
beschert. Er hatte das Glück, mit seiner getreuen Gattin nicht nur das Fest
der goldenen, sondern auch die seltene Feier der diamantenen Hochzeit
erleben zu dürfen. Letztere fand am .. Nissan unter Teilnahme weiter
Kreise und hoher Behörden statt. Aus diesem Anlass wurde ihm durch den Herrn
Distriktsrabbiner Weinberg in Neumarkt
der Chawer-Titel, den er früher aus Bescheidenheit verschwiegen,
erneuert, am 18. Kislev entschlief der Selige ohne Kampf und wurde im nahen
Marisfeld zur letzten Ruhe bestattet.
Sieben Söhne und drei Töchter beweinen mit ihren Familien und mit der
greisen Gattin sowie ein großer Kreis von Verehrern den Verlust des Frommen.
An dessen Bahre schilderte sein Schwiegersohn in beredten Worten das Leben
des Verblichenen und dessen ältester Sohn, Lehrer M. Mayer, widmete dem
Vater tief ergreifende Worte des Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik
(Gerechten) zum Segen sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in "Der Israelit" vom 23. Dezember 1926: "Neustadt an der
Aisch, 13. Dezember. Ein alter Lehrerveteran, der Nestor und
Mitbegründer des israelitischen Lehrervereins in Bayern, Lehrer M. Mayer,
verschied im hohen Alter von beinahe 87 Jahren in
Themar (Thüringen), wo er seit 1914 im
Ruhestand lebte. Er stammt aus Aschbach
in Oberfranken und erhielt seine berufliche Ausbildung in
Höchberg und Würzburg. Nach
mehrjähriger aus Wirksamkeit in den Gemeinden
Oberthulba und Giebelstadt
wurde er nach Schnaittach bei
Nürnberg berufen, wo er beinahe 50 Jahre in vorbildlicher Weise segensreich
sich betätigte. Im Jahre 1914 trat er in den wohlverdienten Ruhestand,
gleichzeitig nach Themar übersiedelnd. An
dem stets lebensfrohen Greis, der stets in den Wegen der Thora wandelte,
erfüllte der sich des Psalmisten Wort. Bis zu den letzten Tagen seines
Lebens konnte er sich in körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische
erfreuen. In den Kriegsjahren 1916 bis1918 versah er in noch rüstiger Weise
das anstrengende Amt seines zum Heere einberufenen Schwiegersohnes, des
Lehrers Levinstein in Themar und noch als
86-jähriger Greis versah er in der dortigen Gemeinde den Dienst des
Schaliach Zibbur (Vorbeter). Sein Leben war reich an Arbeit und Last,
aber auch viele Tage der Freude und des Glückes waren dem Verlebten
beschert. Er hatte das Glück, mit seiner getreuen Gattin nicht nur das Fest
der goldenen, sondern auch die seltene Feier der diamantenen Hochzeit
erleben zu dürfen. Letztere fand am .. Nissan unter Teilnahme weiter
Kreise und hoher Behörden statt. Aus diesem Anlass wurde ihm durch den Herrn
Distriktsrabbiner Weinberg in Neumarkt
der Chawer-Titel, den er früher aus Bescheidenheit verschwiegen,
erneuert, am 18. Kislev entschlief der Selige ohne Kampf und wurde im nahen
Marisfeld zur letzten Ruhe bestattet.
Sieben Söhne und drei Töchter beweinen mit ihren Familien und mit der
greisen Gattin sowie ein großer Kreis von Verehrern den Verlust des Frommen.
An dessen Bahre schilderte sein Schwiegersohn in beredten Worten das Leben
des Verblichenen und dessen ältester Sohn, Lehrer M. Mayer, widmete dem
Vater tief ergreifende Worte des Abschieds. Möge das Andenken des Zaddik
(Gerechten) zum Segen sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Asser Stein wird Religionslehrer und Vorsänger in Giebelstadt (1867)
Anmerkung: Asser Stein Nachfolger von Lehrer Maier
Mayer (siehe oben)
 Anzeige
im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und
Aschaffenburg" vom 23. November 1867: "Durch
Regierungs-Entschließung vom 14. November 1867 ad Nr. 42344 ist die von
der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt, königliches
Bezirksamt Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer Religionslehrer-
und Vorsänger-Stelle an den israelitischen Religionslehrer Asser Stein
in Oettershausen,
königliches Bezirksamt Volkach, genehmigt
worden". Anzeige
im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und
Aschaffenburg" vom 23. November 1867: "Durch
Regierungs-Entschließung vom 14. November 1867 ad Nr. 42344 ist die von
der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt, königliches
Bezirksamt Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer Religionslehrer-
und Vorsänger-Stelle an den israelitischen Religionslehrer Asser Stein
in Oettershausen,
königliches Bezirksamt Volkach, genehmigt
worden". |
Ausschreibungen der Stelle des Lehrer / Vorbeters /
Schochet in Gaukönigshofen (mit
Giebelstadt) (1931)
 Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
1. und 15. Juli 1931: "Infolge Pensionierung unseres Beamten, der 40 Jahre im
Dienste der Gemeinde stand, wird die Stelle des Religionslehrers,
Vorbeters und Schochets in der Israelitischen Kultusgemeinde
Gaukönigshofen zur alsbaldigen Besetzung frei. Der Stelleninhaber hat den
Dienst in der benachbarten Gemeinde Giebelstadt mitzuversehen. Die Besoldung
regelt sich nach der Besoldungsordnung des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden. Schöne Dienstwohnung in neuerbautem Schulhaus
ist vorhanden. Reichsdeutsche Bewerber mit seminaristischer Vorbildung,
die über eine angenehme Stimme verfügen, bitten wir, ihre Bewerbungen
mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gesundheitszeugnis und Lichtbild an
die Israelitische Kultusgemeinde Gaukönigshofen einzureichen. Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom
1. und 15. Juli 1931: "Infolge Pensionierung unseres Beamten, der 40 Jahre im
Dienste der Gemeinde stand, wird die Stelle des Religionslehrers,
Vorbeters und Schochets in der Israelitischen Kultusgemeinde
Gaukönigshofen zur alsbaldigen Besetzung frei. Der Stelleninhaber hat den
Dienst in der benachbarten Gemeinde Giebelstadt mitzuversehen. Die Besoldung
regelt sich nach der Besoldungsordnung des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden. Schöne Dienstwohnung in neuerbautem Schulhaus
ist vorhanden. Reichsdeutsche Bewerber mit seminaristischer Vorbildung,
die über eine angenehme Stimme verfügen, bitten wir, ihre Bewerbungen
mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gesundheitszeugnis und Lichtbild an
die Israelitische Kultusgemeinde Gaukönigshofen einzureichen.
Gaukönigshofen, den 29. Juni 1931. Die Israelitische Kultusgemeinde
Gaukönigshofen. Felix Mainzer, 1. Vorstand". |
| Auf diese Anzeige hin hat sich Leo Kahn
beworben, der nun den Religionsunterricht in Gaukönigshofen und
Giebelstadt erteilte. |
Schulamtsbewerber Justin Heinemann wechselt nach
Scheinfeld (1936)
 Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Schulamtsbewerber Justin Heinemann in Giebelstadt
wurde nach Scheinfeld
berufen." Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Schulamtsbewerber Justin Heinemann in Giebelstadt
wurde nach Scheinfeld
berufen." |
Aus dem
jüdischen Gemeindeleben
Rückblick: Esrogim-Mangel (1810)
Anm.: bei einem Esrog (beziehungsweise Etrog) handelt es sich um eine
Zitrusfrucht, die beim Sukkotfest (Laubhüttenfest) Verwendung findet;
siehe Wikipedia-Artikel
"Etrog"
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit.
In dem mir vorliegenden Memorbuch der Gemeinde Giebelstadt in Unterfranken
(hier aus dem Hebräischen übersetzt) berichtet ein Chronist: 'Zur
Erinnerung! Im Jahre 571 der kleinen Zeitrechnung (d.i. 1810) hat die
hiesige Gemeinde ihr Esrog, das einzige am Ort, für 20 Gulden rheinisch
kaufen müssen. Die beiden Gemeinden Geroldshausen und
Kirchheim kauften
eines gemeinsam für zwei Karlin, ebenso Allersheim und
Bütthard. Solche
Esrogim wurden in wohlfeilen Zeiten leicht für 24 Kreuzer (= 72
Reichspfennig) gekauft. Vorbeter Lämmle b. Mhhr* Benjamin'.
Was der Grund der Teuerung gewesen, wird nicht angegeben. Möglich, dass
politische Hinderungsgründe in der damaligen Napoleonischen Zeit die
Einfuhr erschwerten."
*Mhhr Abkürzung für: "unser Lehrer, der Chawer, Herr...",
Bezeichnung für einen Gelehrten. |
Ergebnis einer Kollekte (1921)
Anmerkung: Kollekten wurden mehrmals im Jahr in den jüdischen Gemeinden für
die unterschiedlichsten Zwecke durchgeführt. Die Ergebnisse wurden teilweise in
jüdischen Periodika mitgeteilt. In diesem Fall handelte es sich um eine Sammlung
zugunsten ukrainischer Waisenkinder.
 Mitteilung
in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas
Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) vom 18. August 1921: "Giebelstadt:
David Pfeuffer 50, Max Pfeuffer 100, Alfred und Jakob Pfeuffer 10,
Kultusgemeinde, Giebelstadt gesammelt durch Cäcilie Heinemann von den
Mitgliedern: Aron Heinemann 1, Salomon Heinemann 1, David Pfeuffer 10, David
Schmidt 20, Ludwig Pollack 1, Emanuel Solinger 20, Max Heinemann 15, David
Mannheimer 20, Samson Heinemann 10, Max Pfeuffer 30, Rudolf Schmidt 10, Lina
Krämer 2, Hirsch Schmidt 5. " Mitteilung
in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas
Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) vom 18. August 1921: "Giebelstadt:
David Pfeuffer 50, Max Pfeuffer 100, Alfred und Jakob Pfeuffer 10,
Kultusgemeinde, Giebelstadt gesammelt durch Cäcilie Heinemann von den
Mitgliedern: Aron Heinemann 1, Salomon Heinemann 1, David Pfeuffer 10, David
Schmidt 20, Ludwig Pollack 1, Emanuel Solinger 20, Max Heinemann 15, David
Mannheimer 20, Samson Heinemann 10, Max Pfeuffer 30, Rudolf Schmidt 10, Lina
Krämer 2, Hirsch Schmidt 5. " |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Aaron Mendel - zeitweise Lehrer in
Giebelstadt - konvertiert zum Christentum (um 1756; Artikel von 1903)
 Artikel
in "Blätter für jüdische Geschichte und Literatur" 1903 12 S. 179ff:
zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. Artikel
in "Blätter für jüdische Geschichte und Literatur" 1903 12 S. 179ff:
zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. |
 |
 |
Zum Soldatentod von Hirsch Neumann (1871)
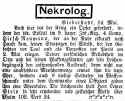 Nekrolog
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1871: "Giebelstadt, 14. Mai (1871). Auch hier hat der Krieg ein Opfer gefordert,
indem der israelitische Soldat im 9. bayerischen Infanterie-Regiment, 4.
Comp., Hirsch Neumann, der an der Ruhr erkrankt nach Hause kam, seinen Strapazen
bei Wörth, bei den Gefechten vor Toul und als Vorposten vor Paris am 2.
Mai erlegen. Seiner persönlichen Beliebtheit im Ort und bei seinen
Waffengefährten gab sein Leichenbegängnis den entsprechenden Ausdruck;
denn nicht nur eine unabsehbare Menschenmenge erwies ihm die letzte Ehre,
sondern auch acht hiesige Soldaten im Waffenschmucke unter dem Kommando
eines Offiziers gaben ihm eine Ehrensalve. Die Leichenrede hielt Herr
Lehrer Stein in sehr erhebender und geistreicher Weise über Psalm 102
Vers 24. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Nekrolog
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1871: "Giebelstadt, 14. Mai (1871). Auch hier hat der Krieg ein Opfer gefordert,
indem der israelitische Soldat im 9. bayerischen Infanterie-Regiment, 4.
Comp., Hirsch Neumann, der an der Ruhr erkrankt nach Hause kam, seinen Strapazen
bei Wörth, bei den Gefechten vor Toul und als Vorposten vor Paris am 2.
Mai erlegen. Seiner persönlichen Beliebtheit im Ort und bei seinen
Waffengefährten gab sein Leichenbegängnis den entsprechenden Ausdruck;
denn nicht nur eine unabsehbare Menschenmenge erwies ihm die letzte Ehre,
sondern auch acht hiesige Soldaten im Waffenschmucke unter dem Kommando
eines Offiziers gaben ihm eine Ehrensalve. Die Leichenrede hielt Herr
Lehrer Stein in sehr erhebender und geistreicher Weise über Psalm 102
Vers 24. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Seligmann Neumann (1911)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1911:
"Giebelstadt, 1. Mai (1911). Am 23. April verschied in unserer
Gemeinde Herr Seligmann Neumann, der es verdient, auch in diesen Blättern
genannt zu werden. Er war mit all seinen anderen menschlichen
Eigenschaften auch ein treuer Anhänger der Tora und der Wahrheit.
Ihm ist es auch mit zu verdanken, dass in hiesiger Gemeinde wieder ein
neues Beit HaKnesset (Synagoge) ersteht. Mit welcher Freude sah er
die Verwirklichung dieses seines Lieblingswunsches entgegen! Leider sollte
er die Bauvollendung dieses Gotteshauses nicht mehr erleben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Mai 1911:
"Giebelstadt, 1. Mai (1911). Am 23. April verschied in unserer
Gemeinde Herr Seligmann Neumann, der es verdient, auch in diesen Blättern
genannt zu werden. Er war mit all seinen anderen menschlichen
Eigenschaften auch ein treuer Anhänger der Tora und der Wahrheit.
Ihm ist es auch mit zu verdanken, dass in hiesiger Gemeinde wieder ein
neues Beit HaKnesset (Synagoge) ersteht. Mit welcher Freude sah er
die Verwirklichung dieses seines Lieblingswunsches entgegen! Leider sollte
er die Bauvollendung dieses Gotteshauses nicht mehr erleben.
Der Verblichene hatte sich infolge seines rechtlichen Handelns und seines
bescheidenen Benehmens große Beliebtheit erworben. Das zeigte sich am
besten bei seiner Beerdigung. Von nah und fern kamen Verwandte, Bekannte
und Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu erzeigen.
Nicht nur seine Angehörigen, sondern auch die Gemeinde Giebelstadt wird
ihn schmerzlich vermissen. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens". |
Ludwig Pfeuffer (Giebelstadt) hält
einen Vortrag in Bad Mergentheim (1919)
Vgl. zur Aguda Jisroel die Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Agudat_Jisra'el und
https://de.wikipedia.org/wiki/Agudath_Israel_Weltorganisation
 Artikel
in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas
Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) 1919 Heft 06 S. 108: "Mergentheim:
im Februar dieses Jahres hielt in unserer Gruppe Herr Ludwig Pfeuffer aus
Giebelstadt einen Vortrag über 'Das Leben eines religiösen Kriegers im
Felde'. Seine längeren Ausführungen schlossen mit einem Appell an den
Arewus-Gedanken (vgl.
http://www.juedisches-recht.de/lex_all_arewut.php), der mehr als
bisher in der jetzigen schweren Zeit gepflegt werden müsste. Unsere
allwöchentlichen Lernabende erfreuen sich des zahlreichen Besuches unserer
Mitglieder, die mit großem Eifer den Schiurim (religiöse Lernstunden)
folgen." Artikel
in "Blätter / hrsg. von dem Gruppenverband der Aguda Jisroel und der Agudas
Jisroel Jugend-Organisation" (Frankfurt) 1919 Heft 06 S. 108: "Mergentheim:
im Februar dieses Jahres hielt in unserer Gruppe Herr Ludwig Pfeuffer aus
Giebelstadt einen Vortrag über 'Das Leben eines religiösen Kriegers im
Felde'. Seine längeren Ausführungen schlossen mit einem Appell an den
Arewus-Gedanken (vgl.
http://www.juedisches-recht.de/lex_all_arewut.php), der mehr als
bisher in der jetzigen schweren Zeit gepflegt werden müsste. Unsere
allwöchentlichen Lernabende erfreuen sich des zahlreichen Besuches unserer
Mitglieder, die mit großem Eifer den Schiurim (religiöse Lernstunden)
folgen." |
Der aus Giebelstadt stammende
Lehrer Jakob Schloß wird Lehrer in Würzburg (1925)
Anmerkung:
Jakob Schloß ist am 18. November 1880 in
Giebelstadt (Ort nach Artikel unten) oder (nach anderen Angaben) in
Olnhausen geboren und war seit 1. April
1919 in Nassau als Religionslehrer und Vorbeter tätig. Seit 25. April 1906 war
er mit Sofie geb. Wechsler verheiratet, die am 14. August 1878 in
Aschbach geboren ist. Die beiden hatten eine
Tochter Resi (geb. 10. Januar 1907). Am 18. September 1940 zog Jakob Schloß,
mittlerweile verwitwet, nach Frankfurt am Main, wo er sich am 6. Dezember 1940
das Leben nahm.
Bei Reiner Strätz Biographisches Handbuch Würzburger Juden wird Jakob Schloß
nicht genannt
 Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 13. Februar 1925: "Würzburg.
Die hiesige israelitische Kultusgemeinde wählte in einer Versammlung ihren
neuen Lehrer und Kantor. Unter zehn Bewerbern fiel die Wahl auf den Lehrer
Jakob Schloß, zur Zeit Lehrer in Bad
Nassau, gebürtig aus Giebelstadt. Er besuchte die Lehrer Schule in
Würzburg, die er im Jahre 1901 mit gutem Erfolg absolvierte und das
Konservatorium in Karlsruhe. Er wird demnächst seinen Posten hier antreten." Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 13. Februar 1925: "Würzburg.
Die hiesige israelitische Kultusgemeinde wählte in einer Versammlung ihren
neuen Lehrer und Kantor. Unter zehn Bewerbern fiel die Wahl auf den Lehrer
Jakob Schloß, zur Zeit Lehrer in Bad
Nassau, gebürtig aus Giebelstadt. Er besuchte die Lehrer Schule in
Würzburg, die er im Jahre 1901 mit gutem Erfolg absolvierte und das
Konservatorium in Karlsruhe. Er wird demnächst seinen Posten hier antreten." |
Zum Tod von Clara Pfeuffer (1930)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1930:
"Giebelstadt bei Würzburg, 16. März (1930). Am Heiligen Schabbat
Mischpatim, Freitag, den 21. Februar (Datierung unklar, denn Schabbat
Mischpatim war erst am 1. März 1930, Toralesung Mischpatim
ist 2. Mose 21,1 - 24,18), ging Frau Clara Pfeuffer ein zur Ruhe
des ewigen Lebens. Im 83. Lebensjahr, die älteste unserer Gemeinde,
die zweitälteste Einwohnerin des Ortes, schied sie von uns. Ein
Wahrzeichen aus der in jüdischer Beziehung wohl wirklich besseren, alten
Zeit, ein Beispiel lebender Tradition ist mir ihr dahin gegangen. In ihrer
Jugend war sie sieben Jahre im Hause des Großen in Israel, des
alten Würzburger Raw, Rabbi Seligmann Bär Bamberger - das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen. Das im Talmud oft gespendete Lob der ...
traf vollkommen auf die Verblichene - sie ruhe in Frieden- zu - und
der heilige Geist, der von diesem Geisteshelden ausstrahlte,
beschattete das ganze Leben dieser edlen Frau. Selbstlos und bescheiden,
von tiefer Gottesfurcht getragen, kannte sie als höchste Aufgabe nur Wohltätigkeit
in des Wortes weitester Bedeutung und wenn sie den Gewinn hatte,
alle ihre Kinder zu selten braven frommen Juden heranwachsen zu
sehen, so führte sie selbst dieses immer wieder vor allem auf das
Verdienst des alten Würzburger Raw - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - zurück, dessen Lebensmaximen sie stets zu verwirklichen
sich bemühte. - Wohl die gesamte Einwohnerschaft Giebelstadts, eine
große Zahl auswärtiger Freunde und Verehrer folgten der Bahre dieser wackeren
Frau - sie ruhe in Frieden - und in beredten Worten nahmen Herr
Rabbiner Dr. Wohlgemuth, Kitzingen
und Herr Lehrer Bravmann, Gaukönigshofen,
Abschied von dieser edlen Matrone. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1930:
"Giebelstadt bei Würzburg, 16. März (1930). Am Heiligen Schabbat
Mischpatim, Freitag, den 21. Februar (Datierung unklar, denn Schabbat
Mischpatim war erst am 1. März 1930, Toralesung Mischpatim
ist 2. Mose 21,1 - 24,18), ging Frau Clara Pfeuffer ein zur Ruhe
des ewigen Lebens. Im 83. Lebensjahr, die älteste unserer Gemeinde,
die zweitälteste Einwohnerin des Ortes, schied sie von uns. Ein
Wahrzeichen aus der in jüdischer Beziehung wohl wirklich besseren, alten
Zeit, ein Beispiel lebender Tradition ist mir ihr dahin gegangen. In ihrer
Jugend war sie sieben Jahre im Hause des Großen in Israel, des
alten Würzburger Raw, Rabbi Seligmann Bär Bamberger - das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen. Das im Talmud oft gespendete Lob der ...
traf vollkommen auf die Verblichene - sie ruhe in Frieden- zu - und
der heilige Geist, der von diesem Geisteshelden ausstrahlte,
beschattete das ganze Leben dieser edlen Frau. Selbstlos und bescheiden,
von tiefer Gottesfurcht getragen, kannte sie als höchste Aufgabe nur Wohltätigkeit
in des Wortes weitester Bedeutung und wenn sie den Gewinn hatte,
alle ihre Kinder zu selten braven frommen Juden heranwachsen zu
sehen, so führte sie selbst dieses immer wieder vor allem auf das
Verdienst des alten Würzburger Raw - das Andenken an den Gerechten ist
zum Segen - zurück, dessen Lebensmaximen sie stets zu verwirklichen
sich bemühte. - Wohl die gesamte Einwohnerschaft Giebelstadts, eine
große Zahl auswärtiger Freunde und Verehrer folgten der Bahre dieser wackeren
Frau - sie ruhe in Frieden - und in beredten Worten nahmen Herr
Rabbiner Dr. Wohlgemuth, Kitzingen
und Herr Lehrer Bravmann, Gaukönigshofen,
Abschied von dieser edlen Matrone.
Den Kindern, Enkeln und Urenkeln möge ihr Verdienst beistehen, in
ihrem Sinne weiter zu leben und weiter zu wirken. Ihre Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
80. Geburtstag von Babette Neumann (1931)
 Meldung
in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. September
1931: "Israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt. Die Witwe
Babette Neumann von hier kann am 12. September dieses Jahres ihren 80.
Geburtstag feiern." Meldung
in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. September
1931: "Israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt. Die Witwe
Babette Neumann von hier kann am 12. September dieses Jahres ihren 80.
Geburtstag feiern." |
Zum 80. Geburtstag des langjährigen
Kultusvorstandes der Gemeinde Hirsch Schmidt (1933)
Anmerkung: Hirsch Schmidt ist
am 11. Februar 1853 in Giebelstadt geboren als Sohn des Händlers Marx Schmidt
und seiner Frau Regine. Er war verheiratet mit Klara geb. Ehrlich (geb. um 1855,
gest. 1915 in Giebelstadt). Im Alter von 85 Jahren wurde Hirsch Schmidt im
Dezember 1938 in das Altersheim Konradstraße 3 der Israelitischen Kranken- und
Pfründnerhausstiftung nach Würzburg verbracht, wo er am 8. November 1941
gestorben ist.
Die im Text genannte Zwillingsschwester Karoline Grünebaum geb. Schmidt lebte in
Kleinwallstadt (verheiratet mit Elias Grünebaum).
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei
Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,
und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt
bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in
voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1933: "80. Geburtstag. Herr Hirsch Schmidt in Giebelstadt bei
Würzburg, früher langjähriger Kultusvorstand der Gemeinde Giebelstadt,
und dessen Zwillingsschwester Frau Karoline Grünebaum in Kleinwallstadt
bei Aschaffenburg konnten am Samstag, den 11. Februar 1933, gemeinsam in
voller Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag feiern." |
70. Geburtstag von Henriette Krämer
(1934)
Anmerkung: Henriette Krämer ist am 27. Dezember 1864 in Giebelstadt geboren.
Nach dem Novemberpogrom 1938 lebte sie mit ihrer verwitweten Schwägerin Lina
Krämer noch in Giebelstadt. Im November 1939 wurde sie nach Würzburg gebracht
und im "Jüdischen Unterkunftsheim" Bibrastraße 6, dann ab Januar 1940 im
Israelitischen Pfründnerhaus Dürerstraße 20 einquartiert. Sie wurde am 10.
November 1942 deportiert und im Vernichtungslager Treblinka ermordet.
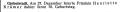 Mitteilung
in "Bayerische Israelitische Gemeindezeitung" vom 1. Januar 1935: "Giebelstadt.
Am 27. Dezember feierte Fräulein Henriette Krämer dahier ihren 70.
Geburtstag. ." Mitteilung
in "Bayerische Israelitische Gemeindezeitung" vom 1. Januar 1935: "Giebelstadt.
Am 27. Dezember feierte Fräulein Henriette Krämer dahier ihren 70.
Geburtstag. ." |
Zum Tod des Sohnes des Kultusvorstandes Max
Pfeuffer (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1935:
"Giebelstadt, 10. März (1935). Von einem schweren Schicksalsschlag
wurde die Familie unseres Kultusvorstandes, Max Pfeuffer, heimgesucht.
Innerhalb weniger Tage wurde deren jüngster hoffnungsvoller Sohn
hingerafft. Die allgemeine Teilnahme wendet sich der beliebten Familie zu
und aus Nah und Fern gaben Freunde und Bekannte dem Kinde das letzte
Geleite. Am Grabe fand Herr Lehrer Kahn, Gaukönigshofen
Worte des Trostes, indem er schilderte, wie dieses Kind bereits weit über
sein Alter hinaus die ernste Lebensauffassung eines guten Jehudi zu
erkennen gab. Möge der Heilige - gepriesen sei er den Eltern und
Geschwistern seinen Trost senden. S.H." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1935:
"Giebelstadt, 10. März (1935). Von einem schweren Schicksalsschlag
wurde die Familie unseres Kultusvorstandes, Max Pfeuffer, heimgesucht.
Innerhalb weniger Tage wurde deren jüngster hoffnungsvoller Sohn
hingerafft. Die allgemeine Teilnahme wendet sich der beliebten Familie zu
und aus Nah und Fern gaben Freunde und Bekannte dem Kinde das letzte
Geleite. Am Grabe fand Herr Lehrer Kahn, Gaukönigshofen
Worte des Trostes, indem er schilderte, wie dieses Kind bereits weit über
sein Alter hinaus die ernste Lebensauffassung eines guten Jehudi zu
erkennen gab. Möge der Heilige - gepriesen sei er den Eltern und
Geschwistern seinen Trost senden. S.H." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von Lehrer Schloss -
Commisstelle-Gesuch (1892)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Commisstelle-Gesuch. Anzeige in "Der Israelit" vom 15. September 1892: "Commisstelle-Gesuch.
Ein junger Mann, welcher bis 1. November in einem Spezerei-, Holz- und
Eisengeschäft seine Lehrzeit beendet, den Detail-Verkauf allein besorgte und
guter Verkäufer ist, sucht als angehender Commis in einem an Feiertag und
Schabbat geschlossenen Geschäfte Stelle.
Lehrer Schloß, Giebelstadt bei Würzburg." |
Anzeige von Johanna Stern -
Stellensuche für ihre Tochter (1895)
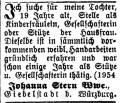 Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. April 1895: " Ich suche für meine
Tochter, 19 Jahre alt, Stelle als Kinderfräulein, Gesellschafterin oder
Stütze der Hausfrau. Dieselbe ist in sämtlich vorkommenden weiblichen
Handarbeiten gründlich erfahren und war schon einige Jahre als Stütze und
Gesellschafterin tätig. Anzeige
in "Der Israelit" vom 8. April 1895: " Ich suche für meine
Tochter, 19 Jahre alt, Stelle als Kinderfräulein, Gesellschafterin oder
Stütze der Hausfrau. Dieselbe ist in sämtlich vorkommenden weiblichen
Handarbeiten gründlich erfahren und war schon einige Jahre als Stütze und
Gesellschafterin tätig.
Johanna Stern Witwe, Giebelstadt bei Würzburg. " |
Anzeige von Lehrer Schloß -
Stellengesuch für einen Schneidergehilfen (1899)
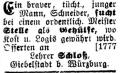 Anzeige in "Der Israelit" vom 27. Februar 1899: "Ein
braver, tüchtiger, junger Mann, Schneider, sucht bei einem
ordentlichen Meister Stelle als Gehilfe, wo Kost und Logis
gewährt wird. Anzeige in "Der Israelit" vom 27. Februar 1899: "Ein
braver, tüchtiger, junger Mann, Schneider, sucht bei einem
ordentlichen Meister Stelle als Gehilfe, wo Kost und Logis
gewährt wird.
Offerten an Lehrer Schloß, Giebelstadt bei Würzburg. " |
Max Heinemann sucht eine Lehrstelle für seinen Sohn
(1908)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1908: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1908:
"Suche für meinen Sohn pr. Mitte Mai dieses Jahres eine
Lehrstelle
in einem feinen
Schneidergeschäfte, welches Samstag und Feiertage
geschlossen ist.
Max Heinemann,
Giebelstadt (Bayern)." |
Verlobungsanzeige von Pauline Pfeuffer und Moritz
Katz (Giebelstadt / Gersfeld) (1911)
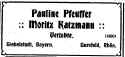 Die
Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Oktober 1911: Die
Anzeige erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Oktober 1911:
Pauline Pfeuffer - Moritz Katzmann. Verlobte
Giebelstadt, Bayern. Gersfeld,
Rhön". |
Verlobungsanzeige von Ella Krämer und Heinrich Heinemann
(1923)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:
"Frau Lina Krämer, Giebelstadt bei Würzburg und Herr und Frau
Lehrer Heinemann in Berlin beehren sich, die Verlobung ihrer Kinder Ella
und Heinrich anzuzeigen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:
"Frau Lina Krämer, Giebelstadt bei Würzburg und Herr und Frau
Lehrer Heinemann in Berlin beehren sich, die Verlobung ihrer Kinder Ella
und Heinrich anzuzeigen.
Ella Krämer - Heinrich Heinemann - Verlobte - Giebelstadt
bei Würzburg, Berlin Schöneberg, Eberstr. 13. Chanuka
5684." |
Todesanzeige für Jacob David
Pfeuffer (1925)
Anmerkung: Genealogische Informationen und Foto siehe
https://www.geni.com/people/Jacob-Pfeuffer/6000000052972193517
 Anzeige in "Der Israelit" vom 15. Januar 1925: "Danksagung. Anzeige in "Der Israelit" vom 15. Januar 1925: "Danksagung.
Für die anlässlich des Ablebens unseres unvergesslichen Gatten und Vaters
von allen Seiten überaus zahlreich entgegengebrachten Beweise herzlicher
Teilnahme sprechen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank aus
Klara Pfeuffer und Kinder
Giebelstadt, Würzburg,
Bamberg,
Mainz, Königsbach,
Gersfeld. |
Zum Tod von Klara Pfeuffer geb.
Rauh (1930)
Anmerkung: genealogische Informationen und Foto siehe https://www.geni.com/people/Klara-Pfeuffer/6000000052967461011
 Anzeige in "Der Israelit" vom 6. März 1930: "Danksagung Anzeige in "Der Israelit" vom 6. März 1930: "Danksagung
Außerstande, für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme, die uns
anlässlich des Heimgangs unserer unvergesslichen Mutter
Frau Klara Pfeuffer - Friede sei mit ihr - Giebelstadt
aus weiten Kreisen zugingen, sprechen wir auf diesem Wege allen Verwandten,
Freunden und Bekannten unseren herzlichsten Dank aus Geschwister Pfeuffer
Giebelstadt, Würzburg,
Bamberg,
Mainz, Königsbach,
Gersfeld. 3. März 1930"" |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betsaal vorhanden. 1799 wurde
eine erste Synagoge erstellt. Über einhundert Jahre diente sie als religiöses
Zentrum der jüdischen Gemeinde in Giebelstadt. Anfang des 20. Jahrhunderts war
sie in sehr schlechtem baulichem Zustand und musste 1908 wegen Baufälligkeit
geschlossen, wenig später abgebrochen werden.
Spendenaufruf für die Synagoge (1909)
 Anzeige im "Israelitischen
Familienblatt" vom 22. Juli 1909: "Giebelstadt, Unterfranken. Anzeige im "Israelitischen
Familienblatt" vom 22. Juli 1909: "Giebelstadt, Unterfranken.
Aufruf!
Die hiesige Synagoge musste wegen Einsturzgefahr eingelegt werden. Wir sind
daher gezwungen, ein neues Gotteshaus zu bauen.
Obzwar wir dabei die bescheidensten Verhältnisse obwalten lasten, so ist es
unmöglich, den Bau allein aus eigenen Mitteln aufzuführen.
Wir erlauben uns daher, unsere Glaubensbrüder und Schwestern herzlich zu
bitten, uns durch Zuwendung reichlicher Spenden, in den Stand zu setzen ein
neues Gotteshaus aufzubauen.
Die israelitische Kultusgemeinde Giebelstadt in Unterfranken
S. Heinemann, Kassierer. H. Schmidt, Vorstand.
NB. Beiträge, worüber an dieser Stelle quittiert wird, nimmt entgegen H.
Schmidt, Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Giebelstadt i.
Unterfranken." |
1911 ließ die Gemeinde durch die Gebrüder Johann und Roman Scheckenbach aus Giebelstadt,
die als Baumeister gemeinsam ein Zimmereigeschäft führten, die Pläne für eine
neue Synagoge zeichnen. Noch in diesem Jahr wurde das Gebäude erbaut. Im
Nachruf auf Seligmann Neumann, der am 23. April 1911 verstarb (siehe oben), wird
davon berichtet, dass die neue Synagoge derzeit "ersteht", aber der
Verstorbene die Bauvollendung nicht mehr erleben konnte. Vorsteher der
jüdischen Gemeinde war zur Zeit des Synagogenbaus Hirsch Schmidt.
Die Einweihung der Synagoge war am 31. August 1911 durch
Distriktsrabbiner Bamberger aus Würzburg, der gerade Vakaturvertretung des
nicht besetzten Distriktsrabbinates Kitzingen hatte. Über die Feier liegen
folgende
Berichte vor:
 Bericht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1911: "Giebelstadt
(Unterfranken), 10. September. Vor einigen Tagen wurde in unserer kleinen
Gemeinde ein seltenes Fest gefeiert. Ungefähr 3 Jahre sind es her, dass
unsere Synagoge wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. Mit vieler
Mühe und großen Opfern ist es uns gelungen, eine entsprechende neue
Synagoge zu bauen, welche am 31. August in würdiger Weise eingeweiht
wurde. Die politische Gemeinde nahm regen Anteil daran, indem die
Einwohner ihre Häuser beflaggte und sich sowohl beim Zuge als auch in der
Synagoge mit ihren jüdischen Mitbürgern vereinigten. Vor dem Tore der
Synagoge trug die Tochter des Vorstandes, Frl. Schmidt, einen Prolog vor
und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister; derselbe
hielt eine Ansprache, in der er den Opfersinn der Gemeinde lobte und
übergab den Synagogenschlüssel Herrn Distrikts-Rabbiner Bamberger aus
Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen. Nach den üblichen Umzügen
der Torarollen und nachdem Herr Vorstand Schmidt die Anwesenden begrüßt
hatte, hielt Herr Rabbiner Bamberger die Einweihungsrede, die zu Herzen
aller Anwesenden ging. Vom Gotteshause aus bewegte sich die ganze
Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthaus zur geselligen
Unterhaltung. Alle Anwesende, worunter viele Fremde aus nah und fern sich
befanden, waren sehr befriedigt von der außerordentlich gelungenen
Feier." Bericht
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1911: "Giebelstadt
(Unterfranken), 10. September. Vor einigen Tagen wurde in unserer kleinen
Gemeinde ein seltenes Fest gefeiert. Ungefähr 3 Jahre sind es her, dass
unsere Synagoge wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste. Mit vieler
Mühe und großen Opfern ist es uns gelungen, eine entsprechende neue
Synagoge zu bauen, welche am 31. August in würdiger Weise eingeweiht
wurde. Die politische Gemeinde nahm regen Anteil daran, indem die
Einwohner ihre Häuser beflaggte und sich sowohl beim Zuge als auch in der
Synagoge mit ihren jüdischen Mitbürgern vereinigten. Vor dem Tore der
Synagoge trug die Tochter des Vorstandes, Frl. Schmidt, einen Prolog vor
und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister; derselbe
hielt eine Ansprache, in der er den Opfersinn der Gemeinde lobte und
übergab den Synagogenschlüssel Herrn Distrikts-Rabbiner Bamberger aus
Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen. Nach den üblichen Umzügen
der Torarollen und nachdem Herr Vorstand Schmidt die Anwesenden begrüßt
hatte, hielt Herr Rabbiner Bamberger die Einweihungsrede, die zu Herzen
aller Anwesenden ging. Vom Gotteshause aus bewegte sich die ganze
Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthaus zur geselligen
Unterhaltung. Alle Anwesende, worunter viele Fremde aus nah und fern sich
befanden, waren sehr befriedigt von der außerordentlich gelungenen
Feier." |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September
1911: "Giebelstadt (Unterfranken). Vor einigen Tagen wurde in
unserer kleinen Gemeinde die neue Synagoge eingeweiht. Die politische
Gemeinde nahm regen Anteil an diesem Feste, indem die Einwohner ihre
Häuser beflaggten und sich sowohl beim Zuge als auch in der Synagoge mit
ihren israelitischen Mitbürgern vereinigten. Der Festzug bewegte sich vom
Hause des Kultusvorstandes, H. Schmidt, mit Vorantritt der Musik zur
Synagoge. Dort angelangt, trug die Tochter des Vorstandes ein Gedicht vor
und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister, der nach
einer Ansprache den Schlüssel dem Distriktsrabbiner Bamberger -
Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen,
übergab. Dieser erwiderte dem Herrn Bürgermeister in entsprechender Rede
und überreichte den Schlüssel dem Vorstande. Nach dem Einzuge wurde
Ma-Towu gesungen und die Umzüge mit den Tora-Rollen vorgenommen. Nachdem
Vorstand Schmidt die Anwesenden in längerer Ansprache begrüßt hatte,
bestieg Rabbiner Bamberger die Kanzel und hielt die Einweihungsrede, die
sich darüber verbreitete, welche Namen unsere Stammväter den geheiligten
Städten beilegten, nämlich Berg, Feld und Haus, als Symbol für die
Synagoge. Sie sei stets ein Berg zur Erhebung zur Gottesfurcht und
Gotteserkenntnis, ein Feld zur Aussaat von Liebe zu Gott und dem
Nebenmenschen und ein Haus, in dem man sich jederzeit heimisch und
glücklich fühlen solle. Die Rede schloss mit dem Königsgebet und einem
Segen für die Gemeinde und die Behörden. Nach Absingung eines Psalms
(150.) war die Feier beendigt. Von da aus bewegte sich die ganze
Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthause zur geselligen
Unterhaltung. Alle Anwesenden, darunter viele Fremde, waren sehr
befriedigt von der außerordentlich gelungenen Feier." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. September
1911: "Giebelstadt (Unterfranken). Vor einigen Tagen wurde in
unserer kleinen Gemeinde die neue Synagoge eingeweiht. Die politische
Gemeinde nahm regen Anteil an diesem Feste, indem die Einwohner ihre
Häuser beflaggten und sich sowohl beim Zuge als auch in der Synagoge mit
ihren israelitischen Mitbürgern vereinigten. Der Festzug bewegte sich vom
Hause des Kultusvorstandes, H. Schmidt, mit Vorantritt der Musik zur
Synagoge. Dort angelangt, trug die Tochter des Vorstandes ein Gedicht vor
und überreichte den Synagogenschlüssel dem Bürgermeister, der nach
einer Ansprache den Schlüssel dem Distriktsrabbiner Bamberger -
Würzburg, Verweser des Rabbinats Kitzingen,
übergab. Dieser erwiderte dem Herrn Bürgermeister in entsprechender Rede
und überreichte den Schlüssel dem Vorstande. Nach dem Einzuge wurde
Ma-Towu gesungen und die Umzüge mit den Tora-Rollen vorgenommen. Nachdem
Vorstand Schmidt die Anwesenden in längerer Ansprache begrüßt hatte,
bestieg Rabbiner Bamberger die Kanzel und hielt die Einweihungsrede, die
sich darüber verbreitete, welche Namen unsere Stammväter den geheiligten
Städten beilegten, nämlich Berg, Feld und Haus, als Symbol für die
Synagoge. Sie sei stets ein Berg zur Erhebung zur Gottesfurcht und
Gotteserkenntnis, ein Feld zur Aussaat von Liebe zu Gott und dem
Nebenmenschen und ein Haus, in dem man sich jederzeit heimisch und
glücklich fühlen solle. Die Rede schloss mit dem Königsgebet und einem
Segen für die Gemeinde und die Behörden. Nach Absingung eines Psalms
(150.) war die Feier beendigt. Von da aus bewegte sich die ganze
Festversammlung unter Musikbegleitung in ein Gasthause zur geselligen
Unterhaltung. Alle Anwesenden, darunter viele Fremde, waren sehr
befriedigt von der außerordentlich gelungenen Feier." |
| |
 Artikel in "Das jüdische Blatt" vom 22. September 1911:
Artikel in "Das jüdische Blatt" vom 22. September 1911:
Artikel identisch mit dem Artikel im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt" (siehe oben) |
1925 erhielt die jüdische Gemeinde Giebelstadt zur Vornahme von
Reparaturen in der Synagoge durch den Verband bayerischer israelitischer
Gemeinden einen Zuschuss von 500.- Mark (Bayerische israelitische
Gemeindezeitung vom 9. Mai 1925 S. 65).
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch Angehörige der NSDAP und der
SA demoliert und geschändet. Die Ritualien wurden vernichtet. Das Gebäude
blieb jedoch erhalten, wurde jedoch im Sommer 1939 abgebrochen, nachdem es
vorher mit dem dazugehörigen Grundstück vom Vorgänger des jetzigen Besitzers
gekauft worden ist. An Stelle der Synagoge, von der nichts mehr erhalten ist,
wurde ein Wohnhaus erbaut. Eine Gedenktafel im Treppenhaus des Rathauses
erinnert an die jüdische Gemeinde und die Synagoge mit dem (nicht ganz
korrekten) Text: "Im Gemeindebereich bestand bis 1941 eine jüdische
Gemeinde. Die 1799 erbaute Synagoge wurde 1938 geschändet und 1944 abgebrochen.
Der Markt GIEBELSTADT gedenkt seiner ehemaligen jüdischen Kultusgemeinde.
Die 1948/49 kurzzeitig wieder entstandene Jüdische Kultusgemeinde (DP-Camp)
richtete eine Synagoge in einem früher von der Mennonitengemeinde
genützten Bethaus ein. Nach Wegzug der DPs aus Giebelstadt kam dieses Gebäude
in den Besitz der evangelischen Kirchengemeinde und wurde später zu einem bis
heute bestehenden Wohnhaus umgebaut.
Adresse/Standort der Synagoge: Synagoge bis
1938: Mergentheimer Straße 20; Synagoge 1945-1948:
Mergentheimer Straße 31.
Pläne / Fotos
(Quelle für die Pläne: Storck-Pfitzer s.Lit. S. 62).
| Die von den
Gebrüdern Johann und Roman Scheckenbach gezeichneten Baupläne von 1911 |
|
 |
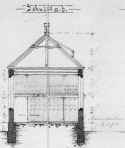 |
 |
| Ansicht von der Straße |
Schnitt durch das Gebäude |
Östliche Giebelansicht |
| |
|
|
 |
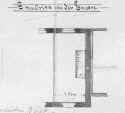 |
 |
| Grundriss des Erdgeschosses |
Grundriss von der Empore |
Situationsplan |
| |
|
|
 |
 |
| Der Plan der
Gebrüder Scheckenbach ist im Original koloriert (Quelle: www.synagogen.info) |
Nach den Plänen gezeichnete
Darstellung der
ehemaligen Synagoge mit dem
Lehrerhaus/Schule |
| |
Aus der Geschichte der
Familie Mannheimer
(vgl. Reiner Strätz: Biographisches Handbuch
Würzburger Juden 1900-1945 1. Teil 1989 S. 371 und 2. Teil S. 421)
Grabsteine im jüdischen Friedhof in
Allersheim erinnern an die Geschichte der Familie
(Fotos: Detlef Ernst Rosenow, Karlsruhe)
 |
 |
Grabstein für David
Mannheimer (Vater von
Otto Mannheimer) geb. 27. Januar 1872 in
Bütthardt, gest. 29. Juli 1933 in Giebelstadt |
Grabstein für Otto
Mannheimer, geb. 1. September 1899 in Giebelstadt, gest. 21. November
1967
mit Gedenkinschrift für Sohn Sally Mannheimer, geb. 21. Mai
1926 in Giebelstadt,
gest. 31. März 1945 bei der Bombardierung von
Würzburg-Unterdürrbach |
|
|
|
Otto Mannheimer (Grabstein rechts)
ist am 1. September 1899 in Giebelstadt geboren. Seine Eltern waren der
Viehhändler David Mannheimer, Viehhändler in Giebelstadt (geboren 1872
in Bütthardt, Grabstein links) und Ida (Jette) geb. Neumann (geboren 1878
in Giebelstadt). Otto Mannheimer besuchte 1911 bis 1914 die Oberrealschule
in Würzburg; 1918 war er Kriegsteilnehmer an der Westfront. Später
arbeitete er als Viehhändler in Giebelstadt. Otto Mannheimer war seit 1924
verheiratet mit der aus einer katholischen Familie stammenden Regina
(Dina) geb. Zorn (geb. 16. September 1900 in Rothenburg ob der
Tauber). Regina trat bei der Heirat zur jüdischen Religion über und
führte einen streng rituellen Haushalt. Das Ehepaar hatte vier Kinder:
Siegfried (geb. 1923), Ruth (geb. 1924), Sally
(1926) und Ludwig (1928).
Seine Viehhandlung musste Otto Mannheimer 1937 aufgeben. Er zog
nach Würzburg und fand noch Arbeit als Pferdeknecht in der Fa. S.
Kleemann & Söhne. Die Familie wohnte seit Januar 1938 in Würzburg,
Domerschulstraße 25. Der Sohn Siegfried emigrierte mit der
Jugend-Alija im August 1938 nach Palästina (nannte sich seitdem S. Oded),
die Tochter Ruth konnte im Juni 1939 nach Schweden auswandern. Otto
Mannheimer selbst emigrierte, nachdem er nach dem Novemberpogrom 1938 zwei
Monate im KZ Buchenwald festgehalten worden war, im August 1939 nach
Brüssel. Zurück blieben in Würzburg seine Mutter Ida geb. Neumann, die
Frau Ruth und die beiden Söhne Sally und Ludwig. Die vier bemühten sich
vergeblich um eine Ausreise nach Belgien. Sally Mannheimer hatte ab 1941
Zwangsarbeit in Würzburg zu leisten, eine Ausreise nach Schweden wurde
ihm und seinem Bruder Ludwig im März 1942 trotz Genehmigung der
Gesandtschaft verweigert. Die Mutter von Otto Mannheimer - Ida (Jette)
geb. Neumann - wurde am 23. September 1942 in das Ghetto
Theresienstadt und von hier im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und
ermordet. Sally Mannheimer kam Ende März 1945 bei der
Bombardierung von Würzburg-Unterdürrbach ums Leben. Ludwig
Mannheimer hat überlebt und konnte nach Schweden auswandern.
Nach 1945 lebte das Ehepaar Otto und Regina Mannheimer wieder in
Giebelstadt. Otto Mannheimer starb am 21. November 1967 in Würzburg und
wurde auf dem jüdischen Friedhof in Allersheim beigesetzt; Regina
Mannheimer starb am 16. September 1977 in Würzburg. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 302-303. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 74. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 439-441. |
 | Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen
Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg
1988 S. 61-63. |
 |  Jim
G. Tobias: "Zu Pessach nach Unterfranken". Das
jüdische DP-Camp Giebelstadt 1948-49. Reihe: Hefte zur
Regionalgeschichte Heft 3. Antogo-Verlag 2005. Informationen
zum Buch. Jim
G. Tobias: "Zu Pessach nach Unterfranken". Das
jüdische DP-Camp Giebelstadt 1948-49. Reihe: Hefte zur
Regionalgeschichte Heft 3. Antogo-Verlag 2005. Informationen
zum Buch. |
 | Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg.
Band 13. Würzburg 2008. S. 224-225. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Giebelstadt Lower
Franconia. A community is known from the mid-18th century and a synagogue was
consecrated in 1799. The Jewish population reached 103 in 1814 (total 597) and
declined steadily thereafter to 38 in 1933. Twenty-four Jews left in 1933-38, 16
of them emigrating from Germany. On Kristallnacht (9-10 November 1938),
the synagogue and Jewish homes were wrecked by the SA and SS. The last five Jews
were deported to Izbica in the Lublin district (Poland) via Wuerzburg on 25
April 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|