|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht Synagogen im Kreis Neuwied
Rheinbrohl (VG
Bad Hönningen, Kreis
Neuwied)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Rheinbrohl bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht nach den vorliegenden Quellen
mindestens in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück; der jüdische Friedhof
wurden bereits im 17. Jahrhundert angelegt. 1697 werden in dem zum
Erzbistum Trier gehörenden Rheinbrohl Juden am Ort genannt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1822 26 jüdische Einwohner, 1858 43, 1862 45, 1895 19.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Schule
(Religionsschule in einem 1837 erstellten Gebäude, siehe unten, 1879 9
schulpflichtige jüdische Kinder am Ort) und ein Friedhof.
1925 wurden 26 jüdische Einwohner gezählt, 1938 25. Bis
zum Beginn der Deportationen konnte noch mehrere auswandern oder sind in andere
Orte verzogen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.). Die letzten jüdischen Einwohner wurden im Juli 1942 deportiert.
Von den in Rheinbrohl geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Albert Abraham Baer
(1871), Katharina Baer geb. Mortje (1880), Moritz Baer (1873), Johanna Daniel
geb. Wolff (1893), Josef Jonas (1876), Helene Levy geb. Bär (1870), Hermann
Wolff (1890), Hertha M. Wolff geb. Abraham (1907), Johanna Wolff (1873), Leo
Wolff (1889), Leo Wolff (1889), Mathilde Wolff geb. Steinberg (1896), Paula
Wolff geb. Sommer (1891).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
Es gibt bei 31 jüdischen Einwohnern
9 schulpflichtige Kinder in Rheinbrohl (1879)
 Aus einem Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar
1879: "Der Bericht aus Linz am Rhein. II. Aus einem Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar
1879: "Der Bericht aus Linz am Rhein. II.
Der wackere Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu
Linz, insonders dessen Vorsitzender Herr Marx Meyer hat auf unsere
Veranlassung Erhebungen in seinen nächsten Kreisen gemacht. Dieselben
ergaben: aus dem Kreise Neuwied: Rheinbrohl mit 31 jüdischen
Einwohnern und 9 schulpflichtigen Kindern;
Hönningen mit 27 jüdischen
Einwohnern und 7 schulpflichtigen Kindern; ..." |
Probleme bei der religiösen Prägung
der jüdischen Kinder durch den christlichen Religionsunterricht (1879)
mit kuriosem Beispiel aus Rheinbrohl.
 Aus einem Artikel über die Zustände des Religionsunterrichtes in Gemeinden
des Bezirkes Koblenz in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13.
Januar 1879: "Nun gibt es in dem hiesigen Regierungsbezirk eine große Anzahl
kleinerer jüdischer Gemeinden und zerstreut wohnender Juden, deren Kinder
die durchweg katholischen Volksschulen besuchen und stillschweigend an
dem Unterricht in der biblischen Geschichte des alten Testaments nach Dr.
Schuster teilnehmen. Die Eltern dieser Kinder unterlassen es in vielen,
vielleicht sogar in den meisten Fällen, teils aus religiöser
Gleichgültigkeit, teils aus Unwissenheit und teils aus Furcht vor Zerwürfnissen mit dem betreffenden
Lehrpersonal, um die Dispensation ihrer Kinder von
dem betreffenden biblischen Geschichtsunterricht einzukommen, und dieselbe nötigenfalls im Beschwerdewege zu erzwingen. Ein Teil dieser kleinen
Gemeinden ist noch gar nicht nach dem Gesetze über die Verhältnisse der
Juden vom Juli 1847 organisiert, und es fehlt denselben an staatlich
anerkannten Organen, welche berufen wären, für die religiösen Interessen
ihrer Glaubensgemeinde einzutreten. Nun befindet sich nur in äußerst wenigen
dieser kleinen jüdischen Gemeinden und der Ortschaften mit einzelnen Juden
ein jüdischer Religionslehrer, welcher die aus dem Unterricht der christlichen
biblischen Geschichte aufgenommenen Vorstellungen und Lehren in den Herzen
der jüdischen Kinder nach dem Geiste der väterlichen Religion berichtigen
könnte; den Eltern fehlt es hierzu teils an der nötigen Befähigung, teils
an dem Interesse. Die nachteiligen Folgen dieses Übelstandes machen sich
machen sich schon heute bei der betreffenden Jugend in schmerzlichem Grade
bemerkbar. So berichtet mir der Lehrer Mandel, ein in der Nähe wohnender
katholischer Pfarrer habe ihm gegenüber geäußert, die jüdischen Kinder in den
Volksschulen eines Ortes wussten die biblische Geschichte von allen am
besten, und weiter kann ich Ihnen die einem nahezu 13 Jahre alten jüdischen
Knaben in Rheinbrohl auf die Frage wie die drei Erzväter hießen, erteilte
charakteristische Antwort: 'Vater, Sohn und heiliger Geist' als verbürgt
mitteilen. Die späteren Folgen werden, wenn nicht Abhilfe erfolgt,
unvermeidlich Missachtung der väterlichen Religion und Abfall von derselben
sein. Solchen Zuständen muss abgeholfen werden." Aus einem Artikel über die Zustände des Religionsunterrichtes in Gemeinden
des Bezirkes Koblenz in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13.
Januar 1879: "Nun gibt es in dem hiesigen Regierungsbezirk eine große Anzahl
kleinerer jüdischer Gemeinden und zerstreut wohnender Juden, deren Kinder
die durchweg katholischen Volksschulen besuchen und stillschweigend an
dem Unterricht in der biblischen Geschichte des alten Testaments nach Dr.
Schuster teilnehmen. Die Eltern dieser Kinder unterlassen es in vielen,
vielleicht sogar in den meisten Fällen, teils aus religiöser
Gleichgültigkeit, teils aus Unwissenheit und teils aus Furcht vor Zerwürfnissen mit dem betreffenden
Lehrpersonal, um die Dispensation ihrer Kinder von
dem betreffenden biblischen Geschichtsunterricht einzukommen, und dieselbe nötigenfalls im Beschwerdewege zu erzwingen. Ein Teil dieser kleinen
Gemeinden ist noch gar nicht nach dem Gesetze über die Verhältnisse der
Juden vom Juli 1847 organisiert, und es fehlt denselben an staatlich
anerkannten Organen, welche berufen wären, für die religiösen Interessen
ihrer Glaubensgemeinde einzutreten. Nun befindet sich nur in äußerst wenigen
dieser kleinen jüdischen Gemeinden und der Ortschaften mit einzelnen Juden
ein jüdischer Religionslehrer, welcher die aus dem Unterricht der christlichen
biblischen Geschichte aufgenommenen Vorstellungen und Lehren in den Herzen
der jüdischen Kinder nach dem Geiste der väterlichen Religion berichtigen
könnte; den Eltern fehlt es hierzu teils an der nötigen Befähigung, teils
an dem Interesse. Die nachteiligen Folgen dieses Übelstandes machen sich
machen sich schon heute bei der betreffenden Jugend in schmerzlichem Grade
bemerkbar. So berichtet mir der Lehrer Mandel, ein in der Nähe wohnender
katholischer Pfarrer habe ihm gegenüber geäußert, die jüdischen Kinder in den
Volksschulen eines Ortes wussten die biblische Geschichte von allen am
besten, und weiter kann ich Ihnen die einem nahezu 13 Jahre alten jüdischen
Knaben in Rheinbrohl auf die Frage wie die drei Erzväter hießen, erteilte
charakteristische Antwort: 'Vater, Sohn und heiliger Geist' als verbürgt
mitteilen. Die späteren Folgen werden, wenn nicht Abhilfe erfolgt,
unvermeidlich Missachtung der väterlichen Religion und Abfall von derselben
sein. Solchen Zuständen muss abgeholfen werden." |
Bei einer Versammlung des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Bonn wird auf
"jüdische Bauern in Rheinbrohl" hingewiesen (1920)
Anmerkung: der Hinweis auf angebliche "10 jüdische Bauern" in Rheinbrohl ist
übertrieben, möglicherweise dachte der Referent an den erfolgreichen
Weingutsbesitzer Albert Baer in Rheinbrohl.
 Artikel in "Jüdisches Bote vom Rhein" vom 20. Februar 1920: "Bonner
Nachrichten. Bonn. Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens hatte zu einer Versammlung eingeladen, die am letzten Sonntag im
Saale der Fortbildungsschule stattfand und in der Herr Dr. Lange aus
Essen über 'Juden und Antisemiten' referierte. Nach den einleitenden Worten des
Versammlungsleiters, Herrn Dr. Herrmanns, sollte der Zweck der
Zusammenkunft die gegenseitige Aussprache und, wenn möglich, die Anbahnung
eines besseren Verstehens zwischen Juden und Christen sein. Herr Dr.
Lange, ein gewandter und im Rheinland bekannter Redner, sprach zunächst von
der Taktik der Antisemiten in Flugblatt und Presse, prüfte sodann die
Vorwürfe der Antisemiten auf ihren Wert, wies ihre Unhaltbarkeit an Hand
eines großen Tatsachenmaterials nach, bei dem das über die
Kriegsbeteiligung der Juden am interessantesten und schlagendsten war, und
bezeichnete alle Vorwürfe in Bezug auf ihre Herkunft als die heimliche
Arbeit der alldeutschen Reaktion. Anregender noch als der Vortrag war die
folgende Aussprache, an der sich Nichtjuden und auch Antisemiten beteiligten. Abgesehen von den grob antisemitischen Bemerkungen des ersten
Redners, waren die Einwände von nichtjüdischer Seite durchaus ehrlich und
ernst gemeint und von dem sichtlichen Bestreben erfüllt, zu verstehen und
zum Teil sogar das Problem tiefer zu erfassen. So zeugte die Art, mit der
zum Beispiel Herr Dr. Thiel seine Frage vorbrachte, 'wo man je jüdische Bauern
oder Arbeiter gesehen habe', immer noch von der ehrlichen Überzeugtheit des
Fragesteller. Frau Petersen betonte ihre Verständniswilligkeit und deutete
leise das Rassenproblem als das entscheidende an. Ein letzter Redner Herr Ritter
(?) wies darauf hin, dass man das ganze Problem doch tiefer und
historisch erfassen müsse. Es war sehr bedauernswert, dass der Referent in
seinen Antworten nicht überzeugend war, ja eine Ableugnungspolitik trieb,
die auf Unbeteiligte keinen günstigen Eindruck machen konnte. Seine
Behauptung, dass es in Deutschland ungezählte jüdische Bauern gäbe, in
Rheinbrohl allein sogar zehn,
ferner dass im Ruhrgebiet hunderte von jüdischen
Bergleuten unterschichtig arbeiten, ferner das der Vorwurf, in der
Regierung und den Ministerien säßen zu viel Juden, glattweg unhaltbar,
schließlich, dass die Rasseabneigung eine Sache lächerlicher Richtigkeit
sei, - das alles mag eine Methode sein, den Antisemitismus zu bekämpfen, eine
Methode der Aufklärung ist es nicht. Das heißt denn doch die Sache etwas
oberflächlich betreiben und an dem wahren Problem stracks vorübergehen, vor
allem aber mit vollkommenem Unverständnis an der Psyche des Nichtjuden. Trotz der zehn Bauern in
Rheinbrohl und 100 andere in Hessen und Bayern
wird kein Christ und kein Jude glauben und auch kein Jude glauben, dass der Jude ein Bauer sei, trotz der vom Krieg nach dem Ruhrgebiet
vorschlagenen polnischen Arbeiter wird er auch nicht an ein deutsch-jüdisches Arbeiterproletariat glauben, und bei allem Hinweis auf den Rassenunterschied zwischen Süd- und Norddeutschen wird der Germane dem Semiten
doch noch anders gegenüberstehen als der Bayer den Preußen. Aufklären heißt
nicht ableugnen oder gar vertuschen, sondern auf die geschichtliche
Entwicklung hinweisen, die den Juden leider Gottes dem Acker und
Schraubstock entfremdet hat, und es heißt die beste Waffe wegwerfen, wenn
man dem Christen gegenüber auf die Bilanz der Jahrhunderte verzichtet,
anstatt ihm zu zeigen, wie sein Hass, seine Verfolgung und sein Ghettozwang
den Juden zu dem machten, was er ward und werden musste, zum Händler und
Kaufmann. 'Ihr lähmt uns und scheltet, wenn wir hinken', sagt Schylock. Wenn man
dann noch auf die arbeitenden Massen des Ostens, die
Kolonisationsbestrebungen und -erfolge usw. hinzeigte, hätte man
auch noch die positive Eignung der Juden zu jeder, auch der schwersten
Arbeit und sein ideales Streben erwiesen. Es würde zu weit führen, wollte
man für die anderen Punkte die entsprechenden Richtlinien aufweisen, es ist
aber schade, dass über die Grundsätze der Abwehr und Aufklärung noch
solche Unklarheit und Verworrenheit herrscht, wie sie in der
Sonntagsversammlung zutage trat."
Artikel in "Jüdisches Bote vom Rhein" vom 20. Februar 1920: "Bonner
Nachrichten. Bonn. Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens hatte zu einer Versammlung eingeladen, die am letzten Sonntag im
Saale der Fortbildungsschule stattfand und in der Herr Dr. Lange aus
Essen über 'Juden und Antisemiten' referierte. Nach den einleitenden Worten des
Versammlungsleiters, Herrn Dr. Herrmanns, sollte der Zweck der
Zusammenkunft die gegenseitige Aussprache und, wenn möglich, die Anbahnung
eines besseren Verstehens zwischen Juden und Christen sein. Herr Dr.
Lange, ein gewandter und im Rheinland bekannter Redner, sprach zunächst von
der Taktik der Antisemiten in Flugblatt und Presse, prüfte sodann die
Vorwürfe der Antisemiten auf ihren Wert, wies ihre Unhaltbarkeit an Hand
eines großen Tatsachenmaterials nach, bei dem das über die
Kriegsbeteiligung der Juden am interessantesten und schlagendsten war, und
bezeichnete alle Vorwürfe in Bezug auf ihre Herkunft als die heimliche
Arbeit der alldeutschen Reaktion. Anregender noch als der Vortrag war die
folgende Aussprache, an der sich Nichtjuden und auch Antisemiten beteiligten. Abgesehen von den grob antisemitischen Bemerkungen des ersten
Redners, waren die Einwände von nichtjüdischer Seite durchaus ehrlich und
ernst gemeint und von dem sichtlichen Bestreben erfüllt, zu verstehen und
zum Teil sogar das Problem tiefer zu erfassen. So zeugte die Art, mit der
zum Beispiel Herr Dr. Thiel seine Frage vorbrachte, 'wo man je jüdische Bauern
oder Arbeiter gesehen habe', immer noch von der ehrlichen Überzeugtheit des
Fragesteller. Frau Petersen betonte ihre Verständniswilligkeit und deutete
leise das Rassenproblem als das entscheidende an. Ein letzter Redner Herr Ritter
(?) wies darauf hin, dass man das ganze Problem doch tiefer und
historisch erfassen müsse. Es war sehr bedauernswert, dass der Referent in
seinen Antworten nicht überzeugend war, ja eine Ableugnungspolitik trieb,
die auf Unbeteiligte keinen günstigen Eindruck machen konnte. Seine
Behauptung, dass es in Deutschland ungezählte jüdische Bauern gäbe, in
Rheinbrohl allein sogar zehn,
ferner dass im Ruhrgebiet hunderte von jüdischen
Bergleuten unterschichtig arbeiten, ferner das der Vorwurf, in der
Regierung und den Ministerien säßen zu viel Juden, glattweg unhaltbar,
schließlich, dass die Rasseabneigung eine Sache lächerlicher Richtigkeit
sei, - das alles mag eine Methode sein, den Antisemitismus zu bekämpfen, eine
Methode der Aufklärung ist es nicht. Das heißt denn doch die Sache etwas
oberflächlich betreiben und an dem wahren Problem stracks vorübergehen, vor
allem aber mit vollkommenem Unverständnis an der Psyche des Nichtjuden. Trotz der zehn Bauern in
Rheinbrohl und 100 andere in Hessen und Bayern
wird kein Christ und kein Jude glauben und auch kein Jude glauben, dass der Jude ein Bauer sei, trotz der vom Krieg nach dem Ruhrgebiet
vorschlagenen polnischen Arbeiter wird er auch nicht an ein deutsch-jüdisches Arbeiterproletariat glauben, und bei allem Hinweis auf den Rassenunterschied zwischen Süd- und Norddeutschen wird der Germane dem Semiten
doch noch anders gegenüberstehen als der Bayer den Preußen. Aufklären heißt
nicht ableugnen oder gar vertuschen, sondern auf die geschichtliche
Entwicklung hinweisen, die den Juden leider Gottes dem Acker und
Schraubstock entfremdet hat, und es heißt die beste Waffe wegwerfen, wenn
man dem Christen gegenüber auf die Bilanz der Jahrhunderte verzichtet,
anstatt ihm zu zeigen, wie sein Hass, seine Verfolgung und sein Ghettozwang
den Juden zu dem machten, was er ward und werden musste, zum Händler und
Kaufmann. 'Ihr lähmt uns und scheltet, wenn wir hinken', sagt Schylock. Wenn man
dann noch auf die arbeitenden Massen des Ostens, die
Kolonisationsbestrebungen und -erfolge usw. hinzeigte, hätte man
auch noch die positive Eignung der Juden zu jeder, auch der schwersten
Arbeit und sein ideales Streben erwiesen. Es würde zu weit führen, wollte
man für die anderen Punkte die entsprechenden Richtlinien aufweisen, es ist
aber schade, dass über die Grundsätze der Abwehr und Aufklärung noch
solche Unklarheit und Verworrenheit herrscht, wie sie in der
Sonntagsversammlung zutage trat." |
Aus der Geschichte der
jüdischen Gemeinde
Über die "Judenordnung" des
Erzbistums Trier von 1717 und die Nennung jüdische Familien in Rheinbrohl 1697 (Artikel von 1933)
 Aus einem
längeren Artikel von Adolf Kober über "Eine Kurtrierer 'Jüdisch Ceremonial
Verordnung' aus der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts' in "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums" 1933 Heft 2 S. 103: "Die Judenordnung, genannt 'Ceremonial-Verordnung',
die hiermit im folgenden veröffentlicht wird, betrifft nicht die
Judengemeinde einer einzelnen Stadt, sondern die des Erzbistums Trier. Sie
ist in mehreren Judenlandtagen, die zwischen 1691 und 1717 stattfanden,
beschlossen und der größere Teil derselben im Jahre 1717 zu Neumagen
festgesetzt worden und vermutlich ursprünglich in deutscher Sprache mit
hebräischen Schriftzeichen geschrieben. Diese Judenordnung aber wird erst
verständlich, wenn wir die Lage der Juden im Erzstift Trier um die Wende des
17. und 18. Jahrhunderts vorher kurz schildern. Es wohnten um 1700 im Ober-
und Niedererzstift 160 Familien und außerdem einige Kameraljuden, die ihre
Abgaben an den Kurfürsten direkt zahlten - als 'Kameralorte' werden im Jahre
1697 Kruft,
Hönningen, Rheinbrohl, im
Jahre 1716 außerdem Sayn,
Herschbach,
Osann, Monzel, Amt S.
Maximin, genannt. Die Juden des Erzstifts bildeten einen 'Corpus' und lebten
auf Grund der Judenordnung vom 17. Januar 1681, die ihnen der Erzbischof und
Kurfürst Johann Hugo gegeben hatte und in deren 20 Paragraphen ihr
Verhältnis zur Obrigkeit geregelt war. Sie unterschied sich nicht viel von
den Judenordnungen, die vorausgegangen waren, denen vom Jahre 1618, 1624,
1670." Aus einem
längeren Artikel von Adolf Kober über "Eine Kurtrierer 'Jüdisch Ceremonial
Verordnung' aus der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts' in "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums" 1933 Heft 2 S. 103: "Die Judenordnung, genannt 'Ceremonial-Verordnung',
die hiermit im folgenden veröffentlicht wird, betrifft nicht die
Judengemeinde einer einzelnen Stadt, sondern die des Erzbistums Trier. Sie
ist in mehreren Judenlandtagen, die zwischen 1691 und 1717 stattfanden,
beschlossen und der größere Teil derselben im Jahre 1717 zu Neumagen
festgesetzt worden und vermutlich ursprünglich in deutscher Sprache mit
hebräischen Schriftzeichen geschrieben. Diese Judenordnung aber wird erst
verständlich, wenn wir die Lage der Juden im Erzstift Trier um die Wende des
17. und 18. Jahrhunderts vorher kurz schildern. Es wohnten um 1700 im Ober-
und Niedererzstift 160 Familien und außerdem einige Kameraljuden, die ihre
Abgaben an den Kurfürsten direkt zahlten - als 'Kameralorte' werden im Jahre
1697 Kruft,
Hönningen, Rheinbrohl, im
Jahre 1716 außerdem Sayn,
Herschbach,
Osann, Monzel, Amt S.
Maximin, genannt. Die Juden des Erzstifts bildeten einen 'Corpus' und lebten
auf Grund der Judenordnung vom 17. Januar 1681, die ihnen der Erzbischof und
Kurfürst Johann Hugo gegeben hatte und in deren 20 Paragraphen ihr
Verhältnis zur Obrigkeit geregelt war. Sie unterschied sich nicht viel von
den Judenordnungen, die vorausgegangen waren, denen vom Jahre 1618, 1624,
1670." |
Erinnerungen an die jüdische
Geschichte in Niederbreisig,
Hönningen und Rheinbrohl (1927)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Mai 1927: "Jüdische
Rheinlanderinnerungen.
Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Mai 1927: "Jüdische
Rheinlanderinnerungen.
Die Tausendjahrfeier mit ihrer Ausstellung 'Jüdische Kunst' führte
uns die tausendjährige Geschichte der Juden am Rhein vor Augen. Dies
gab mir Veranlassung, die jüdische Vergangenheit bei meinen Wanderungen an
Ort und Stelle zu erforschen. Mein Weg führte mich nach
Niederbreisig mit seinen
Quellen, Bädern und Rheinpromenaden. Dieser Ort ist ein Idyll an Ruhe und
Schönheit. Unweit dieses Ortes auf dem Wege zur Burg Rheineck blieben wir in
Andacht stehen. Mitten im Waldesgrün erheben sich alte jüdische
Grabsteine, wunderbar erhalten und mit leicht lesbarer Schrift. Um das
Jahr 1000 gewährte der Schlossherr der Rheineckburg jüdischen Flüchtlingen
und Bedrängten Obdach und Schutz. Sie wurden seine Leibeigenen und hier im
Walde fanden sie ihre letzte Ruhe. Zurückgekehrt nach Niederbreisig,
lassen wir uns bei der Dampferhaltestelle auf die andere Seite des Rheins
übersetzen. Wir landen in Hönningen.
Unser Ziel gilt einem Hause, in dem seit dem 16. Jahrhundert, zwischen den
Etagen ganz versteckt, eine kleine, altehrwürdige Schul zu finden ist. So
viel patriarchalischees im Original Zustand zeigt uns weder Worms noch Prag.
Wir stehen vor kleinen Betpulten im Renaissancestil, die noch mit Hand
geschmiedete Eisenbändern, alten Schlössern und Original-Schlüsseln versehen
sind. Die ganze Anlage spricht dafür, dass die Synagoge nur Eingeweihten
auffindbar war, sie hängt sozusagen zwischen den Wohnräumen. Interessant ist
der Kronleuchter, ferner die Jad, das Holzgitterchen zur Frauenschul,
welches nochmals stark mit Vorhängen behängt ist.
Nun weiter nach Rheinbrohl. Dort bringt uns ein liebenswürdiger
Balbos in ein seit der frühen Renaissance von Juden bewohntes Haus. Unter
dem Dach (damit es die Feinde nicht aufspürten) ist eine kleine Schul
eingebaut. Sie gemahnt an den Ernst der Zeit, und obwohl heute nur die
Umrisse noch stehen und von den alten Einrichtungen nur noch ein sehr
primitiver, großer Chanukkaleuchter, ferner das Gitter zur Frauenschul sowie
die heilige Lade vorhanden sind, so erinnert das ganze Milieu an die
Gefahren und Schrecken der Zeiten, in denen unsere rheinischen Brüder hier
vor vielen Jahrhunderten ihre Gebete verrichteten. Zur Geschichte der
Gemeinde Rheinbrohl erfahre ich noch folgende Episode: Vor 100 Jahren
hatte die altehrwürdigen Synagoge, welche damals mitten im Ort stand, einen
bösen, aber sehr einflussreichen, antijüdisch eingestellten Nachbarn.
Letzterer war Gutsherr; der ganze Ort war infolge seiner großen Besitztümer
von ihm abhängig. Er ließ die Gemeinde nicht in Frieden, und um die
benachbarte Synagoge los zu werden, legt er ringsherum Schweineställe an,
sodass die Jauche ins Gotteshaus drang. Die Glaubensbrüder suchten unter
diesem Druck Schutz und Hilfe beim Rabbiner in Bonn. Dieser empfahl das
Gotteshaus sofort außerhalb des Ortes zu verlegen und das Heiligste
mitzunehmen. Es entstand die heutige Synagoge nahe der Post. Den Platz zur
heutigen Synagoge bekam die Gemeinde zur Zeit von der Ortsverwaltung
unentgeltlich. Leider trägt diese Synagoge nicht mehr den Stempel der alten
Zeit. Erhalten ist nur in der Frauenschul ein schöner Leuchter alten Stils.
Aber mit dem Auszug der Gemeinde aus der alten Schule drehte sich das
Schicksal des schlimmen Nachbarn. Alle Seuchen, alle Krankheiten, die im
Orte ausbrachen, gingen von seinen Höfen aus. Es starben ihm in kurzer
Reihenfolge alles Vieh, alle Kinder. Er selbst endete bettelarm im Armenhaus
von Rheinbrohl, und wurde auf Kosten des Ortes beerdigt. H.H." |
| |
 Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 29. Juli 1927: Artikel
in "Jüdisch-liberale Zeitung" vom 29. Juli 1927:
Derselbe Artikel wie oben im "Israelitischen Familienblatt" |
Ein Schild "Juden
unerwünscht" wird am Ortseingang aufgestellt - und wieder beseitigt
(1935)
Anmerkung: diese Mitteilungen erschienen in mehreren jüdischen Zeitungen.
 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1935: "In Rheinbrohl
am Rhein ist am Ortseingang ein Schild über die Straße gespannt worden,
auf dem es heißt: 'Juden sind hier unerwünscht.'" Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1935: "In Rheinbrohl
am Rhein ist am Ortseingang ein Schild über die Straße gespannt worden,
auf dem es heißt: 'Juden sind hier unerwünscht.'" |
| |
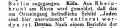 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Köln.
Aus Rheinbrohl am Rhein wird gemeldet, dass das am Ortseingang
befindliche Schild 'Juden sind hier unerwünscht' entfernt worden
ist." Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Köln.
Aus Rheinbrohl am Rhein wird gemeldet, dass das am Ortseingang
befindliche Schild 'Juden sind hier unerwünscht' entfernt worden
ist." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Herr H. Löwenherz ist bereit zur
Aufnahme eines russischen Waisenknaben (1870)
Anmerkung: zu Geschichte und Aktivitäten der Alliance Israélite Universelle
siehe Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Alliance_Israélite_Universelle.
 Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Alliance
Isr. Univ.
Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Alliance
Isr. Univ.
Herr H. Löwenherz zu Rheinbrohl erklärt sich bereit, einen russischen
Waisenknaben, welcher das dreizehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, zu sich zu
nehmen." |
Sanitätsunteroffizier Meyer, Sohn
von Carl Meyer erhält das Eiserne Kreuz II (1917)
 Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. April 1917 über die
Verleihung des Eisernen Kreuzes II: "Essen.
Sanitätsunteroffizier Meyer, zurzeit verwundet, Sohn des Herrn Carl
Meyer, Rheinbrohl."
Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. April 1917 über die
Verleihung des Eisernen Kreuzes II: "Essen.
Sanitätsunteroffizier Meyer, zurzeit verwundet, Sohn des Herrn Carl
Meyer, Rheinbrohl." |
Auszeichnungen für den
Weingutbesitzer Albert Baer (1928)
 Artikel in "israelitisches Familienblatt" vom 14. Juni 1928: "Rheinbrohl.
Vom Kreisausschuss Neuwied der Bonner Landwirtschaftskammer wurde der Winzer
Albert Bär in Rheinbrohl als einziger an seinem Ort mit der Zulassung seines
Weinbaubetriebes als 'Beispielswirtschaft' ausgezeichnet." Artikel in "israelitisches Familienblatt" vom 14. Juni 1928: "Rheinbrohl.
Vom Kreisausschuss Neuwied der Bonner Landwirtschaftskammer wurde der Winzer
Albert Bär in Rheinbrohl als einziger an seinem Ort mit der Zulassung seines
Weinbaubetriebes als 'Beispielswirtschaft' ausgezeichnet." |
| |
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 8. November 1928: "Rheinbrohl
(Auszeichnung eines jüdischen Winzers). Herr Albert Bär in Rheinbrohl, der
schon vor einigen Jahren von der Landwirtschaftskammer Bonn die Auszeichnung
erhielt, dass sein Weinberg als einziger in Rheinbrohl als 'Beispielwirtschaft' erklärt wurde hatte
dieses Jahr wieder einen Erfolg zu verzeichnen. Vom Propagandaausschuss der
Landwirtschaftskammer Wiesbaden und
Bonn wurde sein Wein preisgekrönt, er selbst erhielt eine Preismünze und
Ehrenurkunde. Herr Bär ist passionierter Winzer und baut den schon von
seinem Großvater angelegten Weinberg mit großem Sachverständnis,
vorbildlich in der Bekämpfung der Schädlinge und in der Heranzüchtung eines
Edelholzes, das von den Winzern der Umgegend unter anderem auch von den
staatlichen Versuchsgütern zur Anpflanzung neuer Weinberge sehr begehrt ist.
Herr Bär verbindet mit der vorbildlichen Liebe zur Scholle eifrige Tätigkeit
für die kommunalen Interessen und treue Anhänglichkeit zum Judentum. Eine
kleine Synagoge in unmittelbarer Nähe der Weinberge vereinigt die
geringe Zahl der Gemeindemitglieder, die ihren schlichten Gottesdienst
aufrecht erhalten. " Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 8. November 1928: "Rheinbrohl
(Auszeichnung eines jüdischen Winzers). Herr Albert Bär in Rheinbrohl, der
schon vor einigen Jahren von der Landwirtschaftskammer Bonn die Auszeichnung
erhielt, dass sein Weinberg als einziger in Rheinbrohl als 'Beispielwirtschaft' erklärt wurde hatte
dieses Jahr wieder einen Erfolg zu verzeichnen. Vom Propagandaausschuss der
Landwirtschaftskammer Wiesbaden und
Bonn wurde sein Wein preisgekrönt, er selbst erhielt eine Preismünze und
Ehrenurkunde. Herr Bär ist passionierter Winzer und baut den schon von
seinem Großvater angelegten Weinberg mit großem Sachverständnis,
vorbildlich in der Bekämpfung der Schädlinge und in der Heranzüchtung eines
Edelholzes, das von den Winzern der Umgegend unter anderem auch von den
staatlichen Versuchsgütern zur Anpflanzung neuer Weinberge sehr begehrt ist.
Herr Bär verbindet mit der vorbildlichen Liebe zur Scholle eifrige Tätigkeit
für die kommunalen Interessen und treue Anhänglichkeit zum Judentum. Eine
kleine Synagoge in unmittelbarer Nähe der Weinberge vereinigt die
geringe Zahl der Gemeindemitglieder, die ihren schlichten Gottesdienst
aufrecht erhalten. " |
Persönlichkeiten
 Johanna Loewenherz (geb. 12. Mai 1857 in Rheinbrohl, gest. 17. Mai
1937 ebd.) war das jüngste der drei Kinder von Heymann Loewenherz
(Kaufmann und Steinbruchbesitzer, 1812-1897) und seiner Frau Fanny geb. Jacobson.
Über ihre Ausbildung ist wenig bekannt - in Stuttgart studierte sie am
Konservatorium Klavierspiel und Gesang. Johanna Loewenherz wurde in den 1890er-Jahren
u.a. in Berlin bekannt als sozialdemokratische Rednerin auf zahlreichen
Versammlungen und Parteitagen. Sie verfasste literarische Arbeiten und politische Schriften zu
Frauenthemen. Seit 1911 lebte sie mit ihrem Sohn Fritz in München. Nach
Ausbruch des Ersten Weltkrieges zog sie wieder nach Rheinbrohl. 1933 kam sie kurzzeitig in "Schutzhaft", danach musste
sie sich regelmäßig bei der Polizei melden. Im Dezember 1933 starb ihr Sohn
Fritz unter ungeklärten Umständen. Ihr Nachlass wurde von den
Nationalsozialisten vernichtet. Johanna Loewenherz (geb. 12. Mai 1857 in Rheinbrohl, gest. 17. Mai
1937 ebd.) war das jüngste der drei Kinder von Heymann Loewenherz
(Kaufmann und Steinbruchbesitzer, 1812-1897) und seiner Frau Fanny geb. Jacobson.
Über ihre Ausbildung ist wenig bekannt - in Stuttgart studierte sie am
Konservatorium Klavierspiel und Gesang. Johanna Loewenherz wurde in den 1890er-Jahren
u.a. in Berlin bekannt als sozialdemokratische Rednerin auf zahlreichen
Versammlungen und Parteitagen. Sie verfasste literarische Arbeiten und politische Schriften zu
Frauenthemen. Seit 1911 lebte sie mit ihrem Sohn Fritz in München. Nach
Ausbruch des Ersten Weltkrieges zog sie wieder nach Rheinbrohl. 1933 kam sie kurzzeitig in "Schutzhaft", danach musste
sie sich regelmäßig bei der Polizei melden. Im Dezember 1933 starb ihr Sohn
Fritz unter ungeklärten Umständen. Ihr Nachlass wurde von den
Nationalsozialisten vernichtet.
Link zur Johanna-Loewenherz-Stiftung
des Landkreises Neuwied (von hier auch das Foto links); hier auch
ausführliche Biografie von Hildegard Brog.
Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Loewenherz
Literatur siehe Wikipedia-Artikel.
In Rheinbrohl erinnert die "Johanna-Loewenherz-Straße" an
Johanna Loewenherz. |
| |
Wohnhaus von Johanna
Loewenherz in der
Hauptstraße in Rheinbrohl mit Gedenktafel
(Quelle: Gemeinde
Rheinbrohl) |
 |
 |
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Branntweinbrennerei des Weingutsbesitzer Albert Baer (1927)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. März 1927: "Günstiges
Angebot zu Pessach. Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 10. März 1927: "Günstiges
Angebot zu Pessach.
Ia Rot- und Weißweine eigene Kelterung, v. 1.25 Mark an pro
Flasche
Selbstgebrannte Edelbranntweine
Weintrester, 3.- M. per Flasche
Original Weinhefen, 3,25 M. pro Flasche
Zwetschen, 3.50 Mark per Flasche
Albert Baer Branntweinbrennerei und Weingutsbesitzer Rheinbrohl
am Rhein." |
Hochzeitsanzeige von Albert Baer
und Thea geb. Faber (1937)
 Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Juli 1937: "Statt
Karten! Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 22. Juli 1937: "Statt
Karten!
Albert Baer - Thea Baer geb. Faber
Vermählte
Rheinbrohl am Rhein -
Leubsdorf bei Linz am Rhein 28. Juli 1937." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein kleines Bethaus auf einem 80 qm
großen Grundstück "Oben im Dorf", ehemals Gebäude Nr. 717
vorhanden. Es war ein kleiner Bruchsteinbau mit einem tonnengewölbten Betsaal.
Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Synagoge wurde das Gebäude 1863 an einen
Nachbarn verkauft, der das Gebäude um zwei Geschosse aufstockte. Bei einem
Bombenangriff am 19. März 1945 wurde das Gebäude zerstört; das Grundstück
wurde nicht wieder bebaut.
Einzelheiten zur alten Synagoge und den Umständen, die nach der Erinnerung
der Gemeinde zum Bau einer neuen Synagoge führten, siehe oben im Artikel von
1927.
Schon 1837 wollte die Gemeinde eine neue Synagoge bauen. Der Bau war
jedoch nicht von den Behörden genehmigt, musste zunächst eingestellt und
konnte dann jedoch zur Einrichtung einer jüdischen Schule für den Unterricht
der Kinder fertiggestellt werden. Das Gebäude stand vermutlich im oberen Teil
der Kirchstraße.
1862 wurde eine neue Synagoge geplant. Nach dem Verkauf der alten
Synagoge konnte am 11. Mai 1863 ein neues Grundstück an der damaligen
Chaussee, der heutigen Hauptstraße erworben werden. Im Jahr darauf, also im
Frühjahr 1864 konnte die Synagoge - nach dem
Bürgermeistereiprotokoll dieses Jahres - "fertiggestellt und feierlich dem
Dienst übergeben" werden. Finanziert wurde der Bau durch Spenden und
Kollekten, die auch in anderen Gemeinden (Bonn, Frankfurt, Köln usw.)
durchgeführt wurden. Auch wenn die Zahl der Gemeindeglieder und damit
Gottesdienstbesucher klein blieb, konnte 1927 dennoch berichtet werden (im
Bericht zu Albert Baer s.o.): "Eine kleine Synagoge in unmittelbarer Nähe der Weinberge
vereinigt die geringe Zahl der Gemeindemitglieder, die ihren schlichten
Gottesdienst aufrecht erhalten."
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
angezündet. Die Feuerwehr beschränkte sich auf den Schutz der Nachbargebäude.
Einige durch den Brand schon teilweise zerstörte Einrichtungsgegenstände
wurden am folgenden Tag auf den am Rheinufer für das Martinsfeuer der Schule
aufgestapelten Holzstoß geworfen und mit verbrannt. Die Brandruine wurde
abgebrochen, das Grundstück nach 1945 neu bebaut.
Im April 1982 wurde unweit des Synagogengrundstückes am Aufgang zur
evangelischen Kirche eine Gedenktafel angebracht.
Adresse/Standort der Synagoge: Auf
dem Grundstück des heutigen Wohnhauses Hauptstraße 20a
Fotos
(Quelle: Historische Aufnahmen: Landesamt s. Lit. S.
321; neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum
26.08.2009)
| Die Synagoge in Rheinbrohl |
 |
 |
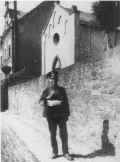 |
| |
Ausschnitt aus
einem Luftbild von Rheinbrohl
mit der Synagoge an der Chaussee (1929) |
Die Synagoge (Aufnahme
zwischen
1933 und 1938) |
| |
|
|
Grundstück der ehemaligen
Synagoge
im August 2009 |
 |
 |
| |
Bauliche Situation
im Sommer 2009: das hohe Gebäude ist noch dasselbe wie auf den obigen
Aufnahmen; das angebaute niedrigere Wohnhaus steht auf dem Grundstück der
früheren
Synagoge; die Gebäude rechts stehen auf damals noch unbebautem
Grundstück. |
| |
|
|
Gedenken an die
Zerstörung der Synagoge |
 |
 |
| |
Am Aufgang zur
evangelischen Kirche die Gedenktafel mit einer Abbildung der Synagoge und
der Inschrift: "Hier in der Nähe stand bis zur Zerstörung durch die
Nationalsozialisten am 9.11.1938
die Synagoge der jüdischen Gemeinde
Rheinbrohl. Erinnerung - Mahnung - Dez. 1981" |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Jakob Weiler: Die Verhältnisse der Juden in
Hönningen und Rheinbrohl und ihr Leidensweg im "Dritten Reich".
Bad Hönningen. Beiträge zur Heimatkunde und Heimatgeschichte Bd. 3.
Selbstverlag des Heimatvereins Bad Hönningen. 1997 61 S.
|
 | Werner Schönhofen: Johanna Loewenherz - Eine
Sozialistin und Jüdin kämpfte für die Sache der Frauen. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 8. Jahrgang
Ausgabe 2/1998 Heft Nr. 16. S. 65. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 320-321 (mit weiteren Literaturangaben).
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|