|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg

Unterschwandorf (Stadt
Haiterbach, Landkreis Calw)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version see Baisingen)
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts den Freiherren
von Kechler gehörenden Unterschwandorf bestand eine jüdische Gemeinde bis
1861. Ihre Entstehung geht in die Zeit Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Erste
Schutzbriefe für Juden wurden 1799 ausgestellt.
Die ersten jüdischen Familien lebten in der
Ortsherrschaft gehörenden Häusern in unmittelbarer Nähe zur Synagoge. Ein
"großes Judenhaus" (Haus Nr. 3 neben der 1803 erbauten Synagoge) wurde 1802/03 für die jüdischen
Familien von der Ortsherrschaft erbaut (1885 abgebrannt und nicht wieder aufgebaut). Nach 1815 lebten jüdische Familien auch im Ort außerhalb des Schlossbereichs (Bereich der Sommerhalde). 1823 gehörten
drei der 27 Häuser des Ortes jüdischen Familien, 1843 waren es neun der 30 Häuser des
Ortes.
Die Zahl der jüdischer
Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie folgt: 1806 63
jüdische Einwohner, 1822 64, 1826 95, 1933 101, 1841 Höchstzahl mit 109
jüdischen Einwohnern (etwa ein Drittel der Einwohnerschaft), 1844 105, 1858 49,
1864 1, 1871 2, 1875 1.
In den 1830er-Jahren wurde mit Gottlieb Moses Dessauer
erstmals in Württemberg ein jüdischer Ortsbewohner zum Bürgermeister der
Gemeinde gewählt. Er hatte dieses Amt über mehrere Jahre inne.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Religionsschule (zum allgemeinen Unterricht besuchten die jüdischen
Kinder gemeinsam mit den christlichen Schülern die Ortsschule), ein rituelles
Bad (1828 genannt; 1847/48 wurde ein neues Bad auf einem Platz hinter der
Synagoge gebaut, das mit Wasser aus dem Schlossbrunnen versorgt wurde; nach dem
Verkauf der Synagoge wurde das Badhäuschen als Abstellraum verwendet; mit der
Synagoge wurde es 1920 abgebrochen) und ein Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Die Gemeinde
gehörte zum Bezirksrabbinat Mühringen.
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer sehr schnellen Aus- und Abwanderung
der jüdischen Familien. Um 1870 gab es nur noch zwei jüdische Einwohner. Seit
1880 wurden bei den Volkszählungen keine jüdischen Einwohner mehr am Ort
festgestellt.
Berichte
aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Hinweis auf den jüdischen Bürgermeister in
Unterschwandorf - Gottlieb Moses Dessauer (1846)
Anmerkung (Hinweis von Martin Frieß, s. Lit.): Dessauer war bis zu
seinem Tod 1842 Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Auch wenn er sich in
Quellen manchmal "Judenschultheiß" nennt, so darf das nicht darüber
hinwegtäuschen, dass er kein eigentlicher Schultheiß war. Die (bürgerliche)
Gemeinde Unterschwandorf wurde erst 1834 gegründet. Deren Schultheiß hieß von
Anfang an Kehle (ein Christ, Vorname unbekannt).
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1846: "Pflaumloch,
26. Dezember (Württemberg). Die hiesige Stadtkommune hat den Israeliten
Markus Ettlinger zu ihrem Bürgermeister erwählt. Es ist dies seit
Erlassung der die Juden zu Gemeindeämtern für wahlfähig erklärenden
Gesetze von 1828 und resp. 1933 in unserm Lande der erste derartige Fall,
was einerseits das Schwinden des Vorurteils gegen die Juden auch unter
unseren Landbewohnern, andererseits aber auch den Ungrund der hier und da
laut gewordenen Besorgnis beweist, als ob in Folge der gesetzlichen
Aufhebung der bürgerlichen Unfähigkeit der Juden bald alle
Gemeindeämter von Juden besetzt sein würden. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1846: "Pflaumloch,
26. Dezember (Württemberg). Die hiesige Stadtkommune hat den Israeliten
Markus Ettlinger zu ihrem Bürgermeister erwählt. Es ist dies seit
Erlassung der die Juden zu Gemeindeämtern für wahlfähig erklärenden
Gesetze von 1828 und resp. 1933 in unserm Lande der erste derartige Fall,
was einerseits das Schwinden des Vorurteils gegen die Juden auch unter
unseren Landbewohnern, andererseits aber auch den Ungrund der hier und da
laut gewordenen Besorgnis beweist, als ob in Folge der gesetzlichen
Aufhebung der bürgerlichen Unfähigkeit der Juden bald alle
Gemeindeämter von Juden besetzt sein würden.
Hiergegen bemerkt das Frankfurter Journal, dass es nicht der erste Fall
sein, denn im Dorfe Unterschwandorf, Oberamts Nagold, was mehrere Jahre
lang bis an seinen Tod ein Israelit, namens Dessauer, Schultheiß einer
Bevölkerung, die fast zu gleichen Teilen aus Protestanten, Katholiken und
Juden bestand, und die dort recht einträchtlich beisammen
wohnten." |
Über die Schwierigkeiten einer christlich-jüdischen
Liebesbeziehung (1852)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1852:
"In Schwandorf, Rabbinats Mühringen, hat ein Judenmädchen
jahrelang mit einem Deutschkatholiken Umgang gepflogen, dieser wollte
sogar aus Indifferentismus gegen alle Religion zum Judentume übertreten,
um die gesetzliche Form zu finden, das Mädchen ehelichen zu können.
Rabbiner Dr. Wassermann aber wies denselben ab. Nun haben die beiden sich
dennoch durch einen katholischen Geistlichen trauen lassen, ohne dass dem
Rabbiner amtlich bekannt wurde, dass die Verlobte vom Judentums
ausgeschieden sei. Da nach den bestehenden Staatsgesetzen jeder
Konvertierende vor seinem Übertritte seinem Geistlichen von seinem Vorgaben
Anzeige zu machen hat, in diesem Falle aber gegen die bestehende
gesetzliche Norm jedenfalls gefehlt worden ist, so hat Dr. Wassermann bei
den Behörden Reklamation angestellt, über deren Erfolg ich später
berichten werde." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. März 1852:
"In Schwandorf, Rabbinats Mühringen, hat ein Judenmädchen
jahrelang mit einem Deutschkatholiken Umgang gepflogen, dieser wollte
sogar aus Indifferentismus gegen alle Religion zum Judentume übertreten,
um die gesetzliche Form zu finden, das Mädchen ehelichen zu können.
Rabbiner Dr. Wassermann aber wies denselben ab. Nun haben die beiden sich
dennoch durch einen katholischen Geistlichen trauen lassen, ohne dass dem
Rabbiner amtlich bekannt wurde, dass die Verlobte vom Judentums
ausgeschieden sei. Da nach den bestehenden Staatsgesetzen jeder
Konvertierende vor seinem Übertritte seinem Geistlichen von seinem Vorgaben
Anzeige zu machen hat, in diesem Falle aber gegen die bestehende
gesetzliche Norm jedenfalls gefehlt worden ist, so hat Dr. Wassermann bei
den Behörden Reklamation angestellt, über deren Erfolg ich später
berichten werde." |
Zur Geschichte der Synagoge
In dem den jüdischen Familien am
2. Januar 1799 ausgestellten Schutzbrief war festgelegt, dass diese
"ihre Religion, soweit es einer Judenschaft nach der Reichsverfassung vergönnte
werden darf, ungehindert" ausüben dürften. Schon bald hat sich die jüdische
Gemeinde an den Bau einer Synagoge gemacht. Von der Grundherrschaft
konnte ein Grundstück gekauft und das kleine Gotteshaus im Jahr 1803
erbaut werden. Zur Finanzierung des Gebäudes hatten unter anderem neu
aufgenommene Familien eine "Annahmegebühr" von immerhin 33 Gulden zu
entrichten. Für dieses Geld erhielten sie zwei Synagogenplätze als Ausdruck
ihrer Aufnahme in die Gemeinde. Obwohl das Synagogengrundstück im Eigentum der
jüdischen Gemeinde war, hatte diese weiterhin jährlich einen Gulden "Bodenzins"
an die Grundherrschaft zu bezahlen.
Bei der Unterschwandorfer Synagoge handelte es sich um ein
Gebäude mit annähernd quadratischem Grundriss von wenig mehr als 8 Meter
Seitenlänge. Sie besaß im Unterschied zu den Nachbarhäusern ein kurzes,
seitlich nicht heruntergezogenes Walmdach. Das Erdgeschoss war von Stein, darüber
wurde mit Fachwerk gebaut. Im Inneren des Gebäudes gab es vermutlich über dem
Betsaal der Männer eine ungeteilte Frauenempore im hinteren Drittel.
Aus der Geschichte der Synagoge ist nur wenig überliefert.
1805 gab es eine Auseinandersetzung zwischen Bediensteten der
herrschaftlichen Familie und der jüdischen Gemeinde, nachdem durch ablaufendes
Wasser aus dem herrschaftlichen Fischweiher die Synagoge überschwemmt wurde.
Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Ab- und
Auswanderung der Unterschwandorfer Juden einsetzte, verlor die Synagoge rasch
ihre Bedeutung als Mittelpunkt des Gemeindelebens. Gottesdienste fanden immer
seltener statt und hörten schließlich mit der Versetzung des letzten Vorsängers
praktisch auf. 1860 entschloss sich die Muttergemeinde in Baisingen,
das Gebäude zu verkaufen und für eine profane Nutzung freizugeben. Einige
Jahrzehnte lang diente das Gebäude dann als Heu- und Holzlager, wurde
wiederholt verpfändet, verfiel in zunehmendem Maße und hatte bei einer 1907
erfolgten Schätzung mit 600 Mark gerade noch den Wert einer billigen Scheuer. 1920
wurde das Gebäude abgebrochen.
Adresse / Standort der Synagoge:
unterhalb des Schlosses
Fotos
Historisches Foto und Plan:
(Quelle: Heft IV der Reihe "Die Unterschwandorfer Juden" s. Lit.
S. 66-67)
|

|
 |
Die Synagoge Unterschwandorf (mit weißem
Pfeil markiert) unterhalb des
Schlosses |
Ausschnitt aus einer Flurkarte von 1836
mit eingetragener Synagoge |
Neuere Fotos:
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |
|
| |
Der ehemalige Synagogenstandort unterhalb
des im Gegenlicht
befindlichen
Unterschwandorfer Schlosses |
|
| |
|
|
| |
Neuere Fotos vom ehemaligen
Synagogenstandort
werden
bei Gelegenheit erstellt |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und
Hohenzollern. 1966. S. 186. |
 | Siegfried Kullen: Der Einfluss der Reichsritterschaft auf die
Kulturlandschaft im Mittleren Neckarland. 1967. S.79.81. |
 | Otto-Hahn-Gymnasium Nagold (Hg.), Der jüdische Friedhof von
Unterschwandorf. 1992. |
 | dass. (Hg.), Die Unterschwandorfer Juden. Geschichte einer vergessenen
Gemeinde. 7 Hefte. 1992. |
 |
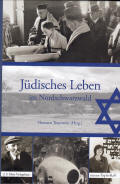 Thorsten
Trautwein (Hrsg.): Jüdisches Leben im Nordschwarzwald. Edition Papierblatt Band
2. J. S.
Klotz Verlagshaus GmbH Neulingen 2021. 800 S. Thorsten
Trautwein (Hrsg.): Jüdisches Leben im Nordschwarzwald. Edition Papierblatt Band
2. J. S.
Klotz Verlagshaus GmbH Neulingen 2021. 800 S.
ISBN: 978-3-948968-45-8. 29,90 €.
Informationen auf Verlagsseite. Mehr zur Edition
Papierblatt:
https://www.papierblatt.de/edition/
Darin u.a. der Abschnitt 2.6 von Martin Frieß: Leben in Armut, doch
"in seltener Eintracht" - Die jüdische Gemeinde in Unterschwandorf. S.
197-226.
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|