|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Fürth
Fürth (Mittelfranken)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Über die israelitische Bürgerschule / ab 1899: israelitische Realschule
mit angeschlossener Volksschule
Übersicht:
- Ausschreibung
der Stelle eines Volksschullehrers (1938)
- Ausschreibung
der Stelle einer Volksschullehrerin (1938)
Einführung
- zur Geschichte der jüdischen Schulen in Fürth im 19./20. Jahrhundert
Über die bis 1829 bestehende
Fürther Jeschiwa (Talmudhochschule)
Fürth war bereits seit dem 17. Jahrhundert ein Ort großer
jüdischer Gelehrsamkeit. Der aus Krakau stammende, zunächst in Prag, von 1628
bis 1632 in Fürth und anschließend als Oberrabbiner in Frankfurt tätige Sabbatai
Halevi Horowitz (ca. 1590-1660) charakterisierte die "Heilige Gemeinde
Fürth" (Kehilla Keduscha Fiorda) mit den Worten: "eine kleine
Stadt, in meinen Augen jedoch so groß wie Antiochien, denn hier versammelten
sich gelehrte Leute zum täglichen Studium". Ort der Gelehrsamkeit war
insbesondere die bereits 1606 genannte "Jeschiwa", eine
Talmudhochschule, in der in den folgenden 300 Jahren unzählige Rabbiner und
Lehrer ihre Ausbildung erhielten. In ihrer Blütezeit besuchten bis zu 400
Studenten die Fürther Jeschiwa. Unter den Vorstehern der Schule sind im 17. Jahrhundert
neben dem schon genannten Rabbiner Horwitz zu nennen: Aron Samuel Kaidanower
(1660 bis 1667), Jesaja II. Horowitz (1668 bis 1674, Meir Ben Ascher (1670 bis
1683), im 18. Jahrhundert u.a. Bermann Fränkel (1700 bis 1708), Josef Steinhart
(1764 bis 1776) und Hirsch Josef Janow (1778 bis 1785). Die letzten Leiter der Jeschiwa waren
Salomon (Meschullam Salman) Kohn (1779 bis 1819) und Abraham Benjamin Wolf Hamburg
(bzw. Wolf Lippmann Hamburger; bis zur Schließung der Jeschiwa 1829).
Auf Grund der Bestimmungen und Intentionen des 1813 verabschiedeten bayerischen
"Judenedikts" waren die traditionellen Jeschiwot aus Sicht der bayerische Regierung jedoch Hindernisse für die angestrebte bürgerliche
"Verbesserung der Juden". Die Regierung wollte aus der Fürther
Talmudschule eine zentrale Ausbildungsinstitut für jüdische Kultusbeamte
und Religionslehrer machen. Dabei sollte das Seminar unter staatlicher
Oberaufsicht stehen und auch höhere weltliche Studienfächer umfassen. 1826
wurden der Fürther Gemeinde entsprechende Auflagen gemacht. Diese war jedoch
nicht zu Kompromissen bereit, zumal die Regierung zu den Betriebskosten keine
Zuschüsse zahlen wollte. Das Ergebnis war die von den Behörden angeordnete
Schließung der Anstalt 1829. Der Leiter der Jeschiwa, Rabbiner Wolf Hamburger
erhielt Lehrverbot. Die Schüler der Jeschiwa, deren Zahl auf Grund der
unsicheren Situation bereits von 88 (1824) auf 36 (1828) zurückgegangen
Mit dieser Schließung war für Fürth die Chance vertan, mit einer reformierten
Religionshochschule auch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zentraler
Ausbildungsort für jüdische Lehrer und Rabbiner zu sein. Diese Rolle übernahm
seit 1864 im bayerischen Bereich die Universitätsstadt Würzburg nach Gründung der dortigen "Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt" in enger Verbindung mit der Präparandenschule
im nahen Höchberg. Zur selben Zeit, als in Würzburg die Israelitische
Lehrerbildungsanstalt entstand, wurde in Fürth jedoch die israelitische Bürgerschule
gegründet.
Die "israelitische Bürgerschule" von 1862
bis 1939 (seit 1899: "israelitische Realschule")
Die israelitische Bürgerschule wurde 1862, nach mehrjährigen intensiven
Bemühungen von Seiten orthodox-jüdischer Kreise in Fürth, mit Hilfe von privaten Spenden
und einem neu installierten Trägerverein gegründet. Es handelte sich um eine
Besonderheit im jüdischen Schulwesen Bayerns: während es eine große Zahl
jüdischer Volksschulen gab, war die Fürther Schule einzigartig
im Land. Die Schule begann 1862 mit 42 Schülern, die im ersten Jahr in Mieträumen
in einem Gebäude an der Blumen- und Theaterstraße (späteres Postgebäude) untergebracht waren.
Im zweiten Jahr zog man in ein größeres Gebäude in der Hirschenstraße um. 1868
konnte ein Grundstück in der Blumenstraße 31 erworben und noch im selben Jahr
das Vorderhaus fertiggestellt werden. Seit 1884 stand den vier Vorschul- (=
Volksschul-) und
sechs Realschulklassen auch das Rückgebäude zur Verfügung.
1881 erfolgte die staatliche Anerkennung der Schule. Seit 1899 durfte
sich die Schule "israelitische Realschule" nennen.
Die Leiter / Direktoren der israelitischen Bürgerschule / Realschule
waren: Dr. Selig Auerbach (1862 bis 1873), Dr. Samuel Dessau (1873 bis
1898, gest. März 1904), Dr.
Moritz Stern (September 1898 bis Dezember 1899), Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld (1901 bis 1923,
gest. 15. Juli 1923), Dr. Markus Elias (1924 bis 1928) und Dr. Fritz Prager
(1929 bis ?).
Ein besonderer Schwerpunkt an der Schule war in den ersten Jahren der spezifisch jüdische
Unterricht. Bis dahin wurden je nach Klassenstufe sieben bis dreizehn Stunden
Unterricht in Religionslehre, biblischer Geschichte und Hebräisch erteilt. Mit
diesem Schwerpunkt wollten die Schulleiter bewusst an die Tradition der nicht
mehr bestehenden Fürther Jeschiwa anknüpfen (vgl. auch unten die Darstellung
von Rabbiner Hildesheimer). Erst seit 1881 wurde eine Reduktion auf vier Stunden Religionsunterricht
vorgenommen. der andere Schwerpunkt der schulischen Ausbildung lag im
handelswissenschaftlichen Bereich ("Handelsabteilung" in den oberen
drei Klassen).
1928 zählte die Schule 160 Schüler und Schülerinnen, die weiterhin in zehn
Klassen (vier Vorschul- und sechs Realklassen) unterrichtet wurden. Damals gab
es elf hauptamtliche Lehrer an der Schule: drei Volksschullehrer, zwei
Religionslehrer, sechs Reallehrer und mehrere technische
Hilfskräfte. Die Namen der Lehrer waren: neben Direktor Dr. Markus Elias:
Lehrer A. Bing, Hauptlehrer Benzion Ellinger, Studienass. H. Geißler, Rabbiner
Dr. Kahn, Studienrat W. Keßler, Studienass. Dr. Lebherz, Studienass. Fritz
Prager, Hilfslehrerin M. Maunz und Studienass. Zeilhofer. Vorsitzender des
Trägervereins "Verein der Israelitischen Realschule e.V." war J. L.
Weißkopf. 1932 waren unter der Leitung von Studiendirektor Dr. Fritz
Prager die Lehrer: Dr. Breslauer, Eldod, Günzler, Dr. Heinemann, Dr. Kahn,
Kohn, Königshöfer, Kraus, Ott, Zeilhofer. Die Volksschulklassen wurden im
Schuljahr 1931/32 von 36 Jungen und 38 Mädchen besucht, die Realschulklassen
von 65 Jungen und 31 Mädchen. Weiterhin war J. L. Weißkopf Vorsteher des
Trägervereins.
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 nahm die Zahl der
Schüler an der israelitischen Realschule zunächst zu, da der Besuch der
allgemeinen Schulen für die jüdischen Schüler der Stadt im mehr erschwert,
schließlich nicht mehr möglich war. Im Frühjahr 1937 gingen insgesamt
224 Schüler in die israelitische Realschule, 98 von ihnen besuchten die
Volksschulklassen dieser Schule. Im Februar 1938 genehmigten die
Behörden das Fortbestehen der Schule als höhere Schule mit fünf Klassen. Beim
Novemberpogrom 1938 blieb das Gebäude der Realschule unbeschädigt, daher wurde
der Sitz der Gemeinde danach in das Schulgebäude verlegt. Im Dezember 1939 musste die Realschule
allerdings wegen angeblich "zu geringer Frequenz"
von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland aufgelöst werden. Im März
1940 richtete die jüdische Gemeinde im Gebäude eine Kleiderkammer und
Schuhreparaturwerkstätte für ihre Mitglieder ein.
Die israelitischen Volksschulklassen bestanden zunächst weiter. Sie
musste jedoch auf Jahresende 1941 auf Anordnung der NS-Behörden zwangsweise
geschlossen werden. Im Dezember 1939 war sie noch von 83, im Oktober 1941 immer
noch von 76 Schülern besucht worden. Bis zum 1. Juli 1942 erhielten die
übriggebliebenen Kinder der jüdischen Gemeinde Fürth in einem Klassenzimmer
der jüdischen Schule in Nürnberg Unterricht.
Berühmtester Schüler der israelitischen Realschule war der am 27. Mai
1923 in Fürth geborene spätere amerikanische Außenminister Henry (Heinz
Alfred) Kissinger. Er hatte zunächst die jüdische Grundschule in Fürth
besucht. Da ihm nach 1933 nicht mehr erlaubt war, das Gymnasium zu besuchen,
setzte er die Schulausbildung in der Israelitischen Realschule fort. 1938
verließ er mit seiner Familie Fürth, um in die USA zu emigrieren. Seit 1998
ist Henry Kissinger Ehrenbürger der Stadt Fürth. Siehe Seite
auf der Website der Stadt Fürth zu Henry A. Kissinger.
Fotos
Das Gebäude
der ehemaligen
Israelitischen Realschule in der
Blumenstraße 31
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 21.10.2007) |
 |
 |
| |
Das Gebäude wird
heute für Wohnzwecke, aber auch für die Verwaltung der Israelitischen
Kultusgemeinde Fürth verwendet - auf rechtem Foto mit Mesusa am
Eingang. |
| |
|
|
| |
|
|
Fotos zu
Schülergruppen der israelitischen Realschule in Fürth
aus dem Archiv des United States Holocaust Memorial Museums
Quelle: © United States
Holocaust Memorial Museum |
|
 |
 |
 |
Schülergruppe einer
Volksschulklasse
der israelitischen Realschule (1936)
Link zum Foto |
Schülergruppe der
israelitischen Realschule,
vorne links: Henry (Heinz Alfred) Kissinger
(1938); Link
zum Foto |
Schülergruppe der
israelitischen Realschule
mit dem Lehrer Benno Heinemann (1936)
Link zum Foto |
| |
|
|
 |
 |
 |
Schülergruppe der
israelitischen Realschule:
4. von rechts. Paul Stiefel, in der Mitte mit
Papier in der Hand: Henry (Heinz Alfred) Kissinger (1938);
Link
zum Foto |
Schülergruppe der
israelitischen Realschule
mit Rabbiner Dr. Heilbronn (1936/1938)
Link
zum Foto |
Lehrer
der israelitischen Realschule um
1934/35: von links nach rechts:
Heinemann,
Mandelbaum, Eldod, Falkenmeier, Kohn,
sitzend: Direktor Prager
(Quelle: Jüdisches Museum
Franken) |
| |
Texte
zur Geschichte der israelitischen Bürgerschule, ab 1899: israelitische
Realschule
Die nachstehend wiedergegebenen Texte wurden in jüdischen Periodika des
19./20. Jahrhunderts
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Neueste Ergänzung am 22.7.2012.
Porträt
des Direktors Wolf L. Hamburger (1846)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8. September
1846: "In G. Loewesohn's Kunstanstalt in Fürth ist
erschienen und durch die v. Ebner'sche Buchhandlung in Nürnberg, sowie
durch sämtliche Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz zu beziehen: Porträt
des W. K. Hamburger, Direktor der frühern jüdischen Hochschule zu
Fürth. Nach dem Original gestochen von G. Loewesohn. Royal-Foli. Preis
auf chines. Papier 12 1/2 Ngr. = 48 Kr. Anzeige
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8. September
1846: "In G. Loewesohn's Kunstanstalt in Fürth ist
erschienen und durch die v. Ebner'sche Buchhandlung in Nürnberg, sowie
durch sämtliche Buchhandlungen Deutschlands und der Schweiz zu beziehen: Porträt
des W. K. Hamburger, Direktor der frühern jüdischen Hochschule zu
Fürth. Nach dem Original gestochen von G. Loewesohn. Royal-Foli. Preis
auf chines. Papier 12 1/2 Ngr. = 48 Kr.
Seinen Freunden und Gönnern wird dieses schöne und gelungene Porträt
eine freundliche Erinnerung sein." |
Zum Tod von
Rabbiner Wolf Hamburg(er), letzter Leiter der Fürther Jeschiwa (1850)
Anmerkung: Rabbiner Wolf Hamburger (geb. 1770 in Fürth, gest. 1850 ebd.) war
ein Sohn des Gemeindevorstehers Elieser Lippmann Ansbach aus Fürth. Er
studierte in Fürth bei Dajan Wolf Ullmann und an der Jeschiwa des Oberrabbiners
Meschullam Salman Kohn. Dieser bestimmte ihn 1799 zum Leiter der Fürther
Jeschiwa. Sie war während seiner dreißigjährigen Amtszeit die größte
rabbinische Schule des westlichen Deutschlands. Zur Schließung der Jeschiwa und
zum Lehrverbot für Hamburger kam es - wie oben dargestellt - 1829. In der
Folgezeit war Hamburger Wortführer der Fürther Orthodoxen und bekämpfte die
Reformpartei und seine zu ihr übergelaufenen Schüler David Einhorn, Isaak
Löwi, Joseph Aub, Leopold Stein, Bernhard Wechsler, Elias Grünebaum und Moses
Gutmann.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni
1850: "Schließlich melde ich Ihnen noch den Tod des Nestors
talmudischer Gelehrsamkeit, des vieljährigen unentgeltlichen Lehrers der
meisten bayerischen Rabbiner und Lehrer etc., des Herrn R. Wolf
Hamburger in Fürth. Einfach und kein Freund asketischer
Übertreibungen im Leben, verbat er sich auch alle Feierlichkeiten und Hespedim
(Trauerreden) bei seinem Leichenbegängnisse und auf seinen Grabsteine
solle nichts weiteres als sein Name gesetzt werden. In der Neuzeit ist er
mit seinen vormaligen Schülern, Rabbinen, vielfach in leicht erklärliche
Konflikte geraten. Welches Urteil man sich über dieselbe auch bilden
mochte, der Uneigennützigkeit seiner Bestrebungen, der Abgesagtheit aller
Übertreibungen und der Ehrlichkeit seines Charakters muss jeder
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Juni
1850: "Schließlich melde ich Ihnen noch den Tod des Nestors
talmudischer Gelehrsamkeit, des vieljährigen unentgeltlichen Lehrers der
meisten bayerischen Rabbiner und Lehrer etc., des Herrn R. Wolf
Hamburger in Fürth. Einfach und kein Freund asketischer
Übertreibungen im Leben, verbat er sich auch alle Feierlichkeiten und Hespedim
(Trauerreden) bei seinem Leichenbegängnisse und auf seinen Grabsteine
solle nichts weiteres als sein Name gesetzt werden. In der Neuzeit ist er
mit seinen vormaligen Schülern, Rabbinen, vielfach in leicht erklärliche
Konflikte geraten. Welches Urteil man sich über dieselbe auch bilden
mochte, der Uneigennützigkeit seiner Bestrebungen, der Abgesagtheit aller
Übertreibungen und der Ehrlichkeit seines Charakters muss jeder
Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Diesem letztwilligen Begehren unbeschadet wäre die Mitteilung eines
ausführlichen Nekrologs abseiten seines seiner Vertrauten sehr
wünschenswert." |
Von
der Jeschiwa in Fürth zur israelitischen Bürgerschule (Beitrag von Dr. Esriel Hildesheimer)
(1866)
Anmerkung: Der Verfasser dieses Beitrages ist der für die jüdische Orthodoxie hoch
bedeutende Rabbiner Esriel (auch Israel) Hildesheimer (1820-1899). Zur Zeit der
Abfassung des Artikels war Hildesheimer Rabbiner in Eisenstadt, wo er
erfolgreich eine Jeschiwa begründet hatte. 1869 wurde Hildesheimer als Rabbiner
der orthodoxen Adass-Jisroel-Gemeinde nach Berlin berufen. Hier etablierte er
ein orthodoxes Rabbinerseminar, das zu einer wichtigen Ausbildungsstätte für
Rabbiner aus ganz Europa wurde. Weitere
Informationen siehe Wikipedia-Artikel zu Esriel Hildesheimer.
Im nachfolgenden Abschnitt kritisiert Hildesheimer scharf die erzwungene
Schließung der Jeschiwa in Fürth. Zugleich sieht er mit der neu gegründeten
israelitischen Bürgerschule jedoch die Möglichkeit, dass auch in Fürth wieder
die Liebe zur Tora in neuer Weise gepflegt
wird.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai
1866: "Noch einmal über die Jeschiba-Angelegenheit. Von Dr.
J(srael).
Hildesheimer. ... In Mittelfranken befindet sich a. Schwabach ... b. Fürth,
eine hochaufrichtende Erscheinung. Wem wäre nicht das Rischut (die
Schlechtigkeit) bekannt, welches die verfolgungssüchtigen Reformer mit
unerhörtester Frechheit auf Süddeutschland ausgeübt. In Fürth hat man
unter Mephistophelischem Hohngelächter die nach Hunderten zählende Jeschiwa
des Rabbi Wolf Hamburger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen
- zerstört, und die Schüler in alle Ecken und Enden zerstreut.
Natürlich, so lange man noch eine 'talmudische Melodie' hört, kann die
Reform, welche nur bei absoluter Ignoranz ihrer Laien leben kann, nicht zu
Ruhe kommen. Fürth aber hat sich wieder ermannt; sagen wir es nur gleich;
es hat sich vorzüglich durch den festen Willen eines Mannes Rabbiner
Menke Zimmer - seine Licht leuchte - ermannt. Ihm allein wäre
natürlich, was erreicht wurde, nicht möglich gewesen, wenn nicht viele
wackere Mitglieder ihm unbedingtes Vertrauen entgegentrugen, weit mehr
aber noch als dies, ihm die zur Regeneration des Alten und zur Erhaltung
der altehrwürdigen Institutionen nötigen Mittel zur Verfügung stellten.
Ja, es leben dort noch Schüler aus der Hamburg'schen Schule, welchen von
ihrem großen Meister nicht nur dessen Genialität in Bezug auf Tora,
sondern auch seine unbeschreibliche Charaktergröße, besonders wie man um
jeden Preis jemand wird, der sich mit den öffentlichen Bedürfnissen
in Wahrheit beschäftigt (frei übertragen), sein muss,
lernten. So wurden vor 8 Jahren die Straßenlaternen, welche als
Sabbatbegrenzungen benutzt wurden, von der Stadtbehörde entfernt und
Gasbeleuchtung dafür eingerichtet. Diese kleine Gemeinde, nur ein sehr
kleiner Teil von der dortigen, ca. 700 Familien zählenden, erwirkte, dass
ganz neue Sabbatbegrenzungen, gemäß den Vorschriften unserer Weisen
seligen Angedenkens - angebracht worden. Die Unterrichtsanstalt,
welche von einer kleinen Anzahl dieser Gemeinde gegründet wurde,
berechtigt unter der Direktion des Dr. Sig. Auerbach zu den größten
Hoffnungen und wird dadurch die Liebe zur Tora und das Lernen
der Tora so recht von Grund auf anerzogen, indem in dieser 'israelitischen
Bürgerschule' nicht nur dem Geiste der Zeit auf das Rigoroseste
Rechnung getragen, sondern auch gründlicher Unterricht in Tanach
(Bibel), Mischna und Gemara erteilt wird, was hier etwas seit
vielen Jahren Unerhörtes ist. Aber diese Jehudim wissen auch Opfer
zu bringen; sie legen auf den Altar dieser heiligsten aller Gebote
(Mizwot) einen jährlichen Zuschuss von ca. 4.000 Gulden. Was diese
wenigen Männer mit Gottes Hilfe tun, glaubt man kaum, dies und so
mancher Andere echt jüdische kommt jedoch nicht unmittelbar hierher;
jedoch ist dies wieder ein sehr erhebendes Beispiel dafür: erstens, dass
der Jehudi eben alles kann, was er will, zweitens, wie viel an der
zähen edlen Tätigkeit auch nur eines Einzelnen für das Gesamtjudentum
gelegen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai
1866: "Noch einmal über die Jeschiba-Angelegenheit. Von Dr.
J(srael).
Hildesheimer. ... In Mittelfranken befindet sich a. Schwabach ... b. Fürth,
eine hochaufrichtende Erscheinung. Wem wäre nicht das Rischut (die
Schlechtigkeit) bekannt, welches die verfolgungssüchtigen Reformer mit
unerhörtester Frechheit auf Süddeutschland ausgeübt. In Fürth hat man
unter Mephistophelischem Hohngelächter die nach Hunderten zählende Jeschiwa
des Rabbi Wolf Hamburger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen
- zerstört, und die Schüler in alle Ecken und Enden zerstreut.
Natürlich, so lange man noch eine 'talmudische Melodie' hört, kann die
Reform, welche nur bei absoluter Ignoranz ihrer Laien leben kann, nicht zu
Ruhe kommen. Fürth aber hat sich wieder ermannt; sagen wir es nur gleich;
es hat sich vorzüglich durch den festen Willen eines Mannes Rabbiner
Menke Zimmer - seine Licht leuchte - ermannt. Ihm allein wäre
natürlich, was erreicht wurde, nicht möglich gewesen, wenn nicht viele
wackere Mitglieder ihm unbedingtes Vertrauen entgegentrugen, weit mehr
aber noch als dies, ihm die zur Regeneration des Alten und zur Erhaltung
der altehrwürdigen Institutionen nötigen Mittel zur Verfügung stellten.
Ja, es leben dort noch Schüler aus der Hamburg'schen Schule, welchen von
ihrem großen Meister nicht nur dessen Genialität in Bezug auf Tora,
sondern auch seine unbeschreibliche Charaktergröße, besonders wie man um
jeden Preis jemand wird, der sich mit den öffentlichen Bedürfnissen
in Wahrheit beschäftigt (frei übertragen), sein muss,
lernten. So wurden vor 8 Jahren die Straßenlaternen, welche als
Sabbatbegrenzungen benutzt wurden, von der Stadtbehörde entfernt und
Gasbeleuchtung dafür eingerichtet. Diese kleine Gemeinde, nur ein sehr
kleiner Teil von der dortigen, ca. 700 Familien zählenden, erwirkte, dass
ganz neue Sabbatbegrenzungen, gemäß den Vorschriften unserer Weisen
seligen Angedenkens - angebracht worden. Die Unterrichtsanstalt,
welche von einer kleinen Anzahl dieser Gemeinde gegründet wurde,
berechtigt unter der Direktion des Dr. Sig. Auerbach zu den größten
Hoffnungen und wird dadurch die Liebe zur Tora und das Lernen
der Tora so recht von Grund auf anerzogen, indem in dieser 'israelitischen
Bürgerschule' nicht nur dem Geiste der Zeit auf das Rigoroseste
Rechnung getragen, sondern auch gründlicher Unterricht in Tanach
(Bibel), Mischna und Gemara erteilt wird, was hier etwas seit
vielen Jahren Unerhörtes ist. Aber diese Jehudim wissen auch Opfer
zu bringen; sie legen auf den Altar dieser heiligsten aller Gebote
(Mizwot) einen jährlichen Zuschuss von ca. 4.000 Gulden. Was diese
wenigen Männer mit Gottes Hilfe tun, glaubt man kaum, dies und so
mancher Andere echt jüdische kommt jedoch nicht unmittelbar hierher;
jedoch ist dies wieder ein sehr erhebendes Beispiel dafür: erstens, dass
der Jehudi eben alles kann, was er will, zweitens, wie viel an der
zähen edlen Tätigkeit auch nur eines Einzelnen für das Gesamtjudentum
gelegen." |
Die
Diskussion um eine orthodox geprägte jüdische Schule auf dem Hintergrund der
Spannungen zwischen Liberalen und Orthodoxen in der Gemeinde (1860/61)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Dezember 1860: "Fürth,
im November. Endlich nach mehreren Wochen währendem Kampfe, nach
verschiedenen Plänkeleien, Evolutionen und Scharmützeln, machte eine
dreitägige Schlacht (18., 19. und 20. dieses Monats) zwischen den zwei
Parteien, in welche die hiesige israelitische Gemeinde geteilt ist,
geschlagen, wobei die eine, spottweise 'die schwarze' genannt, ungeachtet
sie sich weißer Wahlzettel bediente, unterlag. Nach einem öffentlichen
Ausschreiben des hiezu als Wohlkommissär ernannten ersten rechtskundigen
Bürgermeisters sollten nach zurückgelegter ehrenwerter Amtsführung
abtretender Verwaltungsglieder Ersatzwahlen für drei Vorstandsmitglieder
und fünf zu dem größeren Verwaltungsausschusse gehörige Personen
vorgenommen werden. Nach dem gesetzlich formulierten Wahlmodus hatten die
411 berechtigten Votanten 49 Wahlmänner zu wählen, diese fünf
Mitglieder des Verwaltungsausschusses zu ernennen, worauf das ganze aus 15
Mitgliedern bestehende Verwaltungskollegium die drei Vorstandsmitglieder
zu wählen hatte. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Dezember 1860: "Fürth,
im November. Endlich nach mehreren Wochen währendem Kampfe, nach
verschiedenen Plänkeleien, Evolutionen und Scharmützeln, machte eine
dreitägige Schlacht (18., 19. und 20. dieses Monats) zwischen den zwei
Parteien, in welche die hiesige israelitische Gemeinde geteilt ist,
geschlagen, wobei die eine, spottweise 'die schwarze' genannt, ungeachtet
sie sich weißer Wahlzettel bediente, unterlag. Nach einem öffentlichen
Ausschreiben des hiezu als Wohlkommissär ernannten ersten rechtskundigen
Bürgermeisters sollten nach zurückgelegter ehrenwerter Amtsführung
abtretender Verwaltungsglieder Ersatzwahlen für drei Vorstandsmitglieder
und fünf zu dem größeren Verwaltungsausschusse gehörige Personen
vorgenommen werden. Nach dem gesetzlich formulierten Wahlmodus hatten die
411 berechtigten Votanten 49 Wahlmänner zu wählen, diese fünf
Mitglieder des Verwaltungsausschusses zu ernennen, worauf das ganze aus 15
Mitgliedern bestehende Verwaltungskollegium die drei Vorstandsmitglieder
zu wählen hatte.
Sie sehen, verehrter Herr Redakteur! dass eine streng gesetzliche Form
beobachtet wurde, was mit umso größerem Danke Anerkennung verdient, als
Alles ex officio und somit diätenfrei geschieht. An den Urwählern lag es
sonach, Männer in den 49. Ausschuss zu bringen, von deren orthodoxen oder
reformistischen Gesinnungen und Bestrebungen man überzeugt war, dass sie
die Tendenz ihrer Partei vertreten und hiernach Mitglieder in den engern (Verwaltungs-)Ausschuss
wählen. Zu diesem wurden beiderseitig mehrfache Vorversammlungen
abgehalten. Programme ausgegeben, Verbesserung der Schulen,
einerseits auch des Kultus, verheißen usw. Die Partei 'der Alten' war
insofern im Vorteile, als sich eine die wundern Flecken nur zu sehr
erkennende und deren Heilung herzlich wünschende zahlreiche Mittelpartei
zu ihr schlug, und sie sich daher einer absoluten Majorität vergewissert
halten durfte. Eine unzeitige Proposition, aber, dass nämlich in der öffentlichen
Unterrichtsanstalt Mischnah und Gemara gelehrt werden sollte, rief
einen gewaltigen Sturm und eine unglückliche Zersplitterung hervor, und
die Mittelpartei sagte sich los, der der 'Weißen' sich anschließend.
Beregter Vorschlag kann schon deshalb ein höchst unzeitgemäßer genannt
werden, als vorerst von einem gründlichen elementarischen
Religionsunterricht, als: richtiges, geläufiges Lesen, Übersetzen und
Verständnis von Tora und Propheten u.m. dergleichen die Rede (Anmerkung
der Redaktion. Wir können unserm geehrten Korrespondenten nicht
beistimmen; eine wahrhaft jüdische Schule muss gleich bei ihrer Gründung
die Kenntnis der mündlichen lehre mindestens in Aussicht stellen) |
 sein sollte. - Trotz der obwaltenden Sprengung würden jedoch die
'Schwarzen' obgesiegt haben, da auch auf gegnerischer Seite Spaltungen zur
Erscheinung kamen, hätten sie nicht, unbegreiflicher Weise in Sicherheit
sich wähnend, ihre Stimmen, anstatt den auf den von ihnen selbst
ausgegangenen Zetteln vorgeschlagenen Namen, vereinzelten, willkürlich
aus der Wahlliste entnommenen Mitgliedern zugewendet, während ihre
Antagonisten, kompakt zusammenhaltend, einen seltenen Eifer entwickelten,
Entfernte eiligst herbeiriefen, Kranke mittelst Fuhrwerks zur Abstimmung
kommen ließen usw. Die Folge dieser Nachlässigkeit einerseits und dieses
einmütigen Strebens andererseits war, dass weder in den 49. noch in den
eigentlichen Verwaltungsausschuss Einer der ihrigen durchzusetzen war.
Montag, den 26. schritt man zur Wahl der drei Vorstandsmitglieder und
diese fiel auf die Herren Bernhard Ullmann, Max Neubauer und Is. Wedeles,
zum Glücke Männer von Besonnenheit, Kenntnissen und vielfacher
Erfahrung, weder vom prinzipiellen Oppositionsgeiste beseelt noch für
rapide Reform eingenommen. - Die alten Römer hatten ihren überwundenen
Feinden Zeit und Raum gegönnt, wieder zu Atem zu kommen und sich sie hierdurch
zu befreunden. Nehme man Lehre an und befolge denselben Grundsatz. Mögen
die von den beiden Parteien gewählten Farben zu ihren Wahlzetteln - blau
und weiß - ein gutes Omen zur Verständigung sein, wie sie unter der
Wittelsbacher glorreichen Aegide schon so lange das Zeichen des Segens und
der Volkswohlfahrt sind. Wir aber rufen: (hebräisch und deutsch:) Liebet
die Wahrheit, liebet den Frieden!
Sch."
sein sollte. - Trotz der obwaltenden Sprengung würden jedoch die
'Schwarzen' obgesiegt haben, da auch auf gegnerischer Seite Spaltungen zur
Erscheinung kamen, hätten sie nicht, unbegreiflicher Weise in Sicherheit
sich wähnend, ihre Stimmen, anstatt den auf den von ihnen selbst
ausgegangenen Zetteln vorgeschlagenen Namen, vereinzelten, willkürlich
aus der Wahlliste entnommenen Mitgliedern zugewendet, während ihre
Antagonisten, kompakt zusammenhaltend, einen seltenen Eifer entwickelten,
Entfernte eiligst herbeiriefen, Kranke mittelst Fuhrwerks zur Abstimmung
kommen ließen usw. Die Folge dieser Nachlässigkeit einerseits und dieses
einmütigen Strebens andererseits war, dass weder in den 49. noch in den
eigentlichen Verwaltungsausschuss Einer der ihrigen durchzusetzen war.
Montag, den 26. schritt man zur Wahl der drei Vorstandsmitglieder und
diese fiel auf die Herren Bernhard Ullmann, Max Neubauer und Is. Wedeles,
zum Glücke Männer von Besonnenheit, Kenntnissen und vielfacher
Erfahrung, weder vom prinzipiellen Oppositionsgeiste beseelt noch für
rapide Reform eingenommen. - Die alten Römer hatten ihren überwundenen
Feinden Zeit und Raum gegönnt, wieder zu Atem zu kommen und sich sie hierdurch
zu befreunden. Nehme man Lehre an und befolge denselben Grundsatz. Mögen
die von den beiden Parteien gewählten Farben zu ihren Wahlzetteln - blau
und weiß - ein gutes Omen zur Verständigung sein, wie sie unter der
Wittelsbacher glorreichen Aegide schon so lange das Zeichen des Segens und
der Volkswohlfahrt sind. Wir aber rufen: (hebräisch und deutsch:) Liebet
die Wahrheit, liebet den Frieden!
Sch." |
Weiterer
Bericht mit Kritik an dem
eben zitierten Artikel (1861)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1861:
"Fürth, 30. Dezember (1860). Liebt die Wahrheit, liebet den Frieden!
Mit diesen Worten schließt der Sch. Korrespondent seinen Bericht über
die dahier stattgefundene Gemeindewahl in Nro. 31 Ihres sehr geschätzten
Blattes. - Während wir aber jenen inhaltsschweren Zuruf, das Palladium
unserer Religion, an die Spitze unserer gegenwärtigen Berichtigung
stellen, hütet sich Korrespondent wohlweislich, dasselbe zu tun, nimmt es
vielmehr als hinkenden Boten ins Schlepptau und darin tat er auch klug;
denn wer mit dem Hergange jener Angelegenheit vertraut ist, weiß gar
wohl, dass der fragliche Bericht sowohl von Wahrheit als von Friede
gar weit entfernt ist.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1861:
"Fürth, 30. Dezember (1860). Liebt die Wahrheit, liebet den Frieden!
Mit diesen Worten schließt der Sch. Korrespondent seinen Bericht über
die dahier stattgefundene Gemeindewahl in Nro. 31 Ihres sehr geschätzten
Blattes. - Während wir aber jenen inhaltsschweren Zuruf, das Palladium
unserer Religion, an die Spitze unserer gegenwärtigen Berichtigung
stellen, hütet sich Korrespondent wohlweislich, dasselbe zu tun, nimmt es
vielmehr als hinkenden Boten ins Schlepptau und darin tat er auch klug;
denn wer mit dem Hergange jener Angelegenheit vertraut ist, weiß gar
wohl, dass der fragliche Bericht sowohl von Wahrheit als von Friede
gar weit entfernt ist.
Das Programm der orthodoxen Partei bezeichnete er das zu erstrebende
Ziel: die Gründung einer öffentlichen Schule, in welcher die
entsprechenden Lehrkräfte zu finden sein sollen, um als ein organisches
Ganze alle Klassen des jüdischen Publikums dahier befriedigen zu können.
Dass hiermit denjenigen Familienvätern, die gar wohl wissen, dass ein
gründlicher, ersprießlicher Religionsunterricht ohne Quellenstudium
nicht erzielt werden könne, Gelegenheit geboten werden sollte, ihren
Kindern auch den erforderlichen Unterricht in Mischnah und Talmud erteilen
lassen zu können, leuchtete wohl ein, nicht minder aber auch, dass die
Teilnahme an demselben durchaus nicht obligatorischer Natur sein sollte;
dennoch wurde in einer berufenen Versammlung, in welcher beide Parteien
vertreten waren, eine spezielle Erklärung in diesem Sinne abgegeben.
Nichts destoweniger rückte hierauf der Führer einer andern Partei mit
einem schon fabrizierten Programme hervor, in welchem eine feierliche
Verwahrung gegen Errichtung einer solchen Schule, in der 'unzeitgemäße
Gegenstände' gelehrt werden sollten, figurierte. Auf die Anfrage, welche
Gegenstände es seien, gegen die man mit Feuer und Schwert zu ziehen
trachte, lautete die Antwort: 'Mischnah und Talmud', diese bezeichnete man
als 'unzeitgemäße Gegenstände' und verlangte hierbei die Genehmigung
eines solchen Programms von Männern, die bisher das Talmudstudium nach
Kräften treulich und mit großen Opfern gepflegt und mit fast
beispielloser Ausdauer für die Grundsätze des orthodoxen Judentums 30
Jahre lang gekämpft haben; von Männern, an deren Lebenswandel kein Makel
haftet, daher ihnen auch die Achtung der beiden Parteien nicht versagt
werden kann; musste also ein so frivoles Ansehen nicht mit Entrüstung
zurückgewiesen werden? Und diese pflichtmäßige Zurückweisung nennt
Korrespondent eine unzeitige Proposition (!!) und jenen Führer zählt er
zur Mittelpartei! Das Eine ist gerade so richtig als das Andere. - Der
weitere Verlauf des Wahlkampfes dokumentierte auch vollständig diese
unsere Ansicht, denn nach diesem Zwischenfall ging eine
allgemein |
 beliebte
Person, welche bei streng religiösen Grundsätzen in Wahrheit zur
Mittelpartei zählt, daher auch gleichsam von beiden Parteien an die
Spitze zur Erzielung einer Einigung berufen ward, nach bitterer
Enttäuschung zur orthodoxen Partei zurück, sobald sie (jene Person) sich
von den gegnerischen Absichten aus eigener Anschauung überzeugt hatte;
jener Führer mit seiner Partei aber hatten unter der Zeit schon schleunigst
die Larve abgeworfen und sich jener Partei wieder angeschlossen, von der
sie gleichsam nur zum Rekognoszieren des Schlachtfeldes hergesandt zu sein
schienen; nicht aber, dass die wirkliche Mittelpartei sich von den
Orthodoxen losgesagt hätte. Warum aber diese dennoch nicht gesiegt haben,
wollen wir hier nicht erörtern, da bei uns Wahrheit und Friede kein
leeres Wortgepränge ist, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Umstände
aber den Frieden nicht fördern
würde." beliebte
Person, welche bei streng religiösen Grundsätzen in Wahrheit zur
Mittelpartei zählt, daher auch gleichsam von beiden Parteien an die
Spitze zur Erzielung einer Einigung berufen ward, nach bitterer
Enttäuschung zur orthodoxen Partei zurück, sobald sie (jene Person) sich
von den gegnerischen Absichten aus eigener Anschauung überzeugt hatte;
jener Führer mit seiner Partei aber hatten unter der Zeit schon schleunigst
die Larve abgeworfen und sich jener Partei wieder angeschlossen, von der
sie gleichsam nur zum Rekognoszieren des Schlachtfeldes hergesandt zu sein
schienen; nicht aber, dass die wirkliche Mittelpartei sich von den
Orthodoxen losgesagt hätte. Warum aber diese dennoch nicht gesiegt haben,
wollen wir hier nicht erörtern, da bei uns Wahrheit und Friede kein
leeres Wortgepränge ist, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Umstände
aber den Frieden nicht fördern
würde." |
Über die
Einweihung der Bürgerschule in Fürth und die Eröffnungsrede von Direktor Dr.
Selig Auerbach (1862)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November
1862: "Fürth, den 29. Oktober (1862). Fast sind es zwei
Jahre, dass wir Ihnen, hochgeehrter Herr Redakteur, über die
beabsichtigte Gründung einer öffentlichen Schule seitens der orthodoxen
Partei dahier Näheres mitzuteilen hatten; wir freuen uns nun, Ihnen jetzt
die frohe Kunde bringen zu können, dass die feierliche Eröffnung dieser
Schule dahier heute auch stattgefunden hat. Auf die erfolgte Einladung hin
kamen wir zur bestimmten Stunde - 10 Uhr vormittags - in das Schullokal
und fanden daselbst eine große Anzahl der hiesigen israelitischen Bürger
versammelt, darunter auch Herrn Rabbiner Dr. Löwi. Auch der Königliche
Bezirksinspektor, Herr Pfarrer Röder, hatte sich - die königliche
städtische Schulkommission vertretend - dort eingefunden. Von dem hohen
Ziele, das die Begründer dieser Anstalt dabei zu erreichen gedenken,
genaue Kenntnis habend, waren wir auf die Eröffnungsrede gespannt,
um die an uns gestellte Frage: ob man in der Person des Herrn Dr.
Auerbach den entsprechenden Mann gefunden, der diesem hochgesteckten
Ziele gewachsen sei, beantworten zu können, und freuen wir uns in der
Tat, dass wir nun diese Frage mit voller Sicherheit zu bejahen vermögen,
da wir nicht nur in hohem Maße befriedigt, sondern unsere Erwartungen
weit übertroffen wurden. Herr Direktor Dr. Auerbach gab in vollendeter
Klarheit Aufschluss über den Plan der neuen Anstalt und gestehen wir
gerne, dass die darin entwickelten Ansichten durch ihre überzeugende
Darstellung und konsequente Durchführung nicht verfehlten, den tiefsten
Eindruck bei den Zuhörern zu hinterlassen. Wir sind nicht imstande, die
Fülle der in der meisterhaften Rede niedergelegten Gedanken wiederzugeben
und begnügen uns daher im Allgemeinen, den Gang der Rede anzudeuten.
Nachdem der Redner die Aufgabe der neuen Schule dahin definiert, dass
dieselbe tüchtige Bürger und wahrhafte Juden heranbilden wolle, ging er
sämtliche Unterrichtsgegenstände der hohen Bürgerschule durch, um an
jedem Einzelnen nachzuweisen, wie derselbe zu einer echt humanen
Ausbildung des Schülers zu verwenden sei. Am längsten verweilte die Rede
bei dem Religionsunterrichte, nicht als ob diese Schule auf diesen allein
ihr vorzügliches Augenmerk zu richten gedächte, sondern nur um
darzulegen, dass, soferne der Geiste, der eine Schule durchzieht,
gleichsam von dem Religionsunterrichte ausgeht und die hohe Bedeutung der
Religion als das höchste Gut des Menschen anerkannt werden muss, die
jüdische Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November
1862: "Fürth, den 29. Oktober (1862). Fast sind es zwei
Jahre, dass wir Ihnen, hochgeehrter Herr Redakteur, über die
beabsichtigte Gründung einer öffentlichen Schule seitens der orthodoxen
Partei dahier Näheres mitzuteilen hatten; wir freuen uns nun, Ihnen jetzt
die frohe Kunde bringen zu können, dass die feierliche Eröffnung dieser
Schule dahier heute auch stattgefunden hat. Auf die erfolgte Einladung hin
kamen wir zur bestimmten Stunde - 10 Uhr vormittags - in das Schullokal
und fanden daselbst eine große Anzahl der hiesigen israelitischen Bürger
versammelt, darunter auch Herrn Rabbiner Dr. Löwi. Auch der Königliche
Bezirksinspektor, Herr Pfarrer Röder, hatte sich - die königliche
städtische Schulkommission vertretend - dort eingefunden. Von dem hohen
Ziele, das die Begründer dieser Anstalt dabei zu erreichen gedenken,
genaue Kenntnis habend, waren wir auf die Eröffnungsrede gespannt,
um die an uns gestellte Frage: ob man in der Person des Herrn Dr.
Auerbach den entsprechenden Mann gefunden, der diesem hochgesteckten
Ziele gewachsen sei, beantworten zu können, und freuen wir uns in der
Tat, dass wir nun diese Frage mit voller Sicherheit zu bejahen vermögen,
da wir nicht nur in hohem Maße befriedigt, sondern unsere Erwartungen
weit übertroffen wurden. Herr Direktor Dr. Auerbach gab in vollendeter
Klarheit Aufschluss über den Plan der neuen Anstalt und gestehen wir
gerne, dass die darin entwickelten Ansichten durch ihre überzeugende
Darstellung und konsequente Durchführung nicht verfehlten, den tiefsten
Eindruck bei den Zuhörern zu hinterlassen. Wir sind nicht imstande, die
Fülle der in der meisterhaften Rede niedergelegten Gedanken wiederzugeben
und begnügen uns daher im Allgemeinen, den Gang der Rede anzudeuten.
Nachdem der Redner die Aufgabe der neuen Schule dahin definiert, dass
dieselbe tüchtige Bürger und wahrhafte Juden heranbilden wolle, ging er
sämtliche Unterrichtsgegenstände der hohen Bürgerschule durch, um an
jedem Einzelnen nachzuweisen, wie derselbe zu einer echt humanen
Ausbildung des Schülers zu verwenden sei. Am längsten verweilte die Rede
bei dem Religionsunterrichte, nicht als ob diese Schule auf diesen allein
ihr vorzügliches Augenmerk zu richten gedächte, sondern nur um
darzulegen, dass, soferne der Geiste, der eine Schule durchzieht,
gleichsam von dem Religionsunterrichte ausgeht und die hohe Bedeutung der
Religion als das höchste Gut des Menschen anerkannt werden muss, die
jüdische |
 Bürgerschule
- die ganze Menschen und wahrhafte Juden heranzubilden beabsichtigt -
ihren Religionsunterricht nicht darauf beschränken dürfe, ihren
Schülern bloße Kenntnis der hebräischen Sprache, der Bibel und der
jüdischen Geschichte beizubringen, dass sie vielmehr die Religion in
ihrer ewigen Wahrheit und Reinheit vor die Seele der Jugend führen, die
hohen Lehren derselben vor dem jugendlichen Geiste entfalten müsse, damit
ewige Liebe zu dem väterlichen Glauben im Innersten der Seele feste
Wurzeln fasse. Dieses Ziel kann aber nur dann erreicht werden, wenn man
die Schüler zu den Quellen der jüdischen Religion und der jüdischen Geschichte
hinführt und sie hieraus selbst schöpfen lässt. Und auf traditionellem
Boden stehend, müssen die Schüler auch die göttliche, nciht minder ewig
bindende mündliche Lehre an der Quelle kennen lernen, weswegen es sich
die jüdische Schule angelegen sein lassen müsse, den reiferen Schülern
das große Meer des jüdischen Schriftentums zu erschließen. Bürgerschule
- die ganze Menschen und wahrhafte Juden heranzubilden beabsichtigt -
ihren Religionsunterricht nicht darauf beschränken dürfe, ihren
Schülern bloße Kenntnis der hebräischen Sprache, der Bibel und der
jüdischen Geschichte beizubringen, dass sie vielmehr die Religion in
ihrer ewigen Wahrheit und Reinheit vor die Seele der Jugend führen, die
hohen Lehren derselben vor dem jugendlichen Geiste entfalten müsse, damit
ewige Liebe zu dem väterlichen Glauben im Innersten der Seele feste
Wurzeln fasse. Dieses Ziel kann aber nur dann erreicht werden, wenn man
die Schüler zu den Quellen der jüdischen Religion und der jüdischen Geschichte
hinführt und sie hieraus selbst schöpfen lässt. Und auf traditionellem
Boden stehend, müssen die Schüler auch die göttliche, nciht minder ewig
bindende mündliche Lehre an der Quelle kennen lernen, weswegen es sich
die jüdische Schule angelegen sein lassen müsse, den reiferen Schülern
das große Meer des jüdischen Schriftentums zu erschließen.
Hierauf wies der Redner durch Schrift und Beispiel nach, wie falsch die
Behauptung sei, dass eine vielseitige und gründliche Bildung sich mit
vieler Religiosität und einem traditionellen Glauben nicht vereinigen
lasse, und beseitigte schlagend die verschiedenen Einwände, die gegen
diese Vereinigung gemacht werden, wobei er eine umfassende Kenntnis des
Talmuds und ein eminentes Wissen in der jüdischen Literatur bekundete.
Diese Stelle der Rede war auch die bedeutungsvollste und machte den
sichtbarsten Eindruck. Nachdem der Redner noch ausdrücklich hervorgehoben
hatte, |
Ausschreibung einer Lehrerstelle an der israelitischen
Bürgerschule - unter Direktor Selig Auerbach (1866)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Januar 1866: "Die israelitische Bürgerschule zu
Fürth sucht zum 1. Mai dieses Jahres gegen ansehnliches Gehalt einen
strengreligiösen Lehrer, der bei einer gründlichen allgemeinen Bildung
tüchtige Kenntnisse im Französischen und Englischen
besitzt. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Januar 1866: "Die israelitische Bürgerschule zu
Fürth sucht zum 1. Mai dieses Jahres gegen ansehnliches Gehalt einen
strengreligiösen Lehrer, der bei einer gründlichen allgemeinen Bildung
tüchtige Kenntnisse im Französischen und Englischen
besitzt.
Bewerber mit akademischer Bildung und Kenntnissen im Talmudischen erhalten
den Vorzug. Anfragen und Bewerbungen wolle man unter Einsendung der
Zeugnisse richten an
Dr. Sg. Auerbach, Direktor der israelitischen
Bürgerschule." |
Die
Einweihung des neuen Schulgebäudes der Bürgerschule (1869)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August
1869: "Fürth, 21. Juli (1869). Wie früher schon in diesen
Blättern erwähnt, haben die hiesigen Orthodoxen, als sie nach
Überwindung von vielen unsäglichen Schwierigkeiten die Gründung einer
Schule bewerkstelligt, in der ein den Zeitverhältnissen angemessener
Unterricht in Verbindung mit den für das jüdische Leben notwendigen Lehren
erteilt wird, durch fernere Bemühungen es dahin gebracht, dass ein
Kapital zusammenkam, mit dem man befähigt war, ein neues Gebäude zu
errichten, um dem Übelstande des Weilens in unzureichenden gemieteten
Lokalitäten ein Ende zu machen. Mit bewundernswerter Aufopferung ist
durch freiwillige Gaben so viel zusammengekommen, dass von den Kosten, die
der Ankauf des Grundstücks und der Neubau erforderte, bereits 3/4 gedeckt
sind, und kann man sich der gegründeten Hoffnung hingeben, dass auch der
noch fehlende Teil durch Wohltätigkeit bald ergänzt sein
wird. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August
1869: "Fürth, 21. Juli (1869). Wie früher schon in diesen
Blättern erwähnt, haben die hiesigen Orthodoxen, als sie nach
Überwindung von vielen unsäglichen Schwierigkeiten die Gründung einer
Schule bewerkstelligt, in der ein den Zeitverhältnissen angemessener
Unterricht in Verbindung mit den für das jüdische Leben notwendigen Lehren
erteilt wird, durch fernere Bemühungen es dahin gebracht, dass ein
Kapital zusammenkam, mit dem man befähigt war, ein neues Gebäude zu
errichten, um dem Übelstande des Weilens in unzureichenden gemieteten
Lokalitäten ein Ende zu machen. Mit bewundernswerter Aufopferung ist
durch freiwillige Gaben so viel zusammengekommen, dass von den Kosten, die
der Ankauf des Grundstücks und der Neubau erforderte, bereits 3/4 gedeckt
sind, und kann man sich der gegründeten Hoffnung hingeben, dass auch der
noch fehlende Teil durch Wohltätigkeit bald ergänzt sein
wird.
So ist denn unter Gottes Beistand und der Hilfe Edeldenkender der Bau
fertiggestellt und die innere Einrichtung hergestellt. Heute Vormittag
wurde das neue Schulgebäude feierlich eingeweiht.
Schon lange vor der zur Feier bestimmten Zeit versammelte sich Jung und
Alt, um seine Freude an |
 einem
gottgefälligen Werke sowohl an den Tag zu legen, als auch um zu zeigen,
dass man noch Gefallen habe an göttlichem Wort und an echt religiöser Erziehung.
Es offenbarte sich deutlich, dass der Kreis derjenigen, die sich um Gott
scharen und für Sein heiliges Wort zu opfern bereit sind, kein kleiner
sei, und dass es gottlob noch gar viele gebe, die an dem Bestand unserer
heiligen Religion Gefallen finden. So füllte sich bald der der Feier
gewidmete Raum. einem
gottgefälligen Werke sowohl an den Tag zu legen, als auch um zu zeigen,
dass man noch Gefallen habe an göttlichem Wort und an echt religiöser Erziehung.
Es offenbarte sich deutlich, dass der Kreis derjenigen, die sich um Gott
scharen und für Sein heiliges Wort zu opfern bereit sind, kein kleiner
sei, und dass es gottlob noch gar viele gebe, die an dem Bestand unserer
heiligen Religion Gefallen finden. So füllte sich bald der der Feier
gewidmete Raum.
Zur festgesetzten Zeit bestieg Herr Dr. Auerbach als Direktor der Anstalt
die Tribüne und legte in gewohnter Meisterschaft den Versammelten den
Zweck der Schule und die Erfordernisse für die Heranbildung zum Beruf
(hier vorzüglich für den kommerziellen dar). Es würde mich zu weit
führen, wollte ich auch nur kurz den Inhalt der Rede, die mehr als eine Stunde
währte, skizzieren; so reichlich waren die Gedanken und so vielerlei die
Gesichtspunkte, die der Redner hervorhob. Ich will daher nur einige
Sentenzen anfühlen, die nicht allein für hiesige Verhältnisse
angemessen sind, deren Wahrheit auch dem allgemeinen Wohle dienlich ist.
'Nicht das spezielle Heranbilden zu einem Berufe ist die Bestimmung der
Schule, obwohl es in jetziger Zeit der Berufsschulen in Menge gibt,
sondern neben einem ausgedehnteren Unterricht in besonderer Fachbildung
vorzüglich allgemeine Bildung durch ethische Wissenschaften; nicht das
ist der Maßstab für eine Schule, was der Zögling später mit dem
Erlernten erwerben kann, sondern die Bildung zum Menschen, dass der
Schüler, wenn er in das Leben eintritt, sich zu drehen und zu wenden
weiß. Und der Jude als solcher, dessen ganzes Leben durchdrungen sein
soll von göttlichem Hauche, dessen Handlungen alle als Gottes-Gebote
geschehen sollen - alle eure Taten seien zur Ehre Gottes - sein
Unterricht soll ein derartiger sein, dass die Kenntnis der schriftlichen
und mündlichen Tora nicht allein zu seinen Disziplinen gehöre, sondern
dass der Gesamt-Unterricht seine Ergänzung und Begrenzung finde durch die
Religion. Und wenn in solcher Weise eine Schule eine rein konfessionelle
ist, so kann und darf ihr Streben doch kein anderes sein als - allgemeine
Menschenliebe zu erwecken, wie bekanntlich Hillel dieses Gebot als die
Wurzel aller andern jenem Heiden mitteilte.'
Anreihend an diese Worte sprach sodann Herr Rabbiner Dr. Löwi innige
Wünsche für das fernere Gedeihen der Anstalt aus und hoffte, dass mit
der Zeit das neue Haus sei ein Haus voll mit allem Guten, das
hervorgebracht religiös-sittliche Männer.
Zum Schlusse richtete noch Herr Stadtpfarrer Lehmus einige Worte an die
Versammlung, in denen er seine Zustimmung aussprach zu den Grundsätzen,
die von dem ersten Herrn Redner entwickelt waren.
Auf die Zuhörer hatten die von Herzen zu Herzen gesprochenen Worte einen
sichtlichen Eindruck hervorgebracht, und Jeder ging mit dem Bewusstsein
fort, dass es sich bei der Wahl einer Schule für die Erziehung seines
Kindes nicht darum handele, in welcher Schule am meisten für den
späteren Beruf desselben geschieht, sondern lediglich darum, wie die
Lehren ihnen beigebracht werden, die sie zu wahrhaften Menschen
herzubilden geeignet sind. Wahrheit."
|
Zum
Tod von Rabbiner Dr. Selig Auerbach (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901: "Fürth.
(hebräisch und deutsch:) Frage Deinen Vater, er wird Dir es verkünden.
Deine Alten, sie werde es Dir sagen, warum besonders in unserer Stadt die
traurige Nachricht vom Hinscheiden des Herrn Rabbiners Dr. Auerbach
seligen Andenkens so große Teilnahme und Betrübnis erweckte. Hatten wir
doch ca. zehn Jahre das Glück, uns an dem Lichte dieses großen Mannes zu
erfreuen; hier begann seine bedeutende Laufbahn, als er sich im Jahre 1862
bereit erklärte, seine ganze jugendliche Kraft dem Gedanken zu widmen,
eine jüdische Bürgerschule nach seinem Sinne zu gründen und als
deren Leiter sie dem vorgesteckten Ziele zuzuführen. Man braucht den
Verstorbenen nicht persönlich gekannt zu haben, man braucht nur die
Begeisterung für ihn bei allen seinen Schülern und zahlreichen Freunden
zu bewundern, und die ersprießlichen Erfolge seiner hiesigen Tätigkeit
zu ermessen, um die Bedeutung dieses Großen seines Geschlechts zu
erfassen. Er verstand es seine Schüler zu begeistern, sodass sie nicht
dem Zwange gehorchend, sondern mit Freude dem Studium der Tora herankamen;
immer größer und größer wurde der Kreis von jungen Leuten und Hausvätern,
die bezaubert von seiner Liebenswürdigkeit, hingerissen von seinem Geiste
und seinem tiefen Wissen, alles im Stiche ließen, um ihm in sein
Lehrzimmer zu folgen und seinen interessanten Vorträgen zu lauschen.
Seine Lieblingsidee scheint es gewesen zu sein, und darauf war
hauptsächlich sein Augenmerk gerichtet, bei den jungen Kaufleuten die
Liebe für die Tora zu erwecken und sie zu echten Jehudim heranzuziehen,
und es war ihm kein Opfer zu schwer, keine Stunde zu früh und keine
Stunde zu spät, um sie nicht mit Freude dem Studium der Tora zu widmen.
'Nicht lernen können', sagte er oft, 'ist ein Fehler, lernen wollen,
macht diesen Fehler wieder gut.' So verstand er es, jeden Einzelnen in
seinem Bestreben, Tora zu lernen, zu bestärken, und so für das wahre Judentum
zu gewinnen. Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, wie unermüdlich
und unverdrossen sich der Verblichene in großer Wohltätigkeit den
hiesigen Armen sowohl als besonders auch den durchziehenden Gästen
gegenüber gezeigt hat. Niemand betrat vergeblich seine Schwelle, ja, er
gab noch besonderen Auftrag, kein Armer sollte die Stadt verlassen, ohne
seine Unterstützung und Gastfreundschaft in Anspruch genommen zu
haben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901: "Fürth.
(hebräisch und deutsch:) Frage Deinen Vater, er wird Dir es verkünden.
Deine Alten, sie werde es Dir sagen, warum besonders in unserer Stadt die
traurige Nachricht vom Hinscheiden des Herrn Rabbiners Dr. Auerbach
seligen Andenkens so große Teilnahme und Betrübnis erweckte. Hatten wir
doch ca. zehn Jahre das Glück, uns an dem Lichte dieses großen Mannes zu
erfreuen; hier begann seine bedeutende Laufbahn, als er sich im Jahre 1862
bereit erklärte, seine ganze jugendliche Kraft dem Gedanken zu widmen,
eine jüdische Bürgerschule nach seinem Sinne zu gründen und als
deren Leiter sie dem vorgesteckten Ziele zuzuführen. Man braucht den
Verstorbenen nicht persönlich gekannt zu haben, man braucht nur die
Begeisterung für ihn bei allen seinen Schülern und zahlreichen Freunden
zu bewundern, und die ersprießlichen Erfolge seiner hiesigen Tätigkeit
zu ermessen, um die Bedeutung dieses Großen seines Geschlechts zu
erfassen. Er verstand es seine Schüler zu begeistern, sodass sie nicht
dem Zwange gehorchend, sondern mit Freude dem Studium der Tora herankamen;
immer größer und größer wurde der Kreis von jungen Leuten und Hausvätern,
die bezaubert von seiner Liebenswürdigkeit, hingerissen von seinem Geiste
und seinem tiefen Wissen, alles im Stiche ließen, um ihm in sein
Lehrzimmer zu folgen und seinen interessanten Vorträgen zu lauschen.
Seine Lieblingsidee scheint es gewesen zu sein, und darauf war
hauptsächlich sein Augenmerk gerichtet, bei den jungen Kaufleuten die
Liebe für die Tora zu erwecken und sie zu echten Jehudim heranzuziehen,
und es war ihm kein Opfer zu schwer, keine Stunde zu früh und keine
Stunde zu spät, um sie nicht mit Freude dem Studium der Tora zu widmen.
'Nicht lernen können', sagte er oft, 'ist ein Fehler, lernen wollen,
macht diesen Fehler wieder gut.' So verstand er es, jeden Einzelnen in
seinem Bestreben, Tora zu lernen, zu bestärken, und so für das wahre Judentum
zu gewinnen. Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, wie unermüdlich
und unverdrossen sich der Verblichene in großer Wohltätigkeit den
hiesigen Armen sowohl als besonders auch den durchziehenden Gästen
gegenüber gezeigt hat. Niemand betrat vergeblich seine Schwelle, ja, er
gab noch besonderen Auftrag, kein Armer sollte die Stadt verlassen, ohne
seine Unterstützung und Gastfreundschaft in Anspruch genommen zu
haben.
Meine Feder ist zu schwach, um alle die Verdienste des Verblichenen,
besonders jene, die sich der Verstorbene um die hiesige Schule erworben,
entsprechend zu würdigen, und will ich nur noch bemerken, dass die von
ihm ins Leben gerufene jüdische Bürgerschule in seinem Sinne bisher
weiter geführt wurde und dass auch diesbezügliche Garantien für die
Zukunft vorhanden sind." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901:
"Aus Bayern, 26. September (1901). (hebräisch und deutsch aus
Jeremia 14,17): 'Tränen entströmen meinen Augen Tag und Nacht und
sind nicht zu stillen, denn einen großen Schaden hat die jungfräuliche
Tochter meines Volkes erlitten, einen sehr schweren Schlag.' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober 1901:
"Aus Bayern, 26. September (1901). (hebräisch und deutsch aus
Jeremia 14,17): 'Tränen entströmen meinen Augen Tag und Nacht und
sind nicht zu stillen, denn einen großen Schaden hat die jungfräuliche
Tochter meines Volkes erlitten, einen sehr schweren Schlag.'
Wenngleich am Grabe unseres unvergesslichen, leider zu früh der Erde
entrissenen Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens eine große Anzahl Redner
sich vernehmen ließen, so war es doch nur ein einziger, der dem teuren
Dahingeschiedenen im Namen derer, denen er in der ersten Kraft seiner
Jugend der treue Lehrer und Führer war, den letzten Scheidegruß entbot.
Da es jedoch eine größere Anzahl Schüler sind, die dem Verblichenen in
den ersten zehn Jahren seines Wirkens in Fürth so viel verdanken, möge
es noch einem derselben gestattet sein, auch an dieser Stelle das Andenken
des ausgezeichneten Mannes zu ehren. Zu einer Zeit, wo die meisten jungen
Leute noch zu Füßen ihrer Professoren und Rabbiner auf Universitäten
und Rabbinerschulen dem Studium obliegen, wurde Dr. Auerbach seligen
Andenkens auf eine Stelle berufen, zu der man gewöhnlich nur Männer mit langjährigen
Erfahrungen befähigt erachtete. Eine kleine Anzahl wahrhaft orthodoxer
Männer in Fürth beschloss Anfangs der 60er-Jahre des vorigen
Jahrhunderts, eine Schule zu gründen, wo neben profanen Wissenschaften
das Torastudium, wie nicht minder der Talmudunterricht gepflegt werden
sollte. Schwierig war die Aufgabe dieser Männer, allein das Ziel schien
diesen begeisterten Anhängern einer solch' heiligen Sache so erhaben,
dass sie kein Mittel scheuten, um den Plan zur Ausführung zu bringen. Zu
damaliger Zeit war in Deutschland kein Überfluss an Männern, welche
befähigt waren, eine solche Anstalt zu leiten, und es war daher für die
Fürther Herren doppelt schwer, zu einer Wahl zu gelangen, da ja auch die
pekuniäre Gegenleistung sich in nur sehr mäßigen Grenzen bewegen
konnte. Bei der Umschau nach einem solchen Manne wurde die Aufmerksamkeit
der Herren auch auf den erst 21-jährigen Dr. Selig Auerbach, der bereits
sein 'Doktor-Examen' und 'Thoras Harooh' (Anerkennung als Rabbiner) zu
dieser Zeit glänzend bestanden hatte, gelenkt; nach mehrfachen
Bemühungen gelang es, denselben für die Leitung zu gewinnen, ganz
besonders auch, weil es sein Vater seligen Andenkens gewünscht hatte. Er
selbst hätte zu gerne eine Zeit lang noch im Auslande seine Erfahrungen
und Kenntnisse bereichert, bescheiden, wie er war, glaubte er sich dem
Posten nicht gewachsen. Dass er es jedoch im höchsten Grade war, sollte
sich bald zeigen. In Fürth, das einst der Sitz großer Männer in Israel
war, war seit langer Zeit für besseren jüdischen Unterricht nichts
geschehen. Die Kinder mussten nichtjüdische Anstalten besuchen und nur
wenige Eltern haben ihren Kindern Privatunterricht im Hebräischen
erteilen lassen. Da erschien Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens mit
einigen Kollegen auf dem Platze (Herr Professor Dr. Werner, zur Zeit in
Frankfurt am Main, war einer seiner ersten tüchtigen Mitarbeiter) und
richtete eine Schule ein, deren Resultate alsbald zeigten, ein wie
trefflicher Mann der neue Direktor war. Es ist hier nicht der Platz, des
Näheren auszuführen, mit welchen Schwierigkeiten nach den
verschiedensten Richtungen der Verstorbene damals zu kämpfen hatte; seine
Energie, sein redliches Wollen blieben Sieger. Neben dem Jugendunterricht
stellte er sein reiches Wissen auch den Erwachsenen zur Verfügung und
seine Vorträge am Sabbatvormittag sind allgemein noch in bester
Erinnerung. Leider sollte sein Wirken bald eine Grenze in Fürth finden.
Durch den Tod seines großen Vaters seligen Andenkens wurde er 1872 auf
das Rabbinat in Halberstadt berufen. Was er da geleistet, wie er dort
gewirkt, mögen berufenere Federn seiner dortigen Schüler und Freunde
schildern. Der Samen, den er in Fürth ausgestreut, hat unter ihm und
unter seinem nicht minder hervorragenden Nachfolger, Herrn Dr. S. Dessau,
gute Früchte gezeitigt.
Diese wenigen Worte glaubte ein früherer Schüler und Verehrer des selig
Entschlafenen den Manen desselben widmen zu sollen. J.F." |
Gedächtnisfeier für Rabbiner Dr.
Selig Auerbach in der Israelitischen Realschule (1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November
1901: "Fürth, 11. November (1901). (Gedächtnisfeier in
der Israelitischen Realschule). In der Aula der Israelitischen
Realschule fand gestern Abend, 5 Uhr, vor zahlreich versammeltem Publikum
eine Gedächtnisfeier für den verewigten Herrn Rabbiner Dr. Auerbach seligen
Andenkens statt, der in den Jahren 1862 bis 1873 die Israelitische
Bürgerschule als Direktor geleitet hatte. Der derzeitige Direktor, Herr
Dr. Feilchenfeld, gab in dreiviertelstündigem Vortrage ein Bild von
der bedeutenden Persönlichkeit des Entschlafenen, seiner vielseitigen
Wirksamkeit für das Judentum und besonders einer segensreichen Tätigkeit
als Organisator und erster Leiter der 1862 gegründeten Israelitischen
Bürgerschule. Die Schule, die mit 42 Schülern eröffnet wurde, war
zuerst in Mieträumen in der Theaterstraße (im Hause der jetzigen Post),
vom zweiten Jahre ab in der Hirschenstraße, untergebracht. Die Frequenz
stieg in Folge des großen Vertrauens, das man dem jugendlichen
tatkräftigen Leiter entgegenbrachte, in wenigen Jahren auf 110 Schüler;
die Schule erwarb ein eigenes Haus in der Blumenstraße, das 1860 bezogen
wurde. Dr. Auerbach unterrichtete während der ersten Jahre in den
verschiedensten Fächern, namentlich in der Geschichte, der deutschen
Literatur und in den fremden Sprachen. Seine Haupttätigkeit aber wandte
er dem Religionsunterricht zu und wusste die Jugend für die heiligen
Schriften des Judentums ganz besonders zu erwärmen und zu begeistern.
Auch auf die Erwachsenen wirkte er durch regelmäßige religiöse
Vorträge, in denen sein reiches Wissen, seine innige Überzeugungstreue
und seine zündende Beredsamkeit in gleicher Weise zur Geltung kamen und
die Hörer mächtig ergriffen. Für den bedeutenden Einfluss der er hier
ausgeübt, spricht die treue Anhänglichkeit, die ihm zahlreiche hier und
auswärts lebende ehemalige Schüler bis an sein Lebensende bewahrt haben.
Sehr schmerzlich berührte es weite Kreise der hiesigen Gemeinde, als Dr.
Auerbach im Jahre 1873 einer Berufung nach Halberstadt folgte, um den dort
erledigten Rabbinersitz seines Vaters einzunehmen. Der Entschlafene hat
dort mehr als 28 Jahre rühmlichst gewirkt und eine führende Stellung
unter den deutschen Rabbinern erlangt. Immer aber hat er seine Beziehungen
zu Fürth aufrecht erhalten und sich seiner pädagogischen Tätigkeit
hier, die ihm so viele Freunde und Anhänger erworben hat, stets gern
erinnert. Am Schlusse des Vortrages wurde noch des vor einigen Monaten
verstorbenen eifrigen Vorstandsmitgliedes der Schule, Herrn Henoch
Zimmer, der für die Interessen der Schule mit großem Erfolge gewirkt
hatte, rühmend gedacht."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November
1901: "Fürth, 11. November (1901). (Gedächtnisfeier in
der Israelitischen Realschule). In der Aula der Israelitischen
Realschule fand gestern Abend, 5 Uhr, vor zahlreich versammeltem Publikum
eine Gedächtnisfeier für den verewigten Herrn Rabbiner Dr. Auerbach seligen
Andenkens statt, der in den Jahren 1862 bis 1873 die Israelitische
Bürgerschule als Direktor geleitet hatte. Der derzeitige Direktor, Herr
Dr. Feilchenfeld, gab in dreiviertelstündigem Vortrage ein Bild von
der bedeutenden Persönlichkeit des Entschlafenen, seiner vielseitigen
Wirksamkeit für das Judentum und besonders einer segensreichen Tätigkeit
als Organisator und erster Leiter der 1862 gegründeten Israelitischen
Bürgerschule. Die Schule, die mit 42 Schülern eröffnet wurde, war
zuerst in Mieträumen in der Theaterstraße (im Hause der jetzigen Post),
vom zweiten Jahre ab in der Hirschenstraße, untergebracht. Die Frequenz
stieg in Folge des großen Vertrauens, das man dem jugendlichen
tatkräftigen Leiter entgegenbrachte, in wenigen Jahren auf 110 Schüler;
die Schule erwarb ein eigenes Haus in der Blumenstraße, das 1860 bezogen
wurde. Dr. Auerbach unterrichtete während der ersten Jahre in den
verschiedensten Fächern, namentlich in der Geschichte, der deutschen
Literatur und in den fremden Sprachen. Seine Haupttätigkeit aber wandte
er dem Religionsunterricht zu und wusste die Jugend für die heiligen
Schriften des Judentums ganz besonders zu erwärmen und zu begeistern.
Auch auf die Erwachsenen wirkte er durch regelmäßige religiöse
Vorträge, in denen sein reiches Wissen, seine innige Überzeugungstreue
und seine zündende Beredsamkeit in gleicher Weise zur Geltung kamen und
die Hörer mächtig ergriffen. Für den bedeutenden Einfluss der er hier
ausgeübt, spricht die treue Anhänglichkeit, die ihm zahlreiche hier und
auswärts lebende ehemalige Schüler bis an sein Lebensende bewahrt haben.
Sehr schmerzlich berührte es weite Kreise der hiesigen Gemeinde, als Dr.
Auerbach im Jahre 1873 einer Berufung nach Halberstadt folgte, um den dort
erledigten Rabbinersitz seines Vaters einzunehmen. Der Entschlafene hat
dort mehr als 28 Jahre rühmlichst gewirkt und eine führende Stellung
unter den deutschen Rabbinern erlangt. Immer aber hat er seine Beziehungen
zu Fürth aufrecht erhalten und sich seiner pädagogischen Tätigkeit
hier, die ihm so viele Freunde und Anhänger erworben hat, stets gern
erinnert. Am Schlusse des Vortrages wurde noch des vor einigen Monaten
verstorbenen eifrigen Vorstandsmitgliedes der Schule, Herrn Henoch
Zimmer, der für die Interessen der Schule mit großem Erfolge gewirkt
hatte, rühmend gedacht." |
Jahrzeit
für Rabbiner Dr. Selig Auerbach (1902)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. Oktober 1902: "Aus Bayern, 5. Oktober (1902). In
diesen heiligen und ernsten Tagen, an denen wir nicht nur Einkehr in uns
halten, sondern uns auch vielfach im Geiste mit teuren Entschlafenen
beschäftigen, beherrscht eine große Anzahl gleichgesinnter
Glaubensgenossen der Gedanke an einen hervorragenden Führer in Israel,
der in diesen Tagen (am Rüsttage zum Jom Kippur) des letzten
Jahres das Zeitliche segnete. Wenngleich den Manen des verlebten Herrn
Rabbiners Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens anlässlich seines
Todes in erschöpfender Weise in der Presse der verdiente Tribut gezollt
wurde, so soll doch der erste Jahrzeitstag nciht vorübergehen, ohne dass
ein alter Schüler im Sinne vieler Kollegen nochmals das Andenken eines
der Besten durch wenige Worte zu ehren versucht.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. Oktober 1902: "Aus Bayern, 5. Oktober (1902). In
diesen heiligen und ernsten Tagen, an denen wir nicht nur Einkehr in uns
halten, sondern uns auch vielfach im Geiste mit teuren Entschlafenen
beschäftigen, beherrscht eine große Anzahl gleichgesinnter
Glaubensgenossen der Gedanke an einen hervorragenden Führer in Israel,
der in diesen Tagen (am Rüsttage zum Jom Kippur) des letzten
Jahres das Zeitliche segnete. Wenngleich den Manen des verlebten Herrn
Rabbiners Dr. Selig Auerbach seligen Andenkens anlässlich seines
Todes in erschöpfender Weise in der Presse der verdiente Tribut gezollt
wurde, so soll doch der erste Jahrzeitstag nciht vorübergehen, ohne dass
ein alter Schüler im Sinne vieler Kollegen nochmals das Andenken eines
der Besten durch wenige Worte zu ehren versucht.
In unserer leichtlebigen, schnell vergessenden Zeit wird nicht allzu oft
in späterer Zeit das Bild eines Dahingeschiedenen in so warmer Erinnerung
bleiben, wie das des Seligen; wie heute werden noch in vielen Jahren die
Schüler desselben die hehre Gestalt, die gewinnende Persönlichkeit und
die überzeugende Belehrung des Verklärten vor ihrem Geiste sich
vergegenwärtigen. In den Nekrologen, die im letzten Jahre erschienen,
wurde schon darauf hingewiesen, unter welch' schwierigen Verhältnissen
der Verblichene in den ersten Jahren ihres Bestehens, die israelitische
Bürgerschule in Fürth zu leiten hatte. Keine Mühe wurde von ihm
gescheut, um nicht nur die Erfordernisse der Schule allein, sondern auch
der Individualität der einzelnen Schüler gerecht zu werden. Was er als
Rabbiner für seine Gemeinde, für die Gesamtheit des Judentums leistete,
wurde oft besprochen und ist bekannt; was er aber als Lehrer in den ersten
zehn Jahren in Fürth leistete, das wissen nur seine Schüler zu
würdigen. Diese erkennen es heute in reiferen Jahren noch an, sie wissen
heute noch seine Tätigkeit zu schätzen und werden nie vergessen mit
welchem Eifer, |
 mit
welcher Sorgfalt und Liebe er sich seinem schweren Berufe
widmete. mit
welcher Sorgfalt und Liebe er sich seinem schweren Berufe
widmete.
Eine Anzahl seiner Schüler in Fürth sind ihm im Tode vorausgegangen; die
große Zahl der ihn Überlebenden hat ihm in ihrem Herzen ein Denkmal
errichtet, dauernder als Erz und Marmor. In den Spuren seines Geistes
werden von ihnen Kinder und Enkel erzogen, und wenn auch der 'moderne' Geist
manche vom Pfade des religiösen Lebens abgebracht hat - ein großer Tel
ist treu geblieben und gedenkt dankend der Saat, die Dr. Selig Auerbach
seligen Andenkens in ihr Herz gesät hat." |
Ausschreibung von Schulplätzen an der israelitischen Bürgerschule - unter
Direktor Dr. Samuel Dessau (1887)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August
1887: "Israelitische Bürgerschule in Fürth. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August
1887: "Israelitische Bürgerschule in Fürth.
Das Wintersemester beginnt am Montag, den 12. September. Auswärtige
Schuler, wenn vorher angemeldet, können später eintreten. Die
Absolutorialzeugnisse der Anstalt berechtigen zum einjährig-freiwilligen
Militärdienst. Weitere Auskunft durch den Direktor
Dr. Dessau." |
Abitur an der israelitischen Bürgerschule
(1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. August 1890: "Am 6. August fand an der israelitischen
Bürgerschule in Fürth unter Vorsitz des Ministerialkommissärs, des
königlichen Professor am Realgymnasium zu Augsburg, Herrn L. König, die
diesjährige Absolutorialprüfung - die 10. dieser Anstalt - statt. Die 4
Abiturienten bestanden dieselbe sämtlich mit glänzendem
Erfolg." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. August 1890: "Am 6. August fand an der israelitischen
Bürgerschule in Fürth unter Vorsitz des Ministerialkommissärs, des
königlichen Professor am Realgymnasium zu Augsburg, Herrn L. König, die
diesjährige Absolutorialprüfung - die 10. dieser Anstalt - statt. Die 4
Abiturienten bestanden dieselbe sämtlich mit glänzendem
Erfolg." |
Über
die Israelitische Bürgerschule (1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Mai 1894: "Fürth, 20. Mai (1894). Die
hiesige israelitische Bürgerschule wurde in Anbetracht, dass die
israelitische Jugend der Unwissenheit in religiöser Hinsicht allzu sehr
verfallen war, von einigen ebenso energischen wie zielbewussten Vertretern
der hiesigen Orthodoxie im Jahre 1862 gegründet. Das hierzu nötige
Kapital wurde von Interessenten aufgebracht. Das Institut hat trotz der
Schwierigkeiten, mit welchen jüdische Privatschulen zu kämpfen haben,
sich auf eine achtungswerte Höhe geschwungen. Dieser Umstand verdient
desto mehr betont zu werden, als die Erhaltung der Bürgerschule auf
eigenen Mitteln und Kräften beruht und ein Zuschuss seitens der
Kultusgemeinde oder einer sonstigen Körperschaft nicht erfolgt. Der
Appell an die Kultusgemeinde der verschiedensten religiösen Richtungen,
Beiträge zu leisten, fällt meist auf fruchtbaren Boden. Außer festen
Jahresbeiträgen fließen namhafte Gaben, sodass die Erhaltung der Anstalt
nicht in Frage gestellt ist, wenn die Opferfreudigkeit ferner anhält. Sie
besitzt ein eigenes Haus nebst dazu gehörigem Rückgebäude und
geräumigem Hof und an ihr wirken 10 ständige Lehrer und die
einschlägigen Fachlehrer bei einer Anzahl von etwa 140 Schülern. Einen
nicht geringen Anteil an der Blüte der Schule hat der frühere Direktor
Herr Dr. Auerbach, jetzt Rabbiner in Halberstadt, sein Nachfolger, der
jetzige Direktor Herr Dessau, und der gesamte Lehrkörper."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Mai 1894: "Fürth, 20. Mai (1894). Die
hiesige israelitische Bürgerschule wurde in Anbetracht, dass die
israelitische Jugend der Unwissenheit in religiöser Hinsicht allzu sehr
verfallen war, von einigen ebenso energischen wie zielbewussten Vertretern
der hiesigen Orthodoxie im Jahre 1862 gegründet. Das hierzu nötige
Kapital wurde von Interessenten aufgebracht. Das Institut hat trotz der
Schwierigkeiten, mit welchen jüdische Privatschulen zu kämpfen haben,
sich auf eine achtungswerte Höhe geschwungen. Dieser Umstand verdient
desto mehr betont zu werden, als die Erhaltung der Bürgerschule auf
eigenen Mitteln und Kräften beruht und ein Zuschuss seitens der
Kultusgemeinde oder einer sonstigen Körperschaft nicht erfolgt. Der
Appell an die Kultusgemeinde der verschiedensten religiösen Richtungen,
Beiträge zu leisten, fällt meist auf fruchtbaren Boden. Außer festen
Jahresbeiträgen fließen namhafte Gaben, sodass die Erhaltung der Anstalt
nicht in Frage gestellt ist, wenn die Opferfreudigkeit ferner anhält. Sie
besitzt ein eigenes Haus nebst dazu gehörigem Rückgebäude und
geräumigem Hof und an ihr wirken 10 ständige Lehrer und die
einschlägigen Fachlehrer bei einer Anzahl von etwa 140 Schülern. Einen
nicht geringen Anteil an der Blüte der Schule hat der frühere Direktor
Herr Dr. Auerbach, jetzt Rabbiner in Halberstadt, sein Nachfolger, der
jetzige Direktor Herr Dessau, und der gesamte Lehrkörper." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Juni 1894: "Fürth, 5. Juni (1894). Die in der Nr. 21
dieser Zeitung vom 25. Mai enthaltene Notiz, die hiesige israelitische
Bürgerschule betreffend, bedarf einer wesentlichen Ergänzung. Die
genannte Anstalt steht unter der Verwaltung einer anerkannten
Genossenschaft und ist eine aus 4 Elementar- und 6 Realklassen bestehende
lateinlose Realschule, in den süddeutschen Staaten die einzige
jüdische Anstalt, deren Abgangszeugnisse zum
Einjährigen-Freiwilligen-Dienst in der deutschen Armee berechtigen."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Juni 1894: "Fürth, 5. Juni (1894). Die in der Nr. 21
dieser Zeitung vom 25. Mai enthaltene Notiz, die hiesige israelitische
Bürgerschule betreffend, bedarf einer wesentlichen Ergänzung. Die
genannte Anstalt steht unter der Verwaltung einer anerkannten
Genossenschaft und ist eine aus 4 Elementar- und 6 Realklassen bestehende
lateinlose Realschule, in den süddeutschen Staaten die einzige
jüdische Anstalt, deren Abgangszeugnisse zum
Einjährigen-Freiwilligen-Dienst in der deutschen Armee berechtigen."
|
Ausschreibung einer Lehrerstelle an der israelitischen
Bürgerschule (1895)
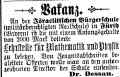 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli
1875: "Vakanz. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli
1875: "Vakanz.
An der Israelitischen Bürgerschule (militärberechtigte
Realschule) in Fürth (Bayern) ist die mit einem Anfangsgehalte von
2.000 Mark dotierte Lehrstelle für Mathematik und Physik zu
besetzen. Von Zeugnisabschriften begleitete Offerten wolle man an den
unterzeichneten Direktor der Schule einsenden.
Dr. Dessau." |
Ausschreibung einer Religionslehrerstelle an der
israelitischen Bürgerschule (1898)
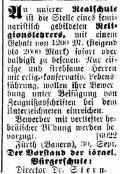 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober
1898: "An unserer Realschule ist die Stelle eines
seminaristisch gebildeten Religionslehrers, mit einem Gehalt von
1.200 Mark (steigend bis 2.000 Mark) sofort oder baldigst zu besetzen. Nur
eifrige und strebsame Herren mit religiös-konservativer Lebensführung,
wollen ihr Bewerbung unter Beifügung von Zeugnisabschriften bei dem
Unterzeichneten einreichen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober
1898: "An unserer Realschule ist die Stelle eines
seminaristisch gebildeten Religionslehrers, mit einem Gehalt von
1.200 Mark (steigend bis 2.000 Mark) sofort oder baldigst zu besetzen. Nur
eifrige und strebsame Herren mit religiös-konservativer Lebensführung,
wollen ihr Bewerbung unter Beifügung von Zeugnisabschriften bei dem
Unterzeichneten einreichen.
Bewerber mit vertiefter hebräischer Bildung werden bevorzugt.
Fürth (Bayern), 30. September.
Der Vorstand der israelitischen Bürgerschule:
Direktor Dr. Stern." |
Zum
Tod von Dr. Samuel Dessau in Schweinfurt, ehemaliger Direktor der Israelitischen
Bürgerschule in Fürth (1904)
Anmerkung: Im Text werden genannt: Rabbiner Dr. Stein in Schweinfurt,
der Schwiegersohn von Dr. Samuel Dessau.
Prof. Dr. Hermann Dessau (geb. 6. April 1856 in Frankfurt am Main; gest.
12. April 1931 in Berlin): war von 1900 bis 1922 wissenschaftlicher Beamter beim
Corps Inscriptionum Latinarum und ab 1917 Honorarprofessor an der Universität
Berlin.
Prof. Dr. Bernhard/Bernardo Dessau (geb. 13. August 1863 in Offenbach am
Main, gest. 17. November 1949 in Perugia): italienischer Physiker: war von 1904
bis 1935 Professor für Physik an der Universität Perugia; weitere
Informationen siehe Wikipedia-Artikel
"Bernardo Dessau".
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. März 1904: "Fürth, 11. März (1904). Unsere Gemeinde
beklagt den Verlust eines ausgezeichneten Mannes. In Schweinfurt,
wohin er sich in den letzten Jahren zurückgezogen, ist Dr. Samuel
Dessau, ein geborener Hamburger, der ein Vierteljahrhundert Direktor
der 'Israelitischen Bürgerschule' hier war, mach schweren Leiden im hohen
Greisenalter verschieden. Sein Verdienst war es, dass die königliche
Regierung die Anstalt als vollberechtigte Realschule anerkannte und die
Reichsbehörden 1882 dem Leiter der Anstalt das Recht zur Ausstellung von
Zeugnissen für den Einjährig-Freiwilligendienst verliehen. Vorher war
Dessau acht Jahre lang Lehrer an der Realschule der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Frankfurt am Main, wo er den
naturwissenschaftlichen Unterricht leitete. Ein Sohn des Verblichenen ist
der Historiker Professor Dr. (sc. Hermann) Dessau in
Berlin, ein anderer ist Professor (sc. Bernardo Dessau) in Florenz,
ein Schwiegersohn Rabbiner Dr. Stein in Schweinfurt.
Wie sehr der Heimgegangene auch selbst seine Verdienste und Leistungen
verbarg, so wusste man doch auch in fernerstehenden Kreisen das Wesen und
Wirken des Mannes nach seinem wahren Wert zu schätzen. Dessau gehörte zu
den seltenen Männern, die arbeiten und schaffen nicht um des Lohnes und
der Anerkennung willen, sondern in der Pflichterfüllung selbst ihre
Befriedigung finden, zu den Männern, die der ihm erwählten guten Sache
mit Überzeugung dienen, ohne sich durch persönliche Rücksichten leiten
zu lassen. Das Leichenbegängnis fand hier, auf den eigenen Wunsch des
Verblichenen, ohne jede Anzeige und Grabrede, aber unter sehr zahlreicher
Beteiligung statt. Aber das Andenken an den vortrefflichen Mann wird in
dem Kreise, den er ausgefüllt, in dankbarer Erinnerung
fortleben."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. März 1904: "Fürth, 11. März (1904). Unsere Gemeinde
beklagt den Verlust eines ausgezeichneten Mannes. In Schweinfurt,
wohin er sich in den letzten Jahren zurückgezogen, ist Dr. Samuel
Dessau, ein geborener Hamburger, der ein Vierteljahrhundert Direktor
der 'Israelitischen Bürgerschule' hier war, mach schweren Leiden im hohen
Greisenalter verschieden. Sein Verdienst war es, dass die königliche
Regierung die Anstalt als vollberechtigte Realschule anerkannte und die
Reichsbehörden 1882 dem Leiter der Anstalt das Recht zur Ausstellung von
Zeugnissen für den Einjährig-Freiwilligendienst verliehen. Vorher war
Dessau acht Jahre lang Lehrer an der Realschule der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Frankfurt am Main, wo er den
naturwissenschaftlichen Unterricht leitete. Ein Sohn des Verblichenen ist
der Historiker Professor Dr. (sc. Hermann) Dessau in
Berlin, ein anderer ist Professor (sc. Bernardo Dessau) in Florenz,
ein Schwiegersohn Rabbiner Dr. Stein in Schweinfurt.
Wie sehr der Heimgegangene auch selbst seine Verdienste und Leistungen
verbarg, so wusste man doch auch in fernerstehenden Kreisen das Wesen und
Wirken des Mannes nach seinem wahren Wert zu schätzen. Dessau gehörte zu
den seltenen Männern, die arbeiten und schaffen nicht um des Lohnes und
der Anerkennung willen, sondern in der Pflichterfüllung selbst ihre
Befriedigung finden, zu den Männern, die der ihm erwählten guten Sache
mit Überzeugung dienen, ohne sich durch persönliche Rücksichten leiten
zu lassen. Das Leichenbegängnis fand hier, auf den eigenen Wunsch des
Verblichenen, ohne jede Anzeige und Grabrede, aber unter sehr zahlreicher
Beteiligung statt. Aber das Andenken an den vortrefflichen Mann wird in
dem Kreise, den er ausgefüllt, in dankbarer Erinnerung
fortleben." |
Dr. Moritz Stern wird Direktor der israelitischen Bürgerschule (1898)
 Zur Person von Dr. Moritz Stern: der
Historiker Moritz Stern ist 1864 in Steinbach
(Hessen-Nassau) geboren. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er 1891 bis
1898 als Prediger, Schuldirigent und Rabbiner in Kiel tätig. Nur für ein
gutes Jahr folgte danach - vom September 1898 bis Dezember 1899 - die Zeit als Schuldirektor in Fürth. 1900 bis
1905 war er Schuldirektor in Berlin, danach Oberbibliothekar der
Bibliothek der jüdischen Gemeinde in Berlin. Er hat zahlreiche
historische Werke verfasst.
Zur Person von Dr. Moritz Stern: der
Historiker Moritz Stern ist 1864 in Steinbach
(Hessen-Nassau) geboren. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er 1891 bis
1898 als Prediger, Schuldirigent und Rabbiner in Kiel tätig. Nur für ein
gutes Jahr folgte danach - vom September 1898 bis Dezember 1899 - die Zeit als Schuldirektor in Fürth. 1900 bis
1905 war er Schuldirektor in Berlin, danach Oberbibliothekar der
Bibliothek der jüdischen Gemeinde in Berlin. Er hat zahlreiche
historische Werke verfasst.
Links: Artikel über Moritz Stern in: "Jüdisches Lexikon. Ein
enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden. Hrsg.
von Georg Herlitz und Bruno Kirschner. Bd. IV/2 Sp. 720. Jüdischer Verlag
Berlin 1927 (Nachdruck 1982) mit Nennung der wichtigsten Werke von Moritz
Stern. |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1898: "Fürth,
7. September (1898). Zum Direktor unserer israelitischen Bürgerschule
ist der bekannte Historiker Dr. Moritz Stern, bisher Prediger und
Schuldirigent der israelitischen Gemeinde in Kiel, einstimmig vom
Kuratorium gewählt worden. Die auf dem Boden des traditionellen Judentums
stehende Bürgerschule, 1862 begründet von Herrn Rabbiner Dr. Auerbach
(Halberstadt) und seit 1872 geleitet von dem verdienten bisherigen
Direktor Dr. Dessau, besteht aus einer vierklassigen Volksschule
und einer sechsklassigen Realschule. Die Reifezeugnisse der obersten
Realschulklasse berechtigen zum einjährig-freiwilligen Militärdienst.
Auf die Pflege der Religion und des Hebräischen einschließlich Mischna
und Talmud wird besonderer Wert gelegt. Zum Lehrerkollegium gehören 18
staatlich geprüfte Lehrkräfte. Dem Wirken des neuen Realschuldirektors,
dem ein vorzüglicher schriftstellerischer und pädagogischer Ruf
vorangeht, wird mit hochgespannten Erwartungen entgegengesehen. Seiner
wartet hier bei der Jugend, wie bei den Erwachsenen ein großes
Arbeitsfeld. Herr Direktor Dr. Stern, ein Neffe des Begründers der
Hamburger Talmud-Thora-Realschule, des verstorbenen Hamburger
Oberrabbiners Ascher Stern seligen Andenkens, erhielt seine
rabbinische Ausbildung am Hildesheimer'schen Rabbinerseminar zu
Berlin." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1898: "Fürth,
7. September (1898). Zum Direktor unserer israelitischen Bürgerschule
ist der bekannte Historiker Dr. Moritz Stern, bisher Prediger und
Schuldirigent der israelitischen Gemeinde in Kiel, einstimmig vom
Kuratorium gewählt worden. Die auf dem Boden des traditionellen Judentums
stehende Bürgerschule, 1862 begründet von Herrn Rabbiner Dr. Auerbach
(Halberstadt) und seit 1872 geleitet von dem verdienten bisherigen
Direktor Dr. Dessau, besteht aus einer vierklassigen Volksschule
und einer sechsklassigen Realschule. Die Reifezeugnisse der obersten
Realschulklasse berechtigen zum einjährig-freiwilligen Militärdienst.
Auf die Pflege der Religion und des Hebräischen einschließlich Mischna
und Talmud wird besonderer Wert gelegt. Zum Lehrerkollegium gehören 18
staatlich geprüfte Lehrkräfte. Dem Wirken des neuen Realschuldirektors,
dem ein vorzüglicher schriftstellerischer und pädagogischer Ruf
vorangeht, wird mit hochgespannten Erwartungen entgegengesehen. Seiner
wartet hier bei der Jugend, wie bei den Erwachsenen ein großes
Arbeitsfeld. Herr Direktor Dr. Stern, ein Neffe des Begründers der
Hamburger Talmud-Thora-Realschule, des verstorbenen Hamburger
Oberrabbiners Ascher Stern seligen Andenkens, erhielt seine
rabbinische Ausbildung am Hildesheimer'schen Rabbinerseminar zu
Berlin." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober
1898: "Fürth, 5. Oktober 1898: "Zufolge höchster
Entschließung des Königlichen Staatsministeriums des Innern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 14. September hat die hohe
Königliche Regierung durch Reskript vom 21. September die Wahl des
bisherigen Predigers und Schuldirigenten der israelitischen Kultusgemeinde
zu Kiel, Dr. phil. Moritz Stern, zum Direktor der hiesigen
israelitischen Realschule und der damit verbundenen Volksschule
bestätigt. Gleichzeitig wurde dem neuen Direktor der Unterricht im
Hebräischen und in den Realen (Deutsch, Geographie und Geschichte) vom
laufenden Schuljahr an übertragen. Für die so erfreulich schnell
erfolgte Bestätigung war, wie wir hören, die frühere pädagogische und
wissenschaftliche Tätigkeit des Gewählten ausschlaggebend. Die
öffentliche Einführung des neuen Herrn Direktors in sein Amt wird
demnächst erfolgen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober
1898: "Fürth, 5. Oktober 1898: "Zufolge höchster
Entschließung des Königlichen Staatsministeriums des Innern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 14. September hat die hohe
Königliche Regierung durch Reskript vom 21. September die Wahl des
bisherigen Predigers und Schuldirigenten der israelitischen Kultusgemeinde
zu Kiel, Dr. phil. Moritz Stern, zum Direktor der hiesigen
israelitischen Realschule und der damit verbundenen Volksschule
bestätigt. Gleichzeitig wurde dem neuen Direktor der Unterricht im
Hebräischen und in den Realen (Deutsch, Geographie und Geschichte) vom
laufenden Schuljahr an übertragen. Für die so erfreulich schnell
erfolgte Bestätigung war, wie wir hören, die frühere pädagogische und
wissenschaftliche Tätigkeit des Gewählten ausschlaggebend. Die
öffentliche Einführung des neuen Herrn Direktors in sein Amt wird
demnächst erfolgen." |
Die israelitische Bürgerschule darf sich israelitische Realschule nennen (1899)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September
1899: "Fürth, 31. August (1899). Die hiesige
Bürgerschule hat vom Reichskanzleramte die Erlaubnis erhalten, ihren
Namen in israelitische Realschule umzuwandern, welche Titeländerung wohl
vom derzeitigen Rektor, Herrn Dr. Stern, erstrebt wurde. So
belanglos der Name auch manchem erscheinen mag, so war er doch geeignet,
Missverständnisse herbeizuführen; denn unter Bürgerschule versteht man
im allgemeinen eine gehobene Volksschule, während die hiesige Anstalt
doch vollkommen den Charakter einer Realschule hat, in welcher die
Schüler die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst
erlangen können. - Aber noch wichtigere Punkte fasst Herr Dr. Stern ins
Auge. So ist er sehr bemüht, tüchtige Lehrkräfte für seine Anstalt zu
gewinnen, die ganz im Geiste eines echte Jehudi (gemeint:
überzeugter Jude) denken, reden und handeln, was auch unbedingt notwendig
ist; denn der einzige Zweck der Schule besteht doch darin, dass sie die
Jugend als gesetzestreue, strenggläubige Mitglieder unserer Gemeinde heranbildet,
und eine solche Erziehung kann nur dann Erfolg haben, wenn die Lehrer
derart sind, dass sie in jeder Hinsicht als Vorbilder für die Jugend
dienen können und jede Verschiedenheit in der Gesinnung und Überzeugung
wird leicht bemerkt. - Gewiss wird es der Tatkraft und den Fähigkeiten
des Herrn Dr. Stern gelingen, seine Bestrebungen im Interesse
seiner Schule durchzusetzen, wie sein bewährter, selbstloser Vorgänger,
Herr Dr. Dessau, viele Jahre hindurch so segensreich für dieselbe
wirkte." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September
1899: "Fürth, 31. August (1899). Die hiesige
Bürgerschule hat vom Reichskanzleramte die Erlaubnis erhalten, ihren
Namen in israelitische Realschule umzuwandern, welche Titeländerung wohl
vom derzeitigen Rektor, Herrn Dr. Stern, erstrebt wurde. So
belanglos der Name auch manchem erscheinen mag, so war er doch geeignet,
Missverständnisse herbeizuführen; denn unter Bürgerschule versteht man
im allgemeinen eine gehobene Volksschule, während die hiesige Anstalt
doch vollkommen den Charakter einer Realschule hat, in welcher die
Schüler die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst
erlangen können. - Aber noch wichtigere Punkte fasst Herr Dr. Stern ins
Auge. So ist er sehr bemüht, tüchtige Lehrkräfte für seine Anstalt zu
gewinnen, die ganz im Geiste eines echte Jehudi (gemeint:
überzeugter Jude) denken, reden und handeln, was auch unbedingt notwendig
ist; denn der einzige Zweck der Schule besteht doch darin, dass sie die
Jugend als gesetzestreue, strenggläubige Mitglieder unserer Gemeinde heranbildet,
und eine solche Erziehung kann nur dann Erfolg haben, wenn die Lehrer
derart sind, dass sie in jeder Hinsicht als Vorbilder für die Jugend
dienen können und jede Verschiedenheit in der Gesinnung und Überzeugung
wird leicht bemerkt. - Gewiss wird es der Tatkraft und den Fähigkeiten
des Herrn Dr. Stern gelingen, seine Bestrebungen im Interesse
seiner Schule durchzusetzen, wie sein bewährter, selbstloser Vorgänger,
Herr Dr. Dessau, viele Jahre hindurch so segensreich für dieselbe
wirkte." |
Direktor Dr. Moritz Stern siedelt nach Berlin über
(1899)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November
1899: "Fürth, 10. November (1899). Direktor Dr. Stern
hat im Anfang des vorigen Monats seine Stellung als Leiter der
israelitischen Realschule zum 1. Januar gekündigt. Er siedelt bereits
Ende Dezember nach Berlin über, um dort eine gleichartige Anstalt und ein
besseres Pensionat zu begründen. Es ist höchst bedauerlich, dass die
geschätzte Lehrkraft uns nach nur einjähriger Tätigkeit verloren
geht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November
1899: "Fürth, 10. November (1899). Direktor Dr. Stern
hat im Anfang des vorigen Monats seine Stellung als Leiter der
israelitischen Realschule zum 1. Januar gekündigt. Er siedelt bereits
Ende Dezember nach Berlin über, um dort eine gleichartige Anstalt und ein
besseres Pensionat zu begründen. Es ist höchst bedauerlich, dass die
geschätzte Lehrkraft uns nach nur einjähriger Tätigkeit verloren
geht." |
Ergänzender Artikel: 70. Geburtstag von Moritz Stern
(1934)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1934: "Moritz Stern. Eine Würdigung zu seinem 70.
Geburtstage. Es wurde bereits einiges über Werdegang und erste
Wirksamkeit Sterns in Fürth und Kiel gesagt. Mit all dem wirkte Stern
segensreich in lokalen und provinziellen Kreisen. Das wurde anders, als
ihn auf Grund seiner wissenschaftlichen Vorbildung und ungemein großen
Literaturkenntnisse die Berliner Gemeinde 1905 zu ihrem Bibliothekar
wählte...." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli
1934: "Moritz Stern. Eine Würdigung zu seinem 70.
Geburtstage. Es wurde bereits einiges über Werdegang und erste
Wirksamkeit Sterns in Fürth und Kiel gesagt. Mit all dem wirkte Stern
segensreich in lokalen und provinziellen Kreisen. Das wurde anders, als
ihn auf Grund seiner wissenschaftlichen Vorbildung und ungemein großen
Literaturkenntnisse die Berliner Gemeinde 1905 zu ihrem Bibliothekar
wählte...."
Der Abschnitt wird nicht abgeschrieben, da er keine weiteren Bezüge
zur Geschichte Moritz Sterns in Fürth enthält. Zum Lesen des Beitrages
bitte Textabbildungen anklicken. |
 |
Schlussfeier der israelitischen Realschule
(1900)
 Zur Person des im Zusammenhang mit der Schlussfeier 1900 erstmals genannten
"künftigen Direktors Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld: Abraham Alfred
Feilchenfeld ist 1860 in Düsseldorf geboren als Sohn des späteren Oberrabbiners von
Posen Wolf Feilchenfeld (1827-1913) und seiner Frau Ernestine geb. Berend
(1835-1912). Nach Abschluss seiner Ausbildung war er
viereinhalb Jahre an der Real- und höheren Töchterschule der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Frankfurt tätig. Von 1889 bis 1900 war der Lehrer der
Talmud Thora-Schule in Hamburg. Im September 1900 übernahm der die Stelle des
Direktors der israelitischen Realschule in Fürth, die er bis zu seinem Tod am
15. Juli 1923 in Berlin leitete. Ein Höhepunkt war das 50-jährige Jubiläum
der israelitischen Realschule, wozu er eine Festschrift über die Geschichte der
Einrichtung erstellte. Zur Person des im Zusammenhang mit der Schlussfeier 1900 erstmals genannten
"künftigen Direktors Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld: Abraham Alfred
Feilchenfeld ist 1860 in Düsseldorf geboren als Sohn des späteren Oberrabbiners von
Posen Wolf Feilchenfeld (1827-1913) und seiner Frau Ernestine geb. Berend
(1835-1912). Nach Abschluss seiner Ausbildung war er
viereinhalb Jahre an der Real- und höheren Töchterschule der Israelitischen
Religionsgesellschaft in Frankfurt tätig. Von 1889 bis 1900 war der Lehrer der
Talmud Thora-Schule in Hamburg. Im September 1900 übernahm der die Stelle des
Direktors der israelitischen Realschule in Fürth, die er bis zu seinem Tod am
15. Juli 1923 in Berlin leitete. Ein Höhepunkt war das 50-jährige Jubiläum
der israelitischen Realschule, wozu er eine Festschrift über die Geschichte der
Einrichtung erstellte.
Dr. Alfred Feilchenfeld war verheiratet mit Lea geb. Friedländer (1869 -
1935 Nürnberg). Die beiden hatten vier Kinder: Marta verh. Gruenbaum
(1895-1986), Georg Gotthelf Josua Feilchenfeld (1896-1978), Ludwig Aryeh
Feilchenfeld (1899-1976), Ruth verh. Azrieli (1910-). Alle Kinder konnten
nach Palästina emigrieren. (Angaben
nach Berend Family Tree). Dr. Alfred Feilchenfeld wurde in Berlin
beigesetzt.
Foto oben: Jüdisches Museum Franken, 03392. |
 Links
- erscheint bis heute immer wieder in neuen Nachdrucken: das
bekannteste Werk von Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld: Denkwürdigkeiten
der Glückel von Hameln aus dem Jüdisch-Deutschen übersetzt,
mit Erläuterungen versehen und herausgegeben von Dr. Alfred Feilchenfeld. Links
- erscheint bis heute immer wieder in neuen Nachdrucken: das
bekannteste Werk von Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld: Denkwürdigkeiten
der Glückel von Hameln aus dem Jüdisch-Deutschen übersetzt,
mit Erläuterungen versehen und herausgegeben von Dr. Alfred Feilchenfeld.
Die Abbildung zeigt die Erstausgabe im Jüdischen Verlag Berlin
1920. |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli
1900: "Fürth, 18. Juli (Schlussfeier). Auch an
der Israelitischen Realschule fand dieses Jahr - am 13. dieses Monats -
eine Schlussfeier statt. Gesänge sowie Deklamationen in deutscher,
französischer und englischer Sprache gelangten unter dem Beifall der
Anwesenden zum Vortrag und legten schöne Proben von dem Können der
Zöglinge dieser Anstalt ab. In einer wohldurchdachten Ansprache legte der
derzeitige interimistische Direktor, Herr Dr. S. Herzstein, von den
wiederum erzielten guten Resultaten ausgehend dar, worauf der Erfolg
eigentlich beruhe. Gottesfurcht, aller Weisheit Anfang, sei der Quell und
die Summe aller Tugenden; aus ihr entsprängen auch Hochachtung vor den
Lehrern, Gehorsam gegen dieselben, Friedfertigkeit den Mitschülern
gegenüber, Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit. Er verlangte auch
Vertrauen zu den Lehrern und ihrer Gerechtigkeit, dieselben vermöchten
leider nicht immer, gute Noten zu erteilen. Er tröstete die schwachen,
aber fleißigen Schüler in dem Bewusststein, ihre Schuldigkeit nach Kräften
getan zu haben, und ermahnte diejenigen, die es an Fleiß hatten fehlen
lassen, dringend, sich zu bessern. Den Abiturienten legte der
Anstaltsleiter ans Herz, an den guten Lehren festzuhalten, die sie auch
der Schule empfangen hätten und auch durch ihr künftiges Verhalten der
Israelitischen Realschule Ehre zu machen. Das Glück des Lebens sei
treueste Pflichterfüllung. Treffend zitierte Redner die goldenen Lehren,
die in Shakespeares Hamlet Polonius seinem in die Fremde ziehenden Sohne
Laertes mit auf den Weg gibt, und ermahnte die Scheidenden besonders,
wählerisch in ihrem Umgange zu sein, da böse Beispiele gute Sitten
verdürben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli
1900: "Fürth, 18. Juli (Schlussfeier). Auch an
der Israelitischen Realschule fand dieses Jahr - am 13. dieses Monats -
eine Schlussfeier statt. Gesänge sowie Deklamationen in deutscher,
französischer und englischer Sprache gelangten unter dem Beifall der
Anwesenden zum Vortrag und legten schöne Proben von dem Können der
Zöglinge dieser Anstalt ab. In einer wohldurchdachten Ansprache legte der
derzeitige interimistische Direktor, Herr Dr. S. Herzstein, von den
wiederum erzielten guten Resultaten ausgehend dar, worauf der Erfolg
eigentlich beruhe. Gottesfurcht, aller Weisheit Anfang, sei der Quell und
die Summe aller Tugenden; aus ihr entsprängen auch Hochachtung vor den
Lehrern, Gehorsam gegen dieselben, Friedfertigkeit den Mitschülern
gegenüber, Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit. Er verlangte auch
Vertrauen zu den Lehrern und ihrer Gerechtigkeit, dieselben vermöchten
leider nicht immer, gute Noten zu erteilen. Er tröstete die schwachen,
aber fleißigen Schüler in dem Bewusststein, ihre Schuldigkeit nach Kräften
getan zu haben, und ermahnte diejenigen, die es an Fleiß hatten fehlen
lassen, dringend, sich zu bessern. Den Abiturienten legte der
Anstaltsleiter ans Herz, an den guten Lehren festzuhalten, die sie auch
der Schule empfangen hätten und auch durch ihr künftiges Verhalten der
Israelitischen Realschule Ehre zu machen. Das Glück des Lebens sei
treueste Pflichterfüllung. Treffend zitierte Redner die goldenen Lehren,
die in Shakespeares Hamlet Polonius seinem in die Fremde ziehenden Sohne
Laertes mit auf den Weg gibt, und ermahnte die Scheidenden besonders,
wählerisch in ihrem Umgange zu sein, da böse Beispiele gute Sitten
verdürben.
Den Herren Kollegen dankte Herr Doktor Herzstein für die bereitwillige
Unterstützung, die sie ihm bei seiner kurzen Amtsführung hätten zuteil
werden lassen und wünscht, dass die Schule auch unter dem künftigen
Direktor - Herrn Dr. Feilchenfeld - weiterhin gedeihen möge. Dem
Kuratorium, das aus Liebe zum Prinzip der Anstalt, unermüdlich Opfer an
Zeit und Geld in sich selbst trage, und hoffend, dass es auch künftig der
Anstalt an Gönnern nicht fehlen möge. Bildungsanstalten, führte der
Redner endlich aus, gedeihen nur bei äußerem und innerem Frieden, als
dessen Hort in unserem engeren Vaterlande den geliebten Landesregenten
feiernd und dem Hause Wittelsbach bei dieser Gelegenheit auch viel Glück
wünschend zu der jüngst erfolgten Vermählung des Prinzen Rupprecht und
der Herzogin, nunmehrigen Prinzessin Marie Gabriele. Möchte auch in
Zukunft in unserem Lande religiöse Duldung, Achtung vor der Überzeugung
und den Glaubensmeinungen der Nebenmenschen herrschen, wodurch sich Bayern
so vorteilhaft vor manchen anderen Ländern auszeichnet. Dem Schirmherrn
des Friedens und der Toleranz, des Bayernlandes weisen Verweser, Seiner
Königlichen Hoheit dem vielgeliebten Prinzregenten Luitpold brachte der
Redner ein dreifaches Hoch aus, in das alle Anwesenden begeistert einstimmten.
Mit dem Absingen der Königshymne fand die erhebende Feier ihren
Abschluss. Sie legte Zeugnis ab von dem patriotischen, religiösen und
ernsten wissenschaftlichen Geiste, der die Anstalt beseelt. Möge sie
wachsen, blühen und gedeihen." |
Ausschreibung von Schulplätzen an der israelitischen Realschule
(1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni
1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juni
1901:
"Israelitische Realschule nebst Vorschule in Fürth (1862
gegründet, seit 1882 mit Militärberechtigung).
Das neue Schuljahr an unserer 6-klassigen Realschule mit
Handelsabteilung, sowie an der 4-klassigen Vorschule beginnt am 5.
September.
Unsere Anstalt ist die einzige Realschule in Bayern, die ihren Zöglingen
neben einer höheren bürgerlichen Bildung, eine eingehende Kenntnis der
heiligen Schriften und Satzungen des Judentums vermittelt und sie
befähigt, als modern gebildete, mit den Lehren Israels vertraute Juden
ins Leben hinauszutreten.
Auswärtige Schüler finden gute Familiepension und sorgfältige Überwachung,
auch bei Lehrern der Anstalt.
Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst der Rektor: Dr. A.
Feilchenfeld." |
Schlussfeiern der israelitischen Realschule (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli
1901: "Fürth, 13. Juli (Schlußfeiern). Den Reigen
derselben eröffnete um 9 Uhr früh in der Aula der Anstalt die
israelitische Realschule. Ein ebenso reichhaltiges als gediegenes Programm
in gesanglichen wie in deklamatorischen Darbietungen lag dieser Feier
zugrunde. Den Eingang bildete ein zweistimmiger Chor 'Der deutsche Knabe',
woran sich vier Gedichtvorträge 'Das Himmelreich', 'Märkische
Volkssage', 'Wie Kaiser Karl Schulvisitation hielt' und 'Der Bayer und der
Zuave' reihten. In reizendem Ausdruck kamen diese Gedicht zu Gehör; ein
zweiter Gesang 'Abendglöcklein' löste sie ab und führte in die zweite
Abteilung, die zwei fremdsprachliche Vorträge 'Le nid de fauvettes'
(Arnaud Berquin) und 'Le Loup et l'Agneau' (Lafontaine) und zwei deutsche
Nummern 'Das Volk in Waffen' (Gerok) und 'Das Lied von den deutschen
Strömen' (Buchner) enthielt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli
1901: "Fürth, 13. Juli (Schlußfeiern). Den Reigen
derselben eröffnete um 9 Uhr früh in der Aula der Anstalt die
israelitische Realschule. Ein ebenso reichhaltiges als gediegenes Programm
in gesanglichen wie in deklamatorischen Darbietungen lag dieser Feier
zugrunde. Den Eingang bildete ein zweistimmiger Chor 'Der deutsche Knabe',
woran sich vier Gedichtvorträge 'Das Himmelreich', 'Märkische
Volkssage', 'Wie Kaiser Karl Schulvisitation hielt' und 'Der Bayer und der
Zuave' reihten. In reizendem Ausdruck kamen diese Gedicht zu Gehör; ein
zweiter Gesang 'Abendglöcklein' löste sie ab und führte in die zweite
Abteilung, die zwei fremdsprachliche Vorträge 'Le nid de fauvettes'
(Arnaud Berquin) und 'Le Loup et l'Agneau' (Lafontaine) und zwei deutsche
Nummern 'Das Volk in Waffen' (Gerok) und 'Das Lied von den deutschen
Strömen' (Buchner) enthielt.
Die Aussprache der französischen Piecen war absolut tadellos. Von fünf Schülern
wurde hierauf die hübsche dreistimmige Volksweise 'Das Blümlein auf der
Beiden' in recht ansprechender Weise gesungen. Ein Gedicht 'Arbeit' von
Dahn, ein französisches 'La Garonne' von Nadaud und ein englisches Poem
'A Psalm of Life' von Longfellow waren sehr tüchtige Leistungen. Es
folgte darauf die Ansprache des Herrn Direktors Dr. A. Feilchenfeld mit
einem Rückblick auf das 39. Schuljahr und mit Verteilung der
Reifezeugnisse; der zweistimmige Gesang von 'Der frohe Wandersmann'
bildete den Schluss der schönen Schulfeier, die ebenso den beweis
erbracht hat von gediegenem, deutschem und fremdsprachlichem, wie von
methodisch richtigem Gesangunterricht." |
Ausschreibung
von Schulplätzen an der israelitischen Realschule (1903)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
9. April 1903: "Israelitische Realschule (mit Handelsabteilung) in
Fürth. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
9. April 1903: "Israelitische Realschule (mit Handelsabteilung) in
Fürth.
Das Sommersemester an unserer militärberechtigten Realschule und der dazu
gehörigen Vorschule, beginnt am 21. April. Anmeldungen neuer Schüler
rechtzeitig erbeten. Nähere Auskünfte jederzeit durch den
Unterzeichneten.
Dr. A. Feilchenfeld, Direktor." |
Jahresbericht
der israelitischen Realschule (1903)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juli 1903: "Fürth in Bayern. Die israelitische
Realschule nebst vorschule wurde zu Beginn des Schuljahres von 51
Vorschülern und 67 Realschülern besucht. Im Laufe des Schuljahres trat 1
Schüler in die Vorschule, 1 in die Realschule ein; dagegen traten 3
Schüler aus der Realschule aus, sodass sich nunmehr eine Frequenz von 52
Vorschülern und 65 Realschülern ergibt.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Juli 1903: "Fürth in Bayern. Die israelitische
Realschule nebst vorschule wurde zu Beginn des Schuljahres von 51
Vorschülern und 67 Realschülern besucht. Im Laufe des Schuljahres trat 1
Schüler in die Vorschule, 1 in die Realschule ein; dagegen traten 3
Schüler aus der Realschule aus, sodass sich nunmehr eine Frequenz von 52
Vorschülern und 65 Realschülern ergibt.
In der Lehrmittelsammlung wurde in diesem Jahre namentlich der
Kartenbestand bedeutend vermehrt. Die Schülerbibliothek wurde durch ca.
60 Werke vergrößert.
Bei der am 11. Juli vorigen Jahres unter dem Vorsitz des königlichen
Ministerialkommissars, Herrn Prof. Dr. Rackl aus Nürnberg, abgehaltenen
mündlichen Absolutorialprüfung bestanden 3 Schüler und erhielten das
Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den
Einjährig-Freiwilligen Dienst.
Zum Ministerialkommissar für die diesjährige, schriftliche und
mündliche Absolutorialprüfung wurde durch höchste
Ministerialentschließung vom 10. Juni dieses Jahres wiederum Herr Dr. Jof.
Rackl, kgl. Prof. an der Industrieschule zu Nürnberg ernannt. Die
schriftliche Prüfung fand am 18., 19., 22. und 23. Juni statt. Für die
Prüfung aus der Religion wurde von den 3 vom hiesigen Rabbinat zur Wahl
gestellten Aufgaben das Thema gewählt. 'Die Pflichten gegen das Leben und
die Gesundheit der Nebenmenschen.' Von den 3 für den deutschen Aufsatz
zur Auswahl gestellten Themen entschied sich die Prüfungskommission für
das erste: 'Naturkunde, eine Mitgift für das Leben.'
Bei der mündlichen Prüfung bestanden allen neun Absolventen. Die
Schlussfeier fand am 14. Juli in der Aula der Anstalt unter zahlreicher
Beteiligung des Publikums statt. In seiner Schlussrede mahnte der
Direktor, Herr Dr. A. Feilchenfeld, die Absolventen, die in der
Schule gepflegten Ideale hochzuhalten und den jüdisch-religiösen
Prinzipien. in denen sie erzogen worden seien, stets treu zu
bleiben." |
Zum Tod des Direktors der israelitischen Realschule Dr. Samuel Dessau (1904)
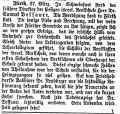 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März
1904: "Fürth, 27. März (1904). In Schweinfurt starb der
frühere Direktor der hiesigen israelitischen Realschule Herr Dr. Samuel
Dessau (statt Dessauer). Die Beerdigung fand in Fürth statt. Die
innige Liebe und Verehrung, mit der weite Kreise der Fürther Gemeinde an
ihm hingen, zeigte sich an dem großen Gefolge, das die irdische Hülle
vom Bahnhofe zur Leichenhalle des Friedhofes geleitete. Gleich hinter den
Leidtragenden folgten, von dem Lehrerkollegium geführt, die Schüler der
Realklassen der israelitischen Realschule, von denen manche noch in ihren
ersten Schuljahren den Verblichenen als Oberhaupt der Schule gekannt
hatten. Diesels einzige schwache Zeichen von Teilnahme war der Schule
verstattet, für die der Heimgegangene so viel getan. Auf dem Friedhofe
durfte Rabbiner Dr. Neubürger nur die letztwillige Bestimmung bekannt
geben, durch die jede Trauerrede an der Bahre des Toten verboten war, und
nur ein kurzes Gebet sprechen. Auch jede Todesanzeige hat Dr. Dessauer
letztwillig verboten. Sein Andenken wird stets gesegnet sein!" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März
1904: "Fürth, 27. März (1904). In Schweinfurt starb der
frühere Direktor der hiesigen israelitischen Realschule Herr Dr. Samuel
Dessau (statt Dessauer). Die Beerdigung fand in Fürth statt. Die
innige Liebe und Verehrung, mit der weite Kreise der Fürther Gemeinde an
ihm hingen, zeigte sich an dem großen Gefolge, das die irdische Hülle
vom Bahnhofe zur Leichenhalle des Friedhofes geleitete. Gleich hinter den
Leidtragenden folgten, von dem Lehrerkollegium geführt, die Schüler der
Realklassen der israelitischen Realschule, von denen manche noch in ihren
ersten Schuljahren den Verblichenen als Oberhaupt der Schule gekannt
hatten. Diesels einzige schwache Zeichen von Teilnahme war der Schule
verstattet, für die der Heimgegangene so viel getan. Auf dem Friedhofe
durfte Rabbiner Dr. Neubürger nur die letztwillige Bestimmung bekannt
geben, durch die jede Trauerrede an der Bahre des Toten verboten war, und
nur ein kurzes Gebet sprechen. Auch jede Todesanzeige hat Dr. Dessauer
letztwillig verboten. Sein Andenken wird stets gesegnet sein!" |
25-jähriges Jubiläum von Prof. Dr. S. Herzstein in
der israelitischen Realschule (1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Mai
1905: "Fürth in Bayern. Professor Dr. S. Herzstein beging am
3. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum als Lehrer an der
israelitischen Realschule." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Mai
1905: "Fürth in Bayern. Professor Dr. S. Herzstein beging am
3. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum als Lehrer an der
israelitischen Realschule." |
Ausschreibung von Schulplätzen an der israelitischen Realschule
(1906)
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. August
1906: Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. August
1906:
"Israelitische Realschule (mit Handelsabteilung) in Fürth.
Das neue Schuljahr an unserer militärberechtigten Realschule und der
dazugehörigen Vorschule beginnt am 4. beziehungsweise 5. September.
Anmeldungen neuer Schüler werden schon jetzt entgegengenommen.
Jahresberichte und nähere Auskunft über die Anstalt durch den
Direktor
Dr. A. Feilchenfeld." |
Über die israelitische Realschule (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August
1908: "Fürth, 1. August (1908). Die Israelitische Realschule
(frühere Israelitische Bürgerschule) in Fürth wurde in diesem Jahre von
132 Schülern besucht. Bei der diesjährigen Absolutorialprüfung
bestanden, wie fast ausnahmslos in den früheren Prüfungen seit 1882,
alle Schüler der Oberklasse und erlangten das Zeugnis der Reife für den
einjährig-freiwilligen Militärdienst. Von den 8 Absolventen erhielt
einer in allen Fächern der schriftlichen und mündlichen Prüfung die
Note I. Die Anstalt ist die einzige israelitische höhere Lehreranstalt
mit einjähriger Militärberechtigung in Bayern und wird bekanntlich nach
streng religiösen Grundsätzen geleitet. Durch den Übertritt in die
neuerdings geschaffenen bayerischen Ober-Realschulen können sich die
Absolventen den Zugang zu den meisten Zweigen der Universitätsstudien
eröffnen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August
1908: "Fürth, 1. August (1908). Die Israelitische Realschule
(frühere Israelitische Bürgerschule) in Fürth wurde in diesem Jahre von
132 Schülern besucht. Bei der diesjährigen Absolutorialprüfung
bestanden, wie fast ausnahmslos in den früheren Prüfungen seit 1882,
alle Schüler der Oberklasse und erlangten das Zeugnis der Reife für den
einjährig-freiwilligen Militärdienst. Von den 8 Absolventen erhielt
einer in allen Fächern der schriftlichen und mündlichen Prüfung die
Note I. Die Anstalt ist die einzige israelitische höhere Lehreranstalt
mit einjähriger Militärberechtigung in Bayern und wird bekanntlich nach
streng religiösen Grundsätzen geleitet. Durch den Übertritt in die
neuerdings geschaffenen bayerischen Ober-Realschulen können sich die
Absolventen den Zugang zu den meisten Zweigen der Universitätsstudien
eröffnen." |
Prüfungen
an der israelitischen Realschule (1911)
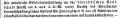 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juli 1911: "Die mündliche Absolutorialprüfung an der
israelitischen Realschule Fürth am 4. und 5. dieses Monats unter Vorsitz
des Ministerialkommissars königlichen Rektors Dr. Zwanziger ist von elf Schülern
der Oberklasse bestanden worden, darunter war einer mit lauter ersten
Noten."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juli 1911: "Die mündliche Absolutorialprüfung an der
israelitischen Realschule Fürth am 4. und 5. dieses Monats unter Vorsitz
des Ministerialkommissars königlichen Rektors Dr. Zwanziger ist von elf Schülern
der Oberklasse bestanden worden, darunter war einer mit lauter ersten
Noten." |
Lehrer Elias Godlewsky
kommt als Lehrer von Nördlingen an die Bürgerschule in Fürth (1911)
Elias
Godlewsky war Lehrer an der Bürgerschule seit 1911. Er stammte aus
Hirschaid, seine Frau Lucie aus dem
schlesischen Lüben. Das Paar hatte drei Kinder. Godlewsky stammte aus einer
Familie orthodoxer Lehrer, arbeitete in mehreren jüdischen Gemeinden in Bayern
(in Amberg bis 1908, dann bis 1911 in
Nördlingen, danach in Fürth) und kam dann
über Kattowitz und Berlin nach Kassel, wo er
1924 bis 1936 als Lehrer wirkte. Sechs Wochen vor der Pogromnacht 1938 zog er
mit seiner Frau Lucie nach Bad Wildungen
in die Synagoge am Dürren Hagen. Am Tag nach dem Pogrom 1938 wurde er mit knapp
20 Wildunger Juden ins KZ Buchenwald deportiert, nach drei Wochen entlassen und
floh 1939 nach London. Nach dem Krieg emigrierte er nach New York, wo er 1953
verarmt und chronisch krank mit 73 Jahren starb.
 Meldung
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 20. Oktober 1911:
"Nördlingen. Elias Godlewsky ist an die
Bürgerschule in Fürth
berufen worden." (im Bericht ist der Familienname verschrieben für
Godlewsky) Meldung
im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 20. Oktober 1911:
"Nördlingen. Elias Godlewsky ist an die
Bürgerschule in Fürth
berufen worden." (im Bericht ist der Familienname verschrieben für
Godlewsky) |
Das 50-jährige Bestehen der israelitischen Realschule
steht bevor (1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Juli
1912: "Fürth. Die Israelitische Realschule feiert mit
dem Ablauf dieses Schuljahres ihr 50-jähriges Bestehen. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Juli
1912: "Fürth. Die Israelitische Realschule feiert mit
dem Ablauf dieses Schuljahres ihr 50-jähriges Bestehen.
Es hat sich ein Jubiläumskomitee gebildet. Dieses hat zunächst
eine Sammlung für einen Pensions- und Reliktenfonds eingeleitet und für
diesen Zweck bereits 19.000 Mark erhalten." |
50-jähriges
Schuljubiläum der israelitischen Realschule (1912)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 25. Oktober 1912: "Fürth. Ein jüdisches
Schuljubiläum, dazu noch ein 50-jähriges, gehört in Deutschland
wohl zu den Seltenheiten; noch seltener wird es, wenn man auch die Tendenz
der Schule in Betracht zieht. Die israelitische Realschule in Fürth,
welche in diesen Tagen auf eine 50-jährige Tätigkeit zurückblicken
kann, ist eine jüdische Schule im wahren Sinne des Wortes: 'Tauroh im
Derech Erez' und hat dies Panier, welches die Gründer auf ihre Fahne
schrieben, bis zum heutigen Tage unbefleckt hoch gehalten.
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 25. Oktober 1912: "Fürth. Ein jüdisches
Schuljubiläum, dazu noch ein 50-jähriges, gehört in Deutschland
wohl zu den Seltenheiten; noch seltener wird es, wenn man auch die Tendenz
der Schule in Betracht zieht. Die israelitische Realschule in Fürth,
welche in diesen Tagen auf eine 50-jährige Tätigkeit zurückblicken
kann, ist eine jüdische Schule im wahren Sinne des Wortes: 'Tauroh im
Derech Erez' und hat dies Panier, welches die Gründer auf ihre Fahne
schrieben, bis zum heutigen Tage unbefleckt hoch gehalten.
Es sind jetzt 50 Jahre her, dass einige opferfreudige gesetzestreue
Männer in Fürth die Gründung der Schule, welche bis Ende des
letzten Jahrhunderts den Namen 'Israelitische Bürgerschule' führte, in
die Hand nahmen und damals in dem ersten Direktor, Dr. Selig Auerbach seligen
Andenkens (zuletzt Rabbiner in Halberstadt), eine treffliche leitende
Kraft fanden. Neben Dr. Auerbach wirkten in den ersten Jahren Prof. Dr.
Jos. Werner seligen Andenkens, der vor einigen Jahren in Frankfurt
seine Tage beschloss, und einige andere Kräfte, von denen S.
Nordheimer, der in Fürth lebt, noch zu nennen wäre), an der Anstalt
und verstanden es, dieselbe in bester Weise in die Höhe zu
bringen.
Von 1873-1900 stand Dr. S. Dessau seligen Andenkens der Schule vor.
Unter ihm, vom Jahre 1881 ab, hat die Schule die
Einjährig-Freiwilligen-Berechtigung erlangt. Seit 1901 wirkt Dr. Alfr.
Feilchenfeld, Sohn des bekannten Posener Rabbiners Dr. Feilchenfeld, als
Leiter der Schule, und auch er hat es verstanden, dieselbe nicht nur auf
der Höhe zu erhalten, sondern noch weiter zu vervollkommnen. Bei den
großen Anforderungen, welche an einer Realschule gestellt werden, ist es
keine Kleinigkeit, bei Heilighaltung des Sabbat noch Zeit für Unterricht
in den verschiedensten jüdischen Fächern zu finden. Die Resultat der
Schule waren bisher stets günstig, und die meisten Schüler der obersten
Klasse erlangten die Berechtigung zum Einjährigendienst.
Am 27. Oktober soll eine größere Feier den Schlussstein der 59 Jahre
krönen. Indem zu dieser Feier auch wir unsere Glückwünsche aussprechen,
möge der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, dass auch ferner der Schule
eine gedeihliche Weiterentwicklung vergönnt sei. J. F.,
München." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. November 1912: "Fürth in Bayern. Der Festakt
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Israelitischen Realschule
nahm folgenden Verlauf: Nach der Begrüßungsrede durch den 1. Vorstand, O.
L. Weiskopf, sprach der Vertreter des bayerischen Staatsministeriums;
er versicherte die Anstalt des Wohlwollens der Königlichen
Staatsregierung, die ihre Leistungen voll anerkenne. Direktor Dr. A.
Feilchenfeld hielt sodann die Festrede. Er legte in den Hauptzügen
die Geschichte der Anstalt von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag
dar. Eine Festschrift, die für die Feier eigens verfasst war, gibt in
sorgfältigster Weise das Wissenswerte über die Anstalt wieder. Diese
hatte gerade im Jubiläumsjahre den Höchststand ihrer Schülerzahl
erreicht. Im abgelaufenen Schuljahr verließen 14 Schüler die Oberklasse
der Anstalt, nachdem sie ihre Einjährigenprüfung sämtlich, zwei sogar
nur mitersten Noten, bestanden hatten. An Seine Königliche Hoheit, den
Prinzregenten Luitpold von Bayern, der augenblicklich in Berchtesgaden
weilt, wurde unter jubelnder Zustimmung der Festversammlung ein
Huldigungstelegramm abgesandt, das im Laufe des Nachmittags freundlich
erwidert wurde.
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. November 1912: "Fürth in Bayern. Der Festakt
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Israelitischen Realschule
nahm folgenden Verlauf: Nach der Begrüßungsrede durch den 1. Vorstand, O.
L. Weiskopf, sprach der Vertreter des bayerischen Staatsministeriums;
er versicherte die Anstalt des Wohlwollens der Königlichen
Staatsregierung, die ihre Leistungen voll anerkenne. Direktor Dr. A.
Feilchenfeld hielt sodann die Festrede. Er legte in den Hauptzügen
die Geschichte der Anstalt von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag
dar. Eine Festschrift, die für die Feier eigens verfasst war, gibt in
sorgfältigster Weise das Wissenswerte über die Anstalt wieder. Diese
hatte gerade im Jubiläumsjahre den Höchststand ihrer Schülerzahl
erreicht. Im abgelaufenen Schuljahr verließen 14 Schüler die Oberklasse
der Anstalt, nachdem sie ihre Einjährigenprüfung sämtlich, zwei sogar
nur mitersten Noten, bestanden hatten. An Seine Königliche Hoheit, den
Prinzregenten Luitpold von Bayern, der augenblicklich in Berchtesgaden
weilt, wurde unter jubelnder Zustimmung der Festversammlung ein
Huldigungstelegramm abgesandt, das im Laufe des Nachmittags freundlich
erwidert wurde.
Am Vorabend der eigentlichen Feier fand ein Kommers ehemaliger Schüler
statt, bei welcher Gelegenheit auch die Anregung gegeben wurde, einen
Verein früherer Schüler der Israelitischen Realschule zu
bilden." |
Festschrift
zur Feier des 50-jährigen Bestehens der israelitischen Realschule (1912 / 1913)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1913: "Festschrift zur Feier des 50-jährigen
Bestehens der israelitischen Realschule in Fürth in Bayern 1862-1912.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. April 1913: "Festschrift zur Feier des 50-jährigen
Bestehens der israelitischen Realschule in Fürth in Bayern 1862-1912.
Derartige Gelegenheitsschriften sind höchst freudig zu begrüßen,
weil sie ein ungemein wichtiges Material zur Kulturgeschichte bieten. Die
vorliegende heißen wir umso lieber willkommen, als sie mit schlichtem
warmen Ton, fern von jeder Phrasenhaftigkeit und Selbstbespiegelung die
Entwicklung einer gedeihlichen Anstalt darstellt. Die Festschrift ist sehr
hübsch ausgestattet, enthält die Bilder des Schulgebäudes, der vier
Vorstandsmitglieder seit 1862, der zwei früheren Leider und des gegenwärtigen.
Unter den früheren ist S. Dessau, 1873-1893, der im Jahre 1904 starb,
besonders gerühmt. Der gegenwärtige Leiter ist A. Feilchenfeld. Von den
älteren Lehrern wird besonders rühmend Professor Herzstein
hervorgehoben, auch der jetzige Leiter unserer Gemeindebibliothek, Dr. M. Stern,
empfängt ein schönes Lob. Es ist nicht möglich, im einzelnen auf die
Geschichte der Anstalt einzugehen, es mag nur hervorgehoben werden, dass
sie die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst erworben hat und
ihre Aufgabe, eine jüdische und zugleich eine deutsche Schule zu sein,
mit schönem Erfolge bisher erfüllt hat. L.G." |
Direktor
Dr. Alfred Feilchenfeld erhält den Titel eines königlichen Professors (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Dezember 1914: "Dem Direktor der israelitischen
Realschule in Fürth, Dr. Alfred Feilchenfeld, wurde der Titel
eines königlichen Professors mit dem Rang eines Gymnasialprofessors
verliehen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Dezember 1914: "Dem Direktor der israelitischen
Realschule in Fürth, Dr. Alfred Feilchenfeld, wurde der Titel
eines königlichen Professors mit dem Rang eines Gymnasialprofessors
verliehen". |
Zum Tod von Realschullehrer Dr. Emanuel Blüth
(1917)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. April
1917: "Reallehrer Dr. Emanuel Blüth, der mehr als 25
Jahre mit großem Erfolg an der israelitischen Realschule in Fürth
gewirkt und sich die Freundschaft seiner Kollegen und die Liebe seiner
Schüler in gleichem Maße errungen hat, ist im Alter von 52 Jahren
gestorben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. April
1917: "Reallehrer Dr. Emanuel Blüth, der mehr als 25
Jahre mit großem Erfolg an der israelitischen Realschule in Fürth
gewirkt und sich die Freundschaft seiner Kollegen und die Liebe seiner
Schüler in gleichem Maße errungen hat, ist im Alter von 52 Jahren
gestorben." |
Ehemalige Schüler der israelitischen Realschule im
Ersten Weltkrieg (1918)
Hinweis: die Lebensdaten hinter den Namen wurden ergänzt.
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August
1918: "Fürth. Von ehemaligen Schülern der Israelitischen
Realschule sind im letzten Jahre gefallen: Leo Fleischmann ((geb.
27.4.1890 in Fürth, gef. 24.10.1916), Leutnant Emil Höchster (geb.
27.10.1894 in Mainstockheim, gef. 12.10.1917), Unteroffizier Siegfried Rau
(geb. 6.3.1897 in Fürth, gef. 13.11.1917), Gefreiter Ernst Blüth (geb.
19.9.1891 in Fürth, gef. 14.4.1916), Simon Beer (geb. 17.10.1897 in
Sulzbürg, gef. 31.3.1918) und Max Kleinmayer (geb. 6.7.1898 in Fürth,
gef. 21.9.1917). Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August
1918: "Fürth. Von ehemaligen Schülern der Israelitischen
Realschule sind im letzten Jahre gefallen: Leo Fleischmann ((geb.
27.4.1890 in Fürth, gef. 24.10.1916), Leutnant Emil Höchster (geb.
27.10.1894 in Mainstockheim, gef. 12.10.1917), Unteroffizier Siegfried Rau
(geb. 6.3.1897 in Fürth, gef. 13.11.1917), Gefreiter Ernst Blüth (geb.
19.9.1891 in Fürth, gef. 14.4.1916), Simon Beer (geb. 17.10.1897 in
Sulzbürg, gef. 31.3.1918) und Max Kleinmayer (geb. 6.7.1898 in Fürth,
gef. 21.9.1917).
Vermisst werden: Gefreiter Sigmund Offenbacher (geb. 21.12.1887 in
Nürnberg, vermisst seit 24.10.1915), Fritz Singer und Alfred Rau (geb.
13.3.1896 in Fürth, vermisst seit 2.12.1916). Leutnant Israel Koschland
erhielt das Eiserne Kreuz 1. Klasse und eine große Anzahl ehemaliger
Schüler das Eiserne Kreuz 2. Klasse.
Hauptmann Julius Lewinsohn ist zum Major befördert
worden." |
| |
 Gedenktafel
für die im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen Schüler der israelitischen
Realschule - im Gebäude der Schule Blumenstraße 31. Erinnert wird
an: Simon Beer (Fürth, Infanterist), Manfred Bendit (Fürth,
Unteroffizier), Ernst Blüth (Fürth, Gefreiter), Alfred Bühler
(Nördlingen, Unteroffizier), Alfred Dingfelder (Uehlfeld, Leutnant),
David Dorn (Fürth, Infanterist), Oscar Ehrlich (Bamberg, Infanterist),
Leo Fleischmann (Fürth, Pionier), Justin Gottlieb (Wilhermsdorf, Ersatzr.),
Heinrich Heinemann (Schopfloch, Offiziers-Stv.), Max Heimann (Kronach,
Unteroffizier), Emil Höchster (Fürth, Leutnant), Simon Horn (Limanowa,
Infanterist), Max Kleinmeyer (Fürth, Infanterist), Josef Königshöfer
(Fürth, Offiziers-Stellv.), Siegfried Kolb (Sugenheim, Unteroffizier),
Willy Landau (Fürth, Fähnrich), Hermann Levi (Fischach, Ersatzr.), Willy
Lion (Fürth, Infanterist), Simon Mayer (Mönchsrot, Infanterist), Max
Meier (Nürnberg, Schütze), Siegfried Meinstein (Zürndorf, Kanonier),
Leopold Nussbaum (Mittelsinn, Infanterist), Ernst Offenbacher (Fürth,
Infanterist), Siegmund Offenbacher (Fürth, Infanterist), Max Peiser (Koschmin,
Unteroffizier), Alfred Rau (Fürth, Infanterist), Siegfried Rau (Fürth,
Unteroffizier), Siegfried Rothschild (Fürth, Unteroffizier), Herrmann
Samuel (Korbach, Leutnant), Fritz Singer (Fürth, Fähnrich), Max Schaeler
(Fürth, Fernsprecher), Wilhelm Stern (Neustadt a. Saale, Unteroffizier),
Moses Strauss (Hofheim, Unteroffizier). Gedenktafel
für die im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen Schüler der israelitischen
Realschule - im Gebäude der Schule Blumenstraße 31. Erinnert wird
an: Simon Beer (Fürth, Infanterist), Manfred Bendit (Fürth,
Unteroffizier), Ernst Blüth (Fürth, Gefreiter), Alfred Bühler
(Nördlingen, Unteroffizier), Alfred Dingfelder (Uehlfeld, Leutnant),
David Dorn (Fürth, Infanterist), Oscar Ehrlich (Bamberg, Infanterist),
Leo Fleischmann (Fürth, Pionier), Justin Gottlieb (Wilhermsdorf, Ersatzr.),
Heinrich Heinemann (Schopfloch, Offiziers-Stv.), Max Heimann (Kronach,
Unteroffizier), Emil Höchster (Fürth, Leutnant), Simon Horn (Limanowa,
Infanterist), Max Kleinmeyer (Fürth, Infanterist), Josef Königshöfer
(Fürth, Offiziers-Stellv.), Siegfried Kolb (Sugenheim, Unteroffizier),
Willy Landau (Fürth, Fähnrich), Hermann Levi (Fischach, Ersatzr.), Willy
Lion (Fürth, Infanterist), Simon Mayer (Mönchsrot, Infanterist), Max
Meier (Nürnberg, Schütze), Siegfried Meinstein (Zürndorf, Kanonier),
Leopold Nussbaum (Mittelsinn, Infanterist), Ernst Offenbacher (Fürth,
Infanterist), Siegmund Offenbacher (Fürth, Infanterist), Max Peiser (Koschmin,
Unteroffizier), Alfred Rau (Fürth, Infanterist), Siegfried Rau (Fürth,
Unteroffizier), Siegfried Rothschild (Fürth, Unteroffizier), Herrmann
Samuel (Korbach, Leutnant), Fritz Singer (Fürth, Fähnrich), Max Schaeler
(Fürth, Fernsprecher), Wilhelm Stern (Neustadt a. Saale, Unteroffizier),
Moses Strauss (Hofheim, Unteroffizier). |
40-jähriges Dienstjubiläum von Hauptlehrer Aron Ellinger
an der israelitischen Realschule (1922)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November
1922: "Fürth in Bayern, 7. November (1922). In diesen
Tagen werden es 40 Jahre, dass Herr Hauptlehrer Ellinger an der
israelitischen Realschule als Lehrer und Erzieher wirkt. Als junger Mensch
begann er an der israelitischen Realschule seinen Lehrberuf. In der
ununterbrochenen Kette der Jahre ist ihm das 'Lehren' ein 'Beruf' gewesen
und geblieben, der weit über das materielle Interesse hinausragt, das wir
gemeinhin mit dem Begriff des Berufes überhaupt verknüpfen. Mit einem
Idealismus sondergleichen, nur erklärlich durch die tiefe religiöse Erfassung
des jüdischen Lebens, ererbt von Generationen her, deren Ahnenreihe bis
zu SchaCH (Sabbataj ben Meir Hakohen, bedeutender Rabbiner
und Gelehrter, 1621-1662), ja bis zu ReMO (Moses Isserles,
bedeutender Gelehrter, Gründer der "Remo-Schul" in Krakau,
1520-1572) emporsteigt - mit diesem erworbenen und ererbten Idealismus
ausgerüstet, hat er schon fast zwei Generationen jüdischer Kinderseelen
mit dem Geist von Tora und profanem Wissen erfüllt. Abhold allen
äußeren Ehren - er hat sich ja auch jede öffentliche Feier seines
Jubiläums verbeten - hat er es veschmäht, Stelle oder Stellung zu
verlassen, um dorthin zu gehen, wo größerer materieller Gewinn und
bessere soziale Bedingungen winkten. Man weiß, welchen furchtbaren Kampf
ums Sein die jüdischen Schulen zu kämpfen haben, und gerade die
israelitische Realschule Fürths im Besonderen. Ein zweifaches Verdienst,
in solchem Sturm materieller Drangsale am Bord zu sein, auf seinem Posten
zu bleiben, solange dem Lenker der Schicksale es gefällt. Möge es
dem Jubilar noch lange vergönnt sein, Jungen und Jüngern seine Dienste
zu leihen. Geb's der die Zeiten ändert bald in sonnigeren und
froheren Tagen als jetzt! Möge der Jubilar noch recht lange Jahre im
Kreise seiner Lieben seinem Ideal leben können zu lernen und zu
lehren, zu beachten und zu tun." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November
1922: "Fürth in Bayern, 7. November (1922). In diesen
Tagen werden es 40 Jahre, dass Herr Hauptlehrer Ellinger an der
israelitischen Realschule als Lehrer und Erzieher wirkt. Als junger Mensch
begann er an der israelitischen Realschule seinen Lehrberuf. In der
ununterbrochenen Kette der Jahre ist ihm das 'Lehren' ein 'Beruf' gewesen
und geblieben, der weit über das materielle Interesse hinausragt, das wir
gemeinhin mit dem Begriff des Berufes überhaupt verknüpfen. Mit einem
Idealismus sondergleichen, nur erklärlich durch die tiefe religiöse Erfassung
des jüdischen Lebens, ererbt von Generationen her, deren Ahnenreihe bis
zu SchaCH (Sabbataj ben Meir Hakohen, bedeutender Rabbiner
und Gelehrter, 1621-1662), ja bis zu ReMO (Moses Isserles,
bedeutender Gelehrter, Gründer der "Remo-Schul" in Krakau,
1520-1572) emporsteigt - mit diesem erworbenen und ererbten Idealismus
ausgerüstet, hat er schon fast zwei Generationen jüdischer Kinderseelen
mit dem Geist von Tora und profanem Wissen erfüllt. Abhold allen
äußeren Ehren - er hat sich ja auch jede öffentliche Feier seines
Jubiläums verbeten - hat er es veschmäht, Stelle oder Stellung zu
verlassen, um dorthin zu gehen, wo größerer materieller Gewinn und
bessere soziale Bedingungen winkten. Man weiß, welchen furchtbaren Kampf
ums Sein die jüdischen Schulen zu kämpfen haben, und gerade die
israelitische Realschule Fürths im Besonderen. Ein zweifaches Verdienst,
in solchem Sturm materieller Drangsale am Bord zu sein, auf seinem Posten
zu bleiben, solange dem Lenker der Schicksale es gefällt. Möge es
dem Jubilar noch lange vergönnt sein, Jungen und Jüngern seine Dienste
zu leihen. Geb's der die Zeiten ändert bald in sonnigeren und
froheren Tagen als jetzt! Möge der Jubilar noch recht lange Jahre im
Kreise seiner Lieben seinem Ideal leben können zu lernen und zu
lehren, zu beachten und zu tun." |
Zum Tod von Professor Dr. Alfred Feilchenfeld, Direktor der
Israelitischen Realschule (1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August
1923: "Professor Dr. Feilchenfeld - das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen. Fürth in Bayern, 1. August
(1923). Am 15. Juli starb in Berlin, wo er zur Erholung bei seinen Kindern
weilte, nach längerem Leiden, aber dennoch unerwartet schnell, der in
weiten Kreisen mit Recht hochgeschätzte und angesehene Direktor der
hiesigen israelitischen Realschule, Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld.
Seine irdische Hülle wurde am 17. Juli in Berlin unter namhafter
Beteiligung der verschiedensten Kreise, zu denen die Trauerkunde gelangt
war, beigesetzt. Das Kuratorium, das Lehrerkollegium, der Verein
ehemaliger Schuler der israelitischen Realschule Fürth und viele andere
Vereine haben dem Heimgegangenen die letzte Ehre erwiesen und seinen Verdiensten
würdigende Nachrufe gewidmet. In Fürth selbst werden anerkennende
Trauerkundgebungen zu Schulbeginn folgen. Der Entschlafene, in Düsseldorf
geboren, ist nicht ganz 63 Jahre alt geworden, lange nicht so alt wie sein
sel. Vater, der berühmte Dr. Wolf Feilchenfeld - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen, der hochbetagt als Oberrabbiner von Posen das
Zeitliche gesegnet. Aber der Inhalt von Alfred Feilchenfelds Leben, das er
hauptsächlich dem Schulfache und der Heranbildung der Jugend in
religiösem und vaterländischem Geiste gewidmet hat, war gleichwohl reich
an ersprießlicher Arbeit und schönsten Erfolgen. Nachdem der nunmehr
Verewigte viereinhalb Jahre an der Real- und höheren Töchterschule der
Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt am Main und 11 Jahre als
Lehrer der Talmud Tora-Schule in Hamburg gewirkt hatte, trat er, durch
umfassende Studien und reiches Fachwissen wohl vorbereitet, im September
1900 die Direktorstelle an der Israelitischen Realschule zu Fürth in
Bayern an als würdiger Nachfolger der seligen Dr. Dessau und Dr. Auerbach
- das Andenken an die Gerechten ist zum Segen. 23 Jahre hat der nun
Heimgegangene die Israelitische Realschule hier mit Kraft, Umsicht,
Geschicklichkeit, unermüdlichem Fleiß und vornehmem Takt geleitet und
den guten Ruf derselben gefestigt und vermehrt. Einen Höhepunkt darin
erlebte der Verewigte, als im Jahre 1912 die Schule das Jubiläum ihres
50-jähriggen Bestehens feiern konnte, bei welcher Gelegenheit er eine
wertvolle Festschrift über die Geschichte der Anstalt veröffentlichte.
Eine geschätzte literarische Leistung bildet auch die von ihm
veranstaltete Ausgabe der Memoiren der Glückel von Hameln, wie er auch
sonst gediegene Beiträge zur klassischen, schöngeistigen und
religionsgeschichtlichen Literatur lieferte. Trotz seines mühevollen
Lehrerberufs stand Prof. Dr. Feilchenfeld mit in vorderster Reihe, wo es
galt, für die heiligen Aufgaben und Ziele der israelitischen
Bekennerschaft zu wirken und die Ehre des Judentums zu wahren. Auch bei
allen karitativen Bestrebungen wirkte er mit. Es ist ein Bild hoher
Vollendung und schönster Menschlichkeit, das er im Andenken aller zurücklässt.
Es wird seinen Freunden und Schülern niemals
entschwinden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August
1923: "Professor Dr. Feilchenfeld - das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen. Fürth in Bayern, 1. August
(1923). Am 15. Juli starb in Berlin, wo er zur Erholung bei seinen Kindern
weilte, nach längerem Leiden, aber dennoch unerwartet schnell, der in
weiten Kreisen mit Recht hochgeschätzte und angesehene Direktor der
hiesigen israelitischen Realschule, Prof. Dr. Alfred Feilchenfeld.
Seine irdische Hülle wurde am 17. Juli in Berlin unter namhafter
Beteiligung der verschiedensten Kreise, zu denen die Trauerkunde gelangt
war, beigesetzt. Das Kuratorium, das Lehrerkollegium, der Verein
ehemaliger Schuler der israelitischen Realschule Fürth und viele andere
Vereine haben dem Heimgegangenen die letzte Ehre erwiesen und seinen Verdiensten
würdigende Nachrufe gewidmet. In Fürth selbst werden anerkennende
Trauerkundgebungen zu Schulbeginn folgen. Der Entschlafene, in Düsseldorf
geboren, ist nicht ganz 63 Jahre alt geworden, lange nicht so alt wie sein
sel. Vater, der berühmte Dr. Wolf Feilchenfeld - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen, der hochbetagt als Oberrabbiner von Posen das
Zeitliche gesegnet. Aber der Inhalt von Alfred Feilchenfelds Leben, das er
hauptsächlich dem Schulfache und der Heranbildung der Jugend in
religiösem und vaterländischem Geiste gewidmet hat, war gleichwohl reich
an ersprießlicher Arbeit und schönsten Erfolgen. Nachdem der nunmehr
Verewigte viereinhalb Jahre an der Real- und höheren Töchterschule der
Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt am Main und 11 Jahre als
Lehrer der Talmud Tora-Schule in Hamburg gewirkt hatte, trat er, durch
umfassende Studien und reiches Fachwissen wohl vorbereitet, im September
1900 die Direktorstelle an der Israelitischen Realschule zu Fürth in
Bayern an als würdiger Nachfolger der seligen Dr. Dessau und Dr. Auerbach
- das Andenken an die Gerechten ist zum Segen. 23 Jahre hat der nun
Heimgegangene die Israelitische Realschule hier mit Kraft, Umsicht,
Geschicklichkeit, unermüdlichem Fleiß und vornehmem Takt geleitet und
den guten Ruf derselben gefestigt und vermehrt. Einen Höhepunkt darin
erlebte der Verewigte, als im Jahre 1912 die Schule das Jubiläum ihres
50-jähriggen Bestehens feiern konnte, bei welcher Gelegenheit er eine
wertvolle Festschrift über die Geschichte der Anstalt veröffentlichte.
Eine geschätzte literarische Leistung bildet auch die von ihm
veranstaltete Ausgabe der Memoiren der Glückel von Hameln, wie er auch
sonst gediegene Beiträge zur klassischen, schöngeistigen und
religionsgeschichtlichen Literatur lieferte. Trotz seines mühevollen
Lehrerberufs stand Prof. Dr. Feilchenfeld mit in vorderster Reihe, wo es
galt, für die heiligen Aufgaben und Ziele der israelitischen
Bekennerschaft zu wirken und die Ehre des Judentums zu wahren. Auch bei
allen karitativen Bestrebungen wirkte er mit. Es ist ein Bild hoher
Vollendung und schönster Menschlichkeit, das er im Andenken aller zurücklässt.
Es wird seinen Freunden und Schülern niemals
entschwinden." |
Schlussprüfung an der israelitischen Realschule
(1924)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai
1924: "Fürth in Bayern, 12. April (1924). Am 1. April ging
die diesjährige Schlussprüfung an der hiesigen Realschule zu Ende.
Sämtlichen Prüflingen, die die Oberklasse ein Jahr lang besucht hatten,
konnte das Schulzeugnis, das zum Übertritt in die siebente Klasse einer
Oberrealschule berechtigt, zuerkannt werden. Als Religionsaufgabe war zur
Bearbeitung gestellt: 'Maimonides und sein Werk.' Am 9. April fand die
Schlussfeier statt. Von dieser verdient hervorgehoben zu werden die
schöne Abschiedsrede eines Oberklässlers (A. Weinheber) an die Schule.
Er feierte das Andenken des am 15. Juli 1923 heimgegangenen Direktors und
Lehrers Prof. Dr. Feilchenfeld - das Andenken an den Gerechten
ist zum Segen - und gelobte zugleich im Namen seiner Mitschüler an
dem traditionellen Judentum festzuhalten. Der stellvertretende Direktor
Prof. Dr. S. Herzstein gab den Scheidenden gute Lehren mit auf den
ferneren Weg unter Anknüpfung an das Goethesche Wort (aus Hermann und
Dorothea): 'Haltet fest am Glauben und frommer Gesinnung!' Er forderte sie
auf, als treue Deutsche und aufrechte Juden durchs Leben zu gehen. Der
Vorsitzende des Vereins der Israelitischen Realschule Fürth, Herr J.
L. Weiskopf, dankte Herrn Prof. Dr. Herzstein, dem langjährigen
Lehrer der Anstalt, für seine bereitwillige wertvolle Aushilfe in der
Leitung der Schule und legte auch seinerseits den Abgehenden ans Herz, den
im Unterricht empfangenen Lehren anzuhängen und der Schule und dem
Judentum Ehre zu
machen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai
1924: "Fürth in Bayern, 12. April (1924). Am 1. April ging
die diesjährige Schlussprüfung an der hiesigen Realschule zu Ende.
Sämtlichen Prüflingen, die die Oberklasse ein Jahr lang besucht hatten,
konnte das Schulzeugnis, das zum Übertritt in die siebente Klasse einer
Oberrealschule berechtigt, zuerkannt werden. Als Religionsaufgabe war zur
Bearbeitung gestellt: 'Maimonides und sein Werk.' Am 9. April fand die
Schlussfeier statt. Von dieser verdient hervorgehoben zu werden die
schöne Abschiedsrede eines Oberklässlers (A. Weinheber) an die Schule.
Er feierte das Andenken des am 15. Juli 1923 heimgegangenen Direktors und
Lehrers Prof. Dr. Feilchenfeld - das Andenken an den Gerechten
ist zum Segen - und gelobte zugleich im Namen seiner Mitschüler an
dem traditionellen Judentum festzuhalten. Der stellvertretende Direktor
Prof. Dr. S. Herzstein gab den Scheidenden gute Lehren mit auf den
ferneren Weg unter Anknüpfung an das Goethesche Wort (aus Hermann und
Dorothea): 'Haltet fest am Glauben und frommer Gesinnung!' Er forderte sie
auf, als treue Deutsche und aufrechte Juden durchs Leben zu gehen. Der
Vorsitzende des Vereins der Israelitischen Realschule Fürth, Herr J.
L. Weiskopf, dankte Herrn Prof. Dr. Herzstein, dem langjährigen
Lehrer der Anstalt, für seine bereitwillige wertvolle Aushilfe in der
Leitung der Schule und legte auch seinerseits den Abgehenden ans Herz, den
im Unterricht empfangenen Lehren anzuhängen und der Schule und dem
Judentum Ehre zu
machen." |
Über die Arbeit der israelitischen Realschule unter dem neuen Direktor Dr.
Markus Elias (1924)
 Zur Person von Dr. Markus Elias
(1886-1984): Der Pädagoge Markus Elias ist am 15.
Juli 1886 in Wien geboren. Er besuchte in München das Gymnasium. Anschließend
lernte er bis 1908 in der Tora-Lehranstalt (Jeschiwa) bei Rabbiner Dr. Salomon
Breuer in Frankfurt und studierte zugleich romanische Sprachen an der
Frankfurter Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften. 1908 bis 1910
studierte er Geschichte, Französisch und Arabisch an der Universität
Heidelberg, wo er 1911 promoviert wurde. Seine ersten Anstellungen fand es als
Rabbinatsassessor bei Rabbiner Dr. Michael Cahn in Fulda und von 1912 bis 1923
als Religionslehrer (ab 1916 Studienrat) in Leipzig. 1923 bis 1928 übernahm er
die Leitung der israelitischen Realschule in Fürth, bis er als
Studiendirektor nach Frankfurt berufen wurde. Hier war er der letzte Direktor
von Realschule und Lyzeum der Israelitischen Religionsgesellschaft
(Samson-Raphael-Hirsch-Schule) von 1928 bis zu der durch Gestapo-Verfügung
erzwungenen Schließung im April 1939. Er konnte 1939 über England in die USA
emigrieren, wo er in New York erster Direktor der dort eröffneten
Samson-Raphael-Hirsch-Schule wurde. 1954 trat er in den Ruhestand. Dr. Elias
verfasste zahlreiche Schriften zu Erziehungs- und Bildungsfragen. Er lebte
zuletzt in Monsey, Rockland NY; er starb im August 1984 im Alter von 98 Jahren.
Zur Person von Dr. Markus Elias
(1886-1984): Der Pädagoge Markus Elias ist am 15.
Juli 1886 in Wien geboren. Er besuchte in München das Gymnasium. Anschließend
lernte er bis 1908 in der Tora-Lehranstalt (Jeschiwa) bei Rabbiner Dr. Salomon
Breuer in Frankfurt und studierte zugleich romanische Sprachen an der
Frankfurter Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften. 1908 bis 1910
studierte er Geschichte, Französisch und Arabisch an der Universität
Heidelberg, wo er 1911 promoviert wurde. Seine ersten Anstellungen fand es als
Rabbinatsassessor bei Rabbiner Dr. Michael Cahn in Fulda und von 1912 bis 1923
als Religionslehrer (ab 1916 Studienrat) in Leipzig. 1923 bis 1928 übernahm er
die Leitung der israelitischen Realschule in Fürth, bis er als
Studiendirektor nach Frankfurt berufen wurde. Hier war er der letzte Direktor
von Realschule und Lyzeum der Israelitischen Religionsgesellschaft
(Samson-Raphael-Hirsch-Schule) von 1928 bis zu der durch Gestapo-Verfügung
erzwungenen Schließung im April 1939. Er konnte 1939 über England in die USA
emigrieren, wo er in New York erster Direktor der dort eröffneten
Samson-Raphael-Hirsch-Schule wurde. 1954 trat er in den Ruhestand. Dr. Elias
verfasste zahlreiche Schriften zu Erziehungs- und Bildungsfragen. Er lebte
zuletzt in Monsey, Rockland NY; er starb im August 1984 im Alter von 98 Jahren.
Lit.: Paul Arnsberg: Die Geschichte der Frankfurter Juden. Bd. 3 Biographisches
Lexikon S. 102-103.
Hans Thiel (Bearb.): Die Samson-Raphael-Hirsch-Schule in Frankfurt am
Main. Dokumente - Erinnerungen - Analysen. hg. von der Kommission zur
Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden. Darin: Meier-Schüler:
Geschichte der Samson-Raphael-Hirsch-Schule 1928-1939. S. 101-118.
Internet: Seite
zur Samson Raphael Hirsch-Schule in der Website ffmhist.de (von hier auch
das Foto von Dr. Marcus Elias). |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember
1924: "Fürth, 10. Dezember (1924). Die jüdische Realschule
in Fürth arbeitet in ihrer Art an Wiederaufbau und Wiedergutmachung. Sie
versucht, den alten Glanz zurückzugeben, indem sie das
Missverhältnis verringert, das in den meisten Ländern des Westens
zwischen jüdischem und nichtjüdischem Wissen besteht. Das Ideal
jüdischen Wissens kann freilich auch sie nicht vermitteln, dazu steht sie
zu sehr zwischen den Anforderungen des Lebens und des Staates. Aber sie
gibt den Kindern, auch solchen anderer Schule, die Möglichkeit, täglich
2-4 Stunden zu sitzen und zu lernen. Sie pflegt alle jüdischen
Disziplinen, Torakunde in weitestem Umfange. Dass sie hierbei auf
richtigem Wege ist, zeigte die öffentliche Prüfung, die der
neue Direktor Dr. anknüpfend an die besten Zeiten der
Schule unter Dr. Dessau und Prof. Feilchenfeld, am 23. November abhielt.
Zweck dieser Prüfung sollte nicht sein, zu zeigen, was der einzelne
Schüler oder die einzelne Klasse konnte, dazu ist eine auf einen Tag
beschränkte Prüfung nie in der Lage. Hauptzweck war, die innere Struktur
des jüdischen Unterrichts zu zeigen, wie derselbe in 15 innerlich
verbundenen und aufeinander aufgebauten Gruppen einen Unterricht
verbürgt, der von den untersten Anfängen des Alphabets zum
selbständigen Lernen von Talmud emporsteigt und wie jeder Schule
seiner Individualität entsprechende Anregung finden kann. - Neben diesem
hauptsächlich beabsichtigten Zweck erreichte die Prüfung, dass man ein
Bild von der aufopfernden Tätigkeit der Lehrer und von der Lernlust der
Schüler gewann, zu deren Ermunterung die Schulkommission 17 Prämien
überreichen ließ. Mit dem Wunsche, dass (sinngemäß hebräisch und
deutsch:) die Eifrigen nicht müde, die Langsamen nicht entmutigt
werden mögen, entließ der Direktor die hochbefriedigte Versammlung. Bei
dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, dass die Schule auch
sonst Vorteile bietet, die sie für jeden Vater, insbesondere in Bayern,
als Zufluchtsstätte vor Rischut (= Verbotenes, Schlechtes), als
Bildungsstätte für Tora und profanes Wissen besonders empfiehlt.
Mit den Zielen einer sechs-klassigen Realschule verbindet sie in den drei
oberen Klassen handelswissenschaftlichen Unterricht. In den kleinen
Klassen lässt sie den einzelnen Schule umso besser fördern. Für
auswärtige Schüler findet sich gute Verpflegung und gewissenhafte
Beaufsichtigung bei Lehrern der Anstalt oder in anderen gut empfohlenen
Häusern." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember
1924: "Fürth, 10. Dezember (1924). Die jüdische Realschule
in Fürth arbeitet in ihrer Art an Wiederaufbau und Wiedergutmachung. Sie
versucht, den alten Glanz zurückzugeben, indem sie das
Missverhältnis verringert, das in den meisten Ländern des Westens
zwischen jüdischem und nichtjüdischem Wissen besteht. Das Ideal
jüdischen Wissens kann freilich auch sie nicht vermitteln, dazu steht sie
zu sehr zwischen den Anforderungen des Lebens und des Staates. Aber sie
gibt den Kindern, auch solchen anderer Schule, die Möglichkeit, täglich
2-4 Stunden zu sitzen und zu lernen. Sie pflegt alle jüdischen
Disziplinen, Torakunde in weitestem Umfange. Dass sie hierbei auf
richtigem Wege ist, zeigte die öffentliche Prüfung, die der
neue Direktor Dr. anknüpfend an die besten Zeiten der
Schule unter Dr. Dessau und Prof. Feilchenfeld, am 23. November abhielt.
Zweck dieser Prüfung sollte nicht sein, zu zeigen, was der einzelne
Schüler oder die einzelne Klasse konnte, dazu ist eine auf einen Tag
beschränkte Prüfung nie in der Lage. Hauptzweck war, die innere Struktur
des jüdischen Unterrichts zu zeigen, wie derselbe in 15 innerlich
verbundenen und aufeinander aufgebauten Gruppen einen Unterricht
verbürgt, der von den untersten Anfängen des Alphabets zum
selbständigen Lernen von Talmud emporsteigt und wie jeder Schule
seiner Individualität entsprechende Anregung finden kann. - Neben diesem
hauptsächlich beabsichtigten Zweck erreichte die Prüfung, dass man ein
Bild von der aufopfernden Tätigkeit der Lehrer und von der Lernlust der
Schüler gewann, zu deren Ermunterung die Schulkommission 17 Prämien
überreichen ließ. Mit dem Wunsche, dass (sinngemäß hebräisch und
deutsch:) die Eifrigen nicht müde, die Langsamen nicht entmutigt
werden mögen, entließ der Direktor die hochbefriedigte Versammlung. Bei
dieser Gelegenheit mag darauf hingewiesen werden, dass die Schule auch
sonst Vorteile bietet, die sie für jeden Vater, insbesondere in Bayern,
als Zufluchtsstätte vor Rischut (= Verbotenes, Schlechtes), als
Bildungsstätte für Tora und profanes Wissen besonders empfiehlt.
Mit den Zielen einer sechs-klassigen Realschule verbindet sie in den drei
oberen Klassen handelswissenschaftlichen Unterricht. In den kleinen
Klassen lässt sie den einzelnen Schule umso besser fördern. Für
auswärtige Schüler findet sich gute Verpflegung und gewissenhafte
Beaufsichtigung bei Lehrern der Anstalt oder in anderen gut empfohlenen
Häusern." |
Über die israelitische Realschule in Fürth (Bericht
von 1928)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1928: "Die israelitische Realschule in Fürth. Im Gegensatz zu der
größeren Zahl jüdischer Volksschulen ist als jüdische Mittelschule in
Bayern die 1862 gegründete 'höhere Bürgerschule in Fürth' vereinzelt
geblieben. Diese außerordentlich verdienstvoll wirkende Schule hat sich
dank der unermüdlichen Bemühungen ihrer Leiter Dr. Auerbach (1862-1873),
Dr. Dessau (1873-1898), Dr. Feilchenfeld (1901-1923) zu einer
Musteranstalt entwickelt, welcher 1911 in Anerkennung ihrer Leistungen
seitens des Reiches die Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen für
den Einjährig-Freiwilligen-Dienst erteilt wurde. Unter dem seit 1923 als
Direktor wirkenden Dr. Elias hat die Anstalt weitere gute Fortentwicklung
genommen. Sie zählt heute 160 Schüler und Schülerinnen, welche in zehn
Klassen (vier Vorschul- und sechs Realklassen) von elf im Hauptamte
wirkenden Lehrern (drei Volksschullehrer, zwei Religionslehrer, sechs
Reallehrer) und mehreren technischen Hilfskräften unterrichtet werden.
Die Schüler der Oberklasse haben seit Bestehen der Anstalt fast
ausnahmslos die seit 18.. ? unter Leitung eines Staatskommissärs an der
Anstalt abgehaltene Abgangsprüfung bestanden. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. März
1928: "Die israelitische Realschule in Fürth. Im Gegensatz zu der
größeren Zahl jüdischer Volksschulen ist als jüdische Mittelschule in
Bayern die 1862 gegründete 'höhere Bürgerschule in Fürth' vereinzelt
geblieben. Diese außerordentlich verdienstvoll wirkende Schule hat sich
dank der unermüdlichen Bemühungen ihrer Leiter Dr. Auerbach (1862-1873),
Dr. Dessau (1873-1898), Dr. Feilchenfeld (1901-1923) zu einer
Musteranstalt entwickelt, welcher 1911 in Anerkennung ihrer Leistungen
seitens des Reiches die Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen für
den Einjährig-Freiwilligen-Dienst erteilt wurde. Unter dem seit 1923 als
Direktor wirkenden Dr. Elias hat die Anstalt weitere gute Fortentwicklung
genommen. Sie zählt heute 160 Schüler und Schülerinnen, welche in zehn
Klassen (vier Vorschul- und sechs Realklassen) von elf im Hauptamte
wirkenden Lehrern (drei Volksschullehrer, zwei Religionslehrer, sechs
Reallehrer) und mehreren technischen Hilfskräften unterrichtet werden.
Die Schüler der Oberklasse haben seit Bestehen der Anstalt fast
ausnahmslos die seit 18.. ? unter Leitung eines Staatskommissärs an der
Anstalt abgehaltene Abgangsprüfung bestanden.
Der Betrieb der Anstalt legt dem Vereine, welcher Unternehmer der Schule
ist, schwere Lasten auf. Nur etwa zwei Fünftel der Eltern sind in der
Lage, das Schulgeld, welches in den Volksschulklassen RM 120.-, in den
Realschulklassen RM 180.- jährlich beträgt, voll zu bezahlen. Aber
selbst bei Vollzahlung würden die Eingänge nicht im Entferntesten zur
Deckung der Gehälter mit RM 48.000,- und der Pensionen für sechs
Bezugsberechtigte mit RM 14.000.- (wozu RM 6.000.- der Versorgungsverband
bayerischer Gemeindebeamten zuschießt) ausreichen. Schon jetzt lastet auf
dem Anwesen eine aus Betriebsausfüllen herrührende Hypothekenschuld von
RM 20.000.- neben einer ungedeckten Bankschule von RM
11.000.-.
Die Schule wendet sich daher an alle Glaubensbrüder Bayerns mit der Bitte
um Förderung. Es ist ihr Bestreben, jüdische Kinder zu guten Juden und
gebildeten Menschen, zu tüchtigen Kaufleuten und treuen Staatsbürgern zu
erziehen. Sie bedarf zur Erreichung dieser Zwecke finanzieller
Unterstützung durch Gemeinden, Verbände und einzelner. Sie bedarf aber
auch ideeller Förderung. Nicht nur Schulkinder aus Fürth und Nürnberg,
auch Volks- und Mittelschüler aus ganz Deutschland können Aufnahme
finden. Es ist Gelegenheit geboten, die Kinder in guten Pensionen zu
mäßigen Preisen unterzubringen.
Mögen alle zusammenstehen, diese segensreich wirkende Anstalt zu
erhalten." |
Nachfolger von Direktor Dr. Markus Elias an der israelitischen Realschule wird Oberlehrer Dr. Prager
(1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November
1928: "Fürth, 14. November (1928). Als Nachfolger des nach
Frankfurt am Main berufenen Herrn Direktor Dr. Elias wurde Oberlehrer
Dr. Prager zum Direktor der Israelitischen Realschule Fürth
gewählt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November
1928: "Fürth, 14. November (1928). Als Nachfolger des nach
Frankfurt am Main berufenen Herrn Direktor Dr. Elias wurde Oberlehrer
Dr. Prager zum Direktor der Israelitischen Realschule Fürth
gewählt." |
Über Direktor Dr. Fritz Prager
Über Direktor Fritz Prager liegen noch keine
ausführlicheren biographischen Angaben vor. Er stammt vermutlich aus Sulzbach
(möglicherweise Sohn des 1930 verstorbenen Gemeindevorstehers Leopold Prager
und der 1943 in Theresienstadt umgekommenen Pauline Prager geb. Arnstein) und
war mit Lina geb. Heinemann verheiratet. 1928 wird er als Studienassessor, wenig
später als Oberlehrer an der israelitischen Realschule genannt. 1929 übernahm
er als Studiendirektor die Leitung der Realschule. 1939 konnte er
emigrieren.
Hinweis: auf der Website einer Enkelin von Dr. Fritz Prager finden sich einige
weitere Informationen zur Familiengeschichte https://anneinpt.wordpress.com/family-history/
.
Verlobungsanzeige von Lina Heinemann und Fritz Prager (1922)
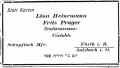 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1922:
"Statt Karten Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1922:
"Statt Karten
Lina Heinemann - Fritz Prager (Studienassessor)
- Verlobte.
Schopfloch Mittelfranken - Fürth in Bayern - Sulzbach
in der Oberpfalz.
2. Halbfeiertag zu Pessach." |
Zum Tod von Hauptlehrer Benzion Ellinger
(1938)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September
1938: "Fürth in Bayern, 5. September (1938). Vor kurzem
verschied im Alter von 75 Jahren der Hauptlehrer Benzion Ellinger in
Fürth in Bayern. Mit ihm ist eine Gestalt dahingegangen, die eine Epoche
der Geschichte verkörperte. Er war der unverfälschte Vertreter des
'alten Aschkenas', Gradlinig in seinem Handeln, eindeutig in seinem Wollen
und unbeugsam in der selbstverständlich gewordenen Erfüllung der Mizwaus.
Es war ein Leben, das sich ohne äußere Pose dafür mit umso größerer
innerer Aktivität auslebte. Benzion Ellinger war der Sohn eines großen
Talmud Chacham, Reb Josef Aron Ellinger in Niederstetten
(Württemberg), der Spross einer erlauchten bis auf Schach (= Sabbataj
ben Meir Hakohen, 1621 - 1662, hervorragender jüdischer Gelehrter des
17. Jahrhunderts, Verfasser zahlreicher halachischer und anderer
Werke) zurückführenden Ahnenreihe, ein würdiges Glied einer
lückenlosen Kette von Talmide Chachomim (Toragelehrte) und Jirej
Schomajim (Gottesfürchtige). Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September
1938: "Fürth in Bayern, 5. September (1938). Vor kurzem
verschied im Alter von 75 Jahren der Hauptlehrer Benzion Ellinger in
Fürth in Bayern. Mit ihm ist eine Gestalt dahingegangen, die eine Epoche
der Geschichte verkörperte. Er war der unverfälschte Vertreter des
'alten Aschkenas', Gradlinig in seinem Handeln, eindeutig in seinem Wollen
und unbeugsam in der selbstverständlich gewordenen Erfüllung der Mizwaus.
Es war ein Leben, das sich ohne äußere Pose dafür mit umso größerer
innerer Aktivität auslebte. Benzion Ellinger war der Sohn eines großen
Talmud Chacham, Reb Josef Aron Ellinger in Niederstetten
(Württemberg), der Spross einer erlauchten bis auf Schach (= Sabbataj
ben Meir Hakohen, 1621 - 1662, hervorragender jüdischer Gelehrter des
17. Jahrhunderts, Verfasser zahlreicher halachischer und anderer
Werke) zurückführenden Ahnenreihe, ein würdiges Glied einer
lückenlosen Kette von Talmide Chachomim (Toragelehrte) und Jirej
Schomajim (Gottesfürchtige).
Selbst ein Talmid Chacham (Toragelehrter), war ihm die Tora, die er
besaß, niemals eine 'Axt des Broterwerbes'. Es hat es geradezu ängstlich
vermieden, von den Möglichkeiten, die ihm die Anerkennung seiner Werte
bei seiner jüdischen Mitwelt hätte geben können, den geringsten
Gebrauch zu irgend einem persönlichen Vorteil zu machen. Nur für Tora
und Mizwoth setzte er die Wucht seiner Persönlichkeit ein. In
anspruchsloser Still floss sein Leben dahin.
Mit Sabbatbeginn ging er in seine Welt ein. In aufrichtiger Klage
beteuerten es ihm seine näheren und weiteren Freunde und Kollegen, dass
mit ihm einer unserer Besten dahingegangen. Seine Seele sei eingebunden
in den Bund des Lebens." |
Ausschreibung der Stelle eines Volksschullehrers
(1938)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar
1938: "An der privaten jüdischen Volksschule in Fürth ist bei
Beginn des nächsten Schuljahres die Stelle eines Volksschullehrers
zu besetzen. In Betracht kommen männliche Bewerber, die für eine wenig
gegliederte Schule geeignet sind und diesbezügliche Lehrerfahrung
besitzen. Meldungen sind mit Zeugnisabschriften an die Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar
1938: "An der privaten jüdischen Volksschule in Fürth ist bei
Beginn des nächsten Schuljahres die Stelle eines Volksschullehrers
zu besetzen. In Betracht kommen männliche Bewerber, die für eine wenig
gegliederte Schule geeignet sind und diesbezügliche Lehrerfahrung
besitzen. Meldungen sind mit Zeugnisabschriften an die
Schulleitung in Fürth in Bayern, Blumenstraße 31 (statt 30)
zu richten." |
Ausschreibung der Stelle einer Volksschullehrerin
(1938)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März
1938: "An der privaten jüdischen Volksschule in Fürth ist bei
Beginn des nächsten Schuljahres die Stelle einer Volksschullehrerin zu
besetzen. In Betracht kommen Bewerberinnen mit Schulpraxis. Bewerbungen
sind mit Zeugnisabschriften an die Schulleitung in Fürth in Bayern,
Blumenstraße 31 zu senden." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März
1938: "An der privaten jüdischen Volksschule in Fürth ist bei
Beginn des nächsten Schuljahres die Stelle einer Volksschullehrerin zu
besetzen. In Betracht kommen Bewerberinnen mit Schulpraxis. Bewerbungen
sind mit Zeugnisabschriften an die Schulleitung in Fürth in Bayern,
Blumenstraße 31 zu senden." |
Links, Quellen und Literatur
Links:
Literatur: es werden nur einzelne neuere Titel
genannt, in denen es jeweils ausführlichere Literaturverzeichnisse gibt
 |  Monika
Berthold-Hilpert:
Orte der Verfolgung und des Gedenkens in Fürth. Einladung zu einem
Rundgang. Haigerloch 2002. Monika
Berthold-Hilpert:
Orte der Verfolgung und des Gedenkens in Fürth. Einladung zu einem
Rundgang. Haigerloch 2002. |
 |  Katrin
Bielefeldt: Geschichte der Juden in Fürth. Jahrhundertelang eine
Heimat. Reihe: Historische Spaziergänge 3. Nürnberg
2005. Katrin
Bielefeldt: Geschichte der Juden in Fürth. Jahrhundertelang eine
Heimat. Reihe: Historische Spaziergänge 3. Nürnberg
2005. |
 |  "Mehr
als Steine..." Synagogen-Gedenkbach Bayern Band II: Mittelfranken. Bearbeitet
von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid, Hans-Christoph Haas und
Angela Hager, unter Mitarbeit von Frank Purrmann und Axel Töllner mit einem
Beitrag von Katrin Keßler. "Mehr
als Steine..." Synagogen-Gedenkbach Bayern Band II: Mittelfranken. Bearbeitet
von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid, Hans-Christoph Haas und
Angela Hager, unter Mitarbeit von Frank Purrmann und Axel Töllner mit einem
Beitrag von Katrin Keßler.
Herausgegeben von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Begründet und hrsg. von
Meier Schwarz, Synagogue Memorial Jerusalem.
Verlag Josef Fink, Lindenberg im Allgäu. 2010.
Zu Fürth: S. 266-349 (mit zahlreichen Literaturangaben).
|
|