|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Worms
Weitere Textseiten zur jüdischen Geschichte in Worms
- Texte aus dem 19./20. Jahrhundert zur
mittelalterlichen und neuzeitlichen jüdischen Geschichte in Worms
- Texte zu den Rabbinern und Lehrern der jüdischen Gemeinde vom
Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (diese Seite)
- Berichte aus dem jüdischen Gemeinde-
und Vereinsleben im 19./20. Jahrhundert
- Berichte zu einzelnen Personen aus der
jüdischen Gemeinde im 19./20. Jahrhundert
- Zum alten jüdischen Friedhof in Worms
("Heiliger Sand")
- Zum neuen jüdischen Friedhof in
Worms-Hochheim
Worms (kreisfreie
Stadt, Rheinland-Pfalz)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Hier: Berichte zu Rabbinern und Lehrern der jüdischen Gemeinde vom
Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Worms wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Hinweis: Die
Texte wurden dankenswerterweise von Susanne Reber (Mannheim) abgeschrieben und
mit Anmerkungen versehen.
Übersicht:
Aus
der Geschichte der Rabbiner in Worms
Aus der Geschichte der Rabbiner in Worms
Berichte zu Rabbinern des
Mittelalters
Siehe als Übersicht den Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Rabbiner_der_jüdischen_Gemeinde_Worms
Beitrag über Raschi (Artikel von
1885)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Mai 1885: "Raschi. (Mit Illustration) Wer kennt ihn nicht,
den in der Überschrift genannten Namen? Die Kinder in der Schule werden mit
dem nach ihm benannten Werken bekannt gemacht, und die größten jüdischen
Gelehrten können sie nicht entbehren. Im Grunde ist es aber gar kein Name;
das Wort Raschi ist aus den Anfangsbuchstaben 'Rabbi Schlomo Izchaki'
gebildet. Dieser große Mann, der Größte einer, wurde im Jahre 1038 in Troyes
in Frankreich geboren und um dieselbe Zeit, als der letzte Gaon (vgl.
https://de.wikipedia.org./wiki/Gaon), Rabbenu Hai (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hai_Gaon) in Babylonien den
Märtyrertod starb. Als die Sonne Israels im Osten zu leuchten aufhören
musste, ging eine neue Sonne im fernen Westen auf. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Mai 1885: "Raschi. (Mit Illustration) Wer kennt ihn nicht,
den in der Überschrift genannten Namen? Die Kinder in der Schule werden mit
dem nach ihm benannten Werken bekannt gemacht, und die größten jüdischen
Gelehrten können sie nicht entbehren. Im Grunde ist es aber gar kein Name;
das Wort Raschi ist aus den Anfangsbuchstaben 'Rabbi Schlomo Izchaki'
gebildet. Dieser große Mann, der Größte einer, wurde im Jahre 1038 in Troyes
in Frankreich geboren und um dieselbe Zeit, als der letzte Gaon (vgl.
https://de.wikipedia.org./wiki/Gaon), Rabbenu Hai (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hai_Gaon) in Babylonien den
Märtyrertod starb. Als die Sonne Israels im Osten zu leuchten aufhören
musste, ging eine neue Sonne im fernen Westen auf.
Abbildung: Das Äußere der alten Synagoge in Worms und das an dieselbe
angebaute Beth Hamidrasch
https://www.wissen.de/lexikon/bet-ha-midrasch.
Der junge Schlomo entstammte einer Gelehrtenfamilie. Sein Vater war ein
Talmudgelehrter; seine Mutter war eine Schwester des berühmten
Mainzer Rabbinen und liturgischen Dichters,
Rabbi Schimeon bar Jizchak bar Abon (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Simeon_bar_Isaac),den man allgemein als
'den Großen' nannte. Durch diese nahe Beziehung zu Mainz kam es auch wohl,
dass der wissbegierige Knabe von seinen Eltern dorthin geschickt wurde, um
daselbst seinem Studium obzuliegen. Zu Mainz befand sich zu jener Zeit die
bedeutendste talmudische Hochschule des Okzidents, an ihr hatte Rabbeum
Gerschom, das Licht |
 der
Diaspora, gelehrt und an ihrer Spitze stand nun mehr der von Raschi so oft
erwähnte Rabbenu Jakob ben Jakir. Von Mainz begab sich Raschi nach Worms, wo
er des Unterrichts der beiden großen Rabbinen Isak Halevi und Isak Ben
Jehudah genoss. Später begab er sich nach Speyer, um zu den Füßen des
Rabbenu Eljakim zu sitzen. Dann kehrte er in seine Heimat zurück, von wo aus
der die ganze Welt mit dem Lichte seines Geistes erleuchtete. der
Diaspora, gelehrt und an ihrer Spitze stand nun mehr der von Raschi so oft
erwähnte Rabbenu Jakob ben Jakir. Von Mainz begab sich Raschi nach Worms, wo
er des Unterrichts der beiden großen Rabbinen Isak Halevi und Isak Ben
Jehudah genoss. Später begab er sich nach Speyer, um zu den Füßen des
Rabbenu Eljakim zu sitzen. Dann kehrte er in seine Heimat zurück, von wo aus
der die ganze Welt mit dem Lichte seines Geistes erleuchtete.
Es scheint, dass Raschi eine Zeit lang in Worms als Rabbiner und Leiter der
Hochschule fungiert hat. Das Bild, welches wir heute unseren geehrten Lesern
vorführen, zeigt uns die alte Synagoge von Worms und das an dieselbe
angebaute Beth Hamidrasch, welches als das Haus bezeichnet wird, in dem
Raschi seine Lehrvorträge gehalten haben soll. Ein großer, aus Steinen
zusammengefügter Lehnsessel wird als "Raschi's Stuhl' gezeigt. Als wir im
Jahre 1855 zum ersten Male Worms besuchten, sahen wir noch ein an die Mauer
angefügtes steinernes Aleph, dass so groß war wie ein Mann von Mittelgröße.
Man sagte, dass Raschi unfähige Schüler auf das Aleph verwiesen, das heißt,
ihnen angedeutet habe, dass sie von vorne anfangen möchten. Bei der bald
darauf vorgenommenen Renovation des Gebäudes wurde dieses Aleph zertrümmert,
so dass jetzt keine Spur mehr vorhanden ist.
Raschi's Hauptwerk ist sein schöner, lichtvoller, umfassender Kommentar zu
fast allen Massechtot des Talmud Babli, dem wir das Verständnis dieses
gewaltigen Werkes verdanken. Ohne den Kommentar Raschis würde uns der Talmud
Babli vielfach ebenso unverständlich sein wie manche Parteien des Talmud
Jeruschalmi. Raschi hat allerdings hierbei die Kommentarien älterer
Gelehrter, namentlich des Gershom aus Mainz, benutzt; Sein Kommentar
übertraf jedoch die Erklärungen aller seiner Vorgänger derart, dass er sie
alle verdrängte. Kein anderer hat so lichtvoll, klar und mit so seltener
Präzision und Kürze die schwierigsten Talmudstellen zu erklären vermocht.
Ebenso wertvoll wie seine Erklärung in der mündlichen Lehre, ist sein
Kommentar zur heiligen Schrift, namentlich zum Pentateuch. So ist Raschi wie
kein anderer, der Lehrer aller Geschlechter geworden, die nach ihm gelebt
haben und wird es auch für alle Zeit bleiben. – Raschi starb im Alter von 77
Jahren, im Jahre 1105, in der Vollkraft seines Schaffens. Gerade war er mit
der Kommentierung des Traktats Mackot beschäftigt; er war bis zum 19. Blatte
desselben gekommen und hatte gerade das Wort tahor 'rein'
geschrieben, als seine reine Seele dem Körper entfloh. Sein Schüler und
Schwiegersohn Rabbi Jehuda bar Nathan, vollendete den Kommentar zu der
genannten Massechta. Ein anderer Schwiegersohn hieß Rabbenu Meïr,
welcher der Vater dreier berühmter Söhne wurde: Rabbenu Samuel Bar Meïr
(Raschbam), Rabbenu Jizchak bar Meïr (Ribam)
und Rabbenu Jakob bar Meïr, genannt
Rabbiner Tham. Diese drei Enkel Raschis wurden die Begründer der großen
Tosafisten-Schule. Sie waren die größten Männer ihrer Zeit, und namentlich
der jüngste von Ihnen, Rabbenu Tham, wurde der Lehrer von ganz Israel. Seine
Entscheidungen sind meistens für die Halachah maßgebend, selbst da, wo er
sich im Widerspruche mit seinem Großvater befindet.
Einen Sohn hat Raschi nicht hinterlassen. Seine drei Töchter waren mit
großen Talmudgelehrten vermählt. Zwei von diesen haben wir genannt; der Name
des dritten ist nicht auf uns gekommen.
Wie mit allen großen Männern, hat sich auch mit Raschi die Sage vielfach
beschäftigt. Sie weiß von seinen großen Reisen und Wanderungen zu erzählen;
sie bringt ihn in Verbindung mit Gottfried von Bouillon, dem Helden des
ersten Kreuzzuges, der Jerusalem eroberte und zum Könige der heiligen Stadt
ausgerufen wurde. Die Sage erzählt, Raschi habe den unglücklichen Ausgang
des Kreuzzuges prophezeit und vorher gesagt, dass Gottfried nur mit drei
Rosen und einem halben Rosse in die Heimat zurückkehren würde. In Begleitung
dreier Reiter sei der Fürst bis an das Tor der Stadt gelangt und habe
geschworen, Raschi und alle Juden zu strafen, weil die Prophezeiung nicht
ganz in Erfüllung gegangen da er doch mit vier Rossen heimkehre. Die
Zugbrücke wurde niedergelassen, und Gottfried ritt mit seinen Begleitern in
die Stadt ein. Als der letzte derselben die Brücke passierte, fiel durch
einen unglücklichen Zufall das Falltor herab und halbierte Ross und Reiter,
so dass die Prophezeiung wirklich in Erfüllung gegangen war; denn das halbe
Ross lag außerhalb der Stadt Tores. Voll Bewunderung habe sich nunmehr
Gottfried in das Haus des Rabbiners begeben, um ihm seine große Verehrung zu
bezeigen. Dort aber herrschte eine unheimliche Stille und als der Fürst in
das Studierzimmer des Rabbiner eintrat, sah er ein Licht auf der Erde
stehen, das die Bahre des großen Weisen beleuchtete.
Dass diese Sage der Wahrheit nicht entspricht, ist zweifellos. Gottfried von
Bouillon starb in Jerusalem fünf Jahre früher als Raschi. – Wir bedürfen
solche wunderbaren Geschichten nicht, um die Größe unseres erhabenen Lehrers
Rabbenu Schlomo Bar Jizchak (Raschi) zu würdigen. Seine großen Werke, sein
tugendhafter Lebenswandel, seine unaussprechliche Bescheidenheit haben ihm
ein unvergängliches Denkmal gesetzt." |
500. Todestag Maharils (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 25. September 1927: "Worms. Zum 500. Todestage
Maharils. Die hiesige Gemeinde beging den 500jährigen Todestag Maharils
mit einer zahlreich besuchten eindrucksvollen Gedenkfeier. Der erste
Vorsitzende, Sanitätsrat Dr. Nickelsburg, leitete den Abend durch
eine feinsinnige Ansprache ein. Rabbiner Dr. Holzer beleuchtete in
tiefschürfender Weise Maharils Leben und Wirken, seine Größe und Bedeutung
und förderte manchen ganz neuen Gesichtspunkt zutage. Umrahmt wurde die
Feier durch Gesänge von Kantor Agulnik und des Synagogenchor-Vereins. Redner
und Sänger wurden mit allseitigem Beifall ausgezeichnet. Am Morgen des
eigentlichen Todestages besuchten die Mitglieder des Chewra-Vereins die
Grabstätte des großen Toten und verrichteten Gebete zu seinen Ehren. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 25. September 1927: "Worms. Zum 500. Todestage
Maharils. Die hiesige Gemeinde beging den 500jährigen Todestag Maharils
mit einer zahlreich besuchten eindrucksvollen Gedenkfeier. Der erste
Vorsitzende, Sanitätsrat Dr. Nickelsburg, leitete den Abend durch
eine feinsinnige Ansprache ein. Rabbiner Dr. Holzer beleuchtete in
tiefschürfender Weise Maharils Leben und Wirken, seine Größe und Bedeutung
und förderte manchen ganz neuen Gesichtspunkt zutage. Umrahmt wurde die
Feier durch Gesänge von Kantor Agulnik und des Synagogenchor-Vereins. Redner
und Sänger wurden mit allseitigem Beifall ausgezeichnet. Am Morgen des
eigentlichen Todestages besuchten die Mitglieder des Chewra-Vereins die
Grabstätte des großen Toten und verrichteten Gebete zu seinen Ehren.
Anmerkung: Rabbiner Dr. Holzer (1873 -1951):
http://www.wormserjuden.de/Biographien/Holzer.html
Oberkantor Leo Agulnik (1869 – 1933)
Grab im Friedhof Hochheim. |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 23. September 1927: Text wie oben. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 23. September 1927: Text wie oben. |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Oktober 1927: "Zum 500. Gedenktag seines
Todes. Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Oktober 1927: "Zum 500. Gedenktag seines
Todes.
Die jüdischen Gemeinden der ganzen Welt und in erster Linie in
Mainz,
gedachten am 19. September in stiller Trauer des Maharil genannten Mainzer
Rabbi. Die Mitglieder der Mainzer israelitischen Religionsgesellschaft
hatten sich am Vorabend des Gedenktages nach Worms begeben. Die jüdischen
Blätter des In- und Auslandes würdigen ihn, die Wiener illustrierte
Zeitschrift 'Menorah' lässt sogar eine Maharil-Nummer erscheinen, in der
jüdische und nichtjüdische Schriftsteller ein Kulturbild des Mainz vor einem
halben Jahrhundert entwerfen. Welche Bewandtnis hat es nun mit diesem Rabbi
Maharil? Zunächst sei daran erinnert, dass im Mittelalter die Führung der
deutschen Juden, und im weiteren Sinne der ganzen Welt, in
religionsgeschichtlicher Hinsicht von den drei großen Städten des
Mittelrheins: Speyer, Worms und Mainz, ausging. Nach der Zerstörung des
zweiten Tempels zu Jerusalem wurde das geistige Zentrum des Judentums nach
dem Irak verlegt. Hier entstand der Talmud, der im vierten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung seinen Abschluss fand, eine spätere Blüte des jüdischen
Schrifttums entwickelte sich nach der gäonischen Epoche in Spanien, von wo
sie ihren Weg über Frankreich an den Rhein und sich hier voll entfaltete.
Die jüdischen Hochschulen in Mainz genossen den besten Ruf, und ihre Leiter
und Lehrer besaßen eine Autorität, von der man sich heute kaum mehr einen
Begriff machen kann. Ihr Wort galt der ganzen jüdischen Welt, und sogar
Verordnungen und Gesetze, die sie, dem Drange der Zeit folgend, neu
einführten, wurden und werden noch heute gehalten. So entstand u.a. in Mainz
das Gesetz, das auch den Juden verbietet, mehr als eine Frau zu heiraten, es
wurde hier das Gesetz des Briefgeheimnisses und verschiedene andere
erlassen. Maharil, der ebenfalls eine Hochschule in Mainz leitete, hat diese
Gesetze gesammelt und nicht nur viele Gebräuche, die sich im Abendland im
Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hatten, niedergeschrieben, er hat auch
Entscheidungen über die Grundgesetze der jüdischen Lehre herausgegeben und
sie in mehreren Werken zusammengefasst. Aus allen Gauen des Reiches wurden
Fragen an ihn gerichtet und als Vorbild tiefster Frömmigkeit übte er einen
gewaltigen Einfluss auf die Zeitgenossen aus. Obgleich Maharil zwanzig Jahre
vor dem Erscheinen des ersten Druckwerks des Mainzer Katholicons starb,
waren seine Bücher durch Abschriften in den Händen der meisten jüdischen
Gemeinden. Als späterhin die großen, methodisch geordneten Gesetzbücher, wie
Schulchan Arun (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch) u.a. Entstanden, griff
man stets auf den Maharil zurück und so trifft man noch heute in den
Erläuterungen dieser Kodizes auf seinen Namen. Die Bezeichnung 'Maharil'
entstand wahrscheinlich aus den Anfangsbuchstaben seines wirklichen Namens.
Sein Vater hieß Rabbi Moses Mulin HaLevi, er selbst Rabbi Jakob, so bedeutet
'Maharil' 'des Moses ha Levi Sohn, Rabbi Jakob Levi'. Wir finden u.a. in ihm
die höchst anschauliche Beschreibung einer jüdischen Hochzeitsfeier in
Mainz, die damals nur an Freitagen stattfand, vermutlich aus
Sparsamkeitsgründen, um den Hochzeitsschmaus mit der Sabbatmahlzeit zu
vereinigen. Nach Feststellungen von Rabbiner Dr. Bondi, Mainz, war Maharil
ungefähr vierzig Jahre in Mainz Rabbiner; er wurde Amtsnachfolger seines
Vaters. Zur Zeit von Maharils Vater war die jüdische Gemeinde in Mainz sehr
groß. Damals regierte als Kurfürst der erste Adolf von Nassau, der die Juden
wohlwollend behandelte.
Bald nach dem Tode Maharils zogen schwere Gewitter über die Juden von Mainz
herauf, das Blut vieler Hunderte von Märtyrern färbte die Gassen
Alt-Moguntias. In Trauergesängen und -sagen wurde ihr Leben und Sterben
später von Mainzer Dichtern gefeiert.
Vgl. auch
https://schumstaedte.de/entdecken/grabstein-des-maharil/ und
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/biographien/maharil.html
und
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_ben_Moses_haLevi_Molin".
|
Über Rabbiner Jakob von Worms (um 1500 - 1563; Artikel von
1867)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. Januar 1867: "6. R. Jaakow min Wirmijsa (= Rabbi
Jakob von Worms) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. Januar 1867: "6. R. Jaakow min Wirmijsa (= Rabbi
Jakob von Worms)
Einer handschriftlichen biographischen Skizzierung der Rabbiner aus Worms
entnehme ich folgende Beschreibung eines hochgestellten Gesetzeslehrers im
16. Jahrhundert. Rabbi Jakob von Worms, berühmt als großer Gelehrter
in allen Zweigen der jüdischen Wissenschaft, war der Sohn des bekannten
Handelsmannes Chajim vom Hause Juda. Dieser wohlhabende Mann hatte
noch zwei andere Söhne, ebenfalls gelehrte Rabbiner deren Namen Bezalel
und Heilmann waren. Beide jedoch werden mehr wegen ihrer Kinder als
ihrer eigenen Gelehrsamkeit gefeiert. Der eine war Vater der vier berühmten
Brüder: Chajim, Löwe, Simson und Sinai, der andere von dem
gelehrten Samuel der Deutsche.
Jakob von Worms, um's Jahr 1500 geboren, war lange einer der vorzüglichsten
Gottesgelehrten in Deutschland, als ihn der Kaiser Ferdinand I. zum
Oberhaupt und Oberrabbiner aller deutschen Gemeinden ernannte: Rosch we
Aw Beth Din lekol Tefuzot Aschenazi (= Oberhaupt und Vorsitzender des
Rabbinatsgerichts für die ganz aschenasische Diaspora), wie David Gans (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Gans) sich im Zemach David
ausdrückt. Da diese Ernennung vom Kaiser allein ausging, so nannte man ihn:
Kaisers Raw = Kaiserlicher Rabbiner. Er starb 1563 kinderlos,
hatte aber den Trost, dass sein Name durch seinen gelehrten Neffen
fortgepflanzt wurde."
Anm.: Zu Kaiser Ferdinand I.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(HRR) |
Zum 300. Todestag von Rabbiner Elia ben Moscheh Loans
(1936)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Juni 1936: "Kleines Feuilleton. R.(abbi) Eila ben Moscheh Loans
(Aschkenasi) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Juni 1936: "Kleines Feuilleton. R.(abbi) Eila ben Moscheh Loans
(Aschkenasi)
Zu seinem 300. Todestage am 21. Tammus
Eines an Wissen und Lebenswandel vorbildlichen Rabbiner sei hier in wenigen
Worten gedacht, nachdem 300 Jahre seit seinem Tode vorübergegangen sind.
Der in der Überschrift genannte R.(abbi) Elia Loans war 1564 in Frankfurt a.
M. geboren, hatte dort bei R.(abbi) Akiba Frankfurter und außerdem beim
Maharal (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Judah_L%C3%B6w) in Prag gelernt und
war hierauf in
Fulda,
Hanau,
Friedberg,
Mainz und zweimal in Worms Rabbiner, von 1600 -1604 und später von 1621
bis zu seinem 1636 erfolgten Tode. Er war ein Mann, dem Gelehrsamkeit lag,
dessen Gefühlsseite aber auch stark ausgeprägt war, sodass er einmal für
Gesang und Dichtungen viel Interesse hatte, und ferner durch die bezaubernde
Kraft seines Wesens und seines Redens in den Ruf eines Wundermannes kam, von
dem Erzählungen und Legenden so sehr umgingen, dass man ihn schließlich Elia
Baalschem (Besitzer des guten Namens, Anm. S.R) nannte.
Er betätigte sich auch literarisch in ganz bestimmter Sphäre. Leichte
Lektüre und leichte Kommentare lagen ihm nicht. In dem melodischen, aber
deshalb dem Verstande nicht leicht erschließbaren Schir Haschirim (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheslied) forschte er und schrieb
dazu einen Kommentar nach kabbalistischer Art, ja nach dem Vorbild des Sohar
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zohar) und nannte seine Schrift
Rinnath dodim; sie ist zweimal in Basel gedruckt worden (1606 und 1612).
So ging er auch den Gedankengängen des Koheleth (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohelet) nach und schrieb dazu in
gleicher Art einen Kommentar in seinen letzten Lebensjahren, erlebte aber
den Druck dieser Schrift Michlal jofi nicht, denn sie wurde erstmalig
in Amsterdam 1695 und später noch einmal in Berlin 1775 gedruckt. Er
erklärte schwere Stellen in Bachja ibn Pakudas (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bachja_ibn_Pakuda) 'Choboth
hawewachoth'. Auch schrieb er unter dem Titel Maagle zedek einen
Kommentar zum Chumischkommentar (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chumasch) des R.(abbi) Bechaj. Zum Sohar
und zu dem Tikkune hasohar schrieb er ebenfalls Erklärungen unter dem
Namen Aderet Eliajahu und Zophnath paneach.
Das ist eine Seite seiner literarischen Tätigkeit. Aber er war ja
vielseitiger. Er verfasste Techinoth (Bittgesuche, Anm. S.R.),
religiöse Lieder und gab sie zusammen mit den gleichnamigen Liedern seines
Lehrers Akiba Frankfurter heraus und noch anderen Liedern für Sabbat-Ein-
und Ausgang heraus; er hatte das Glück, Druck und Verbreitung seiner
Schriften zu erleben.
Am bekanntesten ist sein Streitgedicht 'Wikuach hajajin im hamajim'-Streit
zwischen Wasser- und Wein; in diesem Gedicht beweisen beide Getränke ihre
Vorzüge durch Stellen aus der Bibel. Es wurde zuerst 1582 nur im hebräischen
Text gedruckt, erschien 1757 in Amsterdam in deutscher Übersetzung und
erhielt dabei die Bemerkung, dass es nach der Melodie des 'Dietrich von
Bern' zu singen sei.
Er stammte aus der Familie Raschis und war ein Nachkomme des großen, um die
deutschen Juden wohlverdienten R.(abbi) Joselmann von
Rosheim, so rühmte seine Grabinschrift,
deren Text nicht gut leserlich ist, da der Stein durchgebrochen ist, seine
Lehrtätigkeit und seine publizistische Betätigung während das Wormser
Memorbuch von ihm in den Sprüchen der Väter sagt: Der Geist der Menschen hat
seinen Gefallen an ihm.
Ein würdiges Grab am Rabbinerplatz des Wormser Friedhofes ist es, zu dem wir
am 300. Todestage unsere Blicken richten."
Zu Akiba Frankfurter:
https://www.myheritage.de/names/akiba_frankfurter |
Berichte zu
den Rabbinern des 19. und 20. Jahrhunderts
Übersicht über die Rabbiner in Worms im 19./20. Jahrhundert
Rabbiner in Worms waren im 19./20. Jahrhundert, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Rabbiner_der_jüdischen_Gemeinde_Worms:
- 1778-1808: Samuel Levi (1751-1813)
- 1810-1823: Isaak (Eisik) Adler (gest. 1823); Vater der
Rabbiner Dr. Samuel Adler und Rabbiner Dr. Abraham Adler (beide siehe unten bei
den Predigern).
- 1823-1864: Jakob (Koppel) Bamberger (1785-1864)
- 1864-1866: Dr. Markus Jastrow (1829 in Rogasen - 1903 in
Germantown, Philadelphia/USA); war Rabbiner in Warschau, Worms und Philadelphia.
- 1867-1910: Dr. Alexander Stein (1843-1914)
- 1910-1935: Dr. Isaak Holzer (1873-1951); emigrierte 1935 in die
USA.
- 1935-1937: Dr. Manfred Rosenberg (1908-1980); emigrierte nach
Palästina.
- 1938-1939: Dr. Helmut Frank (Jakob bar Israel)
(1912-1989); emigrierte nach Philadelphia, USA.
Über Rabbiner Samuel Levi (gest. 1813) (Artikel von
1900)
Anmerkung: nachfolgender Beitrag ist von Samson Rothschild, der auch die
Publikation verfasst:
Samson Rothschild: Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde (Mitte des 18.
Jahrhunderts bis zur Gegenwart. J. Kauffmann Verlag / Frankfurt a.M. 1920.
Hierin zu Samuel Levi S. 7-14.
Online zugänglich.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember
1900: "Ein Rabbiner von Worms vor 100 Jahren Von Samson Rothschild
– Worms a./Rh. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember
1900: "Ein Rabbiner von Worms vor 100 Jahren Von Samson Rothschild
– Worms a./Rh.
Als man im Jahre 1889 die Erinnerungsfeier an die vor 200 Jahren erfolgte
Zerstörung der Stadt Worms durch die Franzosen beging, wurde auch an die
gleiche Feier erinnert, welche im Jahr 1789 dahier abgehalten wurde. Jener
Feier stand der Rabbiner Samuel Levi, der Großvater des jüngst
verstorbenen Hofkapellmeisters Hermann Levi, vor. 27 Jahre
lang war Samuel Levi Rabbiner in Worms. Er zählte zu den Notablen (=
Honoratioren vgl.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Notabeln#Frankreich) der Stadt und
flüchtete, um nicht von den Franzosen als Geisel für Contribution (etwa:
Lösegeld) mitgenommen zu werden, nach Frankfurt (am Main). Er wohnte
1806 dem vorbereitenden und 1807 dem wirklichen Sanhedrin (Versammlung
von jüdischen Geistlichen vgl.
https://de.wikisource.org/wiki/Der_große_Sanhedrin_zu_Paris) in
Paris bei, war ein Jahr angesehenes Mitglied derselben, umso mehr, da er der
französischen Sprache vollkommen mächtig gewesen (sc. durch den
Schulbesuch in Augsburg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_bei_St._Anna_(Augsburg)) und
ganz frei in derselben reden konnte. Infolge seines dortigen Wirkens war er
von Napoleon zum Grandrabbin du Consistoire de Département de Tonnère (=
Großrabbiner des Konsistoriums vom Donnersberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Département_du_Mot-Tonnerre) nach
Mainz berufen, wo er nach sechs Jahren 1813 starb. In welchem Grade er der
französischen Sprache mächtig war, beweist Folgendes, das er selbst
niedergeschrieben. 'Zu damaliger Zeit, in den 90erJahren (1790er Jahre)
waren in Worms sehr wenige Leute der französischen Sprache kundig; ich war
vielleicht der Einzige, der sie geläufig sprach und cursorisch (hier:
flüssig) las. Und da dies in der Stadt bekannt war, versammelten sich
eine zeitlang allabendlich Bürgermeister, Gemeinderäte und viele Bürger vor
meinem in der Häuserreihe der Judengasse (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Judengasse_(Worms)) etwas
zurückstehenden Hause, um ihnen auf dem Sessel sitzend, den Inhalt der
angelangten Pariser Zeitung sogleich deutsch vorzutragen.'
Interessant ist die folgende Tatsache, die nicht nur von der Redegabe,
sondern auch von der |
 Macht
und dem Einfluss auf die Gemüter seiner Gemeinde zeigt. Es waren auf der
Gemeindestube mehrere tausend Gulden Pupillen- (vgl.
https://de.wikipedia.org./wiki/Pupillen) und andere Gelder in
eiserner Kiste verwahrt und über Nacht daraus gestohlen worden, worüber dann
natürlich Jammer und Klage in der Gemeinde erfolgte. Das kleine Eigentum und
die Ersparnis vieler geringer Leute, insbesondere vieler Witwen und Waisen
war plötzlich verschwunden und der Täter konnte nicht ermittelt werden. Da
ordnete Rabbiner Levi einen Fasttag an, an dem alle Gemeindeangehörige bis
zum 13. Jahre herab, mit Ausnahme schwächlicher Frauen, in der Synagoge
erscheinen sollten. Als dies geschah und die Synagoge dicht gefüllt war, kam
Levi in Sargenes (vgl.
https://en.wikipedia.org./wiki/Kittel), begleitet vom Vorbeter und
Schofarbläser (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schofar), gleichfalls in Sargenes, und
stellte sich mit ihnen vor die heilige Lade (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Toraschrein), die Tora aus derselben
holend und hoch empor im Arme haltend. Darauf ließ er, wie am Roschhaschonah
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana) Schofar blasen und
hielt dann eine eindringliche ergreifende Rede an die Versammelten, das
Unglück schildernd, welches der Diebstahl über so viele arme und geringe
Leute gebracht habe. Macht
und dem Einfluss auf die Gemüter seiner Gemeinde zeigt. Es waren auf der
Gemeindestube mehrere tausend Gulden Pupillen- (vgl.
https://de.wikipedia.org./wiki/Pupillen) und andere Gelder in
eiserner Kiste verwahrt und über Nacht daraus gestohlen worden, worüber dann
natürlich Jammer und Klage in der Gemeinde erfolgte. Das kleine Eigentum und
die Ersparnis vieler geringer Leute, insbesondere vieler Witwen und Waisen
war plötzlich verschwunden und der Täter konnte nicht ermittelt werden. Da
ordnete Rabbiner Levi einen Fasttag an, an dem alle Gemeindeangehörige bis
zum 13. Jahre herab, mit Ausnahme schwächlicher Frauen, in der Synagoge
erscheinen sollten. Als dies geschah und die Synagoge dicht gefüllt war, kam
Levi in Sargenes (vgl.
https://en.wikipedia.org./wiki/Kittel), begleitet vom Vorbeter und
Schofarbläser (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schofar), gleichfalls in Sargenes, und
stellte sich mit ihnen vor die heilige Lade (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Toraschrein), die Tora aus derselben
holend und hoch empor im Arme haltend. Darauf ließ er, wie am Roschhaschonah
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana) Schofar blasen und
hielt dann eine eindringliche ergreifende Rede an die Versammelten, das
Unglück schildernd, welches der Diebstahl über so viele arme und geringe
Leute gebracht habe.
'Ich glaube den Täter zu kennen oder vermute ihn doch,' sagte er,' und bitte
ihn fußfällig, das Geld wieder zurückzubringen (zu welchem Ende er drei
Häuser bezeichnete, in welche es geschehen konnte, ohne bemerkt zu werden,
wie er dann auch jedermann befahl, an den nächsten drei Abenden zu Hause zu
bleiben, seine Türe aber offen zu lassen, damit kein Nachbar ein Kommen und
Gehen erfahre), in welchem Fall ich den Segen Gottes auf ihn, seine Kinder
und Kindeskinder herabrufe etc. Sofern es aber binnen drei Tagen das Geld
nicht zurückgebracht habe, tue ich ihn und seine Angehörigen in ewigen Bann
und rufe alle Flüche auf sie herab, die in der Tora geschrieben stehen' etc.
Nach diesen Worten soll die ganze Gemeinde in lautes Weinen ausgebrochen
sein. Sie hatten aber den gehofften Erfolg. In der zweiten Nacht wurde das
Geld in den Hausflur von Herz Kahn gelegt. Es fehlte nur wenig daran." |
Über
Rabbiner Samuel Levi (gest. 1813) (Artikel von 1912)
Vgl. Beitrag von Susanne Reber (2023):
Rabbiner Samuel Wolf
Levi
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. April 1912: "Samuel
Levi. (Ein Wormser Rabbiner und Mitglied des Pariser Sanhedrin.)
Von Samson Rothschild - Worms Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. April 1912: "Samuel
Levi. (Ein Wormser Rabbiner und Mitglied des Pariser Sanhedrin.)
Von Samson Rothschild - Worms
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde ein Kapellmeister öfters und in
Ehren genannt, weil er ein hervorragender Interpret Wagner'scher Musik
gewesen und deshalb mit dem 'Meister' und durch diesen mit König Ludwig II.
von Bayern in lebhaftem persönlichen Verkehr gestanden. Dieser
Generaldirektor, welcher Titel ihm später verliehen wurde, Hermann Levi,
war
der Enkel des Mannes, dessen Lebensbild die folgenden Zeilen geben sollen.
Ich folge dabei vorhandenen Akten, ganz besonders aber den Aufzeichnungen
des
Sohnes, des verstorbenen Rabbiners Benedikt Levi in
Gießen, die mir von den Hinterbliebenen freundlichst zur Verfügung gestellt
wurden.
Samuel Levi war der Sohn des Rabbiners Wolf Levi, der das große Landrabbinat
Pfersee bei
Augsburg verwaltete. Auch war
er der Sohn und Enkel von Rabbinern, welche ihre Abstammung auf den
berühmten Rabbiner Elia Wilna (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaon_von_Wilna) zurückführte. In der Tat hatten alle drei Brüder Söhne,
die Elias hießen. Die Bedeutung und das hohe Alter dieser Gemeinde ist
daraus ersichtlich, dass das in der Münchner Staatsbibliothek befindliche,
aus dem Jahre 1343 stammende Talmudmanuskript, welches einen sehr hohen Wert
hat, einst dieser Gemeinde gehörte und das Pferseer 'Schatz' (= Talmud, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud) heißt. Neben seinem großen talmudischen Wissen, scheint er auch Sinn für weltliche Bildung gehabt zu
haben, denn er ließ seine Söhne, selbst die beiden, die sich dem
Rabbinerberufe widmeten, täglich die Schulen zu Augsburg (vgl.
http://gym-anna.de/wordpress/?page_id=737)
besuchen, um Deutsch und Französisch zu lernen, was in damaliger Zeit eine
große Seltenheit war (Anmerkung
unten). Wolf Levi hatte drei Söhne: Samuel, Salomon und
Hirsch. Samuel wurde Rabbiner in Worms, Salomon in
Gailingen
und Hirsch widmete sich dem Kaufmannsstande. Er wurde später Bankier in
Augsburg und hinterließ seinen Kindern ein bedeutendes Vermögen. Ein Sohn
desselben, der das Bankgeschäft übernahm, gab dieses später auf, weil die
Börse ihn als Juden von der Gilde ausschloss. Dass er neben seiner
kaufmännischen und sonstigen Bildung auch des Hebräischen und Talmudischen
sehr kundig gewesen sein muss, beweist der Umstand, dass er mit der
Grabsteininschrift für seinen in
Mainz
verstorbenen Bruder Samuel nicht zufrieden war und verlangte, dass man ihn
mit einer von ihm selbst verfassten beauftragen möge, was aber das Rabbinat
ablehnte. Die Anhänglichkeit des Vaters (sc. Hirsch Levi, Augsburg, Anm. S.R) an
seinen Bruder (Rabbiner Samuel Levi, Worms u. Mainz, Anm. S.R.) hat sich
auch auf dessen in Mainz wohnenden Sohn vererbt, der testamentarisch
bestimmte, einst neben seinem Onkel, dem Rabbiner Samuel Levi, beerdigt zu
werden, was auch geschah, trotzdem diese Stelle nur für Rabbiner und seine
Laien bestimmt war. Der Rabbiner Ellinger soll damals geantwortet haben:
'Der Verstorbene hat mit diesem Wunsche nicht bloß seine Liebe zum Onkel,
sondern auch zum Rabbiner und Talmudgelehrten bekundet, somit die Torah
geehrt, erfüllen wir also seinen Wunsch.'
Samuel Levi war im Jahre 1751 geboren. Sein Sohn, der schon genannte frühere
Rabbiner Benedikt Levi zu
Gießen, beschreibt ihn nach seiner Erinnerung als einen schönen, großen, starken
und stattlichen Mann mit rundem, vollem, etwas gerötetem Gesichte, weißem,
dünnen Barte,
|
 schönen
Augen, schön geformtem Munde, schöner Nase, zarten, weißen Händen, das runde
kleine Käppchen oder den großen dreieckigen breiten Hut auf dem Kopfe, immer
fein gekleidet, beim Spaziergange das spanische Rohr mit großem Goldknopfe
in der Hand, schon durch die äußere Erscheinung Ehrfurcht einflößend. Der
Spazierstock, den die spätere Witwe dem befreundeten Medizinalrat Dr.
Metternich in Mainz geschenkt, vererbte sich laut einer testamentarischen
Bestimmung auf den ältesten Sohn in der Familie; ein Rückkauf für die
Familie Levi wurde kurzerhand abgelehnt. schönen
Augen, schön geformtem Munde, schöner Nase, zarten, weißen Händen, das runde
kleine Käppchen oder den großen dreieckigen breiten Hut auf dem Kopfe, immer
fein gekleidet, beim Spaziergange das spanische Rohr mit großem Goldknopfe
in der Hand, schon durch die äußere Erscheinung Ehrfurcht einflößend. Der
Spazierstock, den die spätere Witwe dem befreundeten Medizinalrat Dr.
Metternich in Mainz geschenkt, vererbte sich laut einer testamentarischen
Bestimmung auf den ältesten Sohn in der Familie; ein Rückkauf für die
Familie Levi wurde kurzerhand abgelehnt.
Levi gehörte zu den wenigen Rabbinern damaliger Zeit, die mit großem
rabbinischen Wissen, humanistische Bildung und feinste gesellschaftliche
Formen verbanden.
In sehr jugendlichem Alter als Rabbiner nach Worms berufen, heiratete er,
kaum 20 Jahre alt, Pessel Hall, eine junge Witwe, die nach 10jähriger Ehe
starb, auch seine zweite Frau, die Tochter des sehr angesehenen Hirsch Worms
von Saarlouis, dessen Bruder der
Stammvater der hervorragenden Familie Worms in Frankreich war, starb bald;
er heiratete dann deren Schwester Brendelchen, später Sara genannt, eine
junge, schöne, geistreiche, brave und wohltätige Frau. Beim Ausbruche der
französischen Revolution war Levi Rabbiner in Worms. Da er zu den Notablen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Notabeln) der Stadt zählte und
fürchten musste, von den Franzosen bei Überwältigung des linken Rheinufers
als Geisel mitgenommen zu werden, flüchtete er mit Frau und Kind nach
Frankfurt. Dort hielt er sich 11
Monate lang auf, bis der Sturm vorüber und Ordnung zurückgekehrt war. Im
Grunde seines Herzens war er der französischen Freiheits- und
Gleichheitsidee sehr gewogen, wie er später auch von hoher Bewunderung für
Napoleon erfüllt war, wovon mehrere hebräische Oden und Gebete sowie
Predigten zur Ehre desselben Zeugnis gaben.
Weil durch die Revolution und Einverleibung von Worms samt dem linken
Rheinufer die jüdische Gemeinde sich aufgelöst hatte, erklärte eine
Versammlung sämtlicher Juden der Stadt die Notwendigkeit der
Wiedererrichtung der Gemeinde. Nahezu hundert Unterschriften enthält das
Aktenstück, das sich im Archiv der hiesigen jüdischen Gemeinde befindet, in
welchen die Unterzeichner sich verpflichten, einen Rabbiner, einen Vorbeter
und einen Schächter anzustellen und alle Institutionen zu schaffen, die zu
einem jüdischen Gemeinwesen gehören.
In damaliger Zeit waren in Worms sehr wenige Leute, die der französischen
Sprache mächtig waren. Rabbiner Levi vielleicht der einzige, der sie
geläufig sprach und kursorisch las. Da man das in der Stadt wusste,
versammelten sich eine Zeit lang allabendlich Bürgermeister und Gemeinderat
und andere vor dem Hause des Rabbiners in der Judengasse, der ihnen dann den
Inhalt der angekommenen Pariser Zeitung sogleich deutsch vorlas, was sein
Ansehen in der Stadt nicht wenig vermehrte.
Im Jahre 1789 wurde die Erinnerung an die vor hundert Jahren zerstörte Stadt
Worms durch die Franzosen* durch gottesdienstliche Feiern begangen. Es ist
interessant, das Programm zu erfahren, welches diese Feier in der hiesigen
jüdischen Gemeinde zugrunde lag. Laut einer Mitteilung des 'Wormsischen
Zeitungs- und Intelligenz-Manual' vom 30. Mai 1789 hatte die jüdische
Gemeinde folgende Bekanntmachung erlassen:
'Auf Befehl E. Hochedlen Magistrats wird dieses Dankfest von der hiesigen
Judenschaft auf den Pfingstdienstag ebenfalls gefeiert. Dieselbe haben 10
Reichsthaler Straf daraufgesetzt, wenn sich ein hiesiger Schutzjude (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Judenregal) auf diesen Tag entfernen wollte.
Gleich nach der Frühschule (Frühgottesdienst in der Synagoge, vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schacharit)
wird mit Absingung des 18.,22., 27., 30., 31., 35., 40., 46., 54., 56., 64.,
66., 71., 85., 86., 113., 118. Und 124. Psalms die Feier eröffnet. Hiernächst um 9 Uhr erscheint sämtliche Judenschaft in ihren
Sabbathskleidern vor des Rabbiners Samuel Levi Behausung und um ½ 10 Uhr
ziehen dieselbe Paarweiß in folgender Ordnung zur Schule (gemeint ist die
alte Synagoge, Anm. S.R.): 1. kommen die Bruderschaften und Schulmeister mit
ihren Schülern, hierauf folgt der Oberrabbiner, die Vorsteher und
Kastenmeister (Verwalter des jüdischen Gemeindevermögens, Anm. S.R.) samt
ihren Beamten, endlich aber die ganze Judengemeinde. In der Schule wird
alles mit Lichtern illuminiert und mit Ehrenpforten (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenpforte)
von grünen Maien mit anhängenden Blumen und Zitronen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Etrog),
der Altar (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Bima) aber mit reichen Decken
geziert. Hierauf wird der Oberrabbiner eine dieser Feier angemessene Rede
halten, nach welcher noch viele Psalmen abgesungen werden. Vor bemeldetem
feierlichem Zuge tragen die ledigen Juden eine große, mit Sr. Kaiserlichen
Majestät und der Reichsstadt Worms Wappen gezierte Tafel mit der
Unterschrift: Es lebe Ihre Kaiserliche Majestät und unsere gnädige
Herrschaft, wie auch sämtliche Bürger und Judenschaft.' –
Interessant ist auch folgende Tatsache, die nicht nur von der Rednergabe
Levis, sondern auch von seiner Macht und seinem Einflusse auf die Gemüter
der Gemeinde Zeugnis gibt. Das Schriftstück befindet sich im Archiv der
hiesigen israelitischen Gemeinde. Es waren auf der Gemeindestube mehrere
tausend Gulden Pupillen- und andere Gelder in eiserner Kiste verwahrt und über
Nacht daraus gestohlen worden, worüber dann natürlich Jammer und Klage in
der Gemeinde erfolgte. Das kleine Eigentum und die Ersparnis vieler geringer
Leute, insbesondere vieler Witwen und Waisen war plötzlich ver. Als dies
geschah und die Synagoge dicht gefüllt war, kam Levi in Sargenes (vgl.
https://en.wikipedia.org./wiki/Kittel), begleitet vom Vorbeter und Schofarbläser (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schofar), gleichfalls in
Sargenes, und stellte sich mit ihnen vor die heilige Lade (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Toraschrein),
die Tora aus derselben holend und hoch empor im Arme haltend. Darauf ließ
er, wie am Roschhaschonah (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana)
Schofar blasen und hielt dann eine eindringliche ergreifende Rede an die
Versammelten, das Unglück schildernd, welches der Diebstahl über so viele
arme und geringe Leute gebracht habe. 'Ich glaube den Täter zu kennen oder
vermute ihn doch,' sagte er,' und bitte ihn fußfällig, das Geld wieder
zurückzubringen (zu welchem Ende er drei Häuser bezeichnete, in welche es
geschehen konnte, ohne bemerkt zu werden, wie er dann auch jedermann befahl,
an den nächsten drei Abenden zu Hause zu bleiben, seine Türe aber offen zu
lassen, damit kein Nachbar |
 ein
Kommen und Gehen erfahre), in welchem Falle ich den Segen Gottes auf ihn,
seine Kinder und Kindeskinder herabrufe etc. Sofern es aber binnen drei
Tagen das Geld nicht zurückgebracht habe, tue ich ihn und seine Angehörigen
in ewigen Bann und rufe alle Flüche auf sie herab, die in der Tora
geschrieben stehen' etc. Nach diesen Worten soll die ganze Gemeinde in
lautes Weinen ausgebrochen sein. Sie hatten aber den gehofften Erfolg. In
der zweiten Nacht wurde das Geld in den Hausflur von Herz Kahn gelegt. Es
fehlte nur wenig daran." ein
Kommen und Gehen erfahre), in welchem Falle ich den Segen Gottes auf ihn,
seine Kinder und Kindeskinder herabrufe etc. Sofern es aber binnen drei
Tagen das Geld nicht zurückgebracht habe, tue ich ihn und seine Angehörigen
in ewigen Bann und rufe alle Flüche auf sie herab, die in der Tora
geschrieben stehen' etc. Nach diesen Worten soll die ganze Gemeinde in
lautes Weinen ausgebrochen sein. Sie hatten aber den gehofften Erfolg. In
der zweiten Nacht wurde das Geld in den Hausflur von Herz Kahn gelegt. Es
fehlte nur wenig daran."
Welche Verehrung man Rabbiner Levi von Seiten seiner Gemeinde
entgegengebracht, davon nur zwei Beispiele: In der
Judengasse bestand ein freier Platz,
auf dem Levi in der Dämmerung öfters spazieren ging. Während dieser Zeit
wagte niemand, den Platz zu betreten: 'Der gehört dem Rabbiner.'
Sein Sohn, der Rabbiner in Gießen (Dr.
Benedikt Levi, Anm. S.R.), hörte bei einem Besuch in Worms, dass eine
arme Familie in der Judengasse das Bild seines Vaters besitze. Er gab sich
alle Mühe, das Bild zu erwerben. 'Um keinen Preis geben wir dieses Bild her,
zu ihm haben wir in schweren Tagen aufgeblickt und haben uns dabei
getröstet, wir geben das Bild nicht her.' Hier mögen auch einige Bonmots von
Levi (Rabbiner Samuel Levi, Anm. S.R.) einen Platz finden. Es kam
eines Tages ein Mann zu ihm und meldete: 'Rebbe, ich habe den N.N. am Sabbat
schreiben sehen.' (Schreiben ist für einen gläubigen Juden am Sabbat
nicht erlaubt, weil es Arbeit darstellt, die am Sabbat, dem Ruhetag,
verboten ist, Anm. S.R.). Levi antwortete: 'Wer heißt dich sehen, du
brauchst nicht zu sehen.'
An einem Fasttage rief jemand Levi, der am Fenster saß, zu: 'Rebbe, ich
meine es ist Nacht.' (Im Judentum wird vom Sonnenuntergang bis zum
Sonnenuntergang des Folgetages gefastet. In dieser Zeit darf der Gläubige
weder essen noch trinken, allerdings darf er nicht länger als 25 Stunden
fasten, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Fasten gilt auch als Form der
Buße und rituellen inneren Reinigung. Schwangere, Stillende und Kinder bis
zum 12. Lebensjahr [bei Mädchen] oder 13. Lebensjahr [bei Jungen] sollen
nicht fasten. Kranke fragen einen Rabbiner, der dann Art und Dauer mit
Hinblick auf die Krankheit berücksichtigt, da die Gesundheit auf keinen Fall
gefährdet werden darf. – Die Person, die Rabbiner Levi hier anspricht,
möchte den Fasttag verkürzen, Anm. S.R.). Darauf antwortete er: 'Ich
meine, bei dir war's schon lange Nacht.
Bei so ausgezeichnetem persönlichem Wesen und dem Ruf eines nicht bloß
talmudisch gelehrten, sondern auch humanistisch gebildeten Rabbiners
genießend, war es natürlich, dass er ganz der Mann war, der sich zum
Mitgliede des Pariser Sanhedrin (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin) eignete, welchem er denn
auch fast ein Jahr lang sowohl dem vorbereitenden als dem 1807
zusammenberufenen angehörte. Er zählte zur Mittelpartei und machte natürlich
oft den Sprecher, namentlich bei festlichen Gelegenheiten im Namen der nur
Deutsch redenden Rabbiner. Napoleon hatte besondere Freude an dem gebildeten
Rabbiner. In einer Audienz habe Napoleon Levi gefragt, was denn die Rabbiner
tun würden, wenn er die von ihnen beabsichtigten Maßregeln selbst
gegen ihre Gutheißung durchführen werde? 'Ew. Majestät kann niemand
widerstehen!' war die Antwort Levis.
Während seiner Anwesenheit in Paris hatte er in der großen Synagoge eine
Drascha (Predigt) unter großem Beifall gehalten, und sowohl diese als sein
kluges Verhalten auf dem Sanhedrin fanden solche Anerkennung, dass Napoleon
ihm die die Wahl gelassen, Grand-Rabbin (Oberrabbiner, Anm. S.R.) zu
Metz oder zu Mainz zu werden, welche
letztere Stadt, sodass er 1808 zum Grand Rabbin du consistoire du
département du Mont-Tonnèrre (Oberrabbiner des Presbyteriums des
https://de.wikipedia.org/wiki/Département_du_Mont-Tonnerre) ernannt
wurde, welche Stelle er dann ein Jahr darauf antrat. In Worms erzählte man
die Ursache seines Weggangs von da in folgender Weise. Levi hatte einen
Metzger eine vorgelegte Lunge für trefa (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Treif) erklärt. Dieser zeigte sie
nachher dem 'Michael Brog' ('Brog' ist rheinfränkische damalige Mundart
für 'Prag', Anm. S.R,), wie er im Volksmunde hieß, (sein eigentlicher
Name war Michael Melas und stammte aus Prag). Dieser sagte, der Raw
(Rabbiner, Anm. S.R.) habe sich geirrt, das Vieh sei koscher. Als der
Metzger dem Rabbiner Levi hiervon Mitteilung gemacht, habe letzterer in
seiner Erregung die Vorsteher der Gemeinde zusammenbitten lassen und ihnen
eröffnet, dass er in einer Gemeinde, in der ein Privatmann sich erdreistete,
zu 'passkenen' (Urteil sprechen, Anm. S. R.), nachdem es der Rabbiner
schon getan, nicht mehr länger Rabbiner sein wolle, und er ging nach -
Mainz. Dort verwaltete Herz Scheuer
das Rabbinat, dass er beim Eintritt Levis niederlegte. Obwohl Levi und
Scheuer immer in Frieden zusammenlebten, suchten Scheuers Anhänger Levi das
Leben recht schwer zu machen, was sich bei seiner ersten Drascha (Predigt)
besonders bemerkbar machte. Sie stellten derartig spitzfindige Fragen an
ihn, dass Levi ärgerlich ausgerufen haben soll: 'Bischloma stehe ich
oben und ihr unten, sagt Kaddisch!' Das Leben wurde Levi in Mainz
umso schwerer gemacht, als der Scheuer’sche Anhang auch Vertreter im
Vorstand fand. Der Zwiespalt kam besonders zum Durchbruch bei einer Audienz,
die Vorstand und Rabbiner 1812 bei Napoleon in Mainz haben sollten. Levi,
der diesen und das Leben am Pariser Hof mit seinen Etiketten kannte, gab dem
Vorstand das Programm, das dieser ablehnte mit den Worten: 'Man braucht
nicht zur Audienz zu fahren, man kann auch gehen, und auch die von Levi
vorgeschriebene Kleidung sei nicht nötig.' Der Vorstand, der sparen wollte,
wurde – nicht empfangen. Das hat Levi derart gekränkt, dass die Gelbsucht
ihn befiel und er anfing zu kränkeln. Trotzdem ihn Napoleon später allein
sehr huldvoll empfing, so konnte er die erste Abweisung nicht verschmerzen.
Am 13. September 1813 starb er, umgeben von einer trauernden Witwe und acht
unversorgten Waisen. Kurz vor seinem Tode hatte er all seinen Kindern die
Hände aufgelegt, ohne etwas dabei zu sprechen. Nur bei seinem Sohne Benedikt
sagte er: 'Du sollst Raw werden!' Unter großen Entbehrungen hatte dieser
sich, wie der Vater es gewünscht, dem Rabbinerberufe gewidmet und wurde
Rabbiner in Gießen, welches Amt er bis zu
seinem neunzigsten Jahre verwaltete. Er hatte die Kette der Rabbiner in
seiner Familie fortgesetzt. aber – auch geschlossen."
Anmerkungen: *Siehe: Pfälzischer Erbfolgekrieg 1688 – 1697, dritter
Absatz:
https://www.worms.de/de/kultur/stadtgeschichte/wussten-sie-es/liste/2014-02_Franzosen_am_Rhein.php)
Zu Herz Scheuer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herz_Scheuer
Zu Elia Öttingen:
https://www.jewgenpedia.com/families/oettingen
Zum Pariser Sanhedrin:
http://hausen.pcom.de/jphebel/geschichten/sanhedrin_zu_paris.htm
Rabbiner Samuel Wolf Levi: Samson Rothschild, 'Beamte der Wormser jüdischen
Gemeinde',1920, Frankfurt a. M., S. 7-14:https://archive.org/stream/bub_gb_t3c7AQAAMAAJ?ref=ol#page/n9/mode/2up
https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/raus-aus-der-parallelgesellschaft/.
Beitrag von Susanne Reber (2023):
Rabbiner Samuel
Wolf Levi
Anmerkung: Zum
Französisch-Unterricht Mitte des 18. Jahrhunderts an Augsburger Schulen:
https://www.augsburgwiki.de/index.php/AugsburgWiki/MertensHieronymusAndreas
|
Rabbiner Samuel Levi - ein Sohn von Rabbiner Wolf Levi in Pfersee sowie über
dessen Urenkel Orchesterdirigent und Komponist Hermann Levi (1853-1900) (Artikel von 1933)
Anmerkung: Rabbiner Wolf Levi = Rabbiner Benjamin-Wolf Spiro:
nach "Biographisches Handbuch der Rabbiner" BHR I.2, 825 vgl.
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1687: geb. in Prag,
gest. 1792 in Pfersee; war ein Sohn des
Prager Parnas und Klausrabbiners Samuel Halevi Lichtenstadt-Wedeles (gest.
1752), welcher selbst ein Enkel des böhmischen Landesrabbiners Wolf Wedeles war.
Dajan (Richter am Rabbinatsgericht) in Prag, 1753 Landesrabbiner in
Oettingen, 1764 Landesrabbiner der Mgft.
Burgau und Schwaben in Pfersee, Vater der
beiden Rabbiner Salomon Levi (Gailingen)
und Samuel Levi (Worms, Mainz).
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
März 1933: "Die Vorfahren Hermann Levis. Zu Richard Wagners fünfzigstem
Todestag. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
März 1933: "Die Vorfahren Hermann Levis. Zu Richard Wagners fünfzigstem
Todestag.
Die Fünfzigjahrfeier des Todestages Richard Wagners weckt auch die
Erinnerung an einen der Getreuen des Hauses Wahnfried, den 1872 von
Karlsruhe nach München berufenen Generalmusikdirektor Hermann Levi
(1839-1900), der nach dem Tode Wagners der treueste Berater seiner Frau
Cosima gewesen ist.
Der Vater, der den Künstlerdrang seines Sohnes schon früh erkannt hatte
und ihn in seinem Künstlerstreben immer zu fördern suchte, war Rabbiner
Dr. Benedict Levi zu Gießen, der 1806 als Sohn des
Rabbiners Samuel Levi in Worms geboren wurde. Dieser war der Sohn des Rabbiners Wolf Levi in
Pfersee bei Augsburg, besuchte die höhere Schule daselbst und eignete
sich die französische Sprache derart an, dass der Bürgermeister von
Worms und einige Stadträte allwöchentlich bei ihm in der Judengasse
einkehrten, um sich von ihm die französischen Zeitungen übersetzen zu
lassen. 1807 wurde er in das Synhedrion zu Paris berufen. Der französisch
sprechende Rabbiner von Worms gefiel Napoleon so gut, dass er ihn mehrmals
in Audienz empfing, und um ihm eine Gnade zu erweisen, bot er ihm das
Rabbinat Metz oder Mainz an. Levi wählte das letztere, und so wurde er
1808 zum Grab Rabbin du consistoire du département de Mont Tonnère
berufen. Dr. Levi erzählte gerne in Freundeskreisen, wie er 1812 Napoleon
auf seinem Zuge nach Russland über die Große Bleiche in Mainz ziehen sah
und wie ihn sein Lehrer in die Höhe hob und aufforderte, den Segensspruch
beim Anblick eines gekrönten Hauptes zu sprechen..." |
| Zu Hermann Levi vgl. auch
Artikel in einer Seite zu Gießen (interner Link) und in einer
Seite zu Garmisch-Partenkirchen (interner Link).
|
Zum Tod von Rabbiner Jacob Koppel Bamberger
(1864)
Anmerkung: Rabbiner Jacob (Koppel) Bamberger ist 1785 in
Neckarbischofsheim
geboren. Er erhielt seine Ausbildung im Elternhaus seines Vaters Rabbiner Juda Moses Levi
Bamberger und wurde 1820 nach dem Tod des Vater Rabbiner in
Neckarbischofsheim.
Er war
auch an den rabbinischen Gerichtshöfen in Mannheim und Karlsruhe tätig, 1824
bis 1864 war er Rabbiner in Worms.
|
 Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1864: "Worms,
Ende März. Wie sich aus der eben noch heitern Luft der vernichtende Blitz
auf die hoffnungsvolle Saat plötzlich herabschwingt, so traf vor wenigen
Tagen, am Schuschan Purim
(= 23. März 1864), viele
Herzen schwer verwundend die Trauerkunde von dem unerwarteten Tod des würdigen,
für die höchste Aufgabe der Menschheit unermüdet tätigen Rabbinen
Jacob Koppel Bamberger. Wenn auch die Silberlocke seinen Scheitel deckt,
wenn er auch das hohe Alter von 79 Jahren erreichte, so sind der Schmerz
und die Wehmut über das Hinscheiden dieses Edlen dennoch gerecht, weil
trotz seines Alters sein heiteres Naturell, sein klarer Verstand, sein
geordnetes Denken noch segensreiche Früchte verhießen. Er glich der
alten Eiche, deren starke Wurzeln fest in der Erde fußen, und die noch
immer dem Wanderer erquickenden Schatten bietet. Gerecht ist der Schmerz,
aber er gehe aus seinem Ungestüm in die stillere Wegmut über und wandle
sich in den einen großen Vorsatz um, den Betrauerten durch ein seiner
Lehre und seinem Willen genehmes Leben fort und fort zu ehren. Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1864: "Worms,
Ende März. Wie sich aus der eben noch heitern Luft der vernichtende Blitz
auf die hoffnungsvolle Saat plötzlich herabschwingt, so traf vor wenigen
Tagen, am Schuschan Purim
(= 23. März 1864), viele
Herzen schwer verwundend die Trauerkunde von dem unerwarteten Tod des würdigen,
für die höchste Aufgabe der Menschheit unermüdet tätigen Rabbinen
Jacob Koppel Bamberger. Wenn auch die Silberlocke seinen Scheitel deckt,
wenn er auch das hohe Alter von 79 Jahren erreichte, so sind der Schmerz
und die Wehmut über das Hinscheiden dieses Edlen dennoch gerecht, weil
trotz seines Alters sein heiteres Naturell, sein klarer Verstand, sein
geordnetes Denken noch segensreiche Früchte verhießen. Er glich der
alten Eiche, deren starke Wurzeln fest in der Erde fußen, und die noch
immer dem Wanderer erquickenden Schatten bietet. Gerecht ist der Schmerz,
aber er gehe aus seinem Ungestüm in die stillere Wegmut über und wandle
sich in den einen großen Vorsatz um, den Betrauerten durch ein seiner
Lehre und seinem Willen genehmes Leben fort und fort zu ehren.
Ist es auch seinen Hinterbliebenen ein schöner und sicherer Trost,
sich dereinst mit ihm in dem Himmel wieder vereint zu wissen, so stärkt
sie doch gewiss auch die bleibende Erinnerung an sein segens- und
tatenreiches Leben.
Und so will denn ein treuer Schüler dem Verewigten auch für weitere
Kreise durch einen kurzen Rückblick auf sein Leben ein
Erinnerungs-Denkmal aufrichten.
Rabbi Jacob Koppel Bamberger ward zu
Neckarbischofsheim geboren. Sein
Vater war der im hohen Greisenalter verstorbene vielgelehrte Rabbiner
Moses Bamberger, und seine Mutter war eine Tochter des talmudisch berühmten
Rabbiners Simon Flehinger, Rabbiner in Mühringen.
Der väterliche Ernst im schönen Bund mit der mütterlichen Milde hatte
sich die Erziehung des einzigen Sohnes zur besonderen Aufgabe gemacht, und
bestimmte denselben der Tora. Der Vater ließ ihn in allen Wissenschaften
privatim unterrichten, und zum Studium des Talmuds nahm er für ihn die
anerkanntesten jüdischen Lehrer auf, um damit dem Sohne die Jeschiwa
zu ersetzen, da der Vater und die Mutter den einzigen Sohn nicht gerne außer
ihrer Obhut ließen. Es wurde kein Opfer gescheut, um ihn tüchtig den
rabbinischen Disziplinen heranbilden zu lassen. Der strebsame Jüngling krönte
alsbald die Hoffnung seiner teueren Eltern; bald erreichte er das Ziel;
denn noch hatte er das 18. Lebensjahr kaum überschritten, so wurde ihm
von den bedeutendsten Rabbinen der damaligen Zeit, namentlich von Rabbiner
Ascher – das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen -, dem Sohne des Schaagath Arjeh, aus Karlsruhe, die rabbinische Autorisation – morenu – erteilt.
Mit dem ausdauerndsten Fleiß betrieb er nun die Studien der beiden
Talmude. Mit wahrhafter Begeisterung durchforschte er die Werke der Poskim (rabbinische Entscheidungsträger) und Meforsim. Er hatte stets große Neigung für das historische Wissen,
und was sein ganzes Leben beseelte, waren die Werke des großen Maimonides.
Dieser große
|
|
 Lehrer
Israels war sein Ideal, dem er stets nachstrebte; es verging kaum ein Tag,
ohne dass er sich begeistert über dessen Werke ausgesprochen hätte. Lehrer
Israels war sein Ideal, dem er stets nachstrebte; es verging kaum ein Tag,
ohne dass er sich begeistert über dessen Werke ausgesprochen hätte.
In seinem 19. Jahre ward er mit der höchst achtbaren Familie des
Mannheimer Rabbiners, Rabbi Getschlik Alsens, bekannt. Die Tochter dieses
Hauses, namens Jitle, gewann und erwiderte seine Zuneigung, und verband
sich ihm auch zur treuen Lebensgefährtin. Ein Mädchen entsprang dieser
Ehe, namens Regine, die der Verewigte besonders liebte; sie verehelichte
sich mit einem Verwandten, Dr. Fraensdorf aus
Bamberg.
Kurze Zeit nach seiner Verehelichung wurde er mit dem Rabbineramt
der Stadt Heidelberg und Umgegend betraut, und es wurde da sein geistiges
Talent sogleicht in die Arena gerufen. Der hochgelehrte Rabbiner Ascher
entbot ihn nach Karlsruhe, um mit ihm gemeinschaftlich den neu erstandenen
Tempel zu bekämpfen, dessen Tendenz die Entfernung jüdischer und Einführung
deutscher Gebete mit Orgelbegleitung war.
Ihre Bemühung krönte den Erfolg, und sie hatten um dessentwillen
in einer deutschen theologischen Zeitschrift bittere Angriffe abzuwehren.
Nach dem Tode seines weit berühmten Vaters wurde er zu dessen
Nachfolger (sc. in Neckarbischofsheim) erwählt, als welcher er segensreich wirkte; er wird noch heute
sein Name dort mit Ehrfurcht genannt.
Im Jahre 1824 wurde ihm von der hiesigen Gemeinde (sc. Worms)
das Rabbineramt
übertragen. Gerne folgte er diesem ehrenhaften Rufe. Da Worms von jeher Stadt
und Mutter in Israel war, und das Rabbinat stets nur mit Autoritäten
besetzt wurde. Er folgte gerne diesem Ruf, um hier seine geistige Tätigkeit
zu entwickeln, aber er ahnte nicht die vielen Kämpfe, die er da zu
bestehen hatte. Nicht allein pekuniäre und Familienverhältnisse haben
manche bittere Stunde ihm bereitet, auch der Sturm der unjüdischen
Bestrebungen der neuen Zeit brauste wider ihn heran und hat die ganze
Kraft seines Lebens in Anspruch genommen.
Gleich nach seinem Hierherkommen hat sich eine große Anzahl Jünger aus
allen Gegenden um ihn geschart, um von ihm Worte der Tora zu hören, und
viele Rabbinen sind aus seiner Jeschiwa hervorgegangen (Anmerkung der
Redaktion: Auch der Herausgeber dieser Blätter hat von ihm Hattarat
Horaah erhalten).
Mitten
im Kampfe für Lehre und Leben wurde er durch die Trauerbotschaft von dem
Hinscheiden seiner treuen Gattin, welche in Bamberg zum
Besuche ihres
Kindes war, tief getroffen. Nun stand er allein als Greis, und keine
teilnehmende Hand hat ihn gepflegt. – Ich, als treue Schüler, hab Alles
aufgeboten, seine traurige Lage einigermaßen zu erleichtern – war so
oft wie möglich um ihn, und habe seine herbe Last ihm tragen helfen. -
Der ehrwürdige Rabbiner Dr. Auerbach, sein Schüler und
Vertrauter, veranlasste ihn zu einer zweiten Ehe, und er verheiratete sich
auch mit Johanna Lehmann aus Darmstadt. Ich bot Alles auf, seinen pekuniären
Verhältnissen eine andere Gestaltung zu geben, was mir unter Gottes
Beistand auch gelang. Sein häusliches Leben wurde nun ein freundliches;
von seiner Frau geliebt, geachtet und treu und sorgsam gepflegt, lebte er
glücklich in dem Kreise der Seinigen, (Anmerkung der Redaktion: Der
Herausgeber dieser Blätter reiste fast alljährlich nach Worms, nur zu
dem Zecke, den ehrwürdigen Greis zu besuchen; die Liebe und sorgsame
Pflege der Angehörigen desselben verfehlte niemals, den erfreulichsten
Eindruck zu machen) und zog, außer seinen amtlichen Verpflichtungen, sich
von der Außenwelt zurück. Dieser Zurückgezogenheit verdankte die
Wissenschaft eine ausgedehnte Bereicherung auf ihrem Gebiete, das der
Selige mit genialer Kraft zu erforschen verstand. Es befindet sich
Folgendes im Manuskript vor: Hebräischer Titel der 4
Bände.
Ein Mann, wie er, der nur mit Gott und sich selbst verkehrt, konnte
nicht viel mit der Gesellschaft verkehren; er lebte in einer selbst
geschaffenen Welt. Seine Liebe zur Einsamkeit stand mit seinem tiefen, großen
und edlen Charakter in Verbindung. |
 Der
Besuch des Gotteshauses, morgens und abends, war ihm eine himmlische Beschäftigung
und nichts vermochte ihn davon abzuhalten; selbst dann, wenn die Kanzel
dazu benutzt wurde, um kränkende Äußerungen hören zu lassen, verfehlte
er nicht, dahin zu gehen. Noch am Taanit-Ester-Abend
(= 21. März 1864, sc. zwei Tage vor seinem Tod) ging er in die Synagoge, wohnte dem Gottesdienst bis zuletzt bei – und
eine Stunde später wurde ich zu ihm ans Krankenlager gerufen (Anmerkung:
er ward ohnmächtig, während er damit beschäftigt war, seinem einziger Töchterchen
aus zweiter Ehe das Buch Esther zu erklären. – Redaktion). Er konnte
sich der Ohnmachten nicht erwehren, und die Schwäche nahm, trotz allen ärztlichen
Beistandes zu, und so entschließ er. Purim nachts 11 Uhr ist dieser
herrliche Geist in seine ewige Heimat entschwebt. Der
Besuch des Gotteshauses, morgens und abends, war ihm eine himmlische Beschäftigung
und nichts vermochte ihn davon abzuhalten; selbst dann, wenn die Kanzel
dazu benutzt wurde, um kränkende Äußerungen hören zu lassen, verfehlte
er nicht, dahin zu gehen. Noch am Taanit-Ester-Abend
(= 21. März 1864, sc. zwei Tage vor seinem Tod) ging er in die Synagoge, wohnte dem Gottesdienst bis zuletzt bei – und
eine Stunde später wurde ich zu ihm ans Krankenlager gerufen (Anmerkung:
er ward ohnmächtig, während er damit beschäftigt war, seinem einziger Töchterchen
aus zweiter Ehe das Buch Esther zu erklären. – Redaktion). Er konnte
sich der Ohnmachten nicht erwehren, und die Schwäche nahm, trotz allen ärztlichen
Beistandes zu, und so entschließ er. Purim nachts 11 Uhr ist dieser
herrliche Geist in seine ewige Heimat entschwebt.
Freitag, den 25. März, morgens 11 Uhr, war das Leichenbegängnis
dieses großen Meisters in Israel.
Es war eine ernste erhebende Feierlichkeit, zu der nicht allein die
ganz hiesige Gemeinde, sowie alle Gemeinden des Kreises – nicht allein
die Staats-, Zivil- und Militärbehörden, die Geistlichen aller
Konfessionen, sondern auch viele Rabbinen sich vereinigt hatten, im Gefühl
der Trauer und des tiefsten Schmerzes. Überall begegnete man Männern in
tiefer Trauerkleidung; überall sah man Tränen fließen, sah, dass jeder
sich der traurigen Bedeutung dieses Tages in tiefstem Ernste bewusst
geworden. Ein unübersehbarer Leichenzug begleitete die Bahre. Kein Laut
wurde vom Todeshause bis zum Beit HaChajim (Friedhof) gehört; ein stiller, tiefer Schmerz erfüllte
die ganze Stadt.
Im
Todeshause, bevor der Leichenzug sich in Bewegung setzte, sprach ich Worte
der Trauer und der Klage (Anmerkung der Redaktion. Herr Mannheimer sprach
in ebenso beredter wie ergreifender Weise; es waren Worte, die vom Herzen
kamen und zu Herzen gingen). -
Am Grabe sprachen außer dem hiesigen Prediger noch vier Rabbinen
benachbarter Gemeinden.
Moses Mannheimer." |
Dr. Alexander Stein wurde zum Rabbiner gewählt
(1867)
Anmerkung: zu Rabbiner Dr. Alexander Stein vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Stein_(Rabbiner)
Im Beitrag von Samson Rothschild: Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde (Mitte
des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart). J. Kauffmann Verlag Frankfurt am Main
1920. Zu Rabbiner Dr. Stein: S. 37-50.
Online zugänglich
 Artikel in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom
15. Juli 1867: "Worms, 3. Juli. Hier wurde ein junger Seminarist,
Dr. Stein, zum Rabbiner gewählt. Der Vorstand hatte an mehrere Rabbinen
beider Richtungen Anfragen gerichtet. Der Frankfurter Hirsch (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch) empfahl seinen
Schwiegersohn Guggenheim, Philippson (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Philippson) seinen
Schwiegersohn Kayserling, Lehmann einige seiner Zugtiere. Diese Empfehlungen
blieben aber erfolglos." Artikel in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom
15. Juli 1867: "Worms, 3. Juli. Hier wurde ein junger Seminarist,
Dr. Stein, zum Rabbiner gewählt. Der Vorstand hatte an mehrere Rabbinen
beider Richtungen Anfragen gerichtet. Der Frankfurter Hirsch (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch) empfahl seinen
Schwiegersohn Guggenheim, Philippson (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Philippson) seinen
Schwiegersohn Kayserling, Lehmann einige seiner Zugtiere. Diese Empfehlungen
blieben aber erfolglos." |
Anmerkungen: Der Schwiegersohn von Samson
Raphael Hirsch, der von diesem vorgeschlagen wurde, war Rabbiner Dr.
Josef Guggenheimer (geb. 1831 in Kriegshaber, gest. 1896 in Kolin,
Böhmen); er heiratete Sara geb. Hirsch (geb. 1834 in Oldenburg, gest. 1909)
vgl. Genealogie zu Samson Raphael Hirsch:
https://www.geni.com/people/Samson-Hirsch/6000000003789115307 und
Biographisches Portal der Rabbiner
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=625
Der Schwiegersohn von Ludwig Philippson; der von diesem vorgeschlagen wurde,
war Rabbiner Dr. Moritz Meyer Kayserling (geb. 1829 in Hannover,
gest. 1905 in Budapest; verheiratet mit Berta geb. Philippson [geb. 1839 in
Magdeburg, gest. 1931 in Budapest]); war ab 1861 Rabbiner der Schweiz mit
Sitz in Lengnau): vgl.:
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=0905 und
https://de.wikipedia.org/wiki/Meyer_Kayserling; Genealogie
https://www.geni.com/people/Ludwig-Philippson/6000000015606223770.
|
Rabbiner Dr. Marcus Jastrow tritt sein Amt in Worms an
(1894)
Anmerkung: zu Rabbiner Dr. Marcus Jastrow vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Jastrow
Im Beitrag von Samson Rothschild: Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde (Mitte
des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart). J. Kauffmann Verlag Frankfurt am Main
1920. Zu Rabbiner Dr. Jastrow: S. 32-37.
Online zugänglich
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September
1894: "Worms. Herr Dr. Jastrow hat sein Amt als
Rabbiner in hiesiger Gemeinde am 15. August angetreten; wir sind es uns und
dem, uns in seiner höchst achtbaren Persönlichkeit nahe tretenden Talent
schuldig; über sein, wenn auch nur kurzes Wirken zu referieren, um einem
Verdienste die gebührende Anerkennung zu zollen, das in kurzer Zeit sich so
die allgemeine Geltung in der Gemeinde zu verschaffen gewusst hat. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September
1894: "Worms. Herr Dr. Jastrow hat sein Amt als
Rabbiner in hiesiger Gemeinde am 15. August angetreten; wir sind es uns und
dem, uns in seiner höchst achtbaren Persönlichkeit nahe tretenden Talent
schuldig; über sein, wenn auch nur kurzes Wirken zu referieren, um einem
Verdienste die gebührende Anerkennung zu zollen, das in kurzer Zeit sich so
die allgemeine Geltung in der Gemeinde zu verschaffen gewusst hat.
Worms hat von jeher zur Verwaltung des Rabbineramts die größten Autoritäten
berufen. Noch ist es kein halbes Jahr, dass wir den großen Verlust unseres
Rabbiners J. Bamberger - das Andenken an den Gerechten und Heiligen sei
zum Segen - , eines Heroen talmudischer Gelehrsamkeit beweinten.
Diesem edlen Manne ist nun Dr. Jastrow auf Berufung der Gemeinde im
Amte gefolgt. Eingedenk der Wichtigkeit dieser Berufung ist er erschienen
als Mann, der da weiß, was er ist und was er will. Seine Predigten, Geist
und Herz zugleich ansprechend, zeugen von den Ansichten und Überzeugungen
des Redners, sie offenbaren den religiösen Charakter des Mannes, dessen
Streben dahin zielt, das Licht des Judentums - unsere Heilige Tora -
leuchten zu lassen, Gottesfurcht und Moral nach echt jüdischem Sinne zu
verbreiten. Die Predigten, die wir von ihm bisher zu hören Gelegenheit
hatten – deren Klarheit und Bestimmtheit, sowie die logische Ordnung in der
Entwicklung der Begriffe, haben uns überzeugt, wie tief dieser Mann zu
denken vermag, und dass er die menschliche Natur in sich und Anderen
studiert haben muss.
Dr. Jastrow gehört nicht zu jenen sogenannten Seelsorgern der Neuzeit,
welche rücksichtslos den Rabbiner dem Dr. der Philosophie opfern; die auf
der Kanzel von Wahrheiten des Judentums reden, aber dennoch nur so, dass
jeder es wohl einsehen kann, dass sie selbst nicht daran glauben, und nicht
von diesen Wahrheiten ergriffen sind: 'Doch sie allzumal haben das Joch
gebrochen, die Bande zerrissen' (Jeremia 5,5) Seelsorger, welche mit dem
Mangel an gründlichen Fachkenntnissen anmaßend genug sind, nach dem Maße des
eigenen Glaubens (?) sich zum Gebieter des Glaubens Anderer zu erheben.
Gottlob! Dr. Jastrow zählt nicht zu diesen Herren, er verfehlt nicht morgens
und abends das Gotteshaus zu besuchen. Talmud (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud) und Poskim (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Posek) sind keine seltenen
Erscheinungen in seinem Hause; er sieht ferner das Heil der Gottesverehrung
nicht in übereilten Reformen, sondern in der Belebung des alten
Gottesdienstes, er beweist durch sein persönliches Verhalten, dass er ihm
nur um die Sache und nicht um den Schein zu tun ist."
Anmerkung: zu Rabbiner J. Bamberger: siehe
Artikel oben
von 1864. |
 Foto links: Rabbiner Marcus Jastrow (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Jastrow)
Foto links: Rabbiner Marcus Jastrow (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Jastrow) |
Zu einer Brückeneinweihung ist neben den christlichen
Geistlichen auch Rabbiner Dr. Alexander Stein geladen (1900)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. April 1900: "Worms. Bei der hiesigen Brückeneinweihung waren
der erste evangelische und der erste katholische Geistliche geladen, ebenso
Rabb. Dr. Stein und zwar vom Ministerium. Auch bei dem Gastmahl, das
die Stadt dem Großherzoge und seinen Gästen gegeben, war Dr. Stein geladen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. April 1900: "Worms. Bei der hiesigen Brückeneinweihung waren
der erste evangelische und der erste katholische Geistliche geladen, ebenso
Rabb. Dr. Stein und zwar vom Ministerium. Auch bei dem Gastmahl, das
die Stadt dem Großherzoge und seinen Gästen gegeben, war Dr. Stein geladen." |
Rabbiner Dr. Alexander Stein möchte in den Ruhestand treten
(1909)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. November 1909: "Worms. Rabbiner Dr. Stein will
wegen eines Augenleides in den Ruhestand treten. Rabb. Dr. Stein, der
sich allgemein eines hohen Ansehens erfreut, blickt auf eine mehr als
40jährige Amtstätigkeit zurück."
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. November 1909: "Worms. Rabbiner Dr. Stein will
wegen eines Augenleides in den Ruhestand treten. Rabb. Dr. Stein, der
sich allgemein eines hohen Ansehens erfreut, blickt auf eine mehr als
40jährige Amtstätigkeit zurück." |
Rabbiner
Dr. Alexander Stein wird ausgezeichnet (1910)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. April 1910: "Herr Rabbiner Dr. Stein in Worms ist
von seiner Gemeinde, mit Genehmigung des Großherzoglichen Kreisamts, zum
Ehrenrabbiner ernannt worden. Auch alle jüdischen Vereine, denen Herr
Dr. Stein während seiner langen und gesegneten Amtsführung angehört hat,
voran der Zweigverein der Alliance Israélite Universelle in Worms
haben Herrn Dr. Stein zu ihrem Ehrenpräsidenten gewählt. Der
Großherzog von Hessen hat dem Rabbiner anlässlich des Abschlusses seiner
amtlichen Tätigkeit das Ritterkreuz erster Klasse des Verdienstordens
Philipps des Großmütigen mit der Krone verliehen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. April 1910: "Herr Rabbiner Dr. Stein in Worms ist
von seiner Gemeinde, mit Genehmigung des Großherzoglichen Kreisamts, zum
Ehrenrabbiner ernannt worden. Auch alle jüdischen Vereine, denen Herr
Dr. Stein während seiner langen und gesegneten Amtsführung angehört hat,
voran der Zweigverein der Alliance Israélite Universelle in Worms
haben Herrn Dr. Stein zu ihrem Ehrenpräsidenten gewählt. Der
Großherzog von Hessen hat dem Rabbiner anlässlich des Abschlusses seiner
amtlichen Tätigkeit das Ritterkreuz erster Klasse des Verdienstordens
Philipps des Großmütigen mit der Krone verliehen."
vgl. zur Alliance Israélite Universelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alliance_Israélite_Universelle
zu Philipp dem Großmütigen:
https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/geschichte/landgraf-philipp
|
Zum
Tod von Rabbiner Dr. Alexander Stein (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Februar 1914: "Ehrenrabbiner Dr. Alexander Stein
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Februar 1914: "Ehrenrabbiner Dr. Alexander Stein
Im Alter von über 70 Jahren starb in vergangener Woche in Karlsruhe der
Träger dieser seltenen Auszeichnung, welche ihm seine Gemeinde Worms
als Dank für seine segensreiche, mehr als vierzigjährige Tätigkeit beim
Ausscheiden aus dem Amte vor vier Jahren verliehen hatte. Aufsehenerregende
Nachrichten werden in dieser langen Amtsperiode wohl kaum über diesen still
und ruhig seine Pflicht erfüllenden Mann in die Öffentlichkeit gelangt sein.
Denn wenn irgend jemand, so hat er sein Leben lang den Spruch der
Väter hochgehalten, dass man die Lehre nicht als Krone zum Prunken und nicht
als Scheit zum Graben missbrauchen solle. Seinem bescheidenen Wesen und
seinem vornehmen Charakter lag jede Spur von Eitelkeit und Ruhmsucht fern;
wo er auf leeres Prunken und eitles Sichgroßtun stieß, erweckte ihm solche
Beobachtung ein herzliches, fröhliches Lachen. In Geist und Wissen sich in
berechtigter Weise hervorzutun, fehlte es ihm freilich nicht. In
Grombach in Baden geboren, war er schon
im Gymnasium, das er zu Karlsruhe absolvierte, ein trefflicher Schüler und
erwarb sich die besondere Zuneigung des Oberrats Altmann, bei dem er sich
für das theologische Studium vorbereitete. Im Breslauer Seminar, das er
alsbald bezog, genoss er die allgemeine Gunst seiner Lehrer und
Kommilitonen. Fränkel, zu dessen Schülern er noch zählte, gestattete dem
noch nicht Vierundzwanzigjährigen noch vor seiner offiziellen Entlassung aus
dem Seminar das Rabbinat der altberühmten Wormser Gemeinde anzunehmen. In
einer Seminarpreisarbeit über die Fortbildung der hebräischen Sprache in der
Mischna, hatte er das Zeugnis von seiner wissenschaftlichen Befähigung
abgelegt, ein schweres Augenleiden, das sich frühzeitig einstellte und ihm
Schonung gebot, ließ ihn freilich später nicht mehr zu wissenschaftlichen
Arbeiten gelangen. Umso eifriger wandte er sich der praktischen
Amtstätigkeit |
 zu;
seine schlichte, aber herzliche und eindringliche Art der Rede und seine
überaus große Milde und Güte gewannen ihm bald aller Herzen. Er war die
Verkörperung des Hillelschen1
Wortes: 'Sei von den Schülern Arons2,
liebe den Frieden und gehe ihm nach, liebe die Menschen und führe sie sanft
zur Lehre hin.' Auch seine religiöse Parteistellung war so beschaffen; sie
kannte keine Schroffheit und kein Extrem. Er war ein aufgeklärter Geist und
sich seiner Aufgabe, als liberaler Theologe in einer liberalen Gemeinde und
in einem modernen Gotteshause zu wirken, wohl bewusst. Aber jeder Fanatismus
nach links und nach rechts war ihm zuwider. In der religiösen Praxis hielt
er sich darum gern von allen Extremen fern und vertrat als eine der
sympathischsten und liebenswürdigsten Gestalten die gute alte Zeit der
Breslauer Schule. Eigenartig war das Verhältnis seiner eigenen Schüler zu
ihm. Alle liebten und verehrten ihn, selbst diejenigen, die seine Güte und
Milde für ihre Schwächen ausnutzten; die Verständigen aber hatten einen
feinen Sinn dafür, dass ein Mann von Wissen und Charakter vor ihnen stand,
und wurden von früh auf seine treuen und anhänglichen Freunde. Einer dieser
treuesten und anhänglichsten war der unvergessene Max Loeb in
Mainz, der dem treuen Lehrer beim Abschied
noch in seiner gewohnten begeisterten und begeisternden Weise des Dankes und
der Verehrung darbrachte. Auch ich rühmte mich voll freudigen Stolzes des
Wormser Ehrenrabbiners als meines Lehrers und Gönners, dem ich
unverlöschliche Dankbarkeit bewahre. Als Dr. Stein vor vier Jahren mit
Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand sein Amt niederlegte, zeigte es
sich, wie fest seine Gemeinde mit ihm verwachsen war; es war ein Abschied
wie von einem Vater. Auch die Behörden, bei denen er höchstes Ansehen
genoss, selbst der Großherzog zeichnete ihn in ehrenvollster Weise aus, der
letztere verlieh ihm das Ritterkreuz 1. Klasse mit der Krone. In Karlsruhe,
der Stadt seiner Jugend, wollte der in Ehren Verschiedene seinen Lebensabend
verbringen und sich der schönen Erinnerung an die einstige Tätigkeit freuen.
Seine Familie umgab ihn dort mit treuester Fürsorge. Ganz besonders
beglückte es ihn, dass zwei seiner Schwiegersöhne, Dr. Grünfeld,
Augsburg und Dr. Levi5,
Krefeld, angesehene und verehrte deutsche Rabbiner sind. Mit regstem
Interesse verfolgte er weiter die lebhaften geistigen Bewegungen, die gerade
seit den letzten Jahren die deutsche Judenheit erfüllen, mit freudiger
Teilnahme empfing er noch am 1. Oktober vorigen Jahres die zahlreichen
Glückwünsche seiner Verehrer zu seinem 70. Geburtstage. Nun ist er rasch
dahingegangen und noch einmal wurden an seinem Grabe all die Stimmen der
Liebe laut, die von dem reichen Segen sprachen, den er in Familie und
Gemeinde ausgestreut hatte. Ein Rabbiner der modernen Zeit war Dr. Alexander
Stein und doch an Wissen, Gottesfurcht, Charakter, Wirksamkeit vollauf
würdig mit der ersten Reihe der trefflichen Männer zu stehen, die den Rabbinatssitz der berühmten Gemeinde Worms je geziert haben. Möge sein Name
gleich der ihrigen allezeit zum Segen fortbestehen! Max Freudenthal4." zu;
seine schlichte, aber herzliche und eindringliche Art der Rede und seine
überaus große Milde und Güte gewannen ihm bald aller Herzen. Er war die
Verkörperung des Hillelschen1
Wortes: 'Sei von den Schülern Arons2,
liebe den Frieden und gehe ihm nach, liebe die Menschen und führe sie sanft
zur Lehre hin.' Auch seine religiöse Parteistellung war so beschaffen; sie
kannte keine Schroffheit und kein Extrem. Er war ein aufgeklärter Geist und
sich seiner Aufgabe, als liberaler Theologe in einer liberalen Gemeinde und
in einem modernen Gotteshause zu wirken, wohl bewusst. Aber jeder Fanatismus
nach links und nach rechts war ihm zuwider. In der religiösen Praxis hielt
er sich darum gern von allen Extremen fern und vertrat als eine der
sympathischsten und liebenswürdigsten Gestalten die gute alte Zeit der
Breslauer Schule. Eigenartig war das Verhältnis seiner eigenen Schüler zu
ihm. Alle liebten und verehrten ihn, selbst diejenigen, die seine Güte und
Milde für ihre Schwächen ausnutzten; die Verständigen aber hatten einen
feinen Sinn dafür, dass ein Mann von Wissen und Charakter vor ihnen stand,
und wurden von früh auf seine treuen und anhänglichen Freunde. Einer dieser
treuesten und anhänglichsten war der unvergessene Max Loeb in
Mainz, der dem treuen Lehrer beim Abschied
noch in seiner gewohnten begeisterten und begeisternden Weise des Dankes und
der Verehrung darbrachte. Auch ich rühmte mich voll freudigen Stolzes des
Wormser Ehrenrabbiners als meines Lehrers und Gönners, dem ich
unverlöschliche Dankbarkeit bewahre. Als Dr. Stein vor vier Jahren mit
Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand sein Amt niederlegte, zeigte es
sich, wie fest seine Gemeinde mit ihm verwachsen war; es war ein Abschied
wie von einem Vater. Auch die Behörden, bei denen er höchstes Ansehen
genoss, selbst der Großherzog zeichnete ihn in ehrenvollster Weise aus, der
letztere verlieh ihm das Ritterkreuz 1. Klasse mit der Krone. In Karlsruhe,
der Stadt seiner Jugend, wollte der in Ehren Verschiedene seinen Lebensabend
verbringen und sich der schönen Erinnerung an die einstige Tätigkeit freuen.
Seine Familie umgab ihn dort mit treuester Fürsorge. Ganz besonders
beglückte es ihn, dass zwei seiner Schwiegersöhne, Dr. Grünfeld,
Augsburg und Dr. Levi5,
Krefeld, angesehene und verehrte deutsche Rabbiner sind. Mit regstem
Interesse verfolgte er weiter die lebhaften geistigen Bewegungen, die gerade
seit den letzten Jahren die deutsche Judenheit erfüllen, mit freudiger
Teilnahme empfing er noch am 1. Oktober vorigen Jahres die zahlreichen
Glückwünsche seiner Verehrer zu seinem 70. Geburtstage. Nun ist er rasch
dahingegangen und noch einmal wurden an seinem Grabe all die Stimmen der
Liebe laut, die von dem reichen Segen sprachen, den er in Familie und
Gemeinde ausgestreut hatte. Ein Rabbiner der modernen Zeit war Dr. Alexander
Stein und doch an Wissen, Gottesfurcht, Charakter, Wirksamkeit vollauf
würdig mit der ersten Reihe der trefflichen Männer zu stehen, die den Rabbinatssitz der berühmten Gemeinde Worms je geziert haben. Möge sein Name
gleich der ihrigen allezeit zum Segen fortbestehen! Max Freudenthal4."
Anmerkungen: 1zu Hillel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hillel
2 zu Aron:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_(biblische_Person)
3 zur Breslauer Schule:
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisch-Theologisches_Seminar_in_Breslau
4 zum Verfasser des Beitrages
Rabbiner Max Freudental:
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Freudenthal
5 zu Rabbiner Dr. Levi,
Oberrabbiner in Krefeld:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Levi |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Februar
1914: "Im Alter von 71 Jahren starb in
Karlsruhe der Ehrenrabbiner Dr. Alexander Stein, der 40 Jahre Rabbiner
in Worms war, wo er sich allgemeiner Verehrung erfreute. Bei seinem
Rücktritt wurde er zum Ehrenrabbiner ernannt. Seit seiner Pensionierung
lebte Dr. Stein in Karlsruhe." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Februar
1914: "Im Alter von 71 Jahren starb in
Karlsruhe der Ehrenrabbiner Dr. Alexander Stein, der 40 Jahre Rabbiner
in Worms war, wo er sich allgemeiner Verehrung erfreute. Bei seinem
Rücktritt wurde er zum Ehrenrabbiner ernannt. Seit seiner Pensionierung
lebte Dr. Stein in Karlsruhe." |
Aus der Geschichte der jüdischen Prediger, Lehrer und weiterer Kultusbeamten
der Gemeinde
Übersicht über die Prediger, die während des Rabbinats von Jakob (Koppel
Bamberger) parallel in der Gemeinde angestellt waren:
- 1839-1842 Prediger Dr. Samuel Adler (geb. 1809 in Worms als Sohn
des Rabbiners Isaak Adler, gest. 1891 in New York): studierte seit 1831 an der
Universität Bonn, dann in Gießen, wurde 1836 an der Universität Gießen in
Philosophie promoviert; 1836 zunächst Religionslehrer, Prediger und Dajan in Worms, wirkte als Reformer; seit 1. Oktober 1842 Rabbiner
in Alzey; im Herbst 1856 wanderte er in die USA
aus, nachdem er einen Ruf der jüdischen Gemeinde Temple Emanu-El in New York
erhalten hatte. Er wurde in der Folgezeit Oberhaupt der
führenden jüdischen Reformgemeinde der USA. Adlers Bibliothek ist weitgehend
erhalten im Hebrew Union College in Cincinatti/USA.
Vgl. Abschnitt zu Dr. Samuel Adler im Buch von Samson Rothschild: Beamte der
Wormser jüdischen Gemeinde. Frankfurt 1920 S. 20-22.
Online zugänglich.
- 1842-1849: Prediger Dr. Abraham Adler (geb. 1811 in Worms als
Sohn des Rabbiners Isaak Adler, gest.1856 in
Bendorf-Sayn): studierte seit 1833 an den Universitäten Bonn und Gießen,
danach Lehrer und Privatgelehrter in Frankfurt am Main, ab 1839 als Erzieher in
Groß-Kanizsa (Ungarn). Ab 1842 Prediger in Worms, Verfechter des
Reformjudentums. War verheiratet mit Rahel geb. Hochstätter (geb. 1823). Wegen
seines Engagements in der Revolution 1849/49 erhielt er 1850 Berufsverbot und
wurde inhaftiert. 1854 musste er eine Berufung nach New York aufgrund seines
schlechten Gesundheitszustandes in Folge der Haft ablehnen. Starb in der
Israelitischen Heilpflegeanstalt Bendorf-Sayn.
Vgl. Artikel zu Abraham Adler im "Frankfurter Personenlexikon":
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/363 und Abschnitt zu Dr. Abraham
Adler im Buch von Samson Rothschild: Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde.
Frankfurt 1920 S. 22-25.
Online zugänglich.
- 1851-1859: Prediger Dr. Ludwig Lewysohn (geb. 1819 in
Schwersenz Kreis Posen, gest. 1901 in Stockholm): studierte nach 1842 an der
Universität Halle, wurde 1847 in Philosophie promoviert; 1848 Rabbiner in
Frankfurt an der Oder, seit 1851 Prediger in Worms, erteilte an den öffentlichen
Schulen Religionsunterricht; beschäftigte sich als erster wissenschaftlich mit
dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand; ab 1859 Rabbiner in Stockholm bis 1883.
War nach dem Tod seiner ersten Frau seit 1854 verheiratet mit Philippine geb.
Bär aus Frankfurt am Main.
Vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn und Abschnitt zu Dr. Ludwig
Lewysohn im Buch von Samson Rothschild: Beamte der Wormser jüdischen Gemeinde.
Frankfurt 1920 S. 25-31.
Online zugänglich.
- 1860-1864: Prediger Dr. J. Rosenfeld (aus Hirschberg/Schlesien).
Weitere Informationen liegen nicht vor.
Übersicht über die Ersten Kantoren:
- Elias Grun - Emil Bloch - Moses Mannheimer
- Arnon Bessels - Moritz Mayer - L. Elkan -
Joseph Strauss - Max Posner - J.H. Zadikow -
Moritz Müller - Gustav Wertheim - Bernhard Stern
Übersicht über die Zweiten Kantoren:
- Heinrich Heidenheim - Raimund Isaak -
Übersicht über die Lehrer:
- Lazarus Lehmann
Prediger
Dr. Abraham Adler führt einen Gottesdienst am Sonntagnachmittag ein (1847)
Anmerkung: Lehrer und Prediger Dr. Abraham Adler war wie Dr. Samuel
Adler ein Sohn des Wormser
Rabbiners Isaak (Eisik) Adler (gest. 1823), siehe
oben.
Weitere Informationen zu Dr. Abraham Adler:
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/363
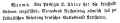 Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23. April
1847: "Worms. Prediger A. Adler hat die kolossalste Reform
eingeführt, Sonnabendnachmittag soll zur sabbatlichen Erholung deutscher
Gottesdienst stattfinden."
Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23. April
1847: "Worms. Prediger A. Adler hat die kolossalste Reform
eingeführt, Sonnabendnachmittag soll zur sabbatlichen Erholung deutscher
Gottesdienst stattfinden." |
Rede von Dr. Israel Schwarz in der Wormser Synagoge
über "Segen und Fluch" (1849)
Hinweis: die hebräischen Zitate konnten noch nicht vollständig wiedergegeben
werden, da die hebräischen Buchstaben großenteils anders als gewöhnlich
geschrieben werden.
 Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 31. August 1849: "Segen und Fluch Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 31. August 1849: "Segen und Fluch
Aus einer Rede gehalten in der Synagoge zu Worms. Paraschat Reeh (=
5. Mose 11,26 - 16,17). Von Dr. Israel Schwarz.
Möge die Hand Gottes unseres Herrn sich jetzt über uns verbreiten, auf dass
das Werk unserer Hände uns gelinge, durch seinen Beistand gelinge. Amen.
Andächtige, verehrte Zuhörer! Schon oft als ich neben der Lade Gottes stand
und vor mir hatte eine aufmerksame Zuhörerzahl, da bebte mein Herz und nur
erschrocken stammelte ich hervor die Worte aus meinem Munde; - aber diesmal,
in diesem Augenblick ergreift mich eine unnennbare Scheu und meines Busens
Schläge gehen unaufhaltsam in mir. Nicht lange brauche ich auf die Ursache
dieser Veränderung sinnen; mir ist es, als höre ich eine geisterhafte Stimme
rufen: 'Wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort'! Auf dieser heiligen
Stätte, da standen einst die gottesbegeisterten Lehrer eurer Ahnen und
Vorahnen, da standen sie einst, die in Gottesfurcht und Tugend ergrauten
Frommen, die (Hebräisch), das heilige Gesetzbuch Gottes in den Händen
und sprachen ihre herzbezwingenden, gemütszerreißenden Predigten zu der
tiefbewegten und erschütterten Versammlung – und in diesem Gotteshause, da
waren versammelt eure gottergebenen Voreltern und riefen zu dem da oben in
Zeiten der schrecklichen Not und Verfolgung und der Herr, der schickte ihnen
wunderbare Hilfe! - Und war es denn nicht diese Gemeinde, Deutschlands
älteste, von deren Ruhm, von deren religiösem Sinne in allen Gauen des
Vaterlands mit freudigem Lobe gesprochen wurde – und wie? Ihr wundert euch,
dass so die Gedanken der glücklicheren Vorzeit jetzt vor meinen Blicken
schweben, dass ich erzittere, indem ich diesen geweihten Ort besteige, und
hintrete vor euch, verehrte Zuhörer? Oh, ich kann mich des Ausrufs nicht
erwehren; mögen von dieser geweihten Stätte herab nur die Worte der Wahrheit
wie Schofarstimmen ertönen, möge jeder Laut, der von hier aus in eure Herzen
dringt, eine Glaubenssonne, kein Irrlicht in eurem Busen anzünden; möge
dieses Gotteshaus alle Besucher in brüderlicher Eintracht umfassen und möge
diese Gemeinde vor wie nach ein Muster reiner Gottesfurcht sein und in Juda |
 alle
anderen mit ihr gesegnet werden. - - Und wenn ich es nun wage, diese Stufen
zu betreten, so geschah es, weil ich einen unwiderstehlichen Drang in mir
fühlte, das, wovon meine Herzenstiefen durchdrungen, auch meinen teuren
Glaubensbrüdern mitzuteilen. Es ist mir zwar keineswegs unbekannt, welche
schwierige Stellung ein Redner in unserer Zeit einnimmt, dass er sich an
tausend Stacheln verwundet, bevor er eine duftende Blume kann pflücken – ich
glaube aber, dass selbst der tief eingekerbte Schmerz von zahllosen,
blutigen Stichen durch den Duft einer gut gehegten Pflanze nicht mehr
fühlbar wird. - So bitte ich euch um eine gütige Nachsicht, Schonung und
Aufmerksamkeit. Wenn meine wohlmeinende Rede mit solchen Gesinnungen
aufgenommen wird, wie sie aus meinem Innern strömt, dann wird diese Stunde
eine segensreiche sein und der Allgütige wird huldvoll auf sie herabschauen.
Amen. alle
anderen mit ihr gesegnet werden. - - Und wenn ich es nun wage, diese Stufen
zu betreten, so geschah es, weil ich einen unwiderstehlichen Drang in mir
fühlte, das, wovon meine Herzenstiefen durchdrungen, auch meinen teuren
Glaubensbrüdern mitzuteilen. Es ist mir zwar keineswegs unbekannt, welche
schwierige Stellung ein Redner in unserer Zeit einnimmt, dass er sich an
tausend Stacheln verwundet, bevor er eine duftende Blume kann pflücken – ich
glaube aber, dass selbst der tief eingekerbte Schmerz von zahllosen,
blutigen Stichen durch den Duft einer gut gehegten Pflanze nicht mehr
fühlbar wird. - So bitte ich euch um eine gütige Nachsicht, Schonung und
Aufmerksamkeit. Wenn meine wohlmeinende Rede mit solchen Gesinnungen
aufgenommen wird, wie sie aus meinem Innern strömt, dann wird diese Stunde
eine segensreiche sein und der Allgütige wird huldvoll auf sie herabschauen.
Amen.
M(eine) L(ieben). Beendet sind die Wochen der Trauer, die wir dem Andenken
von Zion, dem Andenken an die zerstörte Gottesstadt geweiht haben,
verklungen sind die Lieder der Klage ob einer trüben, finstern Vorzeit und
schon ist es der dritte Sabbat, wo wir erquickenden Trost von Israel
wiedererlangender Größe aus den heiligen Propheten vernehmen? Aber wie? Was
ist denn heute für ein Neumondstag? Ist es etwa der Eingang zu fröhlich
jauchzenden Wesen, werden wir etwa entschädigt für jene verklungenen Klänge
der Wehmut, die so lange in unserm Ohre widerhallend? Mitnichten.
(Hebräisch). Mit dem heutigen Rosch Chodesch Elul (1. Elul, d.h.
des Monats mit den hohen Feiertagen) beginnt die ernste Zeit, von der
gesagt wird, dass mit dem großen wirksamen Schofar geblasen wird,
dass man vernehme eine Stimme leisen Geflüsters, dass nur der Denkende hört
und das ihn mehr erschüttert, als des größten Künstlers summende Töne; dass
da die Engel zittern, die Engel in ihrer klaren Anschauung der hochwichtigen
Zeit vor der Nähe des Gerichts und wie schwache Erdensöhne, nicht ahnend das
Hochwichtige dieses Augenblicks, wie unachtsame Schafe an solchen Tagen
vorübergleiten. Also solche Tage sind’s, die wir mit dem heutigen Sabbate
antreten, eine Zeit des tiefen Ernstes, des Fastens, der Tränen, der
Bußgedanken und die zum Lohne für die erst jüngst verlebten trüben Stunden?
Meine Lieben, eine Antwort auf diese Frage ist nicht schwer zu finden.
Gerade diese Wochen bieten uns den schönsten Erlass für dasjenige, was wir
betrauerten. Einen Tempel haben wir verloren aus Stein und Holz, bis zu
seiner Wiederaufbauung lasst uns in unser Herzen einen Gottestempel
errichten. Eine Gottesstadt, die wurde uns zerstört, uns selber können wir
zu Gottesstätten machen; auf keinen Altar legt der Priester seinen
Feuerbrand; wir können unsere Gaben unserm Gotte weihen; kein König thront
auf seinem Purpurthrone, ein edler Fürst ruh’ in dem innern Heiligtume. - So
können wir alle verlorne Geister in den kommenden Tagen sinnbildlich
ersetzen.
Hieß doch auch der letzte Vers in unserm Klagelied: Führe uns zu dir zurück,
oh Gott, erneuere unsere Tage, wie ehedem; durch Rückkehr zu der Tugend und
zur Religion können wir vom Staub des Jammers freudig uns zur Höhe
emporringen. Wir können uns noch freuen, dass uns ein heiterer Sommer
geraubt ist, dass wir ja dennoch Sommerblümchen antreffen, die weder im
Herbste noch im Winter verwelken. So wollen wir denn auch, angemessen einer
ernsten Zeit einen ernsten Gegenstand besprechen. Die Anfangsworte, die wir
aus unserem Torah-Abschnitte hörten, sie geben uns Stoff zu einer tiefern
Betrachtung. (Vers 1-4). Klar und deutlich sind diese Worte, die der
göttliche Mann, Moses, vor seines Lebens Ende zu dem Volke Israel
gesprochen. Doch fragen wir: Woran erkennen wir denn, ob wir 'seinen Fluch'
uns aufgeladen? -
Wenn auch beim flüchtigen Blicke eine solche Frage lächerlich erscheinen
könnte, da wir ja bei unserm Wohlergehen den Segen, bei unserm Unglück den
Fluch Gottes ableiten können, so verhält sich die Sache doch ganz anders,
wenn wir sie genau betrachten, (Hebräisch). Der unglückliche Mensch, meine
Lieben, ist nicht immer der fluchbeladene, vielmehr heißt es (Hebräisch) der
Reiche, nicht der Gesegnete. In mancher elenden Hütte, in der nur Kummer und
Not hausen, in der die Kindlein schreien vergebens nach Brot und die Mutter
jammert, weil sie nichts hat, den Hunger der ihrigen zu stillen, in der ist
eher Gottes Segen zu finden als in den herrlichen Palästen der Großen und
Vornehmen, die da trinken aus goldenen Schalen und speisen aus . |
 silbernen
Schüsseln, deren Mund voll ist von Freude und Ausgelassenheit. silbernen
Schüsseln, deren Mund voll ist von Freude und Ausgelassenheit.
Gerade hier sucht ihr den Segen Gottes am unrechten Orte, ihr findet ihn
mitnichten. Von diesen heißt es: (Hebräisch). Erdenglück ist noch nicht
Gottes Fluch. Da wird ja so oft zum Segen der Fluch eines (Hebräisch), des
gierigen allverschlingenden Zufalls, und Unheil wird der Segen eines
(Hebräisch), eines Blindgeschlagenen des Verführers Ausgeburt. - Und was ist
denn nun Gottes Segen?
Das ist es, was der sterbende Patriarch Jacob seinem geliebtesten Sohne
gewünscht und verheißen. (Hebräisch), Segen, welcher von dem Himmel floss,
Segen, welcher in dem Herzen ruhet. - (Hebräisch), die heilige Religion, die
da herabkam von dem Himmel zur Beglückung der Menschen die Lehre des Herrn,
die das Herz erfreut und die Seele labt, die das Licht brachte, den in
Finsternis wohnenden und die in den Welten erhellte durch ihren Glanz, sie
ist der wahre Segen. Wenn die heilige Schrift in Geist und Tat das Leben
ergriffen, wenn sie wandeln die Menschen in den Vorschriften ihres
himmlischen Vaters, wenn sie erfüllen treulich ihre kindlichen Pflichten und
nie missachten die Lehre, die uns Moses gab – dann ruhet Gottes Segen auf
einem solchen Zeitalter – denn dieses Gottesleben ist der Segen selbst. -
(Hebräisch) Segen, welcher in dem Herzen ruhet. Das ist die Liebe, das ist
die Tugend. Die Religion hat es mehr mit dem Himmel, die Moral mit der Erde
zu tun. Nur, wenn der Bruder liebt seinen Nächsten, und nie ihm zufügt
Unrecht und Leid, wen Recht und Gerechtigkeit sich begegnen und küssen, wenn
der Mensch seinem Berufe als Mensch nachkommt, dann ruht der Segen des
Himmels auf ihm, dann findet er Wohlgefallen in den Augen des Herrn, der
über die Welten waltet. Und vereint müssen sie sein, diese beiden Brüder im
Judentum – weder die Tugend von der Religion, noch die Religion von der
Tugend darf getrennt werden. So heißt es: (Hebräisch).
Nur, wo dieser geistige Gottessegen ist, da kann auch das wahre Glück ruhen,
nur wo Religion und Tugend, da ist auch anderer Segen erfreulich
(Hebräisch). - - So wissen wir nun, was der wahre Gottessegen sei, oh
könnten wir doch immer von ihm sprechen, dürften wir doch nicht nennen
dasjenige, was ihm die finstre Macht entgegenstehen.
Doch wir müssen auch erfahren, was der Fluch Gottes sei. Fluch Gottes ist
es, wenn der Himmelssegen, wenn die heilige Religion nicht mehr beglücken
kann. So treten wir in (Hebräisch) (2-10). Das ist der wahre Himmelsfluch.
Wenn der Born des Lebens für viele eine trübe Quelle wird, wenn das Buch der
Bücher ihnen entfremdet und veraltet scheint, wenn die Gotteswunder ihnen
als Segen erscheinen und wir nicht mehr auf ihn vertrauen können, der Israel
fast 3 Jahrtausende in Sturm und Wetter Obdach war; wenn eintritt diese
öfterweise trübe Aufklärungssucht, der man zurufen möchte: (Hebräisch), sie
soll nicht mit ihnen, die den Glauben schwächer und die Weisheit nicht
weiter macht, nicht diesem Hochmut auf meinen Altar steigen wollen, damit
sie nicht selbst ihre Blöße entdecken, wenn es gibt unter Israel
(Hebräisch), die sich entheiligen und verunreinigen in den Garten der
Wollust, nur allein der lockenden Mode nachjagend, die da essen das Fleisch
unreiner Tiere und genießen die verbotene Speise, wenn der klügelnde
Verstand die Grenzen der Welten einzustürzen glaubt, wenn der verheerende
Leichtsinn, die Frivolität – ihr verstehet unter diesem Namen besser – in
das Lager Israels so eingerissen, dass selbst das Ehrwürdigste mit Füßen
getreten und ein Gespötte froher, kaum der Schule entwachsener Buben wird,
wenn das Gift des Unglaubens schon ansteckt die sonst so tieffühlende und
gläubige Kindheit, dann lastet zentnerschwer der Fluch des Himmels auf ein
solches Geschlecht. Wenn – wie dieses leider so häufig gefunden wird - in
der Mitte des noch treu gebliebenen Häufleins, das sich rühmt auf der
Zionswartburg auszuharren, wenn in deren Augen Moral und Tugend der
Pflichten heiligste und schwerste als ein leerer Wahn erscheint, wenn wir
Jesajas im heutigen Schlussabschnitt sagt: (Hebräisch), wenn sie hier Opfer
schlachten, dort aber auch durch Verleumdung ihren Nebenmenschen töten, hier
ein Lamm auf dem Altar darbringen – dort Liebe und Menschlichkeit nicht
kennen, wenn das geweihte Geschenk durch Gedanken und Herzlosigkeit |
 wie
das Blut eines ekelhaften Tieres wird, wenn hier der Weihrauch duftet, dort
aber dem Götzen des Goldes und Silbers gehuldigt wird, wenn Neid und Hass
und Rache und Misstrauen im Lager dieses Häufchens angetroffen wird, wenn
sie glauben, dass aus dem elenden Schlammenfeld, aus dem Kieselgrunde, aus
dem nur Unkraut wuchert, ein Blumenbeet kann gezogen werden, dann ist es ein
unerträgliches Zeichen, dass Gottes Fluch auf uns lastet. - wie
das Blut eines ekelhaften Tieres wird, wenn hier der Weihrauch duftet, dort
aber dem Götzen des Goldes und Silbers gehuldigt wird, wenn Neid und Hass
und Rache und Misstrauen im Lager dieses Häufchens angetroffen wird, wenn
sie glauben, dass aus dem elenden Schlammenfeld, aus dem Kieselgrunde, aus
dem nur Unkraut wuchert, ein Blumenbeet kann gezogen werden, dann ist es ein
unerträgliches Zeichen, dass Gottes Fluch auf uns lastet. -
Fragen wir nun, wie so wissen wir, ob wir uns Gottes Segen zu erfreuen haben
oder nicht, so lautet also die Antwort: Wenn ihr die heilige Religion, wenn
die (Hebräisch) gehegt und gepflegt auf dem Boden der Sittlichkeit wird,
dann wissen wir, dass uns sein Segen begleitet, wenn dieses nicht der Fall
ist, dann sind wir verstoßen von seinem Angesichte. -
Und das ist der Segen der treuen Pflichterfüllung, dass aus ihr selbst
entwickelnd stets das Gute kommt, (Hebräisch) und das ist der Fluch der
bösen Tat, dass sie fortwährend muss Böses erzeugen, (Hebräisch). Wer, so
lehrten unsere Weisen, wer frommen Willens zeigt, das Gute zu tun und das
Böse zu meiden, der wird unterstützt von der göttlichen Hilfe und eine gute
Handlung lässt die günstige Gelegenheit zu vielen andern bieten, wer aber
keinen Sinn für das für das Edle hat, wer verstockt in der Verleugnung der
ewigen Wahrheit bleibt, wer der Sünden schon zu viel getan, den lässt der
Vergeltende versinken in seiner Schuldenlast, denn das ist die
schrecklichere der Strafen, das ist der fürchterlichste Fluch, wenn man im
sündenhaften Leben den tiefen Abgrund nicht entdeckt.
Oh, möge von uns fern, fern dieser fürchterliche Fluch bleiben. Und
wahrlich, wenn wir sahen die Schakale, die unsere Weinberg verderben; wenn
wir entfernen das Hindernis, das den Glauben stört, das den heiligen
Vorschriften zuwider; wenn wir verscheuchen alles, was dem Herzen ist
verderbenbringend; wenn wir nicht mehr kennen die Schlaffheit und Trägheit;
diesen (Hebräisch), wenn wir tatkräftig fördern, was zum Wohle der
Menschheit, zum Heile der Seele ist, wenn wir hängen treu an den Glauben der
Väter und freudig erfüllen unsere Pflichten als fromme Israeliten, treue
Bürger, gute Menschen: Dann wird auch auf uns Gottes Segen ruhen und immer
mehr werden wir im Guten erstarken; dann werden wir in den kommenden Wochen
der Buße Gnade finden vor dem Vater des Lebens und in alle Welten wird das
Licht ausgehen von Zion, das Wort Gottes von Jerusalem. (Hebräisch).
Aber zu dir, Vater im Himmel; stehen wir: Wende nicht von uns dein gnädiges
Angesicht, damit wir nicht herumtappen im Dunkel des Unglaubens und des
Irrtums. Entferne von uns die Lüge, die Heuchelei und halte fern die
Verführung mit ihrer lockenden Macht. Erleuchte unsre Augen, dass wir es
sehen, wie nur in der Erfüllung deiner heiligen Lehre und die wahre
Glückseligkeit erblicken können. Allgütiger! Schau gnädiger herab auf den
religiösen Wandel deines Volkes Israel .... Wenn es gewichen von dem
Weg des Lebens, so zeige ihm wiederum den rechten Pfad, von dem es
nimmermehr kann weichen. (Hebräisch). Amen." |
Prediger Dr. Abraham Adler wurde wegen seinen
"republikanisch-sozialistischen Ideen" verhaftet
(1849)
Anmerkung: Vgl. weitere Informationen
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/363
 Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 12. Oktober 1849: "Worms, (Hebräisch) – (Hebräisch)
Prediger Adler ist eben mit vier Gendarmen nach dem Gerichtshof in
Mainz transportiert worden. (Hebräisch)
Es wird ihm dort Zeit gegönnt sein, über sein gotteslästerliches Wirken als
Jude und über seine republikanisch-sozialistische Ideen nachzudenken. Auch
sein Bruder in
Alzey ist wegen politischer Vergehen angeklagt worden. – Ich behalte mir
es vor, über ersteren nächstens ausführlicher zu reden, zumal ich die
religiösen Verhältnisse hiesiger Stadt Ihnen zur Musterkarte mitteilen
werde." Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 12. Oktober 1849: "Worms, (Hebräisch) – (Hebräisch)
Prediger Adler ist eben mit vier Gendarmen nach dem Gerichtshof in
Mainz transportiert worden. (Hebräisch)
Es wird ihm dort Zeit gegönnt sein, über sein gotteslästerliches Wirken als
Jude und über seine republikanisch-sozialistische Ideen nachzudenken. Auch
sein Bruder in
Alzey ist wegen politischer Vergehen angeklagt worden. – Ich behalte mir
es vor, über ersteren nächstens ausführlicher zu reden, zumal ich die
religiösen Verhältnisse hiesiger Stadt Ihnen zur Musterkarte mitteilen
werde."
Anmerkung: Der Bruder des Wormser Rabbiners Dr. Abraham Adler war der
Rabbiner Dr. Samuel Adler aus
Alzey (dort weitere Informationen). |
Suspendierung des Predigers und Religionslehrers Dr. Abraham
Adler (1850)
Anmerkung: Vgl. weitere Informationen
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/363
 Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 25. Januar 1850: "Worms. Diese Woche traf ein
Regierungsdekret hier ein, dass die Suspendierung des Predigers und
Religionslehrers A. Adler von seinem Dienste enthielt. - Genannte
Zuschrift enthält ungefähr Folgendes: Obwohl der seitherige Prediger Abraham
Adler noch vor den peinlichen Gerichten nicht verurteilt ist, so sieht
dennoch die hohe Staatsregierung sich veranlasst, denselben von seinem Amte
zu entsetzen, und fordert den Vorstand hiermit auf, genannte Zuschrift der
ganzen Gemeinde in einer Gemeindeversammlung bekannt zu machen. Dem Vorstand
wird in gedachter Zuschrift ferner aufgegeben, eine Abschrift des Reskriptes
dem Gymnasialdirektor, und eine dem Schulvorstande der Staatschule zukommen
zu lassen, weil Adler früher in genannten Anstalten den jüdischen
Religionsunterricht erteilte. - Als Grund der Amtsentsetzung werden
hauptsächlich erwähnt, Reden bei öffentlichen Volksversammlungen, bei
welcher Gelegenheit der frühere Prediger sich des Hochverrats schuldig
machte. - Es werden der Gründe noch sehr viele angegeben, die uns weniger
interessieren dürften, wir erblicken in dieser Sache die Hand Gottes, die
waltende Gerechtigkeit. Hat man sich seitens der orthodoxen Partei früher
bemüht, Adler zu entfernen und ist es nicht gelungen, so möge man sich die
Worte der heiligen Schrift ins Gedächtnis rufen: Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter"
vom 25. Januar 1850: "Worms. Diese Woche traf ein
Regierungsdekret hier ein, dass die Suspendierung des Predigers und
Religionslehrers A. Adler von seinem Dienste enthielt. - Genannte
Zuschrift enthält ungefähr Folgendes: Obwohl der seitherige Prediger Abraham
Adler noch vor den peinlichen Gerichten nicht verurteilt ist, so sieht
dennoch die hohe Staatsregierung sich veranlasst, denselben von seinem Amte
zu entsetzen, und fordert den Vorstand hiermit auf, genannte Zuschrift der
ganzen Gemeinde in einer Gemeindeversammlung bekannt zu machen. Dem Vorstand
wird in gedachter Zuschrift ferner aufgegeben, eine Abschrift des Reskriptes
dem Gymnasialdirektor, und eine dem Schulvorstande der Staatschule zukommen
zu lassen, weil Adler früher in genannten Anstalten den jüdischen
Religionsunterricht erteilte. - Als Grund der Amtsentsetzung werden
hauptsächlich erwähnt, Reden bei öffentlichen Volksversammlungen, bei
welcher Gelegenheit der frühere Prediger sich des Hochverrats schuldig
machte. - Es werden der Gründe noch sehr viele angegeben, die uns weniger
interessieren dürften, wir erblicken in dieser Sache die Hand Gottes, die
waltende Gerechtigkeit. Hat man sich seitens der orthodoxen Partei früher
bemüht, Adler zu entfernen und ist es nicht gelungen, so möge man sich die
Worte der heiligen Schrift ins Gedächtnis rufen:
(Hebräisch und deutsch 2. Mose 14,14:) 'Gott wird für euch
streiten, ihr aber sollt stille sein!'
Dass der Schrecken im Lager der Reformer groß ist, können Sie sich denken,
denn sie hatten ihre Stütze verloren. - Man will gegen diesen Beschluss
protestieren, aber alle Mühe ist vergeblich, die Sache lag dem Ministerium
vor. Aber dem hiesigen, wahrhaft Orthodoxen möchten wir zurufen, seid einig,
zeigt euch als Männer, streitet für eure Sache und lasst euch nicht von
Männern, die nur dem Scheine nach orthodox sind, verhören. Schenket solchen
unter auch, die euch überreden wollen, kleine Reformen einzuführen, kein
Gehör, sondern betretet den Weg, welchen euch euer würdiger Rabbiner zeigt,
dann wird das Geschrei einzelner in leerer Luft verhallen. In Sachen der
Religion gibt es keine Halbheiten, entweder ganz orthodox oder zu den
Reformern. Auf zwei Schultern kann man nicht Wasser tragen, denn Eliohu*,
der Prophet, sagt ja:
(Hebräisch und deutsch 1. Könige 18,21). 'Wie lange noch schwankt
ihr mit geteiltem Sinne? Wenn Gott der Herr ist, so geht ihm nach, und ist
es Baal, so geht ihm nach.'"
*Anmerkung: zu Eliohu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elija |
Rückblick
40 Jahre danach: über die beiden Brüder Prediger Abraham Adler in Worms und
Rabbiner (in Alzey) Dr. Samuel Adler (Beitrag von 1885)
Anmerkung: weitere Texte siehe
Textseite zu Alzey.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1885: "Der Aufmerksamkeit würdig waren
auch die Brüder S. Adler, Kreisrabbiner in Alzey und A.
Adler, Prediger in Worms. Ähnlichkeit besaßen diese Brüder weder in
ihrer äußeren Erscheinung, noch in ihren Ansichten; aber in ihren
Gesinnungen und in ihrer Charakterfestigkeit kamen sie überein. Der
erstere der beiden huldigte damals noch der gemäßigten Reform und wollte
sie überall nur aus dem Talmud selbst herleiten und begründen. Darum
kümmerte sich der zweite wenig, und verteidigte eine durchgreifende
Reform mit großer Schärfe und gewandter Dialektik, der er oft einen
überraschenden Sarkasmus einzufügen wusste, und zwar gerade da, wo man
diesen gar nicht vermutete, und wo er deshalb wie ein Blitz einschlug. S.
Adler gewann gerade durch seine Richtung bald eine gewisse Autorität
unter seinen Kollegen, die er durch ein freundliches, liebenswürdiges
Benehmen steigerte. A. Adler hatte ein hässliches Organ, das er jedoch
durch seine kräftige Redeweise leicht vergessen machte. Von ihm ist mir
nur eine polemische Schrift 'das Judentum und die Kritik, ein
Sendschreiben an Herrn Dr. Frenkel ' (Mannheim 1845) bekannt, und einem
weiteren Wirken setzte ein frühzeitiger Tod ein Ende. Von S. Adler, der
später nach New York berufen ward, wo er eine lange sehensreiche für das
amerikanische Judentum bedeutende amtliche Wirkung bis zum heutigen Tage
ausübte, ist mir kein literarisches Produkt
bekannt."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. September 1885: "Der Aufmerksamkeit würdig waren
auch die Brüder S. Adler, Kreisrabbiner in Alzey und A.
Adler, Prediger in Worms. Ähnlichkeit besaßen diese Brüder weder in
ihrer äußeren Erscheinung, noch in ihren Ansichten; aber in ihren
Gesinnungen und in ihrer Charakterfestigkeit kamen sie überein. Der
erstere der beiden huldigte damals noch der gemäßigten Reform und wollte
sie überall nur aus dem Talmud selbst herleiten und begründen. Darum
kümmerte sich der zweite wenig, und verteidigte eine durchgreifende
Reform mit großer Schärfe und gewandter Dialektik, der er oft einen
überraschenden Sarkasmus einzufügen wusste, und zwar gerade da, wo man
diesen gar nicht vermutete, und wo er deshalb wie ein Blitz einschlug. S.
Adler gewann gerade durch seine Richtung bald eine gewisse Autorität
unter seinen Kollegen, die er durch ein freundliches, liebenswürdiges
Benehmen steigerte. A. Adler hatte ein hässliches Organ, das er jedoch
durch seine kräftige Redeweise leicht vergessen machte. Von ihm ist mir
nur eine polemische Schrift 'das Judentum und die Kritik, ein
Sendschreiben an Herrn Dr. Frenkel ' (Mannheim 1845) bekannt, und einem
weiteren Wirken setzte ein frühzeitiger Tod ein Ende. Von S. Adler, der
später nach New York berufen ward, wo er eine lange sehensreiche für das
amerikanische Judentum bedeutende amtliche Wirkung bis zum heutigen Tage
ausübte, ist mir kein literarisches Produkt
bekannt." |
Ausschreibung der Stelle des ersten Kantors
(1851)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juli 1851: "Konkurrenzeröffnung Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Juli 1851: "Konkurrenzeröffnung
Die Stelle eines ersten Kantors bei der hiesigen israelitischen
Religionsgemeinde mit einem fixen Gehalte von 400 fl. und den
ordnungsmäßigen Akzidenzien ist erledigt. Der Anzustellende muss nicht nur
genügende musikalische und orthographische Fähigkeiten besitzen, sondern
auch zur Erteilung des Hilfsreligionsunterrichtes und namentlich des
hebräischen Elementarunterrichts qualifiziert sein.
Konkurrenzfähige Bewerber werden eingeladen, sich binnen möglichst kurzer
Zeit an die unterzeichnete Stelle zu wenden und ihre Zeugnisse einzusenden.
Worms, am 10. Juni 185.1 Der Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde daselbst. Heinrich Blün, Eduard Blün, Sam. Schneider,
A. Levi." |
Die Prediger- und Religionslehrerstelle konnte mit Dr.
Lewysohn wieder besetzt werden (1851)
Anmerkung: zu Dr. Ludwig Lewysohn siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1851: "Worms, 19. September
(Privatmitteilung). Die bisher vakante hiesige Prediger- und
Religionslehrerstelle ist endlich vergangenen Samstag durch einstimmigen
Beschluss des Vorstandes und Ausschusses der Gemeinde durch die Wahl des Dr.
Levysohn aus Frankfurt am Main wieder besetzt worden. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1851: "Worms, 19. September
(Privatmitteilung). Die bisher vakante hiesige Prediger- und
Religionslehrerstelle ist endlich vergangenen Samstag durch einstimmigen
Beschluss des Vorstandes und Ausschusses der Gemeinde durch die Wahl des Dr.
Levysohn aus Frankfurt am Main wieder besetzt worden.
Es meldeten sich zu dieser Stelle 8 Rabbinatskandidaten (darunter 2
Inländer), von denen 3 zur engeren Wahl kamen. Von diesen 3 Kandidaten,
welche sich hier vorstellen und Predigten abhalten mussten, trug Herr Dr.
L.(evysohn) den Sieg davon, dessen Erscheinen und Vertrauen einflößende
Persönlichkeit die Herzen gewann und dessen Predigt von der Art war, dass
alle Parteien der Gemeinde sofort dessen Anstellung dringend befürworteten,
indem die Predigt von tüchtigem homiletischem Wissen Zeugnis gab und in
dialektischer und rhetorischer Beziehung den entschiedendsten Beifall
fanden.
Herr Dr. L(evysohn). findet hier einen fruchtbaren Boden für sein Wirken von
dem man allgemein den besten Erfolg erhofft.
Die Wahl hat unterm Gestrigen die Genehmigung großherzoglicher
Regierungskommission des Regierungsbezirks Worms erhalten.
N. Frank, Reg.-Sekr.-Assistent." |
Rabbiner
Dr. Ludwig Lewysohn wird verabschiedet (1859)
Anmerkung: Rabbiner Dr. Ludwig Lewysohn war als Rabbiner ausgebildet, aber in
Worms als "Prediger" neben Rabbiner Jakob (Koppel) Bamberger angestellt;
Informationen zu ihm siehe unten in der Übersicht zu den Predigern. Zu Dr.
Ludwig Lewysohn (geb. 1819 in Schwersenz, gest. 1901 in Stockholm) siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25.
April 1859: "Worms, den 11. April (Privatmitteilung). Mächtig ist
für uns, für die hiesige Gemeinde, ja für den hiesigen Ort, im Allgemeinen,
das wehmütige Gefühl der Trennung wegen des Abganges des allverehrten Herrn
Dr. Levysohn, welcher nach einem 7 ½ jährigen Aufenthalt dahier, als
Rabbiner und Prediger, nach dem fernen Stockholm sich begibt. - Am 27.
dieses Monats (gemeint März 1859) hielt derselbe seine
Abschiedspredigt, und wir entsinnen uns nicht, die weiten Räume der heiligen
Hallen so überfüllt gesehen zu haben. - Der bewältigende Eindruck dieser
feierlichen Stunde wird wohl allen Anwesenden unvergesslich bleiben. - Nach
der Predigt begab sich der Großherzogliche Gymnasialdirektor, Herr Prof. Dr.
Wiegand, in die Behausung des Herrn Dr. Levysohn und lud denselben, nach
vorangegangenem einstimmigen Beschlusse des Lehrerkollegiums, zu einem
Festmahle, welches das Kolleg ihm zu Ehren beschlossen hatte. Herr Dr.
Levysohn lehnte jedoch diese ehrende Ovation unter den freundlichsten
Dankversicherungen ab. Herr Direktor Wiegand veröffentlichte ferner im
diesjährigen Gymnasialprogramme eine ausführliche biografische Skizze über
Herrn Dr. Levysohn, welche zum Schluss lautet: 'Herr Levysohn legt sein
Amt gegen Ende März dahier nieder und unsere wärmsten Wünsche folgen ihm
nach die lange Reise von Worms am Rheine bis in den hohen Norden, welchen
schon die poetische Sage des Nibelungen-Liedes mit jener Stadt in Verbindung
setzte. Der Held Siegfried brachte glücklich den goldenen Hort der
Nibelungen aus dem hohen Norden nach Worms, das Gold ward aber daselbst in
den Rhein versenkt. Ein Siegfried im andern Sinne zieht Herr Levysohn von
Worms wieder nach dem hohen Norden, mit dem goldenen Horte des Wortes
Gottes, um es auch zu versenken – in die Herzen seiner neuen Gemeinde. Amen.' Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25.
April 1859: "Worms, den 11. April (Privatmitteilung). Mächtig ist
für uns, für die hiesige Gemeinde, ja für den hiesigen Ort, im Allgemeinen,
das wehmütige Gefühl der Trennung wegen des Abganges des allverehrten Herrn
Dr. Levysohn, welcher nach einem 7 ½ jährigen Aufenthalt dahier, als
Rabbiner und Prediger, nach dem fernen Stockholm sich begibt. - Am 27.
dieses Monats (gemeint März 1859) hielt derselbe seine
Abschiedspredigt, und wir entsinnen uns nicht, die weiten Räume der heiligen
Hallen so überfüllt gesehen zu haben. - Der bewältigende Eindruck dieser
feierlichen Stunde wird wohl allen Anwesenden unvergesslich bleiben. - Nach
der Predigt begab sich der Großherzogliche Gymnasialdirektor, Herr Prof. Dr.
Wiegand, in die Behausung des Herrn Dr. Levysohn und lud denselben, nach
vorangegangenem einstimmigen Beschlusse des Lehrerkollegiums, zu einem
Festmahle, welches das Kolleg ihm zu Ehren beschlossen hatte. Herr Dr.
Levysohn lehnte jedoch diese ehrende Ovation unter den freundlichsten
Dankversicherungen ab. Herr Direktor Wiegand veröffentlichte ferner im
diesjährigen Gymnasialprogramme eine ausführliche biografische Skizze über
Herrn Dr. Levysohn, welche zum Schluss lautet: 'Herr Levysohn legt sein
Amt gegen Ende März dahier nieder und unsere wärmsten Wünsche folgen ihm
nach die lange Reise von Worms am Rheine bis in den hohen Norden, welchen
schon die poetische Sage des Nibelungen-Liedes mit jener Stadt in Verbindung
setzte. Der Held Siegfried brachte glücklich den goldenen Hort der
Nibelungen aus dem hohen Norden nach Worms, das Gold ward aber daselbst in
den Rhein versenkt. Ein Siegfried im andern Sinne zieht Herr Levysohn von
Worms wieder nach dem hohen Norden, mit dem goldenen Horte des Wortes
Gottes, um es auch zu versenken – in die Herzen seiner neuen Gemeinde. Amen.'
Gestern Abend vereinigte ein öffentliches Lokal einen reichen Kreis seiner
Freunde in hiesiger Gemeinde bei einem Festessen, zu Ehren unseres
hochgeschätzten Predigers. Herr Melas, Präsident des Vorstandes, überreichte
Letzterem im Namen seiner vielen Freunde einen prachtvollen silbernen Pokal
und unter den herzlichsten Glückswünschen trennte sich die zahlreiche
Gesellschaft in später Stunde. Alle fühlten es und viele sprachen es aus,
dass unserer Gemeinde nicht so leicht der Verlust ersetzt werden wird. -
Auch wir begleiten unseren allverehrten Freund mit unsern besten Wünschen
und indem wir dem allgemeinen Bedauern über den Weggang unseres Freundes uns
anschließen, gratulieren wir der Gemeinde zu Stockholm zu dieser glücklichen
Wahl, einen Mann zu bekommen, welcher neben anerkanntem, gediegenem Wissen
und ausgezeichnetem Rednertalent einen biedern Charakter und die höchste
Begeisterung für seinen Amtsberuf besitzt. - Der Allmächtige geleite
denselben und seine Familie auf der weiten Reise. -
Dr. Gernsheim." |
Nach
Weggang von Dr. Ludwig Lewysohn ist das Rabbinat vakant (1859)
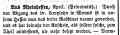 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Mai
1859: "Aus Rheinhessen, April (Privatmitteilung). Durch den
Abgang des Dr. Lewysohn in Worms ist in unserm Hessen nun das dritte
Rabbinat vakant geworden, und es hat beinahe den Anschein, als sollten
solche, zum Teil mindestens, nie mehr besetzt werden."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Mai
1859: "Aus Rheinhessen, April (Privatmitteilung). Durch den
Abgang des Dr. Lewysohn in Worms ist in unserm Hessen nun das dritte
Rabbinat vakant geworden, und es hat beinahe den Anschein, als sollten
solche, zum Teil mindestens, nie mehr besetzt werden." |
Ausschreibung
der Stelle des ersten Kantors (1859)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16.
Mai 1859: "Konkurrenz-Eröffnung. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16.
Mai 1859: "Konkurrenz-Eröffnung.
Die Stelle eines ersten Kantors bei der hiesigen israelitischen
Religionsgemeinde mit einem fixen Gehalt von Fl. 500 und den
ordnungsmäßigen Akzidenzien, ist erledigt.
Der Anzustellende muss nicht nur genügende musikalische und
orthoepographische Fähigkeiten besitzen, sondern auch zur Erteilung des
Hilfs-Religionsunterrichts und des hebräischen Elementarunterrichtes
pädagogisch qualifiziert sein.
Konkurrenzfähige Bewerber werden eingeladen, sich längstens binnen 6
Wochen an die unterzeichnete Stelle zu wenden und Zeugnisse über ihre
bisherige Wirksamkeit einzusenden.
Worms, 27. April 1859. Der Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde daselbst.
L. Melas. M. Edinger. Ed. Herz. Alex Mayer. L.
Wolfskehl." |
Ausschreibung
der Stelle eines Predigers und Religionslehrers (1860)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. April
1860: "Konkurrenz-Eröffnung Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. April
1860: "Konkurrenz-Eröffnung
Die Stelle eines Predigers- und Religionslehrers in der israelitischen
Religions-Gemeinde dahier, mit einem jährlichen fixen Gehalt von Fl. 700 und
ansehnlichen Nebeneinkünften soll wieder besetzt werden. Konkurrenzfähige
Bewerber wollen ihre Gesuche mit Beifügung ihrer Atteste bei unterzeichneter
Stelle franco bis längstens den 15ten Juni des Jahres einreichen.
Worms a./Rh., den 6. April 1860.
Für den Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde. L. Melas." |
Über das Wirken des Predigers Dr. Rosenthaler
(gemeint: Dr. Rosenfeld, 1861)
Anmerkung: es handelt sich sicher um Dr. J. Rosenfeld aus Hirschberg
(Schlesien), siehe oben.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. März 1861: "In Worms wirkt schon seit Monden Herr Dr.
Rosenthaler als Prediger. wir gaben gehört, dass seine Predigten sehr
besucht sein sollen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. März 1861: "In Worms wirkt schon seit Monden Herr Dr.
Rosenthaler als Prediger. wir gaben gehört, dass seine Predigten sehr
besucht sein sollen." |
Nach einem Gastauftritt wird Kantor Elkan aus Schlesien in der
Gemeinde angestellt -
orthodoxer Protest gegen die Gründung eines gemischten Chores und den am
Schabbat schreibenden Gemeindevorstehers
(1864)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. Februar 1864: "Worms, 7. Februar. Wielands
Dichtung, die Abderiten, in welcher auf einmal ganz Abdera und sogar die
Frösche in den Teichen zu singen begannen, scheint in unserer jüdischen
Gemeinde sich verwirklichen zu wollen. Das göttliche Gefühl des Gesanges hat
beinahe alle Gemeindemitglieder erfasst und alles will singen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. Februar 1864: "Worms, 7. Februar. Wielands
Dichtung, die Abderiten, in welcher auf einmal ganz Abdera und sogar die
Frösche in den Teichen zu singen begannen, scheint in unserer jüdischen
Gemeinde sich verwirklichen zu wollen. Das göttliche Gefühl des Gesanges hat
beinahe alle Gemeindemitglieder erfasst und alles will singen.
Vor drei Wochen ist ein Herr Elkan aus Schlesien hier durchgereist, hat als
musikalisch gebildeter Kantor in unserer Synagoge eine Gastrolle gegeben;
die Gemeinde von dessen so herrlicher und kraftvoller Stimme begeistert,
veranlasste den Vorstand, diesen Künstler als ersten Kantor mit einem
Gehalte von fl. 600 zu engagieren.
Nachdem man nun die bezaubernde Stimme des Herrn Elkan zum zweiten Male
gehört, wurde durch die Zeitung zum Zwecke eines neu sich bildenden Chors
aufgefordert, auf Sabbatmittag 4 Uhr auf der israelitischen Gemeindestube zu
erscheinen; um zu beraten und zu besprechen über das Arrangement des neuen
Gottesdienstes - und dieser Ruf war nicht verhallt, denn noch war kaum die
Stunde genaht, so sah man in religiöser Begeisterung Junge und Alte,
Jünglinge und Jungfrauen auf die Gemeindestube eilen, um sich als singende
Mitglieder anzukündigen. Herr Siegmund Gernsheim ergriff alsbald die
Feder, um die sich meldenden Mitglieder aufzuschreiben.
Wir können nicht umhin, eine solche Hinwegsetzung über eines der heiligsten
jüdischen Religionsgesetze von Seiten eines Religionsvorstehers bei Ausübung
seines Amtes anders als unwürdig zu bezeichnen.
Herr Gernsheim möge als gebildeter Kaufmann noch so aufgeklärt (!) sein, und
selbst das Heiligste des Glaubens gering schätzen, so wird ihn darüber
niemand zur Rede stellen (leider!) - aber als Vorsteher einer
Religionsgemeinde – am grünen Tisch auf der Gemeindestube muss er sich als
streng gläubiger Israelit betrachten, der alle Anforderungen der
Strenggläubigen mit gewissenhafter Strenge zu bewachen verpflichtet sei,
wenn sie ihm noch so überschüssig scheinen.
Über die Sache selbst wollen wir heute nicht sprechen, wir werden erst in
einigen Wochen darauf zurückkommen, wenn es ruhiger wird im Hause des Herrn
– der hiesige Enthusiasmus ist doch stets von kurzer Dauer - und dann hat es
die Erfahrung auch sattsam dargetan, dass alle Flicklappen der Reform
niemals im Stande waren, die Blößen des Indifferentismus zuzudecken."
Anmerkung: zu Abderiten vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Abderiten
Kantor Elkan: L. Elkan aus Thorn. |
Ausschreibung der Kantor- und
Hilfsreligionslehrerstelle (1868)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. Januar 1868: "Inserat Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. Januar 1868: "Inserat
Die erste Kantor- und Hilfsreligionslehrerstelle der hiesigen israelitischen
Religionsgemeinde soll durch eine Persönlichkeit besetzt werden, die die
beiderseitige Befähigung in sich vereinigt. – Die Stelle kann sofort
angetreten werden und wird mit einem fixen Gehalte von 875 Gulden dotiert.
Reflektanten belieben sich bei unterzeichneter Stelle unter Beifügung der
betreffenden Zeugnisse zu melden.
Worms, Dezember 1868. Der Vorstand der israelitischen
Religions-Gemeinde. Isaac Pfungst."
Anmerkung: Isaac Pfungst war von Beruf Lederhändler und in der Wormser
Mathildenstraße 20 ansässig. vgl.
Artikel von 1873 zu seinem Tod. |
Ausschreibungen der Stelle des Kantors und Lehrers (1873 / 1876)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Juli 1873: "Vakanz der Kantor- und Lehrerstelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Juli 1873: "Vakanz der Kantor- und Lehrerstelle.
In der hiesigen Gemeinde ist die Stelle des ersten Kantors und
Hilfsreligionslehrers zu besetzen. Wir suchen einen musikalisch gebildeten,
mit einer schönen Stimme begabten Kantor, der gleichzeitig befähigt ist, als
Hilfsreligionslehrer zu fungieren.
Der fixe Gehalt beträgt je nach Leistung fl. 500 bis fl. 1.000 pro Jahr.
Da nur 8 bis 12 der Unterrichtsstunden pro Woche erforderlich sind, so ist
die Gelegenheit geboten, mehrere hundert Gulden durch Privatunterricht zu
erzielen.
Sofortige Anmeldungen unter Begleitung von Zeugnissen sind erwünscht.
Worms a/Rhein, den 24. Juni 1873. Der Vorstand der israel(itischen)
Religionsgemeinde dahier." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1873: Text
wie oben Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1873: Text
wie oben |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Januar 1876: "Vakanz der Kantor- und Lehrerstelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. Januar 1876: "Vakanz der Kantor- und Lehrerstelle.
In der hiesigen Gemeinde ist die Stelle des ersten Kantors und
Hilfsreligionslehrers zu besetzen.
Wir suchen einen musikalisch gebildeten, mit einer schönen Stimme begabten
Kantor, der gleichzeitig befähigt ist, als Hilfsreligionslehrer zu
fungieren.
Der fixe Gehalt beträgt je nach Leistung 1.400 bis 1.700 Mark per Jahr.
Da nur 8 bis 12 der Unterrichtsstunden pro Woche erforderlich sind, so ist
die Gelegenheit geboten, mehrere hundert Mark durch Privatunterricht zu
erzielen.
Sofortige Anmeldungen unter Begleitung von Zeugnissen sind erwünscht.
Worms a/Rhein, den 30. Dez. 1875. Der Vorstand der israel(itischen)
Religionsgemeinde dahier." |
Religionslehrer
Samson Rothschild wird Hilfslehrer an der städtischen Kommunalschule (1874)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. August 1874: "Worms, 22. Juli. (Privatmitteilung).
Die großherzogliche hessische Oberstudiendirektion hat den israelitischen
Religionslehrer Samson Rothschild zum Hilfslehrer an der hiesigen
städtischen Kommunalschule ernannt. Es ist dies der erste Fall, dass in
Hessen ein Israelit an einer christlichen Schule wirkt."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. August 1874: "Worms, 22. Juli. (Privatmitteilung).
Die großherzogliche hessische Oberstudiendirektion hat den israelitischen
Religionslehrer Samson Rothschild zum Hilfslehrer an der hiesigen
städtischen Kommunalschule ernannt. Es ist dies der erste Fall, dass in
Hessen ein Israelit an einer christlichen Schule wirkt." |
Ausschreibung der Kantor- und Religionslehrerstelle
(1877)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juli
1877: "Vakanz der Kantor- und Religionslehrerstelle. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juli
1877: "Vakanz der Kantor- und Religionslehrerstelle.
In der hiesigen Gemeinde ist die Stelle des ersten Kantors und
Hilfsreligionslehrers zu besetzen. Wir suchen einen musikalisch gebildeten,
mit einer schönen Stimme begabten Kantor, der gleichzeitig befähigt ist, als
Hilfsreligionslehrer zu fungieren. Der fixe Gehalt beträgt 2.000 Mark per
Jahr.
Da die Zahl der Unterrichtsstunden nicht sehr bedeutend ist, so ist die
Gelegenheit geboten, mehrere hundert Mark durch Privatunterricht zu
erzielen.
Sofortige Anmeldungen unter Begleitung von Zeugnissen sind erwünscht.
Bewerber, welche zu den hohen Feiertagen die Stelle schon antreten können,
werden bevorzugt.
Worms a. Rhein, den 2. Juli 1877. Der Vorstand der
israel.(itischen) Gemeinde dahier." |
Ausschreibung der Kantor- und Religionslehrerstelle
(1882)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Februar 1882: "Vacanz der Kantor- und
Religionslehrerstelle Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 21. Februar 1882: "Vacanz der Kantor- und
Religionslehrerstelle
In der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines ersten Kantors zu besetzen.
Wir suchen einen musikalisch gebildeten, mit einer schönen Stimme begabten
Kantor, der gleichzeitig befähigt ist, die Stelle eines zweiten
Religionslehrers (mit 12 bis 14 Stunden pro Woche) zu versehen. Der fixe
Gehalt bis zu 2.000 Mark per Jahr. Nebenverdienst durch Privatunterricht
geboten.
Worms, den 14. Februar 1882. Der Vorstand der israelitischen
Religionsgemeinde zu Worms a. Rh." |
Zum Tod des Kantors Reimund Isaac
(1891)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. März 1891: "Worms. Am vergangenen Sonntage bewegte sich ein unendlich großer Leichenzug
nach dem jüdischen Friedhofe, um hier die sterblichen Überreste des nach
mehrmonatigem schweren Leiden verstorbene Kantor Reimund Isaac dem Schoße
der Erde zu übergeben. Der ungemein großen Leichenkondukt, sowie der tiefe
Ernst, der sich auf allen Gesichtern lagerte, waren beredtes Zeugnis, das
man einem Manne die letzte Ehre erweise, der im Leben durch sein Wirken die
Linie des Alltäglichen um Bedeutendes überschritten haben müsse. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. März 1891: "Worms. Am vergangenen Sonntage bewegte sich ein unendlich großer Leichenzug
nach dem jüdischen Friedhofe, um hier die sterblichen Überreste des nach
mehrmonatigem schweren Leiden verstorbene Kantor Reimund Isaac dem Schoße
der Erde zu übergeben. Der ungemein großen Leichenkondukt, sowie der tiefe
Ernst, der sich auf allen Gesichtern lagerte, waren beredtes Zeugnis, das
man einem Manne die letzte Ehre erweise, der im Leben durch sein Wirken die
Linie des Alltäglichen um Bedeutendes überschritten haben müsse.
I. war im Jahre 1827 in Wollenberg
(Großherzogtum Baden) geboren. Nachdem er sich für das Lehrfach
vorbereitet, besuchte er das Seminar zu Karlsruhe. Seine erste Anstellung
war zu Mingolsheim bei Bruchsal. Von hier aus übernahm er eine
Religionslehrerstelle im hiesigen Kreise und übersiedelte dann im Jahre 1857
hierher, um seinen späteren Schwiegervater im Amte zu unterstützen. Nach
dessen Tod wurde ihm die Stelle eines Kantors und Schochet (ritueller
Schächter) übertragen, welche er bis zum vorigen Jahre bekleidete, wo
alsdann der Vorstand die Schechita (rituelles Schächten) seinem
Schwiegersohne übertrug, während er das Amt eines Kantors noch selbst
verwaltete. Wie sehr freute man sich, dass dem gewissenhaften Mann jetzt der
schwere Beruf der Schechitah abgenommen und er jetzt mit Ruhe den Abend
seines Lebens verbringen könne, aber die Worte der heiligen Schrift:
'und er sah die Ruhstatt, dass sie gut' (1. Mose 49,15) hatte für ihn keine Bedeutung. Der Keim der Krankheit war schon
zu stark in ihm entwickelt. Trotzdem sehen wir ihn morgens und abends am
Vorlesepulte, um hier seines Amtes zu walten, bis ihn die Krankheit so
heftig ergriff, dass er 2 Monate lang das Zimmer und Bett hüten musste, bis
ihn am vergangenen Freitag ein sanfter Tod von seinen Leiden erlöste.
Dem Schmerz über den Verlust eines solchen gewissenhaften Beamten gab dann
auch Herr Rabbiner Dr. Stein in bewegten Worten Ausdruck, indem er den
Verstorbenen in seiner Gewissenhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Bescheidenheit
schilderte. Ergreifend war, was der Redner über seine Leistungen als Kantor
sprach. Wie er durch die uralten traditionellen Melodien an den Hohen
Feiertagen die Gottesdienstbesucher zur Andacht stimmte und wie er
selbst bei seinen Funktionen an den Werktagen ... auf ihm lag. Wer in solcher Weise
seine Pflicht erfüllt hat, der stirbt nicht; er lebt fort nicht nur in den
Herzen der Seinen, sonder auch in denen der ganzen Gemeinde. (Rdsch.)" |
Werbung für eine Publikation von Lehrer Samson Rothschild
(1893)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Juni 1893: "Für jüdische Buchhandlungen Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Juni 1893: "Für jüdische Buchhandlungen
In unserem Verlage erschien soeben: Aus Vergangenheit und Gegenwart der
israelitischen Gemeinde Worms
Von Samson Rothschild, Lehrer an der Stadtschule zu Worms a. Rh.
Mit vier Fototypien.
Inhalt: Vorwort. Der Friedhof. Die Synagoge. Interessante Inschriften. Sagen
und Legenden.
Ladenpreis 60 Pfg. – Buchhandlungen entsprechend Rabatt
Joh. Wirth’sche Hof-Buchdruckerei. Aktien-Gesellschaft, Mainz."
vgl.
http://www.warmaisa.de/stolpersteine/rothschild-samson-1848-1939/
|
Silberne
Hochzeit von Lehrer Samson Rothschild und seiner Frau (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Mai 1904: "Worms. Am 23. April feierte Herr Lehrer S.
Rothschild das Fest seiner silbernen Hochzeit. Freitagabend wurde ihm
ein Ständchen durch die 'Liedertafel', dem ersten hiesigen Verein,
dargebracht. Samstag erhielt er durch Deputationen zahlreiche Glückwünsche.
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde war vollzählig vertreten. Der Präsident
Levy* feierte das Ehepaar in einer herzlichen Ansprache. Gleichzeitig waren
auch alle Beamten unter Anführung von Rabb. Dr. Stein sowie eine Deputation
des Synagogenchores, des israelitischen Schülerunterstützungsvereins,
Raschivereins, Bne Bris-Loge (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith) vertreten. Das Kollegium
der höheren Mädchenschule, an der der Jubilar schon lange Jahre segensreich
wirkt, sandte prachtvolle Blumenspenden. Alle Deputationen überreichten
Geschenke. Das Kollegium der Volksschule sandte als Deputation seine
Oberlehrer. Kreisschulinspektor Scherer in
Büdingen,
kurz vorher zu einer Konferenz angekommen, war persönlich erschienen. Auch
wir, die wir den Herrn Jubilar als treuen Mitarbeiter kennen, fügen unseren
Glückwunsch hinzu. Möge er noch lange an der Seite seiner Gattin zum Segen
des Judentums und als Zierde seines Berufs tätig sein."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19. Mai 1904: "Worms. Am 23. April feierte Herr Lehrer S.
Rothschild das Fest seiner silbernen Hochzeit. Freitagabend wurde ihm
ein Ständchen durch die 'Liedertafel', dem ersten hiesigen Verein,
dargebracht. Samstag erhielt er durch Deputationen zahlreiche Glückwünsche.
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde war vollzählig vertreten. Der Präsident
Levy* feierte das Ehepaar in einer herzlichen Ansprache. Gleichzeitig waren
auch alle Beamten unter Anführung von Rabb. Dr. Stein sowie eine Deputation
des Synagogenchores, des israelitischen Schülerunterstützungsvereins,
Raschivereins, Bne Bris-Loge (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith) vertreten. Das Kollegium
der höheren Mädchenschule, an der der Jubilar schon lange Jahre segensreich
wirkt, sandte prachtvolle Blumenspenden. Alle Deputationen überreichten
Geschenke. Das Kollegium der Volksschule sandte als Deputation seine
Oberlehrer. Kreisschulinspektor Scherer in
Büdingen,
kurz vorher zu einer Konferenz angekommen, war persönlich erschienen. Auch
wir, die wir den Herrn Jubilar als treuen Mitarbeiter kennen, fügen unseren
Glückwunsch hinzu. Möge er noch lange an der Seite seiner Gattin zum Segen
des Judentums und als Zierde seines Berufs tätig sein."
*Zu Präsident Levy: es handelt sich um Hofrat Max Moses Levy (1858–1936),
Gemeindevorsitzender und Enkel des Synagogenstifters und Fruchthändlers
Ludwig Levy (1801- 1877). |
40-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer Samson Rothschild
(1912)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 28. Juni 1912: "Worms, Mittwoch, den 3. Juli feiert
die jüdische Gemeinde das 40jährige Ortsjubiläum ihres verdienten und
in allen Kreisen geschätzten Religionslehrers S. Rothschild, der auch
seit 38 Jahren an der städtischen Volksschule als Klassenlehrer wirkt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 28. Juni 1912: "Worms, Mittwoch, den 3. Juli feiert
die jüdische Gemeinde das 40jährige Ortsjubiläum ihres verdienten und
in allen Kreisen geschätzten Religionslehrers S. Rothschild, der auch
seit 38 Jahren an der städtischen Volksschule als Klassenlehrer wirkt." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Juli 1912: "Worms. Der 3. Juli war ein Ehrentag für
die jüdische Gemeinde; unser Lehrer S. Rothschild feierte nämlich
sein 40jähriges Ortsjubiläum. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Juli 1912: "Worms. Der 3. Juli war ein Ehrentag für
die jüdische Gemeinde; unser Lehrer S. Rothschild feierte nämlich
sein 40jähriges Ortsjubiläum.
Der Gemeindevorstand mit den Beamten, Abordnungen der verschiedenen
Wohltätigkeitsvereine, denen der Jubilar sich in hervorragender Weise
widmet, die Loge, deren derzeitiger Präsident der Gefeierte ist, brachten
ihre Glückwünsche unter Überreichung wertvoller und sinniger Geschenke. Für
die Gemeinde sprach Herr Levy, der besonders hervorhob, wie Herr
Rothschild den scheinbar gleichmäßigen Gange des Berufslebens immer neue,
freundliche und fruchtbringende Seiten zum Wohle der Jugend und der
Gemeinde, die eines solch pflichtgetreuen Beamten besitzt. Die Wünsche der
Loge brachte Rechtsanwalt Baruch zum Ausdruck. Für die Beamten der
Gemeinde sprach in herzlicher Weise Kantor Agulik. Zuvor war eine
Abordnung des Synagogenchor-Vereins, in dessen Namen der Präsident, Herr
Berliner, herzliche Glückwünsche überbrachte, des
Schüler-Unterstützungsvereins** und des Jugendvereins erschienen. Namens des
hessischen Lehrervereins sprach der würdige Lehrergreis Wertheimer –
Heldenbergen, der in Begleitung des Reallehrers Eschelbacher –
Mainz
gekommen war. Nun sprachen noch Sam. Guggenheim in Namen des
israelitischen Hospitals und Herr Levy im Namen des Hilfsvereins.
Herr Rothschild dankte auf alle Ansprachen in herzlichen Worten.
Dass auch viele christliche Kreise an der Feier der jüdischen Gemeinde nicht
gleichgültig vorübergingen, braucht, nachdem der Jubilar 38 Jahre an der
städtischen Volksschule als Klassenlehrer wirkt, nicht besonders
hervorgehoben werden. E. in M."
*Bei Herrn Levy handelt es sich um Hofrat Max Moses Levy, (1858 – 1936), den
Gemeindevorsitzenden und Enkel des Synagogenstifters und Fruchthändlers
Ludwig Levy (1801- 1877).
**Zum israelitischen Unterstützungsverein:
http://www.alemannia-judaica.de/worms_gemeindeleben.htm#Über die Arbeit des
israelitischen Unterstützungsvereins (1900). |
Zum Tod
von Lehrer Jakob Stern (1912)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober
1912: "Aus Worms wird gemeldet: Der Nestor der hessischen jüdischen
Volksschullehrer, Jakob Stern, ist im Alter von 84 Jahren hier gestorben.
Der Verstorbene war 32 Jahre mit Eifer und Pflichttreue als Lehrer tätig und
war weit über seinen Wirkungskreis bekannt und beliebt. Am Grabe hielten
Rabbiner Dr. Holzer und Hauptlehrer Rothschild dem Verstorbenen Nachrufe und
legten im Auftrage des Bezirkslehrervereins Kränze nieder." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober
1912: "Aus Worms wird gemeldet: Der Nestor der hessischen jüdischen
Volksschullehrer, Jakob Stern, ist im Alter von 84 Jahren hier gestorben.
Der Verstorbene war 32 Jahre mit Eifer und Pflichttreue als Lehrer tätig und
war weit über seinen Wirkungskreis bekannt und beliebt. Am Grabe hielten
Rabbiner Dr. Holzer und Hauptlehrer Rothschild dem Verstorbenen Nachrufe und
legten im Auftrage des Bezirkslehrervereins Kränze nieder."
Zu Rabbiner Dr. Isaak Holzer (1873–1951):
http://www.wormserjuden.de/Biographien/Holzer.html
Zu Hauptlehrer Samson Rothschild (1848–1939):
http://www.warmaisa.de/stolpersteine/rothschild-samson-1848-1939/ |
25-jähriges
Ortsjubiläum und 25-jähriges Ehejubiläum von Kantor Julius Rosenthal (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Dezember 1914: "Man schreibt uns aus Worms: am 22.
November beging Herr Julius Rosenthal sein 25jähriges Ehejubiläum und seine
25jährige Wirksamkeit als Kantor der hiesigen Gemeinde. Alle Redner feierten
die Gewissenhaftigkeit und die Tüchtigkeit des Jubilars. Die ganze Gemeinde
wetteiferte in der Anerkennung seiner Verdienste und ehrte ihn durch
prächtige Geschenke. Möge Herr Rosenthal auch seine goldene Hochzeit feiern
können und noch lange seines Amtes walten!" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Dezember 1914: "Man schreibt uns aus Worms: am 22.
November beging Herr Julius Rosenthal sein 25jähriges Ehejubiläum und seine
25jährige Wirksamkeit als Kantor der hiesigen Gemeinde. Alle Redner feierten
die Gewissenhaftigkeit und die Tüchtigkeit des Jubilars. Die ganze Gemeinde
wetteiferte in der Anerkennung seiner Verdienste und ehrte ihn durch
prächtige Geschenke. Möge Herr Rosenthal auch seine goldene Hochzeit feiern
können und noch lange seines Amtes walten!" |
Zum
Tod von Lehrer Leo Oppenheimer (1915)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Januar 1915: "Worms, 8. Januar. Am 23. v.(origen) M.(onats)
ist hier ein Mann aus dem Leben geschieden, der, wenn auch lange nicht mehr
im Lehrerberufe tätig, sich doch noch immer und zwar mit vollem Rechte als
Lehrer fühlte und der an allen Freuden und Leiden der Lehrer den wärmsten
Anteil genommen. Leo Oppenheimer, geboren 1840 in Essen, besuchte das
Lehrerseminar in Mülheim a. d. Ruhr an die dortige Simultanschule
berufen wurde, wo seine unterrichtliche Tätigkeit, dem preußischen Gesetze
entsprechend, nur den Fächern zugewandt war, die mit 'Deutsch' nichts zu tun
hatten. Gleichzeitig übertrug ihm die jüdische Gemeinde das Amt eines
Predigers. Hier erwarb er sich das Vertrauen seiner vorgesetzten Behörde im
höchsten Grade, wie auch die Liebe der ganzen israelitischen Gemeinde, was
besonders bei seinem 25jährigen Jubiläum und bei seiner Zurruhesetzung durch
Überreichung vieler und wertvoller Geschenke zum Ausdruck kam. Bei dieser
Gelegenheit wurde er durch Verleihung des Adlers des Hohenzollern'schen
Hausordens ausgezeichnet. Trotz äußerst angestrengter Arbeit im Berufe war
O. stets bemüht, sich weiterzubilden, so dass er über ein bedeutendes Wissen
verfügte. Da sein edles Herz von den Schiller'schen Gedanken 'An ein Ganzes
schließe dich an' durchströmt war, gehörte er zu den Mitbegründern des heute
so bedeutenden Rheinisch-Westfälischen jüdischen Lehrervereins, für dessen
Ziele und Zwecke er auch später immer noch tätig war. Nach dem Tode seiner
Gattin siedelte er mit seinem einzigen Kinde hierher zu Verwandten über, wo
er noch 11 Jahre überaus glücklich und zufrieden, geistig sich immer
betätigen, verlebte. Er hatte noch das Glück, zu sehen, dass sein Sohn, der
zurzeit im Felde steht, sein juristisches Examen bestand. In der hiesigen
jüdischen Gemeinde von jedem sehr geschätzt, versah er, solange sein
Gesundheitszustand es ihm gestattete, ehrenamtlich an den hohen Festtagen
das Amt des Kantors in der Levyschen Synagoge1
und bis an sein Lebensende dasjenige des Schriftführers und Mitgliedes der
Verteilungskommission des israelitischen Unterstützungsvereins. Besonders in
diesem Verein wird das, was O. geleistet, so bald nicht vergessen werden,
wie auch seine Kollegen und viele Freunde sein Andenken stets in Ehren
halten werden. 'Was versunken, kehrt nie wieder, doch ging es leuchtend
nieder, leuchtet’s lange noch zurück.' " Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Januar 1915: "Worms, 8. Januar. Am 23. v.(origen) M.(onats)
ist hier ein Mann aus dem Leben geschieden, der, wenn auch lange nicht mehr
im Lehrerberufe tätig, sich doch noch immer und zwar mit vollem Rechte als
Lehrer fühlte und der an allen Freuden und Leiden der Lehrer den wärmsten
Anteil genommen. Leo Oppenheimer, geboren 1840 in Essen, besuchte das
Lehrerseminar in Mülheim a. d. Ruhr an die dortige Simultanschule
berufen wurde, wo seine unterrichtliche Tätigkeit, dem preußischen Gesetze
entsprechend, nur den Fächern zugewandt war, die mit 'Deutsch' nichts zu tun
hatten. Gleichzeitig übertrug ihm die jüdische Gemeinde das Amt eines
Predigers. Hier erwarb er sich das Vertrauen seiner vorgesetzten Behörde im
höchsten Grade, wie auch die Liebe der ganzen israelitischen Gemeinde, was
besonders bei seinem 25jährigen Jubiläum und bei seiner Zurruhesetzung durch
Überreichung vieler und wertvoller Geschenke zum Ausdruck kam. Bei dieser
Gelegenheit wurde er durch Verleihung des Adlers des Hohenzollern'schen
Hausordens ausgezeichnet. Trotz äußerst angestrengter Arbeit im Berufe war
O. stets bemüht, sich weiterzubilden, so dass er über ein bedeutendes Wissen
verfügte. Da sein edles Herz von den Schiller'schen Gedanken 'An ein Ganzes
schließe dich an' durchströmt war, gehörte er zu den Mitbegründern des heute
so bedeutenden Rheinisch-Westfälischen jüdischen Lehrervereins, für dessen
Ziele und Zwecke er auch später immer noch tätig war. Nach dem Tode seiner
Gattin siedelte er mit seinem einzigen Kinde hierher zu Verwandten über, wo
er noch 11 Jahre überaus glücklich und zufrieden, geistig sich immer
betätigen, verlebte. Er hatte noch das Glück, zu sehen, dass sein Sohn, der
zurzeit im Felde steht, sein juristisches Examen bestand. In der hiesigen
jüdischen Gemeinde von jedem sehr geschätzt, versah er, solange sein
Gesundheitszustand es ihm gestattete, ehrenamtlich an den hohen Festtagen
das Amt des Kantors in der Levyschen Synagoge1
und bis an sein Lebensende dasjenige des Schriftführers und Mitgliedes der
Verteilungskommission des israelitischen Unterstützungsvereins. Besonders in
diesem Verein wird das, was O. geleistet, so bald nicht vergessen werden,
wie auch seine Kollegen und viele Freunde sein Andenken stets in Ehren
halten werden. 'Was versunken, kehrt nie wieder, doch ging es leuchtend
nieder, leuchtet’s lange noch zurück.' "
1Vgl. zur Levyschen Synagoge
https://de.wikipedia.org/wiki/Levy'sche_Synagoge_Worms |
50-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Samson Rothschild
(1918)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Mai 1918: "Worms, 24. Mai. Am 15. d.(es) M.(onats)
beging Herr Lehrer Rothschild sein 50jähriges Dienstjubiläum. Zu der
Feier, die in der mit Pflanzengrün und Blumen geschmückten Turnhalle der
Karmeliterschule (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliter-Realschule#Schulgeb%C3%A4ude)
stattfand, hatten sich um den Jubilar, seine Familie, das Kollegium der
Lehrer und Lehrerinnen, seine Schulklasse und zahlreiche Ehrengäste
versammelt, unter anderem die Herren Oberbürgermeister Köhler,
Kreisschulinspektor Eck, Gewerberat Jochem, die evangelische
Geistlichkeit, die katholische Geistlichkeit, Herr Rabbiner Dr. Holzer
und als Vorstand der Jüdischen Gemeinde Herr Hofrat Levy, ferner
der Gesamtschulvorstand. Nach dem stimmungsvollen Damenchor (Lehrerinnen
unter dem Herrn Lehrer Trieb (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Trieb): 'Der Herr ist mein
Hirte' sprach ein kleines Schulmädel der Klasse ein sinniges
Begrüßungsgedicht für den verehrten Lehrer. Es Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Mai 1918: "Worms, 24. Mai. Am 15. d.(es) M.(onats)
beging Herr Lehrer Rothschild sein 50jähriges Dienstjubiläum. Zu der
Feier, die in der mit Pflanzengrün und Blumen geschmückten Turnhalle der
Karmeliterschule (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Karmeliter-Realschule#Schulgeb%C3%A4ude)
stattfand, hatten sich um den Jubilar, seine Familie, das Kollegium der
Lehrer und Lehrerinnen, seine Schulklasse und zahlreiche Ehrengäste
versammelt, unter anderem die Herren Oberbürgermeister Köhler,
Kreisschulinspektor Eck, Gewerberat Jochem, die evangelische
Geistlichkeit, die katholische Geistlichkeit, Herr Rabbiner Dr. Holzer
und als Vorstand der Jüdischen Gemeinde Herr Hofrat Levy, ferner
der Gesamtschulvorstand. Nach dem stimmungsvollen Damenchor (Lehrerinnen
unter dem Herrn Lehrer Trieb (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Trieb): 'Der Herr ist mein
Hirte' sprach ein kleines Schulmädel der Klasse ein sinniges
Begrüßungsgedicht für den verehrten Lehrer. Es |
 folgten
dann die Ansprachen, in denen all die Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und
Hochachtung zum Ausdruck kam, deren sich Herr Rothschild zu erfreuen hat.
Herr Schuldirektor Eck gedachte der Verdienste, die sich der Jubilar in fünf
Jahrzehnten um Schule und Gemeinde erworben hat. Als Auszeichnung des
Großherzogs überreichte er das Ritterkreuz 2. Klasse des Verdienstordens
Philipps des Großmütigen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzoglich_Hessischer_Verdienstorden)
und brachte dabei die Glückwünsche und die Anerkennung der obersten
Schulbehörde und der Kreisschulkommission dar. In herzlichen Worten gedachte
Redner der ruhigen, abgeklärten Persönlichkeit des Jubilars und stellte ihn
vorbildlich hin als Lehrer, wie ihn die heutige ernste Zeit erfordert und
wie er auch in der Friedenszeit vonnöten ist. – Herr Oberbürgermeister
Köhler erinnerte an den 70jährigen Geburtstag, den Herr Rothschild im Januar
dieses Jahres begehen durfte. Die Charakterfestigkeit gebe ihm die
Jugendlichkeit. Im Jahre 1868 habe der Jubilar das Seminar in Baden
verlassen, um 1874 als erster israelitischer Lehrer in Hessen berufen zu
werden (siehe
Artikel von 1874). Wir wüssten wohl, mit welcher Hingebung, Treue
und Liebe zur Sache er gearbeitet hätte. Von ganzem Herzen wünschte Redner,
dass Gott Herrn Rothschild weiter die Kraft verleihe, die er ihm seither
angedeihen ließ und noch recht lange im Dienste unserer Schule zu wirken.
Der heutige Tag zeige, wie er es verstanden habe, nicht nur eine große Zahl
der Schüler mit reichem Wissen zu versehen, sondern sich auch die Liebe und
Wertschätzung der Berufskollegen zu erwerben. Seine Betätigung habe auch im
öffentlichen Leben gelegen. Ganz besonders hervorzuheben sei, was er über
die Geschichte unserer alten Stadt mitteilen konnte und welchen Anteil seine
Glaubensgenossen an dem Schicksal hatten. Die Glückwünsche namens der
Stadtverordnetenversammlung, Stadtverwaltung und des Schulvorstandes bringt
der Herr Oberbürgermeister dar und überreicht als Erinnerungszeichen eine
goldene Uhr. – Herr Professor Uhrig gedachte der kraftvollen Arbeit,
die Herr Rothschild der Eleonorenschule geleistet hat. Seit Herbst 1874 ist
er ununterbrochen Mitglied des Lehrerkollegiums gewesen. Das wichtigste Fach
habe er lehren dürfen, die Religion. Und das habe er mit Toleranz getan. Mit
Stolz dürfe man sagen, das Blühen und Gedeihen der Eleonorenschule sei mit
sein Verdienst. – Herr Hofrat Levy überbrachte die Wünsche der
israelitischen Gemeinde Worms, die dem Jubilar zu besonderem Dank
verpflichtet sei. Er sei ihr Sekretär und im Laufe der Zeit ihr Chronist
geworden. Er habe eine Schrift über die Vergangenheit und Gegenwart der
israelitischen Gemeinde geschrieben, die viele Auflagen erlebte und allseits
Lob erntete2. Auch viele
Abhandlungen aus anderen Zeiten und Gegenden hätten ihm weithin einen Ruf
geschaffen. – Herr Hauptlehrer Groebe beglückwünschte den Kollegen
herzlich im Namen seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und knüpfte in
begeisterten Worten an das Thema 'Grundsätzliche Bedeutung der Volksschule
für das Volksdasein' an. Es ist Pflicht, mit denen, die draußen im Kampfe
stehen, auszuharren und weiterzubauen, um den Zurückkehrenden ein neues
Deutschland, groß nach innen und außen, zu errichten. Und hierzu sei in
erster Linie auch die Schule berufen. folgten
dann die Ansprachen, in denen all die Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und
Hochachtung zum Ausdruck kam, deren sich Herr Rothschild zu erfreuen hat.
Herr Schuldirektor Eck gedachte der Verdienste, die sich der Jubilar in fünf
Jahrzehnten um Schule und Gemeinde erworben hat. Als Auszeichnung des
Großherzogs überreichte er das Ritterkreuz 2. Klasse des Verdienstordens
Philipps des Großmütigen (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzoglich_Hessischer_Verdienstorden)
und brachte dabei die Glückwünsche und die Anerkennung der obersten
Schulbehörde und der Kreisschulkommission dar. In herzlichen Worten gedachte
Redner der ruhigen, abgeklärten Persönlichkeit des Jubilars und stellte ihn
vorbildlich hin als Lehrer, wie ihn die heutige ernste Zeit erfordert und
wie er auch in der Friedenszeit vonnöten ist. – Herr Oberbürgermeister
Köhler erinnerte an den 70jährigen Geburtstag, den Herr Rothschild im Januar
dieses Jahres begehen durfte. Die Charakterfestigkeit gebe ihm die
Jugendlichkeit. Im Jahre 1868 habe der Jubilar das Seminar in Baden
verlassen, um 1874 als erster israelitischer Lehrer in Hessen berufen zu
werden (siehe
Artikel von 1874). Wir wüssten wohl, mit welcher Hingebung, Treue
und Liebe zur Sache er gearbeitet hätte. Von ganzem Herzen wünschte Redner,
dass Gott Herrn Rothschild weiter die Kraft verleihe, die er ihm seither
angedeihen ließ und noch recht lange im Dienste unserer Schule zu wirken.
Der heutige Tag zeige, wie er es verstanden habe, nicht nur eine große Zahl
der Schüler mit reichem Wissen zu versehen, sondern sich auch die Liebe und
Wertschätzung der Berufskollegen zu erwerben. Seine Betätigung habe auch im
öffentlichen Leben gelegen. Ganz besonders hervorzuheben sei, was er über
die Geschichte unserer alten Stadt mitteilen konnte und welchen Anteil seine
Glaubensgenossen an dem Schicksal hatten. Die Glückwünsche namens der
Stadtverordnetenversammlung, Stadtverwaltung und des Schulvorstandes bringt
der Herr Oberbürgermeister dar und überreicht als Erinnerungszeichen eine
goldene Uhr. – Herr Professor Uhrig gedachte der kraftvollen Arbeit,
die Herr Rothschild der Eleonorenschule geleistet hat. Seit Herbst 1874 ist
er ununterbrochen Mitglied des Lehrerkollegiums gewesen. Das wichtigste Fach
habe er lehren dürfen, die Religion. Und das habe er mit Toleranz getan. Mit
Stolz dürfe man sagen, das Blühen und Gedeihen der Eleonorenschule sei mit
sein Verdienst. – Herr Hofrat Levy überbrachte die Wünsche der
israelitischen Gemeinde Worms, die dem Jubilar zu besonderem Dank
verpflichtet sei. Er sei ihr Sekretär und im Laufe der Zeit ihr Chronist
geworden. Er habe eine Schrift über die Vergangenheit und Gegenwart der
israelitischen Gemeinde geschrieben, die viele Auflagen erlebte und allseits
Lob erntete2. Auch viele
Abhandlungen aus anderen Zeiten und Gegenden hätten ihm weithin einen Ruf
geschaffen. – Herr Hauptlehrer Groebe beglückwünschte den Kollegen
herzlich im Namen seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und knüpfte in
begeisterten Worten an das Thema 'Grundsätzliche Bedeutung der Volksschule
für das Volksdasein' an. Es ist Pflicht, mit denen, die draußen im Kampfe
stehen, auszuharren und weiterzubauen, um den Zurückkehrenden ein neues
Deutschland, groß nach innen und außen, zu errichten. Und hierzu sei in
erster Linie auch die Schule berufen.
Als äußeres Zeichen der Verehrung wird ein Bild Goethes überreicht. – Herr
Lehrer Rothschild sprach in herzlichen Worten allen Dank für die
Wünsche und Geschenke aus. An das biblische Bild des Altvaters Jakob
anknüpfend: 'Ich bin zu gering für all die Gnade und die Treue, die Gott mir
erwiesen hat', gab er einen fesselnden Rückblick über seinen Lebensgang,
öfter untermischt von dem heiteren Frohsinn, der den alten Herrn beseelt.
Mit einem freudigen Ausblick auf einen baldigen gesegneten Frieden schloss
er seine warmen Ausführungen. Mit dem schönen Vortrag des Damenchors 'Die
ganze Welt ist voll des Herren Pracht' hatte die Feier ein Ende."
2Vgl. die Publikation von
Lehrer Samson Rothschild
Artikel oben von 1893.
https://books.google.de/books/about/Aus_Vergangenheit_und_Gegenwart_der_Isra.html?id=UzkbAAAAIAAJ&redir_esc=y
. |
80.
Geburtstag von Hauptlehrer i.R. Samson Rothschild (1928)
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 27. Januar 1928: "Worms. (Ein Lehrer-Veteran). Unter
allgemeiner Beteiligung seiner zahlreichen Verehrer beging der im
Ruhestand lebende Hauptlehrer S. Rothschild seinen 80. Geburtstag. In
seiner fünf Jahrzehnte umfassenden Stellung als Lehrer und
Gemeindebeamter, als gründlicher Kenner der Wormser Gemeindegeschichte,
als rühriges Mitglied vieler Berufs-Organisationen, des Hessischen
Lehrervereins und des Lehrerverbandes, und nicht zuletzt als stets
hilfsbereiter Freund aller Bedrängten und Ratsuchenden hat sich der
Jubilar so viele Sympathien erworben, dass sein 80. Geburtstag in beredter
Form durch die zahlreichen Freundschafts- und Anhänglichkeitsbeweise
davon Zeugnis ablegte."
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 27. Januar 1928: "Worms. (Ein Lehrer-Veteran). Unter
allgemeiner Beteiligung seiner zahlreichen Verehrer beging der im
Ruhestand lebende Hauptlehrer S. Rothschild seinen 80. Geburtstag. In
seiner fünf Jahrzehnte umfassenden Stellung als Lehrer und
Gemeindebeamter, als gründlicher Kenner der Wormser Gemeindegeschichte,
als rühriges Mitglied vieler Berufs-Organisationen, des Hessischen
Lehrervereins und des Lehrerverbandes, und nicht zuletzt als stets
hilfsbereiter Freund aller Bedrängten und Ratsuchenden hat sich der
Jubilar so viele Sympathien erworben, dass sein 80. Geburtstag in beredter
Form durch die zahlreichen Freundschafts- und Anhänglichkeitsbeweise
davon Zeugnis ablegte." |
Kantor
Julius Rosenthal beendet seine Tätigkeit in Worms (1928)
 Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 7. September 1928: "Unser
langjähriges Mitglied, Kantor Julius Rosenthal in Worms, musste aus
Gesundheitsgründen nach 45jähriger Tätigkeit von seinem Amte zurücktreten.
Der Festgottesdienst, bei dem die Synagoge reichen Blumenschmuck trug, war
nicht nur von allen Gemeindemitgliedern besucht, sondern auch viele
Angehörige anderer Konfessionen nahmen daran teil. Die Zeitungen aller
Parteirichtungen bringen ausführliche Berichte über das 'seltene Jubiläum'.
Die vielfache Ehrung wird dem verdienten Manne gezeigt haben, welch große
Achtung er sich in seinem langen Wirken erworben hat." Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 7. September 1928: "Unser
langjähriges Mitglied, Kantor Julius Rosenthal in Worms, musste aus
Gesundheitsgründen nach 45jähriger Tätigkeit von seinem Amte zurücktreten.
Der Festgottesdienst, bei dem die Synagoge reichen Blumenschmuck trug, war
nicht nur von allen Gemeindemitgliedern besucht, sondern auch viele
Angehörige anderer Konfessionen nahmen daran teil. Die Zeitungen aller
Parteirichtungen bringen ausführliche Berichte über das 'seltene Jubiläum'.
Die vielfache Ehrung wird dem verdienten Manne gezeigt haben, welch große
Achtung er sich in seinem langen Wirken erworben hat."
vgl. zu Julius Rosenthal:
http://www.wormserjuden.de/Biographien/Rosenthal-I.html |
|