|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur
Übersicht "Synagogen im Landkreis Alzey-Worms
Bechtheim
(VG Westhofen,
Landkreis Alzey-Worms)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Bechtheim bestand eine jüdische Gemeinde bis um 1880. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück. Erstmals
werden 1540 Juden am Ort genannt (Quelle: "Judensachen" aus dem Fürstlich
Leiningenschen Archiv in Amorbach). 1551 wird der Jude Hirsch in Bechtheim
genannt (ebd.).
1765 wird "des Juden Samuel Witwe zu Bechtheim" genannt.
Bei der Volkszählung
1804 wurden 60 jüdische Einwohner am Ort erfasst. Die Zahl stieg bis um
1840/50 auf über 100 (bis zu 30 Familien) an, doch begann bereits damals eine starke Ab-
und Auswanderung der jüdischen Familien. 1855 wird davon berichtet, dass in den
vergangenen Jahren zwei Familien nach Worms verzogen und sieben nach Amerika
ausgewandert seien (vgl. die Familie von Joseph Simon s.u.). 1857 ist die Rede
von 20 Mitgliedern der Gemeinde (gemeint: 20 Familien bzw. Haushaltungen). 1861 wurden noch 96 jüdische Einwohner gezählt, die
freilich in den folgenden Jahren gleichfalls weggezogen sind. Mehrere Familien
verzogen in der benachbarte Osthofen. 1885
wurden keine
Juden mehr gezählt. Zuletzt (nach Angaben der Ausgaben des "Statistischen
Jahrbuches des Deutsch-israelitischen Gemeindebundes" waren es noch 12 jüdische
Einwohner unter dem Gemeindevorsteher M. Joseph. Die letzten drei Familien
verzogen "aus geschäftlichen Gründen" nach
Osthofen, Offenbach und
Mannheim.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine
Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule (im 19. Jahrhundert zeitweise
israelitische Elementarschule) und ein rituelles Bad (weitere Angaben dazu
siehe unten bei der Synagogengeschichte). Zur Besorgung
religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der auch als
Vorbeter und Schochet tätig war. Um 1850/1885 war als Elementarlehrer
Samson Sonnenberger (auch Sonnenberg und Sonneberger) in der Gemeinde
tätig (gest. 1885).
Von den in Bechtheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Paul Joseph (1886), Regina
Schmidt geb. Wendel (1879), Jacob Wendel (1876).
Berichte aus
der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Über Lehrer Samson Sonnenberger und
die israelitische Volksschule in Bechtheim (1857)
Anmerkung: Lehrer Samson Sonnenberger ist am 14. April 1809 geboren und am 29.
April 1885 gestorben. Er wurde im jüdischen
Friedhof "Heiliger Sand" in Worms (Grab Nr. 2144) beigesetzt. SW-Fotos
seines Grabsteines siehe
https://www.bildindex.de/document/obj20805774
 Artikel
in "Der israelitische Volkslehrer" vom November 1857 S. 337: "In
Bechtheim ist eine gut dotierte Volksschule, an welcher Herr Sonnenberg
seit Jahren segensreich wirkt. Die wenig über 20 Mitglieder zählende
Gemeinde hat ein neues sehr freundliches Schulhaus, und erst im laufenden
Jahre eine sehr hübsche Synagoge gebaut. " Artikel
in "Der israelitische Volkslehrer" vom November 1857 S. 337: "In
Bechtheim ist eine gut dotierte Volksschule, an welcher Herr Sonnenberg
seit Jahren segensreich wirkt. Die wenig über 20 Mitglieder zählende
Gemeinde hat ein neues sehr freundliches Schulhaus, und erst im laufenden
Jahre eine sehr hübsche Synagoge gebaut. " |
Lobende Erwähnung der israelitischen
Elementarschule in Bechtheim (1858)
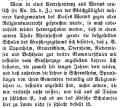 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli 1858: "Wenn in einer
Korrespondenz aus Worms neulich (in No. 22 dieser Zeitung) von der
Gleichgültigkeit mehrerer Landgemeinden des Kreises Worms gegen allen
Religionsunterricht gesprochen wurde, so muss andererseits wieder
hervorgehoben werden, dass in einem anderen Teile Rheinhessens gerade die
bestgestellten Schulen des Großherzogtums sich befinden, dass zum Beispiel
in Oppenheim,
Guntersblum,
Odernheim,
Niederwiesen und Bechtheim
gut dotierte Elementarschulen mit definitiv vom Großherzoge angestellten
Lehrern sich befinden, die zumeist seit langen Jahren dort wirken, und dass
außerdem die Lehrer in Schornsheim,
Sprendlingen von ihren Gemeinden
freiwillig als Religionslehrer etc. definitiv angestellt sind, außer
anderen, die wir vielleicht nicht wissen; und dass aus all diesem zu
schließen ist, dass es um das jüdische Schulwesen hierzulande nicht so
schlecht bestellt ist." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juli 1858: "Wenn in einer
Korrespondenz aus Worms neulich (in No. 22 dieser Zeitung) von der
Gleichgültigkeit mehrerer Landgemeinden des Kreises Worms gegen allen
Religionsunterricht gesprochen wurde, so muss andererseits wieder
hervorgehoben werden, dass in einem anderen Teile Rheinhessens gerade die
bestgestellten Schulen des Großherzogtums sich befinden, dass zum Beispiel
in Oppenheim,
Guntersblum,
Odernheim,
Niederwiesen und Bechtheim
gut dotierte Elementarschulen mit definitiv vom Großherzoge angestellten
Lehrern sich befinden, die zumeist seit langen Jahren dort wirken, und dass
außerdem die Lehrer in Schornsheim,
Sprendlingen von ihren Gemeinden
freiwillig als Religionslehrer etc. definitiv angestellt sind, außer
anderen, die wir vielleicht nicht wissen; und dass aus all diesem zu
schließen ist, dass es um das jüdische Schulwesen hierzulande nicht so
schlecht bestellt ist." |
Über Lehrer Sonnenberg in Bechtheim
um 1860 (in einem Artikel von 1931)
 Artikel
in "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden in Hessen" vom März 1931 S. 5: "Wie sah es mit dem
jüdischen Religionsunterricht in Hessen vor 70 Jahren aus? Herr
Sonnenberg steht der Elementarschule in Bechtheim, Kreis Worms, als
tüchtiger Lehrer fuhr. Er bezieht jährlich an 300 fl., hat eine schöne
Wohnung in dem bei der neu gebauten freundlichen Synagoge gelegenen Hofraum,
nebst großem Garten. " Artikel
in "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen
Religionsgemeinden in Hessen" vom März 1931 S. 5: "Wie sah es mit dem
jüdischen Religionsunterricht in Hessen vor 70 Jahren aus? Herr
Sonnenberg steht der Elementarschule in Bechtheim, Kreis Worms, als
tüchtiger Lehrer fuhr. Er bezieht jährlich an 300 fl., hat eine schöne
Wohnung in dem bei der neu gebauten freundlichen Synagoge gelegenen Hofraum,
nebst großem Garten. " |
Die fünfte Versammlung
israelitischer Lehrer in Rheinhessen findet in Bechtheim statt (1860)
 Artikel in "Der israelitische Volkslehrer" vom Juni 1860 S. 227:
"Die fünfte
Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen, abgehalten zu Bechtheim im
Kreise Worms am 17. Mai 1860. Artikel in "Der israelitische Volkslehrer" vom Juni 1860 S. 227:
"Die fünfte
Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen, abgehalten zu Bechtheim im
Kreise Worms am 17. Mai 1860.
Es waren zugegen die Herren Dr. Aub,
Rabbiner in Mainz, Bär aus Griesheim,
Albert Mayer aus Mainz, Stern aus
Oppenheim und Rosenthal aus
Hillesheim (statt Hildesheim) und von den früheren Mitgliedern
Marx, Gottschall, Hirsch, Sonneberg, Wormser, Herzog, Hauser, Nathan und
Klingenstein. " |
Beiträge von Lehrer Sonnenberger bei
der 10. Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen (in Worms 1864)
 Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Juni 1864: "Bericht über die zehnte
Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen, abgehalten zu Worms, am
26. Mai 1864. (Fortsetzung.) Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Juni 1864: "Bericht über die zehnte
Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen, abgehalten zu Worms, am
26. Mai 1864. (Fortsetzung.)
Sonneberg aus Bechtheim. Meine Herren, Sie
stimmen gewiss mit mir über ein, wenn wir dem verehrten Referenten für das
eben vorgelesene wertvolle Referat unseren Dank aussprechen. Allein,
erlauben Sie mir auf etwas Wichtiges hierauf Bezügliches aufmerksam zu
machen. In der Schule wird gar oft der Keim zur Unwahrhaftigkeit
gelegt. Die Lehrer verbieten dem Kinde: 'ihr dürft nicht aus der Schule
schwatzen'; dass man dies 'aus der Schule schwarzen' für ein Kapitalverbrechen
hielt, wird dadurch bewiesen, dass es sprichwörtlich geworden. Ich halte es
für einen Fehler, wenn wir dem Kinde dies verbieten. Warum soll in unserer
heutigen, der Öffentlichkeit und Mündigkeit zugeneigten Zeit die Schule ihr
Leben und Tun vor den Augen der Welt verbergen? Denkt das Kind nicht, dass
es das, was recht und wahr ist auch erzählen darf? Wird nicht gerade durch
das Verbieten des 'aus der Schule Schwatzens' dasselbe wohl befördert werden?
Und wenn es zu Hause gefragt wird, wenn es dann doch schwätzt und der Lehrer
fragt dem Schwätzer nach, um ihn zu bestrafen; wird es da nicht gerade zum
Lügen gebracht?" |
| |
 Artikel in "Der israelitische Lehrer" vom 14. Juli 1864: "Bericht über die
zehnte Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen, Artikel in "Der israelitische Lehrer" vom 14. Juli 1864: "Bericht über die
zehnte Versammlung israelitischer Lehrer in Rheinhessen,
abgehalten zu
Worms, am 26. Mai 1864. (Schluss.)
Nachmittagssitzung Eröffnung um
3 1/2 Uhr.
Sonneberg aus Bechtheim. Die Mitglieder unserer Konferenz
werden mit mir einverstanden sein, wenn ich hier unseren Dank und unsere
Anerkennung ausspreche für das sehr wertvolle Referat unseres Präsidenten
Marx. Allein bevor wir auf das Einzelne übergehen, werden wir mit der am
Schlusse desselben angeregten Frage uns zu beschäftigen haben, mit dem
Pentateuchübersetzen.
Die Versammlung stimmt ein, und man schreitet zur
Debatte über das Pentateuchübersetzen.
Sonneberg: Der Toravortrag ist
ebenso gut ein Bestandteil des öffentlichen Gottesdienstes als das Gebet.
Ja, es ist allgemein anerkannt, dass er ein sehr wichtiger Bestandteil deselben ist. Es walten also beim Pentateuch dieselben Gründe vor, wie
beim Gebet übersetzen, und ich halte darum das Übersetzen desselben für
notwendig." |
Mitteilung einer Spendensammlung
bei der Hochzeit von E. Brettheimer (Bensheim) mit Frl. Sonnenberger (Bechtheim)
(1877)
Anmerkung: es wird sich um die Tochter von Lehrer
Sonnenberger gehandelt haben.
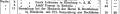 Artikel in "Rechenschaftsbericht der Achawa" 1877 S. 11: "September 11:
Sammlung bei der Hochzeit des Herrn E. Brettheimer in
Bensheim mit Fräulein
Sonneberg aus Bechtheim. " Artikel in "Rechenschaftsbericht der Achawa" 1877 S. 11: "September 11:
Sammlung bei der Hochzeit des Herrn E. Brettheimer in
Bensheim mit Fräulein
Sonneberg aus Bechtheim. " |
Mitteilung des Todes des Lehrers
Samson Sonnenberger (1885)
 Artikel
in "Rechenschaftsbericht der Achawa" 1885 S. 4: "Die Zahl unserer aktiven
Mitglieder belief sich am Anfang des Jahres 1885 auf 243; durch den
Tod verloren wir drei Mitglieder (die Lehrer Hosch in Neisse, Schwab in
Kallstadt und Sonnenberger in
Bechtheim); durch den Beitritt von 15 neuen Mitgliedern (siehe Seite 13)
wuchs die Zahl auf 255." Artikel
in "Rechenschaftsbericht der Achawa" 1885 S. 4: "Die Zahl unserer aktiven
Mitglieder belief sich am Anfang des Jahres 1885 auf 243; durch den
Tod verloren wir drei Mitglieder (die Lehrer Hosch in Neisse, Schwab in
Kallstadt und Sonnenberger in
Bechtheim); durch den Beitritt von 15 neuen Mitgliedern (siehe Seite 13)
wuchs die Zahl auf 255." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Die drei letzten jüdischen Familien
sind aus "geschäftlichen Gründen" aus Bechtheim verzogen (1897)
 Artikel in der Zeitschrift "Im deutschen Reich" vom September 1897 S. 461:
"Der von der Wormser Zeitung gemeldete Wegzug sämtlicher Israeliten von
Bechtheim und die Verteilung der Kultusgegenstände an bedürftige
israelitische Gemeinden ist keineswegs eine Folge unfreundlichen Verhaltens
der Bechtheimer Einwohnerschaft. Von den drei jüdischen Familien, die bisher
in Bechtheim wohnten, ist diejenige des Vorstehers nach
Osthofen, eine andere nach
Offenbach und die dritte nach
Mannheim gezogen. In allen drei Fällen
waren geschäftliche Gründe maßgebend." Artikel in der Zeitschrift "Im deutschen Reich" vom September 1897 S. 461:
"Der von der Wormser Zeitung gemeldete Wegzug sämtlicher Israeliten von
Bechtheim und die Verteilung der Kultusgegenstände an bedürftige
israelitische Gemeinden ist keineswegs eine Folge unfreundlichen Verhaltens
der Bechtheimer Einwohnerschaft. Von den drei jüdischen Familien, die bisher
in Bechtheim wohnten, ist diejenige des Vorstehers nach
Osthofen, eine andere nach
Offenbach und die dritte nach
Mannheim gezogen. In allen drei Fällen
waren geschäftliche Gründe maßgebend." |
Die Auflösung der jüdischen
Gemeinde (1897)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der
Israelit" am 9. August 1897: "Aus Rheinhessen. Die noch vor wenigen
Jahren ziemlich starke israelitische Gemeinde in Bechtheim ist infolge Wegzuges
sämtlicher Israeliten aufgelöst. Das Gemeindevermögen fiel der israelitischen
Kultusgemeinde Osthofen
zu, wohin die meisten der ehemaligen Gemeindemitglieder verzogen sind. Die
Kultusgegenstände werden an bedürftige israelitische Gemeinden verteilt." Artikel
in der Zeitschrift "Der
Israelit" am 9. August 1897: "Aus Rheinhessen. Die noch vor wenigen
Jahren ziemlich starke israelitische Gemeinde in Bechtheim ist infolge Wegzuges
sämtlicher Israeliten aufgelöst. Das Gemeindevermögen fiel der israelitischen
Kultusgemeinde Osthofen
zu, wohin die meisten der ehemaligen Gemeindemitglieder verzogen sind. Die
Kultusgegenstände werden an bedürftige israelitische Gemeinden verteilt."
|
Zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod des aus Bechtheim
stammenden Marx B. Loeb in Philadelphia (1907)
Anmerkung: genealogische Informationen zu Marx B. Loeb (geb. 1836 in
Bechtheim) siehe
https://www.geni.com/people/Marx-Loeb/6000000007123311501
Weitere Links zu Marx B. Loeb: https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll15/id/2739/
Grabmal im Mount Sinai Cemetery in Philadelphia:
https://de.findagrave.com/memorial/141609155/marx-b-loeb
Rodeph-Schalom-Congregation in Philadelphia:
https://rodephshalom.org/ Jewish Hospital Philadelphia
https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_Medical_Center_Philadelphia und
https://www.einstein.edu/
 Artikel
in der "Neuen jüdischen Presse" ("Frankfurter Israelitisches Familienblatt")
vom 23. August 1907: "Philadelphia. Marx B. Loeb, einer
der angesehensten Geschäftsleute und bekannt als Wohltäter, ist im 71.
Jahre gestorben. Loeb, der in Deutschland (in den Orte Bechtheim)
geboren wurde, kam in jungen Jahren nach Amerika. Er war während 27 Jahren
Präsident des Jüdischen Hospital; auch war er Präsident der
Vereinigten jüdischen Wohltätigkeitsgesellschaften und eine zeitlang
Präsident der Rodef-Shalom-Gemeinde. " Artikel
in der "Neuen jüdischen Presse" ("Frankfurter Israelitisches Familienblatt")
vom 23. August 1907: "Philadelphia. Marx B. Loeb, einer
der angesehensten Geschäftsleute und bekannt als Wohltäter, ist im 71.
Jahre gestorben. Loeb, der in Deutschland (in den Orte Bechtheim)
geboren wurde, kam in jungen Jahren nach Amerika. Er war während 27 Jahren
Präsident des Jüdischen Hospital; auch war er Präsident der
Vereinigten jüdischen Wohltätigkeitsgesellschaften und eine zeitlang
Präsident der Rodef-Shalom-Gemeinde. " |
Über den aus Bechtheim stammenden
US-Senator Joseph Simon (1851-1935)
 Joseph Simon ist am 7. Februar 1851 in Bechtheim geboren als Sohn
von David Simon und seiner Frau. 1852 ist die Familie in die USA
ausgewandert und ließ sich in Portland, Oregon nieder. Joseph Simon war
von 1889 bis 1892 und von 1895 bis 1898 President of the Oregon
State Senate und von 1898 bis 1903 United States Senator
from Oregon. Er starb 1935 in Portland und wurde im Beth Israel
Cemetery ebd. beigesetzt. Er blieb unverheiratet. Joseph Simon ist am 7. Februar 1851 in Bechtheim geboren als Sohn
von David Simon und seiner Frau. 1852 ist die Familie in die USA
ausgewandert und ließ sich in Portland, Oregon nieder. Joseph Simon war
von 1889 bis 1892 und von 1895 bis 1898 President of the Oregon
State Senate und von 1898 bis 1903 United States Senator
from Oregon. Er starb 1935 in Portland und wurde im Beth Israel
Cemetery ebd. beigesetzt. Er blieb unverheiratet.
Weitere Informationen siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Simon. |
Sonstiges
Antijüdische Bestimmungen in der
NS-Zeit in Bechtheim (1935)
 Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 27. August 1935: "In Bechtheim
wurde beschlossen, dass kein Jude ein Haus oder Grundstück erwerben darf.
Alle Geschäftsleute, Handwerker und Fuhrleute, welche mit Juden Geschäfte
machen oder verkehren, erhalten keine Lieferungen mehr. Ferner wird den
Unterstützungsempfängern, die den Juden im Handel unterstützen oder bei ihm
kaufen, die Unterstützung gesperrt. Allen Volksgenossen, welche
gemeindeeigene Felder gepachtet haben und mit Juden Geschäfte tätigen,
werden die gepachteten Gemeindeäcker wieder entzogen." Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 27. August 1935: "In Bechtheim
wurde beschlossen, dass kein Jude ein Haus oder Grundstück erwerben darf.
Alle Geschäftsleute, Handwerker und Fuhrleute, welche mit Juden Geschäfte
machen oder verkehren, erhalten keine Lieferungen mehr. Ferner wird den
Unterstützungsempfängern, die den Juden im Handel unterstützen oder bei ihm
kaufen, die Unterstützung gesperrt. Allen Volksgenossen, welche
gemeindeeigene Felder gepachtet haben und mit Juden Geschäfte tätigen,
werden die gepachteten Gemeindeäcker wieder entzogen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Die jüdische Gemeinde hatte bereits in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts ihre Einrichtungen in der heutigen Unteren Klinggasse. Hier stand
auf dem Grundstück Untere Klinggasse 8 das Wohnhaus des jüdischen Lehrers, in
dem sich auch der Unterrichtsraum der jüdischen Schule befand. Auf dem
Nachbargrundstück (Untere Klinggasse 10) standen die alte Synagoge und
das rituelle Bad. Um 1850 befand sich die alte Synagoge jedoch in sehr
schlechtem baulichen Zustand. "Aus Sanitätsgründen" drängten die
Behörden die jüdische Gemeinde zu einem Synagogenneubau. 1855/56 konnte unweit
der älteren Einrichtungen eine
neue Synagoge erbaut werden. Die Grundsteinlegung war am 4. März 1855.
Im Gemeindearchiv findet sich ein Dokument mit einem
Bericht zu Grundsteinlegung (das Dokument wurde bei der Einrichtung der
Kleinkinderschule 1903 aufgefunden, siehe Bericht unten): "Bechtheim, den 4. März im Jahre 5615 -
ist das Jahr 1855 - nach Erschaffung der Welt. Heute versammelt sich die
israelitische Gemeinde dahier zu Bechtheim im Großherzogtum Hessen - Provinz
Rheinhessen Kreis Worms und legte den Grundstein zu einer neuen Synagoge, -
welche aus Mitteln der Gemeinde und verschiedene milde Beiträge von manchen
Wohltätern erbaut wird, - und zwar unter den Verwaltung des derzeitigen
Vorstandes [...] Das Grundeigentum der Gemeinde besteht gegenwärtig aus: a.
einem Wohnhaus für den Lehrer, - worin zugleich das Lokal, in welchem der
Unterricht der Schuljugend erteilt wird sich befindet [Untere Klinggasse 8],
nebst angrenzendem Garten auf dessen oberen Teil die Synagoge erbaut wird
[Martin-Luther-Straße 4]. b einem alten Wohnhäuschen an dem Raum, wo bisher
die alte Synagoge gestanden, und nahe dabei ein Frauenbad [Untere Klinggasse
10.]
Die
Bauaufsicht hatte der Techniker Binz aus Worms übernommen. Finanziert werden
konnte der Bau nur mit Hilfe von großzügigen Spenden, darunter eine in Höhe
von 1.000 Gulden von dem in
Alzey lebenden Herrn A. Florian Belmont sowie mehrere von inzwischen in Amerika
lebenden Familien. Anfang 1857 war das Gebäude fertig. Die Einweihung wurde am 23.
Januar 1857 gefeiert; ein dreitägiges großes Fest für den ganzen Ort schloss
sich an. Am Sabbat, 24. Januar 1857 (28. Tevet 5617) fand ein vierstündiger
Gottesdienst statt. Prediger Dr. Levysohn aus Worms hielt die
Einweihungspredigten; als Vorbeter wirkte der oben genannte Lehrer Samson Sonnenberg. Ein Bericht in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Februar 1857 enthält
weitere Einzelheiten:
Die Einweihung der neuen Synagoge
in Bechtheim (1857)
 "Bechtheim in Rheinhessen, 26. Januar (1857).
Bechtheim
im Rabbinatssprengel Worms, zählte vor wenigen Jahren noch über 30
israelitische Familien, reduzierte sich jedoch in Folge der Auswanderung nach
Amerika auf 20 Familien. Dieselben, unterstützt von einigen auswärtigen
Gönnern, von welchen insbesondere Herr A. F. Belmont aus Alzey, der 1000 Gulden
vorgeschossen und nach 20 Jahren erst als rückzahlbar erklärte, erwähnt
werden muss, haben nun größtenteils aus eigenen Mitteln eine Synagoge erbaut,
deren Geschmack, Eleganz und reichliche Ausstattung sicherlich in keiner
Landgemeinde ganz Süddeutschlands zum zweiten Mal anzutreffen sein dürfte.
Dieses Gotteshaus ist jetzt die einzige und wahre Zierde des Orts geworden.
Freitag, den 23. dieses Monats, fand die Einweihung durch den Prediger Herrn Dr.
Levysohn in Worms statt. Herr Dr. Lewysohn predigte auch Samstag, an welchem der
Gottesdienst von 10 bis 2 Uhr dauerte, sowie am Sonntag, an dem noch einmal die
Gemeinde und die Schuljugend zum Abschiede von dem Herrn Prediger in das
Gotteshaus sich versammelten. Mehr als 300 Glaubensgenossen von inner- und
außerhalb des Kreises fanden sich zur Feier ein, und alle begingen ein
dreitägiges Fest, das jedem Teilnehmer unvergesslich bleiben wird. - Die
Einweihungspredigt nebst einem geschichtlichen Anhang über den Bau der Synagoge
sind dem Drucke übergeben worden. Ref. (Referent) kann nicht schließen, ohne
des dortigen Gemeindelehrers, Herrn S. Sonnenberg, rühmlich zu gedenken,
welcher den Gesangs- und musikalischen Teil der Feier auf das Befriedigendste zu
besorgen wusste. Möglich die fernen Freunde in Amerika, die ebenfalls ihr
Scherflein zum Bau dieses wahrhaft prächtigen Gotteshauses beigetragen, beim
Lesen dieser Zeilen die gerechte und wohlverdiente Freude sich gönnen. Sie
werden später vom hiesigen Vorstand Predigt und Programm zum Andenken zugesandt
erhalten." "Bechtheim in Rheinhessen, 26. Januar (1857).
Bechtheim
im Rabbinatssprengel Worms, zählte vor wenigen Jahren noch über 30
israelitische Familien, reduzierte sich jedoch in Folge der Auswanderung nach
Amerika auf 20 Familien. Dieselben, unterstützt von einigen auswärtigen
Gönnern, von welchen insbesondere Herr A. F. Belmont aus Alzey, der 1000 Gulden
vorgeschossen und nach 20 Jahren erst als rückzahlbar erklärte, erwähnt
werden muss, haben nun größtenteils aus eigenen Mitteln eine Synagoge erbaut,
deren Geschmack, Eleganz und reichliche Ausstattung sicherlich in keiner
Landgemeinde ganz Süddeutschlands zum zweiten Mal anzutreffen sein dürfte.
Dieses Gotteshaus ist jetzt die einzige und wahre Zierde des Orts geworden.
Freitag, den 23. dieses Monats, fand die Einweihung durch den Prediger Herrn Dr.
Levysohn in Worms statt. Herr Dr. Lewysohn predigte auch Samstag, an welchem der
Gottesdienst von 10 bis 2 Uhr dauerte, sowie am Sonntag, an dem noch einmal die
Gemeinde und die Schuljugend zum Abschiede von dem Herrn Prediger in das
Gotteshaus sich versammelten. Mehr als 300 Glaubensgenossen von inner- und
außerhalb des Kreises fanden sich zur Feier ein, und alle begingen ein
dreitägiges Fest, das jedem Teilnehmer unvergesslich bleiben wird. - Die
Einweihungspredigt nebst einem geschichtlichen Anhang über den Bau der Synagoge
sind dem Drucke übergeben worden. Ref. (Referent) kann nicht schließen, ohne
des dortigen Gemeindelehrers, Herrn S. Sonnenberg, rühmlich zu gedenken,
welcher den Gesangs- und musikalischen Teil der Feier auf das Befriedigendste zu
besorgen wusste. Möglich die fernen Freunde in Amerika, die ebenfalls ihr
Scherflein zum Bau dieses wahrhaft prächtigen Gotteshauses beigetragen, beim
Lesen dieser Zeilen die gerechte und wohlverdiente Freude sich gönnen. Sie
werden später vom hiesigen Vorstand Predigt und Programm zum Andenken zugesandt
erhalten."
|
Von der Architektur des Gebäudes her handelt es sich um einen kleinen
klassizistischen Saalbau, der sein besonderes Gepräge durch die
Ecklisenen sowie die Rund- und Rundbogenfenster erhielt.
Über Bechtheim und seine Synagoge
(1857)
 Artikel
in der "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums" vom
Juni 1857 S. 92: "Im Jahre 1846 waren in Hessen 173 Synagogen;
doch haben die letzten zehn Jahre so viele neu gebaute Synagogen
hinzugefügt, dass jetzt deren weit über 200 vorhanden sind. Hierbei ist es
erfreulich zu sehen, wie oft eine Landgemeinde von 15 oder 20 Familien mit
einem Kostenaufwand ein solches dem Gottesdienste geweihtes Gebäude
aufführt, der das rühmlichste Zeugnis ihrer Opferwilligkeit bekundet. So
besitzt die aus 20 Familien bestehende Gemeinde zu Bechtheim eine
durch Symmetrie und Eleganz sich auszeichnende Synagoge, wie sie nur selten
in einer Landgemeinde anzutreffen sein dürfte." Artikel
in der "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums" vom
Juni 1857 S. 92: "Im Jahre 1846 waren in Hessen 173 Synagogen;
doch haben die letzten zehn Jahre so viele neu gebaute Synagogen
hinzugefügt, dass jetzt deren weit über 200 vorhanden sind. Hierbei ist es
erfreulich zu sehen, wie oft eine Landgemeinde von 15 oder 20 Familien mit
einem Kostenaufwand ein solches dem Gottesdienste geweihtes Gebäude
aufführt, der das rühmlichste Zeugnis ihrer Opferwilligkeit bekundet. So
besitzt die aus 20 Familien bestehende Gemeinde zu Bechtheim eine
durch Symmetrie und Eleganz sich auszeichnende Synagoge, wie sie nur selten
in einer Landgemeinde anzutreffen sein dürfte." |
Lehrer Lewysohn aus Worms predigte
in der Synagoge in Bechtheim (1857)
Anmerkung: Rabbiner Dr. Ludwig Lewysohn war als Rabbiner ausgebildet, aber in
Worms als "Prediger" neben Rabbiner Jakob (Koppel) Bamberger angestellt. Zu Dr.
Ludwig Lewysohn (geb. 1819 in Schwersenz, gest. 1901 in Stockholm) siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn.
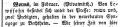 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. März 1857: "Worms,
im Februar. (Privat Mitteilungen). Von Lewysohn befindet sich unter der
Presse: Lächäm Mischna, zwei Predigten, gehalten in der neuerbauten
Synagoge zu Bechtheim. " Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. März 1857: "Worms,
im Februar. (Privat Mitteilungen). Von Lewysohn befindet sich unter der
Presse: Lächäm Mischna, zwei Predigten, gehalten in der neuerbauten
Synagoge zu Bechtheim. " |
Bericht aus dem gottesdienstlichen
Leben - gemeinsame "Konfirmation" (1857)
 Über
das gottesdienstliche Leben in der Synagoge in Bechtheim liegen nur
wenige Berichte vor. Die Gemeinde nahm offenbar noch einige Reformen im
gottesdienstlichen Leben vor. So wurde die gemeinsame Konfirmation (für
die sonst übliche einzelne Bar Mizwa / Bat Mizwa - Feier) eingeführt. Die
"Allgemeine Zeitung des Judentums" berichtet in einem Artikel vom 1.
Juni 1857 von 10 Kindern, die am Schawuotfest 1857 (30. Mai 1857) gemeinsam
konfirmiert wurden: "Während hier in Worms am bevorstehenden
Schebuothfeste 22, ja in der hierher gehörenden Landgemeinde Bechtheim 10
Kinder konfirmiert werden, besteht in Frankfurt a.M., welches 4.000 jüdische
Seelen zählt, die Anzahl der Konfirmanden nur in 8; die Gründe dieser
befremdenden Erscheinung gedenken wir, wann es uns geeignet erscheinen wird, an
dieser Stelle etwas ausführlicher zu besprechen." Über
das gottesdienstliche Leben in der Synagoge in Bechtheim liegen nur
wenige Berichte vor. Die Gemeinde nahm offenbar noch einige Reformen im
gottesdienstlichen Leben vor. So wurde die gemeinsame Konfirmation (für
die sonst übliche einzelne Bar Mizwa / Bat Mizwa - Feier) eingeführt. Die
"Allgemeine Zeitung des Judentums" berichtet in einem Artikel vom 1.
Juni 1857 von 10 Kindern, die am Schawuotfest 1857 (30. Mai 1857) gemeinsam
konfirmiert wurden: "Während hier in Worms am bevorstehenden
Schebuothfeste 22, ja in der hierher gehörenden Landgemeinde Bechtheim 10
Kinder konfirmiert werden, besteht in Frankfurt a.M., welches 4.000 jüdische
Seelen zählt, die Anzahl der Konfirmanden nur in 8; die Gründe dieser
befremdenden Erscheinung gedenken wir, wann es uns geeignet erscheinen wird, an
dieser Stelle etwas ausführlicher zu besprechen."
|
Der Hauptsponsor der Synagoge
verzichtet auf die Rückzahlung der restlichen Schulen (1870)
 Die
von Bechtheim nach anderen Orten wegziehenden Familien machten es den
zurückbleibenden Familien nicht leicht, was die Rückzahlung der noch
vorhandenen Schulden für die Synagoge. Nachdem jedoch Hauptsponsor für den
Synagogenbau - Florian Belmont aus Alzey - im Frühjahr 1870 verstarb,
verzichtete sein Erbe Dr. Ludwig Bamberger auf eine Rückzahlung der noch
ausstehenden Schulden. Die
von Bechtheim nach anderen Orten wegziehenden Familien machten es den
zurückbleibenden Familien nicht leicht, was die Rückzahlung der noch
vorhandenen Schulden für die Synagoge. Nachdem jedoch Hauptsponsor für den
Synagogenbau - Florian Belmont aus Alzey - im Frühjahr 1870 verstarb,
verzichtete sein Erbe Dr. Ludwig Bamberger auf eine Rückzahlung der noch
ausstehenden Schulden.
Darüber berichtete die Zeitschrift "Der
Israelit" vom 29. Juni 1870: "Bechtheim (bei Worms), 22. Juni 1870.
Vor 15 Jahren wurde die hiesige israelitische Gemeinde aus Sanitätsgründen
angehalten, eine neue Synagoge zu bauen. Die finanziellen Verhältnisse waren
jedoch der Art, dass dies ohne eine Anleihe nicht auszuführen war. Herr Florian
Belmont in Alzey übermachte der Gemeinde ein Darlehen von 1.000 Gulden zu dem
niederen Zinsfuß von 2 1/2 % nach 20 Jahren zehntelweise rückzahlbar. Nach dem
im vorigen Monat erfolgten Tode des Herrn Belmont hat dessen Schwiegersohn und
Erbe Dr. Ludwig Bamberger in Mainz der Gemeinde das Darlehen nebst den
rückständigen Zinsen geschenkt." |
Nur wenige
Jahrzehnte (bis 1874) diente die Synagoge ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung.
Nach dem Wegzug der jüdischen Familien wurde das Gebäude 1894/1900
an die politische Gemeinde verkauft. Im Kaufvertrag wurde bestimmt, dass die
Synagoge nicht als "Scheune, Stall oder Abtritt" verwendet werden
durfte. Von der politischen Gemeinde wurde sie zu einer
"Kleinkinderschule" beziehungsweise zu einem Kindergarten umgebaut und
in dieser Weise bis 1962 genutzt.
Die Synagoge wird in eine
Kleinkinderschule umgebaut (1903)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1903: "Bechtheim,
13. Juli (1903). In unserer Gemeinde wurde jüngst die Synagoge in eine
Kleinkinderschule umgebaut. Bei der Niederlegung eines Gebäudeteils wurde
ein Schriftstück in einer Kapsel aufgefunden, welches einen interessanten
Rückblick auf den Bestand und die Verhältnisse der früheren israelitischen
Gemeinde Bechtheims gestattet. Die israelitische Gemeinde Bechtheims hat
sich schon vor Jahren ganz aufgelöst, da alle Mitglieder der Gemeinde
zumeist nach Amerika ausgewandert sind. Aus der aufgefundenen Urkunde geht
hervor, dass am 14. März 5615 nach Erschaffung der Welt (1855 nach der
gewöhnlichen Zählung), die israelitische Gemeinde sich versammelt hatte, um
den Grundstein zu einer neuen Synagoge, welche aus Mitteln der Gemeinde und
verschiedenen milden Gaben errichtet werden sollte, zu legen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1903: "Bechtheim,
13. Juli (1903). In unserer Gemeinde wurde jüngst die Synagoge in eine
Kleinkinderschule umgebaut. Bei der Niederlegung eines Gebäudeteils wurde
ein Schriftstück in einer Kapsel aufgefunden, welches einen interessanten
Rückblick auf den Bestand und die Verhältnisse der früheren israelitischen
Gemeinde Bechtheims gestattet. Die israelitische Gemeinde Bechtheims hat
sich schon vor Jahren ganz aufgelöst, da alle Mitglieder der Gemeinde
zumeist nach Amerika ausgewandert sind. Aus der aufgefundenen Urkunde geht
hervor, dass am 14. März 5615 nach Erschaffung der Welt (1855 nach der
gewöhnlichen Zählung), die israelitische Gemeinde sich versammelt hatte, um
den Grundstein zu einer neuen Synagoge, welche aus Mitteln der Gemeinde und
verschiedenen milden Gaben errichtet werden sollte, zu legen." |
In den 1960er-Jahren ging das Gebäude in den Besitz der
evangelischen Kirchengemeinde über, die es zunächst abbrechen wollte, um hier
ein Gemeindehaus zu erbauen. Auf Grund des Einspruches der staatlichen
Denkmalpflege kam es nicht zum Abbruch. So blieb das Synagogengebäude erhalten
und wird bis zur Gegenwart als evangelisches Gemeindehaus verwendet.
Adresse/Standort der Synagoge: Martin-Luther-Straße 4.
Fotos
(Fotos Hahn, Aufnahmedatum 30.3.2005 beziehungsweise
Michael Ohmsen, Aufnahmen von Anfang Juli 2011)
Die ehemalige
Synagoge
im Frühjahr 2005 |
 |
 |
| |
Die ehemalige
Synagoge in Bechtheim |
| |
 |
 |
 |
Hinweistafel und
Bauinschrift der Bechtheimer Synagoge aus 1. Mose 28.7: "Hier ist
nichts anderes als Gottes Haus
und hier ist die Pforte des Himmels"
und in der unteren Zeile der Jahreszahl (5)616 = 1855/56 |
|
| |
|
Die ehemalige
Synagoge
im Sommer 2011 |
 |
 |
| |
Die ehemalige
Synagoge in Bechtheim |
| |
|
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge
Anfang 2020
(Fotos: Bernhard Kukatzki) |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
| Denkmal am Marktplatz |
|
|
 |
 |
 |
Obelisk mit
einzelnen Denkmalen |
Denkmal
für die jüdische Geschichte in der Inschrift:
"Die ehemalige
Synagoge. Das Erbauungsjahr der Synagoge ist nach jüdischer Zeitrechnung
mit 5615 angegeben.
30 israelische Familien wohnten einst in Bechtheim und
erbauten die Synagoge aus eigenen Mitteln.
Nach einem Ratsprotokoll von
1885 waren alle israelische Familien verzogen oder nach Amerika
ausgewandert.
Die Gemeinde Bechtheim erwarb die Synagoge im Jahr 1900, um
sie bis 1963 als Kindergarten zu nutzen.
Seit 1963 dient sie als
evangelisches Gemeindehaus." |
| |
| |
| |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | "...und dies ist die Pforte des Himmels" Synagogen -
Rheinland-Pfalz. Saarland. Hg. vom Landesamt für Denkmalpflege
Rheinland-Pfalz mit dem Staatlichen Konservatoramt des Saarlandes und dem
Synagogue Memorial Jerusalem. 2005. S. 99-100 (mit weiterer Lit.) |
 | Carola Kaufmann-Levy: "Judensachen" aus dem
Fürstlich Leiningenschen Archiv in Amorbach. In: Der Wormsgau 9 1970-1971 S.
48-53. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|