|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Bütthard (Markt
Bütthard, Kreis Würzburg )
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Bütthard (Marktrechte seit 1503) bestand eine jüdische Gemeinde bis
1937.
Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. 1588
wird das Haus eines Juden Salomon genannt. 1641 werden vier
jüdische Namen erwähnt. 1675 gab es drei jüdische Haushaltungen in
Bütthard. Einer der drei Familieväter war Stoffhändler. 1738 wurden fünf
jüdische Haushaltungen genannt.
1817 wurden der Gemeinde zehn Matrikelstellen
eingeräumt, bis 1820 kamen drei weitere Matrikelstellen dazu. Damit hatten
maximal 13 jüdische Familien das Wohnrecht am Ort. 1817/20 gab es die folgenden
jüdischen Familienvorstände (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Herz
Salomon Hamburger (Pferdehandel), Abraham Herz Hamburger (Pferdehandel), Salomon
Herz Hamburger (Pferdehandel), Moses Hirsch Sichel (Waren- und Wollenhandel),
Kehla, Witwe von Hirsch Mannheimer (Vieh- und Warenhandel), Schela, Witwe von
Jüdlein Frank (Vieh- und Warenhandel), Binges Löw Lehnmann (Waren- und
Wollenhandel), Salomon Hirsch Mannheimer (Waren- und Viehhandel), Moses Hirsch
Mannheimer (Waren- und Viehhandel), Faust Hirsch Mannheimer (Waren- und
Viehhandel), Hirsch Moses Sichel (Feldbau, seit 1818), Anschel Jüdlein Frank
(Warenhandel, seit 1919), Simon Sichel (Warenhandel (seit 1820).
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1816 33 jüdische Einwohner (5,1 % von insgesamt 653 Einwohnern),
1837 60 (9,2 % von 650), 1867 63 (8,2 % von 771), 1890 34 (4,3 % von 786), 1900
22 (2,8 % von 787), 1910 21 (2,5 % von 832).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), ein
Gemeindehaus mit einem Raum für die Religionsschule sowie Wohnungen und ein
rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - in
Verbindung mit der Nachbargemeinde Allersheim - ein
Religionslehrer angestellt, der auch als Vorbeter in der Gemeinde tätig
war. Von 1831 bis 1868 wurden die jüdischen Kinder in Bütthard durch Rabbiner
Samuel Weißbart aus Allersheim
unterrichtet. Sein Sohn Abraham Weißbart übernahm die Lehrerstelle in
Bütthard bis zu seinem Tod 1902, danach wurde sie neu ausgeschrieben (s.u.). Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen
Friedhof in Allersheim beigesetzt. Die
Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Kitzingen.
Um 1924, als nur noch neun jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (1 %
von etwa 900 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Simon Hamburger.
Auch 1932 wird er als Vorsteher genannt.
1933 lebten noch zehn jüdische Personen in Bütthard (1,3 % von
insgesamt 758 Einwohnern). Es handelte sich um die Ehepaare/Familien von Isaak
Lehmann, Simon Hamburger, Max Frank und Moritz Mannheimer. Letzterer verzog 1937
mit seiner Frau nach Frankfurt am Main, wo Moritz Mannheimer starb; die Witwe
konnte emigrieren. Isaak Lehmann konnte mit seiner Frau Hella in die USA
emigrieren. Im Oktober 1937 wurde die Gemeinde offiziell aufgelöst. Beim Novemberpogrom
1938 drangen SA- und SS-Männer aus Ochsenfurt und Umgebung in die Häuser
der beiden letzten jüdischen Familien ein und zerschlugen die Einrichtungen.
Einige Ortsbewohner beteiligten sich an den Verwüstungen. 1939 verließ das
Ehepaar Simon Hamburger den Ort und emigrierte nach Holland. Max und Mina Frank,
die noch 1942 in Bütthard lebten, wurden über Würzburg in das Ghetto
Theresienstadt verschleppt.
Von den in Bütthard geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Heinrich Frank (1863), Johanna
(Hanna, Hannchen) Frank (1866, siehe Anzeige unten),
Theresa Frank (1873), Julie Grünberg geb. Mannheimer (1871), Johanna Hamburger
(1864), Dina Lucas geb. Mannheimer (1877), Herta Mannheimer (1891), Jette
Rothschild geb. Mannheimer (1861), Hedwig Winter geb. Sichel (1874).
Max Frank (1874) und seine Frau Mina geb. Stark (1877) überlebten das Ghetto
Theresienstadt, kehrten 1945 nach Bütthard zurück und wanderten später nach
Amerika aus.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Die Stelle des Friedhofsverwalters in Allersheim war
zeitweise mit der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Bütthard
verbunden:
Zum Tod des Lehrers und Friedhofsverwalters Abraham
Weißbart (1902)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1902: "Giebelstadt,
20. August (1902). In dem nahen Allersheim ist dieser Tage ein Mann
aus dem Leben geschieden, der es verdient, dass ihm in diesen Blättern
ein kleines Denkmal gesetzt wird. Es wurde daselbst Lehrer und
Friedhofsverwalter Abraham Weißbart am Freitag vor Schabbat mit der
Toralesung Matot uMaseh (d.i. Freitag, 1. August 1902) zu Grabe
getragen. Aus einer streng-frommen Gelehrtenfamilie stammend, war sein
ganzes Leben seiner Abstammung und Erziehung entsprechend. Durch seine
Gewissenhaftigkeit in beiden mühevollen Ämtern, seine Freundlichkeit und
große Bescheidenheit hatte er sich die Liebe und Verehrung weiter Kreise
erworben. Sein Leichenbegängnis bestätigte dieses in vollem Mae. Aus
allen Gemeinden des Bezirkes waren Männer herbeigeeilt, um ihm die letzte
Ehre zu erweisen. Der Bruder des Verstorbenen, er ruhe in Frieden -
Herr Seminarlehrer Weißbart, widmete nur einige tief empfundene Worte als
Nachruf, da wegen des Vorabends zum Schabbat von einer (längeren) Trauerrede
Umgang genommen werden musste. Es wird verschlingen der Tod auf ewig." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1902: "Giebelstadt,
20. August (1902). In dem nahen Allersheim ist dieser Tage ein Mann
aus dem Leben geschieden, der es verdient, dass ihm in diesen Blättern
ein kleines Denkmal gesetzt wird. Es wurde daselbst Lehrer und
Friedhofsverwalter Abraham Weißbart am Freitag vor Schabbat mit der
Toralesung Matot uMaseh (d.i. Freitag, 1. August 1902) zu Grabe
getragen. Aus einer streng-frommen Gelehrtenfamilie stammend, war sein
ganzes Leben seiner Abstammung und Erziehung entsprechend. Durch seine
Gewissenhaftigkeit in beiden mühevollen Ämtern, seine Freundlichkeit und
große Bescheidenheit hatte er sich die Liebe und Verehrung weiter Kreise
erworben. Sein Leichenbegängnis bestätigte dieses in vollem Mae. Aus
allen Gemeinden des Bezirkes waren Männer herbeigeeilt, um ihm die letzte
Ehre zu erweisen. Der Bruder des Verstorbenen, er ruhe in Frieden -
Herr Seminarlehrer Weißbart, widmete nur einige tief empfundene Worte als
Nachruf, da wegen des Vorabends zum Schabbat von einer (längeren) Trauerrede
Umgang genommen werden musste. Es wird verschlingen der Tod auf ewig." |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und
Friedhofsverwalters (1902)
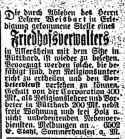 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1902:
"Die durch Ableben des Herrn Lehrer Weißbart in Erledigung gekommene
Stelle eines Friedhofsverwalters in Allersheim mit dem Sitze in
Bütthard
ist wieder zu besetzen. Bevorzugt werden solche, die befähigt sind, den
Religionsunterricht zu erteilen und den Vorbeterdienst versehen zu
können. Gehalt von der Korporation 400 Mark, als Religionslehrer und
Vorbeter in Bütthard 200 Mark nebst freie Wohnung und frei Holz und nicht
unbedeutenden Nebenverdiensten. Meldungen an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1902:
"Die durch Ableben des Herrn Lehrer Weißbart in Erledigung gekommene
Stelle eines Friedhofsverwalters in Allersheim mit dem Sitze in
Bütthard
ist wieder zu besetzen. Bevorzugt werden solche, die befähigt sind, den
Religionsunterricht zu erteilen und den Vorbeterdienst versehen zu
können. Gehalt von der Korporation 400 Mark, als Religionslehrer und
Vorbeter in Bütthard 200 Mark nebst freie Wohnung und frei Holz und nicht
unbedeutenden Nebenverdiensten. Meldungen an
E. Stahl, Sommerhausen am
Main." |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Rückblick: Esrogim-Mangel (1810) - Allersheim und Bütthard kaufen gemeinsam
ein Esrog (Etrog)
Anm.: bei einem Esrog (beziehungsweise Etrog) handelt es sich um eine
Zitrusfrucht, die beim Sukkotfest (Laubhüttenfest) Verwendung findet;
siehe Wikipedia-Artikel
"Etrog"
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit": Esrogim-Mangel in alter Zeit.
In dem mir vorliegenden Memorbuch der Gemeinde Giebelstadt in Unterfranken
(hier aus dem Hebräischen übersetzt) berichtet ein Chronist: 'Zur
Erinnerung! Im Jahre 571 der kleinen Zeitrechnung (d.i. 1810) hat die
hiesige Gemeinde ihr Esrog, das einzige am Ort, für 20 Gulden rheinisch
kaufen müssen. Die beiden Gemeinden Geroldshausen und
Kirchheim kauften
eines gemeinsam für zwei Karlin, ebenso Allersheim und
Bütthard. Solche
Esrogim wurden in wohlfeilen Zeiten leicht für 24 Kreuzer (= 72
Reichspfennig) gekauft. Vorbeter Lämmle b. Mhhr* Benjamin'.
Was der Grund der Teuerung gewesen, wird nicht angegeben. Möglich, dass
politische Hinderungsgründe in der damaligen Napoleonischen Zeit die
Einfuhr erschwerten."
*Mhhr Abkürzung für: "unser Lehrer, der Chawer, Herr...",
Bezeichnung für einen Gelehrten. |
Aufruf zur Unterstützung eines armen jüdischen Ehepaares
in Bütthard (1884)
 Aufruf
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1884: "Verehrte
Glaubensgenossen! Aufruf
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1884: "Verehrte
Glaubensgenossen!
Im Vertrauen, dass noch nie bei dringenden Fällen eine
Fehlbitte geschehen ist, erlauben wir uns für eine hart bedrängte
Familie bittend hervorzutreten. Die betreffende Familie ist durch
Unglücksfälle gänzlich verarmt; in den nächsten Tagen wird das Haus
versteigert, und stehen dann die alten Leute hilflos da. Wir bitten dringend
um Hilfe, um die Familie zu erhalten. Unsere Gemeinde ist zu schwach dazu;
dieselbe besteht nur aus wenigen und noch größtenteils unbemittelten Familien.
Edle Glaubensgenossen, helfet! Der Himmel wird es Euch lohnen. Man bittet,
die Gaben an der Mitunterzeichneten, Herrn S. Sichel, zu senden.
Bütthard, im August 1884. S. Sichel, Kultusvorstand, Oscher
Manheimer, S. Frank.
Die Dürftigkeit und die Würdigkeit der betreffenden Familie in Bütthard
ist auch dem Unterzeichneten bekannt, und wird daher dieselbe hiermit dem
Wohlwollen edler Glaubensgenossen bestens empfohlen.
Kitzingen, den 19. August 1884. Der Distrikts-Rabbiner: Adler.
Wir sind gern bereit, Gaben entgegenzunehmen und weiterzubefördern. Die
Expedition des "Israelit". |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Nach der Deportation: Todesanzeige für Heinrich
Frank und Rosel Frank geb. Halle sowie für Hannchen Frank (umgekommen in
Theresienstadt; 1945)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 20. Juli 1945: "Unsere lieben Eltern und
Großeltern
Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"
vom 20. Juli 1945: "Unsere lieben Eltern und
Großeltern
Heinrich Frank und Rosel Frank geb. Halle (früher Klingenberg
am Main und Regensburg)
und unsere gute Tante Hannchen Frank (früher Bütthart und
Regensburg)
sind in Theresienstadt verschieden.
Walter Frank und Frau Fanny geb. Loose, 19 Stratford Place, Newark 8,
N.F.;
Otto Frank und Frau Irma geb. Fleischmann, 285 Riverside
Drive, New York 25, N.Y." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war vermutlich ein Betsaal oder eine ältere
Synagoge vorhanden. 1812 wurde nach dem Verzeichnis des Königlichen
Landgerichts Röttingen von 1817 eine (neue?) Synagoge erbaut.
Die Synagoge war religiöses Zentrum der in Bütthard lebenden jüdischen
Familien bis zur Auflösung der jüdischen Gemeinde im Oktober 1937 und
dem Verkauf der Synagoge. Die Ritualien kamen im Dezember 1937 nach München.
Das Gebäude blieb nach 1945 und bis zur Gegenwart erhalten, er wurde zu einem
Wohnhaus umgebaut; einige Originalfenster sind noch vorhanden.
Von 1948 bis 1951 fanden vor dem Landgericht Würzburg Prozesse gegen 21
der an den Ausschreitungen in Bütthard beim Novemberpogrom 1938 Beteiligten
statt. Acht erhielten Gefängnisstrafen von drei bis zwölf Monaten.
Eine Gedenktafel im Inneren des Rathauses erinnert an die jüdische
Gemeinde Bütthard und ihre Synagoge mit der Inschrift: "Im MARKT BÜTTHARD
existierte bis 1937 eine jüdische Kultusgemeinde. Synagoge Marktplatz 3. Der
Markt gedenkt seiner ehemaligen jüdischen Mitbürger. ZUR ERINNERUNG UND
MAHNUNG."
Adresse/Standort der Synagoge: Marktplatz 3
Fotos
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 280-281. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 43. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 431.
|
 | Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen
Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg
1988 S. 55. |
 | Joachim Braun:
Die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Allersheim im Ochsenfurter Gau.
In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 2007 S. 535-610. |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 230. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Buetthard Lower Franconia.
Jews numbered 63 (total 771) in 1867 and ten in 1933 with a synagogue and
community center at their disposal. Five left in 1937. On Kristallnacht
(9-10 November 1938) Jewish homes were vandalized with the help of local
residents. Of the last five Jews (all over 65) three emigrated in 1939 and two
were deported to the Theresienstadt ghetto in 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|