|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Urspringen (Main-Spessart-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
(english version)
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts unterschiedlichen Herrschaften
gehörenden Urspringen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. In einem
Schreiben des Rothenfelser Amtmanns Hans-Wilhelm von Riedern aus dem Jahr 1573
wird der aus Urspringen stammende Jude Salomon genannt, der damals in Mainz
lebte und in das wertheimische Dorf Heidenfeld (Marktheidenfeld)
übersiedeln wollte. 1655 gab
es bereits 12 jüdische Haushaltungen mit 34 Personen. Mitte des 18.
Jahrhunderts wurden 14 Haushaltungen gezählt, von denen 12 unter dem Schutz der
Familie von Castell, zwei unter dem Schutz der Familie von Ingelheim standen.
Ihre Blütezeit erlebte die jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert
wie folgt: 1803/04 20 jüdische Familien, 1813 166 jüdische Einwohner (17,1 %
der Gesamteinwohnerschaft), 1815 185 (16,5 % der Gesamteinwohnerschaft von 1.123
Personen), 1837 220 (20,8 % von insgesamt 1.060), 1867 213 (20,7 % von
insgesamt 1.030), 1880 194 (18,3 % von 1.062), 1900 154 (15.1 % von
insgesamt 1.020).
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Urspringen die
folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und
Erwerbszweig): unter bisherigem Schutz der Familie von Castell auf 27
Matrikelstellen (dazu Nachträge/Veränderungen bis 1825): Löw Faust Fränkel
(Pferd- und Rindviehhandel), Nathan Faust Fränkel (Pferd- und Rindviehhandel),
Moses Faust Fränkel (Pferd- und Rindviehhandel), Samuel Hohna Schwab
(Schmuserei), Feist/Faust Nathan Fränkel (Pferdehandel, seit 1819 Pferd- und
Rindviehhandel, Eisen- und Leder-, Hausierhandel mit Spezereiwaren), David Isaak
Adler (Vieh- und Warenhandel), Abraham Isaak Adler (Viehhandel, ab 1819
Rindvieh- und Ellenwarenhandel), Hirsch Samuel Tannenwald (Schmuserei), Moses
Samuel Geyer (Schlächterei und Schmuserei), Jacob Wolf Straus (Schmuserei),
Joseph Isaak Adler (Viehhandel und Schmuserei, ab 1819 Handel mit Eisen, Leder,
Spezerei- und Ellenwaren), Feist/Faust Wolf Straus (Viehhandel und Schmuserei),
Maier Hirsch Krumm (Schmuserei), Jacob Moses Rosenbusch (Schlächterei und
Viehhandel), Moses Aron Freudenreich (Ellen- und Spezereiwarenhandel), Götz Löw
Goldberg (Vieh- und Warenhandel, ab 1819 Ellenwaren-, Bettwerk-
Lederwerkhandel), Abraham Mose Schloß (Warenhandel), Abraham Moses Rosenfeld
(Warenhandel), Eleasar Nathan Trepp (Warenhandel), Himmerla David Rothfelder
(Handarbeit und Unterstützung), Joseph David Rothfelder (Schmuserei), Isack
Moses Schloß (Warenhandel), Abraham Jakob Grün (Warenhandel, seit 1819
Ellenwaren), Maier Leser Stern (Warenhandel), Aron Moses Schloß (Warenhandel),
Lazarus Jakob Waldauer (Warenhandel, seit 1819 Ellenwaren und Bettfedern),
Nathan Moses Fränkel (Feldbau, ab 1824), Löw Moses Sonnenhell (Metzgerei, ab
1818), Hirsch Schmey Schloß (Warenhandel mit offenem Laden, seit 1822), Aron Fränkel
(Handel mit offenem Laden, seit 1825); unter bisherigem Schutz der Familie
von Ingelheim auf neun Matrikelstellen: Joseph Isaak Klein (Mäklerei), Joel
Isaak Klein (Mäklerei), Salomon Löw Stern (Handel mit Schnittwaren), Nathan
Hayum Heimann (Privatlehrer), Hona Isaak Klein (Viehhandel), Hayum Isaac
Dillberger (Viehschlächterei), Nathan Anschel Mandelbaum (Viehhandel), Michel
Hona Frank (Mäklerei); nicht in die Liste aufgenommen wurde die Witwe von Hajum
Isack Klein (Handarbeiten).
Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stagnierte die Zahl der jüdischen
Einwohner durch Aus- und Abwanderung, um danach zurückzugehen. In die USA zogen
u.a. Mitglieder der Familien Heilner, Mosenfelder, Freudenreich.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) sowie
eine jüdische Elementar- und Religionsschule und eine Mikwe (rituelles Bad;
letzteres 1826 in der Quellenstraße neu erbaut). Die Toten der Gemeinde wurden
in Laudenbach
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der als Vorbeters und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der
Stelle unten). Seit dem 19. Jahrhundert gehörte die jüdische Gemeinde
Urspringen zum Distriktsrabbinat in Würzburg.
Näheres zu einzelnen Lehrern: ab etwa 1800 war als 'Judenschulmeister' Gabriel
Wormser (gest. 1825) tätig, der Vater des späteren und einzigen
Distriktrabbiners von Gersfeld
Samuel Wormser (geb. 1807; 1840-1892 Rabbiner in Gersfeld). - Erster Lehrer der
neu errichteten Israelitischen Elementarschule war von 1830 bis 1864 bis zu
seinem Wegzug nach Stuttgart, Aron Heilner (1804-1891), dessen Enkel Dr.
Richard Heilner ab 1926 als Generaldirektor an der Spitze der Deutschen
Linoleumwerke in Bietigheim-Bissingen, eines der größten deutschen
Industrieunternehmen, stand. Sigmund Heilner (1834-1917), einer von Arons Söhnen,
zählt zu den Pionieren Oregons. - Nachfolger von Aron Heilner war Lehrer Samuel
Samuel Samfeld (zuvor in Giebelstadt,
genannt in Urspringen von mind. 1866 bis 1877 oder 1878). Besonders bekannt war der seit 1878 in
Urspringen tätige Lehrer Simon Kissinger. Er konnte 1903 sein 25jähriges,
1928 sein 50jähriges Dienstjubiläum feiern. Bis 1929 blieb er - zuletzt
als Hauptlehrer - in der Gemeinde tätig. 1918 war zwar die Israelitische
Elementarschule aufgelöst wurden, doch blieb Simon Kissinger auch als
Religionslehrer am Ort. 1929 wurde die Stelle neu ausgeschrieben, konnte
jedoch nicht mehr besetzt werden, sodass Lehrer Kissinger auch weiterhin
unterrichtete (Berichte zu Kissinger s.u.).
An jüdischen Vereinen bestanden insbesondere: der Wohltätigkeitsverein Chewra
Schnijah (1851 gegründet, 1924/25 unter Leitung von Moses Adler, damals 12
Mitglieder), der Wohltätigkeitsverein Chewra Neorim (1924/24 unter
Leitung von J. Dillenberger, damals 12 Mitglieder) unter der Frauenverein
Sara (1924/25 26 Mitglieder). Die Chewra Schnijah hatte auch eine Bücherei
eingerichtet. Auch eine Zweigstelle des Jüdischen Nationalfonds Keren
Kajemet le Jisrael bestand in Urspringen.
Seit 1900 ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder weiter zurück von 111
Personen im Jahr 1910 (11,2 % von insgesamt 991) auf 86 im Jahr 1925 (9,1 % von
943).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Friedrich
Philipp Freudenreich (geb. 29.10.1888 in Urspringen, gef. 5.7.1915) und Louis
Leopold (geb. 4.4.1877 in Schmalnau, gef. 1.9.1917). Unter
den vermissten jüdischen Soldaten sind Albert Adolf Ackermann (geb. 28.1.1890
in Urspringen, gef. 15.7.1915) und Gefreiter Siegmund (Sigmund) Samuel (geb. 17.2.1893 in
Karbach, gef. 18.8.1918). Die Namen dieser
vier Soldaten stehen auf dem Gefallenendenkmal der Gemeinde an der Außenseite
der katholischen Pfarrkirche (siehe Fotos unten). Andere jüdische
Kriegsteilnehmer kehrten mit teils hohen Auszeichnungen zurück.
Um 1924, als noch 100 jüdische Einwohner gezählt wurden (10 % von
insgesamt etwa 1.000 Einwohnern) gehörten dem Gemeindevorstand an:
Bernhard Dillenberger, A. Schloss, Simon Kissinger und Max Freudenreich. Im
Schuljahr 1924/25 waren nur zwei jüdische Kinder in der Religionsschule zu
unterrichten. 1932 waren die Gemeindevorsteher Moritz Dillenberger (1.
Vorsitzender) und Hermann Landauer (2. Vorsitzender).
1933 wurden noch 78 jüdische Gemeindeglieder gezählt (7,9 % von 992).
In der ersten Jahren der NS-Zeit blieben die meisten der jüdischen
Gemeindeglieder in ihrem Heimatort. Erst ab 1937 (noch 71 jüdische
Einwohner) entschlossen sich mehrere zum Umzug in die Städte oder zur
Auswanderung. Zu Ausschreitungen gegen die jüdischen Häuser und Familien kam
es erstmals am 29. September 1938, als in vier jüdischen Häusern die
Fenster eingeschlagen wurden. Zu weiteren Verwüstungen der jüdischen Wohnungen
kam es beim Novemberpogrom 1938. Dabei wurde selbst das Haus heimgesucht,
in dem eine verstorbene jüdische Frau aufgebahrt war. 1939 wurden noch
56 jüdische Einwohner gezählt (5,8 % von 973). Im April 1942 wurden 42
jüdische Einwohner aus Urspringen über Würzburg in Vernichtungslager
deportiert. Die Urspringer Juden stellten bei dieser Deportation das größte
Kontingent einer jüdischen Gemeinde aus dem Gebiet des heutigen Landkreises
Main-Spessart. Die letzten vier Urspringer Juden wurden noch im Laufe des Jahres
1942 deportiert.
Von den in Urspringen geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" und auf Grund der
Zusammenstellung von L. Scherg): Adolf Adler (1882), Anny Adler (1924), Bertha
Adler geb. Weinberg (1892), Bettina (Dina) Adler geb. Hahn (1893), David Adler
(1879), Fanny Adler (1899), Fanny Adler geb. Landauer (1875),
Frieda Adler geb. Landauer (1875), Friedrich Adler (1888), Ida Adler geb. Israel
(1892), Inge Adler (1934), Isaak Adler (1876), Justin Adler (1906), Leo Adler
(1924), Lina Adler geb. Schönfärber (1901), Ludwig Adler (1892), Manfred Adler
(1932), Mathilde Adler geb. Günther (1898), Nathan Adler (1878), Paula Adler
geb. Grün (1886), Philipp Adler (1865), Ruth Adler (1924), Senta Adler (1921),
Serry Adler (1925), Emilie Altgenug geb. Klein (1882), Friedrich Dillenberger
(1888), Gitta Dillenberger geb. Gerson (1893), Hans Dillenberger (1931), Heinz
Dillenberger (1927), Joachim Dillenberger (1924), Lenchen Dillenberger geb.
Frank (1892), Marga Dillenberger (1927), Max Dillenberger (1899), Moritz
Dillenberger (1879), Rosa Dillenberger geb. Grün (1883), Rudolf Dillenberger
(1893), Werner Dillenberger (1926), Fanny Ehrmann geb. Adler (1850), Alfons Fränkel
(1888), Hermann Fränkel (1866), Isidor Fränkel (1871), Elsa Frank geb.
Dillenberger (1890), Sofie Frankenfelder geb. Landauer (1879), Hermina
Freimark geb. Adler (1876), Abraham Freudenreich (1884), Albert Freudenreich
(1883), Alice Freudenreich (1921), Dina Freudenreich geb. Freudenreich (1889),
Jenny Freudenreich geb. Schafheimer (1894), Max Freudenreich (1894), Mira Dina
Freudenreich geb. Freudenreich (1889), Ruth Freudenreich (1924), Si(e)gi
Freudenreich (1924), Elsa Friedenhain geb. Dillenberger (1882), Berta Günther
geb. Fleischmann (1864), Sali Hanauer (1887), Gerta Hecht (1908), Sofie Hecht
geb. Adler (1878), Isaak Hobel (1887), Bertha Höchstädter geb.
Dillenberger (1882), Babette Kaiser geb. Adler (1872), Karola (Karolina)
Kaufmann geb. Rosenstein (1861), Julius Kissinger (1894), Abraham Klein (1865),
Josef Klein (1880), Hilda Krug geb. Adler (1887), Hermann Landauer (1882), Hilda
Landauer geb. Adler (1893), Hilde Krug geb. Adler (1887), Tilly Meyer geb.
Leopold (1911), Luise Morgenroth (1882), Moses Morgenroth (1862), Julie Müller
geb. Klein (1876), Emilie Oppenheimer geb. Dillenberger (1879), Sali Rosenbaum
(1885), Wolfgang Rosenstein (1865), Alfred Rothfeld (1920), Berthold Rothfeld
(1908), David Rothfeld (1886), Hannchen Rothfeld geb. Müller (1882), Hilda
Rothfeld geb. Müller (1886), , Meta Schloss geb. Adler (1887), Rosa Schloss
geb. Weikersheimer (1855), Marianne Schömann geb. Adler (1870), Frieda Schönfärber
geb. Adler (1909), Maria (Marianne) Schömann geb. Adler (1870), Aron (Arno,
Armold) Simon (1926), Hermann Simon (1891), Meta Simon geb. Grün (1889), Fanny
Stern geb. Kissinger (1902), Klara Strauss geb. Klein (1878).
Anmerkung: Ein großer Teil dieser Personen lebte schon einige Zeit bis lange
vor 1933 nicht mehr in Urspringen.
Hinweise: Der in obiger Liste bislang genannte Julius Joel Rothfeld (1875)
ist am 29. Januar 1941 gestorben und wurde in Laudenbach
beigesetzt; es war die letzte Bestattung in Laudenbach).
Der Familienname Rothfeld wird teilweise auch "Rotfeld" geschrieben;
in den örtlichen Unterlagen begegnet allerdings nur "Rothfeld").
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Aus der Zeit des Lehrers Simon Kissinger
 Der jüdische Lehrer Simon
Kissinger (1859-1939) mit Frau Babette geb. Fränkel, eigenen Kindern und
den Schulkindern in Urspringen. Kissinger lebte 50 Jahre lang in
Urspringen. Der jüdische Lehrer Simon
Kissinger (1859-1939) mit Frau Babette geb. Fränkel, eigenen Kindern und
den Schulkindern in Urspringen. Kissinger lebte 50 Jahre lang in
Urspringen.
Quelle: Familie Kissinger
Genealogische Informationen: https://www.geni.com/people/Simon-Kissinger/6000000035618480244 |
| |
| 25jähriges
Dienstjubiläum und Ehrenbürgerrecht für Lehrer Kissinger 1903 |
 Aus der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.10.1903: "Dem
Israelitischen Volksschullehrer Kissinger in Urspringen wurde anlässlich
seines 25jährigen Dienstjubiläums das Ehrenbürgerrecht mit Diplom
verliehen" Aus der
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.10.1903: "Dem
Israelitischen Volksschullehrer Kissinger in Urspringen wurde anlässlich
seines 25jährigen Dienstjubiläums das Ehrenbürgerrecht mit Diplom
verliehen"
|
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1903:
"Urspringen, 25. September (1903). Nachdem der israelitische
Volksschullehrer, Herr S. Kissinger, 25 Dienstjahre seit seinem
Seminaraustritte ausschließlich in der hiesigen Kultusgemeinde zugebracht
hat, wurden ihm außer zahlreichen und wertvollen Geschenken durch
einstimmigen Beschluss der Gemeindeverwaltung das Ehrenbürgerrecht mit
Diplom verliehen und durch den Herrn Bürgermeister Albert mit ehrender
Ansprache überreicht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1903:
"Urspringen, 25. September (1903). Nachdem der israelitische
Volksschullehrer, Herr S. Kissinger, 25 Dienstjahre seit seinem
Seminaraustritte ausschließlich in der hiesigen Kultusgemeinde zugebracht
hat, wurden ihm außer zahlreichen und wertvollen Geschenken durch
einstimmigen Beschluss der Gemeindeverwaltung das Ehrenbürgerrecht mit
Diplom verliehen und durch den Herrn Bürgermeister Albert mit ehrender
Ansprache überreicht." |
| |
| Silberne Hochzeit und
30jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger 1908 |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:
"Urspringen bei Karlstadt, 20. November (1908). Am 29. November
feiert Herr Lehrer S. Kissinger mit seiner Gemahlin geborenen Fränkel,
das Fest der silbernen Hochzeit und auch gleichzeitig das 30jährige
Dienstjubiläum. Welch großer Beliebtheit sich Herr Kissinger erfreut,
der seit seiner Seminarabsolvierung in hiesiger Gemeinde als
Volksschullehrer wirkt, geht daraus hervor, dass ihm schon zu seinem
25jährigen Dienstjubiläum neben zahlreichen anderen Ehrungen auf
einstimmigem Gemeindebeschluss hin das Ehrenbürgerrecht verliehen
wurde." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1908:
"Urspringen bei Karlstadt, 20. November (1908). Am 29. November
feiert Herr Lehrer S. Kissinger mit seiner Gemahlin geborenen Fränkel,
das Fest der silbernen Hochzeit und auch gleichzeitig das 30jährige
Dienstjubiläum. Welch großer Beliebtheit sich Herr Kissinger erfreut,
der seit seiner Seminarabsolvierung in hiesiger Gemeinde als
Volksschullehrer wirkt, geht daraus hervor, dass ihm schon zu seinem
25jährigen Dienstjubiläum neben zahlreichen anderen Ehrungen auf
einstimmigem Gemeindebeschluss hin das Ehrenbürgerrecht verliehen
wurde." |
| |
| 45-jähriges
Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger (1923) |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923:
"Urspringen, 10. August (1923). Ein seltenes Jubiläum kann Herr
Hauptlehrer Kissinger dahier am 22. August begehen. An diesem Tage werden
es 45 Jahre, dass Herr Kissinger seit seinem Seminaraustritt im Jahre 1878
ohne Unterbrechung in der hiesigen Kultusgemeinde tätig ist. Es dürfte
dieser Fall wohl sehr selten vorkommen. Alle Kreise der Bevölkerung
nehmen freudigsten Anteil an dem seltenen Ereignis." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923:
"Urspringen, 10. August (1923). Ein seltenes Jubiläum kann Herr
Hauptlehrer Kissinger dahier am 22. August begehen. An diesem Tage werden
es 45 Jahre, dass Herr Kissinger seit seinem Seminaraustritt im Jahre 1878
ohne Unterbrechung in der hiesigen Kultusgemeinde tätig ist. Es dürfte
dieser Fall wohl sehr selten vorkommen. Alle Kreise der Bevölkerung
nehmen freudigsten Anteil an dem seltenen Ereignis." |
| |
| 50-jähriges
Dienstjubiläum von Lehrer Kissinger (1928) |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 13.
September 1928: "Urspringen. Am 8. September waren es 50
Jahre, dass Hauptlehrer Kissinger die Stelle eines Volksschullehrers an
der damals noch sehr gut besuchten jüdischen Volksschule in Urspringen
angetreten hat. Er amtierte an dieser Schule bis zu ihrer vor 10 Jahren
erfolgten Auflösung, verblieb aber in treuer Anhänglichkeit an seine
Gemeinde als Religionslehrer dortselbst und hat bis vor kurzem diesen
Dienst in mustergültiger Weise versehen. Seine eifrige und ersprießliche
Tätigkeit wie seine Sorge um das Allgemeinwohl fanden vielseitige
Anerkennung nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch in
hohem Grade bei der politischen Gemeinde, die ihm anlässlich seines
25jährigen Dienstjubiläums das Ehrebürgerrecht verlieh. Der Jubilar
gehört zu den wenigen noch lebenden Gründungsmitgliedern unseres Vereins
(gemeint: Israelitischer Lehrerverein in Bayern). Möge ihm ein recht
langer und heiterer Lebensabend beschieden sein!" Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 13.
September 1928: "Urspringen. Am 8. September waren es 50
Jahre, dass Hauptlehrer Kissinger die Stelle eines Volksschullehrers an
der damals noch sehr gut besuchten jüdischen Volksschule in Urspringen
angetreten hat. Er amtierte an dieser Schule bis zu ihrer vor 10 Jahren
erfolgten Auflösung, verblieb aber in treuer Anhänglichkeit an seine
Gemeinde als Religionslehrer dortselbst und hat bis vor kurzem diesen
Dienst in mustergültiger Weise versehen. Seine eifrige und ersprießliche
Tätigkeit wie seine Sorge um das Allgemeinwohl fanden vielseitige
Anerkennung nicht nur bei der jüdischen Bevölkerung, sondern auch in
hohem Grade bei der politischen Gemeinde, die ihm anlässlich seines
25jährigen Dienstjubiläums das Ehrebürgerrecht verlieh. Der Jubilar
gehört zu den wenigen noch lebenden Gründungsmitgliedern unseres Vereins
(gemeint: Israelitischer Lehrerverein in Bayern). Möge ihm ein recht
langer und heiterer Lebensabend beschieden sein!" |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1928: "Urspringen,
2. September (1928). Am nächsten Schabbos sind es 50 Jahre, dass der
allseits beliebte und hochgeschützte Herr Hauptlehrer Simon Kissinger
in Urspringen seine ersprießliche und erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer
begann. Es gibt wohl verschwindend wenige Lehrer, deren ganze
Lehrtätigkeit sich nur auf eine Gemeinde erstreckt. Bei Simon Kissinger
war dies der Fall. 40 Jahre war er in Urspringen als Volksschullehrer
tätig und seit seiner Pensionierung lieh er seine Dienste dieser Gemeinde
als Religionslehrer, bis er vor ganz kurzer Zeit in den wohlverdienten
Ruhestand trat. Ihm war es vergönnt, drei Generationen in einer Gemeinde
zu guten Menschen und zu guten Juden zu erziehen. Während seines
Berufslebens vollbrachte er stets die Mizwo, die an seinem Jubelschabbos
verlesen wird. So sind ihm denn nicht nur die Kinder seiner Gemeinde in
Liebe zugetan, sein Name hat in allen kreisen der bayerischen Judenheit
einen guten Klang und insbesondere freiern diesen Tag alle seine
jüdischen Berufskollegen mit ihm. Er gehörte ja zu den wenigen noch
lebenden Gründungsmitgliedern des Israelitischen Lehrervereins für
Bayern. Dass der Jubilar aber auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung
einen guten Namen hat, das beweist wohl das Ehrenbürgerrecht, das ihm vor
25 Jahren von der politischen Gemeinde Urspringen verliehen wurde. Möge
dem Jubilar ein recht langer und glücklicher Lebensabend beschieden
sein." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. September 1928: "Urspringen,
2. September (1928). Am nächsten Schabbos sind es 50 Jahre, dass der
allseits beliebte und hochgeschützte Herr Hauptlehrer Simon Kissinger
in Urspringen seine ersprießliche und erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer
begann. Es gibt wohl verschwindend wenige Lehrer, deren ganze
Lehrtätigkeit sich nur auf eine Gemeinde erstreckt. Bei Simon Kissinger
war dies der Fall. 40 Jahre war er in Urspringen als Volksschullehrer
tätig und seit seiner Pensionierung lieh er seine Dienste dieser Gemeinde
als Religionslehrer, bis er vor ganz kurzer Zeit in den wohlverdienten
Ruhestand trat. Ihm war es vergönnt, drei Generationen in einer Gemeinde
zu guten Menschen und zu guten Juden zu erziehen. Während seines
Berufslebens vollbrachte er stets die Mizwo, die an seinem Jubelschabbos
verlesen wird. So sind ihm denn nicht nur die Kinder seiner Gemeinde in
Liebe zugetan, sein Name hat in allen kreisen der bayerischen Judenheit
einen guten Klang und insbesondere freiern diesen Tag alle seine
jüdischen Berufskollegen mit ihm. Er gehörte ja zu den wenigen noch
lebenden Gründungsmitgliedern des Israelitischen Lehrervereins für
Bayern. Dass der Jubilar aber auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung
einen guten Namen hat, das beweist wohl das Ehrenbürgerrecht, das ihm vor
25 Jahren von der politischen Gemeinde Urspringen verliehen wurde. Möge
dem Jubilar ein recht langer und glücklicher Lebensabend beschieden
sein." |
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1928: "Urspringen. Nachdem Herr Hauptlehrer a.D. S.
Kissinger alle ihm zugedachten offiziellen Veranstaltungen seitens der
Kultusgemeinde, der politischen Gemeinde und Vereine sowie des
Distrikt-Rabbinates und Synagogenchores Würzburg mit Rücksicht auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse abgelehnt hatte, verlief dessen 50jährige
Jubelfeier in Stiller Weise im allerengsten Kreise. Eine Unmenge von
Zuschriften von Privaten sowie solche sehr ehrendem Inhalt liefen ein vom
Verband der Israelitischen Gemeinden Bayerns mit einer Ehrengabe, vom
Distrikt-Rabbinate Würzburg und ein sehr herzlich gehaltenes
Glückwunschschreiben der hiesigen politischen Gemeinde; das Schreiben der
letzteren ist ein erfreuliches Zeichen des schönen Verhältnisses der
drei Konfessionen in hiesiger Gemeinde. Möge dies weiter so
bleiben." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1928: "Urspringen. Nachdem Herr Hauptlehrer a.D. S.
Kissinger alle ihm zugedachten offiziellen Veranstaltungen seitens der
Kultusgemeinde, der politischen Gemeinde und Vereine sowie des
Distrikt-Rabbinates und Synagogenchores Würzburg mit Rücksicht auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse abgelehnt hatte, verlief dessen 50jährige
Jubelfeier in Stiller Weise im allerengsten Kreise. Eine Unmenge von
Zuschriften von Privaten sowie solche sehr ehrendem Inhalt liefen ein vom
Verband der Israelitischen Gemeinden Bayerns mit einer Ehrengabe, vom
Distrikt-Rabbinate Würzburg und ein sehr herzlich gehaltenes
Glückwunschschreiben der hiesigen politischen Gemeinde; das Schreiben der
letzteren ist ein erfreuliches Zeichen des schönen Verhältnisses der
drei Konfessionen in hiesiger Gemeinde. Möge dies weiter so
bleiben." |
Artikel von Lehrer Kissinger "Selbstachtung"
- Kritische Betrachtung (1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1923: "Selbstachtung.
Kritische Betrachtung von Hauptlehrer a.D. S. Kissinger in Urspringen.
Abwehr und Wiederaufbau! Unter diesen Zeichen steht heute das Streben des
deutschen Volkes! Für uns Juden ist es nicht nur eine nationale, sondern
auch eine religiöse Pflicht, an der Wiedergenesung unseres geliebten
Vaterlandes nach Kräften mitzuhelfen. Uns Juden aber, wenigstens denen,
denen das Judentum keine hohle Phrase, sondern ein unser ganzes Leben
durchdringendes Gesetz ist, obliegt noch eine andere Pflicht, d.i. Abwehr
und Wiederaufbau auf dem Gebiete des religiösen Lebens, Abwehr aller
destruktiven Bestrebungen, deren Endziel die Zersetzung des religiösen
Lebens ist und Wiederaufbau des durch die Zeitverhältnisse und den Krieg
stark in Mitleidenschaft gezogenen toratreuen Pflichtenlebens. Die
Auswirkung des Krieges nach dieser Richtung zeigt sich bei einem großen
Teil der Judenheit, auch bei einem Teil der sich noch orthodox nennenden,
in erschreckender Weise. Man hat keine Mittel mehr für die Mizwot
(Weisungen) an Pessach, für die Arba'a Minim am Sukkot-Fest
(Laubhüttenfest) und für die Lichter am Chanukka-Fest, für Mischloach
Manot (Geschenke geben) an Purim, für Anschaffung der Tefillin,
Talit und Mesusa, für die Erfüllung der heiligsten
Pflichten der Frauen ist bei vielen Alles zu teuer, im Hause sieht man
keine Tefila und Chumasch mehr, das Lesen einer jüdischen
Zeitschrift neben den Tagesblättern, die Anschaffung eines belehrenden
Buches aus religiöser Literatur wird als unmöglich bezeichnet und für
die Besoldung der Kultusbeamten, die Vertreter ihrer vitalsten
Angelegenheiten, hat man in vielen Gemeinden eine geradezu unbegreifliche
Hartherzigkeit und ein an Zynismus grenzendes Verhalten an den Tag gelegt.
Ich frage nun: Sagt man denn auch bei anderen Anforderungen des Lebens
auch sofort: Non possumus - das können wir nicht leisten? Leistet man
sich da nicht häufig mehr als das Allernotwendigste, auf das man sich
heute in den Nöten der Zeit beschränken sollte? Und wenn wir heute
vielfach über Missachtung des Judentums klagen hören, so frage ich:
Woher soll denn die Achtung kommen, wenn man in nichtjüdischen Kreisen
sieht, wie leichtfertig und arrogant man sich über die heiligsten
Religionsgesetze hinwegsetzt? Wie kann unser Ansehen erhalten werden, wenn
man seine engeren Beamten hungern und darben lässt, wenn man sie
Beschäftigungen in die Hände treibt, die absolut mit dem Stand
unvereinbar sind? Früher hat man den Opfersinn der Juden
behördlicherweise zum Öfteren öffentlich anerkannt, den sie für die
Erhaltung ihrer Bildungsan- Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1923: "Selbstachtung.
Kritische Betrachtung von Hauptlehrer a.D. S. Kissinger in Urspringen.
Abwehr und Wiederaufbau! Unter diesen Zeichen steht heute das Streben des
deutschen Volkes! Für uns Juden ist es nicht nur eine nationale, sondern
auch eine religiöse Pflicht, an der Wiedergenesung unseres geliebten
Vaterlandes nach Kräften mitzuhelfen. Uns Juden aber, wenigstens denen,
denen das Judentum keine hohle Phrase, sondern ein unser ganzes Leben
durchdringendes Gesetz ist, obliegt noch eine andere Pflicht, d.i. Abwehr
und Wiederaufbau auf dem Gebiete des religiösen Lebens, Abwehr aller
destruktiven Bestrebungen, deren Endziel die Zersetzung des religiösen
Lebens ist und Wiederaufbau des durch die Zeitverhältnisse und den Krieg
stark in Mitleidenschaft gezogenen toratreuen Pflichtenlebens. Die
Auswirkung des Krieges nach dieser Richtung zeigt sich bei einem großen
Teil der Judenheit, auch bei einem Teil der sich noch orthodox nennenden,
in erschreckender Weise. Man hat keine Mittel mehr für die Mizwot
(Weisungen) an Pessach, für die Arba'a Minim am Sukkot-Fest
(Laubhüttenfest) und für die Lichter am Chanukka-Fest, für Mischloach
Manot (Geschenke geben) an Purim, für Anschaffung der Tefillin,
Talit und Mesusa, für die Erfüllung der heiligsten
Pflichten der Frauen ist bei vielen Alles zu teuer, im Hause sieht man
keine Tefila und Chumasch mehr, das Lesen einer jüdischen
Zeitschrift neben den Tagesblättern, die Anschaffung eines belehrenden
Buches aus religiöser Literatur wird als unmöglich bezeichnet und für
die Besoldung der Kultusbeamten, die Vertreter ihrer vitalsten
Angelegenheiten, hat man in vielen Gemeinden eine geradezu unbegreifliche
Hartherzigkeit und ein an Zynismus grenzendes Verhalten an den Tag gelegt.
Ich frage nun: Sagt man denn auch bei anderen Anforderungen des Lebens
auch sofort: Non possumus - das können wir nicht leisten? Leistet man
sich da nicht häufig mehr als das Allernotwendigste, auf das man sich
heute in den Nöten der Zeit beschränken sollte? Und wenn wir heute
vielfach über Missachtung des Judentums klagen hören, so frage ich:
Woher soll denn die Achtung kommen, wenn man in nichtjüdischen Kreisen
sieht, wie leichtfertig und arrogant man sich über die heiligsten
Religionsgesetze hinwegsetzt? Wie kann unser Ansehen erhalten werden, wenn
man seine engeren Beamten hungern und darben lässt, wenn man sie
Beschäftigungen in die Hände treibt, die absolut mit dem Stand
unvereinbar sind? Früher hat man den Opfersinn der Juden
behördlicherweise zum Öfteren öffentlich anerkannt, den sie für die
Erhaltung ihrer Bildungsan- |
 stalten
an den Tag legten, heute dagegen lässt man sie untergehen und zum Teil
ein kümmerliches Dasein fristen. Wie oft schon haben nichtjüdische
Geistliche die Juden z.B. an der Beobachtung ihrer Sabbate und Feiertage
in ihren Predigten als Muster angeführt, heute scheuen sich oft junge
Leute nicht, an den Feiertagen und Samstagen ohne Rücksicht auf ihre
religiös-fühlenden Eltern anzukommen und abzureisen. Da ich gerade bei
der Nichtachtung unserer eigenen Sache stehe, möchte ich auf einen sehr
wunden Punkt hinweisen. gegen nichtjüdische Beamte zeigt man oft ein
geradezu von Seriosität strotzendes, rücksichtsvolles Benehmen, während
man häufig gegen die eigenen jüdischen Beamten mit einer geradezu
zynischen Gleichgültigkeit sich verhält. Ich bin gewiss der Letzte, der
die Verletzung der konventionellen Pflichten gegen Andersgläubige das
Wort redet und habe während meiner 45jährigen Dienstzeit zur Genüge
bewiesen, allein ich verlange die gleiche Rücksicht und Anerkennung auch
für den jüdischen Beamten sowohl in dienstlicher als auch in
gesellschaftlicher Hinsicht. Ich fasse meine Ausführungen in das Resümee
zusammen und sage: Selbstachtung müssen wir üben, Selbstachtung
bezüglich unserer religiösen Pflichten, Hochachtung gegen die eigenen
Beamten und ihre Bildungsstätten, Achtung all dessen, was den Juden erst
recht zu einem Juden stempelt. Wir müssen den von Herrn Regierungsrat
Goslar in einer Versammlung in Frankfurt am Main gemachten Ausführungen,
dass wir den Antisemitismus am besten bekämpfen, wenn wir alle ganze
Juden sind, uneingeschränkt beipflichten. stalten
an den Tag legten, heute dagegen lässt man sie untergehen und zum Teil
ein kümmerliches Dasein fristen. Wie oft schon haben nichtjüdische
Geistliche die Juden z.B. an der Beobachtung ihrer Sabbate und Feiertage
in ihren Predigten als Muster angeführt, heute scheuen sich oft junge
Leute nicht, an den Feiertagen und Samstagen ohne Rücksicht auf ihre
religiös-fühlenden Eltern anzukommen und abzureisen. Da ich gerade bei
der Nichtachtung unserer eigenen Sache stehe, möchte ich auf einen sehr
wunden Punkt hinweisen. gegen nichtjüdische Beamte zeigt man oft ein
geradezu von Seriosität strotzendes, rücksichtsvolles Benehmen, während
man häufig gegen die eigenen jüdischen Beamten mit einer geradezu
zynischen Gleichgültigkeit sich verhält. Ich bin gewiss der Letzte, der
die Verletzung der konventionellen Pflichten gegen Andersgläubige das
Wort redet und habe während meiner 45jährigen Dienstzeit zur Genüge
bewiesen, allein ich verlange die gleiche Rücksicht und Anerkennung auch
für den jüdischen Beamten sowohl in dienstlicher als auch in
gesellschaftlicher Hinsicht. Ich fasse meine Ausführungen in das Resümee
zusammen und sage: Selbstachtung müssen wir üben, Selbstachtung
bezüglich unserer religiösen Pflichten, Hochachtung gegen die eigenen
Beamten und ihre Bildungsstätten, Achtung all dessen, was den Juden erst
recht zu einem Juden stempelt. Wir müssen den von Herrn Regierungsrat
Goslar in einer Versammlung in Frankfurt am Main gemachten Ausführungen,
dass wir den Antisemitismus am besten bekämpfen, wenn wir alle ganze
Juden sind, uneingeschränkt beipflichten.
Erst wenn sich das Prophetenwort 'deine Zerstörer und Verwüster
ziehen fort von dir' (Jesaja 49,17), d.h. wie der unvergessliche
Mendel Hirsch übersetzt: wenn die, die dich zerstörten und niederreißen
wollen, aus dir verschwinden, erst dann wird für uns wieder das Morgenrot
besserer Tage anbrechen und die Selbstachtung wird uns auch die Achtung
unserer nichtjüdischen Mitmenschen als Lohn einbringen nach dem bekannten
Ausspruch (hebräisch und deutsch): 'Wer mich ehrt, den werde ich wieder
ehren lassen.'" |
Artikel von Lehrer Kissinger
"Die Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land" (1924)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Die
Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land. Von S. Kissinger,
Hauptlehrer a.D. in Urspringen. Es ist höchst erfreulich, dass sich
zurzeit vielfach Bestrebungen zeigen zur Hebung des jüdischen Wissens und
Lebens in Stadt und Land, denn es sind hier wie dort weite Kreise fast auf
dem Nullpunkt angelangt. Man suchte seither durch allerlei Vorträge eine
Besserung herbeizuführen, allein die Erfolge waren ähnlich wie bei den
Literaturvereinen so minimal, dass ein weiteres Beschreiten dieses Weges
nicht zu empfehlen ist. Die verschiedenen Vereinigungen suchen durch
Wanderredner und Wanderlehrer etwas zu erreichen. Die Leute auf dem Lande
z.B. sind aber nach des Tages Mühen weder geistig noch körperlich zum
Anhören eines gelehrten Vortrages disponiert; ähnlich wird es in den Städten
sein. So wurde mir erzählt, dass ein Redner, der seinen Vortrag
rechtzeitig angekündigt hatte, in einer 150 Seelen zählenden Gemeinde
vor einem halben Dutzend Menschen sprechen musste. Bei dem zurzeit
herrschenden Indifferentismus auf religiösem Gebiet und bei der
wirtschaftlichen Not braucht man sich über derartige Erscheinungen nicht
zu wundern. Wie soll nun eine Wandlung zum Besseren erzielt werden? In
erster Linie muss das Streben der maßgebenden Kreise, wozu auch die
Gemeinden gehören, darauf abzielen, Lernmöglichkeiten für die Jugend zu
schaffen, durch die es ihr möglich ist, ihr Schulwissen in den
Religionsfächern zu erweitern. Mit der Schaffung der Schulen bzw.
Unterrichtskurse muss aber auch darauf hingewirkt werden, dass die
Angehörigen zunächst sich selbst für die jüdischen Ideale
interessieren, dieses Interesse auf ihre Kinder übertragen und sie zur
Weiterbildung im jüdischen Schrifttum anhalten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Die
Hebung des jüdischen Lebens in Stadt und Land. Von S. Kissinger,
Hauptlehrer a.D. in Urspringen. Es ist höchst erfreulich, dass sich
zurzeit vielfach Bestrebungen zeigen zur Hebung des jüdischen Wissens und
Lebens in Stadt und Land, denn es sind hier wie dort weite Kreise fast auf
dem Nullpunkt angelangt. Man suchte seither durch allerlei Vorträge eine
Besserung herbeizuführen, allein die Erfolge waren ähnlich wie bei den
Literaturvereinen so minimal, dass ein weiteres Beschreiten dieses Weges
nicht zu empfehlen ist. Die verschiedenen Vereinigungen suchen durch
Wanderredner und Wanderlehrer etwas zu erreichen. Die Leute auf dem Lande
z.B. sind aber nach des Tages Mühen weder geistig noch körperlich zum
Anhören eines gelehrten Vortrages disponiert; ähnlich wird es in den Städten
sein. So wurde mir erzählt, dass ein Redner, der seinen Vortrag
rechtzeitig angekündigt hatte, in einer 150 Seelen zählenden Gemeinde
vor einem halben Dutzend Menschen sprechen musste. Bei dem zurzeit
herrschenden Indifferentismus auf religiösem Gebiet und bei der
wirtschaftlichen Not braucht man sich über derartige Erscheinungen nicht
zu wundern. Wie soll nun eine Wandlung zum Besseren erzielt werden? In
erster Linie muss das Streben der maßgebenden Kreise, wozu auch die
Gemeinden gehören, darauf abzielen, Lernmöglichkeiten für die Jugend zu
schaffen, durch die es ihr möglich ist, ihr Schulwissen in den
Religionsfächern zu erweitern. Mit der Schaffung der Schulen bzw.
Unterrichtskurse muss aber auch darauf hingewirkt werden, dass die
Angehörigen zunächst sich selbst für die jüdischen Ideale
interessieren, dieses Interesse auf ihre Kinder übertragen und sie zur
Weiterbildung im jüdischen Schrifttum anhalten.
Wie kann nun das Interesse für das Judentum in den Familien geweckt
werden. Ich glaube, unsere Führer des letzten und gegenwärtigen
Jahrhunderts haben uns den Weg gezeigt, indem sie ihre Geistesprodukte in gemeinfasslicher
Sprache schrieben, um sie so der großen Masse leichter zugänglich zu
machen. Greifen wir diesen Fingerzeig auf und sorgen wir dafür, dass die
Schriften in jedes jüdische Haus wandern. In keinem Hause sollten die
bekannten populären religionsgesetzlichen Schriften fehlen. Nicht zu
vergessen sei die weitgehendste Verbreitung auf dem Boden positiven
Schrifttums stehender, jüdischer Zeitschriften. Die Art und Weise, wie
die bekannten Schriften verbreitet werden sollen, hängt mit der Klugheit
und dem Takt der mit der Sache Betrauten ab.
Nun wird man mir einwenden, woher die Mittel nehmen zu dem großzügigen Unternehmen?
Dazu sei folgendes bemerkt. Wenn man die horrenden Beträge für
Wanderredner und Wanderlehrer, für deren Reisen und Verpflegung, für
Bereitstellung, Beheizung und Beleuchtung der Lokale usw., für die
Herstellung obengenannter Werke und entsprechender Zeitschriften verwenden
würde, so könnte man viele Tausende von Exemplaren in die Hände des
Publikums gelangen lassen. Außerdem wird sich so mancher Mäzen finden,
der für den Zweck eine Auflage eines guten Werkes veranlasst und zur
Verfügung stellt, wie dies ja z.B. in Frankfurt am Main schon öfters der
Fall war.
Ich bin der festen Überzeugung, dass in vielen Familien die anziehend
geschriebenen Schriften und Zeitschriften gerne gelesen werden, und dass
ein ganz neuer Geist in viele Familien getragen und so der Boden für das
eigentliche Lernen gründlich vorbereitet wird nach den Worten Jecheskel
(Hesekiel) Kap. 36 Vers 26: 'Ich werde euch geben ein neues Herz und
einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe
euch ein Herz von Fleisch'." |
Ergänzend eingestellt: Dokument zu Lehrer Kissinger von
1921 - Paketkarte:
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; Anmerkungen auf Grund
der Recherchen von P.K. Müller)
 Die
Paketkarte (zu einem Paket) aus dem Jahr 1921 wurde versandt am 25. März 1921 von Würzburg nach Urspringen an Herrn Hauptlehrer Kissinger.
Simon Kissinger wurde 1859 in Rödelsee
geboren. Er starb 1939.
Er war verheiratet mit Babette geb. Fränkel aus Urspringen, die
gleichfalls 1859 geboren ist und bereits 1919 starb. Sie war die Tochter von Salomon Fränkel und Breinle
geb. Klein. Die beiden hatten sieben Kinder: Salomon (geb. 13. März 1888, ermordet in Auschwitz am
15. Dezember 1942), Irma verheiratete Sonder (geb. 12.Oktober 1889,
gest. im August 1968 in New York), Ferdinand Kissinger (geb. 13. Oktober 1891, ermordet
25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Julius (geb. 7. November 1894, ermordet
25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Jenny verheiratete Neuhaus (geb. 1896, gestorben in Israel),
Bella verheiratete Oppenheimer (geb. 13. November 1897, gest. 1970 in New York),
Fanny verheiratete Stern (geb. 7. März 1903, ermordet 1942 in Riga, Litauen). Die
Paketkarte (zu einem Paket) aus dem Jahr 1921 wurde versandt am 25. März 1921 von Würzburg nach Urspringen an Herrn Hauptlehrer Kissinger.
Simon Kissinger wurde 1859 in Rödelsee
geboren. Er starb 1939.
Er war verheiratet mit Babette geb. Fränkel aus Urspringen, die
gleichfalls 1859 geboren ist und bereits 1919 starb. Sie war die Tochter von Salomon Fränkel und Breinle
geb. Klein. Die beiden hatten sieben Kinder: Salomon (geb. 13. März 1888, ermordet in Auschwitz am
15. Dezember 1942), Irma verheiratete Sonder (geb. 12.Oktober 1889,
gest. im August 1968 in New York), Ferdinand Kissinger (geb. 13. Oktober 1891, ermordet
25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Julius (geb. 7. November 1894, ermordet
25. November 1941 in Kaunas, Litauen), Jenny verheiratete Neuhaus (geb. 1896, gestorben in Israel),
Bella verheiratete Oppenheimer (geb. 13. November 1897, gest. 1970 in New York),
Fanny verheiratete Stern (geb. 7. März 1903, ermordet 1942 in Riga, Litauen).
Simon Kissinger war bereits 1878 als Lehrer in Urspringen tätig. 1903 - anlässlich seines 25 jährigen Dienstjubiläums
- wurde ihm seitens der Gemeinde Urspringen das Ehrenbürgerrecht verliehen. Nach Auflösung der israelitischen
Elementarschule Urspringen 1918 blieb Simon Kissinger weiter als Religionslehrer in Urspringen. 1928 konnte er unter
großer Anerkennung und Würdigung seines langjährigen und unermüdlichen fruchtbaren Wirkens von allen Seiten sein
50-jähriges Dienstjubiläum feiern. Simon Kissinger war auch Gründungsmitglied des "Israelitischen Lehrervereins in Bayern".
Quellen: https://www.geni.com/people/Simon-Kissinger/6000000035618480244
http://www.main-echo.de/regional/kreis-main-spessart/art11878,3446294
http://www.main-echo.de/regional/kreis-main-spessart/art4018,859643
https://www.bllv.de/index.php?id=7729&einzelname=Kissinger,%20Simon
http://tablet.main-netz.de/regional/kreis-main-spessart/art11878,3872844
http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_germany/ger1_00398.html |
Ausschreibung der Lehrerstelle nach der Zurruhesetzung von Lehrer Kissinger 1929
 Zeitschrift "Der
Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde
Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei
gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der
gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem
staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat
sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht
Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand
einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben
dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der
Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der
Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung. Zeitschrift "Der
Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde
Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei
gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der
gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem
staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat
sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht
Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand
einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des
Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben
dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der
Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der
Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung.
Urspringen, den 7. Juni 1929. Der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde Urspringen. Bernhard Dillenberger. |
| |
 Dieselbe
Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. Dieselbe
Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. |
Aus dem jüdischen Gemeinde-
und Vereinsleben
80jähriges Bestehen der Chewra (Wohltätigkeits- und
Bestattungsverein) (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1931:
"Urspringen, 16. März (1931). Die Chewra konnte am 27. Adar (= 16.
März 1931) auf ihr 80jähriges Bestehen zurückblicken. Die Chewra wurde
im Jahre 1851 durch Herrn Lehrer Heilner (nicht: Frilner!) gegründet und sind die von dem
Gründer wunderbar ausgearbeiteten Statuten fast alle heute noch maßgebend.
Derzeitiger Kassierer ist Justin Adler, der das Amt seit 7 Jahren
bekleidet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1931:
"Urspringen, 16. März (1931). Die Chewra konnte am 27. Adar (= 16.
März 1931) auf ihr 80jähriges Bestehen zurückblicken. Die Chewra wurde
im Jahre 1851 durch Herrn Lehrer Heilner (nicht: Frilner!) gegründet und sind die von dem
Gründer wunderbar ausgearbeiteten Statuten fast alle heute noch maßgebend.
Derzeitiger Kassierer ist Justin Adler, der das Amt seit 7 Jahren
bekleidet." |
Vorstandswahlen (1936!)
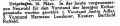 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1936: "Urspringen,
16. März (1936). In der heute vorgenommenen Neuwahl für den Vorstand der
hiesigen Kultusgemeinde wurden gewählt: 1. Vorstand Justin Adler, 2.
Vorstand Hermann Landauer, Kassier: Berthold
Rotfeld." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1936: "Urspringen,
16. März (1936). In der heute vorgenommenen Neuwahl für den Vorstand der
hiesigen Kultusgemeinde wurden gewählt: 1. Vorstand Justin Adler, 2.
Vorstand Hermann Landauer, Kassier: Berthold
Rotfeld." |
| |
Anmerkung: der genannte 2. Vorstand - Landwirt
und Viehhändler - Hermann Landauer (geb. 1892) lebte mit seiner
Frau Hilda geb. Adler (aus Laudenbach) und Sohn Isfried in
der heutigen Grabengasse in Urspringen. In der NS-Zeit bemühte sich die
Familie um eine Auswanderung in die USA. Der Sohn Isfried konnte 1939
über Russland nach Palästina emigrieren. Das Ehepaar Landauer wurde
jedoch mit 40 weiteren Juden aus Urspringen am 25. April 1942 nach Polen
deportiert (umgekommen im KZ Belzec). Von der Familie Landauer ist ein
Koffer mit persönlichen Gegenständen erhalten.
Artikel von Heidi Vogel in der "Main-Post" vom 31. Juli 2015:
"Überseekoffer erzählt eine traurige Geschichte" (Link
zum Artikel). |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod des aus Urspringen stammenden Rabbiners Samuel Wormser (1892)
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1892: "Nekrolog. Anfangs April brachten diese Blätter die traurige Kunde
von dem Ableben des Gersfelder
Distriktrabbiners Wormser – das Andenken an den Gerechten ist zu Segen
-. Der ausdrückliche Wunsch des bescheidenen Entschlafenen verbot der
kurzen Notiz einen wohlverdienten Nekrolog beizufügen. Heute, nachdem die
Trauertage verflossen, können wir es uns jedoch nicht versagen, des edlen
Toten nochmals in kurzen Worten zu gedenken. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Mai 1892: "Nekrolog. Anfangs April brachten diese Blätter die traurige Kunde
von dem Ableben des Gersfelder
Distriktrabbiners Wormser – das Andenken an den Gerechten ist zu Segen
-. Der ausdrückliche Wunsch des bescheidenen Entschlafenen verbot der
kurzen Notiz einen wohlverdienten Nekrolog beizufügen. Heute, nachdem die
Trauertage verflossen, können wir es uns jedoch nicht versagen, des edlen
Toten nochmals in kurzen Worten zu gedenken.
Was Rabbiner Wormser für die große Welt gewesen, das aufzuführen ist
wohl unnötig. Jedermann weiß, mit welch aufopfernder Liebe er vierzig
Jahre lang sich den Sammlungen von Beiträgen für palästinische Zwecke
unterzogen. Selbst hervorgegangen aus einer wenig bemittelten
Lehrerfamilie, kannte er aus eigener früherer Erfahrung das Herz der bedürftigen
Armen und nie verließ ein Armer unbeschenkt sein Haus und ohne, dass der
Verschiedene ihn nach Maßstab der eigenen Vermögensverhältnisse
beschenkt hatte. Trotz des bescheidensten Gehalts überwies der Edle seine
Trauungsgebühren meist der verschämten Armut, sich persönlich nur das
unumgänglich Notwendigste gönnend. Obwohl er durch seine 50jährige
Amtstätigkeit zur Überweisung der ‚Ludwigsmedaille’ berechtigt war,
machte er von einer diesbezüglichen Bewerbung keinen Gebrauch.
Zu Urspringen in Unterfranken
geboren, erreichte Rabbiner Wormser – das Andenken an den Gerechten
ist zum Segen – das hohe Alter von 85 Jahren. Der Verstorbene
hinterließ 6 Kinder, von denen einer, Herr Lehrer Leopold Wormser der rührige
Direktor des Dinslaker Waisenhauses ist. Gott möge die trauernden
Hinterbliebenen trösten. Die Gersfelder Gemeinde aber, deren Seelenhirt
der Verblichene während seiner ganzen Amtsdauer war, ist durch doppelte
Weise Gelegenheit geboten, ihren heimgegangenen Rabbiner zu ehren und zwar
einerseits durch Beherzigung der Lehren und des Lebens desselben und
andererseits, indem sie der Witwe desjenigen, der so lange für sie
gearbeitet – den Abend ihres Lebens durch ausreichende Pension
erheitern." |
Zum Tod des jüdischen Arztes Dr. M. Drey, 54 Jahre Arzt in Urspringen
(1885)
 Artikel
aus der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 11. Mai 1885: "Urspringen, 1. Mai
(1885). Heute wurde der nach kurzem Krankenlager dahier verschiedene Herr Dr. M.
Drey zur letzten Ruhe nach Laudenbach verbracht. Der Verstorbene, der seit 54
Jahren hier mit den schönsten Erfolgen wirkte, stand bei allen, die ihn näher
kannten, in größter Achtung. eine große Menschenmenge begleitete die Leiche
und als erst der herbeigeeilte Herr Rabbiner Bamberger aus Würzburg in
ergreifenden Worten die Verdienste des Dahingeschiedenen um die leidende
Menschheit schilderte, blieb fast kein Auge tränenleer. War doch der Verlebte
ein äußerst pflichttreuer, gewissenhafter Arzt, ein treuer Ratgeber Aller, die
ihn aufsuchten; ja sogar in der Beobachtung seiner religiösen Pflichten ließ
er sich, nur in dringenden Fällen ausgenommen, nicht stören. Trotz seines sehr
hohen Alters besuchte er noch bis zuletzt in seiner ausgedehnten Praxis
regelmäßig seine Patienten. Auch für die Armen hatte er stets eine offene
Hand, aber immer nur da, wo er überzeugt war, dass Almosengeben am Platz war.
Möge er in jener Welt den Lohn seiner Taten reichlich ernten" Artikel
aus der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 11. Mai 1885: "Urspringen, 1. Mai
(1885). Heute wurde der nach kurzem Krankenlager dahier verschiedene Herr Dr. M.
Drey zur letzten Ruhe nach Laudenbach verbracht. Der Verstorbene, der seit 54
Jahren hier mit den schönsten Erfolgen wirkte, stand bei allen, die ihn näher
kannten, in größter Achtung. eine große Menschenmenge begleitete die Leiche
und als erst der herbeigeeilte Herr Rabbiner Bamberger aus Würzburg in
ergreifenden Worten die Verdienste des Dahingeschiedenen um die leidende
Menschheit schilderte, blieb fast kein Auge tränenleer. War doch der Verlebte
ein äußerst pflichttreuer, gewissenhafter Arzt, ein treuer Ratgeber Aller, die
ihn aufsuchten; ja sogar in der Beobachtung seiner religiösen Pflichten ließ
er sich, nur in dringenden Fällen ausgenommen, nicht stören. Trotz seines sehr
hohen Alters besuchte er noch bis zuletzt in seiner ausgedehnten Praxis
regelmäßig seine Patienten. Auch für die Armen hatte er stets eine offene
Hand, aber immer nur da, wo er überzeugt war, dass Almosengeben am Platz war.
Möge er in jener Welt den Lohn seiner Taten reichlich ernten"
|
Zum Tod von Särche Schloß geb.
Weigersheimer aus Heßdorf (1891)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1891:
"Urspringen. Am Ausgang des Heiligen Schabbat, dem 14. Marcheschwan
(= 14. November 1891) starb hier Frau Särche Schloss geb. Weigersheimer
aus Heßdorf. Aus einem für alles
Jüdische begeisterten Hause stammend, ausgerüstet mit einem bei Frauen
seltenen Wissen aus unserer Heiligen Literatur, erfahren in allen Zweigen
der wichtigsten Religionsvorschriften, getragen von einer seltenen
Begeisterung für diem heilige Tora war sie das Muster eines echt
jüdischen Weibes, einer tüchtigen Gattin und einer zärtlichen Mutter.
Gastfreundschaft zu üben, Torabeflissene zu beehren und deren
Bestrebungen zu unterstützen, der Besuch des Gottesdienstes an Werk- und
Feiertagen, die peinlichste Gewissenhaftigkeit in den Pflichten ihres
Wirkungskreises waren Eigenschaften, die sie in hohen Maße
auszeichneten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1891:
"Urspringen. Am Ausgang des Heiligen Schabbat, dem 14. Marcheschwan
(= 14. November 1891) starb hier Frau Särche Schloss geb. Weigersheimer
aus Heßdorf. Aus einem für alles
Jüdische begeisterten Hause stammend, ausgerüstet mit einem bei Frauen
seltenen Wissen aus unserer Heiligen Literatur, erfahren in allen Zweigen
der wichtigsten Religionsvorschriften, getragen von einer seltenen
Begeisterung für diem heilige Tora war sie das Muster eines echt
jüdischen Weibes, einer tüchtigen Gattin und einer zärtlichen Mutter.
Gastfreundschaft zu üben, Torabeflissene zu beehren und deren
Bestrebungen zu unterstützen, der Besuch des Gottesdienstes an Werk- und
Feiertagen, die peinlichste Gewissenhaftigkeit in den Pflichten ihres
Wirkungskreises waren Eigenschaften, die sie in hohen Maße
auszeichneten." |
25-jähriges Jubiläum von Lion Adler als Vorstand der Gemeinde (1907)
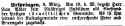 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:
"Urspringen, 8. März (1907). Am 19. dieses Monats begeht Herr Lion
Adler sein 25jähriges Jubiläum als Vorstand der hiesigen israelitischen
Gemeinde. Es ist ihm seitens der Kultusgemeinde eine entsprechende Feier
und Ehrengabe zugedacht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:
"Urspringen, 8. März (1907). Am 19. dieses Monats begeht Herr Lion
Adler sein 25jähriges Jubiläum als Vorstand der hiesigen israelitischen
Gemeinde. Es ist ihm seitens der Kultusgemeinde eine entsprechende Feier
und Ehrengabe zugedacht." |
Eisernes Kreuz für den Weltkriegsteilnehmer Rudolf
Dillenberger (1914)
 Meldung
aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16.
Oktober 1914: "Urspringen. Artillerist Rudolf Dillenberger, Sohn des
Gutsbesitzers Bernhard Dillenberger erhielt das Eiserne
Kreuz". Meldung
aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16.
Oktober 1914: "Urspringen. Artillerist Rudolf Dillenberger, Sohn des
Gutsbesitzers Bernhard Dillenberger erhielt das Eiserne
Kreuz".
|
Ergänzend eingestellt: Grabstein für den im Ersten Weltkrieg gefallenen
Freudenreich (1915; Grab im jüdischen
Friedhof Laudenbach)
(Foto von Georg Schnabel, Laudenbach; erhalten über
Uri Kellermann; Übersetzung von Uri Kellermann)
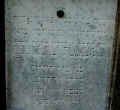 Links: hebräische Grabsteininschrift in Laudenbach
für den an seinen als Soldat erlittenen Verwundungen gestorbenen Friedrich
Philipp Freudenreich (geb. 20. Oktober 1888 in Urspringen, gestorben
am 5. Juli 1915). Übersetzung der Inschrift: "Hier ist begraben /
Jizchak Sohn des Schlomo Freudenreich / aus Urspringen; er ist gestorben
am 23. Tammuz (5. Juli) in Köln / und wurde begraben in der
Grabstätte seiner Väter mit einer Trauerrede und mit großer Ehre / am
Freitag 27. desselben 675 nach der kleinen Zählung (9. Juli 1915)
/ Die edlen Kinder Zions (Klagelieder Jeremias 4,2) / (sind) durchs
Schwert Erschlagene. / Zum Militär ist er gegangen / und Ruhe hat er
gefunden /."
Links: hebräische Grabsteininschrift in Laudenbach
für den an seinen als Soldat erlittenen Verwundungen gestorbenen Friedrich
Philipp Freudenreich (geb. 20. Oktober 1888 in Urspringen, gestorben
am 5. Juli 1915). Übersetzung der Inschrift: "Hier ist begraben /
Jizchak Sohn des Schlomo Freudenreich / aus Urspringen; er ist gestorben
am 23. Tammuz (5. Juli) in Köln / und wurde begraben in der
Grabstätte seiner Väter mit einer Trauerrede und mit großer Ehre / am
Freitag 27. desselben 675 nach der kleinen Zählung (9. Juli 1915)
/ Die edlen Kinder Zions (Klagelieder Jeremias 4,2) / (sind) durchs
Schwert Erschlagene. / Zum Militär ist er gegangen / und Ruhe hat er
gefunden /." |
Goldene Hochzeiten von Nathan Fränkel und Hannchen geb. Sauer sowie Abraham
Dillenberger und Jeanette geb. Schloß (1925)
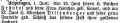 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1925: "Urspringen,
1. Juni (1925). Am 15. Juni fern H. Nathan Fränkel und seine Frau
Hannchen geb. Sauer, und am 22. Juni H. Abraham Dillenberger und seine
Frau Jeanette geb. Schloß das seltene Fest ihrer goldenen Hochzeit." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Juni 1925: "Urspringen,
1. Juni (1925). Am 15. Juni fern H. Nathan Fränkel und seine Frau
Hannchen geb. Sauer, und am 22. Juni H. Abraham Dillenberger und seine
Frau Jeanette geb. Schloß das seltene Fest ihrer goldenen Hochzeit." |
Mitteilung über den aus Urspringen stammenden Lehrer Ferdinand Kissinger (1929)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1926: "Urspringen,
17. November (1926). Der hier gebürtige, an der israelitischen
Volksschule in München angestellte Lehrer Ferdinand Kissinger wurde von
der Regierung von Oberbayern zum Hauptlehrer befördert." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1926: "Urspringen,
17. November (1926). Der hier gebürtige, an der israelitischen
Volksschule in München angestellte Lehrer Ferdinand Kissinger wurde von
der Regierung von Oberbayern zum Hauptlehrer befördert." |
Zum 60. Geburtstag von Lina Adler (1931)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1931:
"Urspringen, 8. März (1931). Eine der beliebtesten und angesehensten
Frauen unseres Ortes, Frau Lina Adler Wwe. Feiert am 25. Adar ihren 60.
Geburtstag. Frau Adler ist eine Frau von echt jüdischer Frömmigkeit.
Seit 14 Jahren bekleidet sie das Kassieramt des Israelitischen
Frauenvereins in gewissenhafter und mustergültiger Weise. Gott möge sie
noch lange Jahre gesund und frisch erhalten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1931:
"Urspringen, 8. März (1931). Eine der beliebtesten und angesehensten
Frauen unseres Ortes, Frau Lina Adler Wwe. Feiert am 25. Adar ihren 60.
Geburtstag. Frau Adler ist eine Frau von echt jüdischer Frömmigkeit.
Seit 14 Jahren bekleidet sie das Kassieramt des Israelitischen
Frauenvereins in gewissenhafter und mustergültiger Weise. Gott möge sie
noch lange Jahre gesund und frisch erhalten." |
Zur Goldenen Hochzeit von Bernhard Dillenberger und Betty geb. Frank (1933)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1933:
"Urspringen, 13. Juli (1933). Am 19. Juli feierten die Eheleute
Bernhard Dillenberger und Frau Betty geb. Frank in Urspringen bei
Karlstadt am Main das seltene Fest der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare
befinden sich noch bei bester Gesundheit und feierten an diesem Tage im
engsten Familienkreise mit ihren Kindern und Enkeln dieses Freudenfest.
Fünf Söhne der Jubilare kämpften fürs Vaterland." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juli 1933:
"Urspringen, 13. Juli (1933). Am 19. Juli feierten die Eheleute
Bernhard Dillenberger und Frau Betty geb. Frank in Urspringen bei
Karlstadt am Main das seltene Fest der Goldenen Hochzeit. Die Jubilare
befinden sich noch bei bester Gesundheit und feierten an diesem Tage im
engsten Familienkreise mit ihren Kindern und Enkeln dieses Freudenfest.
Fünf Söhne der Jubilare kämpften fürs Vaterland." |
| |
 Links:
Grabsteine von Bernhard Dillenberger (gest. 1939) und Betty Dillenberger
geb. Frank (gest. 1936) auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach. Links:
Grabsteine von Bernhard Dillenberger (gest. 1939) und Betty Dillenberger
geb. Frank (gest. 1936) auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach. |
Über den Maler Clemens Fränkel, dessen Vorfahren aus
Urspringen stammten (1872- umgekommen nach Deportation)
 Clemens Fränkel
(Abbildung links: eine der zahlreichen Kopien des Fränkel-Stammbaums;
Quelle: Stadtarchiv Zürich) war ein bekannter
Landschaftsmaler. Er ist am 11. Juni 1872 in Frankfurt am Main geboren.
Sein Vater, der Kaufmann David Fränkel stammte aus Urspringen und
hatte sich in Frankfurt niedergelassen. Seine Mutter Hedwig geb.
Fränkel ist zwar in München geboren, stammte aber aus der bekannten
Urspringener Familie Fränkel. Clemens Fränkel war seit 1898 Student an
der Münchner Kunstakademie. Nach seiner Ausbildung war er mit großem
Erfolg als Kunstmaler tätig. Von 1908 bis 1915 führte er eine Schule
für Landschaftsmalerei in Leoni am Starnberger See. Auf zahlreichen
Ausstellungen (u.a. Frankfurter Kunstverein, Münchner Glaspalast) wurden
Werke von ihm gezeigt. Seit 1929 lebte Clemens Fränkel in
Ohlstadt bei
Garmisch-Partenkirchen. Ab 1937 lebte er mit seinem Sohn Kurt im
italienischen Cortina d'Ampezzo. Hier wurden beide am 11. Januar 1944 von
deutscher Gendarmerie festgenommen. Clemens Fränkel kam in
"Schutzhaft" nach Bozen, später in das Gefängnis von Trient,
danach in das Durchgangslager Fòssoli bei Carpi. Am 19. und 22. Februar
wurde er mit anderen Gefangenen ins Vernichtungslager Auschwitz
deportiert. Er wurde vermutlich noch Ende Februar 1944 in Auschwitz
ermordet. Clemens Fränkel
(Abbildung links: eine der zahlreichen Kopien des Fränkel-Stammbaums;
Quelle: Stadtarchiv Zürich) war ein bekannter
Landschaftsmaler. Er ist am 11. Juni 1872 in Frankfurt am Main geboren.
Sein Vater, der Kaufmann David Fränkel stammte aus Urspringen und
hatte sich in Frankfurt niedergelassen. Seine Mutter Hedwig geb.
Fränkel ist zwar in München geboren, stammte aber aus der bekannten
Urspringener Familie Fränkel. Clemens Fränkel war seit 1898 Student an
der Münchner Kunstakademie. Nach seiner Ausbildung war er mit großem
Erfolg als Kunstmaler tätig. Von 1908 bis 1915 führte er eine Schule
für Landschaftsmalerei in Leoni am Starnberger See. Auf zahlreichen
Ausstellungen (u.a. Frankfurter Kunstverein, Münchner Glaspalast) wurden
Werke von ihm gezeigt. Seit 1929 lebte Clemens Fränkel in
Ohlstadt bei
Garmisch-Partenkirchen. Ab 1937 lebte er mit seinem Sohn Kurt im
italienischen Cortina d'Ampezzo. Hier wurden beide am 11. Januar 1944 von
deutscher Gendarmerie festgenommen. Clemens Fränkel kam in
"Schutzhaft" nach Bozen, später in das Gefängnis von Trient,
danach in das Durchgangslager Fòssoli bei Carpi. Am 19. und 22. Februar
wurde er mit anderen Gefangenen ins Vernichtungslager Auschwitz
deportiert. Er wurde vermutlich noch Ende Februar 1944 in Auschwitz
ermordet. |
| |
- Presseartikel von Martin Harth im
"Main-Echo" vom 27. Januar 2015: "Von Urspringen in die
ganze Welt. Chronik: Stammbaum der jüdischen Familie Fränkel mit
Wurzeln auf der Fränkischen Platte..."
Link
zum Artikel (gebührenpflichtig)
- Presseartikel von Martin Harth in der "Main-Post" vom 27.
Januar 2015: "Die Enge der Heimat verlassen. Familien-Stammbaum.
Der Maler Clemens Fränkel hinterließ der Nachwelt ein einmaliges
Dokument über seine jüdische Familie, die aus Urspringen stammt. Er
starb in Auschwitz..." Link
zum Artikel
- Artikel über Clemens Fränkel bei http://www.antikbayreuth.de/kuenstlerverzeichnis/Kunstler_A-H/Frankel_Clemens_1872_Frankfurt/frankel_clemens_1872_frankfurt.html
- Artikel über Clemens Fränkel bei http://members.gaponline.de/alois.schwarzmueller/juden_in_gap_biographien/fraenkel_clemens.htm
- vgl. auch den Artikel von Leonhard Scherg: Eine Reihe durch Kunst und
Kultur. In: Main Spessart bunterleben (Mediaprinz Paderborn) 2014 S.
10-17. Online
einsehbar.
- Artikel von Olaf Nöller in RP-online vom 4. März 2016 "Serie Denkanstoß -
Abgründe im Wohnzimmer"
Link zum Artikel |
| |
| Literaturhinweis: Thomas Steppan:
Clemens Fränkel (1872-1944). In: Marjan Cescutti / Josef Riedmann
(Hrsg.): Erhalten und erforschen. Festschrift für Helmut Stampfer.
Innsbruck 2013 S. 143-164. |
| |
Abbildungen
(aus der Sammlung
von Martin Harth) |
 |
 |
 |
 |
| |
Portraitskizze von
Clemens Fränkel
(nach einem Foto aus den 1930er-Jahren
gezeichnet von Valentina Harth) |
Sommerwiese
(Gemälde in der Sammlung
von Martin Harth) |
Postkarten: "Völkerkrieg
1914-15";
links mit Titel: "Ulanenvorposten beim Abkochen"
rechts: "Gut Freund" |
Über den aus Urspringen stammenden Lehrer Joseph Klein
(1873-1940)
Lehrer Joseph
Klein
(1873-1940) mit Frau Emma geb. Ermann
(1877- umgekommen nach
Deportation) |
 |
 |
Foto
links (Quelle Weirich/Stoll s.Lit. bei Rhaunen S. 48): Lehrer Joseph Klein (geb. 1873 in
Urspringen, Ausbildung an der
Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg bis 1891): seit 1895
Lehrer in Rhaunen; war verheiratet mit Emma geb. Ermann;
Lehrer Klein
starb am 10.11.1940; seine Frau wurde am 15.10.1941 über Trier deportiert
und ist umgekommen; auf dem Foto rechts (
Quelle: ebd.) das ehemalige Wohnhaus der Familie
Klein in Rhaunen in der Salzengasse 13. |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von
Distriktrabbiner Bamberger, Würzburg (1884)
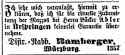 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ich
sehe mich veranlasst, hiermit zu erklären, dass ich für die rituelle
Zubereitung der Mazzos bei Herrn Bäcker Adler in Urspringen
keinerlei Garantie übernehme. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ich
sehe mich veranlasst, hiermit zu erklären, dass ich für die rituelle
Zubereitung der Mazzos bei Herrn Bäcker Adler in Urspringen
keinerlei Garantie übernehme.
Distiktsrabbiner Bamberger, Würzburg." |
Anzeige des Putz-, Mode-
und Weißwarengeschäftes Abraham Adler (1890)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1890: "Ein
mit der Putz-, Mode- und Weißwarenbranche vertrautes Mädchen sucht in
einem an Sonn- (gemeint wohl Schabbat!) und Feiertagen
geschlossenen Geschäfte Stelle als Volontärin. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. August 1890: "Ein
mit der Putz-, Mode- und Weißwarenbranche vertrautes Mädchen sucht in
einem an Sonn- (gemeint wohl Schabbat!) und Feiertagen
geschlossenen Geschäfte Stelle als Volontärin.
Offerten beliebe man an Abraham Adler, Urspringen bei Karlstadt am Main zu
senden." |
Verlobungsanzeige von Bella
Kissinger und Karl Oppenheimer (1926)
Anmerkung: Karl Oppenheimer war Lehrer in
Eiterfeld, Bella geb. Kissinger war eine Tochter von Lehrer Simon Kissinger.
Genealogische Informationen (mit Foto von Bella) siehe
https://www.geni.com/people/Bella-Oppenheimer/6000000035618516462. Bella
geb. Kissinger ist am 13. November 1897 in Urspringen geboren und 1970 in New
York N.Y./USA gestorben.
 Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt
sei Gott. Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt
sei Gott.
Bella Kissinger - Karl Oppenheimer Volksschullehrer.
Verlobte
Urspringen Dezember 1925 Tewet 5686
Eiterfeld -
Gersfeld." |
Doppel-Verlobungsanzeige von Friedl Adler und Jacob
Schönfärber sowie Lina Schönfärber und Justin Adler (1930)
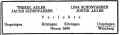 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1930:
"Friedl Adler - Jacob Schönfärber Lina
Schönfärber - Justin Adler.
Verlobte.
Urspringen - Kitzingen - Kitzingen -
Urspringen/Würzburg. Nissan 5690." |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
für den in Urspringen
geborenen Joseph Klein |
 |
|
| |
Kennkarte (ausgestellt
in Mainz 1939) für Joseph Klein (geb. 27. Dezember 1880 in
Urspringen),
Verwalter, wohnhaft in Ingelheim am Rhein
und Mainz, am 27. September 1942 deportiert ab Darmstadt
in das Ghetto Theresienstadt, am 19. Oktober 1944 in das Vernichtungslager
Auschwitz, ermordet |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Die erste Synagoge wurde noch im 17. Jahrhundert als
kleinerer Fachwerkbau errichtet (erste Erwähnung 1702).
1803 wurde im frühklassizistischen Stil eine neue Synagoge auf dem Grundstück
der bisherigen Synagoge erstellt, die bis zur Schändung beim Novemberpogrom
1938 Zentrum des jüdischen Gemeindelebens bleiben sollte. Beim Bau der
neuen Synagoge sollen Steine des 1802 abgebrochenen Teiles des Urspringener
Schlosses verwendet worden sein. Ein größerer Umbau der Synagoge fand 1860
statt. Bis dahin waren die Bima (Almemor) mit dem Vorlesepult in der Mitte des
Raumes; seitdem wurde sie mehr in die Nähe des Toraschreines gerückt. Die
mobilen Betständer (Stehpulte) wurden durch Bankreihen ersetzt.
1932 wurde die Synagoge letztmals renoviert.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von SA-Männern aufgebrochen,
die Torarollen wurden hinausgeworfen und aufgerollt über die Straße
geschleift. Andere Ritualien wurden zur Kreisleitung der NSDAP nach
Marktheidenfeld gebracht. Es ist nicht bekannt, was mit ihnen geschah.
Nach 1945:
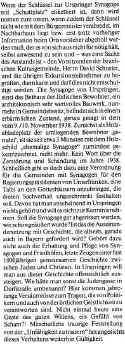 Nach
1945 blieb zwar das Gebäude der Synagoge stehen, doch war der Umgang mit diesem
Haus und der jüdischen Geschichte des Ortes jahrzehntelang mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Dies geht noch aus einem Artikel hervor, in dem
über eine im Herbst 1985 durchgeführte Exkursion der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken und die Erlebnisse in
Urspringen berichtet wird (Artikel aus: "Der Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern" Dezember 1985 S. 8-9): "...
Wenn der Schlüssel zur Urspringer Synagoge mit 'Schuttplatz' etikettiert ist,
dann wird Nomen zum Omen, wenn zudem der Schlüssel nicht wie mit dem
Bürgermeister verabredet, im Nachbarhaus liegt beziehungsweise erst trotz
vorheriger Information beim Ortsvorsteher abgeholt werden muss, der es von sich
aus nicht für nötig hält, selbst anwesend zu sein und - was eine Sache des
Anstandes ist - den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Herrn David
Schuster, und die übrigen Exkursionsteilnehmer zu begrüßen, dann kann und
darf dies nicht entschuldigt werden. Die Synagoge von Urspringen, einst das
Bethaus der Jüdischen Bewohner, ein architektonisch sehr wertvolles Bauwerk,
nunmehr in Gemeindebesitz, befindet sich in einem erbärmlichen Zustand, genau
gesagt in dem vom 9./10. November 1938. Zunächst als Holzabladeplatz der
umliegenden Bewohner 'genutzt', ist sie seit etwa 3 Monaten mit dem Holzschild
'Ehemalige Synagoge' zumindest gekennzeichnet, nicht mehr. Kein Wort über die
Zerstörung und Schändung im Jahre 1938. Schließlich gibt es doch dazu eine
Verordnung für die Gemeinden mit Synagogen für den Regierungspräsidenten von
Unterfranken, eine Tafel an den Gotteshäusern anzubringen, die diesen
Sachverhalt ungeschminkt festhalten soll. Davon hat man anscheinend in
Urspringen nicht gehört und will es nicht zur Kenntnis nehmen. Soll die
Synagoge gar abgerissen werden, wie schon geäußert wurde? Ist das die
Auseinandersetzung mit Geschichte, die allseits, gerade auch in Bayern gefordert
wird? Gehört dazu nicht auch die Erhaltung und Pflege von Synagogen und
Friedhöfen, letzte Zeugen einer fast 1000jährigen gemeinsamen Geschichte
zwischen Juden und Christen. In Urspringen will man aus dieser Geschichte
offensichtlich aussteigen. Wie hätte man sonst die Judengasse in Dorfstraße
umbenannt? Hier kommen jahrelange Versäumnisse zum tragen, die von Politikern
und auch von der örtlichen Geistlichkeit zu verantworten sind. Nicht einmal
heute eine Geste des guten Willens, ein Gefühl von Scham?! Mitscherlichs
traurige Feststellung von der 'Unfähigkeit zu trauern' hat angesichts dieses
Verhaltens weiterhin Gültigkeit." Nach
1945 blieb zwar das Gebäude der Synagoge stehen, doch war der Umgang mit diesem
Haus und der jüdischen Geschichte des Ortes jahrzehntelang mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Dies geht noch aus einem Artikel hervor, in dem
über eine im Herbst 1985 durchgeführte Exkursion der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken und die Erlebnisse in
Urspringen berichtet wird (Artikel aus: "Der Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern" Dezember 1985 S. 8-9): "...
Wenn der Schlüssel zur Urspringer Synagoge mit 'Schuttplatz' etikettiert ist,
dann wird Nomen zum Omen, wenn zudem der Schlüssel nicht wie mit dem
Bürgermeister verabredet, im Nachbarhaus liegt beziehungsweise erst trotz
vorheriger Information beim Ortsvorsteher abgeholt werden muss, der es von sich
aus nicht für nötig hält, selbst anwesend zu sein und - was eine Sache des
Anstandes ist - den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Herrn David
Schuster, und die übrigen Exkursionsteilnehmer zu begrüßen, dann kann und
darf dies nicht entschuldigt werden. Die Synagoge von Urspringen, einst das
Bethaus der Jüdischen Bewohner, ein architektonisch sehr wertvolles Bauwerk,
nunmehr in Gemeindebesitz, befindet sich in einem erbärmlichen Zustand, genau
gesagt in dem vom 9./10. November 1938. Zunächst als Holzabladeplatz der
umliegenden Bewohner 'genutzt', ist sie seit etwa 3 Monaten mit dem Holzschild
'Ehemalige Synagoge' zumindest gekennzeichnet, nicht mehr. Kein Wort über die
Zerstörung und Schändung im Jahre 1938. Schließlich gibt es doch dazu eine
Verordnung für die Gemeinden mit Synagogen für den Regierungspräsidenten von
Unterfranken, eine Tafel an den Gotteshäusern anzubringen, die diesen
Sachverhalt ungeschminkt festhalten soll. Davon hat man anscheinend in
Urspringen nicht gehört und will es nicht zur Kenntnis nehmen. Soll die
Synagoge gar abgerissen werden, wie schon geäußert wurde? Ist das die
Auseinandersetzung mit Geschichte, die allseits, gerade auch in Bayern gefordert
wird? Gehört dazu nicht auch die Erhaltung und Pflege von Synagogen und
Friedhöfen, letzte Zeugen einer fast 1000jährigen gemeinsamen Geschichte
zwischen Juden und Christen. In Urspringen will man aus dieser Geschichte
offensichtlich aussteigen. Wie hätte man sonst die Judengasse in Dorfstraße
umbenannt? Hier kommen jahrelange Versäumnisse zum tragen, die von Politikern
und auch von der örtlichen Geistlichkeit zu verantworten sind. Nicht einmal
heute eine Geste des guten Willens, ein Gefühl von Scham?! Mitscherlichs
traurige Feststellung von der 'Unfähigkeit zu trauern' hat angesichts dieses
Verhaltens weiterhin Gültigkeit." |
Wie aus obigem Artikel hervorgeht, war die ehemalige Synagoge nach 1938
jahrzehntelang als Lagerraum zweckentfremdet worden. Die Inneneinrichtung
blieb jedoch beschädigt erhalten (Aron Hakodesch mit mehreren hebräischen
Inschriften, Frauenempore mit tragenden Säulen). Seit Mitte der
1980er-Jahre gab es Bemühungen, den Zustand des Synagogengebäudes zu
verbessern und das Gebäude einer würdigen Nutzung zuzuführen. In Vorbereitung
einer Sanierung konnte 1988 im Dachraum eine Genisa entdeckt werden. Die Renovierung
wurde 1989 bis 1991 durchgeführt. Seitdem ist die ehemalige Synagoge eine Gedenkstätte, kulturelles Zentrum
sowie Museum zur Geschichte der Juden in der Region Main-Spessart. Mit
verschiedenen kulturellen und Gedenk-Veranstaltungen wurde im Jahr 2003
das 200jährige Bestehen des Gebäudes begangen. In der Synagoge sind
Kultgegenstände (Toramäntel, Gebetsbücher, Taschen- und Wandkalender) und
Dokumente zum Leben jüdischer Gemeinden im Landkreis Main-Spessart ausgestellt. An
der Eingangstür wird auf die Deportation der 42 jüdischen Personen
hingewiesen, die im April 1942 nach Izbica deportierten wurden. Die
Synagoge Urspringen war mit Exponaten auf der internationalen Genizah/Genisa-Ausstellung
1992/93 und mit einem Abguss ihres Chuppa-Steines auf der Mappot-Ausstellung in
München 1997 - beide veranstaltet von The Hidden Legacy Foundation, London -
vertreten.
Erhalten hat sich als landwirtschaftliches Nebengebäude das 1826 in der
Quellenstraße errichtete Badehäuschen (Mikwe).
Adresse/Standort der Synagoge: Judengasse 5 (alte
Bezeichnung des hinteren Teiles der Judengasse: Schulhof, nach 1945 zeitweise
Adresse Dorfgasse 5)
Besichtigungsmöglichkeiten der Synagoge: vom 1. Mai
bis 30. September sonntags von 15-17 Uhr beziehungsweise vereinbar über Telefon
0-9396-385.
Förderkreis Synagoge Urspringen:
1990 wurde der "Förderkreis Synagoge Urspringen" gegründet, der
seitdem die ehemalige Synagoge mit der Ausstellung betreut sowie Sonderausstellungen,
Vorträge und Veröffentlichungen initiiert. Der Förderkreis hat 2012 etwa 75
Mitglieder. Unterhalten wird die ehemalige Synagoge durch den Landkreis
Main-Spessart und die Gemeinde Urspringen.
Kontaktadresse:
Förderkreis Synagoge Urspringen e.V. 1. Vorsitzender Dr. Leonhard Scherg
Luitpoldstraße 17 97828 Marktheidenfeld. E-Mail.
Fotos
(Außenaufnahmen Judengasse und ehemalige Synagoge: Hahn,
Aufnahmedatum 1.10.2006)
 |
 |
 |
| |
Blick in die Judengasse, an
deren Ende
(rechts) die ehemalige Synagoge steht |
Mesusa am Nachbargebäude
zur
ehemaligen Synagoge |
| |
|
|
Historisches
(Aufnahme vom 24.7.1929
durch Theodor Harburger)
|
 |
| |
Oben: Toraschmuck
aus der Synagoge Urspringen (Quelle: Central Archives Jerusalem,
veröffentlicht in: Th. Harburger, Die Inventarisation Bd. 3 S. 741). |
| |
|
| Die ehemalige Synagoge nach
der Renovierung |
|
 |
 |
 |
Blick auf die ehemalige
Synagoge
von der Judengasse (Nordseite) |
Westliche
Wandseite mit dem Hochzeitsstein und der üblichen (hier abgekürzten)
Inschrift:
"Kol sasson wekol simcha, kol
chatan wekol kalla": "Die Stimme der
Wonne
und der Freude, die Stimme des Bräutigams und der Braut", vgl.
Jeremia 7,34 sowie
inmitten des Davidsternes die Buchstaben für Mazel
Tow = Gut Glück Vgl. Seite
über Hochzeitssteine |
| |
| |
|
 |
 |
 |
| |
Die an Stelle des
Zugangs zu dem nach 1938 als Lager zweckentfremdeten Eingangstores durch
den Darmstädter Künstler Cornelis F. Hoogenboom gestaltete Türe
erinnert an die Deportationswege der Urspringer Juden. |
| |
|
Innenaufnahme der
ehemaligen Synagoge
nach der Renovierung |
 |
 |
| |
Foto: Albrecht Winkler
(Quelle: www.synagogen.info) |
Innenaufnahme aus der Website
der
Stadt Marktheidenfeld (Quelle s.u. Links) |
| |
|
|
| |
|
|
Gefallenendenkmal an
der
katholische Pfarrkirche
(Foto erhalten von Leonhard Scherg) |
 |
 |
| |
Auf dem
Gefallenendenkmal sind auch die vier jüdischen Gefallenen / Vermissten
aus Urspringen genannt:
Albert Ackermann, Philipp Friedrich Freudenreich, Louis Leopold und Siegmund
Samuel. |
| |
|
|
| |
|
|
| Andernorts entdeckt |
 |
| |
Grabstein für
Moritz Mannheimer aus Bütthard (1867
- 1937) und Marianne Adler
geb. Fränkel aus Urspringen (1852-1942) im jüdischen
Friedhof an der Eckenheimer
Landstraße in Frankfurt am Main (Symbol: Schofar) |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Oktober
2008: Jahresversammlung des
Förderkreises Synagoge Urspringen am 18.10.2008 |
Artikel von Martin
Harth im "Main-Echo" am 22. Oktober 2008: "
Förderkreis Synagoge Urspringen bleibt weiterhin aktiv.
Jahresversammlung: 20 Jahre an jüdisches Leben erinnert – Als
kompetenter Ansprechpartner etabliert – Gedenkveranstaltung am 9.
November.
Urspringen. Zur Jahresversammlung mit Neuwahlen kam am Samstagabend
der Förderkreis Synagoge Urspringen im Pfarrheim von Urspringen zusammen.
Vorsitzender Dr. Leonhard Scherg erinnerte daran, dass der Förderkreis im
nächsten Jahr 20 Jahre lang als zentrale Anlaufstelle für Informationen
zum früheren jüdischen Leben im Landkreis Main-Spessart wirkt. Im Jahr
2001 übernahm er die Programmgestaltung für die restaurierte Synagoge
Urspringen als zentrale Gedenkstätte im Landkreis Main-Spessart. Diese
Arbeit habe man erfolgreich gestalten können.
Jederzeit Führungen organisiert Die Mitgliederzahlen seien allerdings
rückläufig. Nach dem Tod von Franziska Amrehn konnten die
Öffnungszeiten der Synagoge zunächst weiter organisiert werden. Für
nächstes Jahr müsse man aber in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Urspringen eine neue Lösung mit jungen Leuten suchen. Führungen durch
das Denkmal und den
Friedhof in Karbach konnten jederzeit
organisiert werden. Auch der jüdische
Friedhof in Laudenbach kann
unter sachkundiger Führung von Georg Schnabel jederzeit besucht werden.
Der Förderkreis habe sich als kompetenter Ansprechpartner, gerade auch
für Nachkommen jüdischer Familien etabliert. Er konnte auch der Gemeinde
Karbach bei der gelungenen Rekonstruktion der ehemaligen Mikwe auf dem
Marktplatz und der Gemeinde Adelsberg bei der Herausgabe einer
Ortsgeschichte Informationen geben.
Ein besonderes Ereignis sei der von der Sparkassenstiftung unterstützte
Erwerb eines Beschneidungsbuchs des David Adler aus Urspringen (wir
berichteten). Eine erste Augenscheinnahme habe ergeben, dass das einmalige
Dokument, in dem 366 Beschneidungen aus den Jahren 1813 bis 1856 im
gesamten Raum um Marktheidenfeld verzeichnet sind, auf Papier geschrieben
ist, das in der Homburger Papiermühle hergestellt worden war. Zur
weiteren Bearbeitung wurde das Buch inzwischen digitalisiert.
Nach dem Bericht von Schatzmeister Peter Kausemann dankte Urspringens
Bürgermeister Heinz Nätscher dem Förderkreis, weil er die Gemeinde von
einer wichtigen Aufgabe fachgerecht entlastete. Er wünschte sich, im
nächsten Jahr zum 20. Jubiläum die Synagoge wieder stärker ins
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Wünschenswert sei auch ein schnelles
und koordiniertes Zusammenwirken der Stadt Marktheidenfeld und der
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft bei der Aufarbeitung gemeindlicher
Archive. Aus Urspringer Sicht vermute er, dass dabei auch manches Dokument
zur jüdischen Geschichte auftauchen könne.
Für den 9. November 2008 kündigte Dr. Scherg eine Gedenkveranstaltung
zum 70. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938 im Zusammenwirken mit dem
evangelischen und katholischen Dekanat an. Die Urspringer Genisa wird
unter einem halben Dutzend derartiger Funde in ehemaligen
unterfränkischen Landsynagogen bei einem Ausstellungsprojekt der Synagoge
Veitshöchheim und der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern
Berücksichtigung finden.
Zum 20-jährigen Bestehen des Förderkreises im Jahr 2009 soll über den
Winter eine Ausstellung konzipiert werden, die das Wirken des Vereins in
seiner ganze Breite darstellt. Schließlich stellt das erworbene
Beschneidungsbüchlein den Förderkreis vor neue Aufgaben. Um es
interessierten Menschen zu erschließen, soll es aus der hebräischen
Schrift und jiddischen Sprache ins Deutsche übertragen werden, wofür man
noch einen Fachmann sucht. Mit der Hilfe von Förderern soll es dann mit
weiteren Dokumenten zur jüdischen Geschichte veröffentlicht
werden. |
| |
| August
- September 2009: Ausstellung
"Abgelegt" in der ehemaligen Synagoge Urspringen |
Artikel in der
"Main-Post" vom 30. Juli 2009: "URSPRINGEN - Mit
Ehrfurcht beiseite gelegt. Ausstellung "Abgelegt" in ehemaliger
Synagoge Urspringen eröffnet.
Bis Mitte September bietet die Ausstellung "Abgelegt" in der
ehemaligen Synagoge Urspringen einen noch tiefer greifenden Einblick in
das religiöse Leben des einstigen Landjudentums in Unterfranken, als es
an dieser Stelle ohnehin der Fall ist. Urspringens Bürgermeister Heinz Nätscher
begrüßte eine ganze Reihe von Gästen zur Ausstellungseröffnung. Neben
einigen Bürgermeistern und Kreistagkollegen war auch Pfarrer Mariusz
Dolny an den historischen Ort gekommen. Eine Delegation vom Förderkreis
Synagoge Arnstein hatte Gäste aus dem israelischen Ort Gezer mitgebracht,
mit dem die Stadt Arnstein eine Städtepartnerschaft anstrebt. Außerdem
waren auch Vertreter der deutsch-israelischen Gesellschaft aus Frankfurt
am Main zugegen und mit Elisabeth Singer war die für Urspringen zuständige
Mitarbeiterin des Genisa-Projekts aus Veitshöchheim anwesend.
Mahnung für die Gegenwart. Nätscher nannte die frühere jüdische
Minderheit, die mit der Deportation durch die Nationalsozialisten ein
tragisches Ende gefunden habe, einen einst nicht wegzudenkenden
Bestandteil im Ort. Die Gemeinde freue sich, mit Hilfe des Fördervereins
und seines Vorsitzenden Dr. Leonhard Scherg mit der Gedenkstätte und dem
Museum Synagoge Urspringen die Erinnerung wach halten zu können, die
zugleich auch Mahnung für die Gegenwart sei. Scherg erinnerte in seiner
Eröffnungsansprache daran, dass der Genisa-Fund in der bis dahin als
Feuerwehrhaus genutzten Synagoge in Veitshöchheim das Interesse an
solchen Dingen im ländlichen Unterfranken erst richtig geweckt habe.
"Abgelegt" bedeute nicht, dass man Abfall beiseite geschafft
habe, sondern dass man die Zeugnisse des religiösen Alltags bewusst und
mit Ehrfurcht wegen ihrer Bedeutung weggelegt habe.
Auf Dachböden aufbewahrt. Die Genisot befänden sich auf den Dachböden
der Synagogen heute in sehr unterschiedlichem Zustand. Das hänge von der
Erbauung ab und von der späteren Nutzung. Genisa bezeichnet die in den
Synagogen aufbewahrten Dokumente und Schriften, die den Gottesnamen
enthalten und nicht weggeworfen werden durften, sowie Gegenstände des
religiösen Alltags. Sie wurden in den Synagogen aufbewahrt. In Urspringen
führten die aufgefundenen Reste der Genisa nach ihrer Bergung 1998 zurück
in die Phase des Erbauungsjahres des Gebäudes 1803. Die Bedeutung der
Urspringener Funde sei schon 1992 in der internationalen
Genisa-Ausstellung der Hidden Legacy Foundation aus London deutlich
geworden. Seit damals seien in Unterfranken weitere Funde hinzugekommen
und außerdem sei zu diesem Zeitpunkt auch nicht der volle Umfang
wissenschaftlich erfasst gewesen.
In Veitshöchheim konzipiert. Dies sei nun das Verdienst des 1998
bei der früheren Synagoge in Veitshöchheim angesiedelten Genisa-Projekts.
Von dort sei auch die in Urspringen gezeigte Wanderausstellung konzipiert
worden. Scherg dankte den Mitarbeitern vom jüdischen Kulturmuseum Veitshöchheim,
den Gemeinde Veitshöchheim und Urspringen für ihre Unterstützung und
weiteren Mitwirkenden bei der Gestaltung der Ausstellung, der Plakate und
Handblätter.
Besonderen Dank sprach der Vorsitzende des Fördervereins dem engagierten
Frauenkreis um Hedwig Albert aus Urspringen aus, der bei der Eröffnung,
den Ausstellungszeiten und beim Aufbau mitwirkten.
Die Ausstellung "Abgelegt" ist bis zum 13. September in der früheren
Synagoge (Judengasse) in Urspringen an Sonntagen von 15 bis 17 Uhr zu
sehen. Sonderzeiten können mit der Gemeinde Urspringen, Tel. (0 93 96) 99
38 87 oder E-Mail vereinbart
werden". |
| |
| September
2009: Weiterer Bericht über die
Ausstellung |
Artikel (mh) in der "Mainpost" vom 1. September 2009: "URSPRINGEN.
Erbauliche Schrift aus alter Zeit: Buch über die Pflicht der Frauen. Sonderausstellung mehrerer Genisa in der ehemaligen Synagoge in Urspringen.
An den beiden kommenden Sonntagen bietet die Ausstellung "abgelegt" des Genisa-Projekts aus Veitshöchheim in der ehemaligen Synagoge in Urspringen die Gelegenheit, mehr über Religion und Tradition des einstigen unterfränkischen Landjudentums zu erfahren. Besondere Beachtung verdienen die aus der Urspringer Genisa stammenden Fundstücke.
Genisa, darunter versteht man den Brauch, unbrauchbar gewordene Schriften und Dinge des religiösen Alltags aus Ehrfurcht nicht einfach wegzuwerfen, sondern sie an bestimmten Orten sorgsam abzulegen, sie aufzubewahren und dem Zugriff Dritter zu entziehen. In Unterfranken geschah dies häufig auf den Dachböden der Synagogengebäude. Unbeachtet überstanden dort einmalige historische Zeugnisse die Jahrhunderte und auch die brachiale Vernichtungswut der Nationalsozialisten.
Die Ausstellung in der früheren Synagoge in Urspringen führt Fundstücke aus
Veitshöchheim, Goßmannsdorf,
Gaukönigshofen, Altenschönbach, Wiesenbronn,
Kleinsteinach und Memmelsdorf zusammen. Aus dem Vergleich der Genisot können Gemeinsamkeiten und Entwicklungen über Jahrhunderte aufgezeigt werden. In der Ausstellung zeigen Zettelkästen Folgerungen und Hypothesen, wie sie das Genisa-Forschungsprojekt in Veitshöchheim seit einigen Jahren wissenschaftlich erarbeiten konnte.
Will man die Ausstellung tief erfassen, muss man schon etwas Zeit mitbringen. Genisot sind ein ziemliches spezielles Gebiet und die Ausstellungsmacher haben es leider versäumt, ihre Erkenntnisse
"populär" aufzuarbeiten. Will man sich intensiv damit befassen, so heißt es viel zu lesen in einer ziemlich unübersichtlichen Zettelwirtschaft. Zum Glück bietet die besser aufbereitete Dauerausstellung auf der Frauenempore der Urspringer Synagoge für Laien eine verständlichere Ergänzung.
Manches, was in den unterfränkischen Genisot entdeckt wurde, hat nicht rein religiösen Hintergrund, sondern erzählt auch vom Leben in früheren Jahrhunderten. So findet man Spendenquittungen, Gemeindeberichte von Rabbinern, die auch schon einmal schmunzeln lassen, eine Bescheinigung über eine Pockenschutzimpfung oder eine fromme Strafarbeit von Schülern.
Besonders interessant ist, was über das rein Papierene hinausgeht wie Gebetsriemen und ihre Aufbewahrungstäschchen, ein Gebetsmantel, Socken oder Schuhe. Sie geben uns auch ein Bild über Materialien und Herstellungsformen, von denen sich nur wenige Beispiele im nichtjüdischen Umfeld erhalten haben.
Aus der Urspringer Genisa, deren Reste 1988 im Dachstuhl der Synagoge gefunden wurde und die seitdem im Magazin des Lohrer Spessartmuseums fachgerecht verwahrt werden, zeigt die Ausstellung aus über 800 Dokumenten vier fragmentarische Funde.
Aus dem Revolutionsjahr 1848 stammt ein Kalender in hebräischer und jiddischer Sprache für das jüdische Jahr 5508.
Der jüdischen Gebetsliteratur entstammt ein "Tikkun Lejl Schawuot" aus dem 18. Jahrhundert, eine Sammlung religiöser Texte. Das in Urspringen gefundene Fragment ist eine Besonderheit und beinhaltet einen Text des um 1500 in Thessaloniki geborenen und nach Safed in Galiläa ausgewanderten Kabbalisten Salomo Halevi
Alkabetz. Das 1776 bei Isaak Zirndorffer in Fürth gedruckte "Buch über die Pflicht der
Frauen" ist den erbaulichen Schriften des rabbinischen Judentums zuzurechnen. Ihm liegt das
"Sefer Mizwoth Ha-Naschim" des polnischen Rabbiners Benjamin Ahron Ben Abraham Slonik aus dem 16. Jahrhundert zugrunde. Das
"schön‘ Frauen Büchlein" gibt Auskunft über Menstruationsgebote, das Lichteranzünden am Sabbat oder die
"Challa", die Absonderung und Verbrennung eines Teil des Teigs beim Backen der Sabbat-Brote.
Regionalgeschichtlich ist schließlich das Fragment eines handschriftlichen Gebets für die Obrigkeit bedeutsam. Das vor 1802 entstandene Unikat dürfte den Schutzherren der Urspringer Juden, den Grafen von Castell, gegolten gaben.
Die Ausstellung "abgelegt" ist in der früheren Synagoge (Judengasse) in Urspringen an Sonntagen von 15 bis 17 Uhr zu sehen. Sonderzeiten: Tel. (0 93 96) 99 38 87." |
| |
| Rechts: Artikel
"Historische Funde aus Urspringen" aus dem "Lohrer
Echo" bzw. "Main-Echo" vom 2. September 2009 - zum Lesen
bitte Abbildungen anklicken. |
 |
 |
|
| Die Ausstellungsdauer wurde verlängert - sie
war auch an den beiden Sonntagen 20. und 27. September 2009 von 15-17 Uhr
geöffnet. |
| |
| |
| Juni
2010: Ausstellung über die Geschichte von
fränkischen Synagogengebäuden nach 1945 |
 Artikel im "Lohrer Echo" vom 10. Juni 2010 (Artikel erhalten
über Fred G. Rausch):
Artikel im "Lohrer Echo" vom 10. Juni 2010 (Artikel erhalten
über Fred G. Rausch):
"Vergangenheit und Gegenwart der Synagogen. Ausstellung: 30
großformatige Fotografien sind noch bis Ende Juni in der Gedenkstätte in
Urspringen zu sehen - Auch Bilder von Schändungen.
Urspringen. Etwa 30 großformatige Fotografien informieren noch bis
zum Ende des Monats in der Gedenkstätte Synagoge Urspringen darüber, was
aus den einstigen Kultusstätten der jüdischen Minderheit in Franken
wurde. Wo die Synagogen nicht zerstört wurden, wurden diese nach dem
nationalsozialistischen Pogrom vom November 1938 bald in neue, oftmals
unwürdige neue Nutzungen überführt, die meist lange andauerten....
Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung
anklicken. |
| |
| April
2010: Jahresversammlung des
Synagogen-Förderkreises |
Artikel von Martin Harth in der "Main-Post" vom 26. April 2011 (Artikel):
"URSPRINGEN. Jüdisches Leben bleibt unvergessen
Mitgliederversammlung des Synagogen-Förderkreises Urspringen zieht Bilanz
Zur Mitgliederversammlung hatte der Förderkreis Synagoge Urspringen in die ehemalige Synagoge von Urspringen eingeladen. Obwohl der Mitgliederstand des Vereins rückläufig sei, sei die Arbeit seit der letzten Hauptversammlung im Jahr 2008 nachhaltig fortgesetzt worden, führte Vorsitzender Dr. Leonhard Scherg aus. Einige Mitglieder aus der Gründungszeit im Jahr 1988 seien ausgeschieden. Mit einem Team um Hedwig Albert und einigen weiteren Mitgliedern sei es aber gelungen, die Öffnungszeiten und den Führungsdienst im ehemaligen Synagogen-Gebäude in Urspringen aufrecht zu erhalten.
Im Jahr 2009 hatte man die Geniza-Ausstellung des Jüdischen Kulturmuseums Veitshöchheim und 2010 die Fotoausstellung
'Jerusalem liegt in Franken' des Echter-Verlags zu Gast. Im Jahr 2008 gab es zum 70. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938 eine würdige Gedenkfeier.
Kompetenter Ansprechpartner. Das Buch 'Auf den Spuren der Judenwege' von Barbara Rösch wurde mit Hilfe der Sparkassenstiftung bezuschusst. Im Oktober 2009 stellte die Berliner Kulturwissenschaftlerin ihr Werk bei einem Vortrag in der Volkshochschule Marktheidenfeld vor, das viele Aspekte aus der Region berücksichtigt und örtliche Gegebenheiten dokumentiert. Mit der vhs-Marktheidenfeld wurde 2010 bei einem Konzert mit dem Gerolzhofener Gesangsduo
'Café Sehnsucht' in der Synagoge Urspringen an die Spuren vergessener jüdischer Künstler in Deutschland erinnert.
Der Förderkreis habe auch als kompetenter Ansprechpartner in Fragen der jüdischen Geschichte gewirkt. So werde auch die Datenbank unterstützt, die vom Aschaffenburger Haus Wolfsthalplatz – ausgehend vom Bestand
'Juden am Bayerischen Untermain' – künftig zur zentralen Quelle für ganz Unterfranken erweitert werden soll, kündigte Scherg an. Die Internet-Plattform
'Alemannia Judaica' werde immer wieder mit Ergebnissen und Berichten ergänzt.
Für die Nachfahren jüdischer Familien sei der Förderkreis ein kompetenter Partner in Sachen Familiengeschichte. Scherg erinnerte an die Familien Grünebaum (Homburg), Fuld (Homburg) und Klein (Urspringen), die sich in den letzten drei Jahren an den Verein gewandt hatten. Einige regionale Quellen, die inzwischen im Besitz des Förderkreises sind, möchte man künftig aufbereiten.
Der Förderkreis Synagoge Urspringen ist im Internet auf den Homepages der Stadt Marktheidenfeld, der Gemeinde Urspringen und des Landkreises vertreten oder verlinkt.
Der Kassenbericht von Schatzmeister Peter Kausemann (Marktheidenfeld) belegte, dass der Förderkreis mit seinen Mitteln wirtschaftlich umgegangen war. Die Rechnungsprüfer Armin Hospes (Marktheidenfeld) und Karbachs Bürgermeister Kurt Kneipp hatten keine Einwände. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.
Scherg bleibt Vorsitzender. Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Leonhard Scherg und sein Stellvertreter Martin Wagner (Erlenbach) in ihren Ämtern bestätigt. Peter Kausemann führt weiterhin die Kasse. Die Schriftführung übernimmt der Leiter des Spessartmuseums Lohr, Herbert Bald. Sein Stellvertreter ist Martin Harth (Marktheidenfeld). Dem Beirat gehören Urspringens Bürgermeister Heinz Nätscher und Landrat Thomas Schiebel an. Fachlich sind dem Gremium Martin Harth, Peter Reidelshöfer (Marktheidenfeld), Georg Schnabel (Laudenbach) und Hedwig Albert (Urspringen) beigeordnet.
Die Historischen Vereine aus Lohr, Marktheidenfeld und Gemünden werden durch die jeweiligen Vorsitzenden vertreten. Der Historische Verein Karlstadt hat Gustav Eichler und Alfred Dill als Vertreter benannt.
Beim Ausblick wurde der Beitrag über die Synagoge Urspringen im aktuellen Handbuch
'Museen in Bayern' vorgestellt. Vor der Sitzung hatte Armin Hospes dem Verein ein altes jüdisches Gebetbuch in hebräischer Sprache, das 1866 in einem Verlag in Rödelheim erschienen ist, für die Sammlung übergeben. Angeregt wurde, das 25. Gründungsjubiläum des Fördervereins mit einer Ausstellung über dessen Arbeit zu begehen." |
| |
| Mai
2010: Der Förderverein beteiligt sich
am Gedenkmarsch in Würzburg |
Artikel von "maha"
in der "Main-Post" vom 26. April 2011 (Artikel):
"URSPRINGEN. Gedenkmarsch auf dem Weg der Opfer
Förderkreis und Main-Spessart-Gemeinden unterstützen Aktion – Schilder erinnern an Deportierte
(maha) Am 10. Mai soll in Würzburg unter dem Titel 'Wir wollen uns
erinnern' ein Gedenkmarsch auf dem Weg der größten Deportation von Juden aus Unterfranken am 25. April 1942 von der ehemaligen Gaststätte
'Platz'scher Garten' am Friedrich-Ebert-Ring zum früheren Güterbahnhof Aumühle stattfinden.
Dabei soll auch der großen Anzahl von Opfern der nationalsozialistischen Rassenideologie aus dem heutigen Landkreis Main-Spessart gedacht werden. Der
Förderkreis Synagoge Urspringen unterstützt diese Gedenkveranstaltung, wie dies der Vorsitzende Leonhard Scherg bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich machte.
Für die Aktion 'Wir wollen uns erinnern' wurden die Daten der Deportationsopfer vom 25. April 1942 aus einigen jüdischen Gemeinden überprüft und zusammengestellt. Über den Stand der Vorbereitungen für den Gedenkmarsch
'Wir wollen uns erinnern' am 10. Mai in Würzburg wurde bei der Hauptversammlung berichtet.
So haben sich die Stadt Marktheidenfeld und die Gemeinde Karbach bereits um Teilnehmer bemüht, welche die Namenstafeln der neun, beziehungsweise 27 Opfer aus den Gemeinden beim Gedenkmarsch tragen werden. Auch Triefenstein wird sicher mit fünf Vertretern für die Opfer aus Homburg dabei sein.
Für Urspringen will Bürgermeister Heinz Nätscher Verbindung mit den Schulen in Marktheidenfeld aufnehmen, um Vertreter für die 42 Opfer aus seiner Gemeinde nach Würzburg schicken zu können. Georg Schnabel berichtete über den Stand der Vorbereitungen in Laudenbach.
Bürgermeister Kurt Kneipp aus Karbach will sich um zwei Busse bemühen, die für Vertreter aus dem ehemaligen Landkreis Marktheidenfeld eingesetzt werden, um die Aktion, die von 14 bis etwa 19 Uhr dauern könnte, gemeinsam abzuwickeln.
Josef Laudenbacher (Karbach) holt die Namensschilder für die vier Gemeinden vorher in Würzburg ab und verteilt sie in den Bussen. Bemerkenswert ist, dass im Fall von Karbach auch Nachkommen jüdischer Opfer zu dem Gedenkmarsch aus Israel nach Deutschland kommen wollen." |
| |
| September
2012: Regierungspräsident Beinhofer
besucht die ehemalige Synagoge |
 Artikel
von Bianca Löbbert im "Lohrer Echo" vom 7. September 2012:
"Jüdisches Erbe bewahren. Artikel
von Bianca Löbbert im "Lohrer Echo" vom 7. September 2012:
"Jüdisches Erbe bewahren.
Geschichte: Regierungspräsident Paul Beinhofer besichtigt Synagoge in
Urspringen sowie Mikwe und Friedhof in Karbach.
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
| Oktober
2012: Vortrag zur Geschichte der
Synagoge in Urspringen |
 |
 |
Links: Artikel im "Lohrer Echo" vom
24. Oktober 2012: "Vorgängerbau gab es nicht..."
Anmerkung: Der Referent - Matthias (Mordechai) Doerfer - ist der
Ansicht, dass das Gebäude der Urspringer Synagoge nicht aus dem Gelände
eines Vorgängerbaus erstellt wurde.
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. |
| |
| November
2013: Gedenkstunde zum
Novemberpogrom 1938 |
 Artikel
von Martin Harth in der "Main-Post" vom 11. November 2013:
"'Wir wollen Frieden für alle' Eindrucksvolle Gedenkstunde in der
ehemaligen Synagoge Urspringen zum Novemberpogrom vor 75 Jahren..." Artikel
von Martin Harth in der "Main-Post" vom 11. November 2013:
"'Wir wollen Frieden für alle' Eindrucksvolle Gedenkstunde in der
ehemaligen Synagoge Urspringen zum Novemberpogrom vor 75 Jahren..."
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken. |
| |
| Februar
2014: Fotoalbum von Serry Adler aus
Urspringen in Polen entdeckt |
Artikel von Martin Harth in der
"Main-Post" vom 17. Februar 2014: "MARKTHEIDENFELD/URSPRINGEN.
Das Album von Serry Adler
Der Historiker Dr. Leonhard Scherg zeigte sich tief bewegt über einen unschätzbaren Fund von Fotozeugnissen: das Fotoalbum eines 16-jährigen jüdischen Mädchens aus Urspringen, das jüngst in Polen auftauchte. Das Mädchen war 1942 ins Vernichtungslager Sobibor deportiert worden.
Der Vorsitzende des Förderkreises Synagoge Urspringen stellte am Ende der Eröffnung der Ausstellung
'Mitten unter uns' über das Landjudentum in Franken im Balthasar-Neumann-Gymnasium (wir berichteten bereits ausführlich) diesen Fund vor, der unschätzbare historische Bedeutung für den Verein habe..."
Link
zum Artikel |
Artikel von Pat Christ in der
"Jüdischen Allgemeinen" vom 28. August 2014: "Wer ist
wer in Serry Adlers Album? Das Johanna-Stahl-Zentrum versucht, anhand
von Fotos die Geschichte eines jüdischen Mädchens zu
rekonstruieren..."
Link
zum Artikel |
Hinweis:
Eindrücke aus dem Fotoalbum - zusammen mit Erläuterungen und
ergänzenden Informationen -
hat Leonhard Scherg zusammengestellt: "Das
Fotoalbum von Serry Adler aus Urspringen"
(pdf-Datei) |
| |
|
Oktober 2014:
25 Jahre Förderverein Synagoge
Urspringen |
Artikel von Martin Harth in der
"Main-Post" vom 27. Oktober 2014: "MARKTHEIDENFELD. Förderkreis Synagoge
Urspringen besteht seit 25 Jahren
Der Fund eines Fotoalbums des jüdischen Mädchens Serry Adler in Polen
beschäftigte in diesem Jahr den Förderkreis Synagoge Urspringen.
Zur Hauptversammlung kam am Freitagabend der Förderkreis Synagoge Urspringen
zusammen. Bei den Wahlen wurde der bewährte Vorstand im Amt bestätigt.
Vorsitzender bleibt Dr. Leonhard Scherg, Stellvertreter Martin Wagner,
Schatzmeister Peter Kausemann und Schriftführer Herbert Bald und Martin
Harth (Stellvertreter). Dem Beirat gehören Peter Reidelshöfer, Georg
Schnabel und Hedwig Albert sowie kraft Amtes Landrat Thomas Schiebel und
Bürgermeister Volker Hemrich und außerdem jeweils ein Vertreter der
Historischen Vereine im Landkreis an. Zu Beginn erinnerte der Vorsitzende
Leonhard Scherg daran, dass der Verein im nächsten Jahr auf sein 25-jähriges
Bestehen zurückblicken wird. Er dankte allen, die in dieser Zeit daran
mitwirkten, die ehemalige Synagoge als zentrale Gedenkstätte für die
Verfolgung der jüdischen Minderheit während der NS-Diktatur im Landkreis
Main-Spessart zu erhalten. Das Gedenken der Versammelten galt den bereits
verstorbenen Mitgliedern. Scherg verwies auf leicht rückgängige
Mitgliederzahlen. Mit Hilfe von Hedwig Albert und der Gemeinde Urspringen
sei es gelungen, einen Besucherdienst für das Baudenkmal aufrechtzuerhalten,
der sich erfreulicherweise immer wieder personell selbst ergänze. Im Jahr
2013 besuchten über 300 Gäste die Synagoge, die Mehrzahl davon in Gruppen.
In den vergangen Jahren konnten einige Veranstaltungen initiiert werden, so
ein Besuch des unterfränkischen Regierungspräsidenten 2012 oder eine
Ausstellung mit einem Vortrag des Meininger Richters Christoph Gann 2013
über das Schicksal der Emigrantin Eva Mosbacher, die mit einem
Kindertransport 1939 nach England entkam. Im Oktober 2012 hatte der
deutsch-israelische Autor Matthias Doerfer seine Forschungen zum 1803
errichteten Synagogengebäude vorgestellt.
Gedenkfeier und Ausstellung. Nachhaltig wirkte die Gedenkfeier in der
Synagoge zum 75. Jahrtag des Novemberpogroms 1938, die von Schülern der
Mittelschule, der Realschule und des Gymnasiums in Marktheidenfeld gestaltet
worden war. Großen Zuspruch fand zu Beginn dieses Jahres auf Vermittlung des
Förderkreises die Ausstellung 'Mitten unter uns' der Arbeitsgemeinschaft
Landjudentum am Balthasar-Neumann-Gymnasium in Marktheidenfeld. Hinsichtlich
der einstigen jüdischen Gemeinden im Landkreis gelte der Förderkreis als
kompetenter Ansprechpartner und man halte Kontakte zu vielen Einrichtungen
wie der AG Landjudentum, dem Netzwerk Jüdisches Museum Franken in Fürth oder
dem Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in
Unterfranken. Der Vorsitzende hob die Homepage 'Alemannia Judaica' (www.alemannia-judaica.de)
hervor, mit der man stets neue Informationen austausche. Nächstes Jahr werde
die Synagoge Urspringen bei einer Veröffentlichung des Projekts 'Mehr als
Steine' in einem umfangreichen Buch über Unterfranken Berücksichtigung
finden. Immer wieder wendeten sich Nachfahren einstiger jüdischer Familien
aus der Region an den Förderkreis mit der Bitte um Unterstützung bei
Familienforschungen. Daraus entstünden teilweise dauerhafte Beziehungen. In
diesem Zusammenhang wies Scherg auf die Bedeutung der jüdischen Friedhöfe
hin. Ihre umfassende Dokumentation sei dringlich, bevor die Inschriften auf
den Grabsteinen durch die Verwitterung für immer verloren seien.
Fotoalbum lag am Straßenrand. Was den Förderkreis in diesem Jahr
besonders bewegte, war die Tatsache, dass in Polen im Museum von Majdanek
ein Fotoalbum des Mädchens Serry Adler aus Urspringen gesichert werden
konnte. Das Album war ursprünglich 1942 am Straßenrand gefunden worden, als
Todesmärsche unterfränkische Juden zum Vernichtungslager Sobibor führten. Im
Austausch mit der polnischen Gedenkstätte und dem Würzburger
Johanna-Stahl-Zentrum konnten viele Details zu den auf 13
Schwarz-Weiß-Aufnahmen abgelichteten Personen geklärt werden. Auch für den
Förderkreis waren einige wichtige und neue Erkenntnisse dabei zu gewinnen.
Der Förderkreis schaffte für die Gedenkstätte eine neue Anlage an, um
elektronische Informationsmedien während der Führungen präsentieren zu
können. Die Internet-Präsenz der Gedenkstätte soll mit Partnern weiter
ausgebaut werden. Eine durchweg positive finanzielle Bilanz konnte
Schatzmeister Peter Kausemann mit seinem Bericht ziehen, der die Billigung
der beiden Kassenprüfer Armin Hospes und Kurt Kneipp fand. Nach der
Entlastung leitete Urspringens Bürgermeister Volker Hemrich die Neuwahlen.
Einstimmig wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Im
Ausblick kündigte der wiedergewählte Vorsitzende Leonhard Scherg an, dass
sich bei den nächsten Neuwahlen nach über 25 Jahren ein personeller Wechsel
in den Vorstandspositionen abzeichne.
Weichen für die Zukunft stellen. Man müsse sich im Verein und in der
Gemeinde Gedanken über die Zukunft machen. Der Förderkreis wolle im nächsten
Jahr an seine 25-jährige Vereinsgeschichte erinnern und werde die Gemeinde
Urspringen bei ihrer 1000-Jahr-Feier unterstützen. Dazu werde man unter
anderem die Öffnungszeiten der ehemaligen Synagoge erweitern, kündigte
Scherg an."
Link zum Artikel |
| |
| November
2015: Erinnerungen von Rabbiner
Freimark an Urspringen |
Artikel von Martin Harth im
"Main-Echo" vom 9. November 2015: "Pogromnacht: Ein
amerikanischer Rabbiner blickt auf das jüdische Urspringen vor 1938
zurück..."
Link
zum Artikel |
| |
| November
2017: Christine Kasamas ist neue
Vorsitzende des Förderkreises Synagoge Urspringen |
Artikel von Martin Harth im
"Main-Echo" vom 29. November 2017: "Förderkreis: Christine Kasamas die neue Vorsitzende
Urspringen. Seit Gründung des Förderkreises Synagoge Urspringen 1990 führte Leonhard Scherg den Verein als Vorsitzender. Nun übergab er dieses Amt an Christine Kasamas aus Urspringen.
Die Erinnerung an das einstige jüdische Leben in der Region, dessen Erforschung und das Gedenken an die Opfer des Holocausts seien ein Stück seines geschichtlichen Lebenswerks, erklärte der frühere Bürgermeister von Marktheidenfeld. Deshalb werde er der Sache weiterhin treu bleiben. Er freue sich, dass es über die Jahre gelungen sei, die Synagoge als einmaliges kulturgeschichtliches Denkmal in Urspringen und weit darüber hinaus bewusst zu machen.
Ein Dutzend der knapp 60 Mitglieder des Förderkreises waren am Dienstagabend ins Rathaus von Urspringen gekommen. Aufgabe des Vereins ist es in erster Linie, für verlässliche Öffnungszeiten der einstigen Synagoge mit ihrer Genisa-Ausstellung zu sorgen und Ansprechpartner für Besucher zu sein.
Mit der Volkshochschule. In seinem Bericht über die Jahre 2014 bis 2017 erwähnte Scherg, dass mit der Synagoge auch die jüdische Tradition beim 1000-jährigen Jubiläum Urspringens im Jahr 2015 in den Blickpunkt gerückt worden sei. Weitere Veranstaltungen, oft in Kooperation mit der Volkshochschule Marktheidenfeld, hätten unter anderem das kleine Fotoalbum des in den Tod deportierten Mädchens Sery Adler aus Urspringen vorgestellt.
Pfarrer Hans Schlumberger berichtete von Ausschreitungen gegen die jüdische Minderheit in Wiesenfeld und Laudenbach im Jahr 1866. Der Autor Winfried Mogge warf einen Blick auf die einstigen jüdischen Gemeinden in Rothenfels und Bergrothenfels. Alfred Dill referierte über die Judenwege auf der Fränkischen Platte.
Austausch intensiviert. Immer wieder sei es zu berührenden Begegnungen mit Nachfahren jüdischer Familien gekommen, die einst in der Region lebten. Die Zusammenarbeit mit der Internetplattform
WWW.ALEMANNIA-JUDAICA.DE sei wie der Austausch zum Würzburger Johanna-Stahl-Zentrum intensiviert worden. Bei lokalen Forschungen wurden immer wieder interessante Zeugnisse jüdischen Lebens gefunden und gesichert.
Friedhöfe dokumentieren. Scherg wies darauf hin, dass die Bemühungen, ein historisches Beschneidungsbuch aus Urspringen zu übersetzen und zu veröffentlichen, fortgeführt werden. Aus der Mitgliedschaft wurde deutlich, dass man eine Dokumentation der jüdischen Friedhöfe Laudenbach und Karbach über die Arbeiten von Georg Schnabel und Leonhard Scherg hinaus für wünschenswert halte.
Schatzmeister Peter Kausemann, der sein Amt ebenso wie der bisherige Schriftführer Herbert Bald abgab, machte deutlich, dass sich der Förderkreis finanziell keine Zukunftssorgen machen müsse. Kassenprüfer Armin Hospes sah dies ebenso.
Ergebnis der Neuwahlen. Urspringens Bürgermeister Volker Hemrich dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern und leitete die Neuwahlen. Einmütig wurde Christine Kasamas als neue Vorsitzende gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Martin Wagner aus Erlenbach. Die Kasse wurde von Sabine Eckert aus Urspringen übernommen. Von dort kommt auch der neue Schriftführer Egon Sendelbach. Kassenprüfer bleiben Armin Hospes (Marktheidenfeld) und Kurt Kneipp (Karbach).
Dem Beirat gehören neben den Vorsitzenden der Historischen Vereine aus den vier früheren Kreisstädten Georg Schnabel aus Laudenbach und die Marktheidenfelder Leonhard Scherg und Martin Harth an.
Urspringens früherer Bürgermeister Heinz Nätscher würdigte nochmals die Verdienste von Leonhard Scherg, ohne den es das Denkmal Synagoge Urspringen in seiner heutigen Form sicher nicht geben würde. Dieser versprach, den neuen Vorstand im Marktheidenfelder Stadtarchiv bei einem Blick in die Unterlagen und in die Sammlung des Förderkreises zu unterstützen.."
Link
zum Artikel |
| |
|
April 2020:
Der Urspringer Beitrag für den "Denkort
Deportationen" am Würzburger Hauptbahnhof |
Artikel von Martin Harth im
"Main-Echo" vom 2. April 2020: "Des Sägekünstlers schwerer Koffer.
'Denkort Deportationen': Andreas Öhring griff zu Kettensäge und
Schnitzmesser als Beitrag für die unterfrankenweite Gedenk-Aktion
Urspringen. Im April sollte auf dem Vorplatz des Würzburger Bahnhofs der
'Denkort Deportationen' eröffnet werden. Die gegenwärtige Corona-Krise
zwingt den Kreis der Initiatoren aber dazu, diesen Termin zu verschieben. In
Urspringen ist der örtliche Beitrag zur Erinnerung an die Verfolgung und
Vernichtung der jüdischen Gemeinden in Unterfranken fertiggestellt. Die
Grundidee des Denk- und Mahnmals in Würzburg ist, mit der Nachbildung von
Gepäckstücken an die über 2000 jüdischen Opfer des Holocausts aus
Unterfranken zu erinnern. Mit geringem persönlichem Handgepäck mussten die
jüdischen Bürger bei acht Deportationen zwischen November 1941 und Januar
1944 ihren Weg in die Vernichtung antreten.
42 Urspringer Juden deportiert. Dies galt auch für 42 Juden aus
Urspringen, die am 23. April 1942 aus ihrem Heimatort zum Sammelort 'Platz'scher
Garten' nach Würzburg gebracht wurden. Zwei Tage später mussten sie zum
Güterbahnhof Aumühle marschieren und wurden mit dem Zug nach Krasnystaw in
die Region Lublin im heutigen Polen gebracht. Über das Durchgangslager
Krasniczyn führte ihr Weg zur Ermordung in die nationalsozialistischen
Vernichtungslager von Sobibor oder Belzec. Mit dem 'Denkort Deportationen'
soll öffentlich an dieses Verbrechen erinnert werden. 1933 hatte es noch
über 100 jüdische Gemeinden in Unterfranken gegeben. Die heutigen Kommunen
wurden dazu aufgefordert, wenn möglich unter Beteiligung jüngerer Menschen
Nachbildungen von Koffern, Rucksäcken oder Deckenrollen künstlerisch
anfertigen zu lassen um sie am vorbereiteten Denkort in Würzburg
aufzustellen. Ein entsprechendes Duplikat soll an einem öffentlichen Ort in
der jeweiligen Heimatgemeinde an die Geschehnisse erinnern. Beschriftungen
an den Exponaten verdeutlichen die Herkunft und die Zusammenhänge.
Einer von 60 Beiträgen. Über 60 Beiträge wurden inzwischen zugesagt.
Zur geplanten und nun verschobenen Eröffnung wären bereits 40 Gepäckstücke
aus unterschiedlichen Materialien zur Verfügung gestanden. Weitere Gemeinden
aus Unterfranken sicherten überdies finanzielle Unterstützung zu. In der
früheren Synagoge in der Urspringer Ortsmitte wurde nun der Beitrag aus
Urspringen vorgestellt. Die Gemeinde und der Förderkreis Synagoge Urspringen
wichen in Absprache mit ihrem gemeinsamen Projekt leicht von den
eigentlichen Vorgaben ab.
Original in Urspringer Synagoge. In der Synagoge befindet sich seit
dem Jahr 2015 ein großer Überseekoffer, der sich auf einem Dachboden
erhalten hatte. Nach Zeitzeugenberichten sollte er ursprünglich dem Ehepaar
Hilda und Hermann Landauer zu deren geplanten Auswanderung in die USA
dienen. Der Landwirt war seit 1936 als Stellvertreter seines Schwagers
Justin Adler in der Leitung der israelitischen Gemeinde aktiv. Sohn Isfried
konnte 1939 über die Sowjetunion nach Palästina auswandern. Im Koffer
befinden sich neben Heimtextilien aus dem Anwesen Landauer ebenso Dinge,
insbesondere Bücher, aus dem Besitz des Landmaschinenhändlers Justin Adler
und seiner Frau Lina. Auch Familie Adler wurde mit ihren beiden Kindern
Manfred und Inge wie das Ehepaar Landauer Opfer der Deportation im April
1942. Obwohl der Koffer schon aufgrund seiner Größe im engeren Sinn nichts
mit dem eigentlichen Deportationsgepäck zu tun hat, entschloss man sich in
Urspringen, dieses authentische Zeugnis zum Ausgangspunkt des Beitrags für
das Würzburger Denkmal zu machen. Der Koffer selbst wird so in der früheren
Synagoge zum Gegenstück am Würzburger Hauptbahnhof und mit einer
entsprechenden Beschriftungstafel ausgestattet werden.
Miniatur angefertigt. Um nicht aus dem Rahmen zu fallen, galt es eine
Miniatur des Originals anzufertigen. Dieser Aufgabe widmete sich der
Urspringer Holz- und Motorsägekünstler Andreas Öhring. Der gelernte Maurer
fertigte in nahezu 20 Arbeitsstunden ein verkleinertes Abbild des
Überseekoffers aus massivem Eichenholz. Nach der groben Sägearbeit schnitzte
Öhring die Details wie die Beschläge in den etwa einen Zentner schweren
Holzblock ein, polierte den Koffer und versah ihn mit einem Schutzanstrich.
Die Vorsitzende des Förderkreises, Christine Kasamas, zeigte sich wie
Bürgermeister Volker Hemrich beeindruckt und begeistert von der
kunstfertigen Ausführung. Ein Mitarbeiter des Gemeindebauhofs wird den
Urspringer Koffer nun nach Würzburg bringen. Wann er dort aufgestellt wird
und wann der 'Denkort Deportationen' eröffnet wird, ist vorläufig noch
offen. Hemrich bedankte sich bei Öhring in Namen der Gemeinde für das
eindrucksvolle Kunstwerk."
Link zum Artikel vgl.
https://denkort-deportationen.de/ |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 419-420. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 122. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 398-399. |
 | Herbert Bald (Hrsg. im Auftrag des Landkreises
Main-Spessart und des Förderkreises Synagoge Urspringen): Das Projekt
Synagoge Urspringen. Würzburg 1993. |
 |  Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). Leonhard Scherg: Jüdisches
Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag
Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). |
 | ders.: Urspringen. Eine jüdische Gemeinde, eine Synagoge
und eine Genisa. In: Falk Wiesemann (Hrsg.): Genizah - Hidden Legacies of
the German Village Jews - Genisa - Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden.
Wien 1992. S. 51-57. |
 | ders.: Die Heilner-Brüder aus Urspringen - Eine
erfolgreiche Auswandererfamilie aus Bayern. In: Margot Hamm, Michael Henkel
und Evamaria Brockhoff: Good Bye Bayern. Grüß Gott Amerika. Augsburg 2004
S. 108-109. |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 163-165. |
 |  Hans-Peter
Süss: Jüdische Archäologie im nördlichen Bayern. Franken und
Oberfranken. Verlag Dr. Faustus Büchenbach 2010 (Reihe: Arbeiten zur
Archäologie Süddeutschlands Band 25). Zu Urspringen S. 139-141. Hans-Peter
Süss: Jüdische Archäologie im nördlichen Bayern. Franken und
Oberfranken. Verlag Dr. Faustus Büchenbach 2010 (Reihe: Arbeiten zur
Archäologie Süddeutschlands Band 25). Zu Urspringen S. 139-141.
|
 | 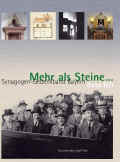 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-89870-449-6.
Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite
von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.
Abschnitt zu Urspringen S. 332-358.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Urspringen Lower Franconia. The first Jews settled in the
early 17th century after their expulsions from Wuerzburg. A new synagogue was
built in 1803 and a Jewish public school was subsequently opened. The Jewish
population reached 220 in 1837 (total 1.060) and thereafter declined steadily to
78 in 1933. Thirteen left in 1935-1938. On Kristallnacht (9-10 November
1938), the synagogue and Jewish homes were vandalized by local SA troops and a
few Jews were sent to the Dachau concentration camp. Another 13 Jews left by
late 1939. Of the remaining 44 Jews, 42 were deported to Izbica in the Lublin
district (Poland) via Wuerzburg on 25 April 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|