|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Heilbronn
Heilbronn (Stadtkreis)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Hier: Berichte zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde (1850-1938)
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Hinweis: einige Texte auf dieser Seite
müssen noch abgeschrieben und teilweise mit Anmerkungen versehen werden,
können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.
Verschiedentlich wird in den Anmerkungen
verwiesen auf Informationen aus der Publikation:
 | Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in
Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen
Verfolgungen (1050-1945). Veröffentlichungen des Archivs der Stadt
Heilbronn Heft 11. Heilbronn 1963.
Als Online-Publikation
des Stadtarchivs Heilbronn Nr. 3 zugänglich
(pdf-Datei) |
Übersicht:
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Über Elieser Heilbronn und weitere
Vertreter des Familiennamens Heilbronn usw. (Artikel von 1900)
Anmerkungen: vgl. Artikel zu
- Elieser Heilbronn
https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php/Elieser_Heilbronn
- Mose Katzenellenbogen
https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Mose_Katzenellenbogen
- Familie Katzenellenbogen:
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/9238-katzenellenbogen#403
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. August 1900: "Biographische Skizzen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. August 1900: "Biographische Skizzen.
3. Elieser Heilbronn (Leser Chariif).
Der Name Heilbronn ist in der jüdischen Literatur ziemlich stark vertreten
und weist jedenfalls auf die gleichnamige Stadt hin, wo im Mittelalter eine
nicht unbedeutende jüdische Gemeinde sich befand. Der Name hat sich in
verschiedenen Ländern, wo er vertreten ist, auch verschiedenartig gestaltet
und erscheint unter den Formen Heilbronn, Heilpern, Heilprin, Halpern und
Alpern.
Unser Elieser Heilbronn, der in Polen geboren ist, leitet seinen
Ursprung zweifellos auch auf Deutschland zurück, da sein Urgroßvater sich
auch Aschkenas schrieb. Derselbe hieß sonst Mosche b. Sebulun
Elieser Heilprin, war Rabbiner in Brisk (Litauen) und ist Verfasser von
Sichron Mosche (Lublin 1611); er war der Schwager des Maharascha.
Sein Sohn war Elieser Lipmann; sein Enkel Isack, Rabbiner in Tiktin,
war der Vater des Mordechai Heilprin in Jaroslaw und dieser zeugte
einen Sohn, unsern Elieser Heilbronn, der, 1648 in Jaroslaw geboren,
gemeinschaftlich mit seinem Jugendgenossen R. Naftali Kohn (später
Rabbiner in Frankfurt a. M.) bei dem damals berühmten Lehrer R. Josia
in Przemysl seine Talmudkenntnis erweiterte, die er bei R. Saul
Katzenellenbogen, Rabbiner in Pintschow, der später mit ihm in nähere
Verwandtschaft trat, noch vervollkommnete.
Elieser Heilbronn, dessen Scharfsinn ihm den Ehrennamen eines Charif
verschaffte (daher gewöhnlich R. Leser charif genannt), war zuerst Rabbiner
in Meseritz und dann in Tomaszow. Von hier erhielt er einen ehrenvollen Ruf
nach Fürth, dem er Folge leistete. Am
Donnerstag, 5. Nissan (25. März) 1700* wurde er mit großen Ehrenbezeugungen
in Fürth empfangen, wo er am folgenden Sabbat (Paraschat wejikra)
seine Antrittsdraschah (Antrittspredigt) hielt. Allein seine Wirksamkeit war
nicht von langer Dauer. Nach einem halben Jahre fand seine verdienstvolle
Tätigkeit ein schnelles Ende; im Alter von 52 Jahren starb er Freitag Abend
19. Tischri (29./30. September) 1700 und wurde Sonntag den 20. Tischri (8.
Oktober) zur Erde bestattet. Die Inschrift
*) Unterwegs 'auf der Reise zum Antritt seines Rabbinats in Fürth'
erteilte er in Breslau am 25. Adar eine Approbation zum ... (Dyhernfurth
1702)." |
 seines
Grabsteins, die ich Cod. 314 der Hamburger Stadtbibliothek entnehme, lautet
wie folgt: seines
Grabsteins, die ich Cod. 314 der Hamburger Stadtbibliothek entnehme, lautet
wie folgt:
* siehe unten ...
Von seinen wissenschaftlichen Werken ist nichts gedruckt. Dagegen besitzt
die Bodleiana in Oxford aus Michael's Nachlass handschriftlich das Siach
ha-Se'uddah, eine scharfsinnige Erklärung zu sämtlichen ... die im
Talmud vorkommen. Ferner befinden sich daselbst in einer Sammlung von
Novellen und Responsen seines Enkel Pinchas Katzenellenbogen, auch solche
von R. Leser Charif. Seine Frau Nechama war eine Tochter des Hirsch Busker
in Satanow. Durch seine Tochter Lea wurde R. Leser mit einer hoch
angesehenen und weit verzweigten Familie verschwägert, indem diese mit Moses
Katzenellenbogen, dem Rabbiner in Schwabach,
sich verehelichte. Aus dieser Ehe gingen Männer hervor, welche die Zierde
ihres Zeitalters bildeten; Pinchas Katzenellenbogen, Rabbiner in
Wallerstein; Elieser
Katzenellenbogen, Rabbiner in Hagenau,
Naftali Hirsch Katzenellenbogen, Rabbiner in
Mannheim." |
| |
Grabinschrift für
Elieser Heilbronn und Übersetzung nach Andreas Würfel (1754),
Quelle:
https://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php/Elieser_Heilbronn |
 |

|
|
| |
Rechtskonsulent Dr. Kallmann hat mit einem schwierigen
Kriminalfall zu tun (1846)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. April 1846: "Aus dem Württembergischen.
(Privatmitteilung). Den 28. Februar. Vorgestern fand vor dem königlichen
Gerichtshof in Esslingen die Schlussverhandlung in einem sehr schwierigen
Kriminalfall statt. Verteidiger war der israelitische Rechtskonsulent
Kallmann in Heilbronn. Derselbe hat sein Plädoyer mit so viel Scharfsinn,
Geistesgegenwart, Humanität und Beredsamkeit ausgeführt, dass ihm, zumal von
Menschenfreunden und Sachkennern, ungemein viel Beifall gezollt wurde..." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. April 1846: "Aus dem Württembergischen.
(Privatmitteilung). Den 28. Februar. Vorgestern fand vor dem königlichen
Gerichtshof in Esslingen die Schlussverhandlung in einem sehr schwierigen
Kriminalfall statt. Verteidiger war der israelitische Rechtskonsulent
Kallmann in Heilbronn. Derselbe hat sein Plädoyer mit so viel Scharfsinn,
Geistesgegenwart, Humanität und Beredsamkeit ausgeführt, dass ihm, zumal von
Menschenfreunden und Sachkennern, ungemein viel Beifall gezollt wurde..." |
Besuch bei Rechtskonsulent Dr. Kallmann in Heilbronn
(1851)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1851 - Aus einem Reisebericht durch Württemberg: "In
Heilbronn kam ich zur Rast. Ich stieg bei meinem Freunde Dr.
Kallmann ab, der mehrere Tage zuvor mit Glück einige der politischen
Angeklagten vor dem Schwurgerichte verteidigt hatte. Aber was hilft's, wenn
auch der Jude sich auszeichnet, im Judenhass sind die politischen Parteien
meistens einig: 'Aristokraten, Demokraten, — sie bieten sich die Hand, — der
Jude wird verbrannt!' Rechtskonsulent Dr. Kallmann ist Stadtrat, dass er
aber Jude ist, kann man ihm nicht verzeihen und deswegen ist es auch am
Geeignetsten, der Jude zieht sich von der politischen Arena zurück. Zum
Vorwurfe muss ich es dem frühem Vorsteher des israelitischen Lesevereins,
Dr. Kallmann, machen, dass er dieses schöne Institut eingehen ließ. Wir
wissen es wohl, wie schwierig es ist, solche Institute wach zu erhalten,
aber ein Mann von wahrer Begeisterung fürs Judentum, und von so poetischem
Gemüte, wie Herr Kallmann, sollte alle Hebel ansetzen, um das Interesse für
die neuere jüdische Literatur unter seinen Glaubensbrüdern lebendig zu
erhalten. Dies ist ja jetzt in Heilbronn um so leichter möglich, als mehrere
israelitische Familien sich dort niedergelassen haben und auch ein jüdischer
Arzt sich dort habilitiert hat." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Oktober 1851 - Aus einem Reisebericht durch Württemberg: "In
Heilbronn kam ich zur Rast. Ich stieg bei meinem Freunde Dr.
Kallmann ab, der mehrere Tage zuvor mit Glück einige der politischen
Angeklagten vor dem Schwurgerichte verteidigt hatte. Aber was hilft's, wenn
auch der Jude sich auszeichnet, im Judenhass sind die politischen Parteien
meistens einig: 'Aristokraten, Demokraten, — sie bieten sich die Hand, — der
Jude wird verbrannt!' Rechtskonsulent Dr. Kallmann ist Stadtrat, dass er
aber Jude ist, kann man ihm nicht verzeihen und deswegen ist es auch am
Geeignetsten, der Jude zieht sich von der politischen Arena zurück. Zum
Vorwurfe muss ich es dem frühem Vorsteher des israelitischen Lesevereins,
Dr. Kallmann, machen, dass er dieses schöne Institut eingehen ließ. Wir
wissen es wohl, wie schwierig es ist, solche Institute wach zu erhalten,
aber ein Mann von wahrer Begeisterung fürs Judentum, und von so poetischem
Gemüte, wie Herr Kallmann, sollte alle Hebel ansetzen, um das Interesse für
die neuere jüdische Literatur unter seinen Glaubensbrüdern lebendig zu
erhalten. Dies ist ja jetzt in Heilbronn um so leichter möglich, als mehrere
israelitische Familien sich dort niedergelassen haben und auch ein jüdischer
Arzt sich dort habilitiert hat." |
I. Stern wurde in den städtischen Bürgerausschuss
gewählt (1871)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. August 1871: "Heilbronn am Neckar. In dieser Woche
wurde ein hiesiger Kaufmann, Herr Is. Stern, in den städtischen
Bürgerausschuss gewählt. Es ist das erste Mal, dass hier ein Jude zu einem
solchen Ehrenamte berufen wird, da die vorjährige Erwählung des Herrn
Rechtsanwalts Dr. Schloss mehr die Wahl eines Advokaten als die eines
Juden zu bedeuten hatte. Auch hat Herr Stern seine Wahl fast ausnahmslos
christlichen Stimmen zu verdanken. Möge hier und allerwärts das Vorurteil
gegen die Juden immer mehr schwinden und diese sich des öffentlichen
Vertrauens würdig zeigen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. August 1871: "Heilbronn am Neckar. In dieser Woche
wurde ein hiesiger Kaufmann, Herr Is. Stern, in den städtischen
Bürgerausschuss gewählt. Es ist das erste Mal, dass hier ein Jude zu einem
solchen Ehrenamte berufen wird, da die vorjährige Erwählung des Herrn
Rechtsanwalts Dr. Schloss mehr die Wahl eines Advokaten als die eines
Juden zu bedeuten hatte. Auch hat Herr Stern seine Wahl fast ausnahmslos
christlichen Stimmen zu verdanken. Möge hier und allerwärts das Vorurteil
gegen die Juden immer mehr schwinden und diese sich des öffentlichen
Vertrauens würdig zeigen." |
Zum Tod von Rechtsanwalt Dr. Moritz Kallmann (geb. 1815
in Eschenau, gest. 1873 in Heilbronn)
 Artikel
in "Jüdische Volkszeitung" vom 7. Oktober 1873: "Heilbronn. In der
ersten Woche des September haben wir einen Mann hier zu Grabe getragen, der
unerwartet schnell seiner Familie, seinem Wirkungskreise, seinen
Glaubensgenossen und Mitbürgern durch den Tod entzogen wurde. Rechtsanwalt
Dr. Moritz Kallmann, geboren 1815 in
Eschenau bei Heilbronn, war dem Studium der jüdischen Theologie
bestimmt. In Nagelsberg bei dem
dortigen tiefgelehrten Rabbinen Hirsch wurde er in die rabbinische
Literatur eingeführt und als er mit 16 Jahren nach
Mannheim in die dortige Talmudschule
kam, ward er ein tüchtiger Jünger des Rabbi Jakob Ettlinger. Er
besuchte das Lyceum und trat von dort in das Gymnasium nach
Stuttgart über. 1835 bezog er die
Universität Tübingen, wo er bis 1839
verblieb und nach erstandenem Staatsprüfungen als Justizreferendar im
Staatsdienste wirkte. 1843 ließ er sich als Rechtsanwalt in Heilbronn
nieder, erwarb sich das Vertrauen seiner Mitbürger, wurde in den Stadtrat
gewählt und war in den städtischen Angelegenheiten tätig. Er war
Mitbegründer der israelitischen Kirchengemeinde und im Kultusvorstande
derselben bis zu seinem Tode. In jüngeren Jahren ein talentvoller
dramatischer Darsteller, war er Mitglied mehrerer Liebhabertheater und hätte
im Dienste der Thalia Rühmliches geleistet; aber auch als Poet war er
produktiv und in Gemeinschaft mit einigen Freunden förderte er manchen
Beitrag in belletristische Zeitschriften. Für das Judentum begeistert, hat
er seine reichen Kenntnisse im jüdischen Schriftentum noch zu erweitern
gesucht. Er starb, kaum 57 Jahre alt, betrauert von seiner Familie, seinen
Glaubensgenossen und Mitbürgern. Er ruhe in Frieden!" Artikel
in "Jüdische Volkszeitung" vom 7. Oktober 1873: "Heilbronn. In der
ersten Woche des September haben wir einen Mann hier zu Grabe getragen, der
unerwartet schnell seiner Familie, seinem Wirkungskreise, seinen
Glaubensgenossen und Mitbürgern durch den Tod entzogen wurde. Rechtsanwalt
Dr. Moritz Kallmann, geboren 1815 in
Eschenau bei Heilbronn, war dem Studium der jüdischen Theologie
bestimmt. In Nagelsberg bei dem
dortigen tiefgelehrten Rabbinen Hirsch wurde er in die rabbinische
Literatur eingeführt und als er mit 16 Jahren nach
Mannheim in die dortige Talmudschule
kam, ward er ein tüchtiger Jünger des Rabbi Jakob Ettlinger. Er
besuchte das Lyceum und trat von dort in das Gymnasium nach
Stuttgart über. 1835 bezog er die
Universität Tübingen, wo er bis 1839
verblieb und nach erstandenem Staatsprüfungen als Justizreferendar im
Staatsdienste wirkte. 1843 ließ er sich als Rechtsanwalt in Heilbronn
nieder, erwarb sich das Vertrauen seiner Mitbürger, wurde in den Stadtrat
gewählt und war in den städtischen Angelegenheiten tätig. Er war
Mitbegründer der israelitischen Kirchengemeinde und im Kultusvorstande
derselben bis zu seinem Tode. In jüngeren Jahren ein talentvoller
dramatischer Darsteller, war er Mitglied mehrerer Liebhabertheater und hätte
im Dienste der Thalia Rühmliches geleistet; aber auch als Poet war er
produktiv und in Gemeinschaft mit einigen Freunden förderte er manchen
Beitrag in belletristische Zeitschriften. Für das Judentum begeistert, hat
er seine reichen Kenntnisse im jüdischen Schriftentum noch zu erweitern
gesucht. Er starb, kaum 57 Jahre alt, betrauert von seiner Familie, seinen
Glaubensgenossen und Mitbürgern. Er ruhe in Frieden!" |
Dr. Löwenstein aus Heilbronn wird Justizassessor in
Tübingen (1876)
Über Lehrer Jakob Löwenstein siehe auf
Seite zu den jüdischen Lehrern in Heilbronn.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. August 1876: "Aus Württemberg, Dr. Löwenstein, Sohn des
israelitischen Lehrers Löwenstein in Heilbronn, wurde zum Justizassessor in
Tübingen ernannt und ist der erste Israelit in Württemberg, der ein
richterliches Amt bekleidet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. August 1876: "Aus Württemberg, Dr. Löwenstein, Sohn des
israelitischen Lehrers Löwenstein in Heilbronn, wurde zum Justizassessor in
Tübingen ernannt und ist der erste Israelit in Württemberg, der ein
richterliches Amt bekleidet." |
M.U. nimmt die Erklärung betr. der
Konfessionslosigkeit zurück (1877)
Anmerkung: zu diesem Sachverhalt liegen keine weiteren Informationen vor.
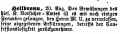 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. August 1877: "Heilbronn, 20. August. Den Bemühungen
des hiesigen Königlichen Vorsteher-Amtes ist es mit noch einigen Freunden
gelungen, den Herrn M. U. zu veranlassen, seine abgegebenen Erklärungen,
betreffs der Konfessionslosigkeit zurückzunehmen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. August 1877: "Heilbronn, 20. August. Den Bemühungen
des hiesigen Königlichen Vorsteher-Amtes ist es mit noch einigen Freunden
gelungen, den Herrn M. U. zu veranlassen, seine abgegebenen Erklärungen,
betreffs der Konfessionslosigkeit zurückzunehmen." |
Kritik an jüdischen Viehhändlern, die auch mit Schweinen
handeln (1878)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. Januar 1878: "Heilbronn. Zu meinem größten Bedauern habe
ich Veranlassung zu den in Ihrer geschätzten Zeitung unter der Aufschrift 'Curiosum'
und 'Trauriges Zeichen der Zeit' aus Krefeld und Prag gebrachten
Mitteilungen noch von einer dritten betrübenden Erscheinung zu berichten. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. Januar 1878: "Heilbronn. Zu meinem größten Bedauern habe
ich Veranlassung zu den in Ihrer geschätzten Zeitung unter der Aufschrift 'Curiosum'
und 'Trauriges Zeichen der Zeit' aus Krefeld und Prag gebrachten
Mitteilungen noch von einer dritten betrübenden Erscheinung zu berichten.
Zwei Israeliten, namens Kirchhausen und Grombacher,
veröffentlichen in der hiesigen 'Neckarzeitung' vom 22. Dezember und 1.
Januar zwei jeden wahrhaften Juden schmerzlich berührende Annoncen.
Dieselben lauten:
'Beachtenswerte Anzeige. Heute Samstag den 22. Dezember bringen wir einen
größeren 'Transport prima fetter Ungarschweine im Gasthof zur Linde zum
Verkauf und laden die hiesigen und auswärtigen Herren Metzgermeister dazu
ein. Verkaufstag nur Samstag.
Kirchhausen u. Grombacher.'
'Heilbronn. Ein Neujahrsgeschenk!! Am 'nächsten ersten Freitag im neuen
Jahren bringen wir eine größere Partie primafette Ungarschweine,
größtenteils englischer Rasse, im Gasthof zur Linde hier per Pfund zu 48 Pfg.
zum Verkaufe und laden hiezu die Herren Metzger, sowie Privatleute von hier
und der Umgegend mit der Zusicherung ein, dass wohl weder im Preise noch in
der Qualität der Ware jemand mit uns wird konkurrieren können.'
'Prosit zum Neujahr, 'Zur guten, billigen War!
'Alle kommet um zu kaufen, von Grombacher u. Kirchhausen.'
Wenn dem Juden der Handel mit Schweinen an und für sich religionsgesetzlich
verboten, wenn es in unserer Zeit leider keine seltene Erscheinung ist, dass
Juden den Sabbat öffentlich entweihen, so ist es aber gewiss unerhört und
wohl noch nie dagewesen, dass Juden im Glauben der Väter so weit
herabgesunken und sich nicht scheuen, aller Welt öffentlich anzuzeigen, dass
ihr 'Verkaufstag nur Samstag' ist." |
Zum Tod von Maier Strauß
(1885)
Anmerkung: Der Weinhändler Maier Strauß ist am 3. November 1803 in
Weikersheim geboren als Sohn des
Kaufmanns Hona Strauß und seiner Frau Klara geb. Sigel. Maier Strauß war seit
dem 9. Juni 1835 verheiratet mit Klara geb. Kohn, eine am 8. Mai 1814 in
Crailsheim geborene Tochter des Moses Löw
Kohn und der Bräunle /Babette geb. Löser. Die beiden hatten sieben - zwischen
1836 und 1848 noch in Weikersheim geborene - Kinder, von denen fünf noch im
Kindesalter verstorben sind. Maier Strauß war seit 1857 Bürger in Heilbronn.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Juni 1885: "Heilbronn a. N. Wieder hat der Tod eine
Lücke in die so lichten Reihen der Frommen gerissen. Am Freitag, dem 19. d.,
wurde seinem Wunsche gemäß Herr Maier Strauß von hier in seiner Geburtsstadt
Weikersheim, um deren israelitische
Gemeinde er sich als langjähriger Vorsteher große Verdienste erworben, an
der Seite seiner vor 3 1/2 Jahren entschlafenen Gattin zur ewigen Ruhe
gebettet. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Juni 1885: "Heilbronn a. N. Wieder hat der Tod eine
Lücke in die so lichten Reihen der Frommen gerissen. Am Freitag, dem 19. d.,
wurde seinem Wunsche gemäß Herr Maier Strauß von hier in seiner Geburtsstadt
Weikersheim, um deren israelitische
Gemeinde er sich als langjähriger Vorsteher große Verdienste erworben, an
der Seite seiner vor 3 1/2 Jahren entschlafenen Gattin zur ewigen Ruhe
gebettet.
Ausgestattet mit seltenen Gaben des Geistes und Herzens hat der Verewigte
diese von frühester Jugend an bis 2 Tage vor seinem, am Abend des 4. Tamus
erfolgten Tode, im Dienst seiner Religion und zum Wohl seiner Nebenmenschen
zu verwerten gewusst. Als Jude und Mensch gleich verehrungswürdig hat er
durch seine ungeheuchelte Frömmigkeit sich allgemeine Achtung erworben. Er
war ein echter Biedermann, Freund alles Edeln, ein wahrer Mensch, der
Frieden liebt und diesem nachstrebt. Mit einem umfassenden Wissen in der
jüdischen Lehre verband er zugleich auch den unbeugsamen Willen nach den
Vorschriften derselben zu handeln und kein Opfer zu scheuen, wo es galt, die
Gebote unserer heiligen Religion in herkömmlicher Weise zu erfüllen. Schon
vor dem Bestehen der neuen Synagoge, als ein reformierter Gottesdienst mit
Begleitung eines Harmoniums hier eingeführt wurde, hat der Verblichene mit
aller nötigen Ausstattung im eigenen Hause aus eigene Kosten einen Betsaal
errichtet, wo er täglich mit dem vorgeschriebenen Minjan Morgens und
Abends, meist selbst als Vorbeter, sowie auch als Bal Tokea, mit
ergreifender Innigkeit und Pünktlichkeit seine Andacht verrichtete.
Leider hatte er seit 2 Dezennien nach Vornahme einer unglücklichen Operation
sein Augenlicht verloren; dennoch hatte er mit seinem scharfen Geistesblicke
für alle Fragen und Fälle des Lebens ein lebhaftes Interesse. Ein Beweis
seines unbegrenzten Gottvertrauens, seiner wahrhaft edlen Frömmigkeit,
seiner treuen Hingebung an den göttlichen Willen ist es, dass während dieser
ganzen Zeit kein Wort der Klage über seine Lippen gekommen, selbst da nicht,
als vor etwa 7 Jahren ein Schlaganfall seine edle Gattin auf ein 3-jähriges
Krankenlager warf und ihn, den Gepflegten, nun zum Pfleger berief, welche
Aufgabe er in rührendster Weise mit Sohn und Tochter teilte.
Hand in Hand mit seiner seligen Gattin hat er in schönster Weise alle die
Pflichten der Wohltätigkeit (Gemilut Chesed) erfüllt;
mildtätig, allezeit zu körperlichen Leistungen so lange bereit, als seine
Natur es gestattete, war er im wahrhaften Sinne ein Vater aller Bedrängten.
Ja, wir dürfen es aussprechen, sein Leben rechtfertigt seinen Ruf. Sanft
hauchte der Edle nach kurzem Leiden in dem hohen Alter von fast 82 Jahren
seine reine Seele aus. Möge er im Himmel den verdienten Lohn für seine guten
Werke finden! Das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen." |
Rechtsanwalt Schloß wurde als Obmann des
Bürgerausschusses gewählt (1889)
Anmerkung: Jakob David Schloss ist am 14. November 1831 in
Laudenbach geboren als Sohn des dortigen
Viehhändlers David Schloss (1797-1865) und seiner Frau Esther geb. Dalheimer
(1798 Aufhausen -?). Jakob Schloss
heiratete am 28. April 1861 Mathilde geb. Hofmann (geb. 7. Februar 1862 in
Walldorf). Jakob Schloß war in Heilbronn als
Rechtskonsulent/Rechtsanwalt tätig. Er starb am 22. Februar 1910, seine Frau war
schon am 2. Mai 1904 gestorben.
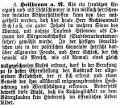 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Januar 1889: "Heilbronn a. N. Als ein freudiges Ereignis
und als Lichtschimmer in den vielfach herrschenden sozialen
Missverhältnissen kann von hier mitgeteilt werden, dass hier heute Herr
Rechtsanwalt Schloß, ein guter Jehudi im wahren Sinne des Wortes, mit
nahezu Tausend Stimmen als Obmann des Bürgerausschusses
(Stadtverordnetenvorsteher) gewählt wurde. In der hiesigen israelitischen
wie in der politischen Gemeinde herrscht darüber allgemeine Freude, und Herr
Schloß, der sich sowohl als Mensch, wie als Anwalt eines gleich
ausgezeichneten Rufes erfreut, darf in der Berufung zu so hoher
Ehrenstellung den Ausdruck der allgemeinen Beliebtheit, der er sich erfreut
und einen Beweis der ihm allüberall entgegengebrachten Hochachtung und
Werthschätzung erkennen. Anderseits beweist diese Wahl, dass die
Anhänglichkeit an dem Väterglauben kein Hindernis im öffentlichen Leben
bildet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Januar 1889: "Heilbronn a. N. Als ein freudiges Ereignis
und als Lichtschimmer in den vielfach herrschenden sozialen
Missverhältnissen kann von hier mitgeteilt werden, dass hier heute Herr
Rechtsanwalt Schloß, ein guter Jehudi im wahren Sinne des Wortes, mit
nahezu Tausend Stimmen als Obmann des Bürgerausschusses
(Stadtverordnetenvorsteher) gewählt wurde. In der hiesigen israelitischen
wie in der politischen Gemeinde herrscht darüber allgemeine Freude, und Herr
Schloß, der sich sowohl als Mensch, wie als Anwalt eines gleich
ausgezeichneten Rufes erfreut, darf in der Berufung zu so hoher
Ehrenstellung den Ausdruck der allgemeinen Beliebtheit, der er sich erfreut
und einen Beweis der ihm allüberall entgegengebrachten Hochachtung und
Werthschätzung erkennen. Anderseits beweist diese Wahl, dass die
Anhänglichkeit an dem Väterglauben kein Hindernis im öffentlichen Leben
bildet." |
Rechtsanwalt Rosengart wird in den städtischen Gemeinderat
gewählt (1889)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1889: "Heilbronn a. N., 10. Dezember. Bei der
gestrigen Gemeinderatswahl wurde erstmals seit Bestehen der hiesigen
israelitischen Gemeinde auch ein Mitglied derselben, Herr Rechtsanwalt
Rosengart, glänzend gewählt. Obwohl derselbe erst einige Jahre hier und
noch ein sehr junger Mann ist, gelang es ihm doch in kurzer Zeit, sich durch
die Beliebtheit bei seinen Mitbürgern auf diesen Ehrenposten berufen zu
sehen. Es beweist dies aufs Neue, dass der Antisemitismus am hiesigen Platze
keinen Boden hat, da auch der dermalige Stadtverordneten-Vorstand Israelit
ist. W." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1889: "Heilbronn a. N., 10. Dezember. Bei der
gestrigen Gemeinderatswahl wurde erstmals seit Bestehen der hiesigen
israelitischen Gemeinde auch ein Mitglied derselben, Herr Rechtsanwalt
Rosengart, glänzend gewählt. Obwohl derselbe erst einige Jahre hier und
noch ein sehr junger Mann ist, gelang es ihm doch in kurzer Zeit, sich durch
die Beliebtheit bei seinen Mitbürgern auf diesen Ehrenposten berufen zu
sehen. Es beweist dies aufs Neue, dass der Antisemitismus am hiesigen Platze
keinen Boden hat, da auch der dermalige Stadtverordneten-Vorstand Israelit
ist. W." |
Stiftungen des verstorbenen Papierfabrikanten Friedrich von
Rauch (nichtjüdisch, 1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. November 1890: "Heilbronn a. N., 7. November. Der
kürzlich verstorbene Papierfabrikant Friedrich v. Rauch hat neben anderen
Stiftungen der Stadtgemeinde testamentarisch ein Kapital von Mark 10.000
überwiesen, mit dessen Zinsen alljährlich würdige Schüler der Kaufmännischen
gewerblichen Fortbildungsschule ohne Unterschied der Konfession unterstützt
werden sollen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. November 1890: "Heilbronn a. N., 7. November. Der
kürzlich verstorbene Papierfabrikant Friedrich v. Rauch hat neben anderen
Stiftungen der Stadtgemeinde testamentarisch ein Kapital von Mark 10.000
überwiesen, mit dessen Zinsen alljährlich würdige Schüler der Kaufmännischen
gewerblichen Fortbildungsschule ohne Unterschied der Konfession unterstützt
werden sollen." |
25-jähriges Amtsjubiläum von Nathan Wachs als
Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege
(1892)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Juli 1892: "Heilbronn, 15. Juli (1892). Herr
Nathan Wachs feierte am 1. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum
als Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege. Die
Oberkirchenbehörde würdigte in einem Schreiben die hervorragenden
Verdienste des Jubilars sowohl im Allgemeinen als insbesondere während
der Anlage des Friedhofes und des Synagogenbaues. Dieses Dokument wurde
gestern Herrn Wachs durch das Gesamtkollegium des Kirchenvorsteheramtes
übergeben; Herr Rabbiner Kahn hielt dabei eine längere Ansprache.
Die hohe Behörde schloss ihr Schreiben mit dem Wunsche: 'Es möge Herrn
Wachs vergönnt sein, die Kirchenpflege in ebenso vorzüglicher als
pflichtgetreuer Weise noch lange Jahre zu verwalten zum Heile und Segen
der israelitischen Gemeinde Heilbronn.'" Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Juli 1892: "Heilbronn, 15. Juli (1892). Herr
Nathan Wachs feierte am 1. dieses Monats sein 25-jähriges Jubiläum
als Vorstand der Verwaltung der israelitischen Kirchenpflege. Die
Oberkirchenbehörde würdigte in einem Schreiben die hervorragenden
Verdienste des Jubilars sowohl im Allgemeinen als insbesondere während
der Anlage des Friedhofes und des Synagogenbaues. Dieses Dokument wurde
gestern Herrn Wachs durch das Gesamtkollegium des Kirchenvorsteheramtes
übergeben; Herr Rabbiner Kahn hielt dabei eine längere Ansprache.
Die hohe Behörde schloss ihr Schreiben mit dem Wunsche: 'Es möge Herrn
Wachs vergönnt sein, die Kirchenpflege in ebenso vorzüglicher als
pflichtgetreuer Weise noch lange Jahre zu verwalten zum Heile und Segen
der israelitischen Gemeinde Heilbronn.'" |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1892: "In Heilbronn feierte vorige Woche der
israelitische Kirchenpfleger Nathan Wachs sein 25-jähriges
Jubiläum und durfte sich dabei auch eines sehr anerkennenden
Glückwunschschreibens der Königlichen israelitischen Oberkirchenbehörde
erfreuen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1892: "In Heilbronn feierte vorige Woche der
israelitische Kirchenpfleger Nathan Wachs sein 25-jähriges
Jubiläum und durfte sich dabei auch eines sehr anerkennenden
Glückwunschschreibens der Königlichen israelitischen Oberkirchenbehörde
erfreuen." |
Der städtische Gemeinderat und der Bürgerausschuss tagen unter dem
Vorsitz von zwei jüdischen Gemeindemitgliedern
(1896)
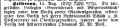 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. August 1896: "Heilbronn, 11. August. Die bürgerlichen
Kollegien (Gemeinderat und Bürgerausschuß) tagten unter dem Vorsitz zweier
Glaubensgenossen, ersterer unter dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts Schloß
z. Zt. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, letzterer unter dem Vorsitz
des stellvertretenden Obmanns W. M. Wolf." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. August 1896: "Heilbronn, 11. August. Die bürgerlichen
Kollegien (Gemeinderat und Bürgerausschuß) tagten unter dem Vorsitz zweier
Glaubensgenossen, ersterer unter dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalts Schloß
z. Zt. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, letzterer unter dem Vorsitz
des stellvertretenden Obmanns W. M. Wolf." |
90. Geburtstag von Babette Mayer
(1899)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. September 1899: "Heilbronn am Neckar. Am Hoschanna
Rabah beging die hiesige Frau Babette Mayer mit Gottes Hilfe
ihren 90. Geburtstag. Frau Mayer ist in dem altehrwürdigen, durch seine
frühere Jeschiwa (Talmudschule) bekannten Schwarzwalddorfe Mühringen
geboren, war in Horkheim bei Heilbronn
verheiratet und ist in den 70er-Jahren mit ihren Söhnen, denen sie stets
ein Gegenstand zarter Liebe und Aufmerksamkeit und religiöses Vorbild
gewesen, hierher gezogen. Die Frau hat das seltene Glücke körperlicher
und geistiger Frische und war am jüngsten Jom Kippur von Anfang
bis Schluss des Gottesdienstes fastend in der Synagoge. Es ist ein
Vergnügen sich mit ihr über Judentum zu unterhalten und sie mit
leuchtenden Blicken Stückchen aus ihrem durch Lektüre von Ze*enah
U-Re'enah (vgl. Artikel)
und anderen populären jüdischen Schriften erworbenen Schatze auskramen
zu hören; fast sämtliche Gebete und Psalmen kann sie auswendig beten.
Möge der ehrwürdigen Matrone noch eine Reihe gesunder Jahre beschieden
sein!" Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. September 1899: "Heilbronn am Neckar. Am Hoschanna
Rabah beging die hiesige Frau Babette Mayer mit Gottes Hilfe
ihren 90. Geburtstag. Frau Mayer ist in dem altehrwürdigen, durch seine
frühere Jeschiwa (Talmudschule) bekannten Schwarzwalddorfe Mühringen
geboren, war in Horkheim bei Heilbronn
verheiratet und ist in den 70er-Jahren mit ihren Söhnen, denen sie stets
ein Gegenstand zarter Liebe und Aufmerksamkeit und religiöses Vorbild
gewesen, hierher gezogen. Die Frau hat das seltene Glücke körperlicher
und geistiger Frische und war am jüngsten Jom Kippur von Anfang
bis Schluss des Gottesdienstes fastend in der Synagoge. Es ist ein
Vergnügen sich mit ihr über Judentum zu unterhalten und sie mit
leuchtenden Blicken Stückchen aus ihrem durch Lektüre von Ze*enah
U-Re'enah (vgl. Artikel)
und anderen populären jüdischen Schriften erworbenen Schatze auskramen
zu hören; fast sämtliche Gebete und Psalmen kann sie auswendig beten.
Möge der ehrwürdigen Matrone noch eine Reihe gesunder Jahre beschieden
sein!" |
Dr.
Hermann Strauß aus Heilbronn wird außerordentlicher Professor an der Charité
in Berlin (1902)
Anmerkung: es handelt sich um Hermann Strauß (geb. 28. April 1868 als Sohn
des Kaufmanns Heinrich Strauß und seiner Frau Röschen geb. Oppenheimer in
Heilbronn, umgekommen 17. Oktober 1944 im Ghetto Theresienstadt); Strauß wurde
1910 Chefarzt der inneren Abteilung im jüdischen Frankenhaus in Berlin; 1918
wurde er auf Grund seiner Verdienste um zwei Lazarette zum Geheimen Staatsrat
ernannt; 1933 verlor er seine Lehrbefugnis. Seine Frau Elsa geb. Isaac ist
gleichfalls im Ghetto Theresienstadt umgekommen. An Hermann Strauß erinnert ein
"Stolperstein" in Berlin-Charlottenburg, Kurfürstendamm
184.
weitere Informationen zu seiner Biographie siehe Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Strauß_(Arzt).
 Vgl.
Literatur: Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt Vgl.
Literatur: Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt
"Für meine Enkel niedergeschrieben" – unter dieser Überschrift verfasst der renommierte Berliner Internist Hermann Strauß (1868–1944) Ende 1941 seine autobiographischen Notizen. In einer jüdischen Familie in Heilbronn aufgewachsen, beschreibt er darin seine ambitionierte medizinische Ausbildung an der Charité und seine Tätigkeit im Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Hochengagiert leistet Strauß wegweisende wissenschaftliche Beiträge für die Spezialgebiete der Nephrologie und Gastroenterologie. Er ist publizistisch höchst produktiv und wirkt in einer Vielzahl von Fachgesellschaften mit. Strauß ist auch nach 1933 im Berliner Jüdischen Krankenhaus ärztlich tätig. 1942 werden er und seine Ehefrau deportiert. Seine Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt sind ein einzigartiges Zeitdokument eines Mitgliedes des dortigen Ältestenrates. Strauß stirbt im Oktober 1944 in Theresienstadt an den Folgen eines Herzinfarktes.
Hermann Strauß: Autobiographische Notizen und Aufzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt.
Herausgegeben von Harro Jenss und Peter Reinicke. Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Harro Jenss.
Mit einem Vorwort von Irene Hallmann-Strauß
Mit Faksimiles seiner maschinenschriftlichen Aufzeichnungen. 168 Seiten, Halbleinen mit Lesebändchen, 23 Abbildungen.
Verlag Hentrich & Hentrich Berlin 2014. ISBN: 978-3-95565-048-3, EUR 24,90.
Link
zur Verlagsseite.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Oktober 1902: "Zu außerordentlichen Professoren ernannt
sind die Privatdozenten in der medizinischen Fakultät der Berliner
Universität: Dr. Heinrich Rosin, ein Sohn des seligen Dr. David
Rosin, Assistent Senators, Dr. Max Hugo Michaelis und Dr.
Hermann Strauß. Michaelis, der 1869 in Berlin geboren wurde, ist Assistent
von Leydens an der ersten medizinischen Klinik der Charité. Strauß
stammt aus Heilbronn, wo er 1868 geboren wurde, und ist seit 1895
Assistent bei Senator an der dritten medizinischen Klinik der
Charité." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 31. Oktober 1902: "Zu außerordentlichen Professoren ernannt
sind die Privatdozenten in der medizinischen Fakultät der Berliner
Universität: Dr. Heinrich Rosin, ein Sohn des seligen Dr. David
Rosin, Assistent Senators, Dr. Max Hugo Michaelis und Dr.
Hermann Strauß. Michaelis, der 1869 in Berlin geboren wurde, ist Assistent
von Leydens an der ersten medizinischen Klinik der Charité. Strauß
stammt aus Heilbronn, wo er 1868 geboren wurde, und ist seit 1895
Assistent bei Senator an der dritten medizinischen Klinik der
Charité." |
Nathan
Wachs tritt nach 36 Jahren von seinem Amt als Kirchenpfleger und
Kirchenvorsteher zurück (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1904:
"Heilbronn, 22. April (1904). Herr Nathan Wachs hier hat in
der hiesigen israelitischen Gemeinde 36 Jahre lang als Kirchenpfleger und
Kirchenvorsteher gewirkt, zu welchen Ehrenämtern ihn das Vertrauen seiner
Mitbürger berufen hat. Aus Gesundheitsrücksichten musste er eine
Wiederwahl ablehnen. Als Zeichen der Anerkennung für seine
ersprießlichen Dienste wurde ihm nun am vergangenen Sabbat von dem
israelitischen Kirchenvorsteheramt eine schön ausgestattete Adresse
überreicht, in welcher seine rühmlichen Verdienste um unsere Gemeinde
hervorgehoben und ihm gebührender Dank ausgesprochen ist.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1904:
"Heilbronn, 22. April (1904). Herr Nathan Wachs hier hat in
der hiesigen israelitischen Gemeinde 36 Jahre lang als Kirchenpfleger und
Kirchenvorsteher gewirkt, zu welchen Ehrenämtern ihn das Vertrauen seiner
Mitbürger berufen hat. Aus Gesundheitsrücksichten musste er eine
Wiederwahl ablehnen. Als Zeichen der Anerkennung für seine
ersprießlichen Dienste wurde ihm nun am vergangenen Sabbat von dem
israelitischen Kirchenvorsteheramt eine schön ausgestattete Adresse
überreicht, in welcher seine rühmlichen Verdienste um unsere Gemeinde
hervorgehoben und ihm gebührender Dank ausgesprochen ist.
Möge es ihm vergönnt sein, sich dieser Ehrung noch recht lange erfreuen
zu dürfen." |
Kaufmann
Julius Spiegelthal wird ausgezeichnet (1907)
70. Geburtstag von Bürgerausschussmitglied W. M. Wolf
(1908)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. Januar 1908: "Heilbronn. Das Bürgerausschussmitglied
der Stadtgemeinde Heilbronn W. M. Wolf feierte dieser Tage seinen
70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden dem Jubilar sowohl von den
bürgerlichen Kollegien als auch von Seiten der israelitischen Gemeinde und
der verschiedenen Vereine, denen er angehört, zahlreiche Ovationen zu Teil,
die von der allgemeinen Beliebtheit und Wertschätzung, deren der Jubilar
sich in weiten Kreisen der Heilbronner Bürgerschaft erfreut, bereites
Zeugnis ablegen. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. Januar 1908: "Heilbronn. Das Bürgerausschussmitglied
der Stadtgemeinde Heilbronn W. M. Wolf feierte dieser Tage seinen
70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden dem Jubilar sowohl von den
bürgerlichen Kollegien als auch von Seiten der israelitischen Gemeinde und
der verschiedenen Vereine, denen er angehört, zahlreiche Ovationen zu Teil,
die von der allgemeinen Beliebtheit und Wertschätzung, deren der Jubilar
sich in weiten Kreisen der Heilbronner Bürgerschaft erfreut, bereites
Zeugnis ablegen.
Oberbürgermeister Dr. Göbel überbrachte dem Jubilar, der seit fast drei
Jahrzehnten den Bürgerausschuss als stellvertretender Obmann angehört, die
Glückwünsche der Stadtverwaltung unter Überreichung eines
Blumenarrangements.
In besonders festlicher Weise wurde des Jubilars in der Generalversammlung
des israelitischen Unterstützungsvereins gedacht, dessen Vorstand
Herr Wolf ist. Hier wies Herr Nathan auf die hervorragende Verdienste
des Jubilars als Mitbürger unserer Stadt, als Gemeindegenosse und als
Vorsitzender des Unterstützungsvereins hin und sprach ihm den innigsten Dank
und die wärmsten Glückwünsche aus. Alsdann verlas er die vom
Gesamtausschusse des Unterstützungvereins überreichte, künstlerisch
ausgestalte Adresse an den Jubelgreis. - Alexander Amberg
kennzeichnete, ausgehend vom kürzlich gefeierten 50-jährigen Jubiläum des
israelitischen Wohltätigkeitsvereins die außergewöhnliche Wirksamkeit und
Persönlichkeit des 70-jährigen Jubilar, seine selbstverleugnende,
überzeugungstreue, auch durch Misserfolge und Undank oder Beifall nicht
abzuschwächende Handlungsweise, sein reiches Wissen und Können, seinen
rastlosen Fleiß, seine edeldenkende Gesinnung, seine Herzensbildung. Mit der
Gründung der hiesigen israelitischen Gemeinde fällt seine Ansiedlung hier
zusammen: das Wachstum und Gedeihen dieser Gemeinde sei hauptsächlich ihm zu
verdanken. Rabbiner Kahn verließ seiner Freude darüber Ausdruck, dass
der Gefeierte es verstanden habe, in der israelitischen Gemeinde mit ihren
sozial-religiösen Aufgaben gleiche Erfolge zu erzielen wie in der
politischen Gemeinde. - Liebmann Strauß übermittelte namens des
Wohltätigkeitsvereins, dem M. W. Wolf seit 35 Jahren als Ausschussmitglied
angehört, die wärmsten Glückwünsche und brachte eine Adresse zur Verlesung.
Tief ergriffen, in wenigen schlichten Worten, dankte der Jubilar. Er schloss
seine Worte: 'Möge die Einigkeit der israelitischen Gemeinde, die sich heute
so schön gezeigt, auch in Zukunft bestehen!'" |
| |
|
Ergänzendes Dokument
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries): Postkarte
von W.M. Wolf an die
Gebrüder Reis in Heidelberg (1888) |
 |
 |
|
Es handelt sich um eine Postkarte geschäftlicher Art von W. M. Wolf an die Gebrüder Reis in Heidelberg,
die am 13. September 1888 verschickt wurde. Wolf Manasse Wolf ließ sich bereits 1862 in Heilbronn nieder und gründete dort eine Sortieranstalt für Lumpen, welche die beiden
Heilbronner Papierfabriken belieferte. Als Wolf Manasse Wolf 1916 starb, übernahmen die Söhne Julius Wolf und Hermann Wolf die Firma.
Wolf Manasse Wolf war auch über Jahrzehnte Mitglied im Bürgerausschuss der Stadt Heilbronn und wurde hierfür an seinem
70. Geburtstag von der Stadt Heilbronn geehrt (siehe oben). Zudem war er Gründer und Vorstand des "Vereins der unteren Stadt".
Lazarus und Simon Reis aus Wollenberg gründeten 1856
in Heidelberg eine Lumpenanstalt und 1871 eine Kunstwolle-Fabrik. Lazarus Reis liegt begraben auf dem
Bergfriedhof / Neuer jüdischer Friedhof in
Heidelberg - Foto
des Grabsteines.
Quellen: https://eichgasse1.wordpress.com/2013/03/11/wolf-manasse-wolf/
http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=hnn-0018
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Heilbronn:
Bismarckstraße 15 - Hermann Wolf
http://www.stolpersteine-heilbronn.de/stolpersteine2012_informationen.pdf
Bismarckstr. 15
Heidelberger Geschichtsverein e.V. - www.haidelberg.de
http://www.s197410804.online.de/ABC/ABCfirmen.htm#R |
Zum Tod von Liebmann Strauß
(1908)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. September 1908: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. September 1908: |
Isidor
Flegenheimer wird Eisenbahnbeirat in der Handelskammer (1911)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. Januar 1911: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 27. Januar 1911: |
Goldene Hochzeit von Leopold Rosenberg und Lina geb. Stiefel
(1913)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Juni 1913:
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Juni 1913: |
Vizewachtmeister Hugo Kern wird zum Leutnant
befördert (1918)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 15. Februar 1918: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 15. Februar 1918: |
70. Geburtstag von Oberkirchenvorsteher Louis Reis
(1921)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Februar 1921: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Februar 1921: |
Zum Tod von Alex Amberg
(1924)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Juli 1924: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Juli 1924: |
Zum Tod von David Reis
(1925)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1925: "Personalien. David Reis - er ruhe in
Frieden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Dezember 1925: "Personalien. David Reis - er ruhe in
Frieden.
Heilbronn, 10. Dezember. Ein imposanter Leichenzug, wie ihn Heilbronn
wohl noch selten gesehen, bewegte sich am Nachmittage des 16. Kislew durch
die Straßen der Stadt. Fast jede Familie der jüdischen Gesamtgemeinde war in
ihm vertreten; die Religionsgesellschaft 'Adaß Jeschuru' war vollzählig
erschienen; auch zahlreiche andersgläubige Mitbürger unserer Stadt waren bei
dem Leichenbegängnis zu sehen. Galt es doch, den beliebten, geachteten und
in allen jüdischen und nichtjüdischen Kreisen Heilbronns wohl bekannten
David Reis zur letzten Ruhe zu bestatten. Infolge der starken
Beteiligung bei der Beerdigung mussten die Trauerzeremonien außerhalb der
Leichenhalle des vorgenommen werden. Zum ersten Male seit Bestehen der
hiesigen Religionsgesellschaft waren die Amtshandlungen bei der Beerdigung
einzig und allein in die Hände der Funktionäre der Religionsgesellschaft
gelegt. Zuerst würdigte Herr Rabbiner Dr. Feinberg in
wohldurchdachter und formvollendeter Rede den Verblichenen als Mensch und
Jehudi. Den Dank und die warme Anerkennung für die aufopfernde Tätigkeit des
Verstorbenen für die Religionsgesellschaft erstattete deren 2. Vorsitzender,
Herr Hermann Wollenberger. War doch David Reis - er ruhe in Frieden -
der Begründer der Religionsgesellschaft Heilbronn und deren erstes
Vorstandsmitglied seit ihrem Bestehen bis heute und war doch diese seine
Gemeinde und ihr Gedeihen im vollsten Sinne des Wortes sein Lebensziel. Seit
Jahrzehnten im Vorstande des die Gesamtgemeinde umfassenden
Wohltätigkeitsvereins Chewrat gemilut chassodim erfreute sich der
Dahingeschiedene der Beliebtheit und Anerkennung aller Gemeindemitglieder,
was im Auftrage des 'Wohltätigkeitsvereins' seitens des Herrn Rabbiner Dr.
Feinberg besonders hervorgehoben wurde. Für den Landesverband zur Wahrung
der Interessen des gesetzestreuen Judentums in Württemberg, zu dessen
Gründern der Verstorbene gehörte und in dessen Vorstand seit seinem Bestehen
der Verewigte saß, sprach Herr Moses Herz -
Hall Worte des ehrenden, treuen und dankbaren Gedenkens. Im Namen der
Familie zeichnete der Schwiegersohn, Herr Josef Hirsch - Halberstadt, die
Persönlichkeit und Charaktergröße des Dahingeschiedenen in warmen und
bewegten Worten. Zum Schluss wies noch ein weiteres Mitglied der Familie,
Herr Ignaz Aron - Frankfurt, auf die eminente religiöse Überzeugung und
Glaubensstärke des Verstorbenen hin, die ihn, von vielen verkannt und nicht
verstanden, zur Gründung der Religionsgesellschaft veranlasste und so hier
eine Pflanzstätte für das gesetzestreue Judentum schaffen ließ.
So ist denn mit David Reis - er ruhe in Frieden - eine Persönlichkeit
von dannen gegangen, die im Kreise ihrer Familie, im engeren Kreise ihrer
Gesinnungsgenossen, in der Gesamtgemeinde Heilbronns, aber auch weit über
das Weichbild der Stadt hinaus, in weiten Kreisen des gesetzestreuen
Judentums eine kaum auszufüllende Lücke hinterlässt. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens. — Eine weitere Würdigung des
Dahingeschiedenen, insbesondere sein Verhältnis zu seiner Gemeinde, soll -
so G'tt will - am Ende des Schloschim (Trauermonat)
-einem Hesped (Trauerrede) Vorbehalten werden." |
| |
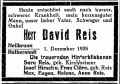 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Dezember 1925: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Dezember 1925: |
Zum Tod von Amanda Schloß geb. Frank
(1929)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Februar 1929: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Februar 1929: |
Rechtsanwalt Max Rosengart wird Ehrenbürger der Stadt
Heilbronn (1930)
 Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Juli 1930: Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Juli 1930: |
Zum Tod von Baruch Reis (1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. August 1930: "Heilbronn a. N., 31. Juli. Am 6. Tamus
traf unsere Religionsgesellschaft ein hartes Geschick. Nach langem, schwerem
Leiden atmete unser braver Baruch Reis seine reine Seele aus, kaum
63-jährig. Er gehörte noch zu der immer seltener werdenden alten, guten Art
Baalebattim (Hausvätern), die auch durch schwere und schwerste erwerbliche
Arbeit sich nicht von ihrer Liebe zum Hause G'ttes abbringen ließen.
Altväterliche Weise erklang aus seinem Munde, wenn er ehrfurchtvoll und
begeistert an den Sabbaten und Festen zum Amud trat, und mit reger
Teilnahme verfolgte er jedes Wort einer Predigt und eines Lehrvortrages. In
schwerer Zeit folgte er seinem auch vorzeitig dahingerafften Bruder im Amte
des Vorstandes seiner Adas Jeschurun, aus Pflichteifer, ohne jeden Ehrgeiz.
Auch seinem friedlichen, vorbildlichen und innigen Familienleben konnte
seine fleißige geschäftliche Arbeit nicht Abbruch tun. Er fehlt nun
vorzeitig seiner schwergeprüften Witwe, seinen Kindern und seiner Gemeinde,
die er aufblühen sah und an deren Gedeihen er unsterbliches Mitverdienst
sich erworben hat. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. August 1930: "Heilbronn a. N., 31. Juli. Am 6. Tamus
traf unsere Religionsgesellschaft ein hartes Geschick. Nach langem, schwerem
Leiden atmete unser braver Baruch Reis seine reine Seele aus, kaum
63-jährig. Er gehörte noch zu der immer seltener werdenden alten, guten Art
Baalebattim (Hausvätern), die auch durch schwere und schwerste erwerbliche
Arbeit sich nicht von ihrer Liebe zum Hause G'ttes abbringen ließen.
Altväterliche Weise erklang aus seinem Munde, wenn er ehrfurchtvoll und
begeistert an den Sabbaten und Festen zum Amud trat, und mit reger
Teilnahme verfolgte er jedes Wort einer Predigt und eines Lehrvortrages. In
schwerer Zeit folgte er seinem auch vorzeitig dahingerafften Bruder im Amte
des Vorstandes seiner Adas Jeschurun, aus Pflichteifer, ohne jeden Ehrgeiz.
Auch seinem friedlichen, vorbildlichen und innigen Familienleben konnte
seine fleißige geschäftliche Arbeit nicht Abbruch tun. Er fehlt nun
vorzeitig seiner schwergeprüften Witwe, seinen Kindern und seiner Gemeinde,
die er aufblühen sah und an deren Gedeihen er unsterbliches Mitverdienst
sich erworben hat. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Chower-(Ehrenrabbiner-)Titel für Dr. A. Würzburger
(1931)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Oktober 1931: "Heilbronn, 5. Oktober. Eine
wohlverdiente Ehrung wurde Herrn Dr. A. Würzburger zuteil, als er
anlässlich seines 65. Geburtstages mit dem Chower-Titel ausgezeichnet
wurde. Das zum größten Teil durch aufopferndes Selbststudium erworbene Maß
jüdischen Wissens verbreitet der auch anderweitig so Vielbeschäftigte bei
Jung und Alt in beispielloser Weise. Die Teilnehmer seiner anregenden
Schiurim (Lernstunden) werden dem Jubilar den Dank dafür zu zollen
wissen und wünschen ihm noch recht langes Wirken zum Guten des
Allgemeinheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. Oktober 1931: "Heilbronn, 5. Oktober. Eine
wohlverdiente Ehrung wurde Herrn Dr. A. Würzburger zuteil, als er
anlässlich seines 65. Geburtstages mit dem Chower-Titel ausgezeichnet
wurde. Das zum größten Teil durch aufopferndes Selbststudium erworbene Maß
jüdischen Wissens verbreitet der auch anderweitig so Vielbeschäftigte bei
Jung und Alt in beispielloser Weise. Die Teilnehmer seiner anregenden
Schiurim (Lernstunden) werden dem Jubilar den Dank dafür zu zollen
wissen und wünschen ihm noch recht langes Wirken zum Guten des
Allgemeinheit." |
Zum Tod von Hermann Wollenberger, langjähriger 2.
Vorsitzender der Israelitischen Religionsgesellschaft
(1932)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. April 1932: "Heilbronn a. N., 4. April. Einen ihrer
rührigsten Mitarbeiter hat die hiesige Israelitische Religionsgesellschaft
leider mit dem Hinscheiden ihres langjährigen 2. Vorsitzenden, Herrn Hermann
Wollenberger - er ruhe in Frieden - verloren. Im Verein mit
den Gebrüdern Reis und noch einigen Gesinnungsgenossen war er vor zwei
Jahrzehnten Mitbegründer dieser Vereinigung, die unter großen Opfern und mit
anerkennenswerter Energie die zum toratreuen Leben notwendigen Institutionen
schuf, und ... jeden, der mit ihnen in Berührung kam, von der heiligen
Begeisterung für Tora und die religiösen Gebote erfassen ließ. Dem
Wunsche des Verblichenen gemäß hielt Herr Rabbiner Dr. Ansbacher,
Wiesbaden, der ein Jahrzehnt geistiger
Führer jenes Kreises war, einen warmempfundenen Hesped (Trauerrede),
in dem er besonders die Treue seines Charakters, den praktischen Blick in
allen nötigen Beschlüssen und sein energisches Eintreten für die Interessen
der orthodoxen Gemeinde betonte, und den Wunsch aussprach, dass sich immer
Männer finden mögen, die auch dem Nachwuchs die unter großen Opfern
geschaffenen Institutionen erhalten werden. Als Vorsitzender der
Israelitischen Religions-Gesellschaft dankte auch Herr Heinrich Scheuer
dem Verblichenen für seine rührige Mitarbeit, woraus auch einer der
Angestellten im Namen des Personals dem Chef für sein vorbildlich gerechtes
Wesen dankte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. April 1932: "Heilbronn a. N., 4. April. Einen ihrer
rührigsten Mitarbeiter hat die hiesige Israelitische Religionsgesellschaft
leider mit dem Hinscheiden ihres langjährigen 2. Vorsitzenden, Herrn Hermann
Wollenberger - er ruhe in Frieden - verloren. Im Verein mit
den Gebrüdern Reis und noch einigen Gesinnungsgenossen war er vor zwei
Jahrzehnten Mitbegründer dieser Vereinigung, die unter großen Opfern und mit
anerkennenswerter Energie die zum toratreuen Leben notwendigen Institutionen
schuf, und ... jeden, der mit ihnen in Berührung kam, von der heiligen
Begeisterung für Tora und die religiösen Gebote erfassen ließ. Dem
Wunsche des Verblichenen gemäß hielt Herr Rabbiner Dr. Ansbacher,
Wiesbaden, der ein Jahrzehnt geistiger
Führer jenes Kreises war, einen warmempfundenen Hesped (Trauerrede),
in dem er besonders die Treue seines Charakters, den praktischen Blick in
allen nötigen Beschlüssen und sein energisches Eintreten für die Interessen
der orthodoxen Gemeinde betonte, und den Wunsch aussprach, dass sich immer
Männer finden mögen, die auch dem Nachwuchs die unter großen Opfern
geschaffenen Institutionen erhalten werden. Als Vorsitzender der
Israelitischen Religions-Gesellschaft dankte auch Herr Heinrich Scheuer
dem Verblichenen für seine rührige Mitarbeit, woraus auch einer der
Angestellten im Namen des Personals dem Chef für sein vorbildlich gerechtes
Wesen dankte. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Moses Reis, Mitbegründer der Israelitischen
Religionsgesellschaft (1935)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. August 1935: "Heilbronn a. N., 10. Aug. Am Tischa
beAw (9. Aw) trug unsere Israelitische Religionsgesellschaft Adaß
Jeschurun einen ihrer besten Männer, Moses Reis, 62jährig, zu Grabe.
Als Mitbegründer der nunmehr 25 Jahre bestehenden Gemeinde gehörte er
jahrelang dem Vorstand an. Dieser seiner Kehila galt neben den Sorgen um
seine Familie seine unermüdliche Arbeitskraft, sein ganzes Denken und
Streben. Als wahrer Kümmerer um die allgemeinen Bedürfnisse in Wahrheit
war er jedem ein väterlicher Freund und Ratgeber. Sein Wesenszug aber war
die vorbildliche Genauigkeit in der Ausübung der Mizwot, jenes
Ausüben der g'ttlichen Gebote, welches der reinen Liebe zur Tora
entspringt. Es verging keine Mahlzeit, bei der nicht etwas 'gelernt' wurde
und wie freute er sich, von Gästen am Tisch, die in seinem Haus die große
Wohltat von wahrer Gastfreundschaft erfahren durften, Worte der Tora
zu hören. Eine schwere Krankheit fesselte Moses Reis in den letzten Wochen
ans Bett; da durften wir seine alles in Liebe hinnehmende Demut bewundern,
die nie ein Wort der Klage über seine Lippen kommen ließ. Nun stehen nicht
nur seine Gattin, eine ebenbürtige Frau aus altjüdischem Frankfurter Haus,
nicht nur seine zwei Söhne, die erzogen im Blick auf die Segnungen der
Tora und G'ttesfurcht sein Glück bedeuteten, sondern auch eine große
Zahl trauernder Freunde an seinem Grabe, Möge uns allen sein Verdienst
beistehen, möge vor allem unsere Gemeinde das große Erbe, das er
hinterlassen, mit seinem Pflichtbewusstsein und mit seinem Ernst übernehmen.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. K.F." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. August 1935: "Heilbronn a. N., 10. Aug. Am Tischa
beAw (9. Aw) trug unsere Israelitische Religionsgesellschaft Adaß
Jeschurun einen ihrer besten Männer, Moses Reis, 62jährig, zu Grabe.
Als Mitbegründer der nunmehr 25 Jahre bestehenden Gemeinde gehörte er
jahrelang dem Vorstand an. Dieser seiner Kehila galt neben den Sorgen um
seine Familie seine unermüdliche Arbeitskraft, sein ganzes Denken und
Streben. Als wahrer Kümmerer um die allgemeinen Bedürfnisse in Wahrheit
war er jedem ein väterlicher Freund und Ratgeber. Sein Wesenszug aber war
die vorbildliche Genauigkeit in der Ausübung der Mizwot, jenes
Ausüben der g'ttlichen Gebote, welches der reinen Liebe zur Tora
entspringt. Es verging keine Mahlzeit, bei der nicht etwas 'gelernt' wurde
und wie freute er sich, von Gästen am Tisch, die in seinem Haus die große
Wohltat von wahrer Gastfreundschaft erfahren durften, Worte der Tora
zu hören. Eine schwere Krankheit fesselte Moses Reis in den letzten Wochen
ans Bett; da durften wir seine alles in Liebe hinnehmende Demut bewundern,
die nie ein Wort der Klage über seine Lippen kommen ließ. Nun stehen nicht
nur seine Gattin, eine ebenbürtige Frau aus altjüdischem Frankfurter Haus,
nicht nur seine zwei Söhne, die erzogen im Blick auf die Segnungen der
Tora und G'ttesfurcht sein Glück bedeuteten, sondern auch eine große
Zahl trauernder Freunde an seinem Grabe, Möge uns allen sein Verdienst
beistehen, möge vor allem unsere Gemeinde das große Erbe, das er
hinterlassen, mit seinem Pflichtbewusstsein und mit seinem Ernst übernehmen.
Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. K.F." |
| |
Weiteres
Dokument zu Moses Reis:
Postkarte an Herrn Moses Reis Söhne
vom 12. Januar 1920
(aus der Sammlung von
Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |
 |
|
|
Die Postkarte der Versicherungsanstalt Württemberg
wurde am 12. Januar 1920 versandt an die Herrn Moses Reis Söhne in
Heilbronn, Mozartstraße 25. Moses Reis führte zusammen mit Baruch und Max Reis den
Webwaren - Groß und Einzelhandel Jakob D. Reis. Moses Reis starb 1935 mit 62 Jahren. Er war einer der Mitbegründer
der Israelitischen Religionsgemeinschaft Adass Jeschuron, in der er auch als Schatzmeister tätig war.
Vgl. zur Israelitische Religionsgemeinschaft Adass Jeschurun e.V.: http://www.stadtarchiv-heilbronn.de/stadtgeschichte/stichworte/r/reis_sofie/
http://de.wikipedia.org/wiki/Adass_Jeschurun_%28Heilbronn%29. |
1945: Todesanzeige für die in Theresienstadt und Auschwitz umgekommenen Eugenie Reuter geb. Sinsheimer und Julius Reuter (1945)
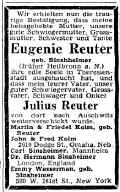 Anzeige
in der deutsch-amerikanischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2.
November 1945: Anzeige
in der deutsch-amerikanischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 2.
November 1945:
"Wir erhielten nun die traurige Bestätigung, dass meine heißgeliebte
Mutter, unsere gute Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und
Tante
Eugenie Reuter geb. Sinsheimer
(früher Heilbronn am Neckar)
ihre edle Seele in Theresienstadt ausgehaucht hat, und dass mein teurer
Vater, unser guter Schwiegervater, Großvater, Schwager und Onkel
Julius Reuter
von dort nach Auschwitz weiterverschickt wurde.
Martin & Friedel Kolm geb. Reuter
John & Fred Kolm 2610 Dodge St., Omaha, Neb.
Carl Sinsheimer, Mannheimer
Dr. Hermann Sinsheimer London, England
Emmy Wasserman geb. Sinsheimer 580 W. 161st St. New
York." |
Ergänzend eingestellt: Informationen zur
Biographie der 1913 in Heilbronn geborenen Hilde Oppenheimer verh. Tod siehe
ergänzende Seite bei Alemannia Judaica.
sowie Lebenslauf und Briefe
des 1914 in Heilbronn geborenen Hans-Georg Kirchheimer (Jean Georg Kirchheimer,
1914-1993)
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen der Fa. N. Wachs, Aussteuer- und Polsterwarengeschäft
(1872)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. April 1872: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. April 1872: |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Oktober 1890: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Oktober 1890: |
Anzeige des koscheren Hotels "Goldener
Adler" (1877)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1877: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1877: |
Anzeige der Firma Gebr. Dittmar
(1878)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. März 1878: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. März 1878: |
Anzeige des koscheren Hotels "Württemberger
Hof" von R. Levy (1884)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Mai 1884: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Mai 1884: |
Anzeige
des Tuch-, Mode- und Konfektionsgeschäftes R. Gummersheimer (1889)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. Mai 1889: "Lehrlings-Gesuch. In meinem Tuch-, Mode-
und Konfektionsgeschäft kann ein junger Mann mit guter
Schulbildung in Bälde eintreten. Kost und Logis im Hause gegen mäßige
Vergütung. R. Gummersheimer, Heilbronn am
Neckar."
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 30. Mai 1889: "Lehrlings-Gesuch. In meinem Tuch-, Mode-
und Konfektionsgeschäft kann ein junger Mann mit guter
Schulbildung in Bälde eintreten. Kost und Logis im Hause gegen mäßige
Vergütung. R. Gummersheimer, Heilbronn am
Neckar." |
Versteigerung einer Metzgerei
(1900)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. Juni 1900: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. Juni 1900: |
Verkauf der Metzgerei mit Wurstgeschäft von Jac.
Fleischhacker (1903)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. November 1903: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. November 1903: |
Anzeige
der Bäckerei Nath. Hahn Witwe (1904)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
11. Mai 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
11. Mai 1904: |
Anzeige des Metzgermeisters M. Rosenthaler
(1906)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. August 1906:
Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 31. August 1906: |
Anzeige
von Heinrich Scheuer (1919)
Anmerkung: die Familie wohnte in Heilbronn bis Mitte der 1930er-Jahre in der
Bismarckstraße 11: Heinrich Scheuer (geb. 1874) mit den Kindern u.a. Gertrud
(geb. 1915), Walter (geb. 1911). Die drei Genannten konnten in der NS-Zeit nach
Palästina/Israel emigrieren.
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 14. März 1919: "Haushälterin gesucht! Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 14. März 1919: "Haushälterin gesucht!
Infolge Todesfalls meiner lieben Frau, suche ich zur Führung meines
Haushalts und zur Erziehung meiner 4 Kinder (4 bis 11 Jahre), eine
tüchtige, gebildete, religiöse Dame aus guter Familie. Offerte
möglichst mit Bild erbeten. Heinrich Scheuer, Heilbronn,
Württemberg, Bismarckstraße 11." |
Anzeige der koscheren Pension Krips
(1921)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Januar 1921: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 20. Januar 1921: |
Hochzeitsanzeige
von Siegfried Maier und Siddy geb. Baer (1924)
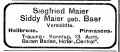 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 10. April 1924:
Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 10. April 1924:
"Siegfried Maier - Siddy Maier geb. Baer.
Vermählte. Heilbronn - Pirmasens.
Trauung: Sonntag, 13. April, Baden-Baden, Hotel Central'." |
Anzeige
der Spirituosenhandlung Landauer & Macholl (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. April 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. April 1924: |
Weitere Dokumente zu jüdischen
Gewerbebetrieben und Einzelpersonen
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
Briefumschlag
eines Briefes der
Gebr. Adler in Heilbronn (1875) |
 |
 |
| Der Brief der
Gebrüder Adler wurde am 20. August 1875 nach Crailsheim geschickt. |
| |
|
|
Postkarte an die Brauerei Gustav Würzburger
in Heilbronn aus Siegelsbach (1877) |
 |
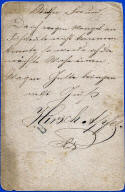 |
|
Die Postkarte wurde am 16. Oktober 1877 von
Hirsch Apfel aus Siegelsbach nach
Heilbronn an Herrn Gustav Würzburger, Brauerei verschickt. Zu dieser
Brauerei siehe Hans Franke (Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn.
S. 90–93.245): "Es kam selten vor, dass Brauereien im Besitz von Juden
waren bzw. das Gewerbe von Ihnen auch ausgeführt wurde. Aber als am 5. Juli
1882 Gustav Würzburger (zusammen mit M. Straßburger und Söhne in Mannheim;
diese wohl nur als Geldgeber) die in Konkurs geratene Brauerei von Wilhelm
Wecker jun., Deutschhofstraße 1, mitsamt den gesamten Liegenschaften und der
Brauereieinrichtung für 356 000 Mark erwarb, trat Nathan Würzburger, der
Bruder von Gustav Würzburger, als Braumeister in das Unternehmen ein. Das
dingliche Recht lautete auf Branntweinbrennerei, Brauereigewerbe und
Essigsiederei. In der Oberamtsbeschreibung heißt es anerkennend, dass 'außer
der Brauerei und Mälzerei mit Dampfbetrieb noch elektrischer Betrieb mit
Kraftübertragung von Laufen für die Eis- und Kühlmaschinen der Brauerei
eingerichtet' worden sei. Die 'Adlerbrauerei' entwickelte sich schnell und
wurde durch die umfangreichen Umbauten in den Jahren 1912 und 1926 in
Brauerei und Restaurationsbetrieb zum größten derartiger Betriebe im
Unterland. Zeitweise wurden im Restaurant 50 und in der Brauerei 20 Menschen
beschäftigt. Sowohl das Lokal in der Deutschhofstraße 1 wie der
'Adlerkeller' Klarastraße 21, boten mit ihren Nebenräumen usw. reichlich
Gelegenheit zu Zusammenkünften, und viele der jüdischen Vereine, so auch die
'Herderloge', hatten hier ihre Vereinslokalitäten. Hier fand die Mehrzahl
ihrer Veranstaltungen und Vorträge statt.
Bereits 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten begannen die
Repressalien gegen die Adlerbrauerei von Gustav Würzburger mit einem von der
Kreisleitung erlassenen Verbot für die Mitglieder der NSDAP Gaststätten zu
betreten in denen Bier der Adlerbrauerei ausgeschenkt wurde. In der Nacht
vom 11. Mai 1935 stürmte dann eine Horde von SA-Leuten in die Adlerbrauerei.
Dabei wurde das Ehepaar Alfred Würzburger und der alte Onkel Nathan
Würzburger so schwer misshandelt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert
werden mussten"..."Letztendlich gipfelte das alles in einem
Zwangsverkauf und der Arisierung der Adlerbrauerei der Familie Würzburger".
Der Absender der Karte - Hirsch Apfel, wurde am 12. August 1828 in
Siegelsbach geboren als siebtes und
letztgeborenes Kind von Jakob Apfel und Scheva (Eva) geb. Mai. Er war
verheiratet mit Lena geb. Vollweiler von Siegelsbach, geboren am 3. Januar
1840 in Siegelsbach, gestorben am 26. April 1914. Hirsch Apfel starb am 18.
Juni 1916 in Siegelsbach. Beide wurden im
jüdischen Friedhof in Bad Rappenau beigesetzt.
Quellen: Hans Franke: Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn.
S.90-93.245.
http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/termin/wirtschaftliche-auspluenderung-der-juedischen-bevoelkerung-im-nationalsozialismus-am-beispiel-der-adler-brauerei-wuerzburger-in-heilbronn/
https://www.findagrave.com/memorial/182973500/hirsch-apfel/photo
http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20266/35_Hirsch_Lena_Apfel.pdf
https://www.findagrave.com/memorial/181473197/jakob-apfel. |
| |
|
|
Postkarte an die Brauerei Gustav Würzburger
in Heilbronn aus Lauda (1884) |
 |
 |
|
Die Postkarte geschäftlicher Art wurde vom
der Handels- und Commissionsgesellschaft Joh. Jos. Stark in Lauda am 3.
August 1884 an Herrn Gustav Würzburger, Brauerei in Heilbronn verschickt.
Text der Karte: "Lauda 3. 8. 84. Herrn Gustav Würzburger; Habe die
sämtlichen Säcke in Besitz und sind 126 Stück. Neue Gerste sind schon
ziemlich unter Dach und dürften ungefähr nach dieser Woche gedroschen
werden. Gerste ist gut. Achtungsvoll - Joh. Jos. Stark, Handels &
Commissionsgesellschaft, Lauda". |
| |
|
|
Karte
an J. Prager in Heilbronn
aus Crailsheim (1880) |
 |
 |
| Die Karte wurde
von Sophie Gundelfinger aus Crailsheim am 29. April 1880 an J.
Prager nach Heilbronn geschickt. Nach H. Franke S. 92 (jüdische Firmen 1875)
hatte J. Prager ein "Lager in feineren & billigeren Kleiderstoffen, alle Sorten schwarze und
farbige Seidenzeuge, ... Flanelle für Kleider, Röcke und Hemden, Bett Bügel und Reisedecken usw.";
das Geschäft war in der Lohtorstraße 49. |
| |
|
|
Postkarte
aus Bruchsal an
Nathan Stein in Heilbronn (1884) |
 |
 |
| Die Karte wurde
aus Bruchsal am 25. Februar 1884 verschickt (Absender: ein Herr
Münzesheimer in Bruchsal). Der Empfänger
Nathan Stein war einer der
ersten Juden, die in Heilbronn zugezogen sind (erstmals 1838 genannt, 1843
im Adressbuch der Stadt). Er stammte aus Grombach,
und wohnte zunächst im Gasthaus "Zum Ritter". In den
1850er-Jahren wird er als Fruchthändler in der Lohtorstraße 51 genannt.
Er genoss hohes Ansehen in der Stadt (Franke S. 56.58). |
| |
|
Streifband
einer Zusendung
an Sam. J. Stern (1885) |
 |
| Die Zusendung -
vermutlich einer Zeitung im Streifband - erfolgte von Stuttgart nach
Heilbronn am 21. März 1885. S. J. Stern wird als Handelsmann in den
1850er-Jahren in der Deutschhofstraße 13 genannt; 1861 wurde er zu einem
der drei "Kirchenvorsteher" der Israelitischen Kirchengemeinde
gewählt; er war Teilhaber der Fa. Gebr. Stern und Rosenstein (Franke S.
57.58.69). |
| |
|
Postkarte
von
Max Rosenthal (1886) |

 |
 |
Die Postkarte aus Heilbronn wurde von Max Rosenthal, Garn & Kurzwaren en gros,
am 5. Juli 1886 an Simon Cahn in Frankfurt verschickt. Bei der 2. Heilbronner Deportation am 23. März 1942 über Haigerloch war auch
Max Rosenthal dabei. Er wurde in Maly Trostinec ermordet. Der genaue Zeitpunkt
seines Todes ist nicht bekannt. Weitere Informationen siehe:
http://www.mahnung-gegen-rechts.de/pages/staedte/Heilbronn/pages/HeilbronnMenschenverachtend.htm
http://www.stolpersteine-heilbronn.de/2014-03-14-datenbank-opfer-ns.pdf
http://www.stadtgeschichte-heilbronn.de/index.php?id=opfer
. |
| |
|
Karte an
Louis Haas
aus Zürich (1891) |
 |
| Die Karte wurde am
29. April 1891 von Zürich nach Heilbronn verschickt. Louis Haas findet sich noch als Rentier, Luisenstraße 30" in
der "Israelitischen Gemeindeliste vom 1. April 1937" bei H. Franke
S. 288. |
| |
|
|
Karte der Firma
Hermann Wollenberger (1896) |
 |
 |
| Die Karte wurde am
11. Januar 1896 an das Gerichtsvollzieheramt in Mainhardt geschickt; rechts Firmenstempel "Herm. Wollenberger - Heilbronn" |
| |
|
|
Karte der Firma H.
Gumbel
am Markt in Heilbronn (1904) |
 |
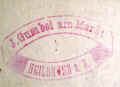 |
 |
| Die Karte von
J.
Gumbel wurde am 10. Mai 1904 nach Neuchatel in die Schweiz verschickt |
| |
|
|
Postkarte an Kaufmann
Moses Weil in Steinsfurt (1904) |
 |
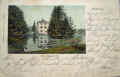 |
| Die Karte
wurde aus Heilbronn vermutlich von einem Angehörigen der Familie Weil am
23. April 1904 nach Steinsfurt geschickt: "Meine Lieben! Eben
wollte nach Steinsfurt fahren, aber ich bin bei der lieben Hedwig
geblieben... Ich komme nächsten Montag auf einige Stunden zu Euch. Alles
andere mündlich. Gruß und Kuss..." |
| |
|
|
Karte
von Nathan Adler
aus Heilbronn
nach Bopfingen (1912) |
 |
 |
| Die Karte wurde
von Nathan Adler am 3. Januar 1912 nach Bopfingen verschickt. Nathan Adler
war Inhaber der Häute- und Fellhandlung Adolf Adler (1931 in der Cäcilienstraße
52) |
| |
|
|
Umschlag
eines Briefes an die
Fa. Steigerwald & Co. (1919) |
 |
| Der Brief des
"Vereins der oberen Stadt" wurde an die Firma Steigerwald
(Likör- und Spirituosenfabrik in Heilbronn) am 25. September 1919
geschickt (vgl. H. Franke S. 94; ebd. S. 98 auch den Hinweis auf den im
Ersten Weltkrieg gefallenen Jakob Steigerwald; aus der Familie Steigerwald
sind nach ebd. S. 314 in der NS-Zeit sieben Mitglieder deportiert und
ermordet wurden). |
| |
|
|
Karte von "Wollenberger"
aus Heilbronn (1921) |
 |
 |
| Die Karte wurde im
Oktober nach Vaihingen/Enz an die dortige Gewerbebank geschickt. |
| |
|
|
Umschlag eines Briefes der
Rechtsanwälte Dr. Gumbel,
Koch & Dr. Scheuer, Heilbronn
(1923)
|
 |
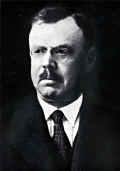 |
 |
Der Brief wurde am
7. September 1923 von Heilbronn nach Backnang verschickt.
Die als Absender genannte Rechtsanwaltspraxis war von Siegfried Gumbel gemeinsam mit
Camill Koch
und Dr. Manfred Scheuer gegründet worden. Sie genoss höchstes Ansehen in
Stadt und Region Heilbronn.
Dr. Siegfried Gumbel (1874-1942, Foto links) war vor allem in Zivilprozessen tätig, war lange
Jahre Vorsitzender des Heilbronner Anwaltsvereines und spielte in der
jüdischen Gemeinde wie im Leben der Stadt eine bedeutende Rolle. Er wurde
Ende Januar 1942 im KZ Dachau ermordet (vgl. weiteres zu seiner Biographie
im Wikipedia-Artikel
zu Siegfried Gumbel sowie in der Seite http://www.zeichen-der-erinnerung.org/n5_1_gumbel_siegfried.htm.
Dr. Manfred Scheuer (1893-1983; schwer verletzt als Unteroffizier
im Ersten Weltkrieg) war als Jurist in der Rechtsanwaltspraxis gemeinsam
mit Dr. Gumbel tätig; er konnte mit seiner Frau und drei
Kindern 1938 nach Palästina emigrieren; hier war er Mitbegründer und
erster Ortsvorsteher von Shavei Zion. Er hatte später große Bedeutung
beim Aufbau der Beziehungen nach Deutschland, u.a. über den ersten
Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss, den er bereits aus seiner
Heilbronner Zeit kannte. |
| |
|
|
Geschäftliche
Postkarte von
Max Pincus aus Heilbronn (1924) |
  |
 |
| Die Karte wurde am 15./16. Februar 1924
nach Bönnigheim versandt. Auf der Vorderseite findet sich als
Geschäftsstempel der Absender "Gothaer Feuerversicherungsbank a.G.
Max Pincus Heilbronn". Max Pincus (auch Pinkus) ist 1869 in Posen
geboren und war in Heilbronn als Versicherungsagent tätig (Adressen: 1931
Friedensstraße 31, Moltkestraße 27; zuletzt Sontheim - Landesasyl
Wilhelmsruhe, am 19.11.1940 wieder zurück nach Heilbronn,
wenig später nach Oberstotzingen eingewiesen, am 22. August 1942 nach Theresienstadt deportiert, Todestag dort - 10. Dez.
1942). |
| |
|
|
Umschlag
eines Briefes von
Heinrich Schwarzenberger
aus Heilbronn (1927) |
 |
| Der Brief der
Fa.
Heinrich Schwarzenberger wurde am 5. Mai 1927 aus Heilbronn an die
Spinnerei Neuhof in Hof (Bayern) verschickt. Damals waren die Inhaber der
Firma (Baumwollabfälle und Putzwollfabrik) Adolf und Lothar
Schwarzenberger (HN, Cäcilienstraße 29). Heinrich Schwarzenberger selbst
ist 1834 geboren und bereits 1893 gestorben (beigesetzt im jüdischen
Friedhof Heilbronn, Informationen
über Dokumentation des Friedhofes durch das Steinheim-Institut).
Weitere Informationen zur Familie Schwarzenberger finden sich im
Gedenkbuch für die Karlsruhe Juden zu Leon Schwarzenberger. |
| |
|
|
Postkarte
an Justin Aufseeser bei
Herrn M. Reis in Heilbronn (1931) |
 |
 |
| Die Karte an
Justin Aufseeser wurde am 27. März 1931 verschickt. Bei M. Reis
handelte es sich um Moses Reis. Woher Justin Aufseeser stammte,
konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. |
| |
|
Werbemarke
der Firma
Landauer und Macholl |
 |
|
 Die Firma Landauer
& Macholl (Gründer Max Landauer aus Gerabronn, geb. 1827; verheiratet
mit Lene geb. Macholl) wurde 1861/62 zunächst als Handelsfirma gegründet.
Nachdem er 1866 seinen Schwager Leopold Macholl mit ins Geschäft genommen
hatte, hieß die Brennerei fortan "Landauer und Macholl". Da die Geschäfte
sehr gut liefen, musste man bereits 1876 eine neue Dampfbrennerei und
Likörfabrik einrichten. In den Jahren 1906 bis 1912 wurde der Betrieb erneut
vergrößert. 1920 übernahm Landauers Sohn Fritz die Geschäftsleitung. Die
Firma wurde besonders durch ihre Cognac-Brennerei sowie durch ihre Kirsch-
und Zwetschgenwasser und feine Tafelliköre bekannt. Landauer & Macholl
erhielt auf der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung 1869 in Heilbronn eine
Belobigung. Bei der Pariser Weltausstellung 1900 wurde sie mit einer
Goldenen Medaille ausgezeichnet. In der Reichspogromnacht 1938 wurde die
Wohnung von Fritz Landauer verwüstet. Der Fall wurde damals, was eine große
Ausnahme darstellt, gerichtlich verfolgt. 1939 wurde Fritz Landauer
allerdings zum Verkauf seines Betriebes gezwungen. Der eigentliche
Verkaufspreis von 709.000 Reichsmark wurde durch verschiedenen Auflagen wie
Judenabgabe, Reichsfluchtsteuer u.a.m. auf 33.000 Reichsmark gedrückt. Fritz
Landauer überlebte die nationalsozialistische Zeit und den Zweiten
Weltkrieg. Seine Firma bestand auch wieder nach 1945. Er konnte die
Brennerei nach der Rückgabe wieder neu aufbauen. Er behielt die Leitung bis
1975 und hatte etwa 200 Mitarbeiter. 1981 übernahm der
Spirituosen-Hersteller Mampe den Betrieb.1962 konnte Inhaber Fritz Landauer das 100-jährige
Firmenjubiläum feiern. Die Firma machte während und nach dem Ersten
Weltkrieg bedeutsame Wohltätigkeits-Stiftungen (Informationen u.a. aus Franke
S. 93). Die Firma Landauer
& Macholl (Gründer Max Landauer aus Gerabronn, geb. 1827; verheiratet
mit Lene geb. Macholl) wurde 1861/62 zunächst als Handelsfirma gegründet.
Nachdem er 1866 seinen Schwager Leopold Macholl mit ins Geschäft genommen
hatte, hieß die Brennerei fortan "Landauer und Macholl". Da die Geschäfte
sehr gut liefen, musste man bereits 1876 eine neue Dampfbrennerei und
Likörfabrik einrichten. In den Jahren 1906 bis 1912 wurde der Betrieb erneut
vergrößert. 1920 übernahm Landauers Sohn Fritz die Geschäftsleitung. Die
Firma wurde besonders durch ihre Cognac-Brennerei sowie durch ihre Kirsch-
und Zwetschgenwasser und feine Tafelliköre bekannt. Landauer & Macholl
erhielt auf der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung 1869 in Heilbronn eine
Belobigung. Bei der Pariser Weltausstellung 1900 wurde sie mit einer
Goldenen Medaille ausgezeichnet. In der Reichspogromnacht 1938 wurde die
Wohnung von Fritz Landauer verwüstet. Der Fall wurde damals, was eine große
Ausnahme darstellt, gerichtlich verfolgt. 1939 wurde Fritz Landauer
allerdings zum Verkauf seines Betriebes gezwungen. Der eigentliche
Verkaufspreis von 709.000 Reichsmark wurde durch verschiedenen Auflagen wie
Judenabgabe, Reichsfluchtsteuer u.a.m. auf 33.000 Reichsmark gedrückt. Fritz
Landauer überlebte die nationalsozialistische Zeit und den Zweiten
Weltkrieg. Seine Firma bestand auch wieder nach 1945. Er konnte die
Brennerei nach der Rückgabe wieder neu aufbauen. Er behielt die Leitung bis
1975 und hatte etwa 200 Mitarbeiter. 1981 übernahm der
Spirituosen-Hersteller Mampe den Betrieb.1962 konnte Inhaber Fritz Landauer das 100-jährige
Firmenjubiläum feiern. Die Firma machte während und nach dem Ersten
Weltkrieg bedeutsame Wohltätigkeits-Stiftungen (Informationen u.a. aus Franke
S. 93). |
| |
|
 Hinweis
auf ein Buch zur Geschichte der Heilbronner Hammer-Brauerei Landauer &
Macholl: Helmut Müller: "Wieviel schöner ist das Leben, wenn wir einen Hammer
heben". Die Geschichte der Heilbronner Hammer-Brennerei Landauer
& Macholl. 176 S. ISBN 978-3-88260-094-0 24,80 € zzgl. Versandkosten.
Verlag Laub. Heilbronn 2007. www.creativ-text.de/publikationen/ Hinweis
auf ein Buch zur Geschichte der Heilbronner Hammer-Brauerei Landauer &
Macholl: Helmut Müller: "Wieviel schöner ist das Leben, wenn wir einen Hammer
heben". Die Geschichte der Heilbronner Hammer-Brennerei Landauer
& Macholl. 176 S. ISBN 978-3-88260-094-0 24,80 € zzgl. Versandkosten.
Verlag Laub. Heilbronn 2007. www.creativ-text.de/publikationen/
Zu diesem Buch: Hammer Jubelbrand - die Legende lebt. Alteingesessene Heilbronner kennen ihn noch, den legendären Hammer Jubelbrand - ein zart-duftender, milder Weinbrand in V.V.S.O.P.-Qualität von der Heilbronner Hammer-Brennerei Landauer & Macholl. Die Renaissance des Edelweinbrands 2015 gab dem freien Texter und Journalisten Helmut Müller den Anstoß zu Recherchen über die Hammer-Brennerei. Entstanden ist ein reich bebildertes Porträt eines jüdischen Familienunternehmens, das über vier Generationen Heilbronner Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat.
Unbekannte Quellen gesichtet. 1861 vom jüdischen Kaufmann Max Landauer gegründet, entwickelt sich das Unternehmen Landauer & Macholl mit dem Markenzeichen Hammer zum größten Spirituosenhersteller im südwestdeutschen Raum mit dem bundesweit breitesten Spektrum an hochwertigen Spirituosen. Für das Buch hat Helmut Müller in Archiven in Heilbronn, Gerabronn, Crailsheim, Ludwigsburg, Stuttgart und München bislang unbekannte Quellen zur Familie des Firmengründers Max Landauer ausfindig gemacht.
'Es war ungemein spannend nachzuvollziehen, unter welchen Umständen Max Landauer aufgewachsen ist und wie er sich schließlich 1861 mit einem Spirituosenhandel in Heilbronn niedergelassen
hat', sagt der Autor.
Geschichte jüdischen Lebens. Die Geschichte der Hammer-Brennerei ist zugleich eine Geschichte jüdischen Unternehmertums. Das Buch gibt Einblick in die jüdische Lebensweise, die jüdischer Kultur und das jüdische Netzwerk. Es schildert aber auch eindringlich die Zeiten der Verfolgung, Erniedrigung, Verleumdung und Entrechtung. Ausführlich wird das Vorgehen der Nationalsozialisten gegen die Familie Landauer und das Unternehmen geschildert, die komplette Zerstörung der Wohnungen einen Tag nach der Reichskristallnacht, die Arisierung des Unternehmens und der lange
'schmähliche Kampf um die Wiedergutmachung nach dem Krieg', so Helmut Müller.
Zeitzeugen befragt. Zur Nachkriegsgeschichte hat er viele Zeitzeugen befragt, darunter zahlreiche noch lebende ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hammer-Brennerei. Eine Gruppe trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr im Café des Insel-Hotels und tauscht Erinnerungen aus.
'So ist eine sehr lebendige Darstellung entstanden, die die Arbeitsatmosphäre und das Betriebsklima bei der Hammer-Brennerei sehr anschaulich
schildert', sagt Helmut Müller.
Anekdoten und Geschichten von Prominenten. Ergänzt wird das Buch mit Anekdoten und Schilderungen rund um die Hammer-Brennerei von Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Der in Heilbronn geborene Autor Rainer Moritz beispielsweise sinniert über die Werbung der Hammer-Brennerei. Der frühere Roigheimer Bürgermeister Dieter Schille skizziert die Rolle von Emil Stückle, Leiter des Berliner Verkaufsbüros von Landauer & Macholl. Steffen Schoch, Leiter der Heilbronn Marketing Gesellschaft, erinnert sich an seine Großmutter, die bei der Hammer-Brennerei einfach so aus Spaß gearbeitet hat. Und der frühere Friedrichshaller Bürgermeister Eugen Kocher weiß noch, wie nach dem Besuch seiner Abiturklasse bei der Hammer-Brennerei und der Verkostung diverser Spirituosen die Mädchen immer schöner geworden sind.
Kooperation mit Schnapsmuseum. Zahlreiche abgebildete Exponate und Dokumente stammen aus der Schatzkiste des Schwäbischen Schnapsmuseums in Bönnigheim.
'Leiter Kurt Sartorius hat bereitwillig die Tore des Museums für mich geöffnet und so die umfangreiche bildliche Darstellung im Buch erst ermöglicht', sagt Helmut Müller. Dass das Buch überhaupt entstanden ist, verdankt er Markus Weisser. Der gab dem Journalisten 2015 den Auftrag, den wieder ins Leben gerufenen Hammer Jubelbrand öffentlichkeitswirksam zu vermarkten.
'Ich recherchierte, las mich ein, und nachdem ich auch die Spirituosen der Jubelbrand-Linie gekostet hatte – meiner Frau und meiner Tochter schmeckte vor allem der Kräuterlikör – war ich mir sicher: Dieses Unternehmen verdient es, erinnert zu
werden'. |
| Hinweis: im
Rabbinatsmuseum Braunsbach hielt der
Leiter des Schwäbischen Schnapsmuseums Bönnigheim, Kurt Sartorius, am 11.
August 2019 einen Vortrag über die Schikanen im Nationalsozialismus gegen
jüdische Firmen. Er veranschaulicht dies am Beispiel der Heilbronner
Hammer-Brennerei. |
| |
|
Ansichtskarte
mit
Firma Louis Eisig (1927) |
 |
 |
| Postkarte
(Original von 1927, Nachdruck 1970er-Jahre) mit Ausschnittvergrößerung -
Geschäftshaus der Firma Louis Eisig |
| |
|
|
Ansichtskarte
mit Geschäft
von J. Danziger
in der Kaiserstraße 9
(um 1930) |
 |
 |
| J. Danziger wird
bei Franke S. 87 unter den Auflistungen zur Israelitischen Kirchengemeinde
Heilbronn genannt: "J. Danziger, Kaufmann, 1929-1931
Kirchenpfleger"; Liste ebd. S. 284 (nach dem Heilbronner Adressbuch 1931): "J. Danziger Nachfolger: Inh. Philipp Mendelssohn: Kaiserstraße
9" |
| |
|
|
Ansichtskarte
mit dem
Kaufhaus Gebr. Landauer
in der Kaiserstraße 44-48
(um 1930) |
 |
| Liste bei Franke
S. 285 (nach dem Heilbronner Adressbuch 1931):
"Brüder Landauer, Inh. Max Kaufmann; Kaufhaus; Kaiserstraße
44-48" |
|
Vor der Deportation:
Karte von Helene Würzburger (1941) |
 |
 |
| Die Karte wurde
von Helene Würzburger geb. Uri (geb. am 3. Dezember 1864 in Hechingen) am
9. April 1941 an ihre Enkel nach Lissabon geschickt, von dort aus
vermutlich nach Brooklyn weitergeleitet. Helene Würzburger wohnte in
Heilbronn in der Klarastr. 21. Sie wurde am 22. August 1942 von Haigerloch
aus nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 14. September 1942
umgekommen ist. |
| "Heilbronn, 8.4.1941.
Meine liebe Fridele (?)! Habe vielen Dank für deine liebevolle
Aufmerksamkeit, mit der du mich erquickt hast, doch sollst du kein Geld
für uns mehr ausgeben, ist es mir immer leid, deswegen. Ich hoffe, dass
Ihr alle wohl seid, werdet Ihr noch länger dort bleiben? Jetzt, so das
Frühjahr kommt, ist es gewiss sehr schön dort. Mir geht es
gesundheitlich ordentlich, in einigen Tagen ist Kurts und deiner lieben
Mutters Geburtstag, nie hätte ich gedacht, dass wir ein Mal so lange
voneinander getrennt würden. Von hier ist wenig zu berichten, eine Woche
geht dahin wie die andere. Mit innigem Gruß und Kuß! Eure Oma Helene.
" |
Sonstiges
Koschere
Zichorien aus Heilbronn - Anzeigen und Berichte
Bericht von Bezirksrabbiner Dr. Engelhart über die
Zichorienfabriken in der Stadt (1867)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. Juni 1867: "Heilbronn. In diesen Tagen besuchte ich
auf Anregung eines hiesigen Kaufmanns die Zichorienfabriken in der hiesigen
Stadt und fand zu meinem größten Leidwesen, dass wohl schon lange von den
Israeliten, welche den Zichorienkaffee von hier beziehen, unwissentlich
trefe (= treif, nicht koscher) genossen wurde, weil die
Zichorienschnitze vor dem Rösten mit Schweineschmalz begossen werden. In
einer Fabrik werden sämtliche inländische Zichorienwurzeln, weil sie wenig
Fettstoff enthalten, mit 1 1/2 - 2 % Schweineschmalz vermischt, während die
von Norddeutschland bezogenen ohne jegliches Surrogat fabriziert werden. In
den anderen Fabriken werden die mittleren Sorten von Zichorien mit Schmalz
vermengt. Auf diese Wahrnehmung hin habe ich die sämtlichen Gemeinden meines
Bezirkes von diesem Verbot durch folgendes Schreiben in Kenntnis
gesetzt: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12. Juni 1867: "Heilbronn. In diesen Tagen besuchte ich
auf Anregung eines hiesigen Kaufmanns die Zichorienfabriken in der hiesigen
Stadt und fand zu meinem größten Leidwesen, dass wohl schon lange von den
Israeliten, welche den Zichorienkaffee von hier beziehen, unwissentlich
trefe (= treif, nicht koscher) genossen wurde, weil die
Zichorienschnitze vor dem Rösten mit Schweineschmalz begossen werden. In
einer Fabrik werden sämtliche inländische Zichorienwurzeln, weil sie wenig
Fettstoff enthalten, mit 1 1/2 - 2 % Schweineschmalz vermischt, während die
von Norddeutschland bezogenen ohne jegliches Surrogat fabriziert werden. In
den anderen Fabriken werden die mittleren Sorten von Zichorien mit Schmalz
vermengt. Auf diese Wahrnehmung hin habe ich die sämtlichen Gemeinden meines
Bezirkes von diesem Verbot durch folgendes Schreiben in Kenntnis
gesetzt:
'Da der Unterzeichnete in diesen Tagen in den hiesigen Zichorienfabriken
wahrgenommen hat, dass die Zichorienschnitze vor dem Rösten mit
Schweineschmalz begossen werden, so wird dieses mit dem Bemerken zur
Kenntnis der Gemeinden gebracht, dass nach dem jüdischen Religionsgesetze
solcher Zichorienkaffee trefe (= nicht koscher) ist und nur derjenige
aus den hiesigen Fabriken bezogene Zichorienkaffee gebraucht weiden darf,
der unter Aufsicht eines Israeliten - eines treuen Mannes (= der sich
nach den Geboten verhält) - verfertigt wurde._ Ich bringe diese so wichtige
Angelegenheit zur öffentlichen Kenntnis, damit ein jeder Jehudi
(frommer Jude) sich darnach richten und sich von einem Übertritt des
Verbotes hüten möge; auch ersuche ich meine Herren Kollegen, welche
Gelegenheit haben, Zichorienfabriken zu besuchen, auch dort eine Recherche
anzustellen und das Resultat der Untersuchung zu veröffentlichen, auf dass
eine Übertretung des Verbotes nirgends mehr geschehe. Dazu wolle Gott
helfen! Dr. M. Engelbert Bezirksrabbiner." |
Eine Zichorien-Fabrik Heilbronns steht unter
Beaufsichtigung des Rabbinates (1867)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1867: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1867: |
Anzeigen des Zichorienfabrikanten Emil Seelig
(1867)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1867:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Juli 1867: |
| |
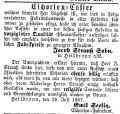 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. Juli 1867: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 2. Juli 1867: |
Anzeigen der Zichorienfabrik Emil Seelig A.G.
(1904)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Februar 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Februar 1904: |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März
1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März
1904: |
| |
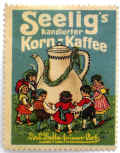 |
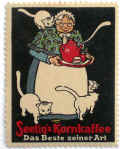 |
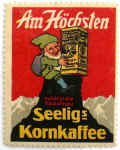 |
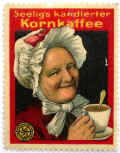 |
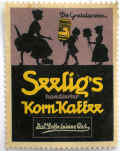 |
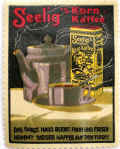 |
| Oben: Werbemarken -
Firmenvignetten der Fa. Emil Seelig A.G. in Heilbronn (aus der Sammlung
von Peter Karl Müller, Kirchheim /Ries) |
Die Zichorien der Zichorienfabrik von Emil
Seelig sind koscher (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Februar 1904: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. Februar 1904: |
|