|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Lahn-Dill-Kreis"
Herborn (Lahn-Dill-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Herborn
bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/40.
Bereits im Mittelalter gab es eine jüdische Gemeinde in Herborn, über
die jedoch nur wenige Mitteilungen vorliegen. 1377 wird eine
"Judenschule" in der Stadt genannt, ein Hinweis auf eine
mittelalterliche Synagoge, die vermutlich vor der Judenverfolgung in der
Pestzeit 1348/49 bestanden hat. 1396 wird eine jüdische Schule erwähnt.
Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht in das 17. Jahrhundert zurück,
1646 erhielt ein Jude aus Gladenbach
die Erlaubnis, sich in Herborn niederzulassen. In der Folgezeit sind vermutlich
weitere Juden beziehungsweise jüdische Familien nachgezogen, da 1660 die
Herforder Juden (im Plural!) das Recht zum Einzelverkauf von Fleisch erhalten
haben. Die Zahl der jüdischen Familien in der Stadt blieb jedoch relativ
gering: zwischen 1680 und 1840 zählte die Gemeinde nie mehr als acht
Haushaltungen.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1807 28 jüdische Einwohner, 1842 27, 1871 48 (1,9 % von insgesamt 2.568
Einwohnern), 1875 87, 1885 67 (2,2 % von 3.104), 1889 52 (in elf Haushaltungen),
1905 50 (1,6 % von 3.144), 1905 70 (1,7 % von 4.035).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine
Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe
Ausschreibungen der Stelle unten). In besonderer Erinnerung blieb Lehrer
Maier Rosenbaum, der von vor 1908 bis zu seinem Tod 1934 in der Gemeinde
wirkte. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Weilburg (beziehungsweise Bad
Ems - Weilburg).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Albert Rosenberg
(geb. 22.8.1877 in Grenzhausen, gef. 8.3.1916) und Julius Weinberg (geb.
18.4.1893 in Gersfeld, gef. 15.11.1914).
Anfang der 1930er-Jahre lebten die meisten jüdischen Familien in einfachen Verhältnissen
und betrieben Kleingewerbe. Zum "Mittelstand" gehörten die Familien
Hecht, Hattenbach, Sternberg (Konfektionshaus in der Hauptstraße) und
Seligmann.
Um 1924, als zur Gemeinde 124 Personen gehörten (2,2 % von insgesamt
5.600 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Leopold Hecht, Bär Sternberg und
Josef Hattenbach. Als Lehrer, Kantor und Schochet war der schon genannte Maier
Rosenbaum in der Gemeinde tätig. 1924 unterrichtete er 11 Kindern in Religion.
An jüdischen Vereinen bestand u.a. ein Israelitischer Frauenverein
(1924 unter Leitung der Frau von Sanitätsrat Dr. Weinberg, Frau Johanna
Schlossmann und der Frau von Heinrich Sternberg). 1932 waren die
Gemeindevorsteher Leopold Hecht (1. Vors.), Josef Hattenbach (2. Vors.) und
David Löwenstein (3. Vors.). Weiterhin war Maier Rosenbaum Lehrer, Kantor und
Schochet; er starb 1934. Im Schuljahr 1931/32 erteilte er noch sechs Kindern der
Gemeinde den Religionsunterricht.
1933 lebten noch 91 jüdische Personen in der Stadt (1,5 % von
insgesamt 6.193 Einwohnern). In den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938
wurde die Synagoge verwüstet, mehrere jüdische Wohnungen überfallen und
demoliert. Max Sternberg und Hugo Löwenstein wurden in das KZ Sachsenhausen
verschleppt. 1939 wurden noch 45 jüdische
Einwohner gezählt (0,7 % von insgesamt 6.478 Einwohnern). Die letzten
jüdischen Einwohner wurden am 10. Juni und am 28. August 1942 über Frankfurt in
das Ghetto Theresienstadt oder direkt in Vernichtungslager des Ostens deportiert: die
letzten 12 waren am 28. August 1942: Simon Friedemann, Karoline Friedemann, Rosa
Hattenbach, Leopold Hecht, Selma Hecht, Berta Levi, David Löwenstein, Rosa
Löwenstein, Henriette Lucas, Lina Rosenbaum, Abraham Simon und Karoline
Simon.
Anmerkung: Hinweis auf die "Liste
der aus Herborn deportierten Juden" (pdf-Datei der
an den International Tracing Service vom Magistrat der Stadt Herborn am
14.2.1962 mitgeteilten Liste mit 23 Namen aus Herborn).
Von den in Herborn geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; darunter sind auch die
Namen der jüdischen Patientinnen und Patienten der früheren
"Landesheilanstalt" in Herborn genannt, die nachweislich ermordet
wurden): Robert Bartenstein
(1902), Berta Bing geb. Rosenstein (1885), Schemajo Blumenthal (1871), Rosa Bock
geb. Sternberg (1887), Sara Bondi (1879), Martha Bornstein (1895), Ignatz
Breslau (1870), Franziska Calm geb. Isak (1883), Lieba (Linda) Cloossen (1894),
Herta Cohn (1896), Johanna Deutsch (1861), Sabine Einhorn geb. Bletz (1890),
Selma Faber (1870), Hilde Falk (1893), Irma Frank (1908), Abraham (Albrecht)
Frenkel (1874), Karoline Friedemann geb. Beifus (1878), Simon Friedemann (1875),
Auguste Grünebaum geb. Rosenstein (1892), Hugo Grünewald (1876), Joseph
Hattenbach (1877), Rosa Hattenbach geb. Katzenstein (1884), Else Hayum (1905),
Leopold Hecht (1862), Selma Hecht geb. Homburger (1876), Max Hirsch (1880),
Josef Hofmann (1892), Ernst Homberger (1872), Anna Junker (1874), Siegmund Katz
(1883), Bernhard Koch (1866), Helene Langenscheid geb. Goldstein (1896), Hedwig
Lebach geb. Baer (1895), Emilie Lehmann geb. Schweitzer (1868), Minna Lehmann
geb. Schweitzer (1864), Isidor Leopold (1880), Berta Levi geb. Dannheisser
(1873), Meier Levi (1892), Selma Levi geb. Hirsch (1904), Friedrich Levy (1889),
Isaak Lilienfeld (1876), David Löwenstein (1866), Rosa Löwenstein geb.
Blumenthal (1868), Henriette Lucas (1862), Josef Mandelbaum (1872), Paula Mayer
geb. Franken (1901), Grete (Margarete) Meyer geb. Ullmann (1919), Irma Nussbaum
(1921), Martin Pawel (1893), Karl Pollak (1901), Auguste Romberg geb. Holberg
(1875), Lina Rosenbaum geb. Hecht (1873), Berta Rosenberg geb. Hirsch (1905),
Emil Rosenstein (1881), Isidor Rosenstein (1890), Julius Salomon (1899), Meta
Salomon geb. Stern (1909), Silvia Salomon (1933), Auguste Schiff geb. Schweitzer
(1863), Suse (Susi) Schiffrin (1925), Richard Schulhaus (1887), Franziska
Schweizer (1873), Abraham Simon (1868), Irma Simon (1911), Karoline Simon geb.
Kirschner (1865), Betti Stern (1896), Julchen Stern geb. Hammerschlag
(1882), Moritz Stern (1877), Wilhelm Stern (1885), Ferdinand Sternberg (1885),
Kurt Süskind (1919), Lina Weiler geb. Mayer (1888), Josef Weissbecker (1876),
Friedrich (Fritz Louis) Wetzstein (1888), Selma Witzell geb. Herzberg
(1909).
Am heutigen Psychiatrischen Krankenhaus in Herborn (Zentrum für Soziale
Psychiatrie Rehbergpark Herborn gGmbH) ist eine Gedenktafel angebracht mit dem
Text: "Zum Gedenken an die ermordeten und zwangssterilisierten
Patientinnen und Patienten der Landesheil- und Pflegeanstalt Herborn. Ihr Leben
galt den Nationalsozialisten als 'lebensunwert'. Zwischen 1934 und 1939 wurden
an insgesamt 1184 angeblich erbkranken Menschen Zwangssterilisationen
durchgeführt. Von 1937 bis 1945 starben viele Patientinnen und Patienten, weil
die Ernährung und Unterbringung absichtlich drastisch verschlechtert wurde. Am
25.09.1940 wurden 22 jüdische Frauen und 16 jüdische Männer aus der Anstalt
abtransportiert und in Brandenburg/Havel ermordet. Von Januar bis Juli 1941
wurden 1630 Kranke über Herborn in andere Anstalten verlegt. Fast alle von
ihnen wurden Opfer der 'Euthanasie'-Verbrechen in Hadamar: 273 davon stammten
aus Herborn. Am 23.07.1941 wurden 504 Patientinnen und Patienten in andere
Anstalten gebracht. Von vielen ist ihr Schicksal unbekannt. Die noch Lebenden
und die Getöteten Menschen verpflichten und mahnen uns: Es gibt kein
lebensunwertes menschliches Leben".
Im November 2013 wurde am Eisernen Steg in Herborn ein Denkmal mit den
Namen von 63 ermordeten jüdischen Herbornern eingeweiht (siehe Pressebericht
unten).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1875 /
1878 / 1886 / 1887 / 1893
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1875:
"In der israelitischen Gemeinde Herborn (Nassau) ist die Stelle eines
Lehrers und Vorbeters mit 900 Mark zu besetzen. Reflektierende wollen ihre
Offerten mit Zeugnissen franco einsenden an den Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1875:
"In der israelitischen Gemeinde Herborn (Nassau) ist die Stelle eines
Lehrers und Vorbeters mit 900 Mark zu besetzen. Reflektierende wollen ihre
Offerten mit Zeugnissen franco einsenden an den
Vorsteher J. Rosenthal". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1878:
"Hiesige Lehrer- und Kantor-Stelle ist sofort zu besetzen. Gehalt
Mark 900 fix. Wer Schochet ist, kann diese Stelle auch dabei erhalten.
Anmeldungen mit Zeugnissen nimmt entgegen der Vorstand. Russen und Polen
werden nicht berücksichtigt. Herborn bei Wiesbaden, 17. März 1878.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. März 1878:
"Hiesige Lehrer- und Kantor-Stelle ist sofort zu besetzen. Gehalt
Mark 900 fix. Wer Schochet ist, kann diese Stelle auch dabei erhalten.
Anmeldungen mit Zeugnissen nimmt entgegen der Vorstand. Russen und Polen
werden nicht berücksichtigt. Herborn bei Wiesbaden, 17. März 1878.
J. Rosenthal." |
| |
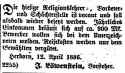 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1886:
"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Jährliches Einkommen
beläuft sich auf ca. 900 Mark. Bewerber wollen sich bei dem
Unterzeichnete melden. Reisekosten werden nur dem Gewählten
vergütet.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1886:
"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist
vakant und soll alsbald wieder besetzt werden. Jährliches Einkommen
beläuft sich auf ca. 900 Mark. Bewerber wollen sich bei dem
Unterzeichnete melden. Reisekosten werden nur dem Gewählten
vergütet.
Herborn, 12. April 1886. J. Löwenstein,
Vorsteher." |
| |
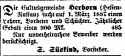 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Februar 1887:
"Die Kultusgemeinde Herborn (Hessen-Nassau) sucht auf 1. März 1887
einen Lehrer, Vorbeter und Schächter. Jährlicher Gehalt circa 900
Mark.
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Februar 1887:
"Die Kultusgemeinde Herborn (Hessen-Nassau) sucht auf 1. März 1887
einen Lehrer, Vorbeter und Schächter. Jährlicher Gehalt circa 900
Mark.
Nur unverheiratete Bewerber werden berücksichtigt.
S. Süskind, Vorsteher". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1887:
"Die israelitische Gemeinde Herborn sucht per 1. August einen
unverheirateten jungen Mann als Religionslehrer, Vorbeter und Schächter.
Wöchentlich 12 Stunden Unterricht. Der Gehalt beträgt circa 900 Mark.
Reflektanten wollen sich melden bei
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1887:
"Die israelitische Gemeinde Herborn sucht per 1. August einen
unverheirateten jungen Mann als Religionslehrer, Vorbeter und Schächter.
Wöchentlich 12 Stunden Unterricht. Der Gehalt beträgt circa 900 Mark.
Reflektanten wollen sich melden bei
Vorsteher S. Süßkind."
|
| |
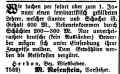 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1893:
"Wir suchen per sofort oder zum 1. Januar einen seminaristisch
gebildeten Lehrer, welcher Kantor und Schochet ist. Gehalt 600 Mark,
Nebeneinkommen durch Schächten 200-300 Mark. Nur unverheiratete deutsche
(kein Ausländer) Bewerber mögen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse
melden. Dem Gewählten werden die Reisekosten vergütet. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1893:
"Wir suchen per sofort oder zum 1. Januar einen seminaristisch
gebildeten Lehrer, welcher Kantor und Schochet ist. Gehalt 600 Mark,
Nebeneinkommen durch Schächten 200-300 Mark. Nur unverheiratete deutsche
(kein Ausländer) Bewerber mögen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse
melden. Dem Gewählten werden die Reisekosten vergütet.
Herborn, Bez. Wiesbaden. M. Rosenstein,
Vorsteher". |
Zum Tod des Lehrers Neumann (1920; Lehrer in
Herborn um 1880)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1920: "Friedberg in
Hessen, 7. März (1920). Unsere Gemeinde hat einen schweren Verlust
erlitten. Am Heiligen Schabbat mit
der Toralesung Teruma starb in Frankfurt am Main infolge einer
Operation Herr Lehrer Neumann, der mehr als zwanzig Jahre die Funktionen
eines Lehrers, Kantors und Schochets hier ausgeübt hat. Schüler der Präparandenanstalt
zu Burgpreppach und des Seminars zu Köln war er nacheinander in
Lohrhaupten, Herborn, an der Israelitischen Religionsgesellschaft in Gießen,
in Reinheim, Groß-Gerau und schließlich dahier tätig. Überall wusste
er sich durch große Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit die Zufriedenheit
der Gemeinden zu erwerben. An seinem Grabe sprachen Herr Rabbiner Dr.
Sander, Gießen, der besonders das Lehrgeschick des Verstorbenen
hervorhob, Herr Lehrer Ehrmann, dahier, für den ‚Unabhängigen Verein
israelitischer Lehrer Hessens’ und für den ‚Bund gesetzestreuer jüdischer
Lehrer Deutschlands’, denen der Verewigte angehört hatte, Herr Rektor
Philipps von der hiesigen Volksschule, das Vorstandsmitglied Herr
Ferdinand Krämer für die Gemeinde und Herr Studienassessor Ehrmann,
Frankfurt am Main, im Namen der Schüler. Möge sein Andenken ein
gesegnetes sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1920: "Friedberg in
Hessen, 7. März (1920). Unsere Gemeinde hat einen schweren Verlust
erlitten. Am Heiligen Schabbat mit
der Toralesung Teruma starb in Frankfurt am Main infolge einer
Operation Herr Lehrer Neumann, der mehr als zwanzig Jahre die Funktionen
eines Lehrers, Kantors und Schochets hier ausgeübt hat. Schüler der Präparandenanstalt
zu Burgpreppach und des Seminars zu Köln war er nacheinander in
Lohrhaupten, Herborn, an der Israelitischen Religionsgesellschaft in Gießen,
in Reinheim, Groß-Gerau und schließlich dahier tätig. Überall wusste
er sich durch große Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit die Zufriedenheit
der Gemeinden zu erwerben. An seinem Grabe sprachen Herr Rabbiner Dr.
Sander, Gießen, der besonders das Lehrgeschick des Verstorbenen
hervorhob, Herr Lehrer Ehrmann, dahier, für den ‚Unabhängigen Verein
israelitischer Lehrer Hessens’ und für den ‚Bund gesetzestreuer jüdischer
Lehrer Deutschlands’, denen der Verewigte angehört hatte, Herr Rektor
Philipps von der hiesigen Volksschule, das Vorstandsmitglied Herr
Ferdinand Krämer für die Gemeinde und Herr Studienassessor Ehrmann,
Frankfurt am Main, im Namen der Schüler. Möge sein Andenken ein
gesegnetes sein! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Heinrich Reuß, Lehrer in Herborn
um 1880 (gest. 1924 in Berlin)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:
"Berlin, 28. November 1924: "Berlin, 28. November (1924). In
Berlin verstarb Heinrich Reuß, ein verdienter Pädagoge und durch seine
Artikel auch unseren Lesern wohl bekannt. Reuß ist in Oberlauringen
geboren, von wo er mit 12 Jahren nach Burgpreppach
(Präparandie) und dann
nach Würzburg ins Lehrerseminar kam. Er war zuerst Religionslehrer in
Herborn und dann 12 Jahre Volksschullehrer und Prediger in Neustadt-Goedens.
Von dort kam er nach Aurich, wo er 14 Jahre als Hauptlehrer, Prediger und
Chasen segensreich wirkt. Seit 1908 lebte er in Berlin, wo er 14 Jahre
lang als Religionslehrer der Adaß und als Lehrer an der Talmud-Tora
Knesset-Jisroel wirkte. Er starb im Alter von 62 Jahren, wovon er 43 Jahre
als Lehrer eine Generation zur Tora und zu Weisheit erzog. Eine große
Reihe pädagogischer, religionsphilosophischer und belletristischer
Schriften sichert sein Andenken für alle Zeiten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:
"Berlin, 28. November 1924: "Berlin, 28. November (1924). In
Berlin verstarb Heinrich Reuß, ein verdienter Pädagoge und durch seine
Artikel auch unseren Lesern wohl bekannt. Reuß ist in Oberlauringen
geboren, von wo er mit 12 Jahren nach Burgpreppach
(Präparandie) und dann
nach Würzburg ins Lehrerseminar kam. Er war zuerst Religionslehrer in
Herborn und dann 12 Jahre Volksschullehrer und Prediger in Neustadt-Goedens.
Von dort kam er nach Aurich, wo er 14 Jahre als Hauptlehrer, Prediger und
Chasen segensreich wirkt. Seit 1908 lebte er in Berlin, wo er 14 Jahre
lang als Religionslehrer der Adaß und als Lehrer an der Talmud-Tora
Knesset-Jisroel wirkte. Er starb im Alter von 62 Jahren, wovon er 43 Jahre
als Lehrer eine Generation zur Tora und zu Weisheit erzog. Eine große
Reihe pädagogischer, religionsphilosophischer und belletristischer
Schriften sichert sein Andenken für alle Zeiten. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Verbesserungen für den Ruhegehalt des Lehrers (1908)
 Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. September
1908: "Oberlahnstein. Dem
Beispiele der meisten Gemeinden im ehemaligen Herzogtum Nassau folgend,
kaufte nunmehr auch unsere Kultusgemeinde die hiesige jüdische
Lehrerstelle in die Ruhegehaltskasse der Kommunalbeamten des
Regierungsbezirks Wiesbaden ein. - Diese erfreuliche Tatsache ist auch von
den Gemeinden Herborn und Langenschwalbach
zu berichten. - Vivat sequentes!" Mitteilung
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. September
1908: "Oberlahnstein. Dem
Beispiele der meisten Gemeinden im ehemaligen Herzogtum Nassau folgend,
kaufte nunmehr auch unsere Kultusgemeinde die hiesige jüdische
Lehrerstelle in die Ruhegehaltskasse der Kommunalbeamten des
Regierungsbezirks Wiesbaden ein. - Diese erfreuliche Tatsache ist auch von
den Gemeinden Herborn und Langenschwalbach
zu berichten. - Vivat sequentes!" |
Aus dem
jüdischen Gemeindeleben
Die jüdische Gemeinde verkauft eine Torarolle (1901)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Eine
gut erhaltene Sefer Thora ist preiswürdig zu verkaufen.
Gefällige Anfragen sind zu richten an Kultusvorsteher Hecht,
Herborn, Bezirk Wiesbaden." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Eine
gut erhaltene Sefer Thora ist preiswürdig zu verkaufen.
Gefällige Anfragen sind zu richten an Kultusvorsteher Hecht,
Herborn, Bezirk Wiesbaden." |
Spendenaufruf für bedürftige Familie von Lehrer Maier Rosenbaum (1908)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
17. September 1908: "Herzliche Bitte! Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
17. September 1908: "Herzliche Bitte!
Unterzeichneter appelliert an den Wohltätigkeitssinn aller
Glaubensgenossen, eine arme, sehr bedürftige Familie zu unterstützen. Da
größere Schulden zu decken sind, so möge meine Bitte nicht unerhört
bleiben. -
Spenden befördert
M. Rosenbaum, Lehrer
Herborn (Nassau)." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Sanitätsrat Dr. Salomo
Weinberg (1931)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1931:
"Herborn, 16. Januar (1931). Am 12. Januar verschied hier
unerwartet im 66. Lebensjahr - aus einem selten arbeitsreichen und
fruchtbaren Wirken jäh hinweggerissen - der praktische Arzt, Sanitätsrat
Dr. Salomo Weinberg.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Januar 1931:
"Herborn, 16. Januar (1931). Am 12. Januar verschied hier
unerwartet im 66. Lebensjahr - aus einem selten arbeitsreichen und
fruchtbaren Wirken jäh hinweggerissen - der praktische Arzt, Sanitätsrat
Dr. Salomo Weinberg.
Der Verblichene, einem angesehenen gesetzestreuen Haus in Gersfeld (Rhön)
entstammend, übte zuerst seine Praxis in seinem Heimatsorte aus und
siedelte dann vor 20 Jahren nach Herborn über. Schön früh erwarb er
sich durch seine ungewöhnliche berufliche Tüchtigkeit, verbunden mit
hohen menschlichen Qualitäten, in seltenem Maße die Achtung und das
Vertrauen seiner Mitbürger. Trotz seines anstrengenden Berufes eignete er
sich schon in jungen Jahren ein großes religiöses Wissen an, sodass ihm
schon bald die Chowerwürde zuteil wurde.
Mit Dr. Weinberg ist ein Mann dahingegangen von eigenem Gepräge, eine
geschlossene Persönlichkeit, ein fester Charakter, der, in sich beruhend,
still und gerade seinen Weg ging. Treue zum Gesetze in sich und über
sich, Gewissenhaftigkeit und Ehrfurcht, das machten das Wesen dieses
Mannes aus. Aus dieser Grundhaltung heraus versteht sich - nur einem nicht
tief genug gehenden, unverständlich - die Synthese von streng
gesetzhaftem naturwissenschaftlichem Handeln, die auch im kleinsten Detail
zur gewissenhaften Durchführung der Gebote und Vorschriften der
jüdischen Lehre führt.
Tiefe Religiosität erfüllte die Seele dieses adligen und starken
Menschen, dessen seltener kritischer und überlegener Geist demütig Halt
machte vor den Rätseln des Unerforschlichen. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Untersagung der Ausübung der Handelstätigkeit für
jüdische Unternehmen (1937)
(aus der Sammlung von Hans-Peter
Trautmann)
 Anzeige vom 14. Mai 1937: "Untersagung der Ausübung der
Handelstätigkeit wegen Unzuverlässigkeit.
Anzeige vom 14. Mai 1937: "Untersagung der Ausübung der
Handelstätigkeit wegen Unzuverlässigkeit.
Lpd. Die Landesbauernschaft Hessen-Nassau teilt mit: Im Gebiet der
Landesbauernschaft Hessen-Nassau ist im Jahre 1936/37 folgenden Betrieben
wegen Unzuverlässigkeit die Handelserlaubnis entzogen worden: 1. Gebrüder
Karlsberg, Viehhandlung, Fränkisch-Crumbach.
(Entzug der Handelserlaubnis - Entscheidung des Provinzialausschusses der
Provinz Starkenberg vom 21.10.1936). 2. Gustav Sternberg,
Viehhändler, Herborn (Dillkreis), Hauptstraße 105a. (Entzug der
Handelserlaubnis für Vieh, Fleisch, rohe Häute und Felle - Verfügung
des Landrats von Dillenburg vom 24.10.1936). 3. Ludwig Oppenheimer,
Neckarsteinach. (Ablehnung der
Legitimationskarte für 1936 - Entscheidung des Provinzialausschusses
Starkenburg vom 7.10.1936 und für 1937 - Entscheidung des Kreisamtes
Heppenheim a.d.B.) ... 6. Firma Gärtner und Blum, Nierstein
am Rhein (Entzug der Handelserlaubnis wegen Verstoßes gegen das
Weingesetz. Urteil des Landgerichts Mainz - Große Strafkammer). 7. S.
Heymann Söhne, Mainz, Breidenbacherstraße 25 (Entzug der
Handelserlaubnis wegen Verstoßes gegen das Weingesetz - Urteil des Landgerichts
Mainz. Große Strafkammer).... Die Firmen zu 1,2,3,6 und 7 sind sämtlich
jüdische Firmen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Im Mittelalter war eine (1377 genannte) "Judenschule" (Synagoge)
vorhanden. Es wurde mehrfach die Vermutung geäußert, dass sich diese - auf
Grund des vorhandenen rituellen Bades möglicherweise bereits im Haus Kornmarkt
22 bzw. einem mittelalterlichen Vorgängerbau befand. Nach Thea Altaras war
das rituelle Bad eine selbständige Anlage. Es ist nach ihr möglich
("keineswegs auszuschließen"), jedoch nicht nachzuweisen, dass diese
Anlage des rituellen Bades bereits mit der 1377 erwähnten Synagoge bzw. der
1396 erwähnten jüdischen Schule in baulicher Verbindung gestanden
ist. So bleibt offen, wo sich die mittelalterliche Synagoge in der Stadt
befand.
Das Gebäude Kornmarkt 22 wurde Anfang des 17. Jahrhunderts (1609) nach
einem Besitzerwechsel in größerem Ausmaß renoviert und vergrößert. Um
1677 erfolgte ein erneuter Besitzwechsel eines Gebäudeteils: die südliche
Hälfte des Gebäudes kam in jüdischen Besitz. Damals wurden eine Synagoge,
Schulräume für den Unterricht und eine Wohnung eingerichtet. Die Wohnung
könnte von einem Rabbiner bewohnt gewesen sein, was nach Thea Altaras
"durchaus möglich gewesen sein konnte, zumal Anfang des 18. Jahrhunderts
auch Rabbi Levi aus Katzenfurt an der
Hohen Schule in Herborn mitgewirkt haben soll".
1805 kam auch die nördliche Hälfte des Gebäudes am Kornmarkt in
jüdischen Besitz. 1840 wechselte das Gebäude wiederum den Besitzer,
jedoch fand auch danach, mit kurzen Unterbrechungen, der jüdische Gottesdienst
in diesem Gebäude in einem gemieteten Raum statt.
1875 richtete die jüdische Gemeinde eine Synagoge
(beziehungsweise einen Betraum) in einem
einfachen Fachwerkgebäude hinter dem Amtsgericht ein. 1880 beantragten
die überwiegend in sehr einfachen Verhältnissen lebenden jüdischen Familien
der Stadt bei den Behörden die Durchführung einer Kollekte für einen
Synagogenneubau, jedoch reichten die eingesammelten Summen - auch von einer
später durchgeführten weiteren Kollekte - zum Bau einer neuen Synagogen nicht aus. 1928
hatte die Gemeinde erneut vor, einen Synagogenneubau anzugehen, da sich
das Gebäude hinter dem Amtsgericht in baufälligem Zustand befand. Die
jüdische Gemeinde bat damals den Magistrat darum, dass ein Bauplatz für einen
Synagogenplatz unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 1929 wurde der
Entwurf einer neuen Synagoge (mit 64 Plätzen für Männer und 48 für Frauen)
vorgelegt. Die Pläne konnten jedoch nicht mehr ausgeführt werden, obwohl im Februar
1932 der Magistrat eine finanziellen Zuschuss für die Errichtung einer
Synagoge in Aussicht gestellt hatte. Für den Neubau war ein Bauplatz an der
Ecke Mühlgasse und Schulhofstraße (gegenüber der Hohen Schule)
vorgesehen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge hinter dem Amtsgericht
verwüstet in angezündet. Das Dach des Synagogengebäudes wurde dabei
zerstört. Das Gebäude blieb nach 1945 erhalten, wurde jedoch 1982
abgebrochen.
Das rituelle Bad im Kellergewölbe des Hauses Kornmarkt
22 wurde 1983 ausgegraben und restauriert. Es befindet sich in der
südlichen Hälfte des aus Bruchsteinen gemauerten Gewölbekeller. Eine exakte
Datierung mit baugeschichtlichen Daten des Bades ist nicht möglich. Nicht
ausgeschlossen werden kann, dass das Bad bereits im 14. Jahrhundert in
Verbindung mit einer 1377 erwähnten Synagoge in Herborn stand. Doch ist dies
auch bislang nicht nachzuweisen. Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert haben
mehrere Umbauten des Hauses und Renovierungsarbeiten am rituellen Bad ihre
Spuren hinterlassen. Die letzte größere Renovierung des Bades war im 19.
Jahrhundert, als veränderte Vorschriften zum Betrieb der Mikwen
staatlicherseits erlassen wurden (betreffs Beheizung des Raumes, Erwärmen von
zusätzlichem Wasser, Hygiene u.a.m.). Nach einem Bericht von 1837 benutzten die
damals fünf jüdischen Familien der Stadt die Mikwe. Der von Medizinalrat Dr.
Müller erstellte Bericht über den Zustand des Judenbades sorgte vermutlich
für eine baldige Renovierung der Mikwe.
Die Mikwe ist zugänglich über den Seiteneingang im Hanauer Hof (Schlüssel
erhältlich im Museum der Stadt).
Adresse/Standort der Synagogen: Alte
Synagoge bis nach 1840 im Gebäude Kornmarkt 22; Synagoge von 1875 bis
1938 hinter dem Amtsgericht.
Fotos
(Quelle: Fotos und Pläne zum rituellen Bad: Altaras
s.Lit. 1994 S. 80-81; neuere Fotos Haus Kornmarkt 22: Hahn,
Aufnahmedatum 27.10.2009)
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| November 2013:
Ein Mahnmal für die ermordeten jüdischen
Herborner wird eingeweiht |
Artikel von Christian Röder in
mittelhessen.de vom 8. November 2013: "'Auch Herborn war ein
Tatort'
EINWEIHUNG Mahnmal am Eisernen Steg erinnert an ermordete Juden
Herborn. In würdevollem Rahmen haben Vertreter der Stadt und der Kommunalpolitik gestern das Denkmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden Herborns am Eisernen Steg eingeweiht. Über 250 Personen - darunter viele Nachkommen der Holocaust-Opfer - nahmen an der Veranstaltung teil.
"Wer die Geschichte vergisst, muss sie wieder erleben", prangt in großen Lettern auf dem Gedenkstein, einem "Nero Africa Impala". Darüber stehen die Namen von 63 Herborner Opfern des nationalsozialistischen Terrors zwischen 1933 und 1945.
Das Herborner Denkmal solle nicht nur erinnern, sondern "fordern und anspornen", sagte Stadtverordnetenvorsteher Jörg Michael Müller (CDU). Es erinnere daran, dass "auch Herborn ein Tatort war".
Bürgermeister Hans Benner (SPD) sagte, dass der Massenmord "zwar durch die Hitler-Diktatur angeordnet wurde, jedoch ohne das Versagen der Gesellschaft nicht möglich war." Er dankte auch den Spendern Manfred Schäfer und Klaus Dietrich.
Denkmal-Initiator Gerald Stern aus Newcastle, dessen Großeltern von den Nationalsozialisten ermordet wurden, sagte: "Wir hatten wenige Gräber, an denen wir trauern konnten." Bei seinem ersten Besuch Herborns vor über zehn Jahren schien es ihm, als seien die Juden vergessen worden. "Heute können wir ihre Namen endlich wieder lesen und ihrer gedenken", sagte er.
Das einzige "Verbrechen" seiner Großeltern, David und Rosa Löwenstein, sei es gewesen, dass sie Juden waren: "Sie waren stolz darauf, Juden und Deutsche zu sein", sagte Stern. Viele hätten im Ersten Weltkrieg für ihr Land gekämpft. Spätestens am 9. November 1938, vor 75 Jahren, wären dann Freunde zu Feinden geworden.
Reverend Bernd Koschland weihte das Denkmal ein. Auf hebräisch trug er das "Gebet der Erinnerung" vor und sagte: "Synagogen und Körper kann man zerstören, aber nicht den Geist des Judentums und der Juden."
Benner und Müller trugen anschließend im Wechsel die Namen der Ermordeten vor.
Dann machte ein kleiner Junge den Anfang und legte einen Stein vor dem Denkmal nieder. Viele weitere Blumen, Kerzen und Steine folgten.
Nie mehr dürfe Unrecht das Recht des Einzelnen dominieren und pervertieren, sagte Müller zum Abschluss. Das Denkmal bedeute auch große Verantwortung."
Link
zum Bericht |
Programm
der Gedenkstunde Einweihung Holocaust-Denkmal Herborn am 8. November 2013
(pdf-Datei)
Rede
von Gerald Stern zur Einweihung des Holocaust-Denkmales am 8. November
2013 (pdf-Datei) |
| |
|
|
|
Fotos des Denkmales
am Eisernen Steg
(erhalten von Gerald Stern,
Newcastle) |
 |
 |
 |
 |
| |
am Denkmal nach der
Enthüllung: Mayor Hans Benner, Rev. Bernd Koschland und Gerald
Stern |
Gedenkinschrift
mit Symbolik (Buchstaben rechts Abkürzung für
"seligen Andenkens") und den Namen der aus Herborn
stammenden
und in der NS-Zeit ermordeten jüdischen Personen |
| |
April 2024:
Verlegung von "Stolpersteinen" in
Herborn
Vgl. Liste
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Herborn
|
Pressemitteilung
der Stadt Herborn vom 24. April 2024: "Verlegung von Stolpersteinen in
Herborn.
Im Gedenken an in Herborn lebende Jüdinnen und Juden wurden 2009 schon 15
Steine verlegt, weitere 8 Stolpersteine folgen am 16. April 2024 um 17 Uhr.
Das Schicksal unserer geschändeten Mitbürger verpflichtet zur Erinnerung und
vor allem Verantwortung für die Zukunft. Heute erinnern wir an acht
Menschen, die Herborn einst ihre Heimat nannten. Wir laden Sie zu
öffentlichen Gedenken und der Verlegung weiterer Stolpersteine ein: 16.
April 2024, 17:00 Uhr; Treffpunkt Kornmarkt 5, 35745 Herborn.
Programm: Begrüßung durch Bürgermeisterin Katja Gronau
1. Station, Kornmarkt 5 - SIMON FRIEDEMANN und KAROLINE FRIEDEMANN
2. Station, Mühlbach 16 - ABRAHAM SIMON und KAROLINE SIMON
3. Station, Hauptstraße 72 - BERTA ROSENBERG
4. Station, Austraße 12 - MORITZ STERN und JULCHEN STERN
5. Station, Walther-Rathenau-Straße 59 - MEIER LEVI
Schlusswort des Stadtverordnetenvorstehers Jörg Michael Müller am
Holocaust-Mahnmal am Eisernen Steg
An jeder Station erinnert Gästeführerin Annemarie Benner an das Schicksal
der Menschen, deren Erinnerung mit einem Stolperstein wachgehalten werden
soll. Auch rezitieren die Schüler der Buchenwald AG des Johanneum Gymnasiums
Herborn Gedichte von Holocaust-Überlebenden. Musikalisch umrahmt wird die
Veranstaltung von Tamara Kraus (Geige) und Dieter Senz (Querflöte)."
Link zur Pressemitteilung der Stadt |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,1 S. 354-355. |
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 352-353. |
 | Rüdiger Mack: Juden an den hessischen Hochschulen
im 18. Jahrhundert. In: Schriften der Kommission für die Geschichte der
Juden in Hessen VI. Neunhundert Jahre Geschichte der Juden in Hessen.
Wiesbaden 1983 S. 293-295. |
 | Helmut Groos: Dokumente der Judenverfolgung in
Herborn. In: Heimatjahrbuch für das Land an der Dill. Dillenburg
1985. |
 | Kein Artikel zu Herborn in Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988. |
 | Ausführlich zu Herborn in dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 76-82. |
 | dies.: Neubearbeitung der beiden Bände. 2007² S.
215-221. (mit weiteren Literaturangaben) |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 452-454. |
 | Christina Diederichs/Kerstin Ehrlich: Auf den
Spuren jüdischen Lebens in Herborn. Seminararbeit im Fach Staat und
Verfassung. Download
der pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Herborn
Hesse-Nassau. After the Black Death persecutions of 1348-49, a permament
community was not established until about 1680, when the Jews built a synagogue.
Numbering 48 in 1871, the community maintained a school (1870-1933), was
affiliated with the Bad Ems rabbinate, and grew to 124 (2 % of the total) in
1925. Its synagogue was destroyed on Kristallnacht (9-10 November 1938)
and 46 of the 91 Jews left (mostly emigrating) by 1939; at least 22 were
eventually deported.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|