|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Schwalm-Eder-Kreis"
Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Melsungen bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/42. Erstmals werden Juden 1532 in der Stadt
genannt. Im 17./18. Jahrhundert lebten jeweils einige jüdische Familien in
Melsungen. 1664 waren es zwei Familien (1680 zehn, 1730 22 jüdische
Einwohner), 1744 drei Familien. In der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm die Zahl weiter zu (1776
sieben Familien), sodass eine jüdische Gemeinde gegründet werden konnte. Im
18. Jahrhundert fanden in Melsungen mehrere "Judenlandtage" statt. Auf
dem Judenlandtag 1779 in Melsungen wurde Moses Joseph Michel Kugelmann aus
Meimbressen zum Landrabbiner ernannt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1827 82 jüdische Einwohner (2,5 % von insgesamt 3.324), 1835 98
(2,6 % von 3.708), 1858 121, 1861 133 (3,8 % von 3.540), 1880 188 (5,1 % von 3.619), 1895
105 (2,8 % von 3.742), 1905 116 (2,9 % von 3.940). Im Revolutionsjahr 1848
kam es zu Ausschreitungen gegen die jüdischen Familien, worauf einige nach
Kassel flüchteten (siehe Artikel unten).
Zur Gemeinde in Melsungen gehörten nach Auflösung der dortigen Gemeinde 1895
auch die in Röhrenfurt lebenden
jüdischen Personen (1861 77, 1905 22, 1924 12, 1932 12).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische
Schule (Religionsschule, von 1854 - 1924 Elementarschule; im selben Gebäude wie
die Synagoge), ein rituelles Bad und
seit 1860 ein Friedhof. Zuvor waren die
Toten der Gemeinde in Binsförth
beigesetzt worden. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein
Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter/Schochet tätig war. Unter den
jüdischen Lehrern sind bekannt: bis 1869 Aron Müller (in diesem Jahr
verstorben; zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum siehe Bericht unten), danach bis zu seiner Pensionierung 1908 Baruch Block
(zu seinem 50-jährigen Dienstjubiläum siehe Artikel
unten). Blocks Nachfolger war Philipp Dillhof, der 1924 in den Ruhestand
trat. Seit 1924 bestand nur noch eine Religionsschule; in diesem Jahr wurde als
Lehrer und Vorbeter Dagobert Löwenstein, bisher in Jesberg, gewählt
(siehe Artikel unten). Lehrer Löwenstein wechselte 1930 in einen
kaufmännischen Beruf. Seit 1. Juli 1930 wurde an seiner Stelle P. Löw aus
Gemen (Westfalen) Religionslehrer, Vorbeter und Schochet. Er blieb vermutlich
nicht lange, da zur Purimfeier 1931 Lehrer Willy Katz genannt wird, der
von Kassel aus in Melsungen als Kultusbeamter und Religionslehrer tätig
war.
Die Gemeinde
gehörte zum Rabbinatsbezirk Niederhessen / Kassel, der nach den damaligen
Kreisen aufgeteilt war, in denen jeweils ein jüdischer Kreisvorsteher gewählt
war. Ein langjähriger Kreisvorsteher war in der Mitte des 19. Jahrhunderts
Leiser Kaufmann (siehe Artikel unten).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Sußmann Siegmund
Levy (geb. 12.1.1880 in Röhrenfurth, gef. 18.7.1918) und Joseph Stern (geb.
22.6.1879 in Melsungen, gef. 28.9.1915). Außerdem sind gefallen: Louis Levi
(geb. 20.4.1879 in Melsungen, vor 1914 in Dortmund wohnhaft, gef. 16.4.1918),
Leutnant Julius Leeser (geb. 18.6.1875 in Melsungen, vor 1914 in Hannover
wohnhaft gef. 5.8.1915).
Um 1924, als 89 jüdische Einwohner gezählt wurden (2,0 % von
4.481), waren die Vorsteher der Gemeinde Julius Levy, Moses Levy und Moritz
Meyer. Als Lehrer und Kantor war noch der inzwischen im Ruhestand befindliche Philipp
Dillhof tätig (siehe Artikel unten). Er unterrichtete an inzwischen zur
Religionsschule umgewandelten Schule der jüdischen Gemeinde 15 Kinder. An jüdischen Vereinen bestanden
der Israelitische Männerverein (Männer-Chewro, gegründet 1858,
Wohltätigkeits- und Bestattungsverein, 1932 waren die Vorsitzenden Meier Abt
und Abraham Speier, 1932 16 Mitglieder), der Israelitische Frauenverein (Wohltätigkeits-
und Bestattungsverein, 1924 unter Leitung von Fanny Abt, Henriette Levy, Becky
Levy, 1932 unter Leitung von Fanny Abt und Paula Speier, 1932 26 Mitglieder), der Synagogenchor, ein
Nähverein. 1932 waren die Gemeindevorsteher Julius Levy (1. Vors.) und
M. Katz (2. Vors.); als Schatzmeister war Albert Abt tätig. Inzwischen (bereits
seit 1924, siehe Artikel unten) war
Lehrer an der Religionsschule Dagobert Löwenstein; er unterrichtete im Schuljahr 1931/32 noch sieben
Kinder (Lehrer Löwenstein ist in der NS-Zeit nach England emigriert).
An jüdischen Gewerbebetrieben hatten u.a. die Familien Katz und
Levy Textilgeschäfte, Nathan Stern einen Schuhladen, Sally Abt einen
Altwarenhandel, Familie Kaufmann einen Versandhandel mit Tuchen u.a.m.
1933 lebten noch 76 jüdische Personen in der Stadt. In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. In die USA konnten neun
Personen emigrieren, nach Südafrika, Belgien, England und Palästina jeweils
drei, nach Holland zwei. Beim Novemberpogrom
1938 wurden durch Nationalsozialisten die Synagoge sowie jüdische Wohnungen
und Geschäfte überfallen und demoliert. Mehrere jüdische Einwohner wurden
verprügelt. Der Ziegenhändler Goldschmidt, wohl der ärmste Jude der Stadt,
lag die halbe Nacht mit gebrochenem Bein um Hilfe rufend in der Oberen
Mauergasse, bis der Gastwirt Müllermeister sich um ihn kümmerte. In das KZ
Buchenwald wurden verschleppt: der Kaufmann Hugo Rothschild (Brückenstraße),
der Buchbinder Emil Goldschmidt (Markt), der Metzger Arthur Katz (Fritzlarer Straße
107) und Leopold Abt (Poststraße). Emil Goldschmidt starb im KZ Buchenwald am
20. November 1938. 1939 wurden
noch 26 jüdische Einwohner gezählt (0,5 % von 4.909 Einwohnern). Die letzten
der jüdischen Einwohner wurden 1942 deportiert.
Anmerkung: im Anhang der Liste des Bürgermeisteramtes
Guxhagen von 1962 über die "Juden, die am 31.1.1933 und später in
Guxhagen (und Umgebung) wohnhaft waren" (pdf-Datei
der an den International Tracing Service mitgeteilten Liste) werden auch die
jüdischen
Personen aus Melsungen genannt.
Von den in Melsungen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Benjamin Abt (1877), Bessy Abt (1898), Emma Abt
geb. Nagel (1877), Fanny Abt geb. Spangenthal (1880), Henriette Abt geb.
Nussbaum (1863), Leopold Abt (1894), Sally Abt (1864), Siegfried Abt (1870), Bertha Bloch geb.
Goldschmidt (1886), Helene Block (1864), Paula Cohn geb. Goldberg (1896), Agnes
Dalberg geb. Kaufmann (1873), Toni Goldschmidt (1889), Paula Helene Ehrlich geb. Kaufmann
(1868), Emil Goldschmidt (1879), Siegmund Goldschmidt (1890), Bertha
Hammerschlag geb. Levy (1877), Gerda Höflich (1932), Gidel J. Josephs (1894), Moritz Kahn (),
Röschen Kahn geb. Kaufmann (1856), Moritz Kanter (1901), Leopold Katz (1882),
Leo Kaufmann (1877), Clara Lewisohn (1870), Ernst Levy (1912), Hermann Levy (1872), Johanna Levy
geb. Levy (1885), Leopold Levy (1877), Paula Levy geb. Mosheim (1885), Selma
Levy (1881), Meinhard
Meyer (1880), Rosalie Mayer geb. Siegel (1876), Flora Meyerfeld geb. Levy
(1882), Bertha Rothschild geb. Levy
(1905), Hugo Rothschild (1888), Clara Saevici geb. Meyer (1909), Abraham Speier
(1868), Flora Speier geb. Abt (1873), Johanna Speier geb. Flörsheim (1862), Leo Speier (1905), Settchen Speier geb.
Katz (1870), Franziska Stern geb. Rosenbusch (1886), Henny Stern geb. Abt (1907), Adelheid Wallach geb.
Apt (1857), Lina
Weisslitz geb. Goldschmidt (1871), Franziska Wolff geb. Kaufmann
(1879).
Zur Erinnerung an viele der genannten, aus Melsungen in der NS-Zeit nach der
Deportation umgekommene / ermordete jüdische Personen erinnern seit 2008
sogenannte "Stolpersteine" in der Stadt (siehe Presseberichte
zu den Verlegungen unten und Website www.stolpersteine-melsungen.de).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer
50-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Aron Müller (1867)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November
1867: Melsungen, Provinz Hessen, 29. Oktober (1867). Ein
seltenes Fest wurde heute hier begangen. Die israelitische Gemeinde
feierte das 50-jährige Dienstjubiläum ihres Lehrers Müller, der
während dieser langen Zeit hier tätig war. Es hatte sich zu diesem
Zwecke schon vor längerer Zeit ein Komitee gebildet, welches die nötigen
Einleitungen hierzu traf, und diesem ist es zunächst zu danken, dass eine
so schöne und umfangreiche Feier begangen wurde. Das Fest begann mit
einer Synagogalfeier, der sämtliche Behörden und Geistlichen hiesiger
Stadt beiwohnten. Die Festrede bei derselben hielt Herr Handrabbiner Dr.
Adler aus Kassel und machte dieselbe bei allen Anwesenden einen erhebenden
Eindruck. Mit großer Geschicklichkeit wurde von ihm über Schule und
Volksbildung gesprochen, ganz besonders auf das Schulwesen und den
Bildungsgrad der Israeliten in früherer und jetziger Zeit hingewiesen.
Wie die Stellung der Juden durch ihre Schulbildung bedingt wurde und wie
durch die Vernachlässigung der Schulen in früherer Zeit, ein so
nachteiliger Einfluss auf das Ansehen der Juden ausgeübt wurde. Der
kirchlichen Feier folgte ein Festmahl, woran sich außer den her wohnenden
Israeliten viele Lehrer und Beamte hiesiger Stadt sowie israelitische
Lehrer aus der Umgegend beteiligten. Verschiedene Toaste würzten das
Mahl. Der eine galt des Königs und der Königin Majestäten. Eine
freudige Stimmung bemächtigte sich aller Festteilnehmer und war heirbei
eine selten gesehene Harmonie zwischen Juden und Christen wahrnehmbar. Man
tauschte gegenseitig die Gedanken aus und kam zur Ansicht, dass das Fest
einen guten Eindruck auf die allgemeine Volksstimmung haben würde. Der
Abend vereinigte die Frauen und Jungfrauen zu einem Tanzvergnügen, dem
einige wohl gelungene theatralische Vorstellungen vorangingen, und so
schloss dieses Fest spät nach der Geisterstunde zur Befriedigung aller
Festteilnehmer, denen es noch nach späten Jahren eine angenehme
Rückerinnerung bleiben wird. Dem Jubilar, der sich trotz seiner 72 Jahre
einer körperlichen und geistigen Rüstigkeit zu erfreuen hat, wurde
seitens der Gemeinde eine Dotation von ca. fünf Hundert Talern, welches
in Anbetracht der kleinen Gemeinde, die aus nur 25 Mitgliedern besteht,
als eine ehrende Anerkennung des Lehrers sowie der Gemeinde selbst
öffentlich hervorgehoben zu werden verdient." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. November
1867: Melsungen, Provinz Hessen, 29. Oktober (1867). Ein
seltenes Fest wurde heute hier begangen. Die israelitische Gemeinde
feierte das 50-jährige Dienstjubiläum ihres Lehrers Müller, der
während dieser langen Zeit hier tätig war. Es hatte sich zu diesem
Zwecke schon vor längerer Zeit ein Komitee gebildet, welches die nötigen
Einleitungen hierzu traf, und diesem ist es zunächst zu danken, dass eine
so schöne und umfangreiche Feier begangen wurde. Das Fest begann mit
einer Synagogalfeier, der sämtliche Behörden und Geistlichen hiesiger
Stadt beiwohnten. Die Festrede bei derselben hielt Herr Handrabbiner Dr.
Adler aus Kassel und machte dieselbe bei allen Anwesenden einen erhebenden
Eindruck. Mit großer Geschicklichkeit wurde von ihm über Schule und
Volksbildung gesprochen, ganz besonders auf das Schulwesen und den
Bildungsgrad der Israeliten in früherer und jetziger Zeit hingewiesen.
Wie die Stellung der Juden durch ihre Schulbildung bedingt wurde und wie
durch die Vernachlässigung der Schulen in früherer Zeit, ein so
nachteiliger Einfluss auf das Ansehen der Juden ausgeübt wurde. Der
kirchlichen Feier folgte ein Festmahl, woran sich außer den her wohnenden
Israeliten viele Lehrer und Beamte hiesiger Stadt sowie israelitische
Lehrer aus der Umgegend beteiligten. Verschiedene Toaste würzten das
Mahl. Der eine galt des Königs und der Königin Majestäten. Eine
freudige Stimmung bemächtigte sich aller Festteilnehmer und war heirbei
eine selten gesehene Harmonie zwischen Juden und Christen wahrnehmbar. Man
tauschte gegenseitig die Gedanken aus und kam zur Ansicht, dass das Fest
einen guten Eindruck auf die allgemeine Volksstimmung haben würde. Der
Abend vereinigte die Frauen und Jungfrauen zu einem Tanzvergnügen, dem
einige wohl gelungene theatralische Vorstellungen vorangingen, und so
schloss dieses Fest spät nach der Geisterstunde zur Befriedigung aller
Festteilnehmer, denen es noch nach späten Jahren eine angenehme
Rückerinnerung bleiben wird. Dem Jubilar, der sich trotz seiner 72 Jahre
einer körperlichen und geistigen Rüstigkeit zu erfreuen hat, wurde
seitens der Gemeinde eine Dotation von ca. fünf Hundert Talern, welches
in Anbetracht der kleinen Gemeinde, die aus nur 25 Mitgliedern besteht,
als eine ehrende Anerkennung des Lehrers sowie der Gemeinde selbst
öffentlich hervorgehoben zu werden verdient." |
50-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Baruch Block (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1908:
"Melsungen, 1. April (1908). Herr Lehrer Block dahier feiert am 3.
April sein goldenes Dienstjubiläum; am hiesigen Platze wirkt er bereits
über 40 Jahre. Die israelitische Gemeinde hatte geplant, den Tag festlich
zu begehen, Herr Block hat sich jedoch jede Feier verbeten. Der Jubilar
erfreut sich in unserer Stadt allseitiger Wertschätzung." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. April 1908:
"Melsungen, 1. April (1908). Herr Lehrer Block dahier feiert am 3.
April sein goldenes Dienstjubiläum; am hiesigen Platze wirkt er bereits
über 40 Jahre. Die israelitische Gemeinde hatte geplant, den Tag festlich
zu begehen, Herr Block hat sich jedoch jede Feier verbeten. Der Jubilar
erfreut sich in unserer Stadt allseitiger Wertschätzung." |
Verschwinden des Lehrers Baruch Bloch (1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. März
1912: "Melsungen. Der fast 80jährige emeritierte Lehrer B.
Block, der hochgradig nervös war, verschwand am 3. dieses Monats nachts.
Erst am Morgen wurde sein Fehlen bemerkt. Beim Nachforschen fand man
seinen Rock und Hut an dem Fuldaufer. Trotz allen Suchens hat man seinen
Leichnam nicht gefunden. Die hiesige Männer-Chewroh hat demjenigen, der
den Verschwundenen auffindet, eine Belohnung von 50 Mark
zugesichert." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. März
1912: "Melsungen. Der fast 80jährige emeritierte Lehrer B.
Block, der hochgradig nervös war, verschwand am 3. dieses Monats nachts.
Erst am Morgen wurde sein Fehlen bemerkt. Beim Nachforschen fand man
seinen Rock und Hut an dem Fuldaufer. Trotz allen Suchens hat man seinen
Leichnam nicht gefunden. Die hiesige Männer-Chewroh hat demjenigen, der
den Verschwundenen auffindet, eine Belohnung von 50 Mark
zugesichert." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1912: "Melsungen,
24. März (1912). Die Leiche des seit Purim-Abend verschwundenen emeritierten
israelitischen Lehrers Block wurde am Donnerstag in dem 2 1/2 Stunden von
hier entfernteren Dorfe Guxhagen von dem Maurer Reuter am Ufer der Fulda
gelandet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1912: "Melsungen,
24. März (1912). Die Leiche des seit Purim-Abend verschwundenen emeritierten
israelitischen Lehrers Block wurde am Donnerstag in dem 2 1/2 Stunden von
hier entfernteren Dorfe Guxhagen von dem Maurer Reuter am Ufer der Fulda
gelandet." |
Über Lehrer Philipp Dilloff (Lehrer in Melsungen von 1908 bis
1923/25)
(zusammengestellt auf Grund der Recherchen von Heidemarie Kugler-Weiemann,
Lübeck; mitgeteilt am 25.5.2013)
| Lehrer Philipp Dilloff ist am 18. Dezember
1863 in Frankenberg als Sohn von
Loeb Dilloff und der Fanny (Frommet) geb. Teisebach (Deisebach, Theisebach)
geboren. Nach seinem Schulbesuch ließ er sich am Lehrerseminar in Köln
und Büren ausbilden. 1887 bewarb er sich auf die Stelle in Ziegenhain
(Ausschreibung siehe oben). Er bekam die Stelle und zog nach Ziegenhain,
wo er im Haus Kasseler Straße 28 lebte. Er heiratete Veilchen geb. Stern,
geb. 1871 in Salmünster. Das
Ehepaar hatte eine Tochter Elsa (geb. 1893 in Ziegenhain), eventuell noch
weitere Kinder. Philipp Dilloff blieb bis 1908 in Ziegenhain,
danach wurde er Lehrer in Melsungen, wo er bis zu seinem Ruhestand
1923 geblieben ist. 1925 verzogen Beilchen und Philipp Dillof nach Riga,
wo ihr Schwiegersohn Ludolph (Ludwig) Häusler - von Beruf Rechtsanwalt -
für einen schwedischen Finanzkonzern tätig war. 1927 verzog die ganze
Familie nach Lübeck. Veilchen Dillof verstarb bereits im Mai 1932 und
wurde im jüdischen Friedhof in Moisling beigesetzt. Philipp Dilloff blieb
in der NS-Zeit in Lübeck. Am 19. Juli 1942 wurde er über Hamburg in das
Ghetto Theresienstadt deportiert, von dort im September 1942 nach
Treblinka, wo er ermordet wurde. |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 10. April 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 10. April 1924:
"Wir suchen zum Eintritt per 1. Mai dieses Jahres,
eventuell später einen
Religionslehrer, Vorbeter und Schochet.
Dienstwohnung und 9 Ar großer Garten vorhanden. Bewerbungen sind zu
richten an den
Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu Händen des Herrn Julius
Levy, Melsungen (Regierungsbezirk
Kassel)." |
Lehrer Dillhof verlässt die Gemeinde - Nachfolger wird
Lehrer Löwenstein (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,
3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als
Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.
Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten
Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1925: "Melsungen,
3. März (1925). Lehrer Dillhof, der nach seiner Pensionierung als
Religionslehrer hier verblieben war, hat der Gemeinde das Amt gekündigt.
Die Gemeinde wählte nun Löwenstein aus Jeßberg, bisher im besetzten
Gebiet, als Lehrer und Vorsänger." |
Lehrer P. Löw aus Gemen in Westfalen wird in Melsungen angestellt
(1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Juli 1930: "Melsungen. Die hiesige
Gemeinde hat für die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle zum
1. Juli dieses Jahres Herrn P. Löw, Gemen in Westfalen,
verpflichtet. Herr Löwenstein, bisheriger Inhaber dieses Amtes,
hat einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Der Gottesdienst unter seiner
Leitung und seine Vorträge waren über den allgemeinen Durchschnitt, und
wird sein Nachfolger es nicht leicht haben, die Gemeinde in dieser
Hinsicht zufrieden zu stellen."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. Juli 1930: "Melsungen. Die hiesige
Gemeinde hat für die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle zum
1. Juli dieses Jahres Herrn P. Löw, Gemen in Westfalen,
verpflichtet. Herr Löwenstein, bisheriger Inhaber dieses Amtes,
hat einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Der Gottesdienst unter seiner
Leitung und seine Vorträge waren über den allgemeinen Durchschnitt, und
wird sein Nachfolger es nicht leicht haben, die Gemeinde in dieser
Hinsicht zufrieden zu stellen." |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Ausschreitungen gegen jüdische Familien (1848)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 15. Mai
1848: "Kassel, 2. Mai. Die Exzesse gegen Personen und Eigentum in den
Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und Juden, nehmen auf
eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar, Melsungen,
Rothenburg
und Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren geretteten Habseligkeiten
hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine Anzahl der Exzedenten
gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal Zeit, gegen diese
Übeltätiger, deren Absicht lediglich auf Plünderung und Raub gerichtet
ist, energisch einzuschreiben und die Gesetze wieder zu Ansehen zu
bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in Haft zu
nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme hat deren
schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenberg ein Advokat und
ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbebetriebe durch die Juden beengt
fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und Nachsicht wäre
hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung der Judentums" vom 15. Mai
1848: "Kassel, 2. Mai. Die Exzesse gegen Personen und Eigentum in den
Landständen und Dörfern, namentlich gegen Beamte und Juden, nehmen auf
eine bedauerliche Weise überhand; von Hofgeismar, Melsungen,
Rothenburg
und Breidenbach sind Judenfamilien mit ihren geretteten Habseligkeiten
hier eingetroffen; zugleich ist aber heute eine Anzahl der Exzedenten
gefesselt eingebracht worden. Es ist endlich einmal Zeit, gegen diese
Übeltätiger, deren Absicht lediglich auf Plünderung und Raub gerichtet
ist, energisch einzuschreiben und die Gesetze wieder zu Ansehen zu
bringen. Vor allen Dingen sind die Aufwiegler und Verführer in Haft zu
nehmen und den Gerichten zu überweisen; die öffentliche Stimme hat deren
schon Mehre bezeichnet. So sollen namentlich in Rothenberg ein Advokat und
ein Kaufmann, der sich in seinem Gewerbebetriebe durch die Juden beengt
fühlt, die dortigen Szenen veranlasst haben. Milde und Nachsicht wäre
hier ein Verbrechen gegen das Land. (O.P.A.Z.)." |
Purimfeier in der Gemeinde (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. März 1931: "Melsungen. Am Purimabend
fand hier unter Beteiligung fast aller Gemeindemitglieder eine
wohlgelungene Purimfeier statt. Von dieser Tatsache wird jeder, der
Einblick in die hiesigen Verhältnisse der letzten Jahre gehabt hat,
angenehm überrascht sein. Den neuen Geist, der in der Gemeinde eingekehrt
ist, hat sie in erster Linie Herrn Lehrer Willy Katz zu verdanken,
der es in so kurzer Zeit verstanden hat, die Sympathien zu gewinnen. Herr
Katz versieht von Kassel aus den Dienst als Kultusbeamter und
Religionslehrer. Die kleine Schar der Schüler trat am Purimabend in
bunter Folge vor das in freudiger Erregung harrende Publikum. Später
hielten Tanz und abwechslungsreiche Vorträge die Erwachsenen noch lange
zusammen. Man ging mit dem Gefühl nach Hause, wieder einmal einige
gemütliche Stunden im geschlossenen Kreis der Gemeinde verlebt zu
haben." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. März 1931: "Melsungen. Am Purimabend
fand hier unter Beteiligung fast aller Gemeindemitglieder eine
wohlgelungene Purimfeier statt. Von dieser Tatsache wird jeder, der
Einblick in die hiesigen Verhältnisse der letzten Jahre gehabt hat,
angenehm überrascht sein. Den neuen Geist, der in der Gemeinde eingekehrt
ist, hat sie in erster Linie Herrn Lehrer Willy Katz zu verdanken,
der es in so kurzer Zeit verstanden hat, die Sympathien zu gewinnen. Herr
Katz versieht von Kassel aus den Dienst als Kultusbeamter und
Religionslehrer. Die kleine Schar der Schüler trat am Purimabend in
bunter Folge vor das in freudiger Erregung harrende Publikum. Später
hielten Tanz und abwechslungsreiche Vorträge die Erwachsenen noch lange
zusammen. Man ging mit dem Gefühl nach Hause, wieder einmal einige
gemütliche Stunden im geschlossenen Kreis der Gemeinde verlebt zu
haben." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Kreisvorsteher Perll (1848)
 Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8.
Februar 1848: "Aus Kurhessen. Am 1. Januar dieses Jahres
verstarb zu Melsungen in der Provinz Niederhessen, der Kreisvorsteher
Perll, ein Mann von echtem, altjüdischem Schrot und Korn, einfach in
Wesen und Sitten, aber felsenfest und treu anhängend dem Glauben seiner
Urväter. Von seiner Tätigkeit für das allgemeine Beste, besonders da,
wo es die Erhaltung des wahren, orthodoxen Judentums galt, legte er in
neuerer Zeit Beweise noch dadurch ab, dass er der erste aller
Kreisvorsteher es war, der eine Eingabe sämtlicher Gemeindeältesten
seines Kreises an Kurf. Ministerium des Innern bewirkte, in welcher sowohl
die Gefahren dringend geschildert, die den Israeliten Hessens
bevorständen, falls einem neologen, reformistischen, Landrabbinen die
Seelsorge der jüdischen Gemeinden des Staates anvertrauet, als die
Vorteile aufgezählt wurden, die den religiösen Zuständen des
Vaterslandes dadurch erwachsen würden, falls ein Geistlicher, wie in der
Person des Dr. Feuchtwang die Petenten vorzuschlagen sich erlaubten, jene
Stellung einnehme. Wie sehr dieser Schritt von vielen anderen
Kreisvorstehern gebilligt und nachgeahnt. wie sehr Kurf. Ministerium die
Majorität der Gemeinden berücksichtigte, ist hinreichend bekannt.
Deshalb war auch die Trauer um den Dahingeschiedenen, eine allgemeine, und
nicht besser glaubte man das Andenken des entschlafenen Frommen ehren zu
können, als dass man bei der am 19. dieses Monats stattgefundenen Wahl
eines neuen Kreisvorstehers, mit großer Majorität den Herrn L. Kaufmann
wählte, dessen religiöse Ansichten denen seines Vorgängers, durchaus
konform ein Ehrenmann wie jener, im wahren Sinne des Wortes ist, gewiss
nichts unterlasen wird, die religiösen Interessen des Kreises wie bisher
zu wahren und zu schützen. Artikel in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 8.
Februar 1848: "Aus Kurhessen. Am 1. Januar dieses Jahres
verstarb zu Melsungen in der Provinz Niederhessen, der Kreisvorsteher
Perll, ein Mann von echtem, altjüdischem Schrot und Korn, einfach in
Wesen und Sitten, aber felsenfest und treu anhängend dem Glauben seiner
Urväter. Von seiner Tätigkeit für das allgemeine Beste, besonders da,
wo es die Erhaltung des wahren, orthodoxen Judentums galt, legte er in
neuerer Zeit Beweise noch dadurch ab, dass er der erste aller
Kreisvorsteher es war, der eine Eingabe sämtlicher Gemeindeältesten
seines Kreises an Kurf. Ministerium des Innern bewirkte, in welcher sowohl
die Gefahren dringend geschildert, die den Israeliten Hessens
bevorständen, falls einem neologen, reformistischen, Landrabbinen die
Seelsorge der jüdischen Gemeinden des Staates anvertrauet, als die
Vorteile aufgezählt wurden, die den religiösen Zuständen des
Vaterslandes dadurch erwachsen würden, falls ein Geistlicher, wie in der
Person des Dr. Feuchtwang die Petenten vorzuschlagen sich erlaubten, jene
Stellung einnehme. Wie sehr dieser Schritt von vielen anderen
Kreisvorstehern gebilligt und nachgeahnt. wie sehr Kurf. Ministerium die
Majorität der Gemeinden berücksichtigte, ist hinreichend bekannt.
Deshalb war auch die Trauer um den Dahingeschiedenen, eine allgemeine, und
nicht besser glaubte man das Andenken des entschlafenen Frommen ehren zu
können, als dass man bei der am 19. dieses Monats stattgefundenen Wahl
eines neuen Kreisvorstehers, mit großer Majorität den Herrn L. Kaufmann
wählte, dessen religiöse Ansichten denen seines Vorgängers, durchaus
konform ein Ehrenmann wie jener, im wahren Sinne des Wortes ist, gewiss
nichts unterlasen wird, die religiösen Interessen des Kreises wie bisher
zu wahren und zu schützen.
den 28. Januar. Ich beeile mich, Ihnen die freudige Nachricht mitzuteilen,
dass soeben der Rabbiner Lipschütz, vom Allerhöchsten Orte aus zum
Landrabbinen ernannt worden ist." |
Zum Tod des Gemeinde- und Kreisvorstehers Leiser Kaufmann (1861)
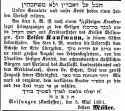 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. August
1861: "Unsere Gemeinde und unser Kreis haben einen herben Verlust
erlitten. Am 6. dieses Monats ist nach einem 3/4jährigen Krankenlager heimgegangen
zu den Seligen unser Gemeindevorsteher (Rosch HaKehila) und
Kreisvorsteher des Kreises Melsungen, Herr Leiser Kaufmann, in seinem 63.
Lebensjahre. Am 8ten dieses Monats wurden die Überreste dem Schoße der
Erde übergeben, unter einer großen Anzahl von Leichenbegleitern, von den
Israeliten hiesigen Kreises, den achtenswerten christlichen Bürgern und
Personal des Kurfürstlichen Landratsamtes und dem Medizinalrat, Herr Dr.
Schott. Dies war gewiss Zeugnis seiner Würdigkeit. Mir ward es
vergönnt, dem verklärten Bruder Trauerredner zu sein und den Text
zu wählen: 'der Herr wird seinen Engel senden vor dir her um dich zu
bewahren auf deinem Weg' (1. Mose 24,7). Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. August
1861: "Unsere Gemeinde und unser Kreis haben einen herben Verlust
erlitten. Am 6. dieses Monats ist nach einem 3/4jährigen Krankenlager heimgegangen
zu den Seligen unser Gemeindevorsteher (Rosch HaKehila) und
Kreisvorsteher des Kreises Melsungen, Herr Leiser Kaufmann, in seinem 63.
Lebensjahre. Am 8ten dieses Monats wurden die Überreste dem Schoße der
Erde übergeben, unter einer großen Anzahl von Leichenbegleitern, von den
Israeliten hiesigen Kreises, den achtenswerten christlichen Bürgern und
Personal des Kurfürstlichen Landratsamtes und dem Medizinalrat, Herr Dr.
Schott. Dies war gewiss Zeugnis seiner Würdigkeit. Mir ward es
vergönnt, dem verklärten Bruder Trauerredner zu sein und den Text
zu wählen: 'der Herr wird seinen Engel senden vor dir her um dich zu
bewahren auf deinem Weg' (1. Mose 24,7).
Melsungen (Kurhessen), den 5. Elul 1861. Lehrer Müller." |
80. Geburtstag von Herz Speier (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925: "Melsungen,
27. Januar (1925). Der Rentner Herz Speier, früher Schochet dahier, kann
kommenden Schabbat seinen 80. Geburtstag begehen. Seitdem er vor
Jahresfrist infolge Sturzes von der Treppe einen Oberschenklebruch
erlitten, ist er bettlägerig, im übrigen aber vollkommen gesund und
geistig sehr rege. (Alle Gute) bis 100 Jahre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1925: "Melsungen,
27. Januar (1925). Der Rentner Herz Speier, früher Schochet dahier, kann
kommenden Schabbat seinen 80. Geburtstag begehen. Seitdem er vor
Jahresfrist infolge Sturzes von der Treppe einen Oberschenklebruch
erlitten, ist er bettlägerig, im übrigen aber vollkommen gesund und
geistig sehr rege. (Alle Gute) bis 100 Jahre." |
Zum Tod von Isaak Speier (1925)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Melsungen,
10. Mai (1925). Im Alter von 69 Jahren wurde hier unter Beteiligung
sämtlicher Behörden der Stadt, an deren Spitze die Herren Landrat und
Bürgermeister stand, der Kreisvorsteher Lederhändler Isaak Speier zur
letzten Ruhe bestattet. Auch der Kriegerverein nahm in corpore an der
Beerdigung teil. Der Dahingeschiedene hat das Kreisvorsteheramt seit über
30 Jahren zur größten Zufriedenheit der gesamten Kreisbevölkerung
bekleidet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Melsungen,
10. Mai (1925). Im Alter von 69 Jahren wurde hier unter Beteiligung
sämtlicher Behörden der Stadt, an deren Spitze die Herren Landrat und
Bürgermeister stand, der Kreisvorsteher Lederhändler Isaak Speier zur
letzten Ruhe bestattet. Auch der Kriegerverein nahm in corpore an der
Beerdigung teil. Der Dahingeschiedene hat das Kreisvorsteheramt seit über
30 Jahren zur größten Zufriedenheit der gesamten Kreisbevölkerung
bekleidet." |
91. Geburtstag von Josef Speier
(1927)
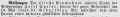 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Mai 1927: "Melsungen. Der älteste
Einwohner unserer Stadt, der Privatmann Josef Speier, feierte bei
guter Gesundheit am 10. Mai seinen 91. Geburtstag. Wir wünschen
dem alten Herren einen weiteren glücklichen Lebensabend." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Mai 1927: "Melsungen. Der älteste
Einwohner unserer Stadt, der Privatmann Josef Speier, feierte bei
guter Gesundheit am 10. Mai seinen 91. Geburtstag. Wir wünschen
dem alten Herren einen weiteren glücklichen Lebensabend." |
Zum Tod von Josef Speier (1929)
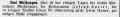 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 22. März 1929: "Aus Melsungen. Hier
ist vor einigen Tagen der älteste Einwohner Melsungens, der Privatmann
Joseph Speier, der in einigen Wochen seinen 93. Geburtstag hätte
feiern können, zur ewigen Ruhe eingegangen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 22. März 1929: "Aus Melsungen. Hier
ist vor einigen Tagen der älteste Einwohner Melsungens, der Privatmann
Joseph Speier, der in einigen Wochen seinen 93. Geburtstag hätte
feiern können, zur ewigen Ruhe eingegangen." |
Julius Levy wurde zum Gemeindeältesten gewählt
(1929)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Melsungen. Der
Kaufmann Julius Levy zu Melsungen wurde anstelle des Herrn Abraham Speier
zum Gemeindeältesten gewählt und vom Vorsteheramt
bestätigt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. Dezember 1929: "Melsungen. Der
Kaufmann Julius Levy zu Melsungen wurde anstelle des Herrn Abraham Speier
zum Gemeindeältesten gewählt und vom Vorsteheramt
bestätigt." |
Unfalltod des taubstummen Sally Speier am Bahnübergang zwischen Röhrenfurth
und Melsungen (1930)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. August 1930: "Tragödie eines jüdischen
Taubstimmen. Ein entsetzlicher Unglücksfall ereignete sich am
Dienstag abend gegen 6 Uhr an dem Bahnübergang zwischen Röhrenfurth
und Melsungen. Der 66-jährige taubstumme Sally Speier aus
Melsungen, der in früheren Jahren als Schreiner bei der Firma
Henschel u. Sohn gearbeitet hatte, wurde auf den Gleisen von dem
herannahenden Personenzug 643 erfasst und auf der Stelle getötet. Die
entsetzlich verstümmelte Leiche konnte geborgen werden. Wie sich der
Unfall zugetragen hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der
Bahnübergang ist in der üblichen Weise mit Bahnschranken und Drehkreuzen
sowie mit den erforderlichen Warnungstafeln gesichert. Vermutlich hat der
taubstumme Speier den herannahenden Zug nicht gesehen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 1. August 1930: "Tragödie eines jüdischen
Taubstimmen. Ein entsetzlicher Unglücksfall ereignete sich am
Dienstag abend gegen 6 Uhr an dem Bahnübergang zwischen Röhrenfurth
und Melsungen. Der 66-jährige taubstumme Sally Speier aus
Melsungen, der in früheren Jahren als Schreiner bei der Firma
Henschel u. Sohn gearbeitet hatte, wurde auf den Gleisen von dem
herannahenden Personenzug 643 erfasst und auf der Stelle getötet. Die
entsetzlich verstümmelte Leiche konnte geborgen werden. Wie sich der
Unfall zugetragen hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der
Bahnübergang ist in der üblichen Weise mit Bahnschranken und Drehkreuzen
sowie mit den erforderlichen Warnungstafeln gesichert. Vermutlich hat der
taubstumme Speier den herannahenden Zug nicht gesehen." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Geburtsanzeige einer Tochter von Bernhard Speier und seiner Frau geb.
Spangenthal (1927)
Anmerkung: angezeigt wird die Tochter Hannelore der Eheleute Bernhard
Speier (Fritzlarer Straße in Melsungen) und Berta geb. Spangenthal. Bernhard
Speier wurde am 20. Juni 1887 in Melsungen geboren; er starb am 3. September
1892 in Chicago, USA. Berta wurde am 12.6.1890 in Spangenberg geboren;
sie starb im Alter von fast 104 Jahren am 5. Mai 1994 in Chicago, USA. Das Paar
hatte neben der Tochter Hannelore einen Sohn Albert (in den USA: Fred),
geb. 2. September 1922 in Kassel-Wilhelmshöhe. Die Familie konnte 1938 in die
USA emigrieren.
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 26. August 1927: Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 26. August 1927:
"Die glückliche Geburt eines gesunden Mädels zeigen hocherfreut
an
Bernhard Speier und Frau geb. Spangenthal
Melsungen, den 23. August 1927 (zur Zeit: Rotes Kreuz)." |
Todesanzeige für Lisette Abt geb. Wertheim
(1938)
Anmerkung: Lisette (Settchen) geb. Wertheim war verheiratet mit Leiser
Abt.
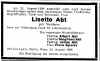 Anzeige
im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 26. August 1938: Anzeige
im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 26. August 1938:
"Am 24. August 1938 entschlief sanft nach kurzem Krankenlager unsere
liebe, herzensgute Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Tante und
Schwester, Frau
Lisette Abt geb. Wertheim
kurz vor Vollendung ihres 93. Lebensjahres. Die trauernden
Hinterbliebenen:
Familie Albert Abt Familie Siegfried Abt
Familie Julius Abt Frau Flora Speier.
Melsungen, Berlin, Wien, 24. August 1938. Die Beerdigung hat
bereits stattgefunden." |
Zur Geschichte der Synagoge
Ein erste Synagoge unbekannten Alters stand in der
Mühlenstraße (Altaras 1994) oder eher im Bereich hinter der Fritzlarer Straße
(zur Diskussion siehe Beitrag
von Kurt Maurer und Dieter Hoppe 2005, die Vermutungen, ein auf dem
Grundstück der Fritzlarer Straße 3 stehendes klassizistisches Gebäude sei die
"Alte Synagoge" gewesen, haben sich nach Angaben von Dieter Hoppe
allerdings durch nichts bestätigen lassen; auch die Rundbogenfenster können
nicht aus der alten Synagoge stammen). Es handelte sich um ein
Fachwerkgebäude, in dem der Betsaal, das Schullokal und die Lehrerwohnung
untergebracht waren. In den 1830er-Jahren war das Gebäude durch
Senkungen in einen baufälligen Zustand geraten. Der damalige Landbaumeister
Augener empfahl dringend eine komplette Renovierung oder einen Neubau der
Synagoge. Der Lehrer war wegen seiner verfallenen Wohnung bereits
ausgezogen.
Hierauf begann die jüdische Gemeinde mit der Planung einer neuen Synagoge.
Die alte Synagoge wurde 1837 abgebrochen, um das noch verwendbare Baumaterial zu
verkaufen und - nach den ersten Planungen- am selben Standort beziehungsweise in
unmittelbarer Nähe einen Synagogenneubau errichten zu können. Bis zur
Einweihung einer neuen Synagoge fanden die Gottesdienste in einem Zimmer im Haus
des Benjamin Abt und der Schulunterricht in einem Raum bei der Witwe des Salomon
Abt statt. Der bisherige Standort der Synagoge wurde aufgegeben, da das Gelände
dort bereits zu eng bebaut war.
Landbaumeister Augener erstellte seit Juni 1837 Kostenvoranschläge sowie
Pläne für einen Neubau, die mehrmals auf Grund von Wünschen der
israelitischen Gemeinde, des Kreisrates, der Stadt Melsungen und des
Bürgermeisters verändert werden mussten. Als Standort wurde die damals
bevorzugte Lage des
Neubaugebietes der Rotenburger Straße bestimmt. Die unmittelbare Nähe zum
1837-38 im Stil des Kasseler Klassizismus erbauten Kasinos (heute:
Stadthalle) prägte den Stil der neuen Synagoge.
Es entstand ein jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge (Betraum mit 89 Plätzen
für Männer, auf der Empore 58 Plätze für Frauen), jüdischer Schule,
Lehrerwohnung und rituellem Bad. Auf dem die Jahreszahl "1841"
tragenden Grundstein stehen die Namen der damaligen Vorsteher der Gemeinde
(Stern und Apt). Wann das Gebäude eingeweiht wurde, ist nicht bekannt; es
konnte noch kein Bericht über die Einweihung gefunden werden.
Fast 100 Jahre war die Synagoge Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens in
Melsungen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Inneneinrichtung der Synagoge demoliert.
Im September 1939 zwang die Stadt die jüdische Gemeinde zum Verkauf des
Gebäudes zu einem Preis von ein paar Tausend RM, von denen lediglich 1.000 RM bezahlt wurden. 1941
wurde das Gebäude der Kreishandwerkerschaft übergeben, in deren Besitz sich
das Gebäude bis zur Gegenwart befinden (Handwerker-Genossenschaft des
Schwalm-Eder-Kreises).
Über den Verkauf der Synagoge
Näheres aus dem Artikel von Dieter Hoppe (siehe unter Lit.): "Mit
dem Nationalsozialismus droht beiden Gebäuden (sc. Casino und Synagoge)
der Abriss. Die erhaltenen Dokumente über den Zwangsverkauf der Synagoge
erlauben einen Blick auf das verworrene Ränkespiel der damaligen Zeit.
Der damalige Bürgermeister Dr. Otto Schmidt (er gehörte vor 1933 der DDP
an) wollte im Vertrag vom 23. Januar 1939 der Synagogengemeinde die
Synagoge zusammen mit einem Acker für 10.000 RM (9.000 RM für die
Synagoge und 1.000 RM für den Acker) abkaufen. Die Synagogengemeinde
sollte außerdem jährlich die Zinsen aus dem Kaufpreis sowie 1.000 RM für
Mitglieder der Gemeinde erhalten. Am 30. Januar wird der Einheitswert des
Gebäudes mit 12.400 RM beziffert. Am 22. Juni 1939 wird durch den
Regierungspräsidenten in Kassel der Kaufpreis auf 5.000 RM (4.000 für
die Synagoge und 1.000 RM für den Acker) ohne weitere jährliche
Zahlungen herabgesetzt. Die Synagoge wird auf 7.300 RM geschätzt. Der Bürgermeister
möchte die Synagoge für handwerkliche Zwecke haben. Der Landrat will die
Synagoge abreißen. Auf dem heutigen Parkplatz soll ein Parteihaus für
1000 Personen entstehen um die Erfolge des 1000jährigen Reiches zu
feiern. Zu diesem Zweck soll auch das Kasino, das schon seit 1935 in der
Hand der Partei war, abgerissen werden. Der Anblick der ehemaligen
Synagoge galt als untragbar. Der Abbruch sollte der erste Schritt sein, um
einen Durchblick zur Fulda zu schaffen. Dafür hätten weitere Häuser
weichen müssen.
Am 7. November 1939 beschwert sich die israelitische Kultusgemeinde. Am 6.
August wird Bürgermeister Otto vom Regierungspräsidenten praktisch
abgekanzelt, weil er im Vertrag vom 23. Januar 1939 einen so hohen Betrag
zahlen wollte. Am 24. Januar 1941 wird der Kaufpreis endgültig auf 6.500
RM festgesetzt. Nach J. Schmidt verkaufte die Stadt noch 1941 die
ehemalige Synagoge für 11.500 RM an die Handwerkerschaft." |
Nach 1945 kam es im Zusammenhang mit
der "Wiedergutmachung" zu einer finanziellen Nachforderung durch die
Jüdische Vermögensverwaltung JRSO, die zu einem Prozess zwischen
Handwerkerschaft und der Stadt Melsungen führte. Der Prozess endete 1953 mit
einem Vergleich: die Stadt Melsungen hatte 22.000 DM Entschädigung und 7.000 DM
Prozesskosten zu bezahlen.
Die ehemalige Synagoge wird bis heute als Geschäfts- und Bürohaus verwendet.
Eine Gedenktafel erinnern an die frühere Geschichte als Synagoge.
Adressen/Standorte der Synagogen: alte
Synagoge in der Mühlenstraße (bis 1836), neue Synagoge in der Rotenburger
Straße 13 (bis 1938).
Fotos
(Quelle: obere Zeile Geschichtsverein
Melsungen, zweite Fotozeile Fotos von Adam Yamey, www.synagogen.info)
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Februar 2010:
"Stolperstein"-Aktion
in Melsungen - Stand der Verlegungen - mehr dazu bei www.stolpersteine-melsungen.de |
Artikel in der "Hessischen
Allgemeinen" vom 25. Februar 2009 (Artikel):
"Sieben neue Stolpersteine an drei Stellen.
Melsungen. Sieben weitere Stolpersteine werden am Mittwoch, 11. März, an vier Stellen im Melsunger Stadtgebiet verlegt. Sie sollen an das Schicksal von Menschen erinnern, die von Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet wurden. Die Steine mit einer gravierten Metallplatte werden ins Straßenpflaster vor ehemaligen Wohnhäusern eingelassen..."
|
| |
| Mai 2010:
Weitere "Stolpersteine" werden verlegt
|
Artikel von "and" in der "Hessischen Allgemeinen" vom 12. Mai 2010
(Artikel): "Mit neun neuen Stolpersteinen erinnern jetzt in Melsungen 25 Mahnobjekte an tote jüdische Mitbürger.
Stolpersteine: Denken an Nachbarn von damals.
Melsungen. 'Sie gingen durch diese Türen', zeigte Bürgermeister Dieter Runzheimer auf den Eingang des Hauses Burgstraße 21,
'und dann waren sie nicht mehr da'. Neun Stolpersteine verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig am Mittwochmorgen in Melsungen vor drei Häusern zur Erinnerung an Juden, die einst dort
wohnten..." |
| |
| Mai 2011:
Weitere "Stolpersteine" werden
verlegt |
Artikel von Grugel in der "Hessischen Allgemeinen" vom Mai 2011
(Artikel):
"Künstler Gunter Demnig verlegte sechs Stolpersteine in der Melsunger Innenstadt
Melsungen. Die Melsunger Initiative für Stolpersteine hat am Donnerstag in der Melsunger Innenstadt sechs Steine zum Gedenken an jüdische Opfer aus der Bartenwetzerstadt verlegt..." |
| |
| November 2013:
Schüler beschäftigen sich mit den Schicksalen
jüdischer Melsunger |
Artikel von Judith Féaux de Lacroix in der
"Hessischen Allgemeinen" vom 21. November 2013 (Artikel):
"Jugendliche befassten sich mit jüdischem Leben in Felsberg und Melsungen
- Schüler auf Spurensuche
Melsungen/Felsberg. Was ist eigentlich ein Stolperstein? Bis vor wenigen Monaten konnten die meisten Schülerinnen der Klasse 10F13 an der Melsunger Radko-Stöckl-Schule diese Frage noch nicht beantworten. Jetzt wissen sie nicht nur, was hinter dem Begriff steckt, sondern wollen sogar selbst eine Spendenaktion starten, damit weitere Stolpersteine verlegt werden können.
Auf die Idee gekommen sind die Schülerinnen durch ein Projekt mit dem Titel
'Zivilcourage', das der Bund deutscher Pfadfinder und Pfadfinderinnen Nordhessen (BDP) in Kooperation mit der Radko-Stöckl-Schule organisiert hat. Dabei setzen sich Schüler mit Themen wie Rassismus und Ausgrenzung auseinander. Für dieses Projekt, das von der Initiative
'Gewalt geht nicht' finanziell unterstützt wird', wurde der BDP jetzt mit dem Förderpreis des Hessischen Jugendrings ausgezeichnet. Unter rund 30 Bewerbern kam das Projekt auf den vierten Platz.
Sammeln für Stolpersteine. Die Schülerinnen der Klasse 10F13 machten sich im Rahmen des Projektes auf die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in Melsungen und Felsberg. Dabei befassten sie sich auch mit dem Schicksal von Juden, die früher in der Region gelebt haben.
'Es ist schrecklich, wie Juden damals behandelt wurden', sagt die 16-jährige Christine Hartlieb aus
Eubach. 'Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist'...." |
| |
|
Mai 2024:
Weitere "Stolpersteine" werden
verlegt |
Artikel von Manfred Schaake in hna.de vom 4.
Mai 2024: "Melsungen. Symbole der Würdigung: Zehn Gedenktafeln für
ehemals verfolgte Melsunger verlegt
In Gedenken an zehn verfolgte Melsunger während der NS-Zeit wurden in der
Melsunger Innenstadt am Freitagvormittag Stolpersteine verlegt.
Melsungen – Die vier Gedenkfeiern in der Melsunger Innenstadt zur
Verlegung von zehn Stolpersteinen waren am Freitag eine Mahnung für Frieden,
Freiheit, Gerechtigkeit, für Toleranz und Menschenwürde.
Von Schülern der Melsunger Schulen begleitet. Begleitet wurde die
Verlegung der Messingsteine von Schülerinnen und Schülern der Melsunger
Schulen, Renate und Roland Häusler und durch Initiator Gunter Demnig aus dem
Vogelsbergkreis. Seitdem der Künstler das Projekt 1992 ins Leben gerufen
hat, hat Demnig in 31 Ländern bisher 105.000 Stolpersteine verlegt. 'Die
Nachfrage nach Stolpersteinen ist weiterhin groß,', sagte Demnig beim
Empfang im Rathaus. 'Ich habe nie Werbung gemacht – es kommt vom Herzen'.
Gäste reisten extra aus den USA an. Dankbar für die Würdigung waren
auch viele Gäste, die extra aus den USA nach Melsungen anreisten:
'Herzlichen Dank für diese Aktion' sagte Michael Freedberg, der mit seiner
Familie aus den USA nach Melsungen gekommen war. Er kam wegen seiner
Großmutter Grete Levy, die damals Melsungen verlassen musste, weil sie von
den Nationalsozialisten verfolgt wurde. Am Ende der Gedenkveranstaltung
sagte er: 'Es ist für mich und meine Familie von großer Bedeutung, gemeinsam
mit der Bevölkerung von Melsungen die ehemaligen jüdischen Einwohner ehren
zu dürfen. Durch diesen Zusammenhalt geschieht viel Heilung für meine
Familie, die gesamte jüdische Gemeinschaft und die ganze Welt.'
Melsungens Erste Stadträtin Ulrike Hund und Stadtverordnetenvorsteher Timo
Riedemann würdigten die Arbeit Demnigs und der Melsunger Initiative um
Hans-Peter Klein. Demnig habe die Stolpersteine erschaffen und ins Leben
gerufen, sagte Hund. Und: 'Auch die Stadt Melsungen hat ihre schwarzen und
schweren Zeiten durchlebt.' Ebenfalls gewürdigt wurden die laut Hund
'unermüdlichen Recherchen' von Hans-Peter Klein. 'Nie war ehrenamtliches
Engagement und persönlicher Einsatz für dieses Gedenken so wertvoll wie
heute', sagte sie, 'leider ein Satz, der in der näheren Vergangenheit
besondere Bedeutung hat'.
Auch Kritik an den Steinen wurde geäußert. Gedacht werde der
Personen, 'über deren Schicksal wir stolpern und uns erinnern'. Es gebe auch
verschiedene Arten von Kritik an der Verlegung der Stolpersteine, erklärte
Hund. So werde beispielsweise argumentiert, die Privatsphäre der Opfer werde
verletzt, oder es werde befürchtet, dass dieses Gedenken die historische
Tragweite des Verbrechens verharmlost. Hund: 'Ich meine, dass es
unerlässlich ist, der Opfer zu gedenken, die keine andere Gedenkstätte,
keinen Grabstein haben können, als den Stolperstein in ihrer Heimat.'
Stolpersteine sind mehr als nur Gedenksteine. Stolpersteine seien
mehr als nur kleine Gedenksteine: 'Sie sind Symbole der Erinnerung, der
Würdigung und des Gedenkens an die Menschen, an ihre Angehörige und unsere
Mitbürger, die während der Zeit des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte
unsägliches Leid erfahren haben.'
Steine geben Opfern ihre Würde zurück. Jeder Stolperstein gebe den
Opfern des Nationalsozialismus ihre Namen und ihre Würde zurück. Die erste
weiße Rose bei der Verlegung der Stolpersteine Am Markt 4 legte Elfriede
Plümpe nieder – 'um die Verstorbenen zu ehren', wie sie sagte. Auch auf den
weiteren Stolpersteinen lagen weiße Rosen. An der Rotenburger
Straße/Tränkelücke stellten Schüler der Geschwister-Scholl-Schule mit
Pfarrer Jörg Ackermann die Geschichte des jüdischen Lehrers Dagobert
Löwenstein und seiner Frau vor. Hans-Peter Klein stellte in Zukunft auch
weitere Stolpersteinverlegungen in Melsungen in Aussicht.
Familie Rothschild. Bei der gestrigen Stolpersteinverlegung wurde auch der
Familie Rothschild gedacht. Hans-Peter Klein von der Stolperstein-Initiative
hat Interessantes über die Rothschilds zusammengetragen: Hanns-Joseph
Rothschild wurde nach der Pogromnacht am 08. November 1938 verhaftet und mit
drei anderen Männern jüdischen Glaubens - Emil Goldschmied, Arthur Katz und
Leopold Abt - aus Melsungen in dem Lager Breitenau bei Guxhagen inhaftiert.
Von dort wurde er in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar
überstellt. In Belgien wurden Hugo und Bertha Rothschild in dem Lager
Mechelen inhaftiert und von dort im Oktober 1942 nach Auschwitz deportiert.
Hanns-Joseph und Myrtle Rothschild haben zwei Kinder: Hilary Rothschild und
Renee Richmond, die beide in England leben, wie Klein erläutert."
Link zum Artikel |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 67-69. |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 54-55. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 51. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.178-179. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 508-510. |
 | Artikel von Dieter Hoppe: Das Ensemble des Kasseler
Klassizismus in Melsungen: Die Stadthalle und die ehemalige Synagoge in der
Rotenburger Straße:
Artikel
zur "Alten Synagoge" in Melsungen (Kurt Maurer/Dieter Hoppe)
in einer Seite des Geschichtsvereins Melsungen. |
 | Die Geschichte des Hauses Kasseler Straße 28 (unter
besonderer Berücksichtigung seiner jüdischen Vergangenheit). Eine
Darstellung in Dokumenten und Bildern. Hg. von Bernd Köhler, Melsungen
2001. Online
als pdf-Datei zugänglich.
(http://platin.koehler-shop.de/images/firmengeschichte/geschichte_des_hauses.pdf)
|
 |
 Beitrag
über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing
the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut Beitrag
über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing
the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut
When Elizabeth S. Plaut began tracing her husband’s family roots forty
years ago, she had no idea how this undertaking would change her life and
turn her into a serious genealogist. A trained researcher, she corresponded
with hundreds of people around the world to glean information about the
various branches of the family; scoured cemetery files, archives, and other
available sources; and maintained copious files brimming over with her notes
and charts. Beginning with her quest to find the roots of her husband’s
branch of the family from Willingshausen, Germany -many years before
genealogy became popular - Elizabeth Plaut discovered families in dozens of
small villages in Germany. She tracked the relationships between more than
11,000 people and separated the branches according to the many cities where
the families originated. Impressive in its scope and in Elizabeth Plaut’s
meticulous commitment to detail, The Plaut Family: Tracing the Legacy will
be of immense value to all those interested in knowing more about their
roots. 7" x 10" 420 pp. softcover $45.00. Vgl.
http://www.avotaynu.com/books/Plaut.htm.
Family Trees Organized by German Town of Ancestry: Bodenteich, Bovenden,
Falkenberg, Frankershausen, Frielendorf, Geisa, Gudensberg, Guxhagen,
Melsungen, Obervorschuetz, Ottrau, Rauschenberg, Reichensachsen,
Rotenburg, Schmalkalden, Wehrda, Willingshausen. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Melsungen
Hesse-Nassau. Established around 1776, the community built a large synagogue in
1841 and operated an elementary school from 1854 to 1924. It numbered 188 (5 %
of the total) in 1880. Anti-Jewish riots and disputes with German cattle traders
occured in the 19th century. Affiliated with Kassel's rabbinate, the community
declined to 89 (2 %) in 1925 and by November 1938 it had shrunk to 29. On Kristallnacht
(9-10 November 1938), the synagogue's interior was vandalized and Jews were
attacked, one detainee later dying in the Buchenwald concentration camp. After
1935, 42 Jews left (25 emigrating), ten were deported, and at least 18 perished
in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|