|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Frankenwinheim (VG
Gerolzhofen, Kreis Schweinfurt)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Frankenwinheim bestand eine jüdische Gemeinde bis
1942. Ihre Entstehung geht in die Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
zurück.
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im Laufe des 19.
Jahrhunderts wie folgt: 1816 79 jüdische Einwohner (13,8 % von insgesamt
574), 1837 100 (18,3 % von 546), 1867 82 (14,1 % von 580), 1889 77, 1892 82 (in
16 Familien), 1899 85 (in 15 Haushaltungen), 1900 86 (13,8 % von
623), 1910 58 (10,0 % von 588). Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom Handel mit Vieh und
Waren, seit der Mitte des 19. Jahrhundert betrieben sie einige für das
wirtschaftliche Leben des Ortes wichtige Handlungen.
Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Frankenwinheim auf
insgesamt 22 Matrikelstellen (einschließlich von drei Veränderungen bis
1826) die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem
Familiennamen und Erwerbszweig): Abraham Hajum Traubel (Handel mit alten Kleidern
und seidenen Flecken), Jacob Banfelt (Schmusen), Haium Hirsch
(Ellenwarenhandel), Hanna, Witwe von Kallmann Roth (lebt von Almosen), Hirsch
Isaac Bamberger (Ellenwarenhandel), Joseph Hirsch (Getreide-, Vieh- und
Ellenwarenhandel), Joseph Jacob (Viehhandel), Joseph Machol Kaiser
(Schnittwarenhandel), Israel Joel Kaiser (Kleider- und Ellenwarenhandel),
Kallmann Gerst (Getreide- und Ellenwarenhandel), Leser Moses Gottlieb (Vieh- und
Ellenwarenhandel), Löw Hirsch (Vieh- und Getreidehandel), Mannes Baerlein
Baermann (Viehhandel), Samson Hirsch Baumann (Schlachten und Viehhandel), Samson
Moises Friedmann (Viehhandel und Schlachten), Sandel Isaac Freudmann
(Viehhandel, Bänder- und Schnürenhandelschaft), Schmul Wolf (Schmusen),
Schönla, Witwe von Joel Kaiser (wird von ihren beiden Söhnen ernährt), Simon
Gerst (Getreide-, Vieh- und Ellenhandel), Moses Gerst (Betrieb des Feldbaus,
seit 1818), Seligmann Bamberger (Güterbesitz, seit 1820), Löb Gottlieb
(Feldbau, seit 1826).
An Einrichtungen waren neben der Synagoge (s.u.) ein Gemeindehaus mit
einer Religionsschule vorhanden sowie ein Ritualbad, das 1910 neu erbaut wurde.
Nach dem Standort der Synagoge erhielt die "Judengasse" ihren
Namen (die jüdischen Familien wohnten ansonsten im gesamten Ort verstreut).
Die
Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Von 1876 an war
über 50 Jahre lang Josef Kissinger auf dieser Stelle, ein Onkel des
späteren US-Außenministers Henry Kissinger (geb. als Heinz Alfred Kissinger
1923 in Fürth). Er war in dieser
Zeit geistiges Oberhaupt der Gemeinde (vgl. Presseartikel zu Josef Kissinger unten).
An der Religionsschule der Gemeinde waren 1892 19 Kinder zu unterrichten, 1894
16, 1898 20, 1899 18 Kinder. Kissinger unterrichtete teilweise auch die Kinder
in umliegenden Orten wie in Lülsfeld (1892
sechs, 1899 vier Kinder) und in Brünnau
(1896 ein Kind, 1903 vier Kinder).
An jüdischen Vereinen gab es einen Talmud-Thora-Verein (seit 1889/1894
genannt).
Die Gemeinde
gehörte zum Bezirksrabbinat Schweinfurt.
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1865/1879 Maier Hirsch, um
1888/1895 S. Hirsch, um 1896 J. Stern, um 1898 S. Hirsch.
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Felix Kolb (geb.
11.7.1895 in Frankenwinheim, gef. 7.6.1917). Sein Name steht auf dem alten
Kriegerdenkmal in der Ortsmitte oberhalb des Rathauses am Kirchberg (Inschrift
kaum lesbar). Außerdem ist gefallen: Siegfried Strauß (geb. 8.8.1895 in
Frankenwinheim, wohnte 1914 in Idstein).
Um 1924, als 53 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (von insgesamt
etwa 500 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Siegfried Kahn.
Religionslehrer, Kantor und Schochet war weiterhin Josef Kissinger. Er
unterrichtete an der Religionsschule der Gemeinde damals noch zwei Kinder. Als
jüdischer Verein wird der Toralernverein Limud Tora genannt, damals geleitet
von Lehrer Kissinger. Ihm gehörten 11 Mitglieder an. Der jüdischen Gemeinde
Frankenwinheim waren inzwischen auch die in Lülsfeld noch lebenden jüdischen
Personen angeschlossen, nachdem dort die Zahl der jüdischen Einwohner stark
zurückgegangen war (1924: 17 Personen). 1932 war Vorsteher der Gemeinde
Isidor Mermelstein (emigrierte 1938 mit seiner Frau Ida und den 1934 in
Schweinfurt geborenen Zwillingen Egon und Lothar in die USA).
1933 lebten noch 54 jüdische Personen in Frankenwinheim (8,0 % der
Einwohnerschaft). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der
zunehmenden Repressalien und der Entrechtung verließen in der Folgezeit viele
von ihnen den Ort: bis 1938 verzogen 13 in andere Städte, sechs
wanderten aus. Ende Oktober 1938 kam es zu ersten Gewalttätigkeiten
gegen die jüdischen Einwohner von Frankenwinheim, da gegen ein Gemeindemitglied
der Vorwurf der Brunnenvergiftung erhoben wurde. Mitglieder der Ortsgruppen der
Gliederungen der NSDAP beteiligten sich an den Ausschreitungen. Beim Novemberpogrom
1938 gingen SA-Leute aus Gerolzhofen und Volkach in brutaler Weise gegen die
jüdischen Einwohner des Ortes vor. Nach abscheulichen Szenen in und vor der
Synagoge (s.u.) wurden alle Juden, Männer, Frauen und Kinder in das Gefängnis
nach Gerolzhofen gebracht. Die Frauen und Kinder wurden am Tag darauf wieder
entlassen, fünf Männer in das KZ Buchenwald verbracht. Die jüdischen
Wohnungen waren inzwischen zerstört und ausgeraubt worden. Bis 1941
verließen weitere der jüdischen Einwohner den Ort, 17 konnten auswandern,
sieben verzogen in andere deutsche Orte. Im April und September 1942
wurden die letzten Juden über Würzburg deportiert, 13 wurden nach Izbica bei
Lublin deportiert, drei kamen in das Ghetto Theresienstadt.
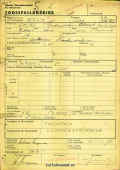 Von den in Frankenwinheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Margarete (Gretchen) Braunold
geb. Kissinger (1887), Johanna Durmann geb. Kolb (1893), Bertha
Friedmann (1890), Gerhard Friedmann (1925), Ilse Friedmann (1922), Max
Friedmann (1886), Walter Friedmann (1928), Maria Friess (1915), Nanny Gerst
(1858), Ernestina Gildner (1872), Sabina Gottlieb geb. Schild (1859; vgl. Dokument
aus dem Ghetto Theresienstadt über ihren Tod 1942), Meta Guttmann geb. Hirsch (1891), Klara
Güthermann (1881), Hannchen Heippert geb. Gottlieb (1889), Emma Hirsch (1890), Gustav Hirsch
(1884), Isaak Hirsch (1875; links Dokument aus dem Ghetto Theresienstadt
über seinen Tod 1943), Ignaz Hirsch (1871), Josef Hirsch (1869),
Simon Hirsch (1875), Willy Hirsch (1864), Samuel Kahn (1886), Jettchen Kissinger
(1888), Maier Kissinger (1885), Berta Kolb
(1892), Kathi Kolb (1908), Max Kolb (1898), Meta Kolb geb. Künstler (1902),
Regina Kolb geb. Jacob (1867), Siegbert Kolb (1932), Betty Proskauer geb. Kissinger (1891), Fanny Rosenthal (1884), Henriette Wolf
(1900), Isbert Wolf
(1935), Liebmann Wolf (1896), Selma Wolf geb. Kolb (1899). Von den in Frankenwinheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Margarete (Gretchen) Braunold
geb. Kissinger (1887), Johanna Durmann geb. Kolb (1893), Bertha
Friedmann (1890), Gerhard Friedmann (1925), Ilse Friedmann (1922), Max
Friedmann (1886), Walter Friedmann (1928), Maria Friess (1915), Nanny Gerst
(1858), Ernestina Gildner (1872), Sabina Gottlieb geb. Schild (1859; vgl. Dokument
aus dem Ghetto Theresienstadt über ihren Tod 1942), Meta Guttmann geb. Hirsch (1891), Klara
Güthermann (1881), Hannchen Heippert geb. Gottlieb (1889), Emma Hirsch (1890), Gustav Hirsch
(1884), Isaak Hirsch (1875; links Dokument aus dem Ghetto Theresienstadt
über seinen Tod 1943), Ignaz Hirsch (1871), Josef Hirsch (1869),
Simon Hirsch (1875), Willy Hirsch (1864), Samuel Kahn (1886), Jettchen Kissinger
(1888), Maier Kissinger (1885), Berta Kolb
(1892), Kathi Kolb (1908), Max Kolb (1898), Meta Kolb geb. Künstler (1902),
Regina Kolb geb. Jacob (1867), Siegbert Kolb (1932), Betty Proskauer geb. Kissinger (1891), Fanny Rosenthal (1884), Henriette Wolf
(1900), Isbert Wolf
(1935), Liebmann Wolf (1896), Selma Wolf geb. Kolb (1899).
Die kursiv markierten Personen werden auf dem Gedenkstein der Gemeinde
Frankenwinheim genannt, die anderen Personen sind teilweise in Frankenwinheim
geboren, lebten später aber an anderen Orten.
Im September 2013 wurden in Frankenwinheim an zwei Stellen in der
Schallfelder Straße zusammen elf "Stolpersteine" durch den
Künstler Gunter Demnig verlegt (vgl. Fotos und Link zu einem Pressebericht
unten). Die Gedenksteine erinnern an zwei jüdische Familien Frankenwinheims: an
die Familie Friedmann, von der niemand den Holocaust überlebte:
Max, Bertha, Ilse, Gerhard und Walter Friedmann wurden nach Krasnystaw deportiert
und dort ermordet, die 80-jährige Großmutter kam im Ghetto Theresienstadt ums Leben;
an die Familie Gottlieb, von der zwar fast alle noch in die USA
emigrieren konnten, doch mussten sie ihren gesamten Besitz zurücklassen; die
Großmutter Sabina Gottlieb kam 1942 im Ghetto Theresienstadt ums Leben.
Am 27. Mai 2014 war die zweite Verlegung von "Stolpersteinen"
für Mitglieder der Familie Kolb (siehe Fotos und Bericht unten), am 30. Mai
2015 die dritte Verlegung für Mitglieder der Familien Niedermann (vier Steine)
und Familie Hirsch (zwei Steine). Am 1. August 2015 erfolgte die vierte
Verlegung, am 5. Mai 2017 die fünfte Verlegung (insgesamt neun
"Stolpersteine", weitere Informationen zu den Verlegungen mit Fotos
siehe unten), im Oktober 2017 die sechste Verlegung.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Lehrers, Kantors und Schochets (1927)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:
"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und
hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch
Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,
Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.
Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger
Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis
spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den
Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen
falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen
Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November
1927. Siegfried Kahn." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. November 1927:
"In der hiesigen Kultusgemeinde, an die auch Lülsfeld und
hinsichtlich der Schechitoh auch Brünnau angeschlossen ist, ist durch
Pensionierung des seitherigen Stelleninhabers, die Stelle des Lehrers,
Kantors und Schochets frei und soll alsbald wieder besetzt werden.
Geeignete gesetzestreue Bewerber wollen unter Vorlage beglaubiger
Zeugnisabschriften und eines Lichtbildes sich bei dem Unterzeichneten bis
spätestens 1. Dezember melden. Der Gehalt bestimmt sich nach den
Satzungen des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden. Gegebenen
falls wäre die Übernahme des Amts des Schochets in einigen
Nachbargemeinden nicht ausgeschlossen. Frankenwinheim, November
1927. Siegfried Kahn." |
Zum 25-jährigen Ortsjubiläum von Lehrer Josef Kissinger (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1901: "Frankenwinheim,
im Ijar. Ein erhebendes Fest war es, das die hiesige Kultusgemeinde am
vergangenen Sabbat gefeiert, ehrend sowohl für die Gemeinde wie für den
Gefeierten selbst. Fünfundzwanzig Jahre waren es, seitdem Herr J.
Kissinger als Lehrer in besagter Gemeinde in segensreichster Weise wirkt,
ebenso als Vorstand einer Chewrah, die es sich zur Aufgabe stellt, den
Gemeindemitgliedern, sowie der heranwachsenden Jugend die Lehren und
Wahrheiten unserer heiligen Religion durch Studium an der Quelle, wie
Rasch, Orach chajim, Chajedom, vom Leichteren zum Schwereren
fortschreitend, beizubringen, um diese allgemach zum Selbststudium zu
befähigen. Herr Kultusvorstand Seligmann Hirsch würdigte in rührenden
Worten die großen Verdienste des Jubilars, um die Schule und Gemeinde,
und überreichte im Namen der Gemeinde als äußeres Zeichen der
Anerkennung eine goldene Uhr. Der Jubilar dankte zunächst dem
Allmächtigen für die große Gnade, die ihn gewürdigt, so segensreich
wirken zu können, unter Zugrundlegung des Textes: 'Ich bin zu gering
für all die Gnaden und für all die Treue, die du erwiesen deinem
Knechte...' (1. Mose 32,11) und versprach, unter Dankesausdruck für
die ihm bezeigte Ehrung, auch fernerhin seine ganze Kraft in den Dienst
seiner Gemeinde stellen zu wollen. Beim Mincha-Gebete, dem auch Seiner
Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Stein aus Schweinfurt, der über Sabbat in
dem nahe gelegenen Städtchen Gerolzhofen
weilte, beiwohnte, hob dieser im Anschlusse an seine Predigt die
Verdienste des Jubilars hervor, und dass er sich freue, wie die
Kultusgemeinde ihren Lehrer liebe und achte. Bei dem zu Ehren des Jubilars
veranstalteten Festbankett überreichte eine Schülerin namens der Schule
ein prachtvolles Album. Möge es dem verehrten Jubilar
beschieden sein, noch lange, lange Jahre in ungeschwächter Kraft zum Segen
der Schule und der Kultusgemeinde wirken zu können. um die Tora groß zu
machen und zu verherrlichen. J.H. in M." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1901: "Frankenwinheim,
im Ijar. Ein erhebendes Fest war es, das die hiesige Kultusgemeinde am
vergangenen Sabbat gefeiert, ehrend sowohl für die Gemeinde wie für den
Gefeierten selbst. Fünfundzwanzig Jahre waren es, seitdem Herr J.
Kissinger als Lehrer in besagter Gemeinde in segensreichster Weise wirkt,
ebenso als Vorstand einer Chewrah, die es sich zur Aufgabe stellt, den
Gemeindemitgliedern, sowie der heranwachsenden Jugend die Lehren und
Wahrheiten unserer heiligen Religion durch Studium an der Quelle, wie
Rasch, Orach chajim, Chajedom, vom Leichteren zum Schwereren
fortschreitend, beizubringen, um diese allgemach zum Selbststudium zu
befähigen. Herr Kultusvorstand Seligmann Hirsch würdigte in rührenden
Worten die großen Verdienste des Jubilars, um die Schule und Gemeinde,
und überreichte im Namen der Gemeinde als äußeres Zeichen der
Anerkennung eine goldene Uhr. Der Jubilar dankte zunächst dem
Allmächtigen für die große Gnade, die ihn gewürdigt, so segensreich
wirken zu können, unter Zugrundlegung des Textes: 'Ich bin zu gering
für all die Gnaden und für all die Treue, die du erwiesen deinem
Knechte...' (1. Mose 32,11) und versprach, unter Dankesausdruck für
die ihm bezeigte Ehrung, auch fernerhin seine ganze Kraft in den Dienst
seiner Gemeinde stellen zu wollen. Beim Mincha-Gebete, dem auch Seiner
Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Stein aus Schweinfurt, der über Sabbat in
dem nahe gelegenen Städtchen Gerolzhofen
weilte, beiwohnte, hob dieser im Anschlusse an seine Predigt die
Verdienste des Jubilars hervor, und dass er sich freue, wie die
Kultusgemeinde ihren Lehrer liebe und achte. Bei dem zu Ehren des Jubilars
veranstalteten Festbankett überreichte eine Schülerin namens der Schule
ein prachtvolles Album. Möge es dem verehrten Jubilar
beschieden sein, noch lange, lange Jahre in ungeschwächter Kraft zum Segen
der Schule und der Kultusgemeinde wirken zu können. um die Tora groß zu
machen und zu verherrlichen. J.H. in M." |
Zum 50jährigen Dienstjubiläum des Lehrers Josef Kissinger (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1921:
"Frankenwinheim (Unterfranken), 26. Oktober (1921). Am 7. November
feiert der in weiten Kreisen bekannte und hochgeachtete Lehrer Herr Josef
Kissinger sein 50jähriges Dienstjubiläum, wovon gewiss seine zahlreichen
Freunde gerne Kenntnis nehmen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1921:
"Frankenwinheim (Unterfranken), 26. Oktober (1921). Am 7. November
feiert der in weiten Kreisen bekannte und hochgeachtete Lehrer Herr Josef
Kissinger sein 50jähriges Dienstjubiläum, wovon gewiss seine zahlreichen
Freunde gerne Kenntnis nehmen."
|
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1921: "Frankenwinheim,
27. November 1921: Die Feier des goldenen Dienstjubiläums des Herrn
Lehrer Josef Kissinger dahier am 7. November, war ein Ehrentag nicht nur
für den Jubilar selbst, sondern auch für seine Gemeinde mit den Filialen
Brünnau und Lülsfeld. Ununterbrochen vom frühen Morgen bis
zum späten Abend dauerten die Gratulationen seitens der Jugend und der
Erwachsenen aus den drei Gemeinden und der weiteren Umgebung ohne
Unterschied der Konfession. Ein ungeheurer Depeschen- und Briefverkehr,
sowie die Überreichung zahlreicher und wertvoller Geschenke von hier und
auswärts zeugten von der Beliebtheit des Jubilars, den der zuständige
Rabbiner, Herr Dr. Stein in Schweinfurt, in einem prächtigen,
lehrer-freundlichen Schreiben als einen der Bewährtesten seines Standes
bezeichnete. Möge es dem verehrten Jubilar vergönnt sein, noch recht
lange in seiner seltenen Körper- und Geistesfrische zum Wohle seiner
Familie, seiner Gemeinden und des ganzen Judentums zu wirken. Möge aber
auch in seinen Gemeinden der gute Wille und die billige Einsicht Platz
greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Führer durch Verabreichung
eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorgenlosen Lebensabend zu
bereiten". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1921: "Frankenwinheim,
27. November 1921: Die Feier des goldenen Dienstjubiläums des Herrn
Lehrer Josef Kissinger dahier am 7. November, war ein Ehrentag nicht nur
für den Jubilar selbst, sondern auch für seine Gemeinde mit den Filialen
Brünnau und Lülsfeld. Ununterbrochen vom frühen Morgen bis
zum späten Abend dauerten die Gratulationen seitens der Jugend und der
Erwachsenen aus den drei Gemeinden und der weiteren Umgebung ohne
Unterschied der Konfession. Ein ungeheurer Depeschen- und Briefverkehr,
sowie die Überreichung zahlreicher und wertvoller Geschenke von hier und
auswärts zeugten von der Beliebtheit des Jubilars, den der zuständige
Rabbiner, Herr Dr. Stein in Schweinfurt, in einem prächtigen,
lehrer-freundlichen Schreiben als einen der Bewährtesten seines Standes
bezeichnete. Möge es dem verehrten Jubilar vergönnt sein, noch recht
lange in seiner seltenen Körper- und Geistesfrische zum Wohle seiner
Familie, seiner Gemeinden und des ganzen Judentums zu wirken. Möge aber
auch in seinen Gemeinden der gute Wille und die billige Einsicht Platz
greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Führer durch Verabreichung
eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorgenlosen Lebensabend zu
bereiten". |
Zum 50-jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Josef
Kissinger (1926)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926:
"Frankenwinheim, 23. April. Zu einer Kundgebung, wie sie nur vom
Herzen kommen kann, gestaltete sich das 50-jährige Ortsjubiläum unseres
Lehrers Herrn Josef Kissinger hier. Den Auftakt zur Feier bildete ein
Festakt am Schabbat Schmini in der Synagoge. In einer trefflichen
Rede schilderte Herr Vorstand Kahn das mustergültige Wirken des Jubilars
als vorzüglicher Lehrer, als Fachmann im Schächten und als
ausgezeichneter Chasan (Vorbeter). Besonders gerühmt wurde das
seltene Gemilut Chässäd (Wohltätigkeit) des Gefeierten gegenüber
den Lebenden und gegenüber den Toten. Als Beweis, wie der Jubilar die
Mizwa der Gastfreundschaft übte, sei nur erwähnt, dass
derselbe seit 40 Jahren ein Zimmer für Schlafgelegenheit für die Gäste
stets bereit hält und sie zum Frühstück einlädt. Der Sonntag war ein
Festtag für die ganze Dorfgemeinde. Der Jubilar wurde von allen Vereinen
mit ihren Fahnen unter Musikbegleitung, umringt von Ehrendamen in weißer
Kleidung, ins Festlokal abgeholt, das im Nu überfüllt war. In
prächtigen Ansprachen des Bürgermeisters und der Vereinsvorstand und
andere prominente Persönlichkeiten wurde das edle Wirken des Jubilars
gefeiert. In bewegten Worten dankte der Jubilar für all die Ehre und
Liebe, die ihm erwiesen wurde. Die ganze Veranstaltung war ein Kiddusch
Haschem (Heiligung Gottes) in des Wortes wahrster Bedeutung. Wir rufen
dem Jubilar ein "Gut Glück" zu. "(Alles Gute) bis
einhundertundzwanzig Jahre". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1926:
"Frankenwinheim, 23. April. Zu einer Kundgebung, wie sie nur vom
Herzen kommen kann, gestaltete sich das 50-jährige Ortsjubiläum unseres
Lehrers Herrn Josef Kissinger hier. Den Auftakt zur Feier bildete ein
Festakt am Schabbat Schmini in der Synagoge. In einer trefflichen
Rede schilderte Herr Vorstand Kahn das mustergültige Wirken des Jubilars
als vorzüglicher Lehrer, als Fachmann im Schächten und als
ausgezeichneter Chasan (Vorbeter). Besonders gerühmt wurde das
seltene Gemilut Chässäd (Wohltätigkeit) des Gefeierten gegenüber
den Lebenden und gegenüber den Toten. Als Beweis, wie der Jubilar die
Mizwa der Gastfreundschaft übte, sei nur erwähnt, dass
derselbe seit 40 Jahren ein Zimmer für Schlafgelegenheit für die Gäste
stets bereit hält und sie zum Frühstück einlädt. Der Sonntag war ein
Festtag für die ganze Dorfgemeinde. Der Jubilar wurde von allen Vereinen
mit ihren Fahnen unter Musikbegleitung, umringt von Ehrendamen in weißer
Kleidung, ins Festlokal abgeholt, das im Nu überfüllt war. In
prächtigen Ansprachen des Bürgermeisters und der Vereinsvorstand und
andere prominente Persönlichkeiten wurde das edle Wirken des Jubilars
gefeiert. In bewegten Worten dankte der Jubilar für all die Ehre und
Liebe, die ihm erwiesen wurde. Die ganze Veranstaltung war ein Kiddusch
Haschem (Heiligung Gottes) in des Wortes wahrster Bedeutung. Wir rufen
dem Jubilar ein "Gut Glück" zu. "(Alles Gute) bis
einhundertundzwanzig Jahre". |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1926:
"In Frankenwinheim feierte Lehrer Josef Kissinger sein 50jähriges
Jubiläum als Kantor und Lehrer der Gemeinde. Wir wünschen dem
hochverdienten Jubilar noch viele Jahre in körperlicher und geistiger
Rüstigkeit".
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1926:
"In Frankenwinheim feierte Lehrer Josef Kissinger sein 50jähriges
Jubiläum als Kantor und Lehrer der Gemeinde. Wir wünschen dem
hochverdienten Jubilar noch viele Jahre in körperlicher und geistiger
Rüstigkeit". |
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9.
Februar 1927: "Moses Hofmann (Rothenburg),
J. Kissinger (Frankenwinheim), Abraham Strauß (Uffenheim)
haben 7 x 7 Jahre in einer Gemeinde als Lehrer in der Schule, als Vorbeter
im Gotteshaus, als Berater in ihren Gemeinden gewirkt. Hofmann und Strauß
sind die ersten Lehrer in neu gegründeten Gemeinden gewesen, sie haben
die Einrichtungen des Kultus und der Schule erst schaffen müssen. Ihres
Wirkens und Schaffens Geschichte ist die Geschichte ihrer Gemeinden. In
solchen kleinen Gemeinden 50 Jahre auszuharren, dazu bedarf es einer
seltenen Treue, großer Liebe zum Berufe - und einer Resignation, die
manchen Undank und manche Verkennung hinnimmt. Unsere drei Jubilare haben
als Jünglinge und Männer in einem Berufe gewirkt, der Hungerlohn und
Rechtlosigkeit als Entschädigung bot für Pflichttreue - und erst in
späteren Jahren sahen sie Ernten reifen, zu denen sie die Saaten hoffend
gestreut." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9.
Februar 1927: "Moses Hofmann (Rothenburg),
J. Kissinger (Frankenwinheim), Abraham Strauß (Uffenheim)
haben 7 x 7 Jahre in einer Gemeinde als Lehrer in der Schule, als Vorbeter
im Gotteshaus, als Berater in ihren Gemeinden gewirkt. Hofmann und Strauß
sind die ersten Lehrer in neu gegründeten Gemeinden gewesen, sie haben
die Einrichtungen des Kultus und der Schule erst schaffen müssen. Ihres
Wirkens und Schaffens Geschichte ist die Geschichte ihrer Gemeinden. In
solchen kleinen Gemeinden 50 Jahre auszuharren, dazu bedarf es einer
seltenen Treue, großer Liebe zum Berufe - und einer Resignation, die
manchen Undank und manche Verkennung hinnimmt. Unsere drei Jubilare haben
als Jünglinge und Männer in einem Berufe gewirkt, der Hungerlohn und
Rechtlosigkeit als Entschädigung bot für Pflichttreue - und erst in
späteren Jahren sahen sie Ernten reifen, zu denen sie die Saaten hoffend
gestreut." |
| |
| Josef Kissinger war auch im bürgerlichen
Leben von Frankenwinheim völlig integriert: so war er von 1881 bis 1929
Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr, vgl. Link
zu einer Seite der Freiwilligen Feuerwehr in Frankenwinheim. |
82. Geburtstag von Lehrer Josef Kissinger im November
1934
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1934: "Frankenwinheim (Unterfranken). Dieser Tage (8.
Marcheschwan = 17. Oktober 1934) beging Herr Lehrer Josef Kissinger, der länger als ein
halbes Jahrhundert hier amtierte, seinen 82. Geburtstag in
verhältnismäßig recht günstiger körperlicher und geistiger
Verfassung." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1934: "Frankenwinheim (Unterfranken). Dieser Tage (8.
Marcheschwan = 17. Oktober 1934) beging Herr Lehrer Josef Kissinger, der länger als ein
halbes Jahrhundert hier amtierte, seinen 82. Geburtstag in
verhältnismäßig recht günstiger körperlicher und geistiger
Verfassung." |
| |
| |
Grabsteine
für Ida Kissinger geb. Grünfeld
(29.11.1851-7.7.1929; rechts) und
Oberlehrer Josef Kissinger
(28.10.1852-14.1.1939) sowie
Maier Kissinger (15.12.1885-14.12.1938)
im jüdischen Friedhof
Gerolzhofen
(Fotos von Stefan Polster) |
 |
 |
| |
|
|
| Hinweis (von
Stefan Polster): Kinder von Josef Kissinger und Ida geb. Grünfeld waren
neben dem Sohn Maier (geb. 1885) die oben in der Liste der in der NS-Zeit
umgekommenen Frauen: Margarete Braunold geb. Kissinger (geb. 1887),
Jettchen Kissinger (geb. 1888) und Betty Proskauer geb. Kissinger (geb.
1891). Die Tochter Fanny Kissinger (siehe Heiratsanzeige unten) emigrierte
zusammen mit ihrem Mann Norbert Guggenheim und den beiden Söhnen Armin
und Helmut 1939 in die USA. |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Feier des Talmud-Tora-Vereins
(1897)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 11. Februar 1897: "Vereinsnachrichten. Artikel
in "Der Israelit" vom 11. Februar 1897: "Vereinsnachrichten.
Frankenwinheim (Unterfranken). Eine erheben die Feier galt einem
Sijum in unserem Talmud-Tora-Verein, der aus zehn Mitgliedern besteht
und am 1. Juli 1888 gegründet wurde. Die Mitglieder, sämtlich
Geschäftsleute, versammeln sich alle Sabbat- und Feiertage morgens
unmittelbar nach dem Morgengottesdienste im Schullokale, um eine Stunde sich
dem Torastudium zu widmen. In den Wintermonaten geschieht dies auch jeden
Donnerstag Nachts. Mit Gottes Hilfe ist es dem Vorstande und eifrigen Leiter
dieses Vereins, Herrn Lehrer Kissinger, der sich es zur hohen Aufgabe
gestellt, die Teilnehmer immer mehr zum Selbstlernen zu befähigen, gelungen,
bereits sehr schöne Resultate zu erzielen. In diesem Verein wird abwechselnd
Chai Adam, Raschi mit Chimusch Kizzur Schulchan Aruch
und Orach Chaim gelernt und wurden einige dieser Bücher schon mehrere Male
beendet. Nachdem der Sijum über Orach Chaim vollzogen, gab der
Verein ein Festessen, in dessen würdigen Verlauf der derzeitige
Kultusvorstand und Mitglied des Vereins, Herr Seligmann Hirsch eine
mit vielem Beifall aufgenommene Ansprache hielt über die Gründung und Ziele
des Vereins, den hohen Wert des Torastudiums darlegend, und die Mitglieder
zur ferneren eifrigen Beteiligung am Lernen auffordernd.
Herr Lehrer Kissinger sprach über Lo HaMidrasch Ikar ele HaMaaseh,
dass nicht das <lernen die Hauptsache, sondern das Darnachhandeln und die
Ausübung des Gelernten sei. Das Schir HaMaalot und Tischgebet wurde
versteigert, und nachdem bereits die Mitternachtsstunde herangerückt, schied
man mit dem ergebenden Bewusstsein, einen wahren, nur lichbod Hatora (zur
Ehre der Tora) veranstalteten Maadat Mizwah beigewohnt zu haben." |
Herausgabe des Memorbuches u.a. der
jüdischen Gemeinde Frankenwinheim (1938)
 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für den Verband der Kultusgemeinden in
Bayern" vom 1. November 1938: "Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in
Bayern. 2. Lieferung. Von Rabbiner Dr. M. Weinberg. Verlag S. Neumann,
Frankfurt am Main 1938." Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für den Verband der Kultusgemeinden in
Bayern" vom 1. November 1938: "Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in
Bayern. 2. Lieferung. Von Rabbiner Dr. M. Weinberg. Verlag S. Neumann,
Frankfurt am Main 1938." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
1769 ist "Jüdlein" aus
Frankenwinheim Delegierter der jüdischen Gemeinde (Artikel von 1889)
 Artikel
in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1889 Heft 2 S.
276: "Demnach zwischen der Hochfürstlich-Würzburgischen gemeinen
Land-Judenschaft eines, denn der Ritterschaftlichen Judenschaft in Franken,
anderen Teils, von dem Jahr 1769 an bis daher verschiedene Irrungen sich
ereignet haben, zu deren Erledigung Ihro Hochfürstliche Gnaden, Unser
gnädigster Fürst und Herr, eine besondere Kommission in höchsten Gnaden
ernannt haben, vor welcher bereits mehrere und weitläufige Handlungen
gepflogen worden, auch bereits darauf einige Verfügungen ergangen sind: Nun
aber nach reiflicher Überlegung beide Teile zu der Sachen gütlichen
Ausgleichung sich entschlossen, und zu dem Ende zwölf aus ihrem Mittel des
Geschäfts erfahrene Männer, als nämlichen Artikel
in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1889 Heft 2 S.
276: "Demnach zwischen der Hochfürstlich-Würzburgischen gemeinen
Land-Judenschaft eines, denn der Ritterschaftlichen Judenschaft in Franken,
anderen Teils, von dem Jahr 1769 an bis daher verschiedene Irrungen sich
ereignet haben, zu deren Erledigung Ihro Hochfürstliche Gnaden, Unser
gnädigster Fürst und Herr, eine besondere Kommission in höchsten Gnaden
ernannt haben, vor welcher bereits mehrere und weitläufige Handlungen
gepflogen worden, auch bereits darauf einige Verfügungen ergangen sind: Nun
aber nach reiflicher Überlegung beide Teile zu der Sachen gütlichen
Ausgleichung sich entschlossen, und zu dem Ende zwölf aus ihrem Mittel des
Geschäfts erfahrene Männer, als nämlichen
den Doktor Wolfsheimer - Vorgänger
Herz Kissingen - Vorgänger
Leser Bamberger - Deputierter
Isaak Langheim - Deputierter
Abraham Sondheimer - Ausschuss
Moses Kußel Schonungen -
Ausschuss
ab Seiten der Würzburgischen: und ab Seiten der ritterschaftlichen
Judenschaft
den Jonathan Samuel Westheim -
Vorgänger
Jüdlein Frankenwinheim - Vorgänger
Beer Feist Karbach - Vorgänger
Feist Joseph Niederwerrn -
Deputierter
Salomon Juda Westheim - Deputierter
Salomon Abraham Rottenbauer -
Vorgänger
mit dem Gewalt ernennet haben, dass, was diese zwölf Deputierte namens Ihrer
tun, handeln und vergleichen werden, von beiden Teilen genehmigt und als
eine Richtschnur angenommen und künftighin anerkennet werden solle." |
Dokument zur Beschneidung eines Sohnes von Samuel Marschütz
(1836) und weitere Dokumente zur Familie Marschütz
Anmerkung: Samuel Marschütz hatte mit seiner Frau Therese geb. Kanna/Kanne drei
in Frankenwinheim geborene Kinder: Moses (geb. 14.6.1835, gest. 15.6.1835),
Moses (Moritz; geb. 10.7.1836, Beschneidung am 17.7.1836 siehe Dokument sowie
Dokument zu seiner zweiten Heirat 1884; Moritz/Moses Marschütz war von 1859 bis
1896 Lehrer in Burghaslach) und Hanna
(geb. 22.11.1837, siehe Dokument zur Heirat 1868).
Dokumente erhalten von Stefan Polster.
| Rechts: Mohelbuch des Oscher
Blumenthal von Altenschönbach:
die 5. Eintragung von oben bezieht sich auf den Sohn Moses des Schmuel (Samuel) Marschütz aus
Frankenwinheim, durchgeführt am Sonntag, 3. Aw 5596 = 17. Juli
1836. |
 |
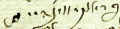
Der Ortsname "Frankenwinheim"
im Dokument links |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Grabstein
für die im Juli 1857 verstorbene
Thereses Marschütz im jüdischen Friedhof
Gerolzhofen
Samuel Marschütz ist 1871 gestorben und ebd. beigesetzt
(Grabstein bisher nicht gefunden) |
Die oben
genannte Tochter Hanna heiratete
1868 in Kitzingen den Salomon Grünbaum aus
Adelsberg
vgl.
genealogische Informationen bei geni.com
|
Der oben
genannte Sohn Moses heiratete in zweiter Ehe
1884 in Kitzingen Hannchen geb. Löwentritt
aus Schonungen (Moses/Moritz war
damals Lehrer in Burghaslach) |
Erinnerung an die Kriegsteilnehmer
1870/71
 Mitteilung
in "Im Deutschen Reich" 1896 Heft 1 Seite 40: "Hirsch, Sußmann, vor Paris
verwundet, aus Frankenwinheim.": Mitteilung
in "Im Deutschen Reich" 1896 Heft 1 Seite 40: "Hirsch, Sußmann, vor Paris
verwundet, aus Frankenwinheim.": |
Zum Tod von Bela Wolf geb. Forchheimer (1889)
Weiteres zur Genealogie:
https://www.geni.com/people/Babette-Wolf/6000000055827302929 Demnach ist
Babette Bela Wolf geb. Forchheimer am 29. August 1811 in Adelsberg geboren als
Tochter von Ephraim Löb Forchheimer und seiner Frau Bessle. Sie hatte mehrere
Geschwister: Baruch Forchheimer, Zärle Löb verh. Winheimer, Manes (?)
Firchheimer, Binas Löb Forchheimer, Gindel Forchheimer, Bünle Forchheimer und
Marianne Forchheimer. Sie war verheiratet mit Feibel Wolf, der am 6. Juni 1807
in Adelsberg geboren ist als Sohn von Wolf Joseph und seiner Frau Jindel. Die
beiden hatten Kinder, die zwischen 1835 und 1850 in Adelsberg geboren sind: Wolf
Wolf, Binas Wolf, Ephraim Wolf, Manes Manasse Wolf und Baruch Wolf.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1889:
"Frankenwinheim, im Adar II. - Es ist keine Freudenbotschaft,
von der ich Ihnen heute zu berichten habe. Ein biederes Weib, eine jener
edlen Frauengestalten, von tiefinnerster Religiosität durchdringen, wie
sie, ach, immer seltener, immer weniger werden, hat ihre reine Seele
ausgehaucht im hohen Alter von 79 Jahren, um einzugehen in jene lichten
Gefilde des Jenseits, zu genießen von dem hohen Gute, das nur den Frommen
und Gottesfürchtigen aufbewahrt ist. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1889:
"Frankenwinheim, im Adar II. - Es ist keine Freudenbotschaft,
von der ich Ihnen heute zu berichten habe. Ein biederes Weib, eine jener
edlen Frauengestalten, von tiefinnerster Religiosität durchdringen, wie
sie, ach, immer seltener, immer weniger werden, hat ihre reine Seele
ausgehaucht im hohen Alter von 79 Jahren, um einzugehen in jene lichten
Gefilde des Jenseits, zu genießen von dem hohen Gute, das nur den Frommen
und Gottesfürchtigen aufbewahrt ist.
Bela Wolf - der Friede sei mir ihr - Frau des vor 27 Jahren
verstorbenen Feibel Wolf - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen,
ehemaligen Buchbinders und Schochet (Schächter) in Heßdorf, ist
nicht mehr. Am 13. Adar I wurde sie unter großer Teilnahme trotz
des großen Schnees und der dabei herrschenden Kälte zur ewigen Ruhe bestattet.
Die edle Verblichene - der Friede sei mit ihr - , eine geborene
Forchheimer aus Adelsberg bei Gemünden, war eine Eschet chajal (tüchtige
Frau) im wahren Sinne des Wortes. Bei all den schweren Prüfungen, die sie
nun überstanden, bei all den harten Schlägen des Schicksals, die sie
erlebt und erlitten, bei all den blutenden Wunden, die ihrem edlen Herzen
geschlagen, sie blieb fest und unerschütterlich in ihrem Gottvertrauen
bis zum letzten Augenblicke ihres Lebens.
Von ihr kann man mit vielem Rechte sagen: mit ihr stirbt eine Fülle von
Weisheit aus, die doch nichts anderes ist als Gottesfurcht und
Frömmigkeit. Vom großen Unglücke des Witwenstandes in seiner ganzen Schwere
getroffen, wo ihr durch den Tod ihres Gatten ihr Stab und ihre Stütze
entrissen, hatte sie, obwohl selbst 12 Jahre hindurch leidend und
bettlägerig, für ihre verwaisten Kinder gelebt und gesorgt, und für
deren Erhaltung und Erziehung ihren Nacken gebeugt, sie hat gekämpft und
gerungen - und gesiegt.
Fünf ihrer guterzogenen, herangewachsenen Söhne sah sie durch den Tod
scheiden, mit blutendem und gebrochenem Herzen sah sie besonders einen
dieser durch Tora ausgezeichneten Sohn, Ephraim Wolf - das Gedenken an den
Gerecht ist zum Segen - Lehrer in Fischach, in bestem Mannesalter von sich
losgetrennt, mit den Worten Hiobs sich tröstend: Der Herr hat's gegeben,
der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all diesen
schweren Schicksalsschlägen ertrug sie ihr eigenes Leiden mit größter
Geduld, mit Ergebung in Gottes heiligen Willen. Sie war eine große
Freundin der Tora und der sich ihr Beschäftigenden, mit freudig
strahlendem Auge lauscht sie auf jedes Wort unserer heiligen Tora und
erzog auch alle ihre Kinder im Sinne und Geiste unserer heiligen Tora.
Selbst nicht mit irdischen Gütern gesegnet, unterstützte sie nach
Kräften Arme und Notleidende, war leutselig und zuvorkommend gegen jeden
Menschen ohne Unterschied. Sie hat gelebt für die drei Säulen, worauf
die sittliche Welt besteht: auf Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit.
Sie hatte das Glück, dass ihre Kinder - sie mögen leben - ihr mit
der zärtlichsten Liebe zugetan, sie auf das Würdigste pflegten und ihr
die Beschwerden des Alters und ihrer Leiden möglichst
erleichterten.
Möge sie nun ernten Heil, Lohn und Seligkeit im ewigen Leben, möge sie
sich ergötzen im glückseligen Zustande ihres eigenen Geistes, vereint
mit den verklärten Frommen aller Zeiten; möge der Allgütige den
Hinterbliebenen lindernden Balsam auf die geschlagene Wunde senden Amen,
so möge es Gottes Wille sein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Auszeichnungen im Ersten Weltkrieg
für jüdische Kriegsteilnehmer aus Frankenwinheim - Eisernes Kreuz für Gefreiter
Gottlieb, Leopold Krämer und Lehrer J. Krämer (1914/1916)
 Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Dezember 1914 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim.
Gefreiter Gottlieb, beim Regiments-Stab des bayerischen
Reserve-Infanterieregiments Nr. 4." Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Dezember 1914 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim.
Gefreiter Gottlieb, beim Regiments-Stab des bayerischen
Reserve-Infanterieregiments Nr. 4." |
| |
 Mitteilung
in "Der Gemeindebote" vom 8. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Gefreiter Gottlieb, beim Regimentsstab des bayerischen
Reserve-Infanterieregiments Nr. 4, aus Frankenwinheim." Mitteilung
in "Der Gemeindebote" vom 8. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Gefreiter Gottlieb, beim Regimentsstab des bayerischen
Reserve-Infanterieregiments Nr. 4, aus Frankenwinheim." |
| |
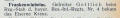 Mitteilung
in "Das jüdische Echo" vom 29. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Frankenwinheim. Gefreiter Gottlieb beim Reg.-Stab des
bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 4 bekam das Eiserne Kreuz." Mitteilung
in "Das jüdische Echo" vom 29. Januar 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Frankenwinheim. Gefreiter Gottlieb beim Reg.-Stab des
bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 4 bekam das Eiserne Kreuz." |
| |
 Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 9. Juli 1915 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold
Krämer." Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 9. Juli 1915 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold
Krämer." |
| |
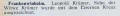 Mitteilung
in "Das Jüdische Echo" vom 23. Juli 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold Krämer, Sohn der Witwe Krämer wurde mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet." Mitteilung
in "Das Jüdische Echo" vom 23. Juli 1915: Auszeichnung mit dem Eisernen
Kreuz: "Frankenwinheim. Leopold Krämer, Sohn der Witwe Krämer wurde mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet." |
| |
 Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 1. Januar 1916 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse: "Frankenwinheim. J.
Krämer, Lehrer." Mitteilung
in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 1. Januar 1916 -
Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse: "Frankenwinheim. J.
Krämer, Lehrer." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Verlobungsanzeige von Sofie Strauss und Max Friedmann
(1908)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Statt
Karten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Statt
Karten.
Sofie Strauss - Max Friedmann. Verlobte. Bad
Brückenau - Frankenwinheim." |
Heiratsanzeige von Norbert Guggenheim und Fanni geb. Kissinger (1929)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: "Statt
Karten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: "Statt
Karten.
Norbert Guggenheim - Fanni Guggenheim geb. Kissinger.
Vermählte. Gailingen - Frankenwinheim.
Trauung: 7. Mai, Schweinfurt, Restaurant Seelig, 1 Uhr nachmittags." |
Weiteres
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Fotos einzelner jüdischer Gemeindeglieder (erhalten
von Stefan Polster)
 |
 |
 |
Hilde (Jenni) Hirsch
geb. Friedmann (geb. 7. September 1888;
verh. seit 1915 mit Isaak Hirsch s.u.; sie starb 1940 in
Würzburg und wurde auf dem jüdischen Friedhof
in
Gerolzhofen beigesetzt; Inschrift nicht lesbar) |
Berta Friedmann geb.
Kaufmann (geb. 1890
in Laudenbach, umgekommen
nach
Deportation 1942 nach Krasnystaw)
|
Ilse Friedmann (geb.
1922 in Frankenwinheim,
umgekommen nach Deportation 1942
nach Krasnystaw)
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Isaak Hirsch (geb. 1875
in Frankenwinheim;
umgekommen am 24. Februar 1943 im
Ghetto Theresienstadt) |
Max Friedmann (geb.
1886 in Frankenwinheim,
umgekommen nach Deportation 1942
nach Krasnystaw) |
Max Kolb
(geb. 1898 in
Frankenwinheim,
umgekommen nach Deportation 1942
nach Krasnystaw) |
| |
|
|
 |
|
Klassenfoto von
1936: jüdische SchülerInnen waren: 1. Reihe 5. von rechts mit weißem
Hemd:
Werner Gottlieb; 1. Reihe 4. von rechts: Gerhard Friedmann; 3. Reihe
2. von rechts:
Klara Niedermann. Es müssten die Jahrgänge 1923 bis 1935 abgebildet
sein. |
|
| April
2012: Werner Gottlieb wird
Ehrenbürger in Frankenwinheim |
 Aus der Website der Gemeinde Frankenwinheim www.frankenwinheim.de:
Zur Biographie von Werner Gottlieb:
Aus der Website der Gemeinde Frankenwinheim www.frankenwinheim.de:
Zur Biographie von Werner Gottlieb:
Werner Gottlieb wurde am 12. September 1925 als
Erstes von zwei Kindern in Frankenwinheim geboren. Seine Eltern Max und
Jenny Gottlieb bewohnten das ehemalige Anwesen Haus Nr. 86, heute
Schallfelder Straße 21. An seiner Stelle steht heute das Feuerwehrhaus.
Neben dem Viehhandel bewirtschaftete die Familie einen kleinen Bauernhof.
Werner und seine Schwester Vera Gottlieb besuchten wie alle Kinder in
Frankenwinheim, unabhängig von der Glaubensrichtung, die Dorfschule, in
der jetzt das Rathaus untergebracht ist. Nur während des
Religionsunterrichtes wurde die Klasse getrennt unterrichtet, es gab
katholischen und hebräischen Religionsunterricht. Die Lehrer waren damals
Emil Auer und der Rabbiner Isidor Mermelstein.
Am 27. September 1937 verließ Werner Gottlieb mit seinen Eltern und
seiner Schwester Vera Frankenwinheim und emigrierte nach New York, USA.
Sein Großvater Loeb Gottlieb (geb. 22. September 1859 in Rimbach)
starb in Frankenwinheim am 24. Dezember 1936. Seine Großmutter Sabina
geb. Schild (geb. 20. Juli 1859 in Atlanta, Georgia, USA) verblieb auf eigenen Wunsch in Frankenwinheim,
wurde am 24. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo
sie am 5. Dezember 1942 umgekommen ist. 2012 lebt Werner
Gottlieb zusammen mit seiner Frau Shirley in San Francisco. Die beiden
haben drei Kinder Leonhard, Debbie und David sowie fünf Enkel. In den letzten
25 Jahren besuchte Werner Gottlieb fünfmal Frankenwinheim, begleitet
wurde er bei seinem jetzigen Besuch von seiner Enkelin Elspeth Looks aus
Israel. |
Fotos von der Verleihung
der
Ehrenbürgerwürde am 1. April
2012 in Frankenwinheim
(Fotos: Stefan Polster) |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
90. Geburtstag von
Ehrenbürger
Werner Gottlieb im September 2015 |
 |
 |
 |
| |
Ehrenbürger Werner Gottlieb feierte bei bester Gesundheit seinen 90 Geburtstag.
Aus Frankenwinheim waren die Familien Helbig und Böhm zur Feier in San Francisco
(Fotos oben von Anton Helbig). Links Werner und seine Schwester Vera,
rechts Werner Gottlieb mit Geschenk der Gemeinde, in der Mitte Werner
Gottlieb und seine Schwester Vera mit den deutschen Besuchern. |
| |
|
Erinnerungen an die
Großeltern
von Werner Gottlieb |
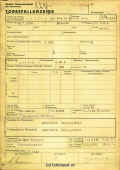 |
 |
|
| |
Anzeige des Todes von Sabine
Gottlieb
geb. Schild im Ghetto Theresienstadt (1942) |
Grab-/Gedenkstein für die
Großeltern von
Werner Gottlieb im jüdischen Friedhof
Gerolzhofen |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert erbaute Synagoge wurde 1910 umfassend
renoviert (in Klinker aufgestockt). Es handelt sich ursprünglich um einen
zweigeschossigen Walmdachbau.
Beim Novemberpogrom 1938 wurden am Morgen des 10. November alle Juden aus
Frankenwinheim und Lülsfeld in der Synagogen zusammengetrieben. Die Frauen
mussten - in Gebetmäntel und Sterbegewänder gehüllt - die Möbel und
Ritualien auf die Straße tragen und dort anzünden. Alle Gemeindemitglieder
mussten sich um die Feuerstelle aufstellen und dem Brand zusehen. Es kam zu
Verwüstungen und Gewalttaten unter Beteiligung zahlreicher Jugendlicher des
Ortes. Etwa 200 weitere Dorfbewohner sowie die Polizei sahen dem Treiben
zu.
Zu den Vorgängen beim Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim vgl. auch den Vortrag
von Stephan Oettermann in Gerolzhofen im November 2009.
1950 fanden vor dem Landgericht zwei Prozesse gegen 27 Teilnehmer am
Novemberpogrom 1938 in Frankenwinheim statt. Sechs erhielten Gefängnisstrafen
von neun Monaten bis zu einem Jahr und neun Monaten.
Das Gebäude der ehemaligen Synagoge wurde zu einem bis heute erhaltenen
Wohnhaus umgebaut.
Im November 1999 wurde von der Gemeinde Frankenwinheim ein Gedenkstein
für die ehemaligen jüdischen Frankenwinheimer vor dem Rathaus aufgestellt. Die
Gedenkrede hielt der Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Würzburg Dr.
Joseph Schuster.
Adresse/Standort der Synagoge: Judengasse 6
Fotos
(Historische Innenaufnahme oben links von Theodor
Harburger, aufgenommen am 16. September 1931; Quelle: Central Archives for the
History of the Jewish People, Jerusalem; veröffentlicht in Th.
Harburger: "Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern.
1998 Bd. 2 S. 204)
 |
 |
 |
Historische Innenaufnahme der
Synagoge
von 1929 mit dem Blick zum Toraschrein
|
Plan
von Frankenwinheim mit Eintragung
der jüdischen Wohnhäuser / Anwesen
um 1930 (Plan erhalten von Stefan Polster)
|
Der jüdische Lehrer Joseph
Kissinger
(1852-1939) und seine Frau Ida geb. Grünfeld
(1851-1929).
Quelle: Website der Family Kissinger
(Website ist seit 2009 gelöscht) |
| |
|
Das Gebäude der
ehemaligen
Synagoge |
 |
 |
 |
| |
Die ehemalige Synagoge, zu
einem Wohnhaus umgebaut,
(Fotos von Stefan Polster, links vom April 2021;
rechts in höherer Auflösung vom Juli 2014 anlässlich
des Besuches von Egon Mermelstein s.u.) |
Gedenktafel zwischen der
"Mariensäule"
und der ehemaligen Synagoge |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Der Gedenkstein für die
ermordeten Juden aus Frankenwinheim vor dem Rathaus. Der Gedenkstein wurde
zunächst im Jahr 1999 der Öffentlichkeit übergeben: Foto links:
Kranzniederlegung durch Bürgermeister Robert Finster; in der Mitte (vor
Baum) Dr. Josef Schuster, rechts von ihm Ehrengast Werner Gottlieb; die Beschriftung
des Mahnmals wurde
2021 überarbeitet, u.a. wurden noch sieben Personennamen ergänzt
(Foto von 1999 und neue Fotos (April 2021) von Stefan Polster).
|
Das Gebäude des 1987
abgebrochenen
rituellen
Bades (Mikwe, Aufnahme von
1982; Quelle: www.frankenwinheim.de)
|
| |
|
|
Erinnerung
an einem früheren
jüdischen Haus in Frankenwinheim
(Nebengebäude zum nicht mehr bestehenden
Haus Nr. 69, heute im Bereich des
Anwesens Kornbrunnen 9;
Fotos: Stefan Polster) ) |
 |
 |
 |
| |
Spur
einer Mesusa am Hauseingang |
Reste
eines Mesusa an einem Türpfosten |
| |
|
|
| |
|
|
|
Verlegung
von "Stolpersteinen" am 12. September 2013 in
Frankenwinheim
(Fotos: Stefan Polster, weitere
Fotos bei frankenwinheim.de)
|
|
 |
 |
 |
| Gunther Demnig bei
der Verlegung |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
"Stolpersteine"
für Angehörige
der Familie Gottlieb |
"Stolpersteine"
für Angehörige
der Familie Friedmann |
|
| |
|
|
|
Verlegung
von weiteren sechs "Stolpersteinen" am 27. Mai 2014 in
Frankenwinheim
(Fotos: Stefan Polster, auch eingestellt bei www.frankenwinheim.de)
|
Der
Pressebericht unten in der "Main-Post"
vom 30. Mai 2014 |
Pressebericht
von Stefan Polster: "Zweite Verlegung von Stolpersteinen. Landrat Töpper würdigt Erinnerungsarbeit in Frankenwinheim
Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur zweiten Stolpersteinverlegung in Frankenwinheim zwei neunte Klassen vom Gymnasium in Gerolzhofen, viele Dorfbewohner, Gäste und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen.
Die Schüler waren am Morgen von Gerolzhofen nach Frankenwinheim gelaufen um im Rahmen des Geschichtsunterrichtes bei der Verlegung dabei zu sein. Landrat Florian Töpper freute sich, dass in seinem Landkreis und besonders in Frankenwinheim aktiv Erinnerungsarbeit geleistet wird. Die Anwesenheit der Schüler bei dieser Aktion lobte er besonders schließlich müsse eine Geschichtsexkursion nicht immer zu weit entfernten Zielen führen.
Möglich wurde die Stolpersteinverlegung für die Familie Kolb durch die Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen Hausbesitzerin Anna Kratschmer. Zwei Paten und zwei Schüler trugen die Lebensläufe der jüdischen Familie Kolb vor. Sie wurden allesamt in Konzentrationslagern ermordet. Gemeinderätin Bettina Roth las auch vor, wie eine Deportation damals durchgeführt wurde. Das Ganze wurde von der Gestapo Evakuierung genannt und von den Vorschriften zum Kofferpacken über Vermögensaufstellungen bis hin zu Anweisungen wie das Haus zu hinterlassen ist, löste die detaillierte Schilderung Betroffenheit aus. Die Familie Kolb wurde nur zwei Tage vor der Abholung informiert. Hunde, Katzen und andere Haustiere durften natürlich nicht mitgenommen werden, gutes Schuhwerk wurde empfohlen und sogar für einen Vorrat an Verpflegung gab es
Vorschriften.
Betroffen lauschten die Frankenwinheimer am Dienstag solch entwürdigenden Details. Die Familie Kolb wurde nur zwei Tage vor ihrer Abholung informiert. Das Ganze gipfelte darin, dass man die Evakuierungsnummer an Kleidung und Gepäck anbringen musste:
'So wurden diese Menschen zu Nummern', resümierte Roth, 'mit den Stolpersteinen bringt man ihre Namen wieder dahin zurück, wo die Menschen mitten unter uns gelebt
hatten.'" |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Gunter
Demnig in Frankenwinheim |
Die zu
verlegenden "Stolpersteine" |
Interessierte
Zuschauer in der Rosenbergstraße |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
Gunter
Demnig bei der Verlegung |
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Landrat Florian
Töpper |
|
|
|
Schüler
tragen die Lebensläufe vor |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
|
Die
für die Familie Kolb verlegten "Stolpersteine" |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Dritte
Verlegung von Stolpersteinen im Mai 2015 |
|
Bericht
von Stefan Polster: "Dritte Verlegung von Stolpersteinen. Bürgermeister Herbert Fröhlich würdigt Gedenkarbeit im Ort
Frankenwinheim (stop). Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur dritten Stolpersteinverlegung in Frankenwinheim viele Dorfbewohner, Gäste, Politiker aus der näheren Umgebung und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen.
Möglich wurde die Stolpersteinverlegung für die Familie Niedermann und Hirsch durch die Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen Hausbesitzer Familie Kaim sowie Familie Kunzmann.
In Frankenwinheim liegen nun an 5 Stellen insgesamt 23 Stolpersteine für ehemalige Dorfbewohner. Neben den Stolpersteinen haben die Gemeinde sowie Privatpersonen Gedenktafeln und Stelen errichtet, um Zeichen zu setzen und um an die ausgeprägte jüdische Vergangenheit zu erinnern.
Durch das Verlegen der Stolpersteine wird der Lebenslauf der einzelnen Personen nochmals aktiv ins allgemeine Gedächtnis gebracht.
Die Familie Niedermann betrieb in Frankenwinheim eine jüdische Metzgerei und vertrieb das Fleisch auch in der näheren Umgebung. Bereits 1937 flüchteten sie über Frankreich in die USA. Sie konnten ihr Anwesen noch rechtzeitig verkaufen und einen anständigen Preis erzielen, welches auch durch Dokumente belegt ist. Der Käufer musste nach dem Krieg das Anwesen nicht ein zweites Mal ablösen, da die Familie Niedermann den ordnungsgemäßen Verkauf nachträglich nochmals bestätigte. Jedoch mussten sie weitestgehend ihr bewegliches Hab und Gut zurücklassen. Auch der Neuanfang in einem neuen Land mit neuer Sprache fiel schwer, besonders der Verlust von Angehörigen und Freunden.
Bei der Familie Hirsch konnte die Tochter Liesel Hirsch ebenfalls 1937 in die USA auswandern jedoch blieben die Eltern Hilda und Isaak Hirsch in Frankenwinheim zurück. Die Mutter Hilda verstarb 1940 in Würzburg und der Vater Isaak wurde Ende 1942 nach Theresienstadt deportiert und verstarb dort ein halbes Jahr später. In einem Brief aus dem Jahr 1946 an den ehemaligen Nachbarn in Frankenwinheim schildert Liesel Hirsch den schwierigen Neubeginn in den USA und den schmerzlichen Verlust der Eltern wie auch weiterer Verwandter.
Die Vita der beiden Familien Niedermann und Hirsch trug Linda Meier vor. Für die passende besinnliche Musikbegleitung sorgten Kristin und Linda Meier mit Querflöte und Gitarre.
Am 1. August werden weitere 5 Steine für die Familien Guggenheim und Kissinger verlegt. Hierzu werden die Familien von Armin und Helmut Guggenheim aus den USA mit Familien erwartet. Die Verlegung beginnt um 10 Uhr in der Schallfelder Straße 11, gegenüber der Mariensäule.
Wer gerne die Patenschaft für Stolpersteine übernehmen möchte kann dies gerne tun. Es wurde hierfür ein Konto bei der Raiffeisenbank Frankenwinheim eingerichtet: IBAN: DE44 7936 4069 0200 0220 39,
BIC: GENODEF1FWH." |
| Presseartikel
von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 2. Juni 2015: "Vertrieben
und ermordet. Dritte Verlegung von Stolpersteinen in Frankenwinheim"
(eingestellt als pdf-Datei) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Verlegung
vor zahlreichen Interessierten |
Gunter Demnig |
Stolpersteine für
Familie Hirsch |
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Vier
Stolpersteine für Familie Niedermann |
Gunter Demnig |
Musikalische
Umrahmung |
| |
|
|
|
|
|
|
Vierte Verlegung von Stolpersteinen im
August 2015
Dazu Bericht von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 23.
Juli 2015: "Als Kinder in die Schweiz geschickt. Armin und Howard
Guggenheim bei Stolperstein-Verlegung für Mitglieder ihrer Familie
dabei" (Link
zum Artikel, als pdf-Datei eingestellt bzw. direkter
Link zur "Main-Post")
Weiterer Bericht von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 7.
August 2015: "Heimatdorf und Heimatland. Stolperstein-Verlegung in
Frankenwinheim" (Link
zum Artikel, als pdf-Datei eingestellt, bzw.
direkter Link zur Website der "Main-Post")
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Die
Stolpersteine vor der Verlegung |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Die
durch einen Gemeindearbeiter verlegten Stolpersteine erinnern an
Norbert, Fanny, Armin und Helmut Guggenheim sowie den Bruder von Fanny,
Maier Kissinger |
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Verlesung
der Viten der fünf Familienmitglieder |
Musikalische
Begleitung |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Besuch
im Rathaus und
auf dem jüdischen Friedhof in Gerolzhofen |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
Auf dem
jüdischen Friedhof in Gerolzhofen |
| |
|
|
|
|
|
|
Fünfte Verlegung von
"Stolpersteinen" am 5. Mai 2017
Weitere Informationen über die Verlegung von insgesamt neun weiteren
"Stolpersteinen" in Frankenwinheim siehe unten die
Presseberichte von Stefan Polster in der "Main-Post".
Seit dieser fünften Verlegung liegen insgesamt 37
"Stolpersteine" in Frankenwinheim. Alle Fotos von Stefan
Polster. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Artikel in der
"Main-Post"
vom 26. April 2017 |
Artikel in der
"Main-Post"
vom 10. Mai 2017 |
"Stolpersteine"
für Hannchen Durmann und ihre Tochter
Bianka Friess, verlegt in der Julius-Echter-Straße 3 |
"Stolpersteine"
für Liebmann Wolf, Isbert Wolf
und Selma Wolf, verlegt in der Schallfelder Straße |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Bettina Roth
verliest
die Vita für die Familie Wolf |
|
Elisabeth Böhrer
verliest die Vita von
Hannchen Durmann und Bianka Friess |
Stolpersteine
für Hannchen Durmann und Bianka Friess, ermordet
in der Tötungsanstalt Bernburg bzw. im KZ Ravensbrück |
| |
|
|
|
|
|
 |

 |
 |
 |
 |
 |
Zeitzeugin
Anna Kratschmer berichtet
über ihre ehemaligen Nachbarinnen
H. Durmann und B. Friess |
Bei
der Verlegung der Stolpersteine für die Familie Friedmann-Selig
|
Musikalische
Umrahmung
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Stolpersteine
für Max Friedmann, Sara Friedmann,
Julius Selig und Irma Selig geb. Friedmann |
|
Andrea
Darandick-Jörg verliest die
Vita der Familie Friedmann Selig |
|
Sechste
Verlegung: "Stolperstein" für Lehrer Josef Kissinger
Anmerkung: Ein 38. Stolperstein in Frankenwinheim wurde für den Lehrer
Josef Kissinger verlegt. Der 86-jährige, gesundheitlich angeschlagene
Josef Kissinger war mit seinem Sohn und anderen jüdischen Einwohnern
gezwungen worden, in einen Brunnen zu steigen, um diesen auszupumpen.
Sohn Maier nahm sich am 15. Dezember 1938 das Leben, Vater Josef Kissinger
verstarb am 14. Januar 1939. Zur Verlegung war der Enkel Armin Guggenheim
und seine Frau Charlotte anwesend. Alle Fotos und der Pressebericht vom 3.
November 2017 von Stefan Polster. |
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
Lehrer Josef
Kissinger
(1852-1939) |
Bericht von Stefan
Polster
in der "Main-Post" vom 3.11.2017 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Bei der Verlegung des
Stolpersteines
für Josef Kissinger
|
Armin Guggenheim mit
Schulkameradin Anna Kratschmer
|
Stolperstein für Josef
Kissinger
(1852-1939)
|
Am Grab von Josef
Kissinger
und Sohn Maier Kissinger
im Friedhof Gerolzhofen |
Erläuterungen von
Evamaria Bräuer
|
Am Grab von Ida
Kissinger
geb. Grünfeld (1851-1929)
|
| |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| April 2012:
Auch in Frankenwinheim sollen
"Stolpersteine" verlegt werden |
Artikel in der "Main-Post" vom 25.
April 2012: "Frankenwinheim. Stolpersteine erinnern an NS-Opfer.
Rat stimmt Projekt zu..."
Link
zum Artikel |
| |
| April 2012:
Artikel in einer israelischen Zeitung zum
Holocaust-Gedenktag |
Artikel von Elka Looks in haaretz.com vom
19. April 2012: "An ode to Frankenwinheim on Holocaust memorial
Day. On the dav we grapple with a tragedy that today seems
unfathomable; we have repented, we have learned, we have said 'never again',
but the pople of Frankenwinheim have repaired..."
Link
zum Artikel |
| |
| September 2013:
In Frankenwinheim werden elf
"Stolpersteine" verlegt |
Artikel in der "Main-Post" vom 10.
September 2013: "FRANKENWINHEIM - Stolpersteine gegen das Vergessen
- Verlegung in Frankenwinheim
Der Aktionskünstler Gunter Demnig wird am Donnerstag, 12. September, in Frankenwinheim an zwei Stellen Stolpersteine verlegen. Die Gemeinde bekennt sich mit dieser Aktion zu ihrer jüdischen Vergangenheit. Sie hat bereits mehrmals Rückgrat bewiesen, zuletzt mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Werner Gottlieb, der 1937 mit seinen Eltern und seiner Schwester in die USA flüchten konnte...
Elf Steine für Frankenwinheim... In Frankenwinheim sollen am Donnerstag insgesamt elf Steine für die Familien Friedmann und Gottlieb verlegt werden. Die Verlegung erfolgt auf öffentlichem Grund und wurde vom Gemeinderat genehmigt. Zu der Aktion sind alle Bürger eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Rathaus."
Link
zum Artikel |
| Fotos
von der Verlegung der "Stolpersteine" in der Website der
Gemeinde Frankenwinheim. |
| |
| November 2013:
Erinnerung an die Pogromnacht
1938 |
| Link
zu einer Fotoseite bei frankenwinheim.de |
| |
Mai 2014:
Ortsrundgang: "von der Wiege bis zur Bahre -
Jüdische Bürger in Frankenwinheim"
vgl. Fotos dieses Rundganges: Link
zu einer Fotoseite bei frankenwinheim.de |
Bericht über den Ortsrundgang von Stefan
Polster: "Die Rituale der jüdischen Bevölkerung
Über 50 interessierte Teilnehmer konnten Claudia Göllner, Evamaria Bräuer und Stefan Polster anlässlich der Ausstellung Landjudentum in Unterfranken beim Dorfrundgang in Frankenwinheim begrüßen. An fünf ehemaligen jüdischen Anwesen spürte man dem Brauchtum und den Ritualen der jüdischen Bevölkerung nach, ließ dabei Zeitzeugen zu Wort kommen und stellte die letzten jüdischen Bewohner in dem jeweiligen Haus aus der Zeit um 1930 vor.
Frankenwinheim war eine Gemeinde mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil. 1870 waren von 546 Dorfbewohnern 100 mit jüdischem Glauben somit 18 Prozent. In den Folgejahren ging die Anzahl zurück. Im Jahr 1910 lebten noch 58 Juden in Frankenwinheim bei insgesamt 588 Bewohnern. An jüdischen Einrichtungen gab es die Synagoge mit Mikwe und als reinen jüdischen Verein den Toralernverein
'Limud Tora'.
Es wurden die ehemaligen Anwesen der Familien Kolb, Friedmann, Hirsch und Niedermann sowie die Synagoge besucht. Dabei behandelte man Feste wie das Purim, dies erinnert an die Errettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora. Kinder verkleiden sich hierbei ähnlich unserem Karneval. Anschaulich wurde eine Messusa erläutert, die Schriftkapsel die im rechten Türpfosten am Hauseingang angebracht war, teilweise auch an weiteren Türpfosten im Haus. In der Schriftkapsel befindet sich ein Stück Pergament, auf dem zwei Abschnitte aus dem 5. Buch Moses geschrieben sind, das ist der sogenannte Haussegen.
Man beschäftigte sich mit der Bar-Mizwa beziehungsweise Bat-Mizwa, damit wird die Religionsmündigkeit bezeichnet, die bei Jungen mit 13 Jahren und bei Mädchen mit zwölf Jahren gefeiert wird. Vor allem für die junge Generation waren auch Berufe wie Ellenwarenhändler oder die Tätigkeit eines Schmusers interessant. Der Schmuser konnte von seinem Beruf nicht alleine leben, in der Regel waren das Hausierer, die viel in der Gegend herum kamen. Dadurch wussten sie, wo ein heiratsfähiger Mann oder ein hübsches Mädchen wohnten, und brachten diese zusammen.
Am ehemaligen Haus des Metzgers Niedermann erklärte Evamaria Bräuer das Schächten der Tiere und andere Ernährungsvorschriften der Juden. Aber nicht nur die Nahrung, auch die Kleidung frommer Juden soll koscher sein, das heißt, sie darf nur aus einem Material, zum Beispiel nur aus Baumwolle, bestehen und keine künstlichen Fasern und Farben aufweisen.
An der Synagoge ging man näher auf den Rabbiner Josef Kissinger ein, übrigens ein Onkel des späteren amerikanischen Außenministers Henry Kissinger. Josef Kissinger war über 50 Jahre Rabbiner, Schächter und Vorbeter in Frankenwinheim. Dabei würdigte nicht nur die jüdische Bevölkerung sein Wirken, sondern die gesamte Dorfgemeinschaft nahm am Fest zu seinem Jubiläum teil. Ein gelebtes
'Mitten unter uns', dies zeigt sich auch dadurch, dass Josef Kissinger 48 Jahre als Schriftführer in der Freiwilligen Feuerwehr Frankenwinheim tätig war. Aus einer Dankesrede für Josef Kissinger ist der schöne Satz überliefert:
'Möge aber auch in seinen Gemeinden (er war zuständig auch für die Filialen Brünnau und Lülsfeld) der gute Wille und die billige Einsicht Platz greifen, ihrem verdienstvollen, langjährigen Religionsführer durch Verabreichung eines zeitgemäßen Gehaltes einen sonnigen, sorglosen Lebensabend zu
bereiten.'
Natürlich durften Erläuterungen zur Mikwe, dem Tauchbad, nicht fehlen. Diese konnte nur noch auf einem Bilddokument bewundert werden..." |
| |
| August 2014:
Egon Mermelstein auf den Spuren seiner Kindheit |
Artikel von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 8.
August 2014: "FRANKENWINHEIM. Überraschender Besuch aus USA
Egon Mermelstein auf der Spur seiner Kindheit.
Für einige Stunden weilte ein ehemaliger jüdischer Bewohner in Frankenwinheim. Egon Mermelstein wurde 1934 in Schweinfurt geboren. Seine Eltern Isidor und Ida Mermelstein wohnten von 1932 bis 1937 in
Frankenwinheim..."
Link
zum Artikel |
| |
 |
 |
77 Jahre, nachdem seine
Familie Frankenwinheim verlassen hatte, besuchte
Egon Mermelstein seine historischen Wurzeln. Im Synagogengebäude
wohnte Familie Mermelstein von 1932 bis 1937. Im Bild Martha Sendner,
Egon Mermelstein, Anna Kratschmer, Mathias und Annette Spies |
Egon Mermelstein besuchte
Frankenwinheim. Er lebte bis 1937
mit seinem Zwillingsbruder und den Eltern in der Synagoge,
bevor die Familie 1938 in die USA emigrierte.
(beide Fotos von Stefan Polster) |
| |
|
Juni 2015:
Dritte Verlegung von
"Stolpersteinen" in Frankenwinheim |
Artikel von Stefan Polster in
der "Main-Post" vom 1. Juni 2015: "Vertrieben und ermordet.
In dem früher auch durch Juden geprägten Dorf erinnern nun schon 23
Stolpersteine an vertriebene und ermordete Mitbürger. Im August sollen fünf
weitere verlegt werden.
Bürgermeister Herbert Fröhlich konnte zur dritten Stolpersteinverlegung in
Frankenwinheim viele Dorfbewohner, Gäste, Politiker aus der näheren Umgebung
und den Aktionskünstler Gunter Demnig begrüßen. Möglich wurde die
Stolpersteinverlegung für die Familie Niedermann und Hirsch durch die
Spende der Stolpersteinpaten und durch die Bereitschaft der heutigen
Hausbesitzer, der Familien Kaim und Kunzmann. In Frankenwinheim liegen nun
an fünf Stellen insgesamt 23 Stolpersteine, die an ehemalige Dorfbewohner
erinnern. Neben den Stolpersteinen haben die Gemeinde sowie Privatpersonen
Gedenktafeln und Stelen errichtet, um Zeichen zu setzen und um an die auch
jüdisch geprägte Vergangenheit des Ortes zu erinnern. Durch das Verlegen der
Stolpersteine wird der Lebenslauf der einzelnen Personen nochmals aktiv ins
allgemeine Gedächtnis gebracht. Die Familie Niedermann betrieb in
Frankenwinheim eine jüdische Metzgerei und vertrieb das Fleisch auch in der
näheren Umgebung. Bereits 1937 flüchteten sie über Frankreich in die USA.
Die Familie konnte ihr Anwesen noch rechtzeitig verkaufen und dabei einen
fairen Preis erzielen, wie Dokumente belegen. Spätestens ab 1939 wurden
Deutsche jüdischen Glaubens gezwungen, ihren Besitz weit unter Wert zu
veräußern. In diesem Fall musste der Käufer nach dem Krieg das Anwesen nicht
ein zweites Mal ablösen, da die Familie Niedermann den ordnungsgemäßen
Verkauf nachträglich nochmals bestätigte. Jedoch hatte sie ihr bewegliches
Hab und Gut weitgehend zurücklassen müssen. Der Neuanfang in einem neuen
Land mit neuer Sprache fiel schwer, besonders wegen des Verlusts von
Angehörigen und Freunden. Bei der Familie Hirsch konnte die Tochter
Liesel Hirsch ebenfalls 1937 in die USA auswandern, jedoch blieben die
Eltern Hilda und Isaak Hirsch in Frankenwinheim zurück. Hilda Hirsch
verstarb 1940 in Würzburg, Isaak Hirsch wurde Ende 1942 nach Theresienstadt
deportiert und wurde dort ein halbes Jahr später ermordet. In einem Brief
aus dem Jahr 1946 an den ehemaligen Nachbarn in Frankenwinheim schildert
Liesel Hirsch den schwierigen Neubeginn in den USA und den schmerzlichen
Verlust der Eltern wie auch weiterer Verwandter. Die Vita der beiden
Familien Niedermann und Hirsch stellte Linda Meier vor. Für die passende
besinnliche Musikbegleitung sorgten Kristin und Linda Maier mit Querflöte
und Gitarre. Am 1. August werden fünf weitere Stolpersteine für die
Familien Guggenheim und Kissinger verlegt. Hierzu werden die Familien
von Armin und Helmut Guggenheim aus den USA mit Familien erwartet. Die
Verlegung beginnt um 10 Uhr in der Schallfelder Straße 11, gegenüber der
Mariensäule. Für Patenschaften für Stolpersteine in Frankenwinheim wurde ein
Konto bei der Raiffeisenbank Frankenwinheim eingerichtet: Iban: DE44 7936
4069 0200 0220 39, Bic: ENODEF1FWH."
Link zum Artikel |
| |
| Dezember
2015: Auf den Spuren von
Frankenwinheimer Juden |
Artikel in der
"Main-Post" vom 11. Dezember 2015:
"Karbach/Frankenwinheim. Auf den Spuren von jüdischen
Frankenwinheimern..."
Link
zum Artikel |
| |
| Beiträge im
Bayerischen Rundfunk (B2) |
Beitrag von Renate Eichmeier vom
8. Dezember 2015 über den Besuch von Armin und Helmut bzw. Howard
Guggenheim im Juli 2015: "Besuch aus Amerika. Auf den Spuren des
fränkischen Landjudentums..."
http://www.br.de/radio/bayern2/bayern/zeit-fuer-bayern/frankenwinheim-juden-franken-familie-guggenheim-100.html |
| Sendung in B2 am Samstag, 26.
Dezember 2015: http://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-537442.html |
| |
Dezember
2016: Über die Frankenwinheimer
Stolpersteine für Angehörige der Familie Guggenheim - Artikel in einer
jüdischen Zeitung in Cleveland
- Courtesy of the Cleveland
Jewish News - wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung der Cleveland
Jewish News vom 30.12.2016 - |
Artikel von Carlo Wolff in
"Cleveland Jewish News" vom 13. Dezember 2016: "Stumbling stones: Markers in Germany hold special meaning for Beachwood resident.
If the door to the synagogue in the tiny German village where his grandfather once was a rabbi hadn’t been so sturdy, Armin Guggenheim might have lost his life.
Guggenheim was 8 and scared to death. He and his little brother, Howard, were hiding in the
Frankenwinheim synagogue the night of Nov. 9, 1938. It was the start of Kristallnacht, two days of Nazi thuggery signaling Adolf Hitler’s attempt to not only put Jews in their place but to exterminate them.
When it unfolded, 'the events were just so frozen,”' Guggenheim said in an interview at his Beachwood
home. 'We were so helpless in not being able to fight back.'
Was he frightened? 'Are you kidding?”' he said. 'It was total fear of what transpired. They tried to ram down the front door of the synagogue. My brother and I were sleeping on the second floor, not knowing what happened. But they were not successful at getting in. It was a very thick, heavy door. If they had gotten in, I would probably not be here today.”'
That old synagogue has been converted to an apartment building, but the Guggenheim clan has a home in Germany again, if only a symbolic
one. Guggenheim was born in Wurzburg, some 50 miles east of Frankfurt, in 1930 and lived in his native Germany until three months after Kristallnacht, when his parents sent him and his brother to Switzerland. His parents applied for immigration in 1935 and were finally able to leave Europe in 1939, the family reuniting in Italy before boarding a ship to the United States that November.
His parents were very Orthodox, as was he, 'until I was 13,' Guggenheim said
wryly. 'During the war years, my mother tried to contact her sisters and was totally unsuccessful. Then after the war, she found out they all were victims of the gas chambers.”' His father’s sister was rounded up in 1942 and never heard from
again.
In 2015, Armin and Howard Guggenheim and their families visited Frankenwinheim, the town in Bavaria the brothers left in 1939, to partake in a ceremony that has graced thousands of residences – or sites where residences used to be – the Nazis appropriated from German
Jews. That Aug. 1, the extended Guggenheim family witnessed the laying of a cobblestone-size, brass-clad brick
'stolperstein,' or stumbling stone, by Guenther Demnig, the man who launched the program some 20 years ago. According to the website, stolpersteine.eu, Demnig is an industrial designer and artist who put together the program in 1993, installing the first stumbling stone in 1997.
Guggenheim and his wife, Charlotte, who attend Park Synagogue in Cleveland Heights and Pepper Pike, participated in two ceremonies. The first was in Frankenwinheim, where they commemorated his family by laying a stumbling stone in the village’s main square (the family home had been torn down). The second, this Sept. 5, commemorated his two aunts, an uncle and first cousin with a stumbling stone laid in the sidewalk in front of their apartment in Mainz.
The stumbling stone program has mushroomed. 'Today, throughout Germany and eight other countries, there are 60,000 stumbling stones commemorating Jewish families that ended up being in concentration camps or who were able to get out of
Europe,' Guggenheim said. 'People in their 50s are trying to find what happened to these families.”'
Not only do these special 'stones' stand out in their color, they’re slightly raised, forcing those who encounter them to ponder what they memorialize. Markers of a vanished culture, they aim to honor, and perpetuate the memory of, those who perished in the Holocaust.
Stefan Polster, a Catholic in his 50s, contacted Armin and Charlotte Guggenheim in 2014, asking whether the Guggenheim family would like to participate in a ceremony marking their former family home. Polster, who lives in Frankenwinheim, had learned of the Guggenheims from another former village resident.
So Armin called his brother, who is two years younger and lives in Boca Raton, Fla., and they decided participation would make for a singular and profound history lesson.
The two thought this could be a unique family affair, underlining how important it was
'for our children and our grandchildren to understand our history and what happened to the German Jewish communities.”'
Charlotte Guggenheim, too, attests to the significance of the stolpersteine. But she is more ambivalent than her
husband.
'I felt that my mother-in-law was with us in this whole process, but I’m not sure she would have approved,”' she
said. 'She lost all her family, and I don’t think she would ever have wanted to step back into that country. But I felt her presence.”'
Armin Guggenheim, meanwhile, is a changed man. And while the dominant feeling these stumbling stones evoke is one of loss, for him they represent a freeing, a coming to
terms.
'I’ve become much more open about my history,”' he said. The stumbling stones are an acknowledgment of
'Germany’s and other European losses of the tremendous Jewish culture,”' he said, adding that they also generate a
'feeling of coming to grips with what these European countries lost.'
"
Link
zum Artikel |
| |
|
April 2017:
Weitere Verlegung von
"Stolpersteinen" in Frankenwinheim |
Artikel von Stefan Polster in
der "Main-Post" vom 25. April 2017: "FRANKENWINHEIM. Stolpersteine zum
Gedenken.
Stolpersteine sind bekannt aus großen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder
auch in unserer Gegend aus Bamberg oder Würzburg, wo sie an die Opfer des
Nationalsozialismus erinnern. Doch gerade in Franken lebten viele Juden auch
auf dem Land, man spricht hier vom fränkischen Landjudentum. So kam es, dass
auch in Frankenwinheim zeitweise zehn bis 18 Prozent der Dorfbevölkerung
jüdischen Glaubens war, noch im Jahr 1935 lebten 54 Juden im Ort.
36 Menschen ermordet. Dem entsprechend hoch ist auch die Zahl der
Opfer des Nationalsozialismus, 38 Frankenwinheimer wurden in
Konzentrationslagern ermordet, viele weitere mussten unfreiwillig ihre
Heimat verlassen. Aber auch das Gedenken wird in diesem kleinen Ort seit
vielen Jahren großgeschrieben. Gedenksteine vor dem Rathaus tragen die
Familiennamen der in Konzentrationslagern ermordeten Frankenwinheimer Juden.
28 Stolpersteine liegen inzwischen in den Gehsteigen vor den letzten
Wohnhäusern. Am Freitag, 5. Mai, kommen weitere neun Steine für die Familien
Wolf, Durmann-Frieß und Friedmann-Selig dazu.
Gunter Demnig kommt in den Ort. Der Künstler Gunter Demnig erläutert
seine Kunstaktion wie folgt: 'Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name
vergessen ist, so hieß es im Talmud. Mit den Steinen vor den Häusern wird
die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten. Auf den
Steinen steht geschrieben: HIER WOHNTE... Ein Stein. Ein Name. Ein Mensch.'
Gedacht wird mit diesen kleinen Kunstwerken aller verfolgten oder ermordeten
Opfer des Nationalsozialismus: Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgter,
religiös Verfolgter, Zeugen Jehovas, Homosexueller, geistig und/oder
körperlich behinderter Menschen, Zwangsarbeiter und Deserteure; letztlich
aller Menschen, die unter diesem Regime leiden mussten.
Patenschaften möglich. Patenschaften helfen diese kleinen Denkmale zu
finanzieren, wer die Verlegung finanziell unterstützen möchte, kann einen
Beitrag auf das Konto 'Stolpersteine Frankenwinheim' IBAN: DE44 7936 4069
0200 0220 39 bei der Raiffeisenbank Frankenwinheim überweisen. Ein Stein
kostet 120 Euro, auch über Teilbeträge freuen sich die Initiatoren.
Zu dieser Aktion sind alle Bürger und Interessierten eingeladen. Treffpunkt
ist am 5. Mai um 13 Uhr in der Schallfelder Straße vor dem Feuerwehrhaus."
Link zum Artikel https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Stolpersteine-zum-Gedenken;art769,9574490
|
| |
|
Oktober 2020:
Einweihung der Gedenkstätte für
die Deportation der Juden aus Frankenwinheim
|
 Artikel
von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 21. Oktober 2020: "Ein
Schulranzen als bleibende Erinnerung. Auch Frankenwinheim beteiligt sich
am Projekt 'Denkort Deportationen', das mit künstlerisch gestalteten
Gepäckstücken an den Weg der Juden in die Vernichtungslager erinnert..." Artikel
von Stefan Polster in der "Main-Post" vom 21. Oktober 2020: "Ein
Schulranzen als bleibende Erinnerung. Auch Frankenwinheim beteiligt sich
am Projekt 'Denkort Deportationen', das mit künstlerisch gestalteten
Gepäckstücken an den Weg der Juden in die Vernichtungslager erinnert..."
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildung anklicken
Link zur Website:
https://denkort-deportationen.de/ |
| Fotos (erhalten von Stefan
Polster): |
 |
 |
 |
 |
Übergabe der
Gedenkstätte mit
Bürgermeister Herbert Fröhlich (links) |
Pater Meinrad Dufner beim
Modellieren der Skulptur |
Die
Frankenwinheimer Projektgruppe steuerte die
Büchertasche mit Teddy und Schiefertafel bei |
| |
September 2021:
Frankenwinheimer Gepäckstück beim
"Denkort Deportationen" in Würzburg
Am 24. September 2021 wurden in Würzburg 32 weitere Gepäckstücke feierlich
übergeben, darunter eines aus Frankenwinheim; weiterer Informationen siehe
https://denkort-deportationen.de/ |
| Fotos (erhalten von Stefan
Polster): |
 |
 |
 |
|
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 291-293. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 52-53. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 537-539.
|
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 131.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Frankenwinheim Lower
Franconia. Jews are known from the second half of the 18th century and numbered
100 in 1837 (total 546) with a synagogue and public school. In 1933, 54 Jews
remained. Anti-Jewish riots broke out in October 1938 in a well-poisoning libel
and on Kristallnacht (9-10 November 1938). Jewish women were forced to
burn the religious articles taken out of the synagogue. Jewish homes were also
destroyed and valuables stolen. Five men were imprisoned in the Buchenwald
concentration camp. Twenty-two Jews emigrated in 1938-41 and 20 left for other
German cities in 1935-1940. Of the remaining Jews, 13 were deported to Izbica in
the Lublin district (Poland) via Wuerzburg on 24 April 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|