|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Hörstein (Stadt Alzenau, Landkreis
Aschaffenburg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Hörstein bestand eine jüdische Gemeinde bis 1940.
Ihre Entstehung geht in die Zeit Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Doch
gab es bereits im 17. Jahrhundert Juden am Ort: So wird 1657 ein Jude namens
"Zehlarl zu Hörstein" genannt (Quelle: Fürst Ysenburg Büdingen Archiv Fasz.
19, Kellerei-Rechnung Meerholz 1657; Hinweis von Hans Kreutzer). 1680
werden drei jüdische Familien genannt, 1685 nennt ein Verzeichnis der
"Schutzjuden" am Ort Izig, Coppell, Ließmann, Seligman, Löw und Mortge.
1707 gab es unter den damals 156 Hörsteiner Familien 13 jüdische
Familien.
1789 waren es 17 "Schutzjuden" (großenteils mit Ihren Familien)
in Hörstein, 1794 21.
Im
19./20. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1867 116 jüdische Einwohner (10,6 % von insgesamt 1.098 Einwohnern), 1880
Höchstzahl von 137 (11,9 % von insgesamt 1.154), 1896 132 (in 24 Familien), 1900 128 (10,7 % von 1.191),
1910 125 (8,5 % von 1.467).
Die Mehrheit der jüdischen Einwohner lebte vom Handel (insbesondere Viehhandel)
und von der Brotbäckerei. Einige Familien hatten Landwirtschaft im Nebenerwerb.
Im Zusammenhang mit der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden auf 35
Matrikelstellen folgende jüdische Familienvorstände genannt (mit neuem
Familiennamen und Erwerbszweig): Michael Geradwohl (Kramhandel und dergleichen),
Jacob Geradwohl (Lumpen- und Landesproduktenhandel), Herz Geradwohl (Ellenhandel
und dergleichen; Matrikelstelle geht 1825 an Raphael Bär Weil), Löb (Koppel)
Rothschild alt (Viehhandel), Raphael Appel (Viehhandel und Krämerei), Löb
(Samuel) Rothschild jung (Viehhandel), Morche Joseph Löwenthal (Kram- und
Viehhandel), Kusel (Samuel) Rothschild (Viehhandel), Daniel (Samuel) Rothschild
(Viehhandel), Simon Reis (Krämerei), Löser Weiler (Krämerei), Süsel (Koppel)
Rothschild (Viehhandel), Moses Hamburger (Viehschlachten), Löser Reis
(Viehhandel), Herz Reis (Viehhandel), Seligmann Straus (Viehhandel), Witwe von
Löser Westheimer Emmerich (Handarbeit, Taglohn, lebt von Unterstützung), Simon
Tugut (Mäkler), Koppel Haas (allerlei Handel), Affrom (Abraham) Neu
(Viehschlachten, ab 1820 auf dieser Stelle sein Sohn Simon Neu, Metzer), Jessel
Lang (Mäkler), Maier Grünebaum (Lehrer, Vorsänger und Handel), Löw Grünebaum
(Lichter und Seifenfabrikation, ab 1824), Raphael Löw Weil (Handel mit Gewürz,
Ellen- und Eisenwaren, ab 1825), Löb Löwenthal (Weber, Leinen und
Baumwollweberei, ab 1825).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule
(Religionsschule, ab 1900 Elementarschule, ab 1910 Volksschule; um 1896 34
Kinder, 1897 30 Kinder, 1899 24 Kinder; ab 1931 noch jüdische Privatvolksschule), ein rituelles
Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. 48 Jahre
lang war bis 1894 Isaak Wahler Lehrer in Hörstein (gestorben 1912 im
Alter von 98 Jahren); sein Nachfolger im Amt war von 1894 bis 1931 sein Sohn Israel Wahler
(Verfasser von "Schulgeschichtlichen Aufzeichnungen 1913-1931").
1872/85 wird ein Lehrer M. Grünbaum (bzw. Grünebaum) in Hörstein genannt,
möglicherweise zur Unterstützung von Lehrer Isaak Wahler am Ort. Die
Gemeinde war orthodox geprägt und gehörte zum Bezirksrabbinat Aschaffenburg. Gemeindevorsteher
waren um 1876 Herr Löwenthal, um 1896 K. Rothschild, 1897 J. Rothschild, D.
Emerich und D. Rothschild, um 1899 J. Rothschild.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde der Gefreite Meier Rothschild
(geb. 9.8.1889 in Hörstein, gef. 2.10.1914), Jakob Steinhäuser (geb. 29.8.1882
in Oberlauringen, gef. 5.9.1916), Emil Strauß (geb. 17.6.1893 in Hörstein,
gef. 22.8.1914) und Unteroffizier Raphael Strauß (geb. 10.6.1885 in Hörstein,
gef. 7.6.1917). Außerdem fiel der Gefreite Emil Rothschild (geb. 28.6.1898 in
Hörstein, vor 1914 in Freudenberg am Main wohnhaft, gef. 8.11.1918).
Um 1925, als noch 117 Personen der jüdischen Gemeinde
angehörten (ca. 7,8 % von insgesamt etwa 1.500 Einwohnern), waren die Vorsteher
der Gemeinde: Moritz Rothschild, David Rothschild, R. Gradwohl, Samuel
Rothschild und Julius Hamburger II. Lehrer der Gemeinde war der bereits genannte
Hauptlehrer Israel
Wahler. Dieser unterrichtete damals 14 Kinder an der Jüdischen Volksschule.
Lehrer Wahler wechselte 1931 nach Bad
Neustadt a.d. Saale.
1932 waren die Vorsteher weiterhin Moritz Rothschild (1. Vorsitzender), Wilhelm
Rothschild (2. Vorsitzender). Als Lehrer war inzwischen Michael Berlinger
angestellt. Dieser unterrichtete an der jüdischen Volksschule noch acht Kinder
in vier Klassen. Ende 1934 wurde er an die jüdische Volksschule in Aschaffenburg
berufen. An jüdischen Vereinen gab es den Israelitischen
Wohltätigkeitsverein Gemilus Chesed (gegründet etwa 1830; Ziele: Unterstützung
Hilfsbedürftiger, Bestattung), den Synagogenverschönerungsverein (1899 genannt
mit den damaligen Vorstehern M. Löwenthal und J. Wahler) sowie die
Armenunterstützungskasse.
1933 lebten noch 98 jüdische Personen am Ort. Bereits in diesem Jahr kam
es zu Übergriffen und schweren Misshandlungen von Juden durch die SS. Dadurch
verließen zunehmend die Hörsteiner Juden den Ort. Anfang 1936 wurden auf dem
jüdischen Friedhof 100 Grabsteine umgeworfen. Die nächste Friedhofschändung
war im Januar 1937 (39 Steine umgeworfen, teilweise zerbrochen). Die letzten
jüdischen Lehrer an der (seit 1931) privaten jüdischen Volksschule waren
Michael Berlinger (bis Ende 1934), dann (Anfang
1935) Paul Possenheimer, danach (ab Mitte
1935) Joseph Gallinger und (ab Herbst 1936) Leopold Rose (siehe Mitteilungen
unten). Im Herbst
1938 wurden zu den Hohen Feiertagen die Fenster der Synagoge und der meisten
jüdischen Häuser eingeworfen. Es kam zu weiteren Misshandlungen. 44 jüdische
Einwohner konnten bis 1940 emigrieren, davon 21 in die Vereinigten Staaten; 46
verzogen in andere Städte in Deutschland, 35 davon nach Frankfurt.
Von den in
Hörstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ludwig Emmerich
(1895), Raphael Gradwohl (1867), Regina Gradwohl geb. Rothschild
(1873), Adolf Moritz Hamburger (1875), Daniel Hamburger (1873), Julius Hamburger (1878),
Julius Hamburger (1894), Mina Hamburger geb. Oppenheimer (1878), Nathan
Hamburger (1871), Rita Hamburger (1920), Selma Hamburger geb.
Hess (1884), Wolf Hamburger (1880), Sophie Heß geb. Hamburger (1869), Selma
(Erna) Kanthal geb. Rotschild (1906), Else Levi geb. Rothschild (1895), Emanuel
Löwenthal geb. Rothschild (1870), Eva Löwenthal (1881), Markus Löwenthal
(1868), Sally Löwenthal (1872), Selma Neuhaus geb. Hamburger (1906), Ester
Oppenheimer (1853), Markus
(Max) Ring (1868), Paula Ring geb. Waller (1912), Else Rosenthal geb. Strauss
(1912), Berta Rothschild (1909), Bertha Rothschild (1886), Daniel Rothschild (1881),
Gustav Rothschild (1902), Hermann Rothschild (1885), Hermann Rothschild (1890), Isaak Rothschild (1878), Josef Rothschild
(1853), Josef Rothschild (1891), Julius Rothschild (1888), Malli
Rothschild (1892), Max Rothschild (1883), Max Rothschild (1887), Meta Rothschild
(1904), Rosa Rothschild geb. Adler (1896), Salli Rothschild (1879), Samuel
Rothschild (1875), Sarah Rothschild (1887), Selma
Rothschild geb. Kleimann (1882), Siegfried Rothschild (1894), Berta Schubach
geb. Rothschild (1886), Kathinka Sonneberg geb. Oppenheimer (1879), Mathilde
Stern geb. Oppenheimer (1881), Leo Strauss (1887), Rafael Strauss (1875), Reni
Paula Strauss (1917, Kennkarte siehe unten), Babette Strauß geb. Hamburger (1890), (1890), Klara Strauß
(1895), Siegfried Strauß (1888), Amalie Stühler geb. Rothschild (1888), Selma
Valk geb. Emmerich (1887), Israel Wahler (1875), Sigmund Wahler (1871), Ella
Waller (1912).
Aus dem Leben der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Jakob Haas, bisher Lehrer in Hörstein, wird Lehrer in
Höchheim (1867)
 Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von
Unterfranken und Aschaffenburg" vom 3. September 1867:
"Durch Regierungs-Entschließung vom 29. August laufenden Jahres Nr.
34007 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Höchheim,
königlichen Bezirksamts Königshofen, beschlossene Übertragung ihrer
Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den Schuldienst-Exspektanten Jakob
Haas in Hörstein, königlichen Bezirksamts Alzenau, genehmigt
worden."
Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von
Unterfranken und Aschaffenburg" vom 3. September 1867:
"Durch Regierungs-Entschließung vom 29. August laufenden Jahres Nr.
34007 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Höchheim,
königlichen Bezirksamts Königshofen, beschlossene Übertragung ihrer
Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den Schuldienst-Exspektanten Jakob
Haas in Hörstein, königlichen Bezirksamts Alzenau, genehmigt
worden." |
Lehrer Israel Wahler sucht den Besitzer von gefundenen
Tefillin (1900)
Anmerkung: Israel Wahler war Nachfolger seines Bruders Carl Wahler, der 1931 in
Neustadt verstorben ist (siehe Berichte oben) Israel Wahler ist 1875 in Hörstein
als Sohn des dortigen Lehrers Isaak Wahler geboren. 1894 übernahm er als
Nachfolger seines Vaters die Leitung der Hörsteiner israelitischen Religionsschule.
Seine Frau Bella geb. Adler ist 1878 in Gleicherwiesen
geboren. Israel und Bella Wahler hatten einen Sohn: Isaac (geb. 1918 in Frankfurt am Main).
Nachdem 1931 die Schule in Hörstein wegen Schülermangels geschlossen
wurde, übernahm Oberlehrer Wahler die Stelle seines verstorbenen Bruders als
Leiter der israelitischen Volksschule in Bad
Neustadt. Nach 1933 wollten die Wahlers zunächst in Deutschland bleiben,
doch wurde der Sohn 1934 auf Drängen seiner Mutter zu einer Großtante in die
USA geschickt. Nach dem Novemberpogrom 1938 betrieben Israel und Bella Wahler ihre eigene Auswanderung, die aber nicht mehr zustande kam.
Sohn Isaac E. Wahler hatte bis zum April 1942 mit seinen Eltern brieflichen Kontakt, dann hörte er nichts mehr von ihnen. Anfang 1947 kam er als Mitarbeiter des stellvertretenden amerikanischen Chefanklägers bei den Nürnberger Prozessen, Robert M. W. Kempner, nach Deutschland zurück. Auf einer Dienstreise entdeckte er in einem amerikanischen Aktendepot in Oberursel im Taunus die Akten der Außenstelle Würzburg der Staatspolizeistelle Nürnberg über die Judendeportationen in den Jahren 1941 bis 1943. Diese Akten wurden 1947 im so genannten Wilhelmstraßen-Prozess, bei den Prozessen gegen Angehörige der Nürnberger und Würzburger Gestapo, beim Eichmann-Prozess in Jerusalem und bei vielen anderen Verfahren verwendet
(vgl.: Herbert Schultheis und Isaac E. Wahler, Bilder und Akten der Gestapo Würzburg über die Judendeportationen 1941-1943, Rötter Druck und Verlag Bad Neustadt,
1988.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Oktober 1900: "Vom
Vorstand der Königlich Preußischen Bahnstation Dettingen wurden mir ein
Paar Tefillin - sehr schön und groß - übergeben, welche im Wartesaal
gefunden wurden. Wahrscheinlich hat sie ein russischer Wanderer, der am
18. und 19. September in Hörstein gewesen, dort liegen lassen.
Eigentümer möge sich bei mir melden. Hörstein bei Aschaffenburg, 21.
September. Israel Wahler, Lehrer". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Oktober 1900: "Vom
Vorstand der Königlich Preußischen Bahnstation Dettingen wurden mir ein
Paar Tefillin - sehr schön und groß - übergeben, welche im Wartesaal
gefunden wurden. Wahrscheinlich hat sie ein russischer Wanderer, der am
18. und 19. September in Hörstein gewesen, dort liegen lassen.
Eigentümer möge sich bei mir melden. Hörstein bei Aschaffenburg, 21.
September. Israel Wahler, Lehrer". |
Die israelitische Elementarschule wird
israelitische Volksschule (1910)
 Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" / "Blätter für Erziehung und Unterricht"
vom 17. März 1910: "Zur Nachahmung! Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" / "Blätter für Erziehung und Unterricht"
vom 17. März 1910: "Zur Nachahmung!
Im Jahre 1900 errichtete die Kultusgemeinde Hörstein bei
Aschaffenburg aus ihrer Religions- eine Elementarschule (Verweserei), um
ihrem Lehrer eine staatliche Anstellung zu verschaffen. Jetzt hat diese
lehrerfreundliche Gemeinde auch den letzten Schritt getan und die Umwandlung
in eine Volksschule einstimmig beschlossen. Dieser Tage nun wurde unser
dortiger Kollege Herr Israel Wahler von der Königs. Regierung von
Unterfranken zum definitiven Volksschullehrer befördert. — Der jetzt 96
jährige Vater und Amtsvorgänger dieses Kollegen, der Nestor der bayerischen
Lehrerschaft, wirkte bis 1894 als Religionslehrer 40 Jahre in Hörstein.
Hochachtung vor einer solchen Gemeinde." |
Zum Tod von Lehrer i.R. Isaak Wahler im Alter fast
98 Jahren (1912)
 Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Februar 1912: "Mein Lehrer. Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 29. Februar 1912: "Mein Lehrer.
Isaak Wahler ist am 14. dieses Monats in seinem Wirkungsort Hörstein
(Bayern) in dem selten hohen Alter von 97 Jahren und 7 Monaten sanft
entschlummert. Die Trauerbotschaft hat mir sofort die Feder in die Hand
gedrückt, nicht etwa um den Tod zu beklagen, sondern um meinen Lehrer in
diesen Blättern in dankbarer Weise einen Gedenkstein aufzurichten. Was er
der Gemeinde Hörstein, in welcher er vom Jahre 1856-1894 als Lehrer und
Kantor gewirkt hat, war, das hat mein Vater als Vorsteher am Tage der
Beerdigung einem zahlreichen Zuhörerkreise in einer kurzen kernigen
Ansprache gesagt: 'Er war ein guter, treuer und gewissenhafter Lehrer, der
seine Schüler mit Liebe und Wärme in unserer heiligen Religion unterwiesen
hat und er war auch ein Chasen (Vorbeter, Chassan) im wahren Sinne
des Wortes, der es verstand, bei jedem Gottesdienste die Gemeinde zu
erbauen.'
Ein ewiges Andenken wird ihm die Gemeinde bewahren.
Der zuständige Rabbiner Dr. Breuer -
Aschaffenburg entwarf in zu Herzen
gehenden Worten ein Lebensbild des Dahingeschiedenen, wobei er ganz
besonders auf dessen vorbildlichen Charakter hinwies. Selbst die Herren:
Bezirksamtmann von Alzenau, der
Schulinspektor, der erste Lehrer und der Ortspfarrer ließen es sich nicht
nehmen, dem Verstorbenen warm empfundene Worte der Anerkennung und
Verehrung, nachzurufen, wobei der letztere ganz besonders hervorhob, dass
auch Lehrer Wahler sehr dazu beigetragen, den Frieden unter den
verschiedenen Konfessionen zu erhalten und zu stärken. Sein jüngster Sohn
und Nachfolger rief ihm zum Schlusse des Traueraktes rührende Abschiedsworte
nach. Ein solches Gefolge hatte man seit Menschengedenken in Hörstein nicht
gesehen.
Am Grabe dankte in warmen Worten der älteste Sohn des Dahingeschiedenen,
Lehrer Calman Wahler, dem Vater für seine große Liebe. Lehrer
Wechsler - Alzenau schilderte im Aufträge
des bayrischen Lehrervereins ihn als den tätigen, aufrichtigen und treuen
Kollegen.
Damit schließt das Leben eines Mannes, der fast ein volles Jahrhundert
gelebt und in dieser langen Zeit viel erlebt, viel gelitten und viel
gekämpft hat, der die ganze Entwicklung des jüdischen Lehrerstandes mit
angesehen, in ihr selber gestanden und manchen wertvollen Beitrag geliefert
hat.
Drang auch sein Ruf nicht nach außen, mit desto größerer Energie und
Intensivität entfaltete er seine Kräfte innerhalb der Gemeinde. Trotzdem er
auf dem Boden des streng gesetzestreuen Judentums stand und sich sein
religiöser Lebenswandel auch in diesen Bahnen bewegte, muss hier anerkennend
hervorgehoben werden, dass er nicht fanatisch, sondern tolerant auch anders
denkenden Kollegen gegenüber antrat.
Wahler wurde am 13. Juli 1814 zu Jochsberg
bei Ansbach geboren. Von seinem Vater, Reb Calman Wahler, der in
Theilheim als Lehrer fungierte, erhielt
er Vorbereitungen für die hebräischen Fächer und das Kantorat. In seinem 17.
Lebensjahre nahm er eine Religionslehrerstelle in der Pfalz an, wo er von
christlichen Kollegen in den weltlichen Fächern für die Finalprüfung
vorbereitet wurde, die er auch im Jahre 1845 am königlichen Lehrerseminar zu
Würzburg bestand. Hierauf war er an verschiedenen Orten, wie
Göllheim (Rheinpfalz),
Geroldshausen,
Rieneck tätig, von wo er, da ihm alle
diese Stellungen nicht zusagten, im Jahre 1852 in Begleitung seiner Frau
nach Amerika reiste, um sein Glück in der neuen Welt zu versuchen. Von
dieser Reise, 120 Tage auf dem Segelschiff, erzählte er oft seinen Schülern.
In Amerika ging es ihm sehr schlecht. Bei den wirtschaftlichen Kämpfen, die
damals die eingewanderten Juden durchzumachen hatten, zeigte man ihm als
Lehrer wenig Verständnis. Infolge der vielen Aufregungen, entstanden durch
ihre soziale Notlage, starb seine Frau, und er kehrte 1856 ganz entmutigt
nach Deutschland zurück. Er erhielt dann gleich eine Anstellung als Lehrer
und Kantor in meinem Heimatorte, der Gemeinde Hörstein, wo er bis zum
Jahre 1894 wirkte.
Er wäre noch länger in Tätigkeit geblieben, wenn nicht gerade sein Sohn sein
Nachfolger geworden wäre. Sein Anfangsgehalt betrug 160 Gulden, und stieg
bis zu einem Endgehalt von 500 Mk. Seine Gemeinde, seine zahlreichen
Schüler, Kollegen, Freunde und Bekannten werden ihm nach Verdienst ein
ehrendes Andenken bewahren und dem teueren Lehrer einen ewigen Denkstein in
ihrem Herzen errichten. Das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen.
Lehrer Adolf Rothschild Achim - Bremen" |
25-jähriges Amtsjubiläum von Lehrer Israel Wahler (1919)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1919: "Hörstein.
Lehrer Israel Wahler beging sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Der Jubilar
übernahm nach überstandener Prüfung am Würzburger Seminar die hiesige
Lehrerstelle, die sein Vater 48 Jahre innehatte, der im gesegneten Alter
von 98 Jahren vor kurzem verstarb. Wie der Vater, so verstand es auch der
Sohn, sich durch volle Hingebung zu seinem Berufe die Liebe der Gemeinde
zu erringen. Gemeinde sowohl wie Schule hat er in jeder Weise zu heben
verstanden. Ihm gelang es auch in inniger Zusammenarbeit mit unserem
Vorsteher Raphael Rothschild, die Religionsschulstelle zu einer
staatlichen Elementarlehrerstelle umzugestalten, ein modernes Schulhaus zu
errichten und einen Umbau der Synagoge
herbeizuführen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1919: "Hörstein.
Lehrer Israel Wahler beging sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Der Jubilar
übernahm nach überstandener Prüfung am Würzburger Seminar die hiesige
Lehrerstelle, die sein Vater 48 Jahre innehatte, der im gesegneten Alter
von 98 Jahren vor kurzem verstarb. Wie der Vater, so verstand es auch der
Sohn, sich durch volle Hingebung zu seinem Berufe die Liebe der Gemeinde
zu erringen. Gemeinde sowohl wie Schule hat er in jeder Weise zu heben
verstanden. Ihm gelang es auch in inniger Zusammenarbeit mit unserem
Vorsteher Raphael Rothschild, die Religionsschulstelle zu einer
staatlichen Elementarlehrerstelle umzugestalten, ein modernes Schulhaus zu
errichten und einen Umbau der Synagoge
herbeizuführen." |
Oberlehrer Israel Wahler aus Hörstein kommt zum 1. April 1931 nach Bad
Neustadt an der Saale
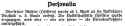 Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. April 1931:
"Personalia. Oberlehrer Wahler (Hörstein) wurde ab 1. April
(1931) an die Volksschule Neustadt a.d. Saale versetzt. Die
Volksschulstelle Hörstein wurde eingezogen, wird aber, wie wir hören,
als Privatvolksschule weitergeführt." Artikel
in der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. April 1931:
"Personalia. Oberlehrer Wahler (Hörstein) wurde ab 1. April
(1931) an die Volksschule Neustadt a.d. Saale versetzt. Die
Volksschulstelle Hörstein wurde eingezogen, wird aber, wie wir hören,
als Privatvolksschule weitergeführt." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April 1931:
"Alzenau (Unterfranken), 25. April (1931). Nach 37jähriger
Wirksamkeit in seinem Heimatorte Hörstein schied Herr Oberlehrer Israel
Wahler von uns, um als Nachfolger seines allzu früh in die Ewigkeit
berufenen Bruders die Volksschullehrerstelle in Neustadt
a.S. anzutreten. Wenn man solange Zeit an einem Platze wirkt, erhält
dieser das Gepräge seines Amtsinhabers. So ist es dem unermüdlichen,
kraftvollen Schaffen des Scheidenden zu verdanken, wenn in Hörstein heute
noch alle jüdischen Institutionen in bester Verfassung sich befinden. Er
wirkte die Umwandlung der Religionsschule in einer Volksschule, sorgte
für die Renovierung der Synagoge und Mikwoh und suchte, begünstigt durch
eine glänzende Rednergabe, durch allsabbatliche Vorträge die
Religiosität seiner Gemeinde zu heben. Sein pflichteifriges Wirken in der
Schule war vorbildlich und wurde bei den Prüfungen auch von der
Staatsbehörde anerkannt. Kein Wunder, dass Oberlehrer Wahler bei seinem
Abschiede große Ehrungen zuteil wurden. Der Bezirkslehrerverein Alzenau
hielt eine Abschiedskonferenz in Hörstein, um ihm eine besondere Freude
zu bereiten. Der Konferenzleiter, Herr Hauptlehrer Rosel von
Großwelzheim, hob in seiner Ansprache die großen Verdienste Wahlers
hervor, die er sich durch Vorträge im Vereine, seine Anregungen bei den
Debatten und durch fleißigen Besuch der Konferenzen im großen bayrischen
Lehrervereine erwarb. Der Gesangverein in Hörstein, dessen Gründer und
Ehrenmitglied Wahler war, brachte ihm ein Ständchen, und die
Kultusgemeinde sowie die christlichen Kollegen und andere Freunde ehrten
den Scheidenden durch prächtige Geschenke. Möge Herrn Oberlehrer Wahler
in seinem neuen Wirkungskreise gleiche Anerkennung und gleicher Erfolg
beschieden sein. Die besten Wünsche seiner zahlreichen Schüler und
Freunde begleiten ihn." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April 1931:
"Alzenau (Unterfranken), 25. April (1931). Nach 37jähriger
Wirksamkeit in seinem Heimatorte Hörstein schied Herr Oberlehrer Israel
Wahler von uns, um als Nachfolger seines allzu früh in die Ewigkeit
berufenen Bruders die Volksschullehrerstelle in Neustadt
a.S. anzutreten. Wenn man solange Zeit an einem Platze wirkt, erhält
dieser das Gepräge seines Amtsinhabers. So ist es dem unermüdlichen,
kraftvollen Schaffen des Scheidenden zu verdanken, wenn in Hörstein heute
noch alle jüdischen Institutionen in bester Verfassung sich befinden. Er
wirkte die Umwandlung der Religionsschule in einer Volksschule, sorgte
für die Renovierung der Synagoge und Mikwoh und suchte, begünstigt durch
eine glänzende Rednergabe, durch allsabbatliche Vorträge die
Religiosität seiner Gemeinde zu heben. Sein pflichteifriges Wirken in der
Schule war vorbildlich und wurde bei den Prüfungen auch von der
Staatsbehörde anerkannt. Kein Wunder, dass Oberlehrer Wahler bei seinem
Abschiede große Ehrungen zuteil wurden. Der Bezirkslehrerverein Alzenau
hielt eine Abschiedskonferenz in Hörstein, um ihm eine besondere Freude
zu bereiten. Der Konferenzleiter, Herr Hauptlehrer Rosel von
Großwelzheim, hob in seiner Ansprache die großen Verdienste Wahlers
hervor, die er sich durch Vorträge im Vereine, seine Anregungen bei den
Debatten und durch fleißigen Besuch der Konferenzen im großen bayrischen
Lehrervereine erwarb. Der Gesangverein in Hörstein, dessen Gründer und
Ehrenmitglied Wahler war, brachte ihm ein Ständchen, und die
Kultusgemeinde sowie die christlichen Kollegen und andere Freunde ehrten
den Scheidenden durch prächtige Geschenke. Möge Herrn Oberlehrer Wahler
in seinem neuen Wirkungskreise gleiche Anerkennung und gleicher Erfolg
beschieden sein. Die besten Wünsche seiner zahlreichen Schüler und
Freunde begleiten ihn." |
Lehrer Paul Possenheimer wechselt von Hörstein nach Lübeck - Lehrer Josef Gallinger
kommt von Uffenheim nach Hörstein (1935)
 Anmerkung:
bei Lehrer Possenheimer handelte es sich um Lehrer Paul Possenheimer (geb.
29.7.1913 in Burgkunstadt): lernte
an der Israelitischen
Präparandenschule in Höchberg, danach (1930 bis 1933) an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Informationen nach Reiner Strätz:
Biographisches Handbuch Würzburger Juden Bd. 2 S. 444). Das Foto
links zeigt (als zweiten von links, Nr. 14) Lehrer Paul Possenheimer mit
Schülerinnen und Schülern der jüdischen Religionsschule Lübeck 1935
(Quelle: www.stolpersteine-luebeck.de:
Unterseite);
Nr. 13 bezeichnet Rabbiner Dr. David Alexander Winter. Anmerkung:
bei Lehrer Possenheimer handelte es sich um Lehrer Paul Possenheimer (geb.
29.7.1913 in Burgkunstadt): lernte
an der Israelitischen
Präparandenschule in Höchberg, danach (1930 bis 1933) an der Israelitischen
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Informationen nach Reiner Strätz:
Biographisches Handbuch Würzburger Juden Bd. 2 S. 444). Das Foto
links zeigt (als zweiten von links, Nr. 14) Lehrer Paul Possenheimer mit
Schülerinnen und Schülern der jüdischen Religionsschule Lübeck 1935
(Quelle: www.stolpersteine-luebeck.de:
Unterseite);
Nr. 13 bezeichnet Rabbiner Dr. David Alexander Winter.
|
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1935: "Personalia. Lehrer Gallinger von Uffenheim
übernahm die private Volksschulstelle in Hörstein, Kollege Possenheimer
in Hörstein trat eine Stelle in Lübeck an. Lehrer Fritz Levy
- Rockenhausen wurde an die
Gartenbauschule Ahlem bei Hannover
berufen." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1935: "Personalia. Lehrer Gallinger von Uffenheim
übernahm die private Volksschulstelle in Hörstein, Kollege Possenheimer
in Hörstein trat eine Stelle in Lübeck an. Lehrer Fritz Levy
- Rockenhausen wurde an die
Gartenbauschule Ahlem bei Hannover
berufen." |
Lehrer Josef Gallinger verlässt die Gemeinde - sein
Nachfolger wird Lehrer Leopold Rose (Herbst 1936)
Anmerkung: In den "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern" vom
1.11.1938 S. 18 ist dann zu lesen: "Lehrer Rose - Hörstein ist zur Hachscharah
(Vorbereitung zur Auswanderung nach Palästina) gegangen. Die private Volksschule
in Hörstein wurde aufgelöst" und "Lehrer Gallinger, früher Hörstein, übernahm
eine Lehrstelle in New York".
 Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Lehrer Josef Gallinger in Hörstein erhielt
eine Lehrerstelle am Philanthropin in Frankfurt am Main. Schulamtsbewerber
Leopold Rose in Oettingen, übernimmt
die Stelle an der privaten Volksschule in Hörstein." Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
September 1936: "Lehrer Josef Gallinger in Hörstein erhielt
eine Lehrerstelle am Philanthropin in Frankfurt am Main. Schulamtsbewerber
Leopold Rose in Oettingen, übernimmt
die Stelle an der privaten Volksschule in Hörstein." |
| |
 Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1936: Lehrer Leopold Rose, bisher in Oettingen,
übernahm die private Volksschule in Hörstein." Mitteilung
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
November 1936: Lehrer Leopold Rose, bisher in Oettingen,
übernahm die private Volksschule in Hörstein." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Spendenaufruf für die Familie des Daniel Löb Strauß
(1876)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September
1876:
"Aufruf! Daniel Löb Strauß, Handelsmann in Hörstein, welcher
sich mit dem Kälber-Handel ernährte, hatte das Unglück, dass er mehrere
Monate schwer krank danieder lag. Als er wieder genesen war, wurden seine
sämtlichen Kinder krank, und so hat er seine paar Gulden, welche er zum Handel
braucht, verzehrt. Die kleine jüdische Gemeinde hat schon Alles aufgeboten,
aber es reicht nicht. Demselben ist nun auch das Kapital auf sein Haus
gekündigt worden. Alle Handels- und Geschäftsleute werden um milde Haben
höflichst ersucht; und wenn nur 300 Mark zusammen kommen, ist dem armen Manne
geholfen. Die Gaben können an der israelitischen Kultusvorstand Herrn J. M.
Löwenthal zu Hörstein bei Aschaffenburg (Bayern) zugeschickt werden.
Veröffentlichung in diesen Blättern. Vorstehendes beglaubigt der Wahrheit gemäß
Der Kultusvorstand J.M. Löwenthal".
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September
1876:
"Aufruf! Daniel Löb Strauß, Handelsmann in Hörstein, welcher
sich mit dem Kälber-Handel ernährte, hatte das Unglück, dass er mehrere
Monate schwer krank danieder lag. Als er wieder genesen war, wurden seine
sämtlichen Kinder krank, und so hat er seine paar Gulden, welche er zum Handel
braucht, verzehrt. Die kleine jüdische Gemeinde hat schon Alles aufgeboten,
aber es reicht nicht. Demselben ist nun auch das Kapital auf sein Haus
gekündigt worden. Alle Handels- und Geschäftsleute werden um milde Haben
höflichst ersucht; und wenn nur 300 Mark zusammen kommen, ist dem armen Manne
geholfen. Die Gaben können an der israelitischen Kultusvorstand Herrn J. M.
Löwenthal zu Hörstein bei Aschaffenburg (Bayern) zugeschickt werden.
Veröffentlichung in diesen Blättern. Vorstehendes beglaubigt der Wahrheit gemäß
Der Kultusvorstand J.M. Löwenthal".
|
Jüdische Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg aus
der Familie Joseph Rothschild
Zu Familie Rothschild aus Hörstein und
Alzenau siehe die genealogischen Zusammenhänge bei geni.com.
Hier zunächst die Familie Joseph Rothschild (1853 Hörstein - 1943 KZ
Auschwitz)
https://www.geni.com/people/Joseph-Rothschild/6000000000169922212
Die unten genannten Söhne von Joseph Rothschild und seiner Frau Philippine geb.
Hamburger (1856-1907) waren:
- Daniel Rothschild (1890-1956 NY, USA):
https://www.geni.com/people/Daniel-Rothschild/6000000000169922329
- Simon Rothschild (1885-1950 NY, USA):
https://www.geni.com/people/Simon-Rothschild/6000000000169922309
- Salli Rothschild (1879-1965 Los Angeles, USA):
https://www.geni.com/people/Salli-Rothschild/6000000000169922274
- Alfred Rothschild (1895-1974 Israel):
https://www.geni.com/people/Alfred-Rothschild/6000000000169922319
- Moritz Rothschild (1877-1943 ?):
https://www.geni.com/people/Moritz-Rothschild/6000000000169922243
- Leopold Rothschild (1876-1944 USA):
https://www.geni.com/people/Leopold-Rothschild/6000000000169922232
- Hermann (Zwi) Rothschild (1881-1970 Würzburg):
https://www.geni.com/people/Hermann-Tzvi-Rothschild/6000000000169922295
- David Rothschild (1888-1973 NY, USA):
https://www.geni.com/people/David-Rothschild/6000000000169922253
Zu den Töchtern und weiteren Nachkommen siehe Angaben bei geni.com.
 Artikel
von 1915/16 (Quelle: Stadtarchiv Alzenau) über "Acht jüdische Brüder im Weltkrieg
1914-1918. Dass acht Brüder im Felde standen und gemeinsam für die Sache
des Vaterlandes kämpften, dürfte auch in diesem, an merkwürdigen Ereignissen
so reichen Kriege von 1914-1918 nicht zu oft vorgekommen sein. Die Familie
Josef Rothschild I. in Hörstein bei Aschaffenburg darf wohl als jüdische
Soldatenfamilie bezeichnet werden. Ein Mitglied dieser Familie (sc.
Salomon Rothschild, "Im deutschen Reich' 1896 Heft 1 S. 44) fiel im
Kriege 1866, ein anderes (sc. Rafael Rothschild s.u. Mitteilung von 1928) kämpfte 1870 mit und besitzt mehrere
Auszeichnungen. Unser Bild führt uns acht Brüder Rothschild, Neffen
des Kriegsveteranen (gemeint wohl Rafael Rothschild), vor. Artikel
von 1915/16 (Quelle: Stadtarchiv Alzenau) über "Acht jüdische Brüder im Weltkrieg
1914-1918. Dass acht Brüder im Felde standen und gemeinsam für die Sache
des Vaterlandes kämpften, dürfte auch in diesem, an merkwürdigen Ereignissen
so reichen Kriege von 1914-1918 nicht zu oft vorgekommen sein. Die Familie
Josef Rothschild I. in Hörstein bei Aschaffenburg darf wohl als jüdische
Soldatenfamilie bezeichnet werden. Ein Mitglied dieser Familie (sc.
Salomon Rothschild, "Im deutschen Reich' 1896 Heft 1 S. 44) fiel im
Kriege 1866, ein anderes (sc. Rafael Rothschild s.u. Mitteilung von 1928) kämpfte 1870 mit und besitzt mehrere
Auszeichnungen. Unser Bild führt uns acht Brüder Rothschild, Neffen
des Kriegsveteranen (gemeint wohl Rafael Rothschild), vor.
Reihenfolge von links nach rechts:
1. Daniel Rothschild, 26 Jahre alt, diente im 2. Bayerischen
Jägerbataillon und wurde in den Kämpfen auf der Loretto-Höhe schwer
verwundet.
2. Simon Rothschild, 30 Jahre alt, diente im 118.
Infanterie-Regiment in Worms und wurde bei den Gefechten vor Brest-Litowsk
ebenfalls schwer verwundet.
3. Salli Rothschild, 36 Jahre alt, diente beim 116.
Infanterie-Regiment, Darmstadt.
4. Alfred Rothschild, 20 Jahre alt, diente im 80. Füsilier-Regiment
in Wiesbaden, war im Felde beim Reserve-Infanterie-Regiment 253,
Reserve-Infanterieregiment 37, später dem Landwehr-Infanterie-Regiment 77
und 78 zugeteilt.
5. Moritz Rothschild, 38 Jahre alt, diente bei ihm Train und war in
den Gefechten in Frankreich, Russland, Ungarn und Serbien.
6. Leopold Rothschild, 40 Jahre alt, diente im 109.
Infanterie-Regiment, war von Mai 1916 bis Kriegsende im Felde dem
Landwehr-Infanterieregiment 40 zugeteilt.
7. Hermann Rothschild, 35 Jahre alt, war im 1. Königlich-Bayerischen
Infanterie-Leib-Regiment und wurde im Westen bei einer größeren Schlacht
verwundet.
8. David Rothschild, 28 Jahre alt, diente beim 116.
Infanterie-Regiment und kam zu dem gleichen Regiment nach Frankreich."
|
| |
Jüdische Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg aus der Familie Raphael
Rothschild
Raphael Rothschild (1848-1929) war ein älterer Bruder des o.g. Joseph
Rothschild:
https://www.geni.com/people/Raphael-Rothschild-III/6000000024787730515
Söhne von Raphael Rothschild und seiner Frau Eva (1850-1921) waren - im
Bericht unten werden drei verheiratete Brüdern von Adolf als
Kriegsteilnehmer genannt:
- Adolf Rothschild (1875-1919 Achim):
https://www.geni.com/people/Adolf-Rothschild/6000000000277431002
- Leopold Rothschild (1877-1947 NY, USA):
https://www.geni.com/people/Leopold-Rothschild/6000000000277302550
- Salomon Rothschild (1881-1946 USA):
https://www.geni.com/people/Salomon-Rothschild/6000000000225797797
- Simon Rothschild (unbekannte Lebensdaten):
https://www.geni.com/people/Simon-Rothschild/6000000000277279661
Mit den "sieben Schwägern" werden u.a. die Ehemänner seiner Schwestern Sara
verh. Jacob, Recha verh. Birkin, Yetta verh. Feilman gemeint sein. Mit den
"sieben Vettern" sind die o.g. Söhne von Joseph Rothschild gemeint, von
denen 1914 vermutlich der achte (Alfred) noch nicht eingezogen war.
|
 Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 28. August 1914 mit einem Bericht von
Lehrer Adolf Rothschild in Achim bei Bremen: "Achim-Bremen, 21.
August. Aus meiner Familie sind 17 Krieger hinausgezogen. Drei verheiratete
Brüder, darunter zwei Unteroffiziere, kämpfen an der französischen Grenze;
sieben Schwäger, darunter ein Unteroffizier (Kampfplatz mir unbekannt),
sieben Vettern, darunter drei Unteroffiziere, wurden auch zur Fahne gerufen.
Mein Vater, Res. (Raphael) Rothschild, Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu
Hörstein (Bayern), der 1870 als Unteroffizier mitgemacht und mehrere
Auszeichnungen besitzt, hat sich freiwillig gemeldet. Ich war auch Soldat,
wurde aber vor einigen Jahren wegen eines Augenleidens für dienstuntauglich
erklärt; ich habe mich auch freiwillig gemeldet... Lehrer Rothschild." Artikel
in "Der Gemeindebote" vom 28. August 1914 mit einem Bericht von
Lehrer Adolf Rothschild in Achim bei Bremen: "Achim-Bremen, 21.
August. Aus meiner Familie sind 17 Krieger hinausgezogen. Drei verheiratete
Brüder, darunter zwei Unteroffiziere, kämpfen an der französischen Grenze;
sieben Schwäger, darunter ein Unteroffizier (Kampfplatz mir unbekannt),
sieben Vettern, darunter drei Unteroffiziere, wurden auch zur Fahne gerufen.
Mein Vater, Res. (Raphael) Rothschild, Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu
Hörstein (Bayern), der 1870 als Unteroffizier mitgemacht und mehrere
Auszeichnungen besitzt, hat sich freiwillig gemeldet. Ich war auch Soldat,
wurde aber vor einigen Jahren wegen eines Augenleidens für dienstuntauglich
erklärt; ich habe mich auch freiwillig gemeldet... Lehrer Rothschild."
Anmerkung: Adolf Rothschild ist 1875 geboren als Sohn von Raphael
Rothschild. Er war Lehrer an der jüdischen Schule in Achim (Georgenstraße),
wo er 1919 starb und im dortigen jüdischen Friedhof beigesetzt wurde. Grab
siehe
https://www.verdener-familienforscher.de/verden/judenfriedhof/index.php?id=grab&ia=29.
|
 Artikel
in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 1. August 1919: "Achim-Bremen.
Adolf Rothschild, ein bewährter Mitarbeiter der 'Neuen Jüdischen
Presse', ein Lehrer, der seinen Beruf auf die idealste Weise erfasst hatte,
und sich sich in Wort und Schrift besonders um die Hebung des Judentums in
Deutschland mühte, ist im besten Alter — er, wurde 1875 in Hörstein
geboren — verschieden." Artikel
in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 1. August 1919: "Achim-Bremen.
Adolf Rothschild, ein bewährter Mitarbeiter der 'Neuen Jüdischen
Presse', ein Lehrer, der seinen Beruf auf die idealste Weise erfasst hatte,
und sich sich in Wort und Schrift besonders um die Hebung des Judentums in
Deutschland mühte, ist im besten Alter — er, wurde 1875 in Hörstein
geboren — verschieden." |
| |
| Nach "Dr. Bloch's österreichischer
Wochenschrift" vom 26. November 1915 erhielt Hermann Rothschild 1915
das Eiserne Kreuz; nach dem "Israelitischen Familienblatt" vom 11. Oktober
1917 S. 2 erhielt Unteroffizier Leopold Rothschild (Miltenberg),
Sohn des Herrn Rafael Rothschild aus Hörstein das Eiserne Kreuz II.
|
Die Witwe des im Krieg vermissten Jakob Steinhäuser
heiratet wieder (1921)
Anmerkung: zur Chaliza vgl. den Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Chalitza-Schuh
 Artikel
in "Jüdische Monatshefte" 1921 Heft 3/4 S. 37: "Ein Zeitbild. Artikel
in "Jüdische Monatshefte" 1921 Heft 3/4 S. 37: "Ein Zeitbild.
Herr Jakob Steinhäuser in Hörstein (Bezirk Aschaffenburg) war
schon zu Beginn des Krieges eingerückt und wurde bald darauf als vermisst
gemeldet. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Er ist, wohlgemerkt,
amtlich nicht als tot, sondern lediglich als vermisst gemeldet. Vor einiger
Zeit wurde dem zuständigen Rabbiner, Herrn Dr. Breuer in
Aschaffenburg, mitgeteilt, dass
Frau Steinhäuser die Absicht habe, sich wieder zu verheiraten. Herr Dr.
Breuer setzte Frau Steinhäuser in mündlicher Unterredung die verhängnisvolle
Bedeutung ihrer Absicht auseinander, wies auf den strengen Ernst hin, mit
welchem die religionsgesetzliche Möglichkeit der Wiederverheiratung einer
Kriegswitwe geprüft werden müsse, zumal in einem Falle, wo über das
Schicksal des aus dem Felde nicht heimgekehrten Ehegatten weder durch
amtliche Feststellungen noch auf dem Wege privater Erkundungen irgendwelche
Sicherheit zu erlangen ist. Die Wirkung dieser Darlegungen auf Frau
Steinhäuser war gering, sogar sehr gering. Denn bald darauf setzte sie sich
mit dein Rabbiner in Offenbach, Herrn Dr. Dienemann, in Verbindung, der sich
auch bereit erklärte, ihre Trauung mit Herrn Löb, ihrem Bräutigam,
vorzunehmen, jedoch erst nachdem ein Schwager der Frau Steinhäuser, die
kinderlos ist, mit ihr den Chaliza-Akt vollzogen habe. Dieser
Chaliza-Akt soll nun vor kurzem in Offenbach unter Hinzuziehung des
Rabbinats der israelitischen Gemeinde in Frankfurt a. M. stattgefunden
haben, so dass nun im Sinne des Offenbacher Rabbinatsgerichtsurteiles
einer Trauung von Herrn Löb mit Frau Steinhäuser nichts mehr im Wege stand,
obwohl Herr Löb ein Kohen ist, der eine Chaliza nicht heiraten
darf. Die Trauung des Herrn Löb mit Frau Steinhäuser ist nun tatsächlich am
Sonntag, den 10. April dieses Jahres durch Herrn Dr. Dienemann vollzogen
worden." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Zum Tod von Löb Grünebaum (1876)
Anmerkung: Löb Grünebaum war mehrere Jahre (genannt u.a. 1868) Vorsteher der
jüdischen Gemeinde Hörstein.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1876:
"Hörstein (Bayern). Wir beklagen den Verlust eines frommen und eines
der edelsten Mitglieder unserer Gemeinde. Löb Grünebaum, Seifenfabrikant
ist am 21. Nissan im 77. Lebensjahre in ein besseres Jenseits abgerufen
worden. Derselbe verdient es, dass sein Name veröffentlicht wird und der
Nachwelt zum ehrenden Andenken bleibt. Er war ein echter Jehudi, übte das
(Lernen der) Tora, den Gottesdienst und die Wohltätigkeit, studierte fast
Tag und Nacht in der heiligen Lehre und belehrte auch andere darin. Möge
Gott denselben belohnen in einer Welt, wo der Lohn ein wahrer
ist." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1876:
"Hörstein (Bayern). Wir beklagen den Verlust eines frommen und eines
der edelsten Mitglieder unserer Gemeinde. Löb Grünebaum, Seifenfabrikant
ist am 21. Nissan im 77. Lebensjahre in ein besseres Jenseits abgerufen
worden. Derselbe verdient es, dass sein Name veröffentlicht wird und der
Nachwelt zum ehrenden Andenken bleibt. Er war ein echter Jehudi, übte das
(Lernen der) Tora, den Gottesdienst und die Wohltätigkeit, studierte fast
Tag und Nacht in der heiligen Lehre und belehrte auch andere darin. Möge
Gott denselben belohnen in einer Welt, wo der Lohn ein wahrer
ist." |
Goldene Hochzeit von David
Oppenheimer und Esther geb. Rothschild (1924)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924:
"Hörstein bei Aschaffenburg, 1. Juli (1924): Das Ehepaar David
Oppenheimer und Frau Esther geborene Rothschild feierten am Samstag, den
21. Juni, in körperlicher und geistiger Frische im Kreise ihrer Kinder
und Enkel das Fest der Goldenen Hochzeit." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1924:
"Hörstein bei Aschaffenburg, 1. Juli (1924): Das Ehepaar David
Oppenheimer und Frau Esther geborene Rothschild feierten am Samstag, den
21. Juni, in körperlicher und geistiger Frische im Kreise ihrer Kinder
und Enkel das Fest der Goldenen Hochzeit." |
80. Geburtstag von Rafael Rothschild (1928)
Weitere Informationen mit weiterem Foto:
https://www.geni.com/people/Raphael-Rothschild-III/6000000024787730515:
demnach ist Raphael Rothschild am 31. März 1848 geboren und am 19. März 1929
gestorben (vgl. Angaben zur Familie oben).
 Mitteilung
im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. April 1928: "Rafael Rothschild
(Hörstein), langjähriger Vorsitzender der Gemeinde Hörstein,
Kriegsteilnehmer von 1870-71, wurde am 31. März 80 Jahre alt". Mitteilung
im "Israelitischen Familienblatt" vom 4. April 1928: "Rafael Rothschild
(Hörstein), langjähriger Vorsitzender der Gemeinde Hörstein,
Kriegsteilnehmer von 1870-71, wurde am 31. März 80 Jahre alt".
|
80. Geburtstag von Sara Hamburger (1932)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar 1932: "Hörstein.
Am 7. Januar (28. Tebeth) vollendete Frau Sara Hamburger in geistiger
und körperlicher Frische ihr 80. Lebensjahr. Frau Hamburger war seit
Gründung des israelitischen Frauenvereins 1. Vorsitzende, dessen
Obliegenheiten sie heute noch mit der größten Pflichttreue ausführt. Vor
drei 2ahren feierte sie mit ihrem Ehegatten Moses Hamburger das Fest
der goldenen Hochzeit." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Februar 1932: "Hörstein.
Am 7. Januar (28. Tebeth) vollendete Frau Sara Hamburger in geistiger
und körperlicher Frische ihr 80. Lebensjahr. Frau Hamburger war seit
Gründung des israelitischen Frauenvereins 1. Vorsitzende, dessen
Obliegenheiten sie heute noch mit der größten Pflichttreue ausführt. Vor
drei 2ahren feierte sie mit ihrem Ehegatten Moses Hamburger das Fest
der goldenen Hochzeit." |
80. Geburtstag von Esther Oppenheimer geb. Rothschild (1933)
 Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. März
1933: "80. Geburtstag. Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in
Hörstein bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger
Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer
aufrichtigen Frömmigkeit und ihrer Mildtätigkeit, die sie besonders
armen jüdischen Leuten gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt.
Möge ihr noch ein langer und glücklicher Lebensabend im Kreise ihrer
ganzen Familie beschieden sein!"
Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. März
1933: "80. Geburtstag. Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in
Hörstein bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger
Rüstigkeit ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer
aufrichtigen Frömmigkeit und ihrer Mildtätigkeit, die sie besonders
armen jüdischen Leuten gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt.
Möge ihr noch ein langer und glücklicher Lebensabend im Kreise ihrer
ganzen Familie beschieden sein!" |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1933: "Hörstein,
7. März (1933). Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in Hörstein
bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit ihren
80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer aufrichtigen Frömmigkeit
und ihrer großen Mildtätigkeit, die sie besonders armen jüdischen
Menschen gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt. Möge ihr noch
ein langer und glücklicher Lebensabend im kreise ihrer ganzen Familie
beschieden sein. (Alles Gute) bis 120 Jahre!". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1933: "Hörstein,
7. März (1933). Am 17. März begeht Frau Esther Oppenheimer in Hörstein
bei Aschaffenburg in voller körperlicher und geistiger Rüstigkeit ihren
80. Geburtstag. Die Jubilarin ist wegen ihrer aufrichtigen Frömmigkeit
und ihrer großen Mildtätigkeit, die sie besonders armen jüdischen
Menschen gegenüber ausübt, überall geachtet und geehrt. Möge ihr noch
ein langer und glücklicher Lebensabend im kreise ihrer ganzen Familie
beschieden sein. (Alles Gute) bis 120 Jahre!". |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige
der Bäckerei Mathes Gradwohl (1865)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 22. November 1865: "Ein Bäckerlehrling wird zum
sofortigen Eintritt gesucht von Mathes Gradwohl, Bäcker in
Hörstein, Post Dettingen (Bayern)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 22. November 1865: "Ein Bäckerlehrling wird zum
sofortigen Eintritt gesucht von Mathes Gradwohl, Bäcker in
Hörstein, Post Dettingen (Bayern)." |
Anzeige
der Weinhandlung M. Grünebaum (1877)
 Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 7. Februar 1877": "Hörsteiner Koscherer
Wein Hörsteiner echten Rießling, empfiehlt Unterzeichneter auf Pessach
in Flaschen und Gebinden, 1876er per Liter 1 Mark, 1874er per Liter 1 Mark
50 Pf., Rothen per Liter 1 Mark 50 Pf., mit der Versicherung, dass der
Wein nur durch mich behandelt und abgekeltert wurde. Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 7. Februar 1877": "Hörsteiner Koscherer
Wein Hörsteiner echten Rießling, empfiehlt Unterzeichneter auf Pessach
in Flaschen und Gebinden, 1876er per Liter 1 Mark, 1874er per Liter 1 Mark
50 Pf., Rothen per Liter 1 Mark 50 Pf., mit der Versicherung, dass der
Wein nur durch mich behandelt und abgekeltert wurde.
M. Grünebaum in Hörstein bei Aschaffenburg." |
Anzeigen des Gemischtwarengeschäftes Jos. Math. Löwenthal (1900 / 1902)
 Anzeige
in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1900: Anzeige
in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1900:
"Suche für mein gemischtes Warengeschäft, Samstags und Feiertage
geschlossen, einen
Lehrling.
Kost und Logis im Hause.
Jos. Math. Löwenthal, Hörstein, Bayern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900:
"Lehrling
und ein angehender Commis gesucht.
Mathias Löwenthal,
Manufakturwaren-, Herren- und
Knaben-Kleider-Fabrik- und Maß-Geschäft,
Hörstein, Bayern." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1901:
"Lehrling gesucht.
Mathias Löwenthal,
Manufaktur- und Herrenkleider-Geschäft,
Hörstein, Bayern." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. November 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. November 1901:
"In meinem gemischten Warengeschäfte, Samstags und Feiertage
geschlossen, suche einen
Lehrling.
Kost und Logis im Hause.
Jos. Math. Löwenthal, Hörstein,
Bayern." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1902: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1902:
"Lehrlingsstelle offen
bei Mathias Löwenthal
Manufakturwaren- und Herrenkleider. Hörstein (Bayern)." |
Anzeige des gemischten Warengeschäftes von Jacob Rothschild I (1903)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903:
"Suche für mein gemischtes Waren-Geschäft, samstags und Feiertage
streng geschlossen, einen
Lehrling.
Jacob Rothschild I.,
Hörstein in
Bayern." |
Lehrlingsstelle gesucht - Anzeige von Kusel Rothschild (1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1904:
"Lehrling
sucht Stelle in Samstags geschlossenem Hause. Derselbe besuchte 3
Jahre die Handelsschule; Stellung in einer kleineren Stadt mit Kost und
Logis im Hause gewünscht. Manufakturwarenbranche bevorzugt. Offerten
an
Kusel Rothschild,
Hörstein bei Aschaffenburg." |
Todesanzeige von Max Rothschild (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1925:
"Gestern starb in Düsseldorf nach kurzem, schweren Leiden mein
geliebter Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1925:
"Gestern starb in Düsseldorf nach kurzem, schweren Leiden mein
geliebter Sohn, unser guter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe
Herr Max Rothschild im Alter von 33 Jahren.
Hörstein/Bayern, Halberstadt, Oberseemen
den 21. Juli 1925.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen Jeanette
Rothschild." |
Verlobungsanzeige von Selma Hamburger und Julius
Neuhaus (1927)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Dezember 1927:
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 2. Dezember 1927:
"Statt Karten!
Selma Hamburger - Julius Neuhaus.
Verlobte.
Hörstein bei Aschaffenburg - Baumbach
(Bezirk Kassel) Dezember 1927" |
Verlobungsanzeige von Nelli Löwenthal und Martin Lehmann (1928)
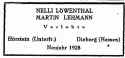 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1927: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1927:
"Nelli Löwenthal - Martin Lehmann - Verlobte.
Hörstein
(Unterfranken) - Dieburg (Hessen) - Neujahr 1928." |
Verlobungsanzeige von Feny Hahn und Willi Rothschild
(1928)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928:
"Feny
Hahn - Willi Rothschild. Verlobte.
Külsheim (Baden) - Hörstein
(Unterfranken)." |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
von Reni Strauss,
geb. in Hörstein |

|
|
| |
Kennkarte für Reni
Strauss (geb. 10. März 1917 in Hörstein, später wohnhaft in Mainz
und Frankfurt),
1941 nach unbekannt deportiert und umgekommen |
|
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein
Betsaal beziehungsweise eine Synagoge vorhanden. 1824 musste die jüdische Gemeinde in Hörstein die Baufälligkeit ihres
Bethauses feststellen. Im Hinblick auf einen notwendigen Neubau waren zu dieser
Zeit schon 1.400 Gulden an Spenden gesammelt worden. Somit dürfte der
Synagogenbau in den folgenden Jahren verwirklicht worden sein. Ein Bericht zur
Einweihung und das genaue Datum der Einweihung ist nicht bekannt.
Von Ludwig Löwenthal (geb. 1895): Erinnerungen an Hörstein und Besuch in der
Synagoge (1905)
 Leserbrief
im ""Frankfurter Israelitischen Familienblatt" Heft 4 1905: "Lieber
Schreibonkel! Leserbrief
im ""Frankfurter Israelitischen Familienblatt" Heft 4 1905: "Lieber
Schreibonkel!
Sehr freute ich mich, als ich Ferien bekam, denn ich wusste, dass ich nach
Hörstein, in meine frühere Heimat, zu meinen lieben Großeltern
durfte. Also will ich Dir den Schabbos, welchen ich bei meinen Großeltern
verlebte, schildern. Denn der Schabbos zu Hause ist doch nicht so schön:
'Während die Großmama die Lichter anzündete, ging ich mit meinem Großpapa,
meinem jüngeren Bruder und meinem 8 Jahre alten Onkel zur Synagoge. Als
dieselbe aus war, gingen wir nach Hause. Hier wurden wir von den lieben
Großeltern gebenscht. Dann machte der liebe Großpapa Kidusch; während dessen
alle im Zimmer ruhig waren. Darnach wurde gegessen. Wenn Du einmal so ein
zappelndes Völkchen hättest sehen wollen, so ist es schade, dass Du am
Freitag Abend nicht dabei gewesen bist. Denn wie wir herumtollten, ich
glaube, so dürfen es wenige Kinder tun. Dafür wurden wir von unseren Tanten
tüchtig geschimpft. Sie sagten: 'Wenn ihr nicht sofort ruhig seid, so jagen
wir euch ins Bett.' Damit wir noch aufbleiben durften, gingen wir zu unserem
Onkel, der unten im Hause wohnt. Auch hier verhielten wir uns lustig. Dann
mussten wir uns zu Bette begeben.
Schabbos Morgen mussten wir etwas früher aufstehen, um rechtzeitig in die
Synagoge zu kommen. Als dieselbe aus war, gingen wir spazieren. Den ganzen
Nachmittag spielte ich mit meinen früheren Schulkollegen. Unser Spiel wurde
durch das Minchagebet unterbrochen. Dann spielten wir wieder weiter, bis es
dunkel wurde und wir wieder in die Synagoge gingen. Als die Synagoge aus
war, machte der liebe Großpapa Habdala aus. Hierauf würden wir gebenscht und
wünschten uns gegenseitig: 'Gut' Woch!"
Ludwig Löwenthal, 10 Jahre alt, zurzeit in Hörstein (Bayern)." |
1909 wurde die Synagoge umfassend renoviert. Architekt war Adolf
Scholl aus Aschaffenburg. Vom 3.-5. September 1909 waren die
Einweihungsfeierlichkeiten. Die Einweihung und die Festpredigt übernahm
Rabbiner Dr. Breuer aus Aschaffenburg. Die Zeitschrift "Der Israelit"
berichtete in ihrer Ausgabe vom 23. September 1909 über das Ereignis:
 Hörstein,
9. September (1909). Am 3.,4. und 5. dieses Monats fand dahier eine seltene
Feier, die Einweihung der renovierten Synagoge statt, an welcher alle
Ortsbürger regen Anteil nahmen. Die Häuser der Hauptstraßen hatten
Festschmuck angelegt. Von nah und fern waren zahlreiche Festgäste erschienen,
darunter der Herr Königlicher Bezirksamtmann und Herr Königlicher Geistlicher
Rat und Dekan von Alzenau. Hörstein,
9. September (1909). Am 3.,4. und 5. dieses Monats fand dahier eine seltene
Feier, die Einweihung der renovierten Synagoge statt, an welcher alle
Ortsbürger regen Anteil nahmen. Die Häuser der Hauptstraßen hatten
Festschmuck angelegt. Von nah und fern waren zahlreiche Festgäste erschienen,
darunter der Herr Königlicher Bezirksamtmann und Herr Königlicher Geistlicher
Rat und Dekan von Alzenau.
Nachmittags 3/4 4 bewegte sich der Festzug, an dem sich die ganze
Kultusgemeinde, die Gemeinde- und Kirchenverwaltung, sämtliche Vereine und eine
große Anzahl anderer Bürger Hörsteins, sowie die auswärtigen Festgäste
beteiligten, von einem Musikchor, der Schuljugend und den Festdamen eröffnet,
zur Wohnung des Herrn Kultusvorsteher Raphael Rothschild III., von wo die
feierlich geschmückten Torarollen abgeholt und in die Synagoge getragen wurden.
Vor dem Synagogeneingang hielt der Kultusvorsteher eine kleine Ansprache, in
welcher er Herrn Lehrer Israel Wahler den Dank der Gemeinde zum Ausdruck brachte
für die großen Verdienste, die sich dieser um die Renovierung erworben. Der
Bezirksamtmann beglückwünschte nach einem vorgetragenen Prologe die
Kultusgemeinde zu ihrem schönen Gotteshause, sprach seine Anerkennung über
ihre Opferwilligkeit aus und übergab hierauf den Schlüssel Herrn Rabbiner Dr.
Breuer - Aschaffenburg.
Herr Dr. Breuer ging in seiner meisterhaft durchgeführten Festpredigt von dem
Psalmvers aus: "Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Höfe mit Lob,
danket und segnet seinen Namen!" und sprach über die Bedeutung des
Gebetes.
Nach dem Festgottesdienst begaben sich alle Teilnehmer im Zuge zum Festbankett
in die Gartenwirtschaft "Zum Ritter". Hier hielt Herr Lehrer Wahler
eine längere Ansprache, in der er alle Anwesenden begrüßte und allen
Mitarbeitern an dem Renovierungswerk, besondern dem verdienstvollen Leiter des
Ganzen, Herrn Architekten Adolf Scholl in Aschaffenburg, dem Kultusvorstand und
den zahlreichen Spendern den Dank der Gemeinde übermittelte. Herr Pfarrer
Klement wies auf das harmonische Zusammenleben der hier wohnenden Konfessionen
hin und beglückwünschte die Kultusgemeinde namens der katholischen
Kirchengemeinde. Herr Lehrer B. Wechsler aus Alzenau überbrachte die Grüße und
Glückwünsche unserer Nachbargemeinde. Herr Salli Löwenthal brachte einen
Toast auf Herrn Lehrer Wahler aus.
|
Die Synagoge blieb Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens bis 1938.
Der nationalsozialistische Terror richtete sich schon bald nach 1933
gegen die Hörsteiner Synagoge. Im Februar und Mai 1936 wurden die
Fenster der Synagoge eingeworfen. Anfang Juni 1938 wurden - am Tage vor
dem Wochenfest Schawuoth - die meisten Silberschmuckstücke der
Torarollen gestohlen. Am Neujahrsfest 1938 (26. September) wurden
wiederum die Fenster der Synagoge eingeworfen; in den Straßen wurde
"Schneidet den Juden die Hälse ab!" gerufen. Da in der Synagoge kein
Gottesdienst mehr abgehalten werden konnte, brachten die in Hörstein noch
lebenden Juden eine Torarolle aus der Synagoge in ein Privathaus, um hier
Gottesdienst abhalten zu können. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
geschändet, blieb jedoch insgesamt erhalten. Die Inneneinrichtung und die
Ritualien wurden völlig vernichtet. Wenig später wurde sie von der
Ortsverwaltung beschlagnahmt.
Nach 1945
wurde das Gebäude zunächst als Feuerwehrhaus zweckentfremdet. 1982 wurde es
abgebrochen. Das Grundstück wurde teilweise von einer Bäckerei überbaut.
Die steinernen Gebotstafeln vom Giebel der Synagoge wurden gesichert und in das Heimatmuseum
Alzenau verbracht.
Adresse/Standort der Synagoge: früheres Haus Nr. 37, heute
Grundstück Hauptstraße 29.
Fotos
Historische Postkarte
von
Hörstein mit Synagoge
(Sammlung Hahn) |

 |
 |
| |
Im Jahr 1900 gelaufene
historische Ansichtskarte
mit Ausschnitt: Synagoge und Schule |
Rückseite der Karte, die
am 26. August 1900 von
Dettingen (Poststempel) nach Nürnberg versandt wurde |
| |
|
|
Weitere historische
Abbildungen
(links aus der Sammlung von Harald Weis,
bzw. Fotos rechts Stadtarchiv Alzenau) |
 |

|
| |
Links das Anwesen des
Händlers und Färbers
Sally Rothschild in der Hauptstraße
in Hörstein (vermutlich vor 1935)
|
Fam. Josef und Moritz
Löwenzahn (Metzger): von links Berta und Moritz mit Tochter Nelly, sitzend
Josef, Enkelin Betty, auf dem Rad Siegfried, ganz rechts Ida Löwenthal. Oben
an der Wand lehnend, Selma Wallerstein |
| |
|
|
Die Synagoge in Hörstein
(Quelle: www.hoerstein.info) |
 |
 |
| |
Außenansicht |
Innenansicht |
| |
|
|
Die Gebotstafeln der
ehemaligen Synagoge
(Fotos: Gerhard Sittinger, Hörstein,
www.hoerstein.info) |
 |
 |
| |
Die Gebotstafeln
der ehemaligen Synagoge in Hörstein, die in den Giebel der Außenwand
eingemauert waren (heute im Museum der Stadt Alzenau; rechts die
dortige Erklärungstafel;
Seite
zum Museum auf www.alzenau.de). |
| |
|
|
Aktuelle Fotos vom
Synagogengrundstück usw. werden noch erstellt; über Zusendungen freut
sich der Webmaster;
Adresse auf der Eingangsseite. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 468-469. |
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 323-324. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 67. |
 | Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen
Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche
Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.
Würzburg 2008. S. 86. |
 | 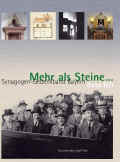 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband
III: Unterfranken, Teil 1.
Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.
von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff
in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-89870-449-6.
Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite
von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.
Abschnitt zu Hörstein S. 92-111.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Hoerstein Lower Franconia. The community was founded in the
mid-18th century. A synagogue was built around 1817. The Jewish population
remained stable and even grew in the 19th century, numbering 128 in 1900 (total
1,191). In 1933, 98 remained, living in traditional religious life. Jews were
beaten by the SS in 1933; the cemetery was desecrated in 1936 and 1937; and the
windows of the synagogue and Jewish homes were smashed in September 1938. Most
Jews left in 1938. In the 1935-40 period, 44 emigrated, including 21 to the
United States, and 46 left for other German cities, including 35 for Frankfurt.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|