|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"
Kreuzlingen (Kanton
Thurgau, CH)
Jüdische Geschichte / Betsaal
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Kreuzlingen lebten seit ca. 1890 wenige jüdische Familien. Dazu gründeten
einige in Konstanz wohnende jüdische Gewerbetreibende mehrere Fabrikations- und
Handelsbetriebe in der schweizerischen Nachbarstadt (u.a. Mechanische
Strumpfwarenfabrik, später Mechanische Strickwarenfabrik Pius Wieler Söhne AG,
Korsettenfabrik Gebr. Heinrich und Sigmund Schwarz; En-Gros-Firma J. & M.
Lion; Eisengroßhandlung Gebr. Spiegel; Eisenwaren usw. Max Schriesheimer,
Schuhhaus Haberer; mehrere Manufakturwarenhandlungen, Darmgroßhandlungen usw.).
Weitere Familien aus dem Aargau und aus Konstanz zogen nach Kreuzlingen während
und nach dem Ersten Weltkrieg zu. Die in Kreuzlingen lebenden jüdischen
Personen waren in der Folgezeit überwiegend Mitglieder der Israelitischen
Gemeinde in Konstanz, wo auch die Gottesdienst besucht wurden. Die Kinder der jüdischen
Familien erhielten den Religionsunterricht gleichfalls in Konstanz.
Eine jüdische Gemeinde in Kreuzlingen besteht erst seit 1939. Sie
entstand mit der Zunahme jüdischer Einwohner in der Stadt nach 1933 durch die
Emigration einiger deutscher, insbesondere Konstanzer Juden. 1936 wurde
zunächst eine "Jüdische Friedhofs-Gemeinschaft" im Blick auf
die Anlage eines jüdischen Friedhofes
in Kreuzlingen gebildet. Die "Israelitische Gemeinde Kreuzlingen"
(seit 1965 "Jüdische Gemeinde Kreuzlingen") wurde am 23.
August 1939 gegründet. Im Frühjahr 1938 wurden in 43 Haushaltungen
Kreuzlingens 91 jüdische Erwachsene mit 17 Kindern bzw. Jugendlichen gezählt.
1939 stieg die Zahl der jüdischen Einwohner auf etwa 130 Personen.
An Einrichtungen gab es fortan einen Betsaal (s.u.), eine Religionsschule
und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde kam regelmäßig ein Rabbiner
beziehungsweise ein jüdischer Lehrer / Kantor einer auswärtigen Gemeinde
(Winterthur, Zürich) nach Kreuzlingen. Nach 1939 war zunächst Rabbiner Dr.
Lothar Rothschild aus St.
Gallen für Kreuzlingen zuständig. Er übernahm auch den
Religionsunterricht der jüdischen Kinder in Kreuzlingen.
Erster Präsident der Israelitischen Gemeinde Kreuzlingens war von 1939
bis 1941 Albert Schwab, gefolgt 1941 bis 1952 von Robert Wieler.
In der Zeit des Zweiten Weltkrieges - nach der Deportation der badischen Juden
im Oktober 1940 - organisierte die Israelitische Gemeinde Kreuzlingen
Kreuzlingen eine großartige materielle und moralische Unterstützungsaktion für
die Deportierten.
Von den in Kreuzlingen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen ist in der NS-Zeit
umgekommen (Angabe nach den Listen des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha (Bertel) Cohn (geb.
1893 in Kreuzlingen, wohnhaft in Konstanz, 1940 nach Gurs deportiert, August
1942 in das KZ Auschwitz). Anfang Februar 1945 kamen in einem Sondertransport
aus dem KZ Theresienstadt 1200 jüdische Personen über Kreuzlingen in die
Schweiz; drei Personen starben in
Kreuzlingen und wurden auf dem Friedhof der Gemeinde beigesetzt.
In den Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges bestand die jüdische
Gemeinde in Kreuzlingen fort. Es gab mehrere jüdische Vereine in der Gemeinde
wie den Wohltätigkeits- und Bestattungsverein Chevra Kadischa, den Frauenverein, eine jüdische
Jugendgruppe (Mitglied der jüdischen Jugendorganisation Hanoar
Haboneh) und eine Ortsgruppe der WIZO. Die Zahl
der jüdischen Gemeindeglieder nahm jedoch - vor allem durch die Überalterung
der Gemeinde und durch Wegzug in größere Städte - ständig ab. Um 1970 gehörten noch etwa
50 Personen zur jüdischen Gemeinde Kreuzlingen.
Präsident der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen war von 1952 bis 1976 Herbert
Dreifuss.
Die Gottesdienste im Betsaal der Gemeinde wurden ehrenamtlich
geleitet. Zu den Hohen Feiertagen wurde ein Vorbeter (Chasan) aus einer anderen
Gemeinde engagiert. Nach den Gottesdiensten traf man sich zu Kidduschim und
geselligen Zusammenkünften, teilweise in privaten jüdischen Häusern, seit den
1990er-Jahren einige Zeit in einem oberen Nebenzimmer des Restaurants
"Bären" in Kreuzlingen.
Im Herbst 1968 flüchteten einige jüdische Familien aus der damaligen
Tschechoslowakei nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Schweiz; mehrere ließen sich in Kreuzlingen nieder.
1989 konnte das 50-jährige Bestehen der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen
gefeiert werden; damals zählte die Gemeinde noch 17 Mitglieder. 2009
wurde das 70-jährige Bestehen gefeiert. Letzteres stand jedoch unter dem
Vorzeichen einer bereits teilweisen Auflösung der Gemeinde, nachdem im
September 2009 der Betsaal aufgegeben werden musste (siehe unten).
Seit 2009 teilten sich das Präsidium der kleinen Gemeinde Dr. Rolf Hilb
und Prof. Erhard Roy Wiehn. Zum Jahresende 2015 bzw. zum 1.
Januar 2016 wurde die jüdische Gemeinde Kreuzlingen aufgelöst.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte zu
einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Spende zum Synagogenbau in Horb von Fabrikant Hermann
Schwarz (1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1927: "Horb
am Neckar. Der aus Horb stammende Fabrikant Hermann Schwarz in
Kreuzlingen (Schweiz) hat seine Anhänglichkeit und Gebefreudigkeit
von Neuem wieder bewiesen, indem er zum Synagogenbau die reiche Gabe von
300 Mark gestiftet hat. Schwarz hat besonders in der Kriegszeit der
hiesigen Armen häufig gedacht und wiederholt große Schenkungen an die
hiesige Stadtgemeinde gelangen lassen, wofür ihm die Stadtgemeinde
öffentlich den Dank ausgesprochen hat. Seine Stiftung als 1. Gabe zum
bevorstehenden Synagogenbau hat bei allen Israeliten hier große Freude
wachgerufen, wofür ihm die ganze Gemeinde den herzlichsten Dank ausspricht.
Möchten auch andere aus dem Schoße der Gemeinde hervorgegangene
Glaubensbrüder diesem edlen Beispiel nachahmen."
Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Mai 1927: "Horb
am Neckar. Der aus Horb stammende Fabrikant Hermann Schwarz in
Kreuzlingen (Schweiz) hat seine Anhänglichkeit und Gebefreudigkeit
von Neuem wieder bewiesen, indem er zum Synagogenbau die reiche Gabe von
300 Mark gestiftet hat. Schwarz hat besonders in der Kriegszeit der
hiesigen Armen häufig gedacht und wiederholt große Schenkungen an die
hiesige Stadtgemeinde gelangen lassen, wofür ihm die Stadtgemeinde
öffentlich den Dank ausgesprochen hat. Seine Stiftung als 1. Gabe zum
bevorstehenden Synagogenbau hat bei allen Israeliten hier große Freude
wachgerufen, wofür ihm die ganze Gemeinde den herzlichsten Dank ausspricht.
Möchten auch andere aus dem Schoße der Gemeinde hervorgegangene
Glaubensbrüder diesem edlen Beispiel nachahmen." |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1927: "Horb.
Die hochherzige Spende des Herrn Fabrikanten Hermann Schwarz von Kreuzlingen
(Schweiz) zum Synagogenbau-Fonds beträgt (nicht 300 Mark wie in voriger
Nummer zu lesen, sondern) 500 Mark. Möge das schöne Vorbild bald
Nachahmer finden."
Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1927: "Horb.
Die hochherzige Spende des Herrn Fabrikanten Hermann Schwarz von Kreuzlingen
(Schweiz) zum Synagogenbau-Fonds beträgt (nicht 300 Mark wie in voriger
Nummer zu lesen, sondern) 500 Mark. Möge das schöne Vorbild bald
Nachahmer finden." |
Weitere Berichte
| April 2012:
Zum Tod von Robert Wieler |
| Robert Wieler (geb. 12. November
1912, gest. 8. April 2012) war Mitbegründer der
jüdischen Gemeinde in Kreuzlingen. Seine Vorfahren stammten aus Randegg.
Er ist als Jugendlicher mit seinen Eltern 1923 von Konstanz nach
Kreuzlingen gezogen. Sein Vater betrieb in Kreuzlingen eine
Strickwarenfabrik, die später gemeinsam von seinem Sohn Robert und dessen
Cousin Ernst Wieler und seiner Frau übernommen wurde
("Strickwarenfabrik Pius Wieler Söhne"). Robert Wieler und
seine Familie setzten sich in der NS-Zeit und danach für zahlreiche über
die Grenze in die Schweiz geflüchtete Menschen ein. Nach der
Zwangsauflösung der jüdischen Gemeinde Konstanz war er Mitbegründer der
jüdischen Gemeinde in Kreuzlingen (vgl. oben) und war über zehn Jahr
Präsident der Gemeinde. Ende der 1970er-Jahre verzog die Familie nach
Israel. Robert Wieler verstarb im April 2012 in
Jerusalem. |
Dazu: Artikel von René Hornung im
"Südkurier" vom 19. April 2012: "Ein Jahrhundert
miterlebt und mitgeprägt.
Robert Wieler, Mitbegründer der jüdischen Gemeinde in Kreuzlingen, ist
im Alter von 99 Jahren in Jerusalem gestorben..."
Link
zum Artikel
Vgl. auch den Artikel von Michael Lünstroth im "Südkurier" vom
30. Dezember 2006: "Konstanz - Jerusalem - Konstanz."
Der Artikel berichtet von einem Buch, das Robert Wieler 1938 aus der
Jüdischen Jugendbibliothek Konstanz ausgeliehen hatte, die wenig später
von der Gestapo beschlagnahmt wurde.
Link
zum Artikel |
| |
| Januar 2016:
Die jüdische Gemeinde wird aufgelöst |
Artikel von Peter Bollag in der
"Jüdischen Allgemeinen" vom 7. Januar 2016: "Der letzte
Beter macht das Licht aus. Kleinstgemeinde Kreuzlingen schließt zum
Jahresanfang ihre Pforten..."
Link
zum Artikel |
Zur Geschichte der Synagoge
Seit 1934 wurden regelmäßige Gottesdienste sowie
Bar-Mizwa- und Jahrzeitfeiern in jüdischen Privatwohnungen
in Kreuzlingen abgehalten. Nach dem Anschlag auf die Konstanzer Synagoge 1936
und der Zerstörung der Synagoge beim Novemberpogrom 1938 wurden zunehmend
Gottesdienste in Kreuzlingen abgehalten. An den Hohen Feiertagen 1938 hielt
Rabbiner Dr. Lothar Rothschild aus Basel (ehem. Saarbrücken, später
St. Gallen) die Gottesdienste im Betlokal der
Pfingstmission in der Brückenstraße. Ein Jahr später - im September 1939 -
konnten die Gottesdienste zu den Hohen Feiertagen bereits im neuen Betsaal in
der Kreuzlinger Hafenstraße abgehalten werden.
Der Betsaal war einfach eingerichtet. Er hatte acht Sitzreihen mit je
fünf Plätzen links und vier Sitzreihen mit je vier Plätzen rechts, zusammen
56 Plätze. Hinter den Bankreihen waren Stühle und Stehplätze für etwa 14
Personen. Insgesamt gab es Platz für etwa 70 Personen. Der Toraschrein, ein
hoher, massiver, brauner Schrank enthielt drei Torarollen, zwei davon mit alten
Kronen und Toraschilden. Diese stammte aus der 1938 zerstörten Synagoge von Wangen
am Untersee.
Nach 1989 wurden von der Gemeinde noch vierteljährliche Schabbat-Gottesdienste
abgehalten sowie ein Sederabend und Gottesdienste zu den Hohen Feiertagen. Die
Gottesdienste wurden geleitet: 1983 bis 1990 von Rabbiner Harry Jacobi, von 1990
bis 1994 von Rabbiner Dr. Israel Aharon Ben Yosef, bis 1997 (auch auch wieder im
Herbst 2009) von Avner Asraf (Uster), von 1996 bis Ende 2009 von Rabbiner Dr.
h.c. Tovia Ben-Chorin (St. Gallen).
Der Betsaal in der Hafenstraße war genau 70 Jahre lang Mittelpunkt des
jüdischen Gemeindelebens in der Stadt. Nach dem starken Rückgang der
jüdischen Einwohner in der Stadt wurde der Betsaal nach den Hohen Feiertagen im
September 2009 aufgegeben. Der Toraschmuck wurde dem Jüdischen Museum Basel
überreicht; zwei Torarollen wurden an liberale jüdische Gemeinden als
Dauerleihgaben gegeben (Communauté Israélite Libérale de Genève und
Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch Zürich), die dritte Torarolle und
weiteres Inventar des Betsaales kamen als
Dauerleihgabe in das Museum des "Vereins für jüdische Geschichte
Gailingen e.V.".
Gottesdienste der noch bis Ende 2015 bestehenden Jüdischen Gemeinde in Kreuzlingen sowie
religiöse und gesellige Zusammenkünfte wurden nach Auflösung des Betsaales nach Bedarf in
anderen Räumen abgehalten.
Adresse/Standort der Synagoge: Hafenstraße 42
Fotos
(Quelle: Erhard Roy Wiehn (Hrsg.) s. Lit.
S. 13-14, hinteres Umschlagbild; alle Fotos von Rolf Hilb)
 |
 |
 |
Blick in den Betsaal, links
der
Toraschrein, in der Mitte das Vorlesepult |
Blick zum
Toraschrein |
Die zuletzt drei Torarollen
mit silbernen Toraschmuck |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Gottesdienst mit
Rabbiner
Dr. h.c. Tovia Ben Chorin 2009 |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 |  Erhard
Roy Wiehn (Hg.): Jüdische Gemeinde Kreuzlingen. 70 Jahre.
Geschichte, Erinnerungen, Dokumente 1939-2009. Hartung-Gorre Verlag
Konstanz. 2009. Erhard
Roy Wiehn (Hg.): Jüdische Gemeinde Kreuzlingen. 70 Jahre.
Geschichte, Erinnerungen, Dokumente 1939-2009. Hartung-Gorre Verlag
Konstanz. 2009.
Vorstellung
des Buches auf einer Seite des Hartung-Gorre-Verlages |
 | Monica Rüthers: factsheet zur jüdischen Geschichte
in Kreuzlingen. 2009. Online
zugänglich (pdf-Datei). |
 | Fritz Barth: Geheimverhandlungen
kurz vor Kriegsende in Wildbad im Schwarzwald (zum Transport von Juden
aus KZ-Lagern in die Schweiz Anfang 1945).: online
zugänglich. |
 |  Marie-Elisabeth
Rehn: Hugo Schriesheimer. Ein jüdisches Leben von Konstanz durch das
KZ Dachau, das französische Internierungslager Gurs, das Schweizer Asyl und
die USA nach Kreuzlingen. 1908-1989. Konstanz (Hartung-Gorre Verlag)
2011. Marie-Elisabeth
Rehn: Hugo Schriesheimer. Ein jüdisches Leben von Konstanz durch das
KZ Dachau, das französische Internierungslager Gurs, das Schweizer Asyl und
die USA nach Kreuzlingen. 1908-1989. Konstanz (Hartung-Gorre Verlag)
2011.
130 S. ISBN 978-3-86628-373-2 18,50 € - 24,00 CHF. Nähere
Informationen. |
 | Gregor Spuhler: Gerettet - zerbrochen. Das Leben des
jüdischen Flüchtlings Rolf Merzbacher zwischen Verfolgung, Psychiatrie und
Wiedergutmachung. Chronos-Verlag. Zürich 2011. 229 S. SFr. 34.-
Dazu Presseartikel/Buchbesprechung von Urs Hafner in der "Neuen
Zürcher Zeitung" vom 5. August 2011 über die Geschichte des nach
Kreuzlingen geflüchteten Rolf (Rudolf) Merzbacher:
"'Gerettet und doch zerbrochen' Das Schicksal des jüdischen
Flüchtlings Rolf Merzbacher. In der Schweiz fand der junge Rolf
Merzbacher Zuflucht vor den Nazis, erkrankte aber psychisch schwer. Gregor
Spuhler verknüpft seine behutsame Biografie des jüdischen Flüchtlings mit
Fragen der Ausländerpolitik und Wiedergutmachung..."
Link zum Artikel
in der Neuen Zürcher Zeitung - auch eingestellt
als pdf-Datei. |
 | 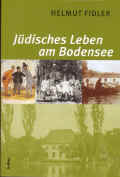 Helmut Fidler: Jüdisches Leben am Bodensee.
Verlag Huber Frauenfeld - Stuttgart - Wien 2011. 320 S. zahlreiche
Abbildungen. Verlag: www.verlaghuber.ch
mit Infoseite
zum Buch. ISBN 978-3-7193-1392-0. 29,90 € 39,90
CHF Helmut Fidler: Jüdisches Leben am Bodensee.
Verlag Huber Frauenfeld - Stuttgart - Wien 2011. 320 S. zahlreiche
Abbildungen. Verlag: www.verlaghuber.ch
mit Infoseite
zum Buch. ISBN 978-3-7193-1392-0. 29,90 € 39,90
CHF
Wenn aus Fremden Nachbarn werden. Zwei Generationen nach dem Zweiten
Weltkrieg und dem Ende des Holocaust geht Helmut Fidler einen
ungewöhnlichen Weg, um achthundert Jahre jüdische Geschichte in der
Bodenseeregion zu beschreiben. Er sucht die Orte auf, an denen jüdisches
Leben heute noch sichtbar, nach-erlebbar und begreifbar ist, erzählt von
Personen, die hier gelebt haben, und von Ereignissen, die in Erinnerung
geblieben sind. |
 |  Erhard Roy
Wiehn (Hg.): Die bittere Not begreifen. Deutsch-jüdische Deportiertenpost
aus südfranzösischen Internierungslagern im Kontext der Hilfsaktion der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen
Thurgau/Schweiz rund 75 Jahre danach zur Erinnerung 1940–1945. Vorwort von Margot Wicki-Schwarzschild.
Transkription Birgit Arnold. 1. Aufl. 2016. 264 Seiten.. € 24,80. ISBN 978-3-86628-571-2 Erhard Roy
Wiehn (Hg.): Die bittere Not begreifen. Deutsch-jüdische Deportiertenpost
aus südfranzösischen Internierungslagern im Kontext der Hilfsaktion der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen
Thurgau/Schweiz rund 75 Jahre danach zur Erinnerung 1940–1945. Vorwort von Margot Wicki-Schwarzschild.
Transkription Birgit Arnold. 1. Aufl. 2016. 264 Seiten.. € 24,80. ISBN 978-3-86628-571-2
Aus dem Vorwort von Erhard Roy Wiehn (Herausgeber): Im vorliegenden Sammelband
Die bittere Not begreifen publizieren wir 30 Dokumente der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen (Thurgau/Schweiz) und des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, vor allem aber Briefe und Postkarten (insgesamt ca. 190) aus dem Camp de Gurs (110), aus Noé (23), Pontacq (17), Récébédou (14), Rivesaltes (7), Les Milles (5) und aus sonstigen Orten (14) an die Jüdische Gemeinde Kreuzlingen
Eine Besonderheit sind die 47 Briefe von Rosa Schriesheimer an ihren Sohn Hugo Schriesheimer, der im Oktober 1942 in die Schweiz gelangen konnte. Diese Sammlung ist nicht vollständig, weil nach meiner ersten Verarbeitung von Deportiertenpost in Oktoberdeportation 1940 ein Teil der Sammlung der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen vermutlich nach Yad Vashem (Jerusalem) gegeben wurde. Aber auch die hier abgedruckte Post sagt genug über den grausamen Leidensweg der Menschen von Konstanz nach und durch Gurs und andere Deportiertenlager und für viele weiter nach Auschwitz.
Die Briefe geben einen Einblick in die Notlage der Deportierten, zeugen aber auch von ihrer Dankbarkeit für materiellen und seelischen Beistand seitens der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen.
Die erstaunlich schnell angelaufene und mehr als vier Jahre durchgehaltene Hilfsaktion der Jüdischen Gemeinde Kreuzlingen in Verbindung mit dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund in Form von Lebensmitteln und Geldspenden – zumal unter den damaligen schwierigen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Schweiz wie in ganz Europa – erwuchs nicht nur aus guter alter jüdischer Tradition, sondern hing auch damit zusammen, dass jüdische Familien in Kreuzlingen bis ca. 1938 Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Konstanz waren, und überdies gab es enge verwandtschaftliche Verbindungen. Die Jüdische Gemeinde Kreuzlingen wurde nach der Zerstörung der Konstanzer Synagoge am 9./10. November 1938 anno 1939 gegründet, der jüdische Friedhof der Gemeinde in Kreuzlingen-Bernrain war bereits 1937 bezugsfertig, da keine Schweizer Juden mehr auf dem jüdischen Friedhof in Konstanz beerdigt werden wollten. Nachdem sich die Jüdische Gemeinde Kreuzlingen nach dem biologischen Lauf der Dinge aus Mitgliedermangel 2016 auflöste, bleiben (neben einigen Erinnerungsstücken im Jüdischen Museum Gailingen am Hochrhein) der jüdische Friedhof Bernrain und unsere Publikationen als Denkmale für ihre 77-jährige Existenz in schweren wie in guten
Zeiten. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|