|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Merchingen (Stadt
Ravenstein) mit Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als Besitz der
Herren von Berlichingen zum Ritterkanton Odenwald gehörenden Merchingen bestand
eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17.
Jahrhunderts zurück. Bisweilen angestellte Vermutungen, dass bereits im
Mittelalter Juden am Ort lebten (während einer Verfolgung von Krautheim nach
Merchingen geflohene Personen), ließen sich bislang nicht bestätigen.
1740 lebten 40 jüdische Familien am Ort (210 Personen).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1809 31 jüdische Familien, 1812 68 Familien, 1825 250 jüdische
Einwohner (26,0 % von insgesamt 962 Einwohnern), 1849 Höchstzahl mit 325
jüdischen Einwohnern, 1875 218 (19,5 % von insgesamt 1.116), 1900 101 (10,4
% von 967), 1910 74 (8,1 % von 910).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule (bis zur Einrichtung einer gemischt-konfessionellen Schule 1869
eine Elementarschule), ein rituelles Bad (in einem kleinen zweigeschossigen
Häuschen bei der Schafbrücke, Ulmenstraße 5, um 1960 abgebrochen, in einer
angebauten Remise wurde ein Sargwagen aufgewahrt) und einen Friedhof. Zur Besorgung
religiöser Aufgaben der Gemeinde war (neben dem Bezirksrabbiner) ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Bei der
Einteilung der badischen Rabbinatsbezirke wurde Merchingen Sitz eines Bezirksrabbinates, dem im Laufe der Zeit bis zu 19 jüdische Gemeinden angehörten,
darunter Adelsheim, Walldürn und Buchen.
Seit 1886 wurde das Rabbinat Merchingen vom Bezirksrabbinat Mosbach
aus versehen. Das
Rabbinatsgebäude stand neben der Synagoge (zuletzt als Wohnhaus genutzt, 1965
abgebrochen, heute Garten bei der Synagoge).
Als Bezirksrabbiner in Merchingen amtierten: Zacharias Staadecker (1832-1857),
Dr. Julius Fürst (1858-1860), Baruch Hirsch Flehinger (1861-1886) sowie - noch
unter Bezirksrabbiner Flehinger als Rabbinatsvikar (bzw. Rabbinatsverweser) Dr. Louis
Heilbut (1883-1884). 1884 wurde die Stelle noch einmal ausgeschrieben
(s.u.), 1885 jedoch gemeinsam mit dem Bezirksrabbinat in Wertheim und wenig
später mit dem seit 1886 in Mosbach tätigen und
von dort aus auch für die Rabbinatsbezirke Wertheim und Merchingen tätigen Rabbiner Dr.
Leopold Löwenstein besetzt (vgl. dazu unten im Bericht zum Tod von Abraham
Strauß).
Unter den Lehrern in Merchingen sind zu nennen: Lehrer D. Callner (Kallner;
1882-1909, siehe Artikel unten), Bravmann (1909 oder bereits zuvor bis 1938).
Neben Vieh- und Fruchthandel betrieben die Merchinger Juden Ladengeschäfte oder
betätigten sich als Handwerker.
Auf dem Gefallenendenkmal 1870/71 und 1914/18 beim Schloss und auf einer Wandtafel im Rathaus finden sich auch die Namen und Bilder der jüdischen Gefallenen und Kriegsteilnehmer aus Merchingen.
Im Ersten Weltkrieg sind aus der jüdischen Gemeinde gefallen: Nathan
Kahn (geb. 4.5.1880 in Oberaltertheim, gef. 13.10.1916), Jakob Ostheimer (geb.
27.10.1882 in Merchingen, gest. 26.8.1914 in Gefangenschaft), Martin (Morton)
Rhonheimer (geb. 20.9.1893 in Merchingen, gef. 18.4.1918). Außerdem ist
gefallen: Philipp Kallner (geb. 21.7.1892 in Merchingen, vor 1914 in Mainz
wohnhaft, gef. 28.7.1915)
1924 wurden noch 68 jüdische Einwohner gezählt (7,5 % von insgesamt etwa
900 Einwohnern). Damals waren die Vorsteher der Gemeinde Nathan Ostheimer,
Julius Fleischhacker und Albert Rödelsheimer. Als Religionslehrer, Kantor und
Schochet war Heimann Bravmann tätig. Er unterrichtete an der Religionsschule
der Gemeinde sieben Kinder. Unter den jüdischen Vereinen wird der
Wohltätigkeitsverein Chewra schel Poale touw (Verein der Werke des
Guten) genannt (1924 unter Leitung von Nathan Ostheimer). Zur
jüdischen Gemeinde in Merchingen gehörten auch die 1924 in Osterburken
lebenden acht jüdischen Personen (1896 wird als der Bezirksälteste des
Rabbinatsbezirkes Mosbach Herr Strauß aus Osterburken genannt; 1932 sieben). 1932 gehörten der
jüdischen Gemeinde 62 Personen an, weiterhin unter dem Vorsitz von Nathan
Ostheimer. Auch Lehrer Bravmann war noch in der Gemeinde. Er hatte im Schuljahr
1931/32 neun Kinder in Religion zu unterrichten.
An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels- und Gewerbebetrieben sind bekannt: Schuhgeschäft Simon Falk
(Eichenstraße 2), Metzgerei und Schächterei Adolf Fleischhacker (Eichenstraße
7, abgebrochen), Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäft Nathan Fleischhacker
(Akazienstraße 3), Lebensmittelgeschäft Fam. Götz (Kastanienweg 2, Buchenweg 1/3 abgebrochen), Textilgeschäft Hermine Kahn
(Eichenstraße 12), Textilgeschäft Fam. Levi (Eichenstraße 18), Viehhandlung Fam. Mai (Holunderweg 4), Haferflockenherstellung und Grünkernerzeugung Fa. Rhonheimer (Birnbaumweg 1), Viehhandlung Max Rhonheimer (Buchenweg 17), Schuhgeschäft Albert Rödelsheimer
(Eichenstraße 4).
1933 lebten noch 38 jüdische Personen in Merchingen (4,7 % von insgesamt
827 Einwohner). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der auch in
Merchingen zunehmenden Repressalien und der Entrechung sind in den folgenden
Jahren die meisten jüdischen Einwohner abgewandert oder ausgewandert. 19
konnten in die USA, England und Palästina emigrieren. Die letzten drei
jüdischen Einwohner (Julius und Selma Fleischhacker, Thekla Ullmann) wurden am
22. Oktober 1940 von Merchingen nach Gurs deportiert.
Von den in Merchingen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emilie Adler
geb. Strauß (1869), Jette Buxbaum (1873), Joel (Julius) Emrich (1867, vgl.
Kennkarte unten), Karoline Emrich
(1871), Wolf Emrich (1855), Emil Fleischhacker (1910), Gustav Fleischhacker
(1907), Ida Fleischhacker geb. Weil (1891), Julius Fleischhacker (1880), Nathan
Fleischhacker (1887), Selma Fleischhacker geb. Fleischhacker (1886), Siegmund
Fleischhacker (1883), Emma Grünebaum geb. Ullmann (1871), Emil Gutmann (1870),
Sophie Jacob (1870), Betty Löwenthal geb. Stadecker (1876), Babette Mai (1868),
Bertha Mai geb. Reis (1868), Max Mai (1872), Gerda Meierhof geb. Kuder (1899),
Lina Ostheimer (1874), Lina Rosenthal (1873), Baruch Rothschild (1859), Max
Strauß (1874), Julius Thalheimer (1869), Berta Tänzer geb. Strauß (1876),
Leon Ullmann (1873), Thekla Ullmann geb. Wertheimer (1866), Thekla Woll geb.
Levy (1894).
Im Mai 2012 wurden vor dem Haus Akazienstraße 4 "Stolpersteine"
für das Ehepaar Nathan Fleischhacker und Ida geb. Weil verlegt, die im Hause
gegenüber in der Akazienstraße 3 lebten (vgl. Link zum Pressebericht
unten).
Aus Osterburken werden in den genannten Listen keine Personen genannt.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte des Bezirksrabbinates in Merchingen
Zum Tod von Bezirksrabbiner Zacharias Staadecker (Stadecker, 1857)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1857: "Merchingen,
im Großherzogtum Baden, im August (1857). Nekrolog. Nach längerem Leiden
starb am 25. August, in einem Alten von 58 Jahren, Bezirksrabbiner
Zacharias Staadecker von hier, nachdem derselbe dem diesseitigen Rabbinate
ein Vierteljahrhundert vorgestanden. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. September 1857: "Merchingen,
im Großherzogtum Baden, im August (1857). Nekrolog. Nach längerem Leiden
starb am 25. August, in einem Alten von 58 Jahren, Bezirksrabbiner
Zacharias Staadecker von hier, nachdem derselbe dem diesseitigen Rabbinate
ein Vierteljahrhundert vorgestanden.
Derselbe gehörte entschieden der
Klasse der strenggläubigen Rabbiner an, war aber auch in vielen anderen
Beziehungen ein höchst achtenswerter Charakter. Er suchte zu belehren, zu
überzeugen und seine religiöse Anschauung zu verbreiten; ließ sich aber
da, wo seine lehren keinen Eingang, keinen fruchtbaren Boden fanden, weder
von leidenschaftlichen Ausbrüchen noch gar von Verfolgungen hinreißen.
Nächst
der Toleranz zeichneten ihn Bescheidenheit, Demut und Genügsamkeit aus,
ein Dreigestirn, das wir in unserer Zeit so selten vereinigt finden!
Sein
umfassendes rabbinisches Wissen veranlasste ihn nie zu jener orthodoxen
Arroganz, die viele seinesgleichen kennzeichnet. Auch auf hierin minder
befähigte Kollegen sah er nie gering schätzend herunter, wusste vielmehr
das anderweitige Wissen jener gebührend zu würdigen.
Aber trotz seiner
streng talmudischen Denkens und Lebens, war er den Anforderungen der Zeit
nie entgegen getreten, sobald er die Überzeugung gewonnen, dass das
religiöse Leben dadurch nicht beeinträchtigt oder gefährdet werde.
Mit
diesen Eigenschaften ausgerüstet, stand er unermüdet, ja oft nur mit zu
großer Ängstlichkeit seinem Berufe vor. Sein Leichenbegängnis bekundete
die Anhänglichkeit nicht nur der seiner geistlichen Obhut anvertrauten
Gemeinden, sondern sogar von zehnstündiger Entfernung eilten Leute
herbei, um ihm den letzten Liebesgang zu erzeigen. Sämtliche angrenzende
Orte Württembergs waren zahlreich vertreten. Noch nie ist hier und in der
Umgegend ein größerer und feierlicherer Leichenzug gesehen worden. Erschütternd
war insbesondere der Moment, als die Leiche in die Synagoge getragen und
an der Stelle niedergesetzt wurde, von der der Verstorbene so oft sein
mahnendes Wort ertönen ließ.
Zuerst trat ein intimer Freund der
Verstorbenen, Herr Rabbiner Hirsch Berlinger von Berlichingen, auf und
hielt einen rabbinischen Vortrag. Nach ihm sprach noch Herr
Bezirksrabbiner Löwenstein von Tauberbischofsheim und Herr
Bezirksrabbiner Weil von Mosbach. Ersterer in der Synagoge, letzterer auf
dem Friedhofe. Beide Redner forderten mit eindringlichen Worten die
Umstehenden auf, die Liebe zu dem Entschlafenen auf dessen Hinterlassenen
zu übertragen. Derselbe hinterlässt nämlich eine kranke Witwe mit 8
Kindern, von denen 6 noch unmündig, das jüngste erst 3 Jahre alt ist.
R." |
Das Bezirksrabbinat wird mit Dr. Julius Fürst besetzt (1858)
Anmerkung: Dr. Julius Fürst (geb. 1826, gest. 1899 Mannheim; Sohn des
Rabbiner Salomon Fürst): Rabbiner in Endingen/Schweiz
1854 bis 1858, danach in Merchingen, Bayreuth und
Mainz, 1880-1899 Rabbiner an der Klaus in Mannheim (gab 1890 ein
"Glossarium Graeco-Hebraeum" heraus, in dem er die im rabbinischen Schrifttum enthaltenen
griechischen und lateinischen Worte verzeichnete und ihre Bedeutung in Midrasch und Talmud erforschte).
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. März 1858: "Aus dem
Rabbinatsbezirke Merchingen (Baden), im März (1858). Das Rabbinat
Merchingen ist nun wieder definitiv besetzt. Bei der am 27. Dezember
vorigen Jahres stattgehabten Beratung der 17. Vorsteher des Bezirks wurde
Herr Dr. Julius Fürst, zur Zeit Rabbiner in Endingen in der Schweiz,
einstimmig zum diesseitigen Bezirksrabbiner gewählt, welche Wahl nun auch
bereits Großherzoglicher Oberrat und hohes Ministerium genehmigt hat. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. März 1858: "Aus dem
Rabbinatsbezirke Merchingen (Baden), im März (1858). Das Rabbinat
Merchingen ist nun wieder definitiv besetzt. Bei der am 27. Dezember
vorigen Jahres stattgehabten Beratung der 17. Vorsteher des Bezirks wurde
Herr Dr. Julius Fürst, zur Zeit Rabbiner in Endingen in der Schweiz,
einstimmig zum diesseitigen Bezirksrabbiner gewählt, welche Wahl nun auch
bereits Großherzoglicher Oberrat und hohes Ministerium genehmigt hat.
Diese Wahl hat im ganzen Lande Sensation erregt, denn man glaubte
sicher, dass der diesseitige Bezirk einen Mann von altem Schrot und Korn,
d.h. der nur Lamden und Chusid (sc. frommer
Talmudgelehrter) ist, wählen würde. Allein das alte
lateinische Sprichwort: die Zeiten ändern sich und mit ihnen ändern auch
wir uns, hat sich auch hier wieder bewährt. Jede Zeit macht ihre
Anforderungen geltend, und dringt, trotz aller Hindernisse, endlich durch.
Auch bei uns ist man zur Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner mehr als
Talmud kennen muss, wenn er seiner hohen Aufgabe zeitgemäß entsprechen
soll.
In dem Gewählten
glauben wir den Mann gefunden zu haben, der mit gediegenen talmudischen
Kenntnissen auch ein anderweitiges gründliches Wissen verbindet, und der
bei seinem sanften Charakter, so Gott will, recht segensreich wirken wird,
wozu ihm ein weites Feld geboten ist." |
Über das Wirken des Bezirksrabbiners Dr. Fürst (Bericht von 1859)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1859: "Merchingen, im November (1859). Erlauben Sie mir, jetzt, nach
Verlauf von dreiviertel Jahren, in Kurzem das Wirken unseres neuen
Bezirksrabbiners Herrn Dr. Fürst zu zeichnen. Um zunächst vom
Gottesdienste zu beginnen, so hat es alle Freunde der Religion gefreut,
dass unser Rabbiner sogleich sein Augenmerk darauf gewendet, und sowohl
hier wie in den sämtlichen Gemeinden des Bezirks durch angemessene
Ordnung, Einführung von Gesang und angemessenen Vortrag der Gebete, auch
hier und da durch Einfügung deutscher Gebete den Gottesdienst zu heben
versuchte. Erleichtert wurde ihm dies durch das bereitwillige
Entgegenkommen erleuchteter Synagogenräte und namentlich der Lehrer und
Vorbeter. Ich erwähnte hier namentlich ein Zirkular unseres
Bezirksrabbiners über den Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1859: "Merchingen, im November (1859). Erlauben Sie mir, jetzt, nach
Verlauf von dreiviertel Jahren, in Kurzem das Wirken unseres neuen
Bezirksrabbiners Herrn Dr. Fürst zu zeichnen. Um zunächst vom
Gottesdienste zu beginnen, so hat es alle Freunde der Religion gefreut,
dass unser Rabbiner sogleich sein Augenmerk darauf gewendet, und sowohl
hier wie in den sämtlichen Gemeinden des Bezirks durch angemessene
Ordnung, Einführung von Gesang und angemessenen Vortrag der Gebete, auch
hier und da durch Einfügung deutscher Gebete den Gottesdienst zu heben
versuchte. Erleichtert wurde ihm dies durch das bereitwillige
Entgegenkommen erleuchteter Synagogenräte und namentlich der Lehrer und
Vorbeter. Ich erwähnte hier namentlich ein Zirkular unseres
Bezirksrabbiners über den
|
 Gottesdienst
am Jom Kippur (? hebräische Buchstaben nicht lesbar), dann die Einführung der Konfirmation hier und in den übrigen
Gemeinden; letztere fand hier am Wochenfeste statt und hatte durch die
herrliche Predigt den erhebendsten Eindruck auf die zahlreichen Zuhörer
gemacht. Schon im Hinblick auf die Ankunft unseres Rabbiners hatte sich
ein Männergesangverein gebildet, welcher alsdann den Herrn Rabbiner
mittelst eines Schreibens ersuchte, die Stelle als Ehrenpräsident
anzunehmen. Dieser Verein hat schon ebenfalls durch seine Produktionen
viel zur Verherrlichung des Gottesdienstes beigetragen. Im laufe des
Sommers erfreuten wir uns an solchen Sabbaten, wo Herr Dr. Fürst nicht in
auswärtigen Gemeinden war, um die Schulen zu inspizieren und zu predigen,
einer Predigt, und statt des bisher eingeführten Schiur
(Lernstunde) am Nachmittag einer Homilie in der Synagoge, in den Wintermonaten wird
meist bloß eine Homilie abgehalten. Dieselben werden mit großem Eifer
gehört und erfreuen sich des größten Beifalls. Die gleich Sorge wie dem
Gottesdienst wendet er dem Schulweisen zu; wöchentliche mehrere Male
besucht er die hiesige Schule, und sucht bei Behörden wie bei Gemeinden
zur Verbesserung des Schulwesens zu wirken. Es sind z.B. in dem Bezirk
drei Gemeinden zu mittellos zur Besoldung eines Religionslehrers; während
die Kinder für den Elementarunterricht die christliche Ortsschule
besuchen, müssen sie eine Stunde weit gehen in die Religionsschule des nächsten
Ortes. Herr Fürst forderte daher in jeder seiner Gemeinden zur Gründung
eines Bezirksvereins auf, damit allmählich solchen mittellosen Gemeinden
zur Besoldung eines Lehrers beigesteuert werden könne. Bei jeder
Festmahlzeit wird zu diesem Behufe kollektiert, und unterziehen sich meist
die Lehrer der Sammlung der ständigen Beiträge. Es wird wohl einige
Jahre dauern, bis der Zweck erreicht werden kann; allein besser spät als
gar nicht, und ist das Unternehmen unseres Rabbiners umso löblicher, dass
er sich durch die späte Erfüllung nicht abhalten lässt. In ähnlicher
Weise hat derselbe bei der Behörde für diesen Zweck gewirkt. Es werden nämlich
nach einer Verordnung des höchstseligen Großherzogs Karl Friedrich vom
Jahre 1809 aus hierzu erhobenen Steuern sämtlicher Israeliten des Landes
eine Anzahl junger Leute jährlich zur Erlernung eines Handwerks unterstützt
und außerdem arme Israeliten mit kleineren Gaben jährlich bedacht. Die
Rabbiner haben jährlich über die eingehenden Gesuche durch die Ämter an
die Kreisregierungen zu berichten. Herr Rabbiner Fürst nahm hiervor
Anlass, in seinem Berichte darzustellen, dass die aus jenen Unterstützungsgeldern
an Arme verabreichten Gaben zu klein seien, um wirksam helfen zu können,
dass sie oft zu einer Zeit kommen, wo es der Arme weniger bedarf und
verbraucht, während es im Fall dringender Not fehle. Hier wüssten die
Ortsvorgesetzten besser Zeit und Verhältnisse abzuwägen, und man möge
diesen die Sorge für ihre Armen ganz überlassen; diese Gelder, wie sie
jetzt verteilt wären, seien meist nutzlos vergeudet. Dagegen schilderte
er die Übelstände solcher Gemeinden, welche zu arm sind, um Lehrer zu
besolden, deren es im ganzen Lande sicherlich viele gebe, und bat schließlich,
dass dahin gewirkt werde, dass diese Unterstützungsgelder zur Anstellung
von Lehrern in armen israelitischen Gemeinden verwendet werden; diese könnten
dann umso eher für ihre Armen selbst sorgen. Der zur Unterstützung
israelitischer Handwerkslehrlinge bestimmte
Teil solle fortwährend diesem Zwecke dienen; aber man müsse hier dem oft
eintretenden Falle entgegentreten, dass israelitische Handwerker oft ihren
gewählten Beruf verlassen. Mit Rücksicht darauf, dass solche Fälle
weniger in der Stadt vorkommen, als auf dem Lande, sei zu erwägen, dass
auf dem Lande ein Handwerker von seinem Gewerbe allein ohne Landbesitz
sich nicht nähren könne, da christliche Handwerker auf dem Lande meist
ererbten Grundbesitz haben. Daher sei dem israelitischen Handwerker, der
seinen Wohnsitz nicht wählen könne, wie er sich für die Betreibung
seines Gewerbes am meisten eigne, oft zu jenem Wechsel des Berufes genötigt.
Solle daher der wohltätige Zweck Carl Friedrichs nicht illusorisch
werden, so müsse man die Hindernisse dazu wegräumen, und es müsse dem
Israeliten gleichfalls das Recht gewährt sein, in jedem Ort des Großherzogtums
sich nach gehörigem Ausweis das Bürgerrecht zu erwerben. Am Schluss wird
die Hoffnung ausgesprochen, dass das Werk Carl Friedrichs durch die
hochherzige Gesinnung seines Enkels in derselben humanen und gerechten
Weise auch zu Ende geführt werde. Zu wünschen ist, dass sämtliche
Rabbinen, welche ja jährlich Gelegenheit dazu haben, ebenfalls diese Anträge
stellen; alsdann ist zumal bei dem jetzigen Systemwechsel in Preußen, der
auch auf die kleineren Staaten von Einfluss sein wird, eine Besserung in
diesen Beziehung zu hoffen. Wir freuen uns indes, das unser
Bezirksrabbiner den Gottesdienst
am Jom Kippur (? hebräische Buchstaben nicht lesbar), dann die Einführung der Konfirmation hier und in den übrigen
Gemeinden; letztere fand hier am Wochenfeste statt und hatte durch die
herrliche Predigt den erhebendsten Eindruck auf die zahlreichen Zuhörer
gemacht. Schon im Hinblick auf die Ankunft unseres Rabbiners hatte sich
ein Männergesangverein gebildet, welcher alsdann den Herrn Rabbiner
mittelst eines Schreibens ersuchte, die Stelle als Ehrenpräsident
anzunehmen. Dieser Verein hat schon ebenfalls durch seine Produktionen
viel zur Verherrlichung des Gottesdienstes beigetragen. Im laufe des
Sommers erfreuten wir uns an solchen Sabbaten, wo Herr Dr. Fürst nicht in
auswärtigen Gemeinden war, um die Schulen zu inspizieren und zu predigen,
einer Predigt, und statt des bisher eingeführten Schiur
(Lernstunde) am Nachmittag einer Homilie in der Synagoge, in den Wintermonaten wird
meist bloß eine Homilie abgehalten. Dieselben werden mit großem Eifer
gehört und erfreuen sich des größten Beifalls. Die gleich Sorge wie dem
Gottesdienst wendet er dem Schulweisen zu; wöchentliche mehrere Male
besucht er die hiesige Schule, und sucht bei Behörden wie bei Gemeinden
zur Verbesserung des Schulwesens zu wirken. Es sind z.B. in dem Bezirk
drei Gemeinden zu mittellos zur Besoldung eines Religionslehrers; während
die Kinder für den Elementarunterricht die christliche Ortsschule
besuchen, müssen sie eine Stunde weit gehen in die Religionsschule des nächsten
Ortes. Herr Fürst forderte daher in jeder seiner Gemeinden zur Gründung
eines Bezirksvereins auf, damit allmählich solchen mittellosen Gemeinden
zur Besoldung eines Lehrers beigesteuert werden könne. Bei jeder
Festmahlzeit wird zu diesem Behufe kollektiert, und unterziehen sich meist
die Lehrer der Sammlung der ständigen Beiträge. Es wird wohl einige
Jahre dauern, bis der Zweck erreicht werden kann; allein besser spät als
gar nicht, und ist das Unternehmen unseres Rabbiners umso löblicher, dass
er sich durch die späte Erfüllung nicht abhalten lässt. In ähnlicher
Weise hat derselbe bei der Behörde für diesen Zweck gewirkt. Es werden nämlich
nach einer Verordnung des höchstseligen Großherzogs Karl Friedrich vom
Jahre 1809 aus hierzu erhobenen Steuern sämtlicher Israeliten des Landes
eine Anzahl junger Leute jährlich zur Erlernung eines Handwerks unterstützt
und außerdem arme Israeliten mit kleineren Gaben jährlich bedacht. Die
Rabbiner haben jährlich über die eingehenden Gesuche durch die Ämter an
die Kreisregierungen zu berichten. Herr Rabbiner Fürst nahm hiervor
Anlass, in seinem Berichte darzustellen, dass die aus jenen Unterstützungsgeldern
an Arme verabreichten Gaben zu klein seien, um wirksam helfen zu können,
dass sie oft zu einer Zeit kommen, wo es der Arme weniger bedarf und
verbraucht, während es im Fall dringender Not fehle. Hier wüssten die
Ortsvorgesetzten besser Zeit und Verhältnisse abzuwägen, und man möge
diesen die Sorge für ihre Armen ganz überlassen; diese Gelder, wie sie
jetzt verteilt wären, seien meist nutzlos vergeudet. Dagegen schilderte
er die Übelstände solcher Gemeinden, welche zu arm sind, um Lehrer zu
besolden, deren es im ganzen Lande sicherlich viele gebe, und bat schließlich,
dass dahin gewirkt werde, dass diese Unterstützungsgelder zur Anstellung
von Lehrern in armen israelitischen Gemeinden verwendet werden; diese könnten
dann umso eher für ihre Armen selbst sorgen. Der zur Unterstützung
israelitischer Handwerkslehrlinge bestimmte
Teil solle fortwährend diesem Zwecke dienen; aber man müsse hier dem oft
eintretenden Falle entgegentreten, dass israelitische Handwerker oft ihren
gewählten Beruf verlassen. Mit Rücksicht darauf, dass solche Fälle
weniger in der Stadt vorkommen, als auf dem Lande, sei zu erwägen, dass
auf dem Lande ein Handwerker von seinem Gewerbe allein ohne Landbesitz
sich nicht nähren könne, da christliche Handwerker auf dem Lande meist
ererbten Grundbesitz haben. Daher sei dem israelitischen Handwerker, der
seinen Wohnsitz nicht wählen könne, wie er sich für die Betreibung
seines Gewerbes am meisten eigne, oft zu jenem Wechsel des Berufes genötigt.
Solle daher der wohltätige Zweck Carl Friedrichs nicht illusorisch
werden, so müsse man die Hindernisse dazu wegräumen, und es müsse dem
Israeliten gleichfalls das Recht gewährt sein, in jedem Ort des Großherzogtums
sich nach gehörigem Ausweis das Bürgerrecht zu erwerben. Am Schluss wird
die Hoffnung ausgesprochen, dass das Werk Carl Friedrichs durch die
hochherzige Gesinnung seines Enkels in derselben humanen und gerechten
Weise auch zu Ende geführt werde. Zu wünschen ist, dass sämtliche
Rabbinen, welche ja jährlich Gelegenheit dazu haben, ebenfalls diese Anträge
stellen; alsdann ist zumal bei dem jetzigen Systemwechsel in Preußen, der
auch auf die kleineren Staaten von Einfluss sein wird, eine Besserung in
diesen Beziehung zu hoffen. Wir freuen uns indes, das unser
Bezirksrabbiner den |
 Anfang
hierzu gemacht und offen den Behörden die Nachteile dargelegt hat, wie
sich denn derselbe mit Eifer und großer Uneigennützigkeit dem Wohle
seiner Gemeinden und der Förderung der religiösen Interessen widmet. So
erteilt derselbe mehreren jungen Leuten, die sich hier für das Schulfach
oder das Studium der Theologie vorbereiten, unentgeltlich zwei Stunden täglich
Unterricht im Talmud. So entfaltet er nach allen Seiten seine ersprießliche
Tätigkeit und gratulieren wir uns aufrichtig, Herrn Dr. Fürst seinem
Vaterlande und unserem Bezirke gewonnen zu haben, und nehmen wir mit Vergnügen
wahr, dass derselbe ebenfalls gern unter uns weilt.
Aron Rosenfeld, Hauptlehrer." Anfang
hierzu gemacht und offen den Behörden die Nachteile dargelegt hat, wie
sich denn derselbe mit Eifer und großer Uneigennützigkeit dem Wohle
seiner Gemeinden und der Förderung der religiösen Interessen widmet. So
erteilt derselbe mehreren jungen Leuten, die sich hier für das Schulfach
oder das Studium der Theologie vorbereiten, unentgeltlich zwei Stunden täglich
Unterricht im Talmud. So entfaltet er nach allen Seiten seine ersprießliche
Tätigkeit und gratulieren wir uns aufrichtig, Herrn Dr. Fürst seinem
Vaterlande und unserem Bezirke gewonnen zu haben, und nehmen wir mit Vergnügen
wahr, dass derselbe ebenfalls gern unter uns weilt.
Aron Rosenfeld, Hauptlehrer." |
Zur Rabbinerwahl in Merchingen (1860)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. April 1860: "Aus dem Rabbinatsbezirke Merchingen (in
Baden). Der Schluss des Artikels in No. 14 dieser Zeitung datiert:
'Mannheim, den 11. März', konnte leicht zu der Ansicht führen, als
hätte Herr Rabbiner Löwenstein bei der jüngsten Rabbinerwahl in
Merchingen (am 1. März) während des Wahlaktes einen Kandidaten der
Würzburger Schule zur Wahl vorgeschlagen. Dem ist aber nicht so. Herr
Rabbiner Löwenstein hat während der Wahlhandlung keinen Bewerber namhaft
gemacht. Allein dass der Erfolg der Wahl den Herrn Wahlkommissar sehr
unangenehm berührt hat, dass er viel lieber einen Bewerber aus der
hyperorthodoxen Würzburger Schule gewählt gesehen hätte, daran wird
niemand zweifeln, der die vor der Wahl gehaltene Rede mit angehört, und
die Richtung des Herrn Rabbiner Löwenstein kennt. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. April 1860: "Aus dem Rabbinatsbezirke Merchingen (in
Baden). Der Schluss des Artikels in No. 14 dieser Zeitung datiert:
'Mannheim, den 11. März', konnte leicht zu der Ansicht führen, als
hätte Herr Rabbiner Löwenstein bei der jüngsten Rabbinerwahl in
Merchingen (am 1. März) während des Wahlaktes einen Kandidaten der
Würzburger Schule zur Wahl vorgeschlagen. Dem ist aber nicht so. Herr
Rabbiner Löwenstein hat während der Wahlhandlung keinen Bewerber namhaft
gemacht. Allein dass der Erfolg der Wahl den Herrn Wahlkommissar sehr
unangenehm berührt hat, dass er viel lieber einen Bewerber aus der
hyperorthodoxen Würzburger Schule gewählt gesehen hätte, daran wird
niemand zweifeln, der die vor der Wahl gehaltene Rede mit angehört, und
die Richtung des Herrn Rabbiner Löwenstein kennt.
Bei der Ernennung desselben zum Wahlkommissar gab man sich von gewisser
Seite der süßen und sichern Hoffnung hin, dass nunmehr die Wahl eines
Hyperorthodoxen gesichert sei, selbst wenn er nicht einmal korrekt Deutsch
zu schreiben vermöge. Allein die Herren Vorsteher des Bezirks dachten
anders als die beiden Herrn Bezirksältesten. Die große Mehrheit der
Gemeinden sich zu der Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner der
Jetztzeit mehr als Talmud kennen muss, wenn er seinen Bezirk nach innen
und außen würdig und segensreich vertreten soll. Was von der Zeit einmal
als Bedürfnis anerkannt ist, das dringt auch in die äußersten
Schichten, und nur eine kranke Phantasie kann sich das Veraltete als eine
neue Zukunft vormalen.
Zur Wiederbesetzung unserer Rabbinatsstelle haben bereits drei
Besprechungen, respektive Wahlen stattgefunden. Bei den zwei letzten hat
Herr Rabbiner Flehinger von Meisenheim
jedes Mal die Majorität der Stimmen erhalten. Bei der letzten sogar von
17 Stimmen 15; denn nach dem jüngsten Beschlusse Großherzoglichen
Oberrats vom 10. Februar dieses Jahres No. 123, hat der bei der Wahl
persönlich zu erscheinende Synagogenrats-Vorsteher nicht etwa seine
subjektive Ansicht, sondern vielmehr die seiner Gemeinde auszusprechen.
Von den fünf Gemeinden, deren Vorsteher nicht für Flehinger gestimmt,
hat aber die Majorität dreier Gemeinden die Erklärung abgegeben: dass
sie mit der Wahl ihrer Vorsteher nicht einverstanden sind, sie ihre Stimmen
vielmehr ebenfalls für Flehinger abgeben.
Wir wollen nun ruhig abwarten, ob unser Großherzoglicher Oberrat den 2
Stimmen mehr Rechnung trägt, als den 15. Dem Gerückte, dass derselbe
eine 4te Wahl anordnen werde, können wir kaum Glauben
schenken." |
Werbeanzeigen für eine Publikation von Bezirksrabbiner
Flehinger (1880)
Spendenaufruf von Bezirksrabbiner Flehinger für eine in Not geratene Familie
(1882)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1882: "Aufruf
und dringende Bitte! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1882: "Aufruf
und dringende Bitte!
Ich erlaube mir, die israelitischen Glaubensgenossen um ihre
Mildtätigkeit anzurufen.
Vor einigen Jahren starb einer unserer Glaubensbrüder des diesseitigen
Bezirks, welcher als ein ehrenhafter, frommer Mann vielfach bekannt war.
Er hinterließ eine greise, gebrechliche Witwe, welche leider nunmehr sehr
wenig Augenlicht besitzt. Ferner noch einen stets arbeitsunfähigen Sohn,
welche beide auf immer den Beistand ihres Sohnes und Bruders bedürfen.
Auch dieser wurde nach dem Tode seines Vaters von harten Schicksalen und
Krankheit so heimgesucht, dass nach Verlauf von bereits 1 Jahr sein
Geschäft gerichtlich verkauft wurde. Um nunmehr wieder ein Geschäft
gründen zu können, wodurch die schwer geprüfte Familie den weiteren
Unannehmlichkeiten und vielleicht gar noch der Obdachlosigkeit entrissen
werden kann, bedarf es den Anspruch um baldige Hilfe und bitte daher
dringend um wohlwollende Beiträge, die ich anzunehmen und
weiterzubefördern gern bereit bin.
Merchingen, am 23. November 1882. Großherzoglicher Badischer
Bezirksrabbiner Flehinger.
Wir sind gern bereit, Gaben in Empfang zu nehmen und weiterzubefördern.
Die Expedition des 'Israelit'." |
Zum Tod von Rabbiner Baruch Hirsch Flehinger (1890)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1890: "Darmstadt.
Vor kurzem starb hier der pensionierte Bezirks- und Konferenz-Rabbiner B.
H. Flehinger im Alter von 80 Jahren. Derselbe war früher Rabbiner in Meisenheim
und in Merchingen im Großherzogtum Baden. - Als Konferenz-Rabbiner war er
auch Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten. Er war
Verfasser zweier biblischer Geschichtsbücher, wovon das für die
‚kleinere Jugend’ 20 und das für ‚reifere Jugend’ 5 Auflagen
erlebte." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Februar 1890: "Darmstadt.
Vor kurzem starb hier der pensionierte Bezirks- und Konferenz-Rabbiner B.
H. Flehinger im Alter von 80 Jahren. Derselbe war früher Rabbiner in Meisenheim
und in Merchingen im Großherzogtum Baden. - Als Konferenz-Rabbiner war er
auch Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten. Er war
Verfasser zweier biblischer Geschichtsbücher, wovon das für die
‚kleinere Jugend’ 20 und das für ‚reifere Jugend’ 5 Auflagen
erlebte." |
|
|
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1890:
"Karlsruhe, 20. Februar (1890). Der frühere Bezirksrabbiner
Dr. Flehinger von Merchingen, bekannt als Herausgeber eines
Geschichtsbüchleins für die israelitische Jugend, ist, 80 Jahre alt, in
Darmstadt gestorben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1890:
"Karlsruhe, 20. Februar (1890). Der frühere Bezirksrabbiner
Dr. Flehinger von Merchingen, bekannt als Herausgeber eines
Geschichtsbüchleins für die israelitische Jugend, ist, 80 Jahre alt, in
Darmstadt gestorben." |
Zum Tod von Bezirksrabbiner (Rabbinatsverweser) Dr.
Louis Heilbut (1884)
Dr. Louis Heilbut (geb. 1849 in Altona, gest. 1884 in Merchingen): studierte bei
Rabbiner Jakob Ettlinger in Altona, dann bei Dr. Esriel Hildesheimer in Berlin:
zunächst Prediger in Tarnowitz, dann in Frankfurt am Main und Biblis,
seit 1883 für ein Jahr bis zu seinem plötzlichen Tod Rabbinatsvikar (noch
unter Rabbiner Flehinger) / rabbinatsverweser in Merchingen und Tauberbischofsheim.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1884: "Merchingen,
24. August (1884). Herr Dr. Heilbut, unser allbeliebter Rabbiner, wurde
gestern plötzlich im blühendsten Mannesalter vom Tode dahingerafft. Der
Verstorbene war ein Schüler Dr. Hildesheimers, war anfangs in Tarnowitz
Prediger und wurde schließlich hier als Rabbiner angestellt. Seine wahre
Frömmigkeit, seine gediegene wissenschaftliche Bildung sowie sein
liebenswürdiger Charakter werden ihm in den Herzen aller, die ihn
kannten, ein unauslöschliches Andenken bewahren." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1884: "Merchingen,
24. August (1884). Herr Dr. Heilbut, unser allbeliebter Rabbiner, wurde
gestern plötzlich im blühendsten Mannesalter vom Tode dahingerafft. Der
Verstorbene war ein Schüler Dr. Hildesheimers, war anfangs in Tarnowitz
Prediger und wurde schließlich hier als Rabbiner angestellt. Seine wahre
Frömmigkeit, seine gediegene wissenschaftliche Bildung sowie sein
liebenswürdiger Charakter werden ihm in den Herzen aller, die ihn
kannten, ein unauslöschliches Andenken bewahren." |
|
|
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September 1884 (der Abschnitt
wird leicht abgekürzt zitiert): "Merchingen
(Baden). Am Tag des Heiligen Schabbat, dem 2. Elul (= Schabbat,
23. August 1884). Eine tief traurige
Veranlassung ist es heute, die mich bitten lässt, die Spalten Ihrer geschätzten
Zeitung zu benützen, um einen unersetzlichen Verlust, den die Gesamtheit
(= das Judentum) leider erlitten, zu registrieren, mehr noch das
Bewusstsein dieses Verlustes wach zu erhalten. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. September 1884 (der Abschnitt
wird leicht abgekürzt zitiert): "Merchingen
(Baden). Am Tag des Heiligen Schabbat, dem 2. Elul (= Schabbat,
23. August 1884). Eine tief traurige
Veranlassung ist es heute, die mich bitten lässt, die Spalten Ihrer geschätzten
Zeitung zu benützen, um einen unersetzlichen Verlust, den die Gesamtheit
(= das Judentum) leider erlitten, zu registrieren, mehr noch das
Bewusstsein dieses Verlustes wach zu erhalten.
Unser geliebter Führer, Herr Dr. Louis Heilbut – das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen – weilt seit dem Vortag zum 1. Elul (=
Donnerstag, 21. August 1884) nicht
mehr unter uns – denn Gott hat ihn genommen – Seit einem Jahre als
Verweser der Bezirksrabbinate Merchingen und Tauberbischofsheim tätig,
ist es ihm durch sein segensreiches, pflichttreues Wirken gelungen, sich
die allseitige Liebe, Verehrung und Hochachtung weit über die Marken
seines Amtskreises in seltener Weise zu erringen, was die äußerst
zahlreiche Beteiligung von nahe und ferne, trotz Freitag (Vortag vor
Schabbat), bei seiner heute stattgefundenen Beerdigung bekundete. Die
nichtjüdische Bevölkerung; der Gemeinderat in corpore, die verehrliche
Geistlichkeit, Lehrer und Schüler der Kommunalschulen nahmen den gleichen
Anteil und es dürften nur wenige Augen tränenleer bei dem unabsehbaren
Trauerzuge geblieben sein. ... – Eine gesetzestreue Jugend heranzubilden war
die Zielscheibe seines unablässigen Strebens.
Bei Herrn Bezirksrabbiner
Dr. L. Heilbut - unser Lehrer, der Herr und unser Meister, Herr Jehuda,
das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - fand der Segensspruch unseres Vaters
Jakob - Jehuda, die preisen deine Brüder (1. Mose 49,8) - die wahrhaftigste Verwirklichung.
In Altona geboren, war er zehn Jahre lang der Schüler des Großen
Gaon, unseres Lehrers, unseres Herrn und Meisters Jakob Ettlinger seligen
Andenkens, dann
begann und vollendete er seine akademischen Studien in Berlin, wo er das
Rabbinerseminar des Herrn Rabbiner Dr. Hildesheimer – sein Licht leuchte
– frequentierte, und bei diesem, seinem hochverehrten Lehrer, in
doppelter Weise, als der Schüler eifrigsten einer und als Hauslehrer bei
dessen Kindern sieben Jahre tätig war, was ein selten inniges
Freundschaftsband mit dieser rühmlichst bekannten Familie bleibend zur
Folge hatte. – Tarnowitz, Frankfurt am Main, Biblis,
|
 waren
seine segensreichen Wirkungskreise, bis er seit einem Jahre die Verwaltung
des hiesigen Bezirksrabbinates übernahm und in oben besagter Weise
verwaltete, dem Worte des Talmuds Jeruschalmi entsprechend… und nicht
nur die junge, tief betrübte Gattin, seit 14 Tagen Wöchnerin mit einem
zweiten Töchterchen, verliert einen treu hingebenden Gatten; die
Schwiegereltern einen Sohn im wahrhaftigsten Sinn des Wortes und der
einzige Bruder den treuesten Ratgeber. Am Heiligen Schabbat Paraschat Reeh
(Schabbat mit der Toralesung Reeh = 5. Mose 11,26 - 26,17, das
war Schabbat, 16. August 1884),
nachdem er seine Predigt beendet und (etwa im Vorgefühl des nahenden
Heimgangs -) den Vers 'bis hierher kommst du, und nicht weiter, und
hier stehe es dem Trotze deiner Wogen': darin
erwähnte, ereilte ihn das Krankenlager und schon am Mittwoch kehrte seine
reine Seele, nachdem sie nur 35 Jahre – jung an Tagen, aber reich an
Taten – hienieder gewaltet, zu den lichten Höhen zurück. waren
seine segensreichen Wirkungskreise, bis er seit einem Jahre die Verwaltung
des hiesigen Bezirksrabbinates übernahm und in oben besagter Weise
verwaltete, dem Worte des Talmuds Jeruschalmi entsprechend… und nicht
nur die junge, tief betrübte Gattin, seit 14 Tagen Wöchnerin mit einem
zweiten Töchterchen, verliert einen treu hingebenden Gatten; die
Schwiegereltern einen Sohn im wahrhaftigsten Sinn des Wortes und der
einzige Bruder den treuesten Ratgeber. Am Heiligen Schabbat Paraschat Reeh
(Schabbat mit der Toralesung Reeh = 5. Mose 11,26 - 26,17, das
war Schabbat, 16. August 1884),
nachdem er seine Predigt beendet und (etwa im Vorgefühl des nahenden
Heimgangs -) den Vers 'bis hierher kommst du, und nicht weiter, und
hier stehe es dem Trotze deiner Wogen': darin
erwähnte, ereilte ihn das Krankenlager und schon am Mittwoch kehrte seine
reine Seele, nachdem sie nur 35 Jahre – jung an Tagen, aber reich an
Taten – hienieder gewaltet, zu den lichten Höhen zurück.
Herr Dr.
Sondheimer aus Heidelberg eilte hierher, dem Verewigten, obgleich am
Monatsbeginn (Rosch Chodesch), doch einen warmen Nachruf zu widmen, und
wer möchte sich nicht gerne dem von ihm ausgesprochenen Wunsche anschließen,
dass Gott die tief betrübten Hinterbliebenen trösten und sich der
gebeugten jungen Witwe mit ihren unmündigen Kinderchen in seiner großen
Barmherzigkeit annehmen möchte! Der Tod wird verschlungen auf
ewig (Jesaja
25,8) und seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. C.G." |
Ausschreibung der Stelle des Rabbinatsvikars (1884)
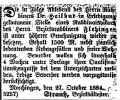 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1884:
"Die in Folge Ablebens des Herrn Rabbiners Dr. Heilbut in Erledigung
gekommene Stelle eines Rabbinatsvikars des Herrn Bezirksrabbiners
Flehinger ist unter höherer Genehmigung wieder zu besetzen. Gehalt 1.500
Mark nebst ziemlich bedeutenden Nebengefällen und freier Wohnung.
Bewerber wollen sich innerhalb 4 Wochen unter Vorlage ihrer
Qualifikationszeugnisse bei dem Unterzeichneten melden. Ledige Bewerber
werden vorzugsweise berücksichtigt. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Oktober 1884:
"Die in Folge Ablebens des Herrn Rabbiners Dr. Heilbut in Erledigung
gekommene Stelle eines Rabbinatsvikars des Herrn Bezirksrabbiners
Flehinger ist unter höherer Genehmigung wieder zu besetzen. Gehalt 1.500
Mark nebst ziemlich bedeutenden Nebengefällen und freier Wohnung.
Bewerber wollen sich innerhalb 4 Wochen unter Vorlage ihrer
Qualifikationszeugnisse bei dem Unterzeichneten melden. Ledige Bewerber
werden vorzugsweise berücksichtigt.
Merchingen, den 27. Oktober 1884. Strauß, Bezirksältester." |
Ausschreibung der Stelle des Bezirksrabbinates Wertheim
- zusammen mit dem Bezirksrabbinat Merchingen (1885)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Oktober 1885: "Das Bezirksrabbinat Wertheim,
mit welchem die Verwaltung des Bezirksrabbinates Merchingen
verbunden ist, soll neu besetzt werden. Die festen Bezüge betragen 1800
bis 2000 Mark neben freier Dienstwohnung. Die Akzidenzien in dem
umfassenden Dienstbezirke (29 Gemeinden) sind nicht unerheblich. Die
Bestallung erfolgt mit der Bedingung, dass der Inhaber der Stelle im Falle
einer organisatorischen Änderung auf Verlangen der zuständigen Behörde
seinen Wohnsitz von Wertheim nach Mosbach
zu verlegen hätte. Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung einer
Darlegung des seitherigen Lebensganges, ferner der Nachweise über die
allgemeine wissenschaftliche und fachliche Ausbildung, sowie über
erlangte Autorisation zur Ausübung von Rabbinatsfunktionen und über die seitherige
Berufstätigkeit binnen 6 Wochen bei der unterzeichneten Behörde
einzureichen.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 27. Oktober 1885: "Das Bezirksrabbinat Wertheim,
mit welchem die Verwaltung des Bezirksrabbinates Merchingen
verbunden ist, soll neu besetzt werden. Die festen Bezüge betragen 1800
bis 2000 Mark neben freier Dienstwohnung. Die Akzidenzien in dem
umfassenden Dienstbezirke (29 Gemeinden) sind nicht unerheblich. Die
Bestallung erfolgt mit der Bedingung, dass der Inhaber der Stelle im Falle
einer organisatorischen Änderung auf Verlangen der zuständigen Behörde
seinen Wohnsitz von Wertheim nach Mosbach
zu verlegen hätte. Bewerbungsgesuche sind unter Beifügung einer
Darlegung des seitherigen Lebensganges, ferner der Nachweise über die
allgemeine wissenschaftliche und fachliche Ausbildung, sowie über
erlangte Autorisation zur Ausübung von Rabbinatsfunktionen und über die seitherige
Berufstätigkeit binnen 6 Wochen bei der unterzeichneten Behörde
einzureichen.
Karlsruhe, den 15. Oktober 1885.
Großherzoglicher Badischer Oberrat der Israeliten. Der
Ministerial-Kommissär: Joos." |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Über die 1869 eingerichtete, gemischt-konfessionelle
Volksschule in Merchingen (1870)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1870: "Merchingen (Baden), 15. Dezember (1870): Die 'Neue
Badische Landeszeitung' schreibt von hier: Seit dem 23. vorigen Monats
besteht hier eine gemischte Volksschule, hervorgehend aus der bisherigen
evangelischen und öffentlichen israelitischen Volksschule.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar
1870: "Merchingen (Baden), 15. Dezember (1870): Die 'Neue
Badische Landeszeitung' schreibt von hier: Seit dem 23. vorigen Monats
besteht hier eine gemischte Volksschule, hervorgehend aus der bisherigen
evangelischen und öffentlichen israelitischen Volksschule.
Ängstliche, vom Einflusse langjähriger Gewohnheit beherrschte Gemüter
suchten noch in der zwölften Stunde gegen die Errichtung der einheitlichen
Schule dadurch zu wirken, dass sie verbreiteten, es könne der
Religionsunterricht und die Sabbatfeier im Lehrplan nicht diejenige
Würdigung finden, wie solche im beiderseitigen Interesse der
Konfessionsgemeinden gewünscht wird, auch müssten die Verhältnisse der
bisher in getrennten Schulen unterrichten, aus verschiedenen Lebenskreisen
entnommenen Schuljugend zu heterogen erscheinen, dass nicht Unbilden etc.
daraus zu befürchten wären.
Diese Befürchtungen haben sich nicht verwirklicht. Ich freue mich
vielmehr konstatieren zu können, dass die kleine Schulbevölkerung in
größter Eintracht beisammen lebt, dass eine neue Tätigkeit, ein
Wissenseifer dieselbe beseelt, und viele der bis jetzt in getrennten
Schulen gewesenen Schüler in den Freistunden sich aufsuchen, um ihre
Aufgaben gemeinschaftlich zu machen.
Die Lehrer, von der erhöhteren Bedeutung der gemischten Schule
durchdrungen, wirken mit anerkennenswertem Gleiße und es gebührt endlich
dem Ortsschulrate das Verdienst, den Lehrplan mit der Einsicht geordnet zu
haben, dass der Religionsunterricht, ohne irgendwie zu stören, den beiden
Konfessionsteilen gerecht wird.
Dieses günstige Resultat der gemischten Schule hier, ist auch den
aufmerksamen Freunden der Schule nicht fremd geblieben und stimmt
dieselben zur Freude.
Man kommt zur Einsicht, dass die gemischte Volksschule dem Prinzipe des
Rechtsstaats gerecht wird, dass sie ein Fortschritt auf dem Gebiete des
sozialen Lebens ist, welches 'gleiches Recht für Alle' zur Devise hat;
dass dieses dem Kinde in der Schule eingepflanzte Rechtsbewusstsein
geeignet ist, den Jüngling vor Vorurteilen zu schützen und dem Manne
jene sittliche Kraft zu verleihen, welche ihn unbefangen in der
menschlichen Gesellschaft das Wahre und Rechte erstreben lässt.
Wir fügen diesem Artikel der 'Neuen Badischen Landeszeitung' hinzu, dass
im Gegensatze hiervon die Verwaltung unseres Religionsschulwesens besseren
Händen anvertraut sein müsste. Da herrscht eine Anarchie, bei Gemeinden
wie bei Lehrern, wie sie zu des seligen Eppstein Zeiten nicht denkbar
gewesen wäre. Die alte Bachurimsverdingzeit scheint im vollen
Anzuge.
Unsere sonstigen inneren Zustände, respektive die längst projektierte
und allseitig ventilierte neue Kirchenverfassung, wird noch längere Zeit,
ohne irgend Eines Verschulden, in ruhendem Zustande verbleiben
müssen." |
Ausschreibung der Kantor- und Schochetstelle (1882)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881: "Die
Kantor- und Schochetstelle dahier ist zu besetzen und werden Bewerber um
dieselbe eingeladen, unter Vorlage von Befähigungs- und Sittenzeugnissen
mit uns sich ins Benehmen zu setzen, mit dem Anfügen, dass solche
Bewerber, welche sich gleichzeitig über ihre Befähigung zur Erteilung
des Religionsunterrichts ausweisen können, zunächst Bevorzugung zu
gewärtigen haben. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881: "Die
Kantor- und Schochetstelle dahier ist zu besetzen und werden Bewerber um
dieselbe eingeladen, unter Vorlage von Befähigungs- und Sittenzeugnissen
mit uns sich ins Benehmen zu setzen, mit dem Anfügen, dass solche
Bewerber, welche sich gleichzeitig über ihre Befähigung zur Erteilung
des Religionsunterrichts ausweisen können, zunächst Bevorzugung zu
gewärtigen haben.
Merchingen, den 6. Juni 1882.
Der Synagogenrat. Strauss, Vorsteher." |
Zum Tod von Lehrer D. Callner (1909)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1909: "Merchingen,
Baden, 8. März (1909). Am 28. Februar wurde Lehrer D. Callner unter
großer Beteiligung zu Grabe getragen. Viele Freunde und Kollegen waren
von nah und fern herbeigeeilt, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.
Der stattliche Trauerzug gab Kunde von der allgemeinen Beliebtheit des
Verstorbenen. Neben der Gattin und den Kindern verliert auch die Gemeinde
Merchingen in dem Heimgegangenen einen gewissenhaften, überzeugungstreuen
Lehrer; einen seltenen Vorsänger, der durch seine klangvolle Stimme,
getragen von wahrhafter Gottesfurcht, seine Gemeinde zu tiefster Andacht
zu stimmen verstand; einen vorzüglichen gewissenhaften Schochet; einen
bewährten Mohel (Beschneider), der als solcher in den entferntesten
Kreisen bekannt war; einen großen Talmudisten und selbstlosen edlen
Menschen. Am Grabe gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Löwenstein der
Anerkennung und Würdigung all dieser Eigenschaften besonders dadurch
Ausdruck, dass er dem Heimgegangenen nachträglich den Ehrentitel Morenu
("unser Lehrer") verlieh. Herr Lehrer Scheuermann feierte im
Auftrag der badischen Lehrer den Verstorbenen durch warme Abschiedsworte.
Herr Lehrer Bravmann - Merchingen dankte namens der dortigen
Gemeinde für die 27-jährige segensreiche Wirksamkeit. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1909: "Merchingen,
Baden, 8. März (1909). Am 28. Februar wurde Lehrer D. Callner unter
großer Beteiligung zu Grabe getragen. Viele Freunde und Kollegen waren
von nah und fern herbeigeeilt, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.
Der stattliche Trauerzug gab Kunde von der allgemeinen Beliebtheit des
Verstorbenen. Neben der Gattin und den Kindern verliert auch die Gemeinde
Merchingen in dem Heimgegangenen einen gewissenhaften, überzeugungstreuen
Lehrer; einen seltenen Vorsänger, der durch seine klangvolle Stimme,
getragen von wahrhafter Gottesfurcht, seine Gemeinde zu tiefster Andacht
zu stimmen verstand; einen vorzüglichen gewissenhaften Schochet; einen
bewährten Mohel (Beschneider), der als solcher in den entferntesten
Kreisen bekannt war; einen großen Talmudisten und selbstlosen edlen
Menschen. Am Grabe gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Löwenstein der
Anerkennung und Würdigung all dieser Eigenschaften besonders dadurch
Ausdruck, dass er dem Heimgegangenen nachträglich den Ehrentitel Morenu
("unser Lehrer") verlieh. Herr Lehrer Scheuermann feierte im
Auftrag der badischen Lehrer den Verstorbenen durch warme Abschiedsworte.
Herr Lehrer Bravmann - Merchingen dankte namens der dortigen
Gemeinde für die 27-jährige segensreiche Wirksamkeit.
Zum Schlusse schilderte Lehrer E. Wertheimer als Spezialfreund des
Verklärten dessen Lehrtätigkeit und segensreiche Wirksamkeit. Auf
Anregung des Lehrers Wertheimer beschlossen die Bezirkskollegen, den
Verklärten - er ruhe in Frieden - noch dadurch besonders zu ehren,
dass sie während der Schloschim (Trauerzeit) einen Schiur
für denselben lernen. Das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Fahndung nach Isaak Fisch von Merchingen (1849)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 7. April 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Karlsruhe. [Aufforderung] Der 16-jährige Isaak Fisch von
Merchingen, Bezirksamtes Adelsheim, soll wegen verschiedener
Unterschlagungen in Untersuchung gezogen werden; da dessen gegenwärtiger
Aufenthaltsort unbekannt ist, so wird er hiermit aufgefordert, sich binnen
drei Wochen anher zu stellen, um sich wegen des hier zur Last gelegten
Verbrechens zu verantworten, widrigens lediglich nach Lage der Akten gegen
ihn erkannt würde.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 7. April 1849 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Karlsruhe. [Aufforderung] Der 16-jährige Isaak Fisch von
Merchingen, Bezirksamtes Adelsheim, soll wegen verschiedener
Unterschlagungen in Untersuchung gezogen werden; da dessen gegenwärtiger
Aufenthaltsort unbekannt ist, so wird er hiermit aufgefordert, sich binnen
drei Wochen anher zu stellen, um sich wegen des hier zur Last gelegten
Verbrechens zu verantworten, widrigens lediglich nach Lage der Akten gegen
ihn erkannt würde.
Zugleich werden sämtliche Gerichts- und Polizeibehörden ersucht, auf
Isaak Fisch, dessen Signalement hier beifolgt, zu fahnden und ihn auf
Betreten mit Laufpass hierher zu weisen.
Signalement. Große 2', Körperbau schwach, Gesichtsform rund, Nase
und Mund klein, Haare und Augen braun, Zähne gut.
Karlsruhe, den 26. März 1849. Großherzogliches Stadtamt."
|
Hinweis auf den in Merchingen geborenen späteren
Oberrabbiner von Luxemburg Isaac Blumenstein (1843 - 1903)
(eingestellt auf Grund einer Mitteilung von Holger
Hübner, Berlin)
 Links:
Eintragung der Geburt und der Beschneidung von Isaak Blumenstein in einem
jüdischen Personenstandsregister Merchingen: HStA Stgt J 386 Bü 348 Bild
104, zugänglich über https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=5632.
Demnach ist Isaak Blumenstein als Sohn des Merchinger Schutzbürgers und
Handelsmann Joseph Blumenstein und seiner Frau Adelheid am 26. September
1843 in Merchingen geboren und wurde am 3. Oktober beschnitten; Zeugen der
Geburt und Beschneidung waren Metzgermeister Hayum Fleischhacker und
Handelsmann Abraham Heß; beurkundet von Bezirksrabbiner Zacharias Israel
Staadecker. Links:
Eintragung der Geburt und der Beschneidung von Isaak Blumenstein in einem
jüdischen Personenstandsregister Merchingen: HStA Stgt J 386 Bü 348 Bild
104, zugänglich über https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=5632.
Demnach ist Isaak Blumenstein als Sohn des Merchinger Schutzbürgers und
Handelsmann Joseph Blumenstein und seiner Frau Adelheid am 26. September
1843 in Merchingen geboren und wurde am 3. Oktober beschnitten; Zeugen der
Geburt und Beschneidung waren Metzgermeister Hayum Fleischhacker und
Handelsmann Abraham Heß; beurkundet von Bezirksrabbiner Zacharias Israel
Staadecker.
Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein (geb. 26. September 1843 in Merchingen, gest. 3.
August 1903 in Luxemburg): Studium in Breslau; 1870 als Rabbinatskandidat
in Mannheim; seit 1871 Großrabbiner in Luxemburg.
Blumenstein hielt
den viel und teilweise falsch überlieferten
Feldgottesdienst zu Jom Kippur vor Metz im Deutsch-Französischen Krieg;
siehe dazu den Beitrag von Holger Hübner: Der Feldgottesdienst zu
Jom Kippur vor Metz 1870; erschienen in: Zeitschrift für Religions- und
Geistesgeschichte Jg. 63 2011 (Heft 2, April 2011) S. 105-121.
Hinweis: Zusammenfassung
des Beitrages von Holger Hübner (eingestellt als pdf-Datei). |
 |
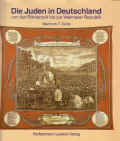 |
Darstellung des
Jom-Kippur-Gottesdienstes vor Metz 1870
mit Rabbiner Dr. Blumenstein, wie er nach der Darstellung
von Hermann Junker stattgefunden hat.
(Quelle
des Fotos)
|
Abbildung eines Erinnerungstuches an den
legendenhaft
ausgeschmückten Gottesdienst zu Jom Kippur vor Metz 1870 auf
dem Buch von Nachum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von
der
Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh 1988. |
| |
 Artikel
zum Tod von Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein in der Zeitschrift "Im
deutschen Reich" vom August 1898 S. 298: "Luxemburg, 9.
August (1898). Im eben vollendeten 60. Lebensjahr ist am 3. dieses Monats
der Rabbiner Dr. I. Blumenstein plötzlich am Herzschlage verstorben. Als
der einzige offizielle jüdische Feldprediger während des Krieges
1870/71, war er es, welcher jenen jüdischen Feldgottesdienst abhielt,
welcher durch das Bild 'Jom Kippur im Felde' weithin bekannt worden ist.
In Anbetracht seiner Dienste während jenes Feldzugs wurde ihm das Eiserne
Kreuz am weißen Bande verliehen. In Luxemburg, wo er 32 Jahre segensreich
gewirkt hat, erfreute er sich allgemeiner Verehrung. Der hiesige nationalliberale
'Volksbote' schreibt: 'Am Leichenzuge, der sich von der Synagoge aus
bewegte, nahmen teil Vertreter der Regierung, des Staatsrates, der
Deputiertenkammer, der Obergerichtshofes, des Bezirksgerichtes, der
Staatsanwaltschaften, der Bureaus der Stadtrates, der Militärbehörden,
der Presse usw. usw. Das Konsistorium war vollzählig erschienen; ebenso
war die hiesige Loge, deren Mitglied er gewesen, sehr zahlreich vertreten.
Eine vielhundertköpfige Menschenmenge aller Stände und aller
Konfessionen angehörend, bildete den Schluss des Leichenzuges.' Der
Bericht schließt mit den Worten: 'Sein Andenken wird nicht bloß bei
seinen Religionsgenossen, sondern auch bei allen Andersgläubigen stets gesegnet
bleiben!'" Artikel
zum Tod von Rabbiner Dr. Isaac Blumenstein in der Zeitschrift "Im
deutschen Reich" vom August 1898 S. 298: "Luxemburg, 9.
August (1898). Im eben vollendeten 60. Lebensjahr ist am 3. dieses Monats
der Rabbiner Dr. I. Blumenstein plötzlich am Herzschlage verstorben. Als
der einzige offizielle jüdische Feldprediger während des Krieges
1870/71, war er es, welcher jenen jüdischen Feldgottesdienst abhielt,
welcher durch das Bild 'Jom Kippur im Felde' weithin bekannt worden ist.
In Anbetracht seiner Dienste während jenes Feldzugs wurde ihm das Eiserne
Kreuz am weißen Bande verliehen. In Luxemburg, wo er 32 Jahre segensreich
gewirkt hat, erfreute er sich allgemeiner Verehrung. Der hiesige nationalliberale
'Volksbote' schreibt: 'Am Leichenzuge, der sich von der Synagoge aus
bewegte, nahmen teil Vertreter der Regierung, des Staatsrates, der
Deputiertenkammer, der Obergerichtshofes, des Bezirksgerichtes, der
Staatsanwaltschaften, der Bureaus der Stadtrates, der Militärbehörden,
der Presse usw. usw. Das Konsistorium war vollzählig erschienen; ebenso
war die hiesige Loge, deren Mitglied er gewesen, sehr zahlreich vertreten.
Eine vielhundertköpfige Menschenmenge aller Stände und aller
Konfessionen angehörend, bildete den Schluss des Leichenzuges.' Der
Bericht schließt mit den Worten: 'Sein Andenken wird nicht bloß bei
seinen Religionsgenossen, sondern auch bei allen Andersgläubigen stets gesegnet
bleiben!'" |
| Vgl. Online-Informationen
über die Großrabbiner von Luxemburg |
Zum Tod von Abraham Strauß (1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1892: "Merchingen,
Anfang Elul. Tiefe Trauer bemächtigte sich unserer Gemeinde durch
den plötzlichen Tod des Herrn Abraham Strauß. Er war bei Juden
und Christen belliebt, hoch geachtet wegen seiner Einfachheit, seiner Hochherzigkeit
und Mildtätigkeit, er war Jedem ein treuer Berater, ein neidloser,
opferfreudiger Freund, ein Vater der Witwen und Waisen. Schmerzlich ist
daher für uns dieser Verlust. Von seinem ersten Auftreten bis zu seinem
Ende hat er sich um unsere jüdische und politische Gemeinde verdient
gemacht. Schon früher, noch als junger Mann, zur Zeit der Vorstandschaft
seines seligen Vaters, Lazarus Strauß - er ruhe in Frieden -
führte er im gerechten Eifer für die Erhaltung des wahren Judentums die
Feder siegreich gegen die Neologie, und später, als jener nach fünfzigjähriger
kraftvoller, segensreicher Tätigkeit das Zeitliche segnete, wurde diese
Einstimmung zum Leiter der Gemeinde und des Bezirks berufen. Seiner
unermüdlichen Tatkraft verdankte unser Bezirk die Wahl der frommen
Rabbinen, des Dr. Louis Heilbut - das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen - für Merchingen, und nach dessen frühem Hinscheiden die des
jetzigen Bezirksrabbiners in Mosbach,
Herrn Dr. Löwenstein, Erfolge. Solche glaubenseifrige Männer berief er
an die Spitze der Bezirke in dem zielbewussten Streben, in den Gemeinden
den religiösen, frommen Sinn unter den Lehrern und Haushaltsvorständen
zu erhalten und aus den Kindern eine Generation heranzubilden, die im
schweren Kampfe mit den Neuerungen der heutigen Zeit festhält an Tora und
Gebot. So wird keiner der heiligen Gebräuche hier seitdem
vernachlässigt, alle jüdischen Institutionen werden aufs äußerste
beobachtet und aufrecht erhalten. War doch auf die Instandhaltung des Eruw,
der Mikwe, der Schechita sein Augenmerk besonders scharf
gerichtet. Dass diese Leistungen den besten Erfolg hier aufzuweisen haben,
muss man dem Einfluss seiner Persönlichkeit zuschreiben, einer Macht, die
er sich erworben durch seine Beliebtheit, seine gewissenhafte
Pflichterfüllung, seine im tiefsten Innern empfundene Überzeugung, die
eines jeden Gegners Widerspruch ausschloss und die Gesinnungstreuen nie
ermüden ließ. Denn wie er im öffentlichen Leben wirkte, so war er auch
im eigenen Hause strengstens einer, der sich genau an die Gebote hielt.
Er war ein fleißiger Besucher unserer Synagoge und befolgte die Gebote
ebenso streng und ernst, wie er sie seine Familie lehrte, und diese wusste
und verstand seine Ansichten hochzuschätzen. War er ja der beste,
liebevollste Gatte, der streng-gute Vater, der angenehme Verwandte, wie er
sich denn überhaupt in seinem ganzen Leben durch seine offenkundige
Liebenswürdigkeit ausgezeichnet. So hat denn Herr Dr. Löwenstein wohl
mit vollem Recht in seiner tief empfundenen Rede am Grabe des Freundes dem
Dahingeschiedenen nachgerufen: 'Die achtundsechzig Jahre Deines Lebens,
teuerer Freunde, waren ein wahres 'Leben' eines echten Jehudi.
Mögen die, die Dir nahe standen, Dir gleichen'. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens. D.K." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1892: "Merchingen,
Anfang Elul. Tiefe Trauer bemächtigte sich unserer Gemeinde durch
den plötzlichen Tod des Herrn Abraham Strauß. Er war bei Juden
und Christen belliebt, hoch geachtet wegen seiner Einfachheit, seiner Hochherzigkeit
und Mildtätigkeit, er war Jedem ein treuer Berater, ein neidloser,
opferfreudiger Freund, ein Vater der Witwen und Waisen. Schmerzlich ist
daher für uns dieser Verlust. Von seinem ersten Auftreten bis zu seinem
Ende hat er sich um unsere jüdische und politische Gemeinde verdient
gemacht. Schon früher, noch als junger Mann, zur Zeit der Vorstandschaft
seines seligen Vaters, Lazarus Strauß - er ruhe in Frieden -
führte er im gerechten Eifer für die Erhaltung des wahren Judentums die
Feder siegreich gegen die Neologie, und später, als jener nach fünfzigjähriger
kraftvoller, segensreicher Tätigkeit das Zeitliche segnete, wurde diese
Einstimmung zum Leiter der Gemeinde und des Bezirks berufen. Seiner
unermüdlichen Tatkraft verdankte unser Bezirk die Wahl der frommen
Rabbinen, des Dr. Louis Heilbut - das Andenken an den Gerechten ist zum
Segen - für Merchingen, und nach dessen frühem Hinscheiden die des
jetzigen Bezirksrabbiners in Mosbach,
Herrn Dr. Löwenstein, Erfolge. Solche glaubenseifrige Männer berief er
an die Spitze der Bezirke in dem zielbewussten Streben, in den Gemeinden
den religiösen, frommen Sinn unter den Lehrern und Haushaltsvorständen
zu erhalten und aus den Kindern eine Generation heranzubilden, die im
schweren Kampfe mit den Neuerungen der heutigen Zeit festhält an Tora und
Gebot. So wird keiner der heiligen Gebräuche hier seitdem
vernachlässigt, alle jüdischen Institutionen werden aufs äußerste
beobachtet und aufrecht erhalten. War doch auf die Instandhaltung des Eruw,
der Mikwe, der Schechita sein Augenmerk besonders scharf
gerichtet. Dass diese Leistungen den besten Erfolg hier aufzuweisen haben,
muss man dem Einfluss seiner Persönlichkeit zuschreiben, einer Macht, die
er sich erworben durch seine Beliebtheit, seine gewissenhafte
Pflichterfüllung, seine im tiefsten Innern empfundene Überzeugung, die
eines jeden Gegners Widerspruch ausschloss und die Gesinnungstreuen nie
ermüden ließ. Denn wie er im öffentlichen Leben wirkte, so war er auch
im eigenen Hause strengstens einer, der sich genau an die Gebote hielt.
Er war ein fleißiger Besucher unserer Synagoge und befolgte die Gebote
ebenso streng und ernst, wie er sie seine Familie lehrte, und diese wusste
und verstand seine Ansichten hochzuschätzen. War er ja der beste,
liebevollste Gatte, der streng-gute Vater, der angenehme Verwandte, wie er
sich denn überhaupt in seinem ganzen Leben durch seine offenkundige
Liebenswürdigkeit ausgezeichnet. So hat denn Herr Dr. Löwenstein wohl
mit vollem Recht in seiner tief empfundenen Rede am Grabe des Freundes dem
Dahingeschiedenen nachgerufen: 'Die achtundsechzig Jahre Deines Lebens,
teuerer Freunde, waren ein wahres 'Leben' eines echten Jehudi.
Mögen die, die Dir nahe standen, Dir gleichen'. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens. D.K." |
Zum Tod von Karoline Strauß (1907)
 Meldung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2.
August 1907: "Merchingen. Hier starb im hohen Alter von 103 Jahren
Frau Karoline Strauß. Sie war gesund bis ans Ende."
Meldung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2.
August 1907: "Merchingen. Hier starb im hohen Alter von 103 Jahren
Frau Karoline Strauß. Sie war gesund bis ans Ende." |
Auszeichnung für Emanuel Strauß in Osterburken
(1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:
"Osterburken, 28. Dezember (1908). Der Großherzog von Baden verlieh
dem Bezirksältesten, Herrn Emanuel Strauß hier, das Verdienstkreuz des
Ordens vom Zähringer Löwen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1908:
"Osterburken, 28. Dezember (1908). Der Großherzog von Baden verlieh
dem Bezirksältesten, Herrn Emanuel Strauß hier, das Verdienstkreuz des
Ordens vom Zähringer Löwen." |
60. Geburtstag des aus Merchingen
stammenden Landauer Kantors und Lehrers Willy Steinem (1928)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1928: "60. Geburtstag. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juni
1928: "60. Geburtstag.
Unser langjähriges, treu bewährtes
Vereinsmitglied, Herr Oberkantor und Lehrer Willy Steinem in Landau
(Pfalz), feierte am 18. Mai seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass
wurden ihm seitens seiner dankbaren Gemeinde und anderer Korporationen
wohlverdiente Ehrungen zuteil. Ist er doch nicht nur ein tüchtiger
Schulmann, sondern, mit prächtigem Bariton ausgestattet, auch ein
anerkannter Künstler auf dem Gebiete des synagogalen Gesanges. Steinems
Wiege stand in Merchingen (Baden). Früh verwaist, wurde er im
hause des Lehrers Oppenheimer in Arnstein
(Unterfranken) erzogen, besuchte dortselbst die Präparandenschule,
sodann das staatliche Schullehrerseminar in Würzburg. Nachdem er einige
Jahre in Kirn an der Nahe und Wiesbaden amtierte, wurde er an die
Kultusgemeinde Landau berufen, woselbst er nun über 3 Jahrzehnte
segensreich wirkt. Weit über den Kreis seiner Amtstätigkeit hinaus ist
er in allen Schichten der Bevölkerung als charaktervoller Mann geachtet
und geehrt, ob seines sonnigen Gemüts und unverwüstlichen Humors,
besonders von seinen Kollegen geschätzt und geliebt. A.St. –
U." |
Max Mai beendet seine Tätigkeit als Bezirksältester (1936)
 Mitteilung
im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt
(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat
Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai
- Merchingen zum Bezirksältesten ernannt." Mitteilung
im "Israelit" vom 4. November 1936: "Hainstadt
(Baden), 1. November (1936). Herr Synodalabgeordneter und Synagogenrat
Moritz Rosenbaum wurde anstelle des ausgeschiedenen Herrn Max Mai
- Merchingen zum Bezirksältesten ernannt." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Manufaktur- und
Herrenkonfektions-Geschäftes von N. Kahn (1907)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 29. März 1907: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 29. März 1907:
"Für mein am Samstag und Feiertagen geschlossenes Manufaktur- und
Herren-Konfektions-Geschäft suche ich per 1. Mai einen Lehrling
aus achtbarer Familie mit guter Schulbildung.
Gebrüder Eisinger Nachfolge. Inh. N. Kahn. Merchingen
(Baden)." |
|
Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
des in Merchingen
geborenen Joel Emrich |

|
|
| |
Kennkarte (Main 1939)
für Joel (Julius) Emrich (geb. 9. Juni 1867 in Merchingen),
Kaufmann,
wohnhaft in Mainz; am 27. September 1942 deportiert ab Darmstadt in
das Ghetto Theresienstadt,
wo er am 18. März 1943 umgekommen ist |
|
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
1737 erwarben die jüdischen Familien das Haus einer nichtjüdischen Familie, das sie zu einer Synagoge umbauten. Damals gab es bereits 40 jüdische Haushaltungen am Ort mit zusammen 210 Personen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude umgebaut oder durch einen Neubau ersetzt. Akten zur Merchinger Synagoge konnten bislang nicht gefunden werden, sodass ihre Baugeschichte nicht nachgezeichnet werden kann.
Einige Nachrichten von Interesse liegen aus der Zeit Ende der 1850er-Jahre vor, als von Merchingen als Sitz des Bezirksrabbinates einige verändernde Impulse ausgingen, die das gottesdienstliche Leben in den Synagogen des Bezirks bestimmen sollten. Zunächst jedoch verhielt sich das Merchinger Rabbinat wie die meisten Landrabbinate gegenüber den in den größeren Städten durchgeführten Reformen sehr zurückhaltend. Bis zu seinem Tod im August 1857 war Zacharias Staadecker 25 Jahre lang Bezirksrabbiner in Merchingen. Er gehörte der Gruppe der strenggläubigen Rabbiner an, den ein umfassendes rabbinisches Wissen, aber keine Reformfreudigkeit auszeichnete. Darin war er sich einig mit dem im benachbarten württembergischen Berlichingen amtierenden, gleichfalls streng konservativen Rabbiner Hirsch Berlinger. Beide verband eine enge Freundschaft. Mit der Wahl des Nachfolgers von Staadecker am 27. Dezember 1857 sollte sich jedoch schnell einiges ändern. Die 17 Vorsteher des Rabbinatsbezirkes Merchingen sprachen sich einstimmig für den jungen, aus Heidelberg stammenden Rabbiner Dr. Julius Fürst aus. Diese Wahl wurde damals im ganzen Land als Sensation empfunden, da man annahm, der Merchinger Bezirk würde wiederum "einen Mann von altem Schrot und Korn" wählen. So war man nach Meinung der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" (15.3.1858) auch im Rabbinat Merchingen "zur Überzeugung gelangt, dass ein Rabbiner mehr als Talmud kennen muss, wenn er seiner hohen Aufgabe zeitgemäß entsprechen soll".
Dr. Fürst sah nach seinem Dienstantritt auch sogleich einen besonderen Schwerpunkt darin, in den Gemeinden seines Bezirkes die Gottesdienste behutsam zu reformieren. Dazu gehörten die Einführung deutscher Gebete und des Gemeindegesangs sowie der "angemessene" Vortrag der Gebete. Auch die Konfirmation als gemeinsame Feier einer Jahrgangsgruppe befürwortete er in den Gemeinden. Am Wochenfest (Schawuot) Anfang Juni 1859 wurde eine solch gemeinsame Feier auch erstmals in der Merchinger Synagoge gefeiert. Die Merchinger Gemeinde machte Fürsts Reformen insgesamt gerne mit. Unterstützt wurde er auch von einem vor seinem Dienstantritt in Merchingen gegründeten jüdischen Männergesangverein. An den Schabbaten hielt er nachmittags eine deutsche Predigt, die von der Gemeinde gerne gehört wurde.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge von auswärtigen Nationalsozialisten zerschlagen. Der jüdische Kantor Bravmann und seine Frau wurden schwer misshandelt, konnten aber bald darauf auswandern. Am 5. Februar 1940 kaufte die bürgerliche Gemeinde das Synagogengebäude für 2.400 RM, das danach als Behelfsturnhalle zweckentfremdet wurde.
Nach 1945 wurde das Gebäude von alliiertem Militär beschlagnahmt und der Jüdischen Vermögensverwaltung (JRSO) übertragen. Da der Verkauf der Synagoge unter Zwang zustande kam, hatte die Gemeinde Merchingen auf Grund eines vor dem Amtsgericht Mannheim geschlossenen Vergleichs 1950 noch einmal 6.000 DM nachzuzahlen. Noch im selben Jahr wurde die ehemalige Synagoge für 4.000 DM an die katholische Kirchengemeinde Hüngheim verkauft, die hierin ihre Filialkirche in Merchingen einrichtete. Angebaut wurde ein kleiner Kirchturm mit zwei Glocken. 1951 wurde die Kirche eingeweiht. 1975 bis 1977 ist eine umfassende Erneuerung des Gebäudes vorgenommen worden. Hierbei fand man in der Dachverschalung eine Genisa mit Resten von religiösen Schriften, Schächtmessern und anderen Ritualien. Von den Funden blieb jedoch offenbar nichts erhalten.
Auf Anregung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Heidelberg (Initiator war Vorstandsmitglied Pfarrer Herbert Duffner) wurde am 6. November 1983 an der ehemaligen Synagoge ein Gedenkstein enthüllt, den der Osterburkener Künstler Bernhard Reißfelder geschaffen hat. Der damalige badische Landesrabbiner Dr. Nathan P. Levinson sprach von der jüdischen Seite. Wenige Wochen später wurde der Gedenkstein durch eine Bronzetafel ergänzt.
Adresse der ehemaligen Synagoge:
Buchenweg 15
Fotos
Historische Fotos:
|
Historische Fotos sind nicht bekannt,
Hinweise bitte an den
Webmaster von "Alemannia Judaica",
E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Foto um 1965:
(Quelle: Hundsnurscher/
Taddey
s. Lit. Abb. 148) |
 |
| |
Ehemalige Synagoge, jetzt Kirche: der Turm wurde erst Anfang der 1950er
angebaut |
| |
|
Fotos im Dezember 1983:
(Fotos: Hahn) |
 |
 |
| |
Aufnahme ähnlich wie oben |
anderer Blickwinkel |
| |
|
|
 |
 |
 |
Innenaufnahme im Dezember 1983
(Weihnachtsbäume) |
Blick nach Osten |
Innenaufnahme
|
| |
|
| |
|
|
| |
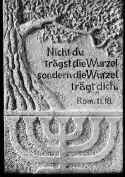 |
 |
| |
Gedenktafel |
Hinweistafel |
| |
|
|
Fotos 2003:
(Fotos: Hahn bzw.
D. Bluthardt (B),
Aufnahmedatum 2.9.2003) |
 |
 |
| |
Blick vom jüdischen Friedhof
zur
ehemaligen Synagoge (B) |
Die ehemalige Synagoge (B) |
| |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Seitenansicht (von Süden) |
Seitenansicht (von Norden) |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Gedenktafel |
Hinweistafel |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Dezember 2011:
Pressebericht zur Erinnerung an die jüdische
Gemeinde |
Artikel von Walter Brecht in den
"Fränkischen Nachrichten" vom 24. Dezember 2011: "FN-Serie
Heimat: Ehemalige blühende jüdische Gemeinde Merchingen endete 1942 in
Auschwitz / Anfänge im 13. Jahrhundert nicht nachzuweisen. Juden
und Christen lebten im Einklang...."
Link
zum Artikel. |
| |
| Mai 2012:
In Merchingen werden "Stolpersteine" verlegt |
Artikel in den "Fränkischen
Nachrichten" vom 21. Mai 2012: "In Merchingen: 'Stolpersteine'
für Ida und Nathan Fleischhacker verlegt / Geschichte der Familie kann
bis 1720 zurückverfolgt werden. Große Kraft der Erinnerung in den
Orten..."
Link
zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 198ff. |
 | Merchingen
1188-1988.
Hg. Förderverein Schlossausbau e.V. Ravenstein 1988 (mit Abdruck von Karl
Renz: Geschichte Merchingens. Adelsheim 1902), hierin Abschnitt "Die
ehemalige Judengemeinde Merchingen" S. 209-216. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -
Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from
their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem
1986. S. 409-411. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 | Rudolf Landauer, Reinhart Lochmann: Spuren jüdischen Lebens im Neckar-Odenwald-Kreis. Herausgegeben vom Landratsamt NOK, 2008, ISBN: 978-3-00-025363-8. 200 S., 284 Fotos, 19,90 Euro.
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Merchingen Baden. The
first Jews settled after the Thirty Years War (1618-48) and by 1740 they
numbered 40 families. A synagogue was consecrated in 1737 and a cemetery opened
in 1768. A Jewish elementary school was in operation from the 1830s. In 1850,
the Jewish population reached a peak of 325. R. Dr. Y. Blumenstein served as one
of the two Jewish chaplains in the Franco-Prussian War of 1870-71. With
emigration and the exodus to the big cities, the Jewish population dropped to
101 in 1900 (total 967) and 39 in 1933. Under Nazi rule, 12 Jews emigrated by
1938 and six in 1939 after the synagogue was vandalized on Kristallnacht
(9-10 November 1938). Nine others left for other German cities. The last three
Jews (and three living in other cities) were deported to the Gurs concentration
camp on 22 October 1940; five perished in Auschwitz.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|