|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht "Synagogen im
Kreis Kaiserslautern"
Niederkirchen (Westpfalz)
(VG
Otterberg, Kreis Kaiserslautern)
mit Relsberg (VG Wolfstein, Kreis Kusel)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Niederkirchen bestand eine jüdische
Gemeinde bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18.
Jahrhunderts zurück, doch werden bereits in einer Einwohnerliste von 1696
zwei Juden am Ort genannt. 1769 gab es fünf jüdische Familien in
Niederkirchen.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie
folgt: 1801 48 jüdische Einwohner (15,6 % der Gesamteinwohnerschaft), 1808
64 (in 13 Familien), 1825 79 (15,9 %), 1848 112 (in 22 Familien), 1859 22
Familien, 1875 80 jüdische Einwohner, 1900 58.
1809/10 werden die folgenden jüdischen Haushaltsvorstände in
Niederkirchen genannt:
Abraham Dalsheimer (Händler), David Heymann (Händler), Marx Heymann
(Händler), Joseph Neu I (Händler), Joseph Neu II, Gabriel Weltz
(Kleinhändler), Michel Weltz (Kleinhändler).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische
Schule (im Synagogengebäude s.u.), ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schochet tätig war. Ab Oktober 1837 war als der erste staatliche geprüfte jüdische Lehrer am Ort M.
Salomon. Um 1870 wird Lehrer Sender genannt (in "Der Israelitische Lehrer" 1874
S. 71). Letzter Lehrer war Salomon Waldbott. Als er 1906 in den Ruhestand trat,
wurde die Schule aufgelöst. Danach war als ehrenamtlicher Vorbeter Max Mayer
tätig. Zu den hohen Feiertagen im Herbst bemühte sich die Gemeinde um einen
Hilfsvorbeter (siehe unten Anzeige von 1926). Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat
Kaiserslautern. Von den jüdischen
Vereinen am Ort wird 1913 ein Israelitischer Frauenverein
genannt (Israelitisches Familienblatt 1.10.1913 S. 8). Vorsitzende des
Frauenvereins war um 1933 Rosalie Meyer.
Als Gemeindevorsteher wird um 1897/99 S. Meyer genannt, bis 1923 Max
Mayer, nach ihm bis nach 1933 Elias Herz.
Um 1924, als zur Gemeinde noch 25 Personen gehörten (3,2 % von insgesamt
etwa 800 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher neben Elias Herz als erstem
Vorsteher auch Emanuel Berg und Sylvain Levy.
1933 lebten noch 19 jüdische Personen in Niederkirchen.
Die Gemeindevorsteher waren weiterhin Elias Herz (1. Vors.) und mit ihm Gustav Mayer (2. Vors.)
sowie
Gustav Felsenthal (3. Vors.). In
den folgenden Jahren sind die meisten jüdischen Einwohner auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1936 wurden noch 21
jüdische Bewohner festgestellt, 1937 18 und 1938 13 ("Jüdisches Gemeindeblatt
für das Gebiet der Rheinpfalz" vom 1.11.1938 S. 2). Beim Novemberpogrom
1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.). Im Oktober 1940 wurde ein
jüdischer Einwohner (Samuel Forst) in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert;
1942 ist die letzte jüdische Einwohnerin deportiert worden.
Im Anhang
eine
Übersicht über die jüdische Bevölkerungsentwicklung von 1930 bis 1945 im
Landkreis Kusel mit Nennung von vier Personen aus Helfersweiler/Relsberg:
Karl Herz (geb. 1889) und Henriette Herz geb. Felsenthal (geb. 1892) sowie
Lieselotte Herz (1921) und Ilse Herz (1924) (Mitteilung von 1962 an den
Internationalen Suchdienst in Arolsen; pdf-Datei).
Von den in Niederkirchen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gustav Erich Felsenthal
(1874), Samuel Forst (1871), Ida Fränkel geb. Dalsheimer (1865), Karoline
Fränkel (1870), Ernst Heimann (1897), Berta Herz geb. Rosenberg (1866), Karl
Herz (1889), Richard Herz (1884), Melanie Loeser geb. Waldbott (1876), Antonie Therese Neuberger geb.
Mayer (1891), Josef Ney (1863), Ludwig Strauß (1855), Leo Waldbott (1875), Bella
(Isabella) Berta Windmüller geb. Forst (1905).
Aus Relsberg sind umgekommen: Henriette Herz geb. Felsenthal (1892), Karl
Herz (geb. 1889 in Niederkirchen, wohnte später in Relsberg).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Nennung von Lehrer M. Salomon in
Niederkirchen (1841)
 Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern
1) Winnweiler, J. Strauss 7. März 1830.
2) Alsenz, B. Weinschenk, 28. August 1830.
3) Odenbach, Is. C. Kampe, 16.
Februar 1831.
4) Otterberg, J. Lehmann, 11. Juni 1831
(Nach dessen Versetzung J. Asser, jetzt gestorben, und an dessen Stelle
jetzt Mandel.)
5) Steinbach, S. Frenkel, 11.
August 1831.
6) Münchweiler, J. Strauß, 15.
Januar 1832.
7) Kirchheimbolanden, Adler,
28. Juli 1832 (an dessen Stelle später der ebenfalls wackere Jakob
Sulzbacher).
8) Kaiserslautern, A. Kahn, 23.
Mai 1833 (später Walz).
9) Hochspeyer, H. Rothschild, 4.
August 1833 (später in Niederhochstadt und jene Stelle ist noch unbesetzt).
10) Gauersheim, B. Feistmann, 30.
Dezember 1834 (gestorben)
11) Börrstadt, Jos. Abr. Blum, 20.
Februar 1836 (versetzt nach Hagenbach, und hier B. Alexander).
12) Rockenhausen, M. Eigner, 28.
Oktober 1837.
13) Niederkirchen, M. Salomon, 11.
Oktober 1837.
14) Marienthal, Isaac Lob, 18. März
1838 (später J. Frank, pensioniert unterm 23. August 1838, für ihn S.
Wolff)." |
Die Schulstelle in Niederkirchen
wurde aufgelöst (Bericht 1907)
 Artikel in
"Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1907: "Bericht über die
9. Jahresversammlung der Freien
Vereinigung israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Die diesjährige
Versammlung, welche am 9. Mai in Landau stattfand, war sehr gut besucht. Von
42 Mitgliedern waren 31 anwesend. Diese erfreuliche, rege Anteilnahme darf
wohl zurückgeführt werden auf die reichhaltige Tagesordnung, welche diesmal
lediglich pfälzische Schul- und Anstellungsverhältnisse, sowie Verbandsangelegenheiten zur Beratung stellte... Artikel in
"Israelitisches Familienblatt" vom 13. Juni 1907: "Bericht über die
9. Jahresversammlung der Freien
Vereinigung israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Die diesjährige
Versammlung, welche am 9. Mai in Landau stattfand, war sehr gut besucht. Von
42 Mitgliedern waren 31 anwesend. Diese erfreuliche, rege Anteilnahme darf
wohl zurückgeführt werden auf die reichhaltige Tagesordnung, welche diesmal
lediglich pfälzische Schul- und Anstellungsverhältnisse, sowie Verbandsangelegenheiten zur Beratung stellte...
... In diesem Jahre sind die drei Kollegen: Wolff-Steinbach,
Waldbott-Niederkirchen und Blüthe aus dem aktiven Dienste geschieden. Diesen
sowohl als auch dem anwesenden pensionierten Kollegen Moses wünscht der
Vorsitzende, dass sich dieselben noch recht lange der wohlverdienten Ruhe
erfreuen möchten..."
Zu Punkt 2A der Tagesordnung:
'Über pfälzische Schul- und Anstellungsverhältnisse', hatte an Stelle des
erkrankten Kollegen Nakler - Kaiserslautern der stets hilfsbereite Kollege
Rosenwald - Steinbach das Referat übernommen. Referent ist der Meinung, dass
für die Erhaltung von Stellen nicht in dem Maße gearbeitet wurde, wie man
hätte erwarten sollen. Die Stelle in Niederkirchen ist aufgelöst worden,
jene in Haßloch und
Venningen müssen erhalten werden. Die Gemeinde in
Venningen beabsichtigt nämlich die Auflösung der Schulstelle, wenn deren
Inhaber zum Militär einberufen wird. Betreffs des Falles 'Kaiserslautern'
verwies Referent auf seine Ausführungen im Verbandsorgan. Das Ministerium
muss unbedingt von der Notlage der jüdischen Lehrer der Pfalz Kenntnis
bekommen. Die Fachpresse muss diese Angelegenheit zur Erörterung bringen und
der Bayerische Lehrerverein muss hierzu Stellung nehmen..." |
Anzeige zur Suche eines
Hilfsvorbeters für die hohen Festtage (1926)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 26. August 1926: "Für die hohen
Festtage suchen wir einen tüchtigen Hilfsvorbeter. Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 26. August 1926: "Für die hohen
Festtage suchen wir einen tüchtigen Hilfsvorbeter.
Meldungen mit Gehaltsansprüchen erbeten an den
Vorstand der Synagogengemeinde
Niederkirchen bei Kaiserslautern E. Herz." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
96. Geburtstag von Max Mayer
 Mitteilung
im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1925: "Niederkirchen
(Bezirk Kaiserslautern). Am 7. Juli begehen Herr Max Mayer seinen 96.
Geburtstag. Mayer ist geistig noch rüstig, hat bis vor zwei Jahren die
Stelle eines 1. Vorstandes begleitet und seit Auflösung der Lehrerstelle bis
zu dieser Zeit den Synagogendienst versehen." Mitteilung
im "Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1925: "Niederkirchen
(Bezirk Kaiserslautern). Am 7. Juli begehen Herr Max Mayer seinen 96.
Geburtstag. Mayer ist geistig noch rüstig, hat bis vor zwei Jahren die
Stelle eines 1. Vorstandes begleitet und seit Auflösung der Lehrerstelle bis
zu dieser Zeit den Synagogendienst versehen." |
Der Viehhändler Forst aus
Niederkirchen wurde in Kaiserslautern sehr wahrscheinlich ermordet (1935)
 Anzeige
in "Die Stimme" vom 27. August 1935: "Ein Mord in Kaiserslautern Anzeige
in "Die Stimme" vom 27. August 1935: "Ein Mord in Kaiserslautern
Kaiserslautern, 23. August. Der 26 Jahre alte jüdische Viehhändler
Forst aus Niederkirchen wurde von einem Gendarmeriebeamten nach
Kaiserslautern gebracht. In einem unbewachten Augenblick stürzte Forst
aus einem Fenster im zweiten Stock auf die Straße, wo er bewusstlos
liegen blieb. Er wurde ins Krankenhaus überführt. Gegenüber dieser amtlichen
Darstellung des Vorfalles erhält sich in Kaiserslautern hartnäckig das
Gerücht, Forst sei nicht freiwillig aus dem Fenster gesprungen, sondern
von Gestapo-Leuten hinaus gestürzt worden." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige zum Tod von Josefina
Felsenthal geb. Sender (1937)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. August 1937: "Am 4. August
1937 verschied meine innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. August 1937: "Am 4. August
1937 verschied meine innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau
Josefine Felsenthal geb. Sender
im Alter von 59 Jahren.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen
Gustav Felsenthal, Leo Felsenthal,
Erna Levy geb. Felsenthal.
Erich Felsenthal, Sylvain Levy, und Anverwandte.
Niederkirchen, Sarreguemines, New York, August 1937." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Betraum vorhanden. 1842/43 konnte die
jüdische Gemeinde eine 1833 von Michael Göttel erbaute Scheune erwerben. Diese
wurde zwischen 1852 und 1858 zu einer Synagoge mit Schule und Lehrerwohnung umgebaut.
Bis 1918 wohnte der jeweilige Lehrer in der Wohnung. Danach konnte die Gemeinde
keinen eigenen Lehrer mehr anstellen, sodass die Wohnung im Synagogengebäude an
andere Gemeindeglieder vermietet werden konnte. Bei der Synagoge handelte es
sich um ein 13,20 m x 10 m großes repräsentatives Gebäude. Charakteristisch
waren die Hufeisenbögen an Fenstern und Eingangsportal. Im Giebel über dem
Eingang war ein Zwillingsfenster. Im Betsaal hatte es 90 Plätze für Männer;
auf der Empore 50 für Frauen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge niedergebrannt. Beim Brand
wurde auch das Reisegepäck von Bella Mayer zerstört, die vorübergehend in der
Synagoge wohnte, während sie sich an diesem Tag auf dem amerikanischen Konsulat
in Stuttgart aufhielt, um die Ausreisepapiere abzuholen. Die Brandruine wurde
wenig später abgebrochen. Das Grundstück der Synagoge wurde 1949 an die
Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz rückübertragen und von diese 1961
an einen Landwirt verkauft. Diese erstellte auf dem Grundstück einen großen
Stall.
Adresse/Standort der Synagoge: Talstraße
15 (früher: Haus Nr. 36)
Fotos
(Quelle: obere Reihe links Weber s.Lit. S. 129; andere
Abbildungen: Landesamt s.Lit. S. 290-291)
| Historische Ansichten |
 |
 |
|
Die Synagoge links im
Vordergrund vor 1938 |
Die Synagoge um 1930
(Ausschnitt aus einer Ortsansicht) |
| |
|
|
| Rekonstruktionen |
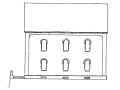 |
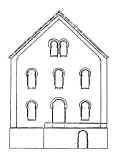 |
| |
Seitenansicht |
Synagoge von
Westen
mit Eingangsbereich |
| |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
|
Oktober 2024:
In Speyer wird ein
"Stolperstein" für die aus Niederkirchen stammenden Eugenie Blum geb.
Fischel und Tochter Betty Blum verlegt |
Artikel in der "Rheinpfalz" vom 16. Oktober
2024: "SPEYER. Stolpersteine: Ein Messingstein für die 'Eiserne Jungfrau'
des Eisenwarenhandels
Am Dienstag, 22. Oktober, werden Stolpersteine vor sechs Anwesen in der
Speyerer Kernstadt verlegt. Sie erinnern an die Schicksale jüdischer Opfer
des Nationalsozialismus, die einst in diesen Häusern lebten. Die
ehrenamtliche Stolperstein-Initiative hat diese recherchiert und
aufgeschrieben. Heute geht es um Betty und Eugenie Blum aus der Landauer
Straße 60.
Ein Ehepaar baut sich ein Geschäft auf, zieht nach Speyer um, unterstützt
die Bildung seiner Söhne und Töchter und akzeptiert die nicht-jüdische
Partnerwahl sowie die Umzugs- und Auswanderungspläne ihrer vier Kinder.
Während der Zeit des Nationalsozialismus aber erlebt die Familie
Entrechtung, Demütigung, brutale Gewalt und Enteignung. Es sind
einschüchternde Zäsuren im Lebenslauf, begleitet von Hoffnung und
Verzweiflung. Betty Blum wird am 6. März 1882 in Niederkirchen bei
Kaiserslautern geboren. Ihre Eltern Moritz Blum (1850-1919) und Eugenie geb.
Fischel (1857-1934), betreiben dort eine Eisenwarenhandlung, die von den
Großeltern Isac und Marianne Felsenthal gegründet worden war. Eugenie
arbeitet im Geschäft ihres Mannes mit. Sie ist ebenso wie ihr Mann auf dem
jüdischen Friedhof beerdigt.
Zeit in London. Betty wächst mit ihrer älteren Schwester Martha
(geboren 1878), der jüngeren Lisa (1885) und ihrem Bruder Eugen (1879) auf.
Sie ist neun Jahre alt, als die Familie nach Speyer übersiedelt, wo die
Eltern das Geschäft in der Wormser Straße 8 eröffnen. Zunächst wohnen die
Blums im Geschäftshaus, bis Betty und ihre Mutter 1931 zur Miete in die
Villa am Rosensteiner Hang ziehen. Nach Abschluss der höheren Töchterschule
in der Hagedornsgasse zieht es Betty nach England. In London bringt sie den
Kindern des Konsuls von Nicaragua Fremdsprachen bei und gibt ihnen
Klavierstunden. Nach Speyer zurückgekehrt, übernimmt sie aushilfsweise eine
Lehrerstelle in ihrer ehemaligen Schule für Englisch, Französisch, Rechnen,
Geschichte und Erdkunde. 1919 stirbt ihr Vater und Betty übernimmt die
Leitung der Eisenwarenhandlung, die sie äußerst erfolgreich führt. Sie
verschafft sich Respekt und wird in der Speyerer Gesellschaft scherzhaft die
'Eiserne Jungfrau' genannt. Vielseitig interessiert und sportlich, engagiert
sich die Zigarrenraucherin auch in der Kommunalpolitik. Auf dem Foto schaut
uns eine selbstbewusste und etwas skeptisch blickende Dame an, die weiß, was
sie will. Im Gegensatz zu ihren Geschwistern, die christliche Ehepartner
geheiratet hatten, bleibt Betty ledig.
Nach Operation gestorben. Am 1. Januar 1936 wird das Geschäft
'arisiert'. Daraufhin fasst sie den Entschluss, zu ihrer Schwester Lisa nach
Ostafrika auszuwandern. Der Reisepass war zwar schon ausgestellt, zur
Ausreise kommt es aber nicht mehr, da Betty Blum an den Folgen einer
Operation am 18. April 1936 im jüdischen Krankenhaus in Mannheim stirbt.
Bettys Schwester Martha, die den Katholiken Josef Fendrich geheiratet hat,
bekommt zwei Söhne: Walter (1906) und Ernst (1908). Von Ludwigshafen aus
wird sie im Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt in Böhmen verschleppt.
Sie überlebt die Shoah, stirbt 1960. 2009 wurde für sie in Ludwigshafen ein
Stolperstein verlegt. Am kommenden Dienstag werden nun auch für Eugenie Blum
und ihre Tochter Betty zwei Stolpersteine vor dem Haus Landauer Straße 60
verlegt."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Alfred Hans Kuby (Hrsg.): Pfälzisches Judentum
gestern und heute. Beiträge zur Regionalgeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. 1992. |
 | Karl Bäcker: Die Juden in Niederkirchen. In:
Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern. 1991. S. 36-39. |
 | Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter
besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.
S. 146-147. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 291-292 (mit weiteren Literaturangaben).
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|