|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
zur Übersicht
"Synagogen im Donnersbergkreis"
Kirchheimbolanden mit
Marnheim und Morschheim (Donnersbergkreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Kirchheimbolanden bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/40. Ihre
Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhunderts zurück. Erstmals
wird ein jüdischer Einwohner 1537 genannt.
1718 waren zehn jüdische Familien am Ort. Im 19. Jahrhundert nahm die Zahl
schnell zu: von 40 jüdischen Gemeindegliedern 1804 auf 201 im Jahr 1825.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner allerdings wieder zurück: von
1848 167 Personen in 31 Familien auf 1875 111, 1897 84 (in 23 Familien, von
insgesamt 3459 Einwohnern), 1900 83, 1905 79. Seit der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts gehörten auch die in Marnheim
und Morschheim lebenden jüdischen Personen
zur Gemeinde in Kirchheimbolanden (1925/32 nur noch eine Person aus Marnheim).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische
Schule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgabe der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,
der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen der
Stelle unten). Erster Lehrer an der jüdischen Schule war ab 1832 Lehrer Adler,
gefolgt 1834 von Jakob Sulzbacher (bis 1866, gest. 1868), um 1892/1920 Simon
Silbermann (1897 zehn jüdische Kinder an der Simultanschule; 1908 Ernennung zum
Hauptlehrer).
Die Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat
Kaiserslautern,
hatte aber noch im 19. Jahrhundert zeitweise einen eigenen Rabbiner (vgl.
den bei der Synagogeneinweihung 1836 genannten Rabbiner H. Kohn, und wiederum
nach 1863 Rabbiner Seligmann aus Kaiserslautern,
siehe Bericht unten).
Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1840 Leo Levy, um 1892/94 Herr
Goldmann, um 1895 D. Levi, J. Metzger, um 1897 Abraham Metzger, A. Decker II, H. Schwarz, um 1903/05
Adolph
Kaufmann.
Als Synagogendiener wird 1897 ein Herr Scholem genannt.
In den Kriegen 1866 und 1870/71 war aus der jüdischen Gemeinde
Kirchheimbolanden Abraham Metzger Kriegsteilnehmer. Zuletzt war er Ehrenmitglied
der Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Er starb im Alter von
92 Jahren 1935 (Israelitisches Familienblatt vom 24.12.1935, siehe
Todesanzeige unten).
Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Oberarzt Dr. Josef
Schwarz (geb. 12.6.1887 in Kirchheimbolanden, gef. 22.3.1918). Für seinen
Kriegseinsatz wurde der Unteroffizier der Reserve Jean Freund von der Haide
(beim 22. bayerischen Reserve-Infanterieregiment) mit der Eisernen Kreuz II
aufgezeichnet.
Um 1925, als noch 70 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (knapp
2 % der insgesamt ca. 3.600 Einwohner) waren die Gemeindevorsteher H.
Decker, Dr. Stern, A. Metzger (1932: 1. Vors. D. Stern, 2. Vors. Sigmund
Metzger, 3. Vors. Fritz Schwarz). Den jüdischen Religionsunterricht erhielten
im Schuljahr 1932/33 acht schulpflichtige jüdische Kinder. Von 1927 bis 1929
war Religionslehrer David Bär (siehe Bericht unten). Nach seinem Weggang
wurde die Stelle erneut ausgeschrieben (siehe unten).
1933 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 65 Personen an. Mit Zunahme
der Entrechtung in der NS-Zeit und den Auswirkungen des wirtschaftlichen
Boykotts verzogen immer mehr von ihnen in andere Städte oder wanderten aus. Bis
1938 war die Zahl auf 30 zurückgegangen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde
die Synagoge niedergebrannt (s.u.), jüdische Wohnungen und Geschäfte wurden
verwüstet. Am 1. September 1939 wurden 16 jüdische Einwohner gezählt. Im
Oktober 1940 wurden zehn der letzten elf jüdischen Einwohner nach Gurs
deportiert.
Von den in Kirchheimbolanden geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben
nach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem
und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna (Anna) Baer geb.
Metzger (1878), Thekla Decker (1879), Pauline Ewers (1864), Emilie Goldmann
(1881), Eugenie Goldmann (1883), Lilli (Karoline) Goldmann (1878), Caroline
(Karoline) Haußmann geb. Rosenthal (1890), Günter Jacob Haußmann (1928),
Johanna Haußmann (1885), Karl Haußmann (1933), Ludwig Haußmann (1877), Karl
Hohmann (1886), Isidor Schwarz (1880), Elise Kahn (1861), Elfriede Klein (1920),
Herbert Klein (1917), Ludwig Lindt (1870), Hannelore Marx (1928), Alfred Metzger
(1880), Paula Metzger (1885), Anna Neumond geb. Schwarz (1889), Luise
Ottenheimer geb. Kaufmann (1889), Hermine Scholem (1878), Ludwig Scholem (1875),
Isidor Schwarz (1880, Foto des Grabsteines in Gurs siehe unten), Rosa (Rosalie) Wassermann (1864), Benjamin Weiss (1892),
Elisabeth Weil geb. Schwarz (1886).
Von den in Marnheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen
Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Arthur Decker (1881),
Frieda Decker (1871), Gustav Decker (1890), Helene Decker (1860), Hedwig Weil
geb. Decker (1886).
Nach 1945 lebten nur noch vereinzelt jüdische Personen in Kirchheimbolanden.
1948 wurden drei jüdische Einwohner in Kirchheimbolanden gezählt von damals
insgesamt 126 jüdischen jüdischen Personen, die damals zur "Israelitischen
Kultus-Vereinigung der Rheinpfalz" gehörten.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stellen des israelitischen Lehrers an der Kommunalschule
1873
sowie des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1877 /
1878 / 1924 / 1929 bzw. eines Hilfsvorbeters 1903 / 1904
bzw. eines Vorbeters für die hohen
Feiertage (1930)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September
1873: "Schuldiensterledigung. Kirchheimbolanden, bayerische
Rheinpfalz. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September
1873: "Schuldiensterledigung. Kirchheimbolanden, bayerische
Rheinpfalz.
Die Lehrerstelle der unteren Abteilung der I. Knabenklasse an der hiesigen
Kommunalschule ist durch Übernahme einer anderweitigen Stellung des
seitherigen Lehrers in Erledigung gekommen und soll, und zwar mit einem
israelitischen Lehrer sofort wieder besetzt werden.
Der Gehalt beträgt jährlich:
1. bar aus der Gemeindekasse fl. 500
2. außerdem bei Übernahme des Vorbeterdienstes aus dem israelitischen
Kultusfonds fl. 300
3. für Erteilung des Religionsunterrichtes der israelitischen Schüler an
der Lateinschule hier fl. 42
Zusammen: fl. 892.
Bewerber um diese Stelle wollen ihre desfallsigen Gesuche mit den
erforderlichen Zeugnissen versehen, binnen 14 Tagen bei dem unterfertigten
Amte einreichen.
Kirchheimbolanden, den 22. August 1873.
Das Bürgermeisteramt. Gez. W. Ritterspach.
Bezugnehmend auf vorstehendes Ausschreiben, erlaube ich mir, die Bewerber
darauf aufmerksam zu machen, dass ad. 2 diejenigen mit musikalischen
Kenntnissen bevorzugt werden, und dieselben alsdann auch einen nicht
unbedeutenden Nebenverdienst hierdurch erhalten.
Der Vorstand Gez. L. Goldmann." |
|
|
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1877: "Die hiesige Kantorstelle ist erledigt und soll alsbald wieder
besetzt werden. Gehalt 800 Mark nebst freier Wohnung mit 2 Gärten. Das
Schlachten, welches mit verbunden ist, trägt außerdem 500 Mark ein.
Derselbe hat Gelegenheit sein Einkommen zu vergrößern. Musikalische
Ausbildung ist erwünscht. Lusttragende belieben ihre Gesuche an den
hiesigen unterzeichneten Kultusvorstand einzureichen. Kirchheimbolanden.
M. Decker, Vorstand." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1877: "Die hiesige Kantorstelle ist erledigt und soll alsbald wieder
besetzt werden. Gehalt 800 Mark nebst freier Wohnung mit 2 Gärten. Das
Schlachten, welches mit verbunden ist, trägt außerdem 500 Mark ein.
Derselbe hat Gelegenheit sein Einkommen zu vergrößern. Musikalische
Ausbildung ist erwünscht. Lusttragende belieben ihre Gesuche an den
hiesigen unterzeichneten Kultusvorstand einzureichen. Kirchheimbolanden.
M. Decker, Vorstand." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.
August 1878: "Die hiesige Kantorstelle soll provisorisch auf die Dauer
eines Jahres besetzt werden mit einem Gehalte von 800 Mark. Mitverbunden
wird der Religionsunterricht mit einem Gehalte von circa 350 Mark. Auch
kann das Schächten mit übernommen werden, welches mehrere hundert Mark
einträgt. Musikalische gebildete Bewerber haben den Vorzug. Diesbezügliche
Gesuche werden sofort erbeten. Kirchheimbolanden, bayrische Pfalz, im
August 1878. Der Kultusvorstand M. Decker." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28.
August 1878: "Die hiesige Kantorstelle soll provisorisch auf die Dauer
eines Jahres besetzt werden mit einem Gehalte von 800 Mark. Mitverbunden
wird der Religionsunterricht mit einem Gehalte von circa 350 Mark. Auch
kann das Schächten mit übernommen werden, welches mehrere hundert Mark
einträgt. Musikalische gebildete Bewerber haben den Vorzug. Diesbezügliche
Gesuche werden sofort erbeten. Kirchheimbolanden, bayrische Pfalz, im
August 1878. Der Kultusvorstand M. Decker." |
| |
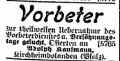 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903:
"Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes am
Versöhnungstage gesucht. Offerten an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1903:
"Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes am
Versöhnungstage gesucht. Offerten an
Adolph Kaufmann, Kirchheimbolanden (Pfalz)." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1.
September 1904: "Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes
am Versöhnungstage gesucht. Offerten an Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1.
September 1904: "Vorbeter zur teilweisen Übernahme des Vorbeterdienstes
am Versöhnungstage gesucht. Offerten an
Adolph Kaufmann,
Kirchheimbolanden." |
| |
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Juni 1924: "Gesucht ein
seminaristisch gebildeter Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Juni 1924: "Gesucht ein
seminaristisch gebildeter
Lehrer als Kantor und Religionslehrer
gegen Bezahlung nach Besoldungsordnung.
Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden, Pfalz. J. Decker."
|
| |
 Anzeige in der Zeitschrift des "Central-Vereins" vom
20. September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden
(Pfalz) sucht möglichst sofort einen seminaristisch gebildeten Lehrer als
Religionslehrer und Kantor. Gehalt nach Besoldungsverordnung. J. Decker". Anzeige in der Zeitschrift des "Central-Vereins" vom
20. September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Kirchheimbolanden
(Pfalz) sucht möglichst sofort einen seminaristisch gebildeten Lehrer als
Religionslehrer und Kantor. Gehalt nach Besoldungsverordnung. J. Decker". |
| |
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1930: "Für die hohen
Feiertage Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1930: "Für die hohen
Feiertage
Vorbeter gesucht, der auch Schofar blasen kann.
Kirchheimbolanden (Rheinpfalz). Der Vorstand der israelitischen
Kultusgemeinde. D. Stern." |
Nennung von Lehrer Adler in
Kirchheimbolanden (ab 1832; 1841)
 Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern
1) Winnweiler, J. Strauss 7. März 1830.
2) Alsenz, B. Weinschenk, 28. August 1830.
3) Odenbach, Is. C. Kampe, 16.
Februar 1831.
4) Otterberg, J. Lehmann, 11. Juni 1831
(Nach dessen Versetzung J. Asser, jetzt gestorben, und an dessen Stelle
jetzt Mandel.)
5) Steinbach, S. Frenkel, 11.
August 1831.
6) Münchweiler, J. Strauß, 15.
Januar 1832.
7) Kirchheimbolanden, Adler,
28. Juli 1832 (an dessen Stelle später der ebenfalls wackere Jakob
Sulzbacher).
8) Kaiserslautern, A. Kahn, 23.
Mai 1833 (später Walz).
9) Hochspeyer, H. Rothschild, 4.
August 1833 (später in Niederhochstadt und jene Stelle ist noch unbesetzt).
10) Gauersheim, B. Feistmann, 30.
Dezember 1834 (gestorben)
11) Börrstadt, Jos. Abr. Blum, 20.
Februar 1836 (versetzt nach Hagenbach, und hier B. Alexander).
12) Rockenhausen, M. Eigner, 28.
Oktober 1837.
13) Niederkirchen, M. Salomon, 11.
Oktober 1837.
14) Marienthal, Isaac Lob, 18. März
1838 (später J. Frank, pensioniert unterm 23. August 1838, für ihn S.
Wolff)." |
Lebensgeschichte des Lehrers Jacob
Sulzbacher (geb. 1809 in Sulzbach,
gest. 2. Dezember 1868 in
Kirchheimbolanden)
Anmerkung: Jacob Sulzbacher war der Sohn des jüdischen Lehrers in
Pfarrweisach Samson Wolf (Sulzbacher), der nach 1817 und
bis um 1832 in Pfarrweisach als Lehrer tätig war. Sein Sohn Jacob lernte in
Memmelsdorf, dann
Burgpreppach und schließlich an der
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg. Zunächst war
er an verschiedenen Gemeinden jeweils kurzzeitig Lehrer, u.a. in
Obrigheim, wo er seinen erblindeten Bruder
unterstützte, dann von 1834 bis 1866 bzw. 1868 in
Kirchheimbolanden.
 Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Dezember 1868: "Jacob Sulzbacher Artikel
in "Der israelitische Lehrer" vom 23. Dezember 1868: "Jacob Sulzbacher
ist tot, entrissen den liebenden Kindern, den zahlreichen Freunden. Wir
standen weinend an seinem Grabe; die endblätterten Bäume, die winterliche
Natur rings um uns her schien mit uns zu trauern. Doch über Berg und Tal,
über Bäume, Gräber und Leichensteine hinweg glänzte ein heller Sonnenstrahl
und spiegelte sich in unseren Tränen, dass sie wie Perlen, wie Tautropfen
erglänzten; - die Liebe stirbt nicht.
Die Liebe lebt ewig. Sie ist das Wahrzeichen der Menschheit, der
Unsterblichkeit. 'Die Lehrer werden erglänzen wie der Strahl des Himmels
und die Viele zur Gerechtigkeit führten, wie die Sterne immer da und ewig'.
(Daniel 12,3, hebräisch und deutsch).
So wollen wir denn in diesen Zeilen dem heimgegangenen Freunde ein Denkmal
unvergänglicher Liebe, heiliger und erhebender Erinnerung an sein Sterben
und Wirken im Leben setzen; uns zum Troste, Allen ein leuchtendes Vorbild.
'Ich bin' - so schrieb der Verblichene in den uns vorliegenden
Aufzeichnungen aus den letzten Monden seines Lebens - 'am 9. Februar 1809 zu
Sulzbach in der bayerischen
Oberpfalz geboren, woselbst mein Vater seligen Andenkens, damals noch Samson
Wolf genannt, Unterkantor war. Er war selbst in
Sulzbach geboren, Sohn des
gedachten Wolf und der Frau Rachel geb. Katzenellenbogen. Diese war
die älteste Tochter des berühmten Gelehrten Naphtali Hirsch
Katzenellenbogen*, weiland Pfalzrabbiners zu Mannheim, und soll nach den
vielen Erzählungen meines seligen Vaters eine sehr fromme, geistreiche Frau
gewesen sein'.
Nach einem Stammbaum (sefer hajuchasin), der sich in den Händen der
Kinder unseres seligen Freundes befindet, gehören dieselben demnach der
hochberühmten und ehrwürdigen Familie Katzenellenbogen an, die ihren
Ursprung bis auf jenen Saul Wahl, der Rabbiner zu Brisk (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Saul_Wahl) und, der
vielbekannten Sage nach, eine Nacht Wahlkönig von Polen war (sc.
man lese das herrliche: 'Mendel Gibbor' von Bernstein: 'Wir sinnen von
Königlichem Geblüt') und weiter auf Rema (Rabbi Moses Isserles
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Isserles), Raban (Rabbi
Elieser ben Natan
https://de.wikipedia.org/wiki/Elieser_ben_Nathan_aus_Mainz) und Eljakim
aus dem
Geschlechte Raschis (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Raschi) zurücklenkt, welcher Familie
bekanntlich auch Gabriel Rieser (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Riesser) und die edlen Montefiore
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore) angehören.
Einige Jahre nach der Geburt unseres Sulzbacher zog der Vater nach
Pfarrweisach; dort war er Lehrer, Vorsänger und Schächter. Da aber die
Erträgnisse der Stelle nicht ausreichten, die Familie zu ernähren - es waren
vier Söhne und eine Tochter da - so beschäftigte sich Samson Sulzbacher auch
damit, Privatbibliotheken, die verkäuflich waren, aufzuspüren, anzukaufen,
die wertvolleren Werke von Kennern ausscheiden zu lassen und die übrigen zu
Tüten zu verarbeiten, bei welcher Fabrikation eigene Kinder und Schüler
gemeinschaftlich beschäftigt und auch zugleich unterrichtet wurden. Unseren
Jakob aber, welcher, weil er Fähigkeit verriet, zur Tora bestimmt wurde, tat
der Lehrer der Vater nach Memmelsdorf,
zwei Stunden von Pfarrweisach, wo damals ein guter Talmudlehrer und auch schon
eine gute deutsche Schule sich befand. Der kleine, kluge und zutunliche
Junge, welcher von seinem 11. bis 13. Jahre dort weilte, war allgemein
beliebt, machte gute Fortschritte in den deutschen Schul-, sowie auch in den
hebräischen und talmudischen Kenntnissen, und offenbarte auch schon
musikalische Befähigung. Von seinem 13. Jahre an war er etwa zwei Jahre lang
in Burgpreppach, anderthalb Stunden
von Pfarrweisach, um das Talmudstudium fortzusetzen, und auch hier mit gutem
Erfolg. Im 20. Jahre seines Lebens kam er ins
Seminar nach Würzburg. Dort war dazu mal eine Zeit des regsten
Emporstrebens. Eine Reihe vorzüglicher Jünglinge, von denen viele später und
auch noch jetzt als Männer segensreich wirken in verschiedenen Berufen,
studierte auf der Universität oder suchte sich auf dem Seminar zum Lehramt
vorzubereiten. Es war eben die neue Zeit mit ihren äußeren und inneren
Umwandlungen, die die jüdischen Jünglinge jener Epoche zur kräftigsten
Entfaltung ihrer Geisteskräfte anregte. Von dem Geist dieser Zeit genährt,
trat Sulzbacher als Lehrer in die Schule, wirkte zuerst in einigen kleineren
Gemeinden Unterfrankens, dann als Gehilfe bei seinem, auch in Gott ruhenden,
erblindeten Bruder, dazumal Lehrer in
Obrigheim in der Pfalz, und wurde alsdann vor 34 Jahren als Lehrer und
Kantor nach Kirchheimbolanden
berufen. Hier wirkte er, bis vor etwa zwei Jahren zunehmende Schwäche und
Kränklichkeit ihn mahnte, das schwierige Amt niederzulegen. Die Regierung
sendete ihm einen Gehilfen, und als die Kränklichkeit nicht abnahm,
versetzte sie ihn in huldvollster Weise in den wohlverdienten Ruhestand. Die
Pension trug teilweise der Staat, teilweise der Lehrerpensionsfonds. Er
hätte sich nun in Ruhe seines Lebens erfreuen mögen. Aber die Vorsehung
hatte es anders beschlossen.
Sulzbacher war vermählt mit einer Cousine, Regine Schwarz aus
Sulzbach, ebenfalls aus der
obengenannten berühmten Familie. Die Ehe war eine gottgesegnete, bis der Tod
dieses herrliche Band vor nun sechs Jahren löste. Von fünf Kindern - vier
Söhnen und einer Tochter - ging ihm der Jüngste - ein hoffnungsvoller, zum
Lehramte vorgebildeter Jüngling von 21 Jahren - am 5. Juni 1866 im Tode
voraus. Nur durch die ausdauerndste und hingebenste Pflege der liebenden
Tochter und einer ebenso liebevollen verwaisten Nichte - die in seinem Hause
reichen Ersatz für Eltern- und Geschwisterliebe gefunden hatte und diese
Liebe in edelster Weise erwiderte - konnte der schwächliche Körper so lange
erhalten werden. Nach langem, in den letzten Monaten hoffnungslos gewordenen
Leiden, hauchte er im Arme seiner liebenden Kinder in der Nacht nach dem 2.
Dezember seine edle Seele aus, nachdem er noch fast unmittelbar vor seinem
Tode einem verwandten Knaben Unterricht erteilt hatte.
An seinem Leichenzuge beteiligten sich neben den Gliedern der israelitischen
Gemeinde und den sämtlichen Lehrern des Kreises, die Professoren der
Lateinschule mit ihren Schülern, die Mitglieder des städtischen
Liederkranzes und ein großer Zug von Leidtragenden aus allen, auch den
besten, Kreisen und Ständen der |
 Bürgerschaft,
die Beamten und so fort. An seinem Grabe sangen der Liederkranz vereint mit
den Lehrern und die jüdischen Schülerinnen. Herr Dr. Rothschild aus
Alzey war von den Hinterbliebenen berufen,
am Grabe zu sprechen und er sprach mit gewohnter Beredsamkeit und in
tiefergreifendster Weise, indem er das Feld der Ehre, auf dem dieser
Kämpfer gefallen, verglich mit jenem Felde, auf welchem Blut gesäet und
Tränen geerntet werden. Er zeichnete den edlen Jakob, der mit
finsteren Mächten gekämpft in der Nacht und dem es nun tagte, wie er war im
Leben: als Lehrer, als Vater, als Mensch. Bürgerschaft,
die Beamten und so fort. An seinem Grabe sangen der Liederkranz vereint mit
den Lehrern und die jüdischen Schülerinnen. Herr Dr. Rothschild aus
Alzey war von den Hinterbliebenen berufen,
am Grabe zu sprechen und er sprach mit gewohnter Beredsamkeit und in
tiefergreifendster Weise, indem er das Feld der Ehre, auf dem dieser
Kämpfer gefallen, verglich mit jenem Felde, auf welchem Blut gesäet und
Tränen geerntet werden. Er zeichnete den edlen Jakob, der mit
finsteren Mächten gekämpft in der Nacht und dem es nun tagte, wie er war im
Leben: als Lehrer, als Vater, als Mensch.
Noch eine Scholle Erde auf seinem Sarge - dann zogen wir heim, um einen
herrlichen Freund ärmer.
Sulzbacher war ein ausgezeichneter Lehrer, voll ausdauerndsten
Berufseifers, ausgerüstet mit hingebendster Begeisterung, mit einem reichen
Fond von Kenntnissen auf allen einschlägigen, besonders aber auf dem
jüdischen Gebiet; voll unwandelbarer Treue und wahrer Hillel'scher Sanftmut,
Geduld und Bescheidenheit, mit einem reichen Herzen voll Liebe. So sehr
seine Kräfte abnahmen - er konnte nicht sein ohne praktische Beschäftigung
in seinem Berufe, und wie er bis jetzt in die letzten Tage und Stunden
seines Lebens zu unterrichten strebte, so liebte er auch fortbildende
Studien, wissenschaftliche, ernste, pädagogische Unterhaltung. Noch im
jüngsten Sommer, als ich zum letzten Male das Glück genoss, ihn zu sehen,
sprach er mit Begeisterung von Raschi, den er in jenen Tagen eifrig
studierte. Alles Neue im Leben der Schule, auf dem Gebiet der Erziehung und
des Unterrichts regte ihn an, suchte er zu prüfen, und er handelte stets nur
nach festen, klaren und anerkannten Prinzipien. Sein Unterricht zeichnete
sich durch sinnreiche Anordnungen aus, und er verstand es, trotz seiner
unvergleichlichen Sanftmut, oder gerade wegen derselben, die Herzen der
Kinder zu fesseln, die ihm eine unbegrenzte Ehrerbietung zollten, sodass er
eigentlich nie strenge disziplinarische Mittel anzuwenden hatte.
Er war ein ganzer Lehrer; die Berufstreue war ihm so sehr Lebens- und
Gewissensache, dass er schon darum in nichts sich ein liest, als was direkt
darauf Bezug hatte; in der Beschränkung lag für ihn die Freiheit, die
intensivste Wirksamkeit.
Er war ein liebender Gatte, ein edler, vortrefflicher Vater. Seinen
Kindern gab er die trefflichste Erziehung und sie hingen ihm an mit
musterhaftester Kindesliebe, mit unbegrenzter Verehrung. Bei der Kunde von
seiner Todesnähe eilte sein Sohn von Paris herbei - und traf leider erst
eine halbe Stunde nach der Beerdigung ein. Das reiche, durch den Hauch der
Bildung und die geistige Regsamkeit ausgezeichnete Familienleben übte einen
beglückenden Zauber auf jeden aus, der es kennenzulernen Gelegenheit
hatte.
Sulzbacher war ein vortrefflicher Mensch, voll unvergleichlicher Herzensgüte, voll tiefen Gemüts. Wohl kein lebendes Wesen ist je von
ihm mit Wissen oder vorsätzlich gekränkt oder beleidigt worden. Im
Gegenteil! Wenn wir auch im Geiste dessen, dem wir dieses Denkmal der Liebe
weihen, Vergangenes unberührt lassen, so wissen wir doch, dass so manche
Unbill und Ungerechtigkeit nur allzu tief sein Gemüt verwundete; und dennoch
ließ er alles über sich ergehen, ohne sich und seinem Berufe untreu zu
werden. Er verbarg den Schmerz, den die Undankbarkeit der
Menschen in seinem Gemüte erregte, in seinem Herzen und war gütig und
liebevoll gegen Alle, nach wie vor.
Diese Liebe, diese Treue, diese edlen
Eigenschaften des Geistes und Herzens gewannen ihm die Hochachtung und
Zuneigung aller derer, die ihn kannten. Die Bürger Kirchheims brachten ihm
eine unbegrenzte Hochachtung und Verehrung entgegen. Insbesondere aber
liebten und verehrten ihn seine Kollegen, für welche er stets und überall
ein treuer Freund und wo er nur konnte ein Helfer in der Not war.
Er war ein
Mann, der mit klarem denkenden Geist die Gegenwart und, was ihr Not tut,
erkannte; der aber auch mit seinem ganzen großen Herzen, mit heilige
Begeisterung das Judentum umfasste, dass er wie wenige unserer Zeit kannte
und liebte. Mit rührender Anhänglichkeit war er den edleren religiösen
Gebräuchen
zugetan und bedauerte lebhaft den Indifferentismus und den Verfall des
religiösen Lebens. Ja er war Einer von den edlen Männern unserer
Übergangsperiode, der mit der ganzen Kraft des Wissens und Geistes das Neue
erkannte, den Fortschritt anstrebte, aber mit ebenso edlem Eifer und
rührender Gemütstiefe den bedeutungsvollen Eigentümlichkeiten des jüdisch-religiösen Lebens zugetan war und blieb. Er hatte ein
jüdisches Herz.
Solch
einen treuen redlichen Freund haben wir verloren! Rings um uns lichten
sich die Reihen, und der Männer aus jener Zeit, welche mit Wissen und
Charakter zu kämpfen für die neue Zeit ausgerüstet waren, werden immer
weniger. Wer wird mit starker Kraft und frischem Mut die ausgestreute Saat
schützen und - die Zeit der Ernte schauen?
Was Sulzbacher mir und wohl auch
seinen übrigen näheren Freunden war, die ich hier nicht nenne, die aber am
Schlage ihres Herzens fühlen, wen ich meine vermag ich nicht auszusprechen.
Wir - ich und noch ein Anderer - hatten ihn spät gefunden. Nur
tiefe und ernste
Motive bilden den Grund für Freundschaften, die auf der Höhe des Lebens
geschlossen werden. Aber umso köstlicher sind diese Blumen auf unserem
ernsten Lebenswege. Sie werden ein Talisman bleiben für unser ganzes Leben.
Ja, in unserem Herzen steht ein Denkmal für dich, dass nicht schwinden wird,
solange wir hier weilen auf Erden. Schlafe wohl, teurer Freund, edler
Genosse. Deinem Wirken ist ein unvergänglicher Lohn beschieden. Unter den
Besten und Edelsten, die ihrer Pflicht voll genügt haben hier im Leben, wird
stets und immerdar von denjenigen, die dich kannten, der Name genannt
werden: Jakob Sulzbacher!".
Anmerkungen:
- Naftali
Hirsch Moses Katzenellenbogen (geb. ca. 1715
Schwabach,
gest. 1800 Mannheim; Sohn des Rabbiners Moses): studierte in Frankfurt,
1741-1763 Rabbiner für den Tauber-Neckar-Kreis des Deutschen Ordens mit Sitz
in
Mergentheim, 1763-1800 Landesrabbiner der Kurpfalz mit Sitz in
Leimen/Heidelberg,
zugleich 1763-68 Hausrabbiner bei Hoffaktor Aron Elias Seligmann in
Leimen,
1768 verlegte er den Amtssitz als Landesrabbiners nach Mannheim, hier
gleichzeitig Oberrabbiner an der Klaus, entfaltete eine reiche Lehr- und
Forschungstätigkeit (insbesondere zum Talmud).
|
Visitation des Religionsunterrichtes durch Rabbiner Dr.
Landsberg aus Kaiserslautern (1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.
Oktober 1890: "Rabbiner Dr. Landsberg aus Kaiserslautern
nahm gestern in Kirchheimbolanden die übliche Visitation des
israelitischen Religionsunterrichtes vor und gedachte in seiner Predigt
unter anderem auch in zündenden Worten der großen Verdienste unseres
greisen Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.
Oktober 1890: "Rabbiner Dr. Landsberg aus Kaiserslautern
nahm gestern in Kirchheimbolanden die übliche Visitation des
israelitischen Religionsunterrichtes vor und gedachte in seiner Predigt
unter anderem auch in zündenden Worten der großen Verdienste unseres
greisen Generalfeldmarschalls Grafen von Moltke." |
Simon Silbermann wird zum Hauptlehrer ernannt (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1908: "Aus
Bayern, 3. Januar (1903). Den Titel Hauptlehrer erhielten am 1. Januar die
Herren Max Behr in Regensburg, Jakob Heß in
Treuchtlingen, Simon
Silbermann in Kirchheimbolanden und Michael Wolf in Winnweiler." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1908: "Aus
Bayern, 3. Januar (1903). Den Titel Hauptlehrer erhielten am 1. Januar die
Herren Max Behr in Regensburg, Jakob Heß in
Treuchtlingen, Simon
Silbermann in Kirchheimbolanden und Michael Wolf in Winnweiler." |
Lehrer David Bär und seine Frau verlassen
Edenkoben (1938; Lehrer Bär war von 1927 bis 1929 Lehrer in Kirchheimbolanden)
 Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. April 1938: "Freie Vereinigung
israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Abschied von Herrn Lehrer
Bär - Edenkoben. David Bär, seit 1920 ununterbrochen im Dienste,
wirkte in der Pfalz zum Wohle seiner Gemeinden von 1927 bis 1929 in
Kirchheimbolanden und von 1929 bis heute in Edenkoben
hauptamtlich als Religionslehrer und Kantor. Außerdem erteilte er in
vielen kleinen Gemeinden den Religionsunterricht. Er ging stets
diensteifrig und beflissen seinem Berufe nach ohne in seiner
Bescheidenheit Ansprach auf öffentliche Anerkennung zu erheben. Nun
verlässt dieser allseits beliebte Kollege die Stätten seiner
Tätigkeit.
Artikel in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der
Rheinpfalz" vom 1. April 1938: "Freie Vereinigung
israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz. Abschied von Herrn Lehrer
Bär - Edenkoben. David Bär, seit 1920 ununterbrochen im Dienste,
wirkte in der Pfalz zum Wohle seiner Gemeinden von 1927 bis 1929 in
Kirchheimbolanden und von 1929 bis heute in Edenkoben
hauptamtlich als Religionslehrer und Kantor. Außerdem erteilte er in
vielen kleinen Gemeinden den Religionsunterricht. Er ging stets
diensteifrig und beflissen seinem Berufe nach ohne in seiner
Bescheidenheit Ansprach auf öffentliche Anerkennung zu erheben. Nun
verlässt dieser allseits beliebte Kollege die Stätten seiner
Tätigkeit.
Wir können zum Abschied unserer beiden Kollegen Schottland (siehe Frankenthal)
und Bär keinen besseren Wunsch zurufen als: (hebräisch und deutsch:) Gesegnet
seid Ihr bei Euerem Auszuge und gesegnet seid Ihr bei Euerem Einzuge." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Ein "Verein zur Besserung des Zustandes der Israeliten" wird gegründet (1836)
 Artikel
in der Zeitschrift "Das Füllhorn" vom 19. Februar 1836: "Rheinbayern. Artikel
in der Zeitschrift "Das Füllhorn" vom 19. Februar 1836: "Rheinbayern.
Von Kirchheimbolanden ist (mit Gutheißen der königlichen Regierung)
die Bildung eines Vereines 'zur Verbesserung des Zustandes der
Israeliten' ausgegangen. Der Zweck desselben ist, nach den vorliegenden
Statuten: 'einem allgemein gefühlten Bedürfnisse der fortschreitenden
Bildung der Israeliten nachzuhelfen,' was besonders auf nachbemerkte Weise
geschehen soll: Jüdische Kinder von guter, sittlicher Aufführung, werden auf
Kosten des Vereins, zu Handwerkern in die Lehre getan, oder erhalten zu
diesem Behufe einen Zuschuss, der 60 fl. nicht übersteigen darf; — Beiträge
zur bessern Besoldung geschickter und braver Lehrer in armen Gemeinden; —
Stipendien zur Bildung jüdischer Schullehrer. Wer auf Kosten des Vereines
ein Handwerk erlernt hat, muss, wenn er dieses selbstständig ausübt, einen
vom Vereine bezeichneten armen Israeliten unentgeltlich in die Lehre nehmen;
geht er hingegen von diesem Handwerke ganz ab; so muss er der Gesellschaft
die für ihn gemachten Auslagen zurückvergüten. Die auf der Wanderschaft
gehenden Israeliten erhalten jeder 20 fl. und ein Felleisen, und sie können
auch bei ihrer Ansässigmachung eine weitere Unterstützung erhalten. Übrigens
können Leute jedes Standes und jeder Konfession Mitglieder des Vereines
werden, und diesen durch fortdauernde oder einmalige Beiträge unterstützen.
— Die Sache verdient auch anderwärts Nachahmung. (A.Z.)." |
Über die gottesdienstlichen Verhältnisse in der
jüdischen Gemeinde Kirchheimbolanden (1838)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Oktober 1838: "Vom Haardt-Gebirge, Juli 1838. Bürgerliche
und kirchliche Verhältnisse. (Der Beitrag wird nur teilweise
wiedergegeben, da er sich nur in einem Teil auf Kirchheimbolanden bezieht).
Und ein anderes als von solcher Seite ausgehende Fortschreiten ist bei uns
- so scheint es nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens - auch nicht
wohl denkbar. Den Synagogen-Vorständen ist hierin de facto eine große
Machtvollkommenheit gegeben. Was die Mehrheit des Vorstands unter
Genehmigung des Rabbinen vorschlägt, wird in der Regel von den
Königlichen Land-Kommissariaten gutgeheißen und erlangt hierdurch
gesetzliche Kraft. Auf diese Weise ist schon manches geschehen, namentlich
für einen verbesserten oder gereinigten Gottesdienst. An der Spitze steht
hier die Kultgemeinde Kirchheimbolanden (Rabbinatsbezirk
Kaiserslautern, Rabbiner Cohen) - durch die Bemühungen des Vorstands-Präsidenten
Herrn Leo Levy. In einem Aufsatze, wie dem gegenwärtigen, dessen
Tendenz eine unparteiische Schil- Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 4. Oktober 1838: "Vom Haardt-Gebirge, Juli 1838. Bürgerliche
und kirchliche Verhältnisse. (Der Beitrag wird nur teilweise
wiedergegeben, da er sich nur in einem Teil auf Kirchheimbolanden bezieht).
Und ein anderes als von solcher Seite ausgehende Fortschreiten ist bei uns
- so scheint es nach den bisherigen Erfahrungen wenigstens - auch nicht
wohl denkbar. Den Synagogen-Vorständen ist hierin de facto eine große
Machtvollkommenheit gegeben. Was die Mehrheit des Vorstands unter
Genehmigung des Rabbinen vorschlägt, wird in der Regel von den
Königlichen Land-Kommissariaten gutgeheißen und erlangt hierdurch
gesetzliche Kraft. Auf diese Weise ist schon manches geschehen, namentlich
für einen verbesserten oder gereinigten Gottesdienst. An der Spitze steht
hier die Kultgemeinde Kirchheimbolanden (Rabbinatsbezirk
Kaiserslautern, Rabbiner Cohen) - durch die Bemühungen des Vorstands-Präsidenten
Herrn Leo Levy. In einem Aufsatze, wie dem gegenwärtigen, dessen
Tendenz eine unparteiische Schil- |
 derung
der dermaligen Verhältnisse der Israeliten in der Pfalz ist - von diesem
Manne schweigen, hieße, dem Verdienste seine Krone rauben. Herr Levy
tat bereits im Jahre 1835 als Ausschuss-Mitglied der Synode zu Speyer
alles Mögliche für Herstellung eines verbesserten Gottesdienstes und
Vereinfachung der Gebete. Seine Bemühungen um die Bildung eines Vereins,
Hebung der Bettelei bezweckend, wären in der Tat eines besseren Erfolgs
würdig gewesen. Hingegen gelang ihm die Errichtung eines Vereins für
Handwerks-Lehrlinge und Schuldienstexpektanten vollkommen; die Statuten
sind von Königlicher Regierung genehmigt, und wurden seitens der
Königlichen Land-Kommissariate den Synagogen-Vorständen zur Bekanntmachung
und Provozierung der Teilnahme übergeben. Das Städtchen
Kirchheimbolanden allein steuert jährlich - viele christliche Bewohner
leisten Beiträge - fl. 250 - bei, und viele andere Orte folgten diesem
schönen Vorgange. Privatverhältnisse - die wir hier nicht berühren
dürfen - hinderten in unserer nächsten Umgegend und im sogenannten
Oberlande (Bezirk Landau) die Vorbereitung der Teilnahme an den Verein. Da
diese jetzt beseitigt sind, so dürfte eine erneute Aufforderung des
Vorstandes an seinem Platze sein, und sicher nicht ohne guten Erfolg
bleiben. derung
der dermaligen Verhältnisse der Israeliten in der Pfalz ist - von diesem
Manne schweigen, hieße, dem Verdienste seine Krone rauben. Herr Levy
tat bereits im Jahre 1835 als Ausschuss-Mitglied der Synode zu Speyer
alles Mögliche für Herstellung eines verbesserten Gottesdienstes und
Vereinfachung der Gebete. Seine Bemühungen um die Bildung eines Vereins,
Hebung der Bettelei bezweckend, wären in der Tat eines besseren Erfolgs
würdig gewesen. Hingegen gelang ihm die Errichtung eines Vereins für
Handwerks-Lehrlinge und Schuldienstexpektanten vollkommen; die Statuten
sind von Königlicher Regierung genehmigt, und wurden seitens der
Königlichen Land-Kommissariate den Synagogen-Vorständen zur Bekanntmachung
und Provozierung der Teilnahme übergeben. Das Städtchen
Kirchheimbolanden allein steuert jährlich - viele christliche Bewohner
leisten Beiträge - fl. 250 - bei, und viele andere Orte folgten diesem
schönen Vorgange. Privatverhältnisse - die wir hier nicht berühren
dürfen - hinderten in unserer nächsten Umgegend und im sogenannten
Oberlande (Bezirk Landau) die Vorbereitung der Teilnahme an den Verein. Da
diese jetzt beseitigt sind, so dürfte eine erneute Aufforderung des
Vorstandes an seinem Platze sein, und sicher nicht ohne guten Erfolg
bleiben.
Diesem Manne, Herrn Leo Levy, dem die Pfälzer Israeliten schon so
viel verdanken, ist es, unterstützt von dem ebenso tätigen als
kenntnisreichen Lehrer J. Sulzbacher, gelungen, den Gottesdienst in
der neu und würdig erbauten Synagoge zu Kirchheimbolanden auf eine
Weise zu ordnen, welche dieselbe zum Muster für den ganzen Kreis gemacht.
Choral-Gesang ist Grundzug des Gottesdienstes, über welchen im Ganzen ich
Ihnen nächstens als Augenzeuge berichten zu können hoffe.
Nachdem die Gemeinden Neuleiningen
und Grünstadt (Bezirk Frankenthal,
Rabbiner A. Merz) durch eigene Abgeordnete von der Trefflichkeit des zu Kirchheimbolanden
organisierten Gottesdienstes sich überzeugt, wurde derselbe in Neuleiningen
durch die Bemühungen des Herrn Kaufmann, unterstützt von dem Privaten
Herrn Schwarz, (einem vielseitig gebildeten, früheren
Rabbinatskandidaten, jetzt Associé einer Weinhandlung) - und in Grünstadt,
wo sogar ein Rabbiner alten Schlags seinen Sitz hat, freilich nicht ohne
Widerstreben, durch Herrn Levy und Lehrer Heß eingeführt. Dasselbe
geschieht nun in Edenkoben (Bezirk
Landau, Rabbiner E. Grünebaum), wo der Lehrer Herr M. Elsasser
(von welchem auch die Stiftung des israelitischen Lesevereins ausging, von
dem in einem Ihrer früheren Blätter als von hiesiger Gemeinde ausgehend,
gesprochen wurde) segensreich wirkt. Choral-Gesang ist ferner eingeführt
in Kaiserslautern (durch den Lehrer
Herrn Walz), in Niederhochstadt
(Lehrer Herr Rothschild), wo der alte Rabbiner (Raw Abraham)
zu den kräftigsten Verteidigern des verbesserten Gottesdienstes gehört,
und gewiss in noch vielen andern Gemeinden, die Ihrem Berichterstatter
noch nicht bekannt sind..." |
Zur Problematik des Eides in der Synagoge - die jüdische Gemeinde
Kirchheimbolanden lehnt den Eid in der Synagoge ab (Artikel von 1839/40)
 Artikel in "Israelitische Annalen" vom 18. Januar 1839: "Legislatives.
Artikel in "Israelitische Annalen" vom 18. Januar 1839: "Legislatives.
Den Judeneid betreffend.
Folgender Vorfall, wiewohl er eine kleine und entlegene israelitische
Gemeinde betrifft, ist vielleicht mehr geeignet, die Aufmerksamkeit der
resp. Regierungen auf die Form des Judeneides zu wenden und sie zu einer
durchgreifenden Reform dieses Teils der Gesetzgebung im Sinne der unter den
Juden sich laut aussprechenden öffentlichen Meinung und der Gerechtigkeit zu
vermögen, als alles, was jemals darüber polemisiert worden ist.
Bekanntlich gibt es in den deutschen Ländern französischen Rechts und auch
im Elsasse eine doppelte Form des Judeneides, welcher in diesen Ländern
nicht ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift, sondern der gerichtlichen
Praxis seine rechtliche Geltung verdankt. Wiewohl die verhältnismäßig
gelindere Form schon drückend genug und dem Geiste der israelitischen
Religion schnurstracks entgegen ist, so hat sich die markiertere öffentliche
Stimme vorerst nur gegen die strengere Form des Eides, (Eid vor der
Coscher Sepher Thora, wie er in der Kanzleisprache heißt), welcher in
der Synagoge im Totengewande und unter Begleitung einer Reihe lächerlicher
Zeremonien abzuleisten ist, mit Entschiedenheit erklärt. Ein rühmliches
Beispiel von Energie hat vor einigen Monaten die israelitische
Religionsgemeinde in Kirchheimbolanden in der bairischen Rheinprovinz
gegeben, indem sie sich geweigert hat, ihre neuerbaute Synagoge zur Vornahme
in dieser unsere Religion entweihenden und dem Spotte des Pöbels
preisgebenden Handlung herzugeben. Der Rechtsfall, der Veranlassung zu
dieser Weigerung gegeben, ist zwar, wie wir vernehmen, dadurch zu Ende
gekommen, dass der Eid in einer anderen Synagoge geschworen wurde; aber mehr
als die desfalls zwischen dem öffentlichen Ministerium am kompetenten
Bezirksgerichte und der israelitischen Gemeinde zu Kirchheimbolanden
entstandene Contestation, deren Lösung auf administrativem Wege man entgegen
sieht, veranlasst uns bei dieser Gelegenheit das Interesse des Judentums zur
Untersuchung der Frage, ob die Weigerung der jüdischen Gemeinde von
Kirchheimbolanden rechtlich begründet war? Referent glaubt seiner innersten
Überzeugung nach, zu welcher er ganz sine ira et studio und bloß auf dem
Wege juristischer Reflexion gelangt ist, diese Frage bejahen zu müssen.
Diese Blätter sind zu einer ausführlichen rechtlichen Erörterung nicht
geeignet; darum erlaubt er sich bloß, seine Gründe mir kurzen Worten
anzudeuten. Die Synagoge ist Eigentum der Gemeinde, welche sie zur Vornahme
religiöser Handlungen bestimmt hat. Dieses Eigentum ist Privateigentum einer
Privatperson, deren Wille allein rücksichtlich der Benutzung jenes Eigentums
maßgebend sein kann. Der Eid ist ein prozessualischer Akt, welchen das
Gesetz dem Richter und den Parteien als Mittel zur Erkennung der Wahrheit an
die Hand gibt. An welche Voraussetzungen und Formen dieses Beweismittel zu
knüpfen sei, um |
 beim
Richter juristische Gewissheit bewirken zu dürfen, ist Sache der
legislativen Gewalt im Staate; so wie es Sache der ausübenden Gewalt im
Staate ist, diejenigen organischen Einrichtungen zu treffen, die zur
Verwirklichung der gesetzlichen Anforderungen nötig sind. Es kann dies
ebensowenig der religiösen Corporation, welcher die im Prozesse handelnde
Partei (also im vorliegenden Falle der Delat angehört, als irgend einer
andern Privatperson zugemutet werden. Angenommen auch, das Gesetz überlasse
der Partei die Beischaffung und Herstellung der zur Ableistung des Eides zu
treffenden Anstalten, woher will man die Solidarität der Religionsgemeinde
ableiten, und zwar in der Art, dass dieselbe verpflichtet sein solle, zur
Erfüllung der Verbindlichkeit eines Individuums mitzuwirken, zu welchem sie
rücksichtlich des obwaltenden Rechtsstreites in keinem andern Verhältnisse
steht, als jeder andere Dritte? Man wende nicht ein, dass der Eid eine
religiöse Handlung sei; denn nach französischem Rechte liegt ihm mindestens
kein konfessionelles Prinzip zu Grunde, und wenn der
Gerichtsgebrauch die gesetzlichen Formen für die Juden vermehrt hat, (die
Frage, ob die Gerichte dazu befugt gewesen, bleibe für jetzt dahin
gestellt), so kann er doch wahrlich die Grundlage der Gesetzgebung nicht
ändern! Gesetzt aber auch, der Eid sei, wie es in andern Ländern wirklich
der Fall ist, eine rein religiöse Handlung, zufällig in den Symbolen aller
im Staate aufgenommenen Kirchengemeinschaften sich wieder findend, und
angenommen, es sei dadurch, dass das Gesetz entsprechende Verfügungen
trifft, den Mitgliedern jeder einzelnen Kirchengemeinde stillschweigend die
gesetzliche Verpflichtung auferlegt worden, ihre religiösen Institute
zur Vornahme dieser gerichtlichen Handlung herzuleihen, wie z. B. es den
politischen Stadt- und Dorfgemeinden obliegt, dasjenige aus eignen Mitteln,
was zur Rekrutierung und zur Führung der Zivilstandsbücher gehört, zu
leisten, so erfordert es doch nicht bloß die Gerechtigkeit, sondern sogar
die reine wissenschaftliche juristische Konsequenz, dass es jeder Kirche
überlassen bleibe, den Eid so zu normieren, wie sie ihn mit ihrem Symbole
für übereinstimmend hält, und so lange im Staate die Gewissensfreiheit und
das Eigentum der kirchlichen Korporationen und Privatpersonen reelle Geltung
haben soll, muss es den letzteren freistehen, nicht zu dulden, dass ihre
Gotteshäuser zu andern Zwecken und Handlungen, als zu rein
dogmatisch-religiösen benutzt werden. Die gerechten Regierungen, deren sich
die Rheinlande zu rühmen haben, werden, wenn das Beispiel der Judengemeinde
zu Kirchheimbolanden in anderen Gemeinden Anklang findet, daraus zum
Mindesten Veranlassung nehmen, die in jenen Ländern herrschende Jurisprudenz
über den Eid der Juden einer genauen Revision zu unterwerfen; sie werden
daraus die Überzeugung schöpfen, dass dieser Eid den jüdischen
Religionsbegriffen und den Anforderungen der Gerechtigkeit widerspricht und
im Gemüte der Schwörenden höchst peinliche Gefühle erwecken muss, und diese
Überzeugung wird sie entweder zu einer völligen Gleichstellung der Juden
auch in dieser Beziehung mit den Christen vermögen, oder doch zu einer
Änderung des Judeneides im wahren Sinne des reinen mosaischen Glaubens. ---ch,
Dr. jur." beim
Richter juristische Gewissheit bewirken zu dürfen, ist Sache der
legislativen Gewalt im Staate; so wie es Sache der ausübenden Gewalt im
Staate ist, diejenigen organischen Einrichtungen zu treffen, die zur
Verwirklichung der gesetzlichen Anforderungen nötig sind. Es kann dies
ebensowenig der religiösen Corporation, welcher die im Prozesse handelnde
Partei (also im vorliegenden Falle der Delat angehört, als irgend einer
andern Privatperson zugemutet werden. Angenommen auch, das Gesetz überlasse
der Partei die Beischaffung und Herstellung der zur Ableistung des Eides zu
treffenden Anstalten, woher will man die Solidarität der Religionsgemeinde
ableiten, und zwar in der Art, dass dieselbe verpflichtet sein solle, zur
Erfüllung der Verbindlichkeit eines Individuums mitzuwirken, zu welchem sie
rücksichtlich des obwaltenden Rechtsstreites in keinem andern Verhältnisse
steht, als jeder andere Dritte? Man wende nicht ein, dass der Eid eine
religiöse Handlung sei; denn nach französischem Rechte liegt ihm mindestens
kein konfessionelles Prinzip zu Grunde, und wenn der
Gerichtsgebrauch die gesetzlichen Formen für die Juden vermehrt hat, (die
Frage, ob die Gerichte dazu befugt gewesen, bleibe für jetzt dahin
gestellt), so kann er doch wahrlich die Grundlage der Gesetzgebung nicht
ändern! Gesetzt aber auch, der Eid sei, wie es in andern Ländern wirklich
der Fall ist, eine rein religiöse Handlung, zufällig in den Symbolen aller
im Staate aufgenommenen Kirchengemeinschaften sich wieder findend, und
angenommen, es sei dadurch, dass das Gesetz entsprechende Verfügungen
trifft, den Mitgliedern jeder einzelnen Kirchengemeinde stillschweigend die
gesetzliche Verpflichtung auferlegt worden, ihre religiösen Institute
zur Vornahme dieser gerichtlichen Handlung herzuleihen, wie z. B. es den
politischen Stadt- und Dorfgemeinden obliegt, dasjenige aus eignen Mitteln,
was zur Rekrutierung und zur Führung der Zivilstandsbücher gehört, zu
leisten, so erfordert es doch nicht bloß die Gerechtigkeit, sondern sogar
die reine wissenschaftliche juristische Konsequenz, dass es jeder Kirche
überlassen bleibe, den Eid so zu normieren, wie sie ihn mit ihrem Symbole
für übereinstimmend hält, und so lange im Staate die Gewissensfreiheit und
das Eigentum der kirchlichen Korporationen und Privatpersonen reelle Geltung
haben soll, muss es den letzteren freistehen, nicht zu dulden, dass ihre
Gotteshäuser zu andern Zwecken und Handlungen, als zu rein
dogmatisch-religiösen benutzt werden. Die gerechten Regierungen, deren sich
die Rheinlande zu rühmen haben, werden, wenn das Beispiel der Judengemeinde
zu Kirchheimbolanden in anderen Gemeinden Anklang findet, daraus zum
Mindesten Veranlassung nehmen, die in jenen Ländern herrschende Jurisprudenz
über den Eid der Juden einer genauen Revision zu unterwerfen; sie werden
daraus die Überzeugung schöpfen, dass dieser Eid den jüdischen
Religionsbegriffen und den Anforderungen der Gerechtigkeit widerspricht und
im Gemüte der Schwörenden höchst peinliche Gefühle erwecken muss, und diese
Überzeugung wird sie entweder zu einer völligen Gleichstellung der Juden
auch in dieser Beziehung mit den Christen vermögen, oder doch zu einer
Änderung des Judeneides im wahren Sinne des reinen mosaischen Glaubens. ---ch,
Dr. jur." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1840: "Frankenthal
(Pfalzbayern), 4. Februar (1840). Sie werden bereits von Ihren französischen
Korrespondenten die nötigen Berichte über den Rechtsfall in Saverne,
betreffs des Eides more judaico,
und die herrliche Rede des Herrn Crémieux erhalten haben. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Februar 1840: "Frankenthal
(Pfalzbayern), 4. Februar (1840). Sie werden bereits von Ihren französischen
Korrespondenten die nötigen Berichte über den Rechtsfall in Saverne,
betreffs des Eides more judaico,
und die herrliche Rede des Herrn Crémieux erhalten haben.
In unserer Pfalz (Rheinbayern) hat sich ein ähnlicher Fall ereignet,
welcher zeigt, dass dieser Missstand auch hier tief gefühlt wird, und es
nur an tüchtigen Männern fehlt, um ihn, sowie bei unseren Nachbarn, zu
bekämpfen. In Kirchheimbolanden, einer Gemeinde, welche sich besonders
durch eine herrliche Synagogenordnung vortrefflich vor den anderen Städtchen
der Pfalz auszeichnet, sollte ein Jude in der (schönen) Synagoge einen
Judeneid nach alter Weise schwören. Allein der würdige Vorstand, Herr
Leo Levi jun., weigerte sich, die Synagoge zu diesem Akte herzugeben, und
verharrte bei diesem schönen Entschlusse. So blieb denn nicht anderes übrig,
als eine gefügigere Gemeinde zu finden, wo der Eid geschworen werden
konnte – und diese fand sich denn leider auch! Es hätte damals nur
einer edlen Nachahmung bedürft, um diesen, von jedem Gebildeten so tief
empfundenen kränkenden Missbrauch auch aus unserem Gerichtsgebrauche
verschwinden zu lassen. -
Doch noch Vieles bleibt bei uns zu tun übrig, da Gemeindevorstände,
welche Ernsteres, Besseres wollen, meistens jene kräftige Unterstützung
von Seiten der Rabbinen nicht finden, welche doch zum Gelingen dieser so
zeitgemäßen Bestrebungen – vorzüglich der Reorganisation des
Gottesdienstes – so notwendig wären. Diese Missstände sind bei uns fühlbarer,
als anderswo, da sie bei unserer öffentlichen Gerichtsbarkeit schroffer
hervortreten." |
Aus der
Geschichte des Rabbinates in Kirchheimbolanden
Kirchheimbolanden wird vorübergehend Sitz des Bezirksrabbinates (1863)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April
1863: "Landau, Pfalz, 29. März (1863). Auf Anordnung unserer hochlöblichen
Kreisregierung, die streng, gerecht und friedliebend ist, musste der
Bezirksrabbiner Seligmann seinen bisherigen Amtssitz zu Kaiserslautern mit
Kirchheimbolanden vertauschen, weil Rabbiner und Gemeinde sich zu sehr gehässig
gegenüberstanden und an eine Aussöhnung, die von Seiten der Behörde öfters
angestrebt worden sein soll, nicht mehr zu denken war. Nun befindet sich
bekanntlich in Kaiserslautern das protestantische Schullehrerseminar für
die Pfalz, in welchem auch die israelitischen Lehrer ihre Ausbildung
erhalten und so erteilte der jeweilige Rabbiner den jüdischen
Seminaristen den hebräischen Unterricht wofür er aus dem
Kreis-Schul-Fond honoriert wurde. Seit dem Wegzuge des Rabbiners wurde
dieser Unterricht nicht mehr fortgesetzt und die jüdischen Seminaristen
waren sonach in dem Studium des Hebräischen gestört. Unsere hochlöbliche
Kreisregierung, dies einsehend, bekundete auf eine gerechte und humane
Weise, ‚ohne dazu aufgefordert worden zu sein,’, wie sehr ihr das Wohl
aller ihrer untergebenen Staatsbürger gleichmäßig am Herzen liege
dadurch, dass sie eine Entschließung des hohen Königlichen Ministeriums
veranlasste, die dem Rabbinatskandidaten Herrn Moses Seligmann von hier,
als Lehrer für das Hebräische an das Königliche Seminar zu
Kaiserslautern beruft. Wir wünschen unserer erleuchteten Kreisregierung
Glück zu der Ausführung solch humanen Werkes und doppelt Glück zu der
getroffenen Wahl, da der Berufene ein in allen klassischen Wissenschaften
und besonders im Hebräischen und Talmudischen ausgezeichneter Gelehrter
ist, der nur wegen zu großer Bescheidenheit nicht zu bewegen war, schon
früher eine öffentliche Stelle einzunehmen. Wir bedauern dessen Abgang
von hier tief, da Männer wie Herr Seligmann, die ihre Gelehrsamkeit nicht
(die hebräischen Wendung sind in der Richtung zu interpretieren:) stolz
vor sich hertragen, in unserer Gegend leider rat oder gar nicht zu
finden sind, und der Verlust, den unsere Gemeinde durch sein Weggehen
trifft, ein nicht leicht zu ersetzender ist. Alle Israeliten der Pfalz und
besonders diejenigen unter ihnen, deren Herz noch warm für jüdisches
Wissen, Religiosität und Jugendbildung, muss die Besetzung dieser höchst
wichtigen Stelle, durch einen Mann wie Herr M. Seligmann gewiss freuen,
weil dadurch wieder gehofft werden darf, dass aus dem Seminar nicht nur
Lehrer, sondern jüdische Lehrer hervorgehen werden, und Herr Seligmann
gewiss mit aufrichtiger Hingebung diesen schönen Zweck zu erreichen
suchen wird. Bedenkt man dabei, dass der bisherige Unterricht durch den
Rabbiner nur ein sehr mangelhafter sein konnte, weil der Amtsberuf eines
Bezirksrabbiners durch öftere Rundreisen, Schulprüfungen, Trauungen etc.
ihn verhinderte, Unterricht zu erteilen, so sind wir unserer hohen
Regierung umso mehr zum Dank verpflichtet, als sie eigens für dieses Fach
einen so würdigen Lehrer berufen hat. Dem Vernehmen nach soll Herr
Seligmann auf höhere Weisung sofort in seine neue Stellung eintreten, und
so wünschen wir dem Wirkungskreise dieses edlen, charakterfesten und
uneingebildeten Gelehrten den besten Erfolg, damit die Saat unserer
heiligen Tora, die er nun auszustreuen den Beruf hat, gedeihlich keime,
hervorsprosse und reife." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April
1863: "Landau, Pfalz, 29. März (1863). Auf Anordnung unserer hochlöblichen
Kreisregierung, die streng, gerecht und friedliebend ist, musste der
Bezirksrabbiner Seligmann seinen bisherigen Amtssitz zu Kaiserslautern mit
Kirchheimbolanden vertauschen, weil Rabbiner und Gemeinde sich zu sehr gehässig
gegenüberstanden und an eine Aussöhnung, die von Seiten der Behörde öfters
angestrebt worden sein soll, nicht mehr zu denken war. Nun befindet sich
bekanntlich in Kaiserslautern das protestantische Schullehrerseminar für
die Pfalz, in welchem auch die israelitischen Lehrer ihre Ausbildung
erhalten und so erteilte der jeweilige Rabbiner den jüdischen
Seminaristen den hebräischen Unterricht wofür er aus dem
Kreis-Schul-Fond honoriert wurde. Seit dem Wegzuge des Rabbiners wurde
dieser Unterricht nicht mehr fortgesetzt und die jüdischen Seminaristen
waren sonach in dem Studium des Hebräischen gestört. Unsere hochlöbliche
Kreisregierung, dies einsehend, bekundete auf eine gerechte und humane
Weise, ‚ohne dazu aufgefordert worden zu sein,’, wie sehr ihr das Wohl
aller ihrer untergebenen Staatsbürger gleichmäßig am Herzen liege
dadurch, dass sie eine Entschließung des hohen Königlichen Ministeriums
veranlasste, die dem Rabbinatskandidaten Herrn Moses Seligmann von hier,
als Lehrer für das Hebräische an das Königliche Seminar zu
Kaiserslautern beruft. Wir wünschen unserer erleuchteten Kreisregierung
Glück zu der Ausführung solch humanen Werkes und doppelt Glück zu der
getroffenen Wahl, da der Berufene ein in allen klassischen Wissenschaften
und besonders im Hebräischen und Talmudischen ausgezeichneter Gelehrter
ist, der nur wegen zu großer Bescheidenheit nicht zu bewegen war, schon
früher eine öffentliche Stelle einzunehmen. Wir bedauern dessen Abgang
von hier tief, da Männer wie Herr Seligmann, die ihre Gelehrsamkeit nicht
(die hebräischen Wendung sind in der Richtung zu interpretieren:) stolz
vor sich hertragen, in unserer Gegend leider rat oder gar nicht zu
finden sind, und der Verlust, den unsere Gemeinde durch sein Weggehen
trifft, ein nicht leicht zu ersetzender ist. Alle Israeliten der Pfalz und
besonders diejenigen unter ihnen, deren Herz noch warm für jüdisches
Wissen, Religiosität und Jugendbildung, muss die Besetzung dieser höchst
wichtigen Stelle, durch einen Mann wie Herr M. Seligmann gewiss freuen,
weil dadurch wieder gehofft werden darf, dass aus dem Seminar nicht nur
Lehrer, sondern jüdische Lehrer hervorgehen werden, und Herr Seligmann
gewiss mit aufrichtiger Hingebung diesen schönen Zweck zu erreichen
suchen wird. Bedenkt man dabei, dass der bisherige Unterricht durch den
Rabbiner nur ein sehr mangelhafter sein konnte, weil der Amtsberuf eines
Bezirksrabbiners durch öftere Rundreisen, Schulprüfungen, Trauungen etc.
ihn verhinderte, Unterricht zu erteilen, so sind wir unserer hohen
Regierung umso mehr zum Dank verpflichtet, als sie eigens für dieses Fach
einen so würdigen Lehrer berufen hat. Dem Vernehmen nach soll Herr
Seligmann auf höhere Weisung sofort in seine neue Stellung eintreten, und
so wünschen wir dem Wirkungskreise dieses edlen, charakterfesten und
uneingebildeten Gelehrten den besten Erfolg, damit die Saat unserer
heiligen Tora, die er nun auszustreuen den Beruf hat, gedeihlich keime,
hervorsprosse und reife." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Das Goldmann'sche Ehepaar feiert Goldene Hochzeit
(1894)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Mai 1894: "In Kirchheimbolanden feierte am 6.
dieses Monats das Goldmann'sche Ehepaar das Fest der goldenen
Hochzeit. Zu diesem Zweck war der Bezirksrabbiner Dr. Landsberg aus
Kaiserslautern in die Familie des Jubelpaares berufen worden, um dem
seltenen Feste auch die religiöse Weihe zu geben. Umgeben von zahlreichen
Kindern und Enkeln beging das Jubelpaar in seltener Frische des Körpers
und des Geistes diesen Ehrentag. Möge es noch lange sich dieser
Rüstigkeit erfreuen." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Mai 1894: "In Kirchheimbolanden feierte am 6.
dieses Monats das Goldmann'sche Ehepaar das Fest der goldenen
Hochzeit. Zu diesem Zweck war der Bezirksrabbiner Dr. Landsberg aus
Kaiserslautern in die Familie des Jubelpaares berufen worden, um dem
seltenen Feste auch die religiöse Weihe zu geben. Umgeben von zahlreichen
Kindern und Enkeln beging das Jubelpaar in seltener Frische des Körpers
und des Geistes diesen Ehrentag. Möge es noch lange sich dieser
Rüstigkeit erfreuen." |
Zum Tod des aus Kirchheimbolanden
gebürtigen Forschungsreisenden Eugen Wolf (1912)
Weiteres zu Eugen Wolf siehe Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Wolf_(Journalist). Eugen Wolf wurde
beigesetzt im Hauptfriedhof in Neustadt a.d. Weinstraße.
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1912:
"München. Hier verschied - 62 Jahre alt - der Forschungsreisende
Eugen Wolff. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. Mai 1912:
"München. Hier verschied - 62 Jahre alt - der Forschungsreisende
Eugen Wolff.
Wolff, aus Kirchheimbolanden gebürtig, studierte Medizin,
machte den Krieg 1870/71 mit und unternahm dann Studienreisen in der
ganzen Welt. 1889 wurde er Beirat von Wißmann, 1892 leitete er die
Verhandlungen mit den Buren, die er zur Übersiedlung nach
Deutsch-Südwestafrika gewinnen wollte. Wolff hatte neben ethnographischen
Interessen die Förderung der kolonialen Ausbreitung Deutschlands im Auge.
Zahlreiche gelehrte Gesellschaften ernannten ihn zum Ehrenmitglied. Seine
Reiseberichte erschienen in den angesehensten deutschen Tageszeitungen. In
Buchform veröffentliche er: 'Im Innern Chinas', 'Deutsch-Südwestafrika'
und 'Vom Fürsten Bismarck und seinem Haus.'" |
| |
 Publikation von Eugen Wolf über "Deutsch-Südwest-Afrika. Ein offenes Wort
von Eugen Wolf - München -".
Publikation von Eugen Wolf über "Deutsch-Südwest-Afrika. Ein offenes Wort
von Eugen Wolf - München -".
Jos. Köselsche Buchhandlung Kempten und München. 1905.
|
Erinnerung an die Deportation in das
südfranzösische Internierungslager Gurs im Oktober
1940: Foto des Grabsteines von Isidor Schwarz in Gurs
 Grabstein im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für
Grabstein im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für
Isidor Schwarz,
geb. am 11. Mai 1880 in Marienthal, später wohnhaft in
Kirchheimbolanden,
am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, wo er am 23. Dezember 1941
umgekommen ist. |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von R.S.T. (1863)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1863:
"Ein israelitisches Mädchen von angenehmem Äußeren, die im Kochen,
sowie in der Haushaltung sehr erfahren ist und sehr gute Zeugnisse hat,
wünscht in eine kleine Haushaltung zum Beispiel bei zwei alten Leuten
oder bei einem einzelnen alten Herrn platziert zu werden. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1863:
"Ein israelitisches Mädchen von angenehmem Äußeren, die im Kochen,
sowie in der Haushaltung sehr erfahren ist und sehr gute Zeugnisse hat,
wünscht in eine kleine Haushaltung zum Beispiel bei zwei alten Leuten
oder bei einem einzelnen alten Herrn platziert zu werden.
Adresse: R.S.T. poste restante in Kirchheimbolanden
(Rheinpfalz)." |
Anzeige von Nachmanns Konfektionshaus (1901)
Anmerkung: das Konfektionshaus Gebr. Nachmann war nach dem Adressbuch 1907 in
der Alleestraße 35.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. August 1901: "Lehrling Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. August 1901: "Lehrling
mit guter Schulbildung per sofort oder 1. September gesucht. Kost
und Logis im Hause.
Nachmann's Konfektionshaus, Kirchheimbolanden,
Rheinpfalz." |
Anzeige von Louis Decker aus Marnheim (1901)
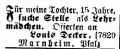 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1901:
"Für meine Tochter, 15 Jahre, Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1901:
"Für meine Tochter, 15 Jahre,
suche Stelle als Lehrmädchen.
Offerten an
Louis Decker, Marnheim, Pfalz". |
Anzeigen des Altmaterial-Geschäftes usw. E. Heumann (1901 / 1906)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juli 1901: "Von
einer kleinen Familie, bestehend aus Mann und Frau, wird aus anständiger
Familie, ein fleißiges, braves jüdisches Mädchen gesucht,
das in allen häuslichen Arbeiten vollständig bewandert ist.
Familienanschluss und guter Lohn werden zugesichert. Eintritt kann sofort
erfolgen. Offerten direkte erbeten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Juli 1901: "Von
einer kleinen Familie, bestehend aus Mann und Frau, wird aus anständiger
Familie, ein fleißiges, braves jüdisches Mädchen gesucht,
das in allen häuslichen Arbeiten vollständig bewandert ist.
Familienanschluss und guter Lohn werden zugesichert. Eintritt kann sofort
erfolgen. Offerten direkte erbeten.
E. Heumann, Kirchheimbolanden,
Pfalz." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Juli 1906:
"Günstige Gelegenheit zur Existenz-Gründung! Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. Juli 1906:
"Günstige Gelegenheit zur Existenz-Gründung!
Ich beabsichtige, mich von meinem seit nahezu 40 Jahren ohne Konkurrenz am
Platze und mit bestem Erfolge betriebenen
Altmaterial-Geschäft en gros - vorzugsweise Alteisen, Altmetalle,
Hadern etc. verbunden mit Fellgeschäft
wegen vorgerückten Alters zurückzuziehen und einem tüchtigen Nachfolger
unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen. Erforderliches Kapital
vorläufig etwa 10 Mille. Auf Wunsch bleibe ich noch einige Zeit bis zur
Einführung kostenfrei mittätig. Reflektanten belieben sich direkt an
mich zu wenden.
E. Heumann in Kirchheimbolanden (Rheinpfalz)." |
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes David Stern (1909)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. Januar 1909:
"Suche zu Ostern einen Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 21. Januar 1909:
"Suche zu Ostern einen
Lehrling
mit guter Schulbildung. Kost und Logis im Hause.
D. Stern Kirchheimbolanden (Rheinpfalz),
Manufakturwaren und Konfektion." |
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes Heinrich Schwarz (1915)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juni 1915:
"Lehrling Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juni 1915:
"Lehrling
gesucht. Kost und Logis im Hause.
Heinrich Schwarz Manufakturwaren Herren- und
Damen-Konfektion.
Kirchheimbolanden
(Rheinpfalz)." |
Anzeige von Frau D. Stern (1916)
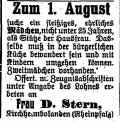 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. Juli 1916:
"Zum 1. August suche ein fleißiges, ehrliches Mädchen,
nicht unter 25 Jahren, als Stütze der Hausfrau. Dasselbe muss in der
bürgerlichen Küche bewandert sein und mit Kindern umgehen können.
Zweimädchen vorhanden. Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. Juli 1916:
"Zum 1. August suche ein fleißiges, ehrliches Mädchen,
nicht unter 25 Jahren, als Stütze der Hausfrau. Dasselbe muss in der
bürgerlichen Küche bewandert sein und mit Kindern umgehen können.
Zweimädchen vorhanden.
Offerten mit Zeugnisabschriften unter Angabe des Lohnes erbeten an
Frau D. Stern, Kirchheimbolanden
(Rheinpfalz)." |
Anzeige des Kurzwarengeschäftes Max Goldschmidt (1921)
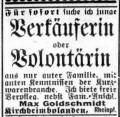 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 27. Oktober 1921: "Für sofort suche
ich junge Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 27. Oktober 1921: "Für sofort suche
ich junge
Verkäuferin oder Volontärin
aus nur guter Familie, mit guten Kenntnissen der Kurz-Warenbranche. Ich
biete freie Verpflegung, nebst Familien-Anschluss.
Max Goldschmidt Kirchheimbolanden, Rheinpfalz". |
Heiratsanzeige von Sigmund Metzger und Selma geb. Becker (1924)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. Juni 1924: Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 5. Juni 1924:
"Sigmund Metzger Selma Metzger geb. Becker
Vermählte
Kirchheimbolanden -
Billigheim (Pfalz) 25. Mai 1924." |
Verlobungsanzeige von Else Stern und Julius Gutheim (1930)
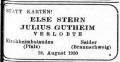 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 28. August 1930: Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 28. August 1930:
"Statt Karten!
Else Stern Julius Gutheim Verlobte
Kirchheimbolanden (Pfalz) Salder (Braunschweig)
24. August 1930." |
Verlobungsanzeige von Lilly Decker und Rabbiner Dr.
Lothar Lubasch (1930)
Anmerkung: Lothar Lubasch ist am 17. Mai
1896 in Berlin als Sohn von Hermann Lubasch und der Hannchen geb. Joseph geboren
und am 28. Juli 1976 in Fort Lauderdale, Broward, Florida, USA verstorben; das
Grab von Rabbiner Dr. Lothar Lubasch ist in Selma, Dallas County, Alabama, USA
siehe
https://de.findagrave.com/memorial/76996946/lothar-lubasch. Hier war er
zuletzt als Rabbiner tätig.Von 1924 bis 1928 wirkte Lothar Lubasch als Prediger
und Hilfsrabbiner am Israelitischen Tempel in Hamburg neben Rabbiner Friedrich
Rülf; seit 1930 war er der dritte Rabbiner in Barmen
https://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/wuppertal/wissenswertes/juedische-geschichte.
Seine letzte Stelle in den USA war der Temple Mishkan Israel in Selma, Alabama,
USA
https://abandonedsoutheast.com/2019/12/04/temple-mishkan-israel/
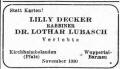 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. November 1930:
"Statt Karten! Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 13. November 1930:
"Statt Karten!
Lilly Decker - Rabbiner Dr. Lothar Lubasch
Verlobte
Kirchheimbolanden (Pfalz) - Wuppertal-Barmen
November 1930" |
Verlobungsanzeige von Ruth Goldschmidt und Alter Katzner (1930)
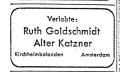 Anzeige
in der "CV-Zeitung" - Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 6.
Dezember 1934: Anzeige
in der "CV-Zeitung" - Zeitschrift des "Central-Vereins" vom 6.
Dezember 1934:
"Verlobte:
Ruth Goldschmidt Alter Katzner
Kirchheimbolanden Amsterdam" |
Todesanzeige für Abraham Metzger (1935)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Dezember 1935:
" Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. Dezember 1935:
"
Plötzlich und unerwartet verschied am 13. dieses Monats unser lieber Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel, Herr
Abraham Metzger
Veteran von 1866, 1870/71 im Alter von 91 Jahren.
Kirchheimbolanden, Pfalz, Worms,
Rodalben, Köln, den 14. Dez. 1935
Die trauernden Hinterbliebenen" |
Todesanzeige von David Stern (1935)
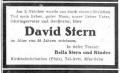 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:
"Am 3. Oktober wurde uns durch einen plötzlichen Tod mein lieber,
guter Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater und Großvater, Herr Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:
"Am 3. Oktober wurde uns durch einen plötzlichen Tod mein lieber,
guter Mann, unser lieber Vater, Schwiegervater und Großvater, Herr
David Stern
im Alter von 59 Jahren entrissen.
In tiefer Trauer: Bella Stern und Kinder
Kirchheimbolanden (Pfalz), Tel-Aviv, Kfar-Saba." |
Weitere Dokumente zu
jüdischen Gewerbebetrieben
(aus der Sammlung von Peter K. Müller, Kirchheim / Ries; weitere
Informationen gleichfalls von P. K. Müller)
Postkarte
von K. Adler & L. Goldmann
aus Kirchheimbolanden (1883) |
 |
 |
|
Die Postkarte von K. Adler & L.
Goldmann wurde versandt an die Fa. Elsas in Cannstatt am 25. April 1883.
Bei K. Adler könnte es sich um Kaufmann Adler handeln. Dieser war verheiratet mit der Frau
des verstorbenen Moses Goldstein, der Witwe Karoline Goldstein. Bei L. Goldmann könnte es
sich um den Sohn von Moses und Karoline Goldstein - Leo Goldstein - handeln.
Im Telephon-Adressbuch für das Deutsche Reich Kirchheimbolanden 1907 findet sich nachfolgender
Eintrag - Adler & Goldmann, Manuf.-W., Schloßstr. 16 (Link
zum Adressnachweis). |
Zur Geschichte des Betsaals / der Synagoge
Im 18. Jahrhundert bestand eine private Betstube im Haus einer
jüdischen Familie, vermutlich im Haus Goldmann in der Schlossstraße 33. Nach
einem Bericht von 1820 war die Betstube angesichts des starken Zuwachses der
Gemeinde inzwischen viel zu klein geworden. Die drei Gemeindeglieder Raphael Durlacher,
Daniel Levi und Moises Süskind hatten aus diesem Grund bereits zwei Jahre zuvor
(1818) ein Haus im Ort
gekauft, das zu einer Synagoge mit Lehrerwohnung und Schule umgebaut werden
sollte. Allerdings gab es Schwierigkeiten, da das Haus neben der
protestantischen Kirche St. Paul stand. Dennoch konnte das Vorhaben ausgeführt werden. Wann
die Einweihung erfolgte, ist unbekannt. Nur wenige Jahre war diese erste
Synagoge religiöses Zentrum der jüdischen Gemeinde, da es beim großen
Stadtbrand am 13. Juni 1833 zerstört wurde.
Zunächst plante man einen Wiederaufbau und ließ sich dazu von Bezirksingenieur
Beyschlag von der Bauinspektion Kaiserslautern einen Plan erarbeiten. Dieser
wurde geprüft und zunächst für gut befunden. Nachdem im Januar 1834
allerdings von der Brandversicherung 4.447,30 Gulden überwiesen wurden,
entschloss die Gemeinde, einen völligen Neubau in Auftrag zu geben. Man
ließ durch den Zivilbauinspektor August Voit einen Plan für einen Neubau in
unmittelbarer Nähe der niedergebrannten Synagoge erstellen. Voit orientierte
sich in der Architektur am Bau der Synagoge in Ingenheim und
an einem geänderten Bauplan Beyschlags, in dem die Wünsche der Gemeinde zur
Gestaltung der Innenräume aufgenommen wurde. Die Pläne Voits wurden akzeptiert
und bereits Ende Oktober 1834 erhielt die Gemeinde
die Baugenehmigung. Die Bauarbeiten begannen im April 1835 und dauerten bis zum
Sommer des folgenden Jahres. Am 1. September 1836 konnte die Synagoge
durch Rabbiner M. Kohn feierlich eingeweiht werden. Darüber berichtete die
"Allgemeine Zeitung des Judentums" in einem kurzen Artikel am 16.
September 1837:
Einweihung der Synagoge (1836)
 Zu Kirchheim-Bolland in Rheinbayern wurde am 1.
September 1836 eine neue, treffliche Synagoge eingeweiht. Am Abend predigte der
dortige Rabbiner M. Kohn, am andern Morgen der Kandidat Samuel Süßkind.
Letzterer hielt eine gediegene Predigt in klarer, eindringlicher Sprache über
"die Bestimmung des Gotteshauses nach dem Sinn und Geiste unserer
Religion;" und zwar 1) dass wir darin erbaut werden sollen durch Gebet und
Gesang (es ist dort auch Choralgesang eingeführt), 2) dass wir darin belehrt
werden sollen durch Predigt und Vorlesung aus der Tora (bei letzterer sprach er
über den alten .., der den vorgelesenen Abschnitt sogleich in die Landessprache
der Gemeinde vortragen musste!). Zu Kirchheim-Bolland in Rheinbayern wurde am 1.
September 1836 eine neue, treffliche Synagoge eingeweiht. Am Abend predigte der
dortige Rabbiner M. Kohn, am andern Morgen der Kandidat Samuel Süßkind.
Letzterer hielt eine gediegene Predigt in klarer, eindringlicher Sprache über
"die Bestimmung des Gotteshauses nach dem Sinn und Geiste unserer
Religion;" und zwar 1) dass wir darin erbaut werden sollen durch Gebet und
Gesang (es ist dort auch Choralgesang eingeführt), 2) dass wir darin belehrt
werden sollen durch Predigt und Vorlesung aus der Tora (bei letzterer sprach er
über den alten .., der den vorgelesenen Abschnitt sogleich in die Landessprache
der Gemeinde vortragen musste!).
|
Die Synagoge wurde in einem klassizistisch-maurischen Mischstil
errichtet. Die Westfassade war von Eckpilastern und einem Schildgiebel gerahmt.
Das Portal in der Mittelachse zeigte einen charakteristischen Hufeisenbogen.
Große Hufeisenbogenfenster prägten auch die Seitenwände (Traufseiten). Den
Abschluss bildeten Rundbogenfriese. Im Untergeschoss des Gebäudes befanden sich
ein "Schulsaal für die Kinder", das rituelle Bad (Frauenbad, Mikwe)
sowie die Lehrerwohnung mit Küche, Schlafraum, Wohnzimmer und einem weiteren
Zimmer.
In den folgende Jahrzehnten waren immer wieder Reparaturen notwendig (1842, 1855
usw.). Dennoch blieb die Synagoge über 100 Jahre gottesdienstliches Zentrum der
jüdischen Gemeinde Kirchheimbolanden.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde von SA-Männern die Inneneinrichtung
teilweise ausgeräumt, schließlich in der Synagoge mit Benzin Feier gelegt,
worauf sie völlig ausbrannte. Nur die Außenmauern blieben stehen. Anfang 1941
wurde die Ruine gesprengt; der Bauschutt wurde zum Auffüllen der Bahnhofstraße
verwendet. Das Grundstück kam in den Besitz der Stadt. Im Dezember 1949
erfolgte eine Rückübertragung an die Jüdische Kultusgemeinde Landau. Nach
Abschluss des Restitutionsverfahrens zahlte die Stadt 1950 eine Entschädigung
in Höhe von 2.300 DM und konnte im folgenden Jahr das Anwesen für 4.500 DM
wieder erwerben. Bei Aufräumarbeiten des Grundstückes wurde eine Torarolle mit
Wimpel gefunden und der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz übergeben.
1978 wurde eine Gedenktafel am Standort der Synagoge angebracht. 1984
wurden drei Steine aus den Konzentrationslagern Natzweiler-Struthof, Dachau und
Auschwitz vor der Gedenktafel aufgeschichtet. 1988 wurde eine Zusatztafel
enthüllt. Das Synagogengrundstück ist als Parkanlage zwischen Paulskirche und
Schlossplatz gestaltet.
Adresse/Standort der Synagoge: Am Husarenhof 8 (zwischen
Paulskirche und Schlossplatz; ehemalige
Schlossstraße 15)
Pläne / Fotos:
Entwürfe zum Neubau der
Synagoge (1834) von August Voit
(Quelle: Landesamt s.Lit. S. 208) |
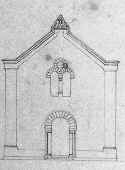 |
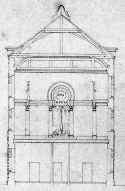 |
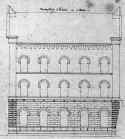 |
Eingangsfassade
(Westseite) |
Querschnitt |
Seitenansicht des zwei- bzw.
dreigeschossigen Baus |
| |
| |
|
|
 |
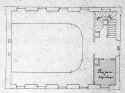 |
 |
Bereich des
Betsaales |
Bereich der
Frauenempore |
Grundriss des Untergeschosses
mit
Lehrerwohnung und Schulraum |
| |
|
|
Die Synagoge 1924
(Quelle: O. Weber s.Lit. S. 103) |
 |
 |
 |
| |
Ansicht von
Nordwesten (Husarenhof) |
Ansicht von
Norden |
Sitzplatzordnung 1876
(Quelle:
Landesamt S. 208) |
| |
|
|
| Die Zerstörung 1938/41 |
 |
 |
| |
Sprengung der Synagoge 1941
(Quelle: links Weber S. 104, rechts Landesamt S. 208) |
| |
|
|
Die Gedenkstätte
für die zerstörte Synagoge
(Fotos: Stefan Haas, Aufnahmen vom Juni 2015) |
|
|
 |
 |

 |
Die Gedenktafeln
mit den Inschriften: "Hier stand die 1835 erbaute und 1938 zerstörte
Synagoge der Jüdischen Kultusgemeinde Kirchheimbolanden" und
"Der Synagogenbrand weitete sich aus. Die Steine aus
Natzweiler-Struthof, Dachau + Auschwitz sind stimme Zeugen. Umkehr braucht
Erinnerung! 9. Nov. 1988."
Das
Foto links auch in hoher Auflösung |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Gedenkstein
in Form eines Grabsteines mit den Namen von Personen, die aus
Kirchheimbolanden deportiert wurden. |
| |
|
|
 |
 |
Menorah mit Datum
"24.8.2010"
|
Inschrift:
"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Allgem.
Erklärung der Menschenrechte. Art. 1" |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
1968
wird die jüdische Geschichte und die Geschichte der NS-Zeit in einer
Stadtchronik noch sehr unvollständig dargestellt - kritische Buchbesprechung aus
jüdischer Sicht (1970)
 Artikel
von Dr. E. G. Lowenthal im "Mitteilungsblatt - Wochenzeitung des Irgun Olej
Merkas Europa" vom 23. Januar 1970: "DEUTSCHE STADTHISTORIEN:
Kirchheimbolanden Artikel
von Dr. E. G. Lowenthal im "Mitteilungsblatt - Wochenzeitung des Irgun Olej
Merkas Europa" vom 23. Januar 1970: "DEUTSCHE STADTHISTORIEN:
Kirchheimbolanden
Kirchheimbolanden, heute eine Kreisstadt in der Pfalz, erhielt 1368
Stadtrechte. Von diesem Ereignis geht Hans Döhns reich illustrierte, 425
Seiten starke Geschichte dieser nordpfälzischen Kleinstadt
('Kirchheimbolanden, Geschichte der Stadt' 1968) aus.
Auch die 1835 an der Stelle des ehemaligen fürstlichen Badehauses erbaute
und 1938 zerstörte Synagoge ist abgebildet. Wie es zu dieser Zerstörung kam,
ist jedoch mit keinem Worte erklärt. Im frühen 18. Jahrhundert durften sich,
so heißt es im Text, nicht mehr als drei jüdische Familien in der Stadt
aufhalten. Der Flurname 'Judenberg' deutet auf eine frühe Ansiedlung von
Juden hin. Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert, die
188 Seelen im Jahre 1835 ausmachte, ist im Anhang zu dem Buch
nachgezeichnet. Allerdings schon 1871 sank die Ziffer auf 130 herab. 1900
lebten in Kirchheimbolanden nur noch 83 und 1925 lediglich noch 75 Juden —
in einem Zeitraum, in dem die Gesamtbevölkerung zunahm —, und nach Döhn gab
es 1939 in Kirchheimbolanden überhaupt keine Juden mehr.
Der Verfasser des Werks ist Professor an der Pädagogischen Hochschule in
Worms. Dass er der 'Zeitgeschichte', das heißt der Periode von 1914 bis
1965, weniger als 100 Zeilen widmet, davon ganze 10 der Nazizeit, ist höchst
verwunderlich, um nicht zu sagen: nicht zu verantworten. Selbst wenn im
Vorwort vorsorglich vermerkt ist, dass 'für die letzten Jahrzehnte die
historischen Fakten bewusst sparsam ausgewählt wurden', denn sie seien noch
in unserer Erinnerung lebendig, und zum andern fehle noch 'der notwendige
Abstand von den Geschehnissen, um sie zu sichten und die wesentlichsten
festzuhalten'.
Dieses bewusste Herausschneiden oder Ausklammern einer sehr wichtigen, weil
gefährlichen und entscheidenden Epoche aus einer 600-jährigen
Stadtgeschichte kann und darf aber nicht der Sinn solcher Jubiläumsschriften
sein, zumal wenn sie, wie im vorliegenden Fall, von der Stadtverwaltung und
dem Stadtrat 'veranlasst' und für die 'heranwachsende Generation'
geschrieben werden. Geschichtliche Landeskunde, wie sie hier betrieben wird,
sollte und muss auch zeit- und lebensnahe sein. Der Vertreter dieses Fachs
an der Universität Mainz, Professor Ludwig Petry, hat das Geleitwort zu dem
stattlichen Band verfasst, ohne — anscheinend — bemerkt zu haben, dass hier
die jüngste Vergangenheit geflissentlich umgangen werden ist. Diese
Unvollständigkeit stimmt bedenklich. Dr. E. G. LOWENTHAL". |
| |
1978 brachte die
Gemeinde eine Gedenktafel am Standort der ehemaligen Synagoge an. 1984
folgte die Setzung von drei Steinen aus den Konzentrationslagern
Natzweiler-Struthof, Dachau und Auschwitz.
1988 wurden
Zusatztafeln mit den folgenden Inschriften enthüllt: 'Hier stand die 1835
erbaute und 1938 zerstörte Synagoge der Jüdischen Kultusgemeinde
Kirchheimbolanden' und 'Der Synagogenbrand weitete sich aus. Die Steine aus
Natzweiler-Struthof, Dachau + Auschwitz sind stumme Zeugen. Umkehr braucht
Erinnerung! 9. Nov. 1988.'.
Siehe Fotos oben. |
| |
|
Februar 2008:
In Süßen wurden "Stolpersteine"
für Familie Metzger aus Kirchheimbolanden bzw. Rodalben verlegt
|
 Artikel
in
https://stolpersteine-goeppingen.de/suessen/die-familien-baer-und-metzger-2/:
"Zur Familie Metzger Artikel
in
https://stolpersteine-goeppingen.de/suessen/die-familien-baer-und-metzger-2/:
"Zur Familie Metzger
Alfred Metzger war das dritte Kind des Metzgermeisters Abraham
Metzger, geboren am 8. August 1844 in
Gauersheim, gestorben am 13.Februar 1935 in Kirchheimbolanden,
und dessen Ehefrau Maria Seeh, geboren am 29. August 1849 in
Hochspeyer, gestorben im Jahr 1923 in
Kirchheimbolanden. Alfred Metzger betrieb in Kirchheimbolanden
zuerst ein Manufakturwarengeschäft, war dann von 1914 bis 1918
Kriegsteilnehmer, wofür er ein Ehrenkreuz erhielt, und eröffnete am 15.
Februar 1919 in seiner Heimatstadt eine Zigarrenhandlung en gros. Am 11.
März 1921 heiratete er in Rodalben
Eugenie Baer, das vierte von elf Kindern des bereits genannten Ehepaars
Josef und Henriette Baer und übernahm dann das Geschäft seines
Schwiegervaters in der Rodalber Hauptstraße 103. Zur weiteren Geschichte (in
Rodalben) siehe:
https://stolpersteine-goeppingen.de/suessen/die-familien-baer-und-metzger-2/"
|
| |
| Juni
2016: Anstelle von
"Stolpersteinen" soll eine Gedenktafel erstellt werden
|
Artikel in der "Rheinpfalz" vom 22. Juni
2016: "Donnersbergkreis. Gedenktafel anstelle von Stolpersteinen
Kirchheimbolanden soll sich nicht am Kunstprojekt 'Stolpersteine'
beteiligen, das hat der Bauausschuss der Stadt bei seiner jüngsten Sitzung
entschieden. Er plädierte dafür, statt der im Boden verlegten Messingtafeln
zur Erinnerung an menschliche Schicksale in der Zeit des Nationalsozialismus
eine Informations- und Gedenktafel an den Treppen zur Holzgasse zu
errichten.
Als Vertreter für den verhinderten Matthias Malinowski berichtete Michael
Juppe vom Arbeitskreis 'Stolpersteine' über den Sachstand und die bisherigen
Aktivitäten. Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln wird in vielen
Städten im Land an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der Zeit des
Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den
Suizid getrieben wurden. Sie werden meist vor den letzten Wohnhäusern der
NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster bzw. den Belag des jeweiligen Gehwegs
eingelassen. Man habe recherchiert, wo überall Juden in Kirchheimbolanden
gewohnt hätten. Juppe betonte, man wolle die Ansicht von Carl Hausman, dem
letzten Überlebenden des Holocausts aus Kirchheimbolanden, respektieren, der
sich gegen die 'Stolpersteine' ausgesprochen habe, weil man, so Hausman, da
'nochmal getreten werde' (wir berichteten). Am heutigen Römerplatz in
Kirchheimbolanden habe früher Thekla Becker gewohnt und so hatte der
Ausschuss die Idee, an dieser Stelle, an der Treppe zur Holzgasse, eine
Gedenk- und Informationstafel zu errichten. Hier sollen die Namen aller
Juden, politisch, kirchlich und aus anderen Gründen Verfolgter, aufgelistet
werden. Die Auffassung des Arbeitskreises wurde von den Ausschussmitgliedern
geteilt. Nun sollen Gestaltungsvorschläge erarbeitet und ein geeigneter Text
erstellt werden. dwk"
Link zum Artikel |
| |
|
November 2024:
Gedenkfeier am Synagogenplatz
|
Artikel von Jeanette Anthes in der
"Rheinpfalz" vom 10. November 2024: "Gedenkfeier zum 9. November:
Erinnerungen an grausame Verbrechen
Gemeinsames Erinnern: Mehr als 100 Menschen kamen zur Gedenkstätte auf dem
Vorplatz der ehemaligen Synagoge.
Mehr als 100 Menschen fanden sich am Samstagabend zu einer Gedenkfeier auf
dem ehemaligen Synagogen-Vorplatz in Kirchheimbolanden ein. Zu der
Veranstaltung hatte der Arbeitskreis Friedenstage eingeladen. Mit
eindrücklichen Worten erinnerten Redner der Stadt, des Landes und der Kirche
an die Ereignisse des 9. November 1938. Die 'Novemberpogrome' bildeten den
Auftakt zum größten Völkermord in Europa. Auch Schüler der
Georg-von-Neumayer-Schule und des Nordpfalzgymnasiums sowie die Amnesty
International Ortsgruppe beteiligten sich mit Redebeiträgen. Der Zerstörung
der Kirchheimbolander Synagoge während der sogenannten 'Reichspogromnacht'
wurde mit einer Kranzniederlegung gedacht. Stadtbürgermeister Marc Muchow
erinnerte in seiner Ansprache an 'den Tag, der tief in die Geschichte
unseres Landes eingebrannt ist. Auch in Kirchheimbolanden hat dieser tiefe
Wunden hinterlassen', so Muchow. Erinnerung bedeute jedoch auch immer
Verantwortung, wie er mahnte.
Gefahr durch Antisemitismus. Für die Kirchengemeinden lud Stefanie
Susenburger von der Pfarrei Hl. Anna zu einem gemeinsamen Gebet. Monika
Fuhr, Landesbeauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen,
schilderte die Gefahr durch den erneut erstarkten Antisemitismus in der
Bevölkerung. Sie verwies dabei auf die erschreckende Anzahl antisemitischer
Angriffe in Rheinland-Pfalz, die sich im vergangenen Jahr verdreifacht habe.
Moderiert wurde die Mahn- und Gedenkfeier von Norbert Willenbacher vom
Arbeitskreis Friedenstage. 'Wir treffen uns hier, weil wir aus den grausamen
Verbrechen, die in unserem Land begangen wurden, gelernt haben', so
Willenbacher. Die Kirchheimbolander Friedenstage würden dafür eintreten,
dass Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland und anderswo in Europa
sicher, frei und ohne Angst leben können. Im Anschluss an die gut
45-minütige Gedenkveranstaltung zeigte der Zellertaler Künstler Reinhard
Geller seine Media-Arts-Performance 'Out of the Dark'. Die
Multimedia-Installation sollte ursprünglich auf eine Giebelwand am
Husarenhof projiziert werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde dies
kurzfristig in die benachbarte Paulskirche verlegt."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Otmar Weber: Die Synagogen in der Pfalz von 1800 bis heute. Unter
besonderer Berücksichtigung der Synagogen in der Südpfalz. Hg. von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz in Landau. 2005.
S. 95-96.103-104. (mit weiteren Literaturangaben). |
 | Bernhard Kukatzki: Jüdische Kultuseinrichtungen in
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Synagogen, Friedhöfe, Ritualbäder
in Gauersheim, Ilbesheim, Kirchheimbolanden, Marnheim. Schifferstadt 1997 S.
5-11. |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 208-210 (mit weiteren Literaturangaben). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Kirchheimbolanden
Palatinate. An ancient settlement apparently existed here. In the early 18th
century, three Jewish families were permitted to reside in the town. The
communitiy maintained a synagogue which was damaged by fire in 1833, and a
cemetery. The congregation was liberal in its religious orientation. The Jewish
population reached a peak of 188 in 1830 and the declined steadily. In June
1933, about four months after the Nazi rise to power, there were 65 Jews in
Kirchheimbolanden. Local residents strictly adhered to the general boycott of
April 1933. On October 1938, 28 Jews remained in Kirchheimbolanden and in late
1939 just 11. Of those who emigrated in 1935-39, 37-39 reached to United States.
On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue was burned, Jewish
homes and stores were vandalized, and Jewish men were sent to the Dachau
concentration camp. Ten Jews were deported to the Gurs concentration camp on 22
October 1940.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|