|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Emmendingen mit
Kenzingen (Kreisstadt,
Baden-Württemberg)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge bis 1938/40
Bitte besuchen Sie auch die
Website des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V.
www.juedisches-leben-in-emmendingen.de
Vergleiche (interne Links) Seite zum Jüdischen
Museum Emmendingen
Seite zur neuen
jüdischen Gemeinde in Emmendingen
Seite zum alten
jüdischen Friedhof Emmendingen
Seite zum neuen
jüdischen Friedhof Emmendingen
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Emmendingen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938.
Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhundert zurück. Nach der
Chronik konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg die ersten Juden in der
Stadt niederlassen (um 1660/70). 1680 wurde Jud Löwel Pächter der
Münze und des städtischen Salzhandels-Monopols. 1716 erhielten fünf aus dem
schweizerischen Thurgau vertriebene Familien von Markgraf Wilhelm einen
Schutzbrief*. 1738 lebten bereits 14 jüdische Familien in der Stadt. 1743 kamen
aus Stühlingen vertriebene Familien
dazu. 1775 war die Zahl der jüdischen Familien auf acht zurückgegangen, bis 1819
waren es wieder 19 Familien.
*Anmerkung von Günter Boll (Mitteilung vom 17.10.2011) : "Nach jahrelangen genealogischen Recherchen in den einschlägigen Archiven bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Behauptung
Adolf Lewins, "die Vertriebenen der Schweiz", die nach 1715 Aufnahme in der baden-durlachischen Markgrafschaft Hochberg (Emmendingen ...) und den oberbadischen Herrschaften Badenweiler (Müllheim) und Rötteln (Lörrach) fanden, seien aus dem Thurgau ausgewiesene Flüchtlinge gewesen, nicht haltbar ist. Plausibler erscheint deren Herkunft aus rechts- und linksrheinischen Judenwohnorten am Hochrhein (Stühlingen, Tiengen, Horheim ...) und im Surbtal (Endingen, Lengnau) oder aus dem Solothurner Gebiet (Dornach ...). Beweisgültige Indizien dafür gibt es allerdings nicht."
Die jüdischen Familien siedelten sich im 18./19. Jahrhundert
sowohl im Stadtgebiet wie seit 1728 in der Vor- und Unterstadt Niederemmendingen
(vor allem in der Karl-Friedrich-Straße) an.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1801 158 jüdische Einwohner, 1825 204 (9,4 % von insgesamt 2.165
Einwohnern), 1842 210, 1875 Höchstzahl mit 406 Personen erreicht (11,6 % von
insgesamt 3.487 Einwohnern), 1880 239 (9,1 % von 2.617), 1895 379 (7,5 % von
5.133), 1900 369 (5,9 % von 6.219), 1910 351 (4,2 % von 8,379). Zur jüdischen
Gemeinde in Emmendingen gehörten auch die in Kenzingen lebenden jüdischen
Personen (1924 25 Personen, 1932 19 Personen).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde einen Betsaal (1727),
dann eine Synagoge (s.u.). Nach dem Bau einer neuen Synagoge wurde die alte Synagoge
Kirchstraße 11 nach 1823 zu einem Gemeindehaus mit Kantorenwohnung und Gemeindesaal umgebaut. In ihm befand sich 1830 auch die jüdische
Konfessionsschule, später wurde diese (bis zur Aufhebung 1872) in die
Karl-Friedrich-Straße 62 verlegt. Lehrer im 19. Jahrhundert waren u.a. ein
Lehrer Auerbach (vgl. bei den Anzeigen unten M. Auerbach), nach 1862 K.
Bodenheimer. Um 1840 richtete die jüdische Gemeinde ein
rituelles Bad am Mühlenbach ein. Es wurde bis etwa 1900 benutzt, danach diente das kleine Badhaus dem Synagogendiener als Wohnung. Nach der Wiederentdeckung 1988 wurde die Mikwe von dem damals gegründeten Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen restauriert und in dem Gebäude 1997 das Jüdische Museum der Stadt eingerichtet (Standort: Schlossplatz 7).
Ein älterer Friedhof bestand seit
1717, ein neuer Friedhof seit 1899.
Die jüdische Gemeinde gehörte seit 1827 zum Rabbinatsbezirk Breisach,
dessen Amtssitz 1885 nach Freiburg i.Br. verlegt wurde.
Die jüdischen Bürger trugen seit dem 19. Jahrhundert in hohem Maß zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Emmendingens bei.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Ludwig
Goldschmidt (geb. 13.12.1886 in Emmendingen, gef. 13.3.1918), Unteroffizier Alfred
Kahn (geb. 1.8.1894 in Emmendingen, gef. 28.10.1916), Moritz Meyer (geb.
30.7.1879 in Emmendingen, gef. 21.8.1917), Vizefeldwebel Otto Veit (geb.
16.1.1891 in Emmendingen, gef. 10.10.1914, Bericht zu seiner Beisetzung siehe
unten), Ludwig Weil (geb. 24.9.1888 in
Mergentheim, gef. 14.10.1916), Unteroffizier Otto Emil Weil (geb. 1.1.1889 in
Emmendingen, gef. 30.7.1915), Unteroffizier Otto H. Weil (geb. 22.9.1891 in
Emmendingen, gef. 22.8.1918), David Wolfsbruck (geb. 14.4.1894 in Randegg, gef.
1.9.1916). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal
1914/18. Außerdem ist gefallen Unteroffizier Prof. Dr. Rudolf Kahn (geb.
24.8.1886 in Emmendingen, vor 1914 in Freiburg wohnhaft, gef. 2.5.1915).
Um 1924, als 364 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (4,1 % von
8.835 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde: Simon Veit, Max Wertheim,
Isaak Hobel, Emanuel Schwarz, Emil Dreyfuß und Alexander Günzburger. Als
Kantor war Hermann Marx angestellt, als Synagogendiener war Alexander Kahn
tätig, als Gemeindeschreiber der Hauptlehrer Isaak Hobel, als Gemeinderechner
Meier Markus. Isaak Hobel erteilte an öffentlichen Schulen 28 jüdischen
Kindern den Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen und
Wohlfahrtseinrichtungen bestanden der Israelitische Wohltätigkeitsverein
"Bikur Cholim" (bzw. Kranken- und Sterbeverein, gegründet
ca. 1825; 1924 unter Leitung von Leopold Veit und Berthold Weil, 1932 nur
Berthold Weil, 1932 100 Mitglieder), der Israelitische Frauenverein
(gegründet 1896, Zweck und Arbeitsgebiet: Kranken- und Wöchnerinnenfürsorge,
1924/32 unter Leitung von Frau H. Goldschmidt, 1932 111 Mitglieder), der Verein
Brith scholom (1924 unter Leitung von Leopold Veit mit 73 Mitgliedern, 1932
Leitung Gustav Wertheimer), der Synagogenchorverein (1924 unter Leitung
von Ludwig Wertheimer mit 120 Mitgliedern, 1932 Leiter Alfred Odenheimer), die Almosenkasse
der Israelitischen Gemeinde (gegründet ca. 1825, Ziel und Arbeitsgebiet:
Unterstützung Hilfsbedürftiger, 1932 Leiter Isidor Weil), die Wanderfürsorgestelle
(Ziel: Unterstützung von Durchwanderern, 1932 Leiter Kantor Joseph Bandel), der
Jugendbund (1932 Leiter Kantor Joseph Bandel), der Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten (1932 Leiter Herr Hobel) sowie eine Ortsgruppe des Central-Vereins
(1932 Leiter Rechtsanwalt Dreifuß). Im Schuljahr 1931/32 erhielten 33
Kinder der Gemeinde Religionsunterricht.
1932 waren die ersten beiden Gemeindevorsteher (der Vorstand bestand aus
fünf Personen) Alfred Odenheimer (1. Vors.), Rechtsanwalt Emil Dreifuß (2.
Vors.), als Schriftführer war weiterhin Hauptlehrer Isaak Hobel tätig. Zur
Repräsentanz gehörten 20 Personen, die Vorsteher waren Berthold Weil (1.
Vors.), Gustav Wertheimer (2. Vors.) und Max I. Weil (3. Vors.).
An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbebetrieben sind bekannt: Rosshandlung Isidor Bloch
(Karl-Friedrich-Straße 65), Kolonialwarenhandlung Max Bloch (Karl-Friedrich-Straße
36), Rechtsanwalt Emil Dreifuß (Karl-Friedrich-Straße 21), Textilgeschäft Theodor Geismar
(Karl-Friedrich-Straße 53), Haushaltwaren Hermann Falk (Theodor-Ludwig-Straße
11), Metzgerei Leopold Goldschmidt (Karl-Friedrich-Straße 17), Viehhandlung Max Goldschmidt
(Karl-Friedrich-Straße 38), Viehhandlung Albert Günzburger und Gasthaus "Ochsen', später Zigarrenfabrik Günzburger & Co.
(Karl-Friedrich-Straße 40), Viehhandlung Hermann Günzburger (Karl-Friedrich-Straße
47), Weinhandlung Hugo Günzburger (Goetheplatz 2), Viehhandlung Israel Philipp Günzburger
(Karl-Friedrich-Straße 9; bis heute mit Initialen und Wappenstein dieser Fam. Günzburger), Viehhandlung Max Günzburger
(Brunnenstraße 16), Sackfabrik Günzburger & Haas (Steinstraße 2), Gasthaus
"Zum Schwanen', Inh. Wwe. Rosa Haas
(Karl-Friedrich-Straße 19), Branntwein-Brennerei Max Heilbrunner (Moltkestraße
8), Branntwein-Brennerei, Likörfabrik und Weinhandlung Heilbrunner & Co.
(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 12), Branntwein-Brennerei, Likörfabrik und Weinhandlung Heilbronner & Moch
(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 13), Weißwarengeschäft Geschw. Kahn (Lammstraße
12), Lumpensortieranstalt und Altwaren Gebr. Kahn (Haselmatten 7), Kaufhaus S. Knopf
(Theodor-Ludwig-Straße 1), Schuhvertrieb A. Löwenthal (Hochburgerstraße 39), Kaufhaus M. Nachmann (Eckhaus
Marktplatz/Kirchstraße ), Arzt Dr. Julius Neuburger (Karl-Friedrich-Straße
24), Viehhandlung Hermann Pickard (Mundinger Straße 6, abgebrochen), Viehhandlung Simon Pickard
(Karl-Friedrich-Straße 55), Arzt Dr. Wilhelm Reutlinger
(Franz-Josef-Baumgartner-Straße 4), Herrenmode-Artikel, Textil- und Aussteuergeschäft Emanuel Schwarz, dann Benjamin Weil
(Markgrafenstraße 2), Textilgeschäft Siegfried Schwartz (Lammstraße 14), Metzgerei Albert Veit
(Markgrafenstraße 8), Viehhandlung Arthur und Louis Veit (Karl-Friedrich-Straße
32), Viehhandlung Julius Veit (Karl-Friedrich-Straße 63, abgebrochen), Lebensmittel- und Futterartikelhandlung Louis Veit und Viehhandlung Arthur Veit
(Theodor-Ludwig-Straße 4), Futtermittelhandlung Samuel Veit (Mundinger Straße
13), Metzgerei Samuel Veit (Karl-Friedrich-Straße 39), Viehhandlung Adolf Weil
(Karl-Friedrich-Straße 50), Häute-, Fell- und Rauchwaren-Großhandlung Benedikt Weil & Söhne
(Markgrafenstraße 4), Schuhgeschäft Ludwig Wolf und Zigarren-Großhandlung Emil Weil
(Markgrafenstraße 45), Bäckerei Fritz Weil (Karl-Friedrich-Straße 1), Aussteuer- und Textilgeschäft Hermann E. Weil
(Kirchstraße 9), Weinhandlung Hugo Weil (Karl-Friedrich-Straße 7), Mehlgroßhandlung J. Weil
(Hochburgerstraße 4), Lebensmittel-Großhandlung Max Benedikt Weil (Landvogteistraße
6), Viehhandlung Adolf Samuel Weil (Mundinger Straße 8), Feinkost-, Wein- und Zigarrenhandlung Sophie Weinstock
(Markgrafenstraße 26), Erste Badische Wein- und Edelbranntwein-Brennerei,
Klosterbrennerei GmbH Wertheimer & Cie., Inh. J.M. Wertheimer (Klostergasse
6; eine der führenden Weinbrennereien Deutschlands und die größte
Edelbranntwein-Brennerei des Schwarzwaldes), Rechtsanwalt Robert Wertheimer (Marktplatz 4).
Zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 lebten 296
jüdische Personen in der Stadt (3,1 % von 9,514). Bis 1934/37 nahm die Zahl auf
Grund des Zuzuges von umliegenden Landgemeinden trotz der auch in Emmendingen
zunehmenden Repressalien und der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts noch nicht
ab (1934 348 jüdische Einwohner, 1936 413, 1937 287). 1935 bis zur Aufhebung am
24. April 1937 bestand wieder eine jüdische Volksschule, da den Kindern der
Besuch der allgemeinen Schulen nicht mehr möglich war. Am 1. Januar 1938 wurden
noch 138 jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Synagoge zerstört (s.u.), das israelitische Gemeindehaus demoliert, die
Friedhöfe geschändet, die Schaufenster jüdische Geschäfte eingeworfen. Von
den nach Dachau verschleppten jüdischen Männern wurde Israel Günzburger
ermordet. Anfang 1939 wurden die letzten 13, bis dahin noch bestehenden
jüdischen Firmen und Geschäfte aufgelöst. Bis Anfang 1940 konnten etwa zwei
Drittel der jüdischen Einwohner Emmendingens emigrieren (etwa 100 nach
Nordamerika).
Die letzten 71 jüdischen Gemeindeglieder wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs
deportiert.
Von den in Emmendingen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Leo Alpern (1903),
Rosa(lie) Beer geb. Günzburger (1888), Emilie Bergheimer geb. Bloch (1883),
David Bloch (1863), Friedrich Bloch (1888), Richard Bloch (1887), Sofie Bloch
(1882), Friederike (Rika) Bodenheimer geb. Sinsheimer (1857), Siegfried
Bodenheimer (1868), Peter Bradt (1913), Melanie Breisacher (1903), Berta Brummer
geb. Liebhold (1895), Emil Dreifuß (1865), Emma Dreifuss geb. Veit (1858),
Mathilde Dreifuß (1885), Rosa Dreifuss geb. Günzburger (1876), Marie Fonteyn
geb. Weil (1914), Liesel Freundlich geb. Seligmann (1923), Marie Fröhlich geb.
Goldschmidt (1880), Ida Fürst geb. Wertheimer (1891), Alfred Geismar (1925),
Emma Geismar geb. Blum (1874), Hedwig Geismar geb. Günzburger (1888), Max
Geismar (1884), Salomon Geismar (1875), Johanna Goldberg (1896), Olga Goldberg
(1868), Hilda Grünebaum geb. Weil (1888), Alfred Günzburger (1894), Hermann
Günzburger (1886), Israel Günzburger (1857), Jakob Günzburger (1883), Johanna
Günzburger I (1886), Johanna Günzburger II (1883), Julius Günzburger (1875),
Max Günzburger (1881), Richard Günzburger (1903), Siegfried Günzburger
(1885), Sophie Günzburger geb. Günzburger (1879), Sophie Günzburger (1882),
Walter Günzburger (1917), Fanny Haas (1897), Frieda Haas geb. Veit (1897),
Julius Haas (1874), Sofie Haas (1872), Thekla Haas (), Hilda Haberer geb.
Wurmser (1886), Siegfried Hauser (1881), Nanette Heilbronner geb. Bernheim
(1859), Ludwig Herz (1872), Isack Hobel (1887), Melitta Hobel geb. Gundelfinger
(1886), Babette Hochstätter (1869), Leo Hofeler (1897), Betty Hofmann (1912),
Mathilde Kahn geb. Hirsch (1871), Elsa Kohlmann geb. Günzburger (1889), Selma
Kraus (1887), Ida Levistein (1874), Fanny Levy (1899), Ida Lion geb. Günzburger
(1885), Siegfried Maier (1897), Thekla Mannheimer geb. Haas (1894), Elsa Mayer
(1909), Emil Mayer (1874), Hermine Mayer geb. Greilsheimer (1879), Lydia Mayer
(1902), Martha Mayer (1907), Max Mayer (1873), Balbine Moch geb. Weil (1867),
Leopold Moch (1885), Stefanie Moch geb. Heilbrunner (1891), Else Müller (1909),
Luise Nahm (1900), Albert Neumann (1869), Emma Olesheimer geb. Weil (1857),
Henriette Pickard geb. Günzburger (1860), Ida Reiss (1860), Camilla (Kamilla)
Roos geb. Pickard (1888), Hermine Roos geb. Günzburger (1882), Hermann Ross
(1888), Lina Ruben (1896), Gertrud Schloss geb. Haas (1899), Hilda Schustermann
(1907), Emma Schwab (1885), Elsa Ullmann geb. Heilbrunner (1889), Lise Ullmann
(1859), Anna Valfer geb. Weil (18794), Flora Veit (1897), Samuel Veit (1866),
Simon Veit (1851), Anna Weil geb. Heim (1880), Arthur Weil (1887), Elias Weil
(1877), Elise Weil geb. Heim (1878), Elsa Weil geb. Wurmser (1890), Erich Weil
(1910), Flora Weil geb. Höchstetter (1892), Frieda Weil (1877), Fritz Weil
(1909), Heinz Weil (1923), Ida Weil geb. Veit (1876), Irma Weil (1909), Jette
Weil geb. Veit (1854), Julius Weil I (1873), Julius Weil II (1873), Julius Weil
III (1884), Lina Weil (1867), Lina Weil geb. Mai (1896), Luise Weil (1877),
Marie Weil (1914), Max Weil (1878), Moritz Weil I (1855), Moritz Weil II (1873),
Rosa Weil geb. Veit (1857), Rolf Weinstock (1920), Sofie Weinstock geb.
Heilbrunner (1884), Jakob Wendel (1876), Lina Wendel geb. Weil (1880), Flora Wertheimer
(1867), Sofie Wertheimer geb. Günzburger (1877), Lina Wolff geb. Günzburger
(1885), Ludwig Wolf (1864).
Nach 1945:
Zur Neubegründung einer Gemeinde kam es in Emmendingen
durch den Zuzug jüdischen Emigranten aus den GUS-Ländern im Februar 1995
(vgl. nächste Seite).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte
der jüdischen Lehrer / Kantoren
Ausschreibungen der Stelle des Vorbeters und Schochet 1877
Anmerkung: auf Grund der Größe der Gemeinde
waren bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Ämter des Lehrers,
Kantors und Schochet auf zwei Personen verteilt. Neben dem jüdischen
Elementarlehrer war der Kantor angestellt, der zugleich das Amt des Schächtens
innehatte. Die Stelle wurde sowohl in der orthodox-jüdischen Zeitschrift
"Der Israelit", als auch in der liberalen "Allgemeinen Zeitung
des Judentums" ausgeschrieben, was von einer liberalen Grundeinstellung der
jüdischen Gemeinde zeugt.
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877:
"Kantorstelle. Bei der hiesigen Israelitischen Gemeinde ist die
Stelle eines Kantors und Schächters bis zum 1. Juli dieses Jahres zu
besetzen. Fixen Gehalt Mark 1.200 und der Schächterdienst trägt ca.
800-900 Mark ein. Musikalische gebildete Bewerber, nicht über 35 Jahre
alt, welche die Fähigkeit besitzen, Religionsunterricht zu erteilen, mit
Chor vorzubeten, sowie die Synagogengesänge einzuüben, werden bevorzugt. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877:
"Kantorstelle. Bei der hiesigen Israelitischen Gemeinde ist die
Stelle eines Kantors und Schächters bis zum 1. Juli dieses Jahres zu
besetzen. Fixen Gehalt Mark 1.200 und der Schächterdienst trägt ca.
800-900 Mark ein. Musikalische gebildete Bewerber, nicht über 35 Jahre
alt, welche die Fähigkeit besitzen, Religionsunterricht zu erteilen, mit
Chor vorzubeten, sowie die Synagogengesänge einzuüben, werden bevorzugt.
Reisekosten werden nur demjenigen vergütet, welchem die Stelle
übertragen wird. Emmendingen (Baden), im April 1877. J. Wertheimer,
Vorsteher". |
| |
 Anzeige
mit demselben Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Mai 1877. Anzeige
mit demselben Text wie oben in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Mai 1877. |
Auszeichnung für Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. März 1914: "Aus Karlsruhe wird geschrieben: Der Oberrat
hat für das Jahr 1914 folgende Fanny Weil'sche Tugendpreise verliehen: im
Betrage von 500 Mark dem Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck an der
Volksschule in Emmendingen; im Betrage von 300 Mark der Frau
Rosa Wachenheimer Witwe in Schmieheim,
der Frau Regine Seelig in Mannheim und der Frau Malchen
Kälbermann in Großeicholzheim."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. März 1914: "Aus Karlsruhe wird geschrieben: Der Oberrat
hat für das Jahr 1914 folgende Fanny Weil'sche Tugendpreise verliehen: im
Betrage von 500 Mark dem Hauptlehrer Jakob Wolfsbruck an der
Volksschule in Emmendingen; im Betrage von 300 Mark der Frau
Rosa Wachenheimer Witwe in Schmieheim,
der Frau Regine Seelig in Mannheim und der Frau Malchen
Kälbermann in Großeicholzheim."
|
Besondere
Ereignisse im jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Die Tagung des "Allgemeinen Landesvereins im
Großherzogtum Baden zur Verbesserung der inneren und äußeren Zustände des
Juden" (1847)
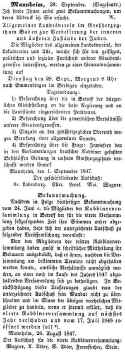 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4.
Oktober 1847: "Mannheim, 20. September (1847). Ich sende Ihnen anbei
zwei Bekanntmachungen, um deren Abdruck ich Sie ersuche. W.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4.
Oktober 1847: "Mannheim, 20. September (1847). Ich sende Ihnen anbei
zwei Bekanntmachungen, um deren Abdruck ich Sie ersuche. W.
Allgemeiner Landesverein im Großherzogtum Baden zur Verbesserung der
inneren und äußeren Zustände der Juden.
Die Mitglieder des allgemeinen Landesvereins, der Lokalvereine und Alle,
welche sich für den geistigen, politischen und sozialen Forschritt
unserer Glaubensgenossen interessieren, werden zu einer Generalversammlung
auf Dienstag, den 28. September, Morgens 8 Uhr nach Emmendingen im
Breisgau eingeladen.
Tagesordnung: 1) Besprechung über die in Betreff der bürgerlichen
Gleichstellung an die hohe Regierung und an die Landstände
einzureichenden Petitionen. 2) Besprechung über die gewerblichen
Verhältnisse unserer Glaubensgenossen. 3) Eingabe an den
großherzoglichen Oberrat wegen Berufung einer allgemeinen Synode. 4)
Besprechung über die Frage: Inwiefern den in den Versammlungen deutscher
Rabbiner gefassten Beschlüssen Geltung in unserm Großherzogtum
verschafft werden könne?
Mannheim, den 1. September 1847. Der geschäftsleitende Ausschuss: Dr. Ladenburg.
Eller. Lenel, Mai. Wagner.
Bekanntmachung. Nachdem in Folge diesseitiger Bekanntmachung vom
24. Juni dieses Jahres die Mitglieder der Rabbinerversammlung in
Betreff der für die vierte Versammlung festzusetzenden Zahl ihre Stimmen
anher abgegeben haben, sieht sich der unterzeichnete Ausschuss zu
folgender Veröffentlichung veranlasst: Von den Mitgliedern der dritten
Rabbinerversammlung haben zwölf in schriftlicher Mitteilung ihr Bedauern
ausgedrückt, dass es ihnen, nachdem die Versammlung am bestimmten Termine
nicht abgehalten werden konnte, amtliche Verhältnisse unmöglich machen,
an einer noch im Laufe des Jahres 1847 abzuhaltenden Versammlung sich zu
beteiligen. In Berücksichtigung dieser Äußerungen glaubt nun der
unterzeichnete Ausschuss sein Mandat nicht zu überschreiten und im Sinne
der übrigen verehrlichen Mitglieder zu handeln, wenn er hiermit erklärt,
dass die vierte Rabbinerversammlung auf nächstes Jahr verschoben und vom
17. Juli 18548 eröffnet werden soll.
Mannheim 26. August 1847. Der Ausschuss für die vierte
Rabbinerversammlung: Wagner, A. Adler, S. Adler, Formstecher, Stein." |
| |
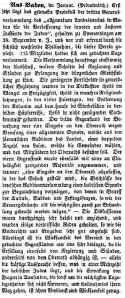 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Januar 1848:
"Aus Baden, im Januar. Erst jetzt liegt das gedruckte
Protokoll der dritten Generalversammlung des 'allgemeinen Landesvereins in
Baden für die Verbesserung der inneren und äußeren Zustände der
Juden', gehalten zu Emmendingen am 28. September vorigen
Jahres, uns vor und erfreut durch die sichtlich wachsende Teilnahme, die
dieser Verein genießt. 115 Mitglieder hatten sich am gedachten Tage
versammelt. Die Versammlung beauftragt einstimmig den Ausschuss, weitere
Schritte bei Regierung und Ständen zur Erlangung der bürgerlichen
Gleichstellung zu tun. Die geringeren Fortschritte in gewerblicher
Beziehung wurden in der Diskussion teils im Mangel an Freizügigkeit,
teils in manchen Religionssatzungen, in den vielen Feiertagen, der
Entfernung der Kohanim aus dem Hause bei Sterbefällen in derselben
Häuserreihe, teils in nicht genügender Sachkenntnis gefunden. Der dritte
Gegenstand der Beratung war eine Eingabe an den Oberrat wegen Berufung
einer allgemeinen Synode, welche aus den sämtlichen Rabbinen des Landes,
einer doppelten Anzahl von Laien, welche die Gemeinden wählen, und den
Mitgliedern des Oberrats bestehen soll. Der vierte Gegenstand wurde
ebenfalls mit einer an Einhelligkeit grenzenden Majorität angenommen, und
lautete: 'eine Eingabe an den Oberrat abzufassen, in der das Gesuch
gestellt wird, die Beschlüsse der deutschen Rabbinerversammlung einer
badischen Synode zur Begutachtung vorzulegen, von denen in Betreff der
Kultus-, Sabbat- und Festtagsfragen, sowie der Trauergebräuche als die
wichtigsten zuerst zur Behandlung gebracht werden mögen.' - Die
Diskussionen waren durchgängig sehr belebt und anziehend, und wurden
einige vortreffliche Reden gehalten, sowie die Vorberichte und Eingaben
sehr gut abgefasst sind. Allerdings ist die Wirksamkeit des Vereins in den
gedachten Gegenständen nur eine sehr bedingte, da die Erfüllung
einerseits von Regierung und Ständen, andererseits von dem Oberrat
abhängig ist, - allein die kräftige Aussprache dessen, was in einer
Mehrzahl der badischen Juden liegt, und die Erweckung von Fragen in
Tausenden, die sonst um die wichtigsten Angelegenheiten sich nicht
kümmern, und teilnahmslos ihren Weg gehen, ist schon Verdienst und
Wirksamkeit genug." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Januar 1848:
"Aus Baden, im Januar. Erst jetzt liegt das gedruckte
Protokoll der dritten Generalversammlung des 'allgemeinen Landesvereins in
Baden für die Verbesserung der inneren und äußeren Zustände der
Juden', gehalten zu Emmendingen am 28. September vorigen
Jahres, uns vor und erfreut durch die sichtlich wachsende Teilnahme, die
dieser Verein genießt. 115 Mitglieder hatten sich am gedachten Tage
versammelt. Die Versammlung beauftragt einstimmig den Ausschuss, weitere
Schritte bei Regierung und Ständen zur Erlangung der bürgerlichen
Gleichstellung zu tun. Die geringeren Fortschritte in gewerblicher
Beziehung wurden in der Diskussion teils im Mangel an Freizügigkeit,
teils in manchen Religionssatzungen, in den vielen Feiertagen, der
Entfernung der Kohanim aus dem Hause bei Sterbefällen in derselben
Häuserreihe, teils in nicht genügender Sachkenntnis gefunden. Der dritte
Gegenstand der Beratung war eine Eingabe an den Oberrat wegen Berufung
einer allgemeinen Synode, welche aus den sämtlichen Rabbinen des Landes,
einer doppelten Anzahl von Laien, welche die Gemeinden wählen, und den
Mitgliedern des Oberrats bestehen soll. Der vierte Gegenstand wurde
ebenfalls mit einer an Einhelligkeit grenzenden Majorität angenommen, und
lautete: 'eine Eingabe an den Oberrat abzufassen, in der das Gesuch
gestellt wird, die Beschlüsse der deutschen Rabbinerversammlung einer
badischen Synode zur Begutachtung vorzulegen, von denen in Betreff der
Kultus-, Sabbat- und Festtagsfragen, sowie der Trauergebräuche als die
wichtigsten zuerst zur Behandlung gebracht werden mögen.' - Die
Diskussionen waren durchgängig sehr belebt und anziehend, und wurden
einige vortreffliche Reden gehalten, sowie die Vorberichte und Eingaben
sehr gut abgefasst sind. Allerdings ist die Wirksamkeit des Vereins in den
gedachten Gegenständen nur eine sehr bedingte, da die Erfüllung
einerseits von Regierung und Ständen, andererseits von dem Oberrat
abhängig ist, - allein die kräftige Aussprache dessen, was in einer
Mehrzahl der badischen Juden liegt, und die Erweckung von Fragen in
Tausenden, die sonst um die wichtigsten Angelegenheiten sich nicht
kümmern, und teilnahmslos ihren Weg gehen, ist schon Verdienst und
Wirksamkeit genug." |
Initiative zur Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins (1872)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1872:
"Aus Baden. Die Synagogenräte der Gemeinden Altdorf,
Breisach, Ettenheim,
Emmendingen, Freiburg, Ihringen,
Kippenheim, Müllheim,
Schmieheim erließen an die
israelitischen Gemeinden Badens einen Aufruf, in welchem sie dieselben zum
Beitritte zu der Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins
auffordern, dessen Aufgabe sei, den Hinterlassenen eines jeden
Familienvaters, - reich oder arm - der Mitglied rubr. Vereins war, eine
Summe von 1000 Gulden auszuzahlen und zwar innerhalb 30 Tage nach dem
Sterbefall. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1872:
"Aus Baden. Die Synagogenräte der Gemeinden Altdorf,
Breisach, Ettenheim,
Emmendingen, Freiburg, Ihringen,
Kippenheim, Müllheim,
Schmieheim erließen an die
israelitischen Gemeinden Badens einen Aufruf, in welchem sie dieselben zum
Beitritte zu der Gründung eines jüdischen Sterbekassenvereins
auffordern, dessen Aufgabe sei, den Hinterlassenen eines jeden
Familienvaters, - reich oder arm - der Mitglied rubr. Vereins war, eine
Summe von 1000 Gulden auszuzahlen und zwar innerhalb 30 Tage nach dem
Sterbefall.
Dieses Projekt wurde von einem Amerikaner, Herrn Jonas Weil aus New York,
geborener Emmendinger, welcher Mitglied eines ähnlichen
amerikanischen Vereins 'Bene Beris' in New York ist, unter Mithilfe des
Herrn Hauptlehrer Bodenheimer in Emmendingen, bei nachfolgenden
Gemeinden schon zur Ausführung gebracht; nämlich in: Emmendingen,
Freiburg, Breisach,
Schmieheim, Kippenheim,
Altdorf, Ettenheim,
Ihringen, Müllheim,
zusammen mit mehr als 500 Mitgliedern.
In Baden wohnen ungefähr 25.000 Israeliten, welche ca. 5.000
Familienväter repräsentieren. Treten von diesen 5.000 auch nur 4.000
diesem nicht genug hoch zu schätzenden Sterbekassenvereine bei, so würde
ein Beitrag von 15 Kreuzer bei jeglichem Sterbefalle dieser 4.000
Mitglieder hinreichen, der Witwe oder den Waisen die erkleckliche Summe
von 1.000 Gulden auszahlen zu können.
Der New Yorker Verein, der 4.200 Mitglieder zählt, hat nach statistischen
Zusammenstellungen bisher höchstens 20 Sterbefälle pro Jahr und würde
nach dieser Annahme 5 Gulden als jährlicher Beitrag zur sofortigen
Ausbezahlung der 1000 Gulden schon hinreichen.
Die Statuten dieses Vereins sollen am Sonntag, den 25. Februar dieses
Jahres, in Freiburg von den Delegierten der betreffenden Gemeinden beraten
und endgültig festgesetzt werden." |
Gründung eines "Sterbekasse-Vereins" (1872)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Emmendingen
(Baden). Wir haben schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass auf
Veranlassung der Herren Jonas Weil aus New York und Hauptlehrer
Bodenheimer in Emmendingen ein 'Sterbekasse-Verein' gegründet worden
und dessen Wohltaten sich womöglich über sämtliche Israeliten Badens
erstrecken sollen. – Inzwischen hat in Freiburg eine
Delegiertenversammlung badischer Israeliten stattgefunden, in welcher die
Statuten entworfen wurden. Sobald der Verein 2.000 Mitglieder zählt, wird
er seine Tätigkeit beginnen. Der Verein wird den Hinterlassenen eines
Mitgliedes ein Minimum von 500 Gulden und ein Maximum von 1.000 Gulden
auszahlen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Emmendingen
(Baden). Wir haben schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass auf
Veranlassung der Herren Jonas Weil aus New York und Hauptlehrer
Bodenheimer in Emmendingen ein 'Sterbekasse-Verein' gegründet worden
und dessen Wohltaten sich womöglich über sämtliche Israeliten Badens
erstrecken sollen. – Inzwischen hat in Freiburg eine
Delegiertenversammlung badischer Israeliten stattgefunden, in welcher die
Statuten entworfen wurden. Sobald der Verein 2.000 Mitglieder zählt, wird
er seine Tätigkeit beginnen. Der Verein wird den Hinterlassenen eines
Mitgliedes ein Minimum von 500 Gulden und ein Maximum von 1.000 Gulden
auszahlen." |
Gründung eines "Vereins zur Förderung des
Handwerkes und der technischen Berufsarten unter den Israeliten des
Großherzogtums Baden" (1890)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar 1891: "Ein schönes
Zeichen der Anhänglichkeit an die Glaubensgenossen in der Heimat ist dem
'Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten
unter den Israeliten des Großherzogtums Baden' (Abteilung Freiburg i.
Br.)
von dem in New York lebenden, aus Emmendingen in Baden stammenden Herrn
Jonas Weil zugegangen. Derselbe übersandte unterm 2. Dezember 1890 dem
Vorstande einen Wechsel über 225 Mark und zugleich eine Liste derjenigen
Herren, welche sich auf seine Fürsprache zu einem jährlichen
Mitglieder-Beitrage von 1 bis 5 Dollars bereit erklärt haben. Wir
veröffentlichen gern die Namen dieser hochherzigen Geber, deren Beispiel
vielfache Nachahmung verdient. Es zeichneten folgende Herren: Rafael
Sturmann, Barnett Sturmann, Hyman Wittkower, Wm. Prager, R. Bromberger, P.
Hirschfield, Ralph Prager, Lesser Prager, Samuel Wornecker, A.S.
Kalischer, Josef Morris, H. Batt, J. Crook, Isac Phillipps, S. Rothschild,
Emil Mayer, M. Rothschild, A Wolf, N. Loewy, A. Alex. Loewy, A. Beller, S.
Beller, E. Frank, Mayer Finn, M. Kahn, A. Kalischer, S. Jarmulowsky, J.
Weil, Edm. Weil, J. Rinaldo, Max Aronson, Isidor Rosenthal, M. Grünstein,
Plaut, je 1 Dollar, S. und D.S. Korn, Grabenheimer je 2 Dollar, M.
Goldschmidt und Familie, B. Meyer, J. Weil je 5 Dollar, sämtlich in New
York, S. Stein in Jersey-City 1 Dollar." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar 1891: "Ein schönes
Zeichen der Anhänglichkeit an die Glaubensgenossen in der Heimat ist dem
'Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten
unter den Israeliten des Großherzogtums Baden' (Abteilung Freiburg i.
Br.)
von dem in New York lebenden, aus Emmendingen in Baden stammenden Herrn
Jonas Weil zugegangen. Derselbe übersandte unterm 2. Dezember 1890 dem
Vorstande einen Wechsel über 225 Mark und zugleich eine Liste derjenigen
Herren, welche sich auf seine Fürsprache zu einem jährlichen
Mitglieder-Beitrage von 1 bis 5 Dollars bereit erklärt haben. Wir
veröffentlichen gern die Namen dieser hochherzigen Geber, deren Beispiel
vielfache Nachahmung verdient. Es zeichneten folgende Herren: Rafael
Sturmann, Barnett Sturmann, Hyman Wittkower, Wm. Prager, R. Bromberger, P.
Hirschfield, Ralph Prager, Lesser Prager, Samuel Wornecker, A.S.
Kalischer, Josef Morris, H. Batt, J. Crook, Isac Phillipps, S. Rothschild,
Emil Mayer, M. Rothschild, A Wolf, N. Loewy, A. Alex. Loewy, A. Beller, S.
Beller, E. Frank, Mayer Finn, M. Kahn, A. Kalischer, S. Jarmulowsky, J.
Weil, Edm. Weil, J. Rinaldo, Max Aronson, Isidor Rosenthal, M. Grünstein,
Plaut, je 1 Dollar, S. und D.S. Korn, Grabenheimer je 2 Dollar, M.
Goldschmidt und Familie, B. Meyer, J. Weil je 5 Dollar, sämtlich in New
York, S. Stein in Jersey-City 1 Dollar." |
Pressearbeit gegen den Antisemitismus (1891)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. November 1891:
"Emmendingen (Baden), den 30. Oktober. Angesichts der Bestrebungen, das Gift
des Antisemitismus auch im Badischen Lande zu verbreiten, ist es erfreulich
und wahrhaft wohltuend, in dem hier erscheinenden 'Hochberger Boten' einen
Artikel zu finden, der das Treiben dieser Patrioten klar charakterisiert und
scharf verurteilt. Die Israeliten hiesiger Stadt, sowie des Badischen
Oberlandes, wo der 'Hochberger Bote' sehr
verbreitet und gern gelesen wird, wissen Herrn A. Dölter, dem Redakteur
des genannten Blattes, Dank für seine Beurteilung der Judenfrage, umso
mehr, als diese Beurteilung von einem Manne herrührt, der seit vielen
Jahren einer der eifrigsten Führer der hiesigen nationalliberalen Partei
ist." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. November 1891:
"Emmendingen (Baden), den 30. Oktober. Angesichts der Bestrebungen, das Gift
des Antisemitismus auch im Badischen Lande zu verbreiten, ist es erfreulich
und wahrhaft wohltuend, in dem hier erscheinenden 'Hochberger Boten' einen
Artikel zu finden, der das Treiben dieser Patrioten klar charakterisiert und
scharf verurteilt. Die Israeliten hiesiger Stadt, sowie des Badischen
Oberlandes, wo der 'Hochberger Bote' sehr
verbreitet und gern gelesen wird, wissen Herrn A. Dölter, dem Redakteur
des genannten Blattes, Dank für seine Beurteilung der Judenfrage, umso
mehr, als diese Beurteilung von einem Manne herrührt, der seit vielen
Jahren einer der eifrigsten Führer der hiesigen nationalliberalen Partei
ist." |
Einweihung des Kriegerdenkmals zu Ehren der Kriegsteilnehmer 1870/71 (1897)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Aus
Baden,
3. Oktober (1897). Am Sonntag, den 26. September wurde in der Stadt
Emmendingen zu Ehren der dortigen, eingeborenen Krieger vom Jahre 1870/71
ein Kriegerdenkmal unter größeren Festlichkeiten enthüllt. Mit dieser
Enthüllung wurde auch eine besondere Ehrung der noch lebenden Emmendinger
Kriegsveteranen aus jenen denkwürdigen Kämpfen verbunden, indem jedem
derselben, worunter sich auch zwei Israeliten befinden, nämlich Dr. med.
Bloch aus Freiburg i.Br. und Hauptlehrer Weil aus
Eichstetten, vom
Bürgermeister der Stadt Emmendingen eine geschmackvoll geprägte,
silberne Erinnerungsmedaille angesichts Hunderter von Festteilnehmer
öffentlich überreicht wurde. Aber auch der bereits verstorbenen Kämpfer
von 1870/71 sollte nicht vergessen werden, indem auf den Friedhöfen der
verschiedenen Konfessionen zu Ehren der dort ruhenden Krieger eine
würdige Gedächtnisfeier veranstaltet wurde. Auf dem jüdischen
Friedhofe, auf welchem zwei derselben beerdigt sind, wurde diese Feier am
Sonntagvormittag, dem Tag vor Rosch Haschana (Neujahrsfest)
abgehalten. Zu diesem Zwecke begaben sich der ganze Emmendinger
Militärverein mit seiner Fahne, sämtlichen Veteranen, eine Abordnung des
Stadt- und Synagogenrates und eine große Anzahl jüdischer Einwohner in
feierlichem Zuge auf den jüdischen Friedhof. Dort hielt der
Kriegsveteran, Herr Hauptlehrer Weil von
Eichstetten, eine feierliche
Ansprache an die Versammelten, in welcher derselbe in gediegenen Worten
die schöne, sinnreiche Bedeutung dieser Gedenkfeier hervorhob. Hierauf
begab sich derselbe auf die Gräber der beiden verstorbenen Krieger und
widmete jedem derselben einen kurzen, ehrenden Nachruf, welchem ein von
Herrn Kantor Goldberg laut und feierlich vorgetragenes, hebräisches Gebet
folgte. Nachdem Herr Hauptlehrer Weil noch ein kurzes Schlusswort an die
Versammelten gerichtet, in welchem dieselben ermahnt wurden, sobald der
Ruf des obersten Kriegsherrn an seine Krieger wieder ergehen sollte, mit
gleicher Treue und mit demselben tapferen Kampfesmute, wie die beiden
Verstorbenen, seiner Fahne zu folgen mit Gott für Fürst und Vaterland,
schieden die Versammelten mit sichtbarer Rührung und Befriedigung über
den äußerst würdigen Verlauf dieser Erinnerungsfeier. Dieser Akt wahrer
Pietät und echter Toleranz auf einem jüdischen Friedhofe ist gewiss ein
erfreulicher Lichtblick in unserer gegenwärtigen, viel bewegten Zeit der
schwersten, konfessionellen Anfeindungen und gereicht seinen
Veranstaltern, ganz besonders aber den zahlreichen, nichtjüdischen
Teilnehmern zu hohen Ehre." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1897: "Aus
Baden,
3. Oktober (1897). Am Sonntag, den 26. September wurde in der Stadt
Emmendingen zu Ehren der dortigen, eingeborenen Krieger vom Jahre 1870/71
ein Kriegerdenkmal unter größeren Festlichkeiten enthüllt. Mit dieser
Enthüllung wurde auch eine besondere Ehrung der noch lebenden Emmendinger
Kriegsveteranen aus jenen denkwürdigen Kämpfen verbunden, indem jedem
derselben, worunter sich auch zwei Israeliten befinden, nämlich Dr. med.
Bloch aus Freiburg i.Br. und Hauptlehrer Weil aus
Eichstetten, vom
Bürgermeister der Stadt Emmendingen eine geschmackvoll geprägte,
silberne Erinnerungsmedaille angesichts Hunderter von Festteilnehmer
öffentlich überreicht wurde. Aber auch der bereits verstorbenen Kämpfer
von 1870/71 sollte nicht vergessen werden, indem auf den Friedhöfen der
verschiedenen Konfessionen zu Ehren der dort ruhenden Krieger eine
würdige Gedächtnisfeier veranstaltet wurde. Auf dem jüdischen
Friedhofe, auf welchem zwei derselben beerdigt sind, wurde diese Feier am
Sonntagvormittag, dem Tag vor Rosch Haschana (Neujahrsfest)
abgehalten. Zu diesem Zwecke begaben sich der ganze Emmendinger
Militärverein mit seiner Fahne, sämtlichen Veteranen, eine Abordnung des
Stadt- und Synagogenrates und eine große Anzahl jüdischer Einwohner in
feierlichem Zuge auf den jüdischen Friedhof. Dort hielt der
Kriegsveteran, Herr Hauptlehrer Weil von
Eichstetten, eine feierliche
Ansprache an die Versammelten, in welcher derselbe in gediegenen Worten
die schöne, sinnreiche Bedeutung dieser Gedenkfeier hervorhob. Hierauf
begab sich derselbe auf die Gräber der beiden verstorbenen Krieger und
widmete jedem derselben einen kurzen, ehrenden Nachruf, welchem ein von
Herrn Kantor Goldberg laut und feierlich vorgetragenes, hebräisches Gebet
folgte. Nachdem Herr Hauptlehrer Weil noch ein kurzes Schlusswort an die
Versammelten gerichtet, in welchem dieselben ermahnt wurden, sobald der
Ruf des obersten Kriegsherrn an seine Krieger wieder ergehen sollte, mit
gleicher Treue und mit demselben tapferen Kampfesmute, wie die beiden
Verstorbenen, seiner Fahne zu folgen mit Gott für Fürst und Vaterland,
schieden die Versammelten mit sichtbarer Rührung und Befriedigung über
den äußerst würdigen Verlauf dieser Erinnerungsfeier. Dieser Akt wahrer
Pietät und echter Toleranz auf einem jüdischen Friedhofe ist gewiss ein
erfreulicher Lichtblick in unserer gegenwärtigen, viel bewegten Zeit der
schwersten, konfessionellen Anfeindungen und gereicht seinen
Veranstaltern, ganz besonders aber den zahlreichen, nichtjüdischen
Teilnehmern zu hohen Ehre." |
Gesangsfest des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes in
Emmendingen (1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1904:
"4. Gesangsfest
des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Bericht von Lazar Schön.
Emmendingen, 26. Mai (1904). Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1904:
"4. Gesangsfest
des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Bericht von Lazar Schön.
Emmendingen, 26. Mai (1904).
Bevor wir auf die nähere Berichterstattung
dieses Gesangsfestes eingehen, wollen wir die Leser mit den Zielen dieser
Feste bekannt machen.
Seit dem Jahre 1897 besteht der Verband oberbadischer Synagogenchöre und
hat sich derselbe die Aufgabe gestellt, die Würde und Weihe des
Gottesdienstes zu mehren und die Andacht durch gefühlvoll vorgetragene
Chöre zu heben. Schon in den Jahren 1897, 1899 und 1901 fanden solche
Verbandsfeste in den Gemeinden Offenburg, Kippenheim und Freiburg statt
und neuerdings am 22. Mai dieses Jahres in Emmendingen als viertes
Gesangsfest des oberbadischen Synagogenchor-Verbandes. Das Programm war
glücklich gewählt und war die Reihenfolge der verschiedenen Arrangements
folgende: vormittags 10 Uhr: Hauptprobe für die Gesamtchöre im Saalbau
zum 'Drei König'. Vormittags 10 Uhr 30 Min: Generalversammlung der
Vorstände der Verbandsvereine und der hierzu eingeladenen Gäste im
Rathause. Nachmittags 1 ¼ Uhr: Aufführung synagogaler Gesänge im
Saalbau zum 'Drei König'. Nachmittags 4 Uhr: Festessen im Bautz'schen
Gartensaal. Nachmittags 7 Uhr: Bankett mit darauf folgender
gesellschaftlicher Unterhaltung im Saalbau zum 'Drei König'.
Gegen 11 Uhr versammelten sich die Gäste im Saalbau zum 'Drei König',
wo laut Programm die Hauptprobe für die Gesamtchöre, ferner die
Generalversammlung der Vorstände der Verbandsvereine stattfand.
Nachmittags um 2 Uhr war der in badischen Landesfarben prachtvoll
geschmückte Saalbau bis auf den letzten Platz besetzt - ungefähr 900 -
1000 Gäste, Damen und Herren - an der Zahl, galt es doch den weihevollen,
Herz und Gemüt ergreifenden synagogalen Gesängen zu lauschen! Ein
Zeichen, wie die Juden in Baden von ihren christlichen Mitbürgern geehrt
und geschätzt werden, beweist schon die Tatsache, dass auch die Herren
Geheimer Regierungsrat Salzer, Oberamtsrichter Schiedelseder,
Oberbauinspektor Bürgerlin und Notar Welcker und noch diverse andere als
Vertreter der christlichen Konfessionen anwesend waren.
Unter der Leitung des Kantors Herrn M. Goldberg begannen die synagogalen
Gesänge mit 'Matowu', das von dem Gesamtchor, bestehend aus den Chören
der Gemeinden Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier,
Offenburg und Emmendingen in wirklich erhebender Weise vorgetragen
wurde.
Die Chöre der genannten Gemeinden sangen auch einzeln und konnte man sich
dabei mit freudiger Genugtuung überzeugen, dass der Gesang von den oberbadischen
Verbandsvereinen in einer Weise gepflegt wird, wie es ihnen nur zur Ehre
gereichen kann. Der große Applaus, der verdiente Beifall, den die Sänger
ernten konnten, bewies ihre meisterhafte Schulen und ihre großen
Leistungen, - und wahrlich, selbst der schärfste Kritiker musste verlegen
sein, da alles aufs herrlichste gelungen ist. Der Beachtung wohl wert ist
dabei die Tatsache, dass der Synagogenchor von Bühl für ein Landesfest
einen zu schwierigen Gesang gewählt hatte, wir meinen, für einen intimen
Künstlerkreis hätte er eine noch weit bessere verständnisvollere
Wirkung abgegeben. Herrn Kantor M. Goldberg aber, in ihm ist alle Ehre und
aller Ruhm verkörpert; feiern wir ihn als einen genialen Künstler, und
die Verkünder seiner Kunst sind damit in ihm und mit ihm in gleicher
Weise geehrt!
Nach Erledigung dieses zu aller Zufriedenheit ausgefallenen Teils des
Programms ging man daran, bei einem solennen Fest wohl nach dem geistigen
Genuss, auch den Körper zu seinem Rechte kommen zu lassen. Zu diesem
Zwecke versammelten sich die Gäste allgemach im Bautz'schen Gartensaal,
wo der Vorsteher der jüdischen Gemeinde, Herr Heinrich Weil, die Gäste
herzlich willkommen hieß. Im Namen der Stadt begrüßte dann Herr
Gemeinderat Philipp Günzburg die Festversammlung, nicht ohne gleichzeitig
die Versicherung abzugeben, dass sie alles aufbieten werde, um den Gästen
angenehme Stunden zu verschaffen und frohe Erinnerungen zu
hinterlassen.
Der Verbandspräsident, Herr Simon Veit, begrüßte dann in schwungvollen
Worten die Gäste namens der Verbandsleitung und sprach den Herren
Vertretern, den Sängern und Sängerinnen, die zum Gelingen des Festes
beigetragen haben, den herzlichsten Dank aus. Ferner gedachte der Redner
in pietätvoller Weise des Komponisten Sulzer, dessen hundertster
Geburtstag in diesem Jahre gefeiert wurde.
Besonders der zweite Teil der wohl durchdachten Rede ist hervorzuheben, in
welchem Herr Veit die soziale Stellung der Juden unter der glorreichen
Regierung Seiner königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden
besprach, dessen Liberalität er ebenso feierte, wie er die Wohltat
hervorhob, die den Juden von diesem tiefedlen Fürsten zuteil wurde.
'Darum - so zitiert der Herr Redner - schlagen unsere Herzen in Liebe und
Dankbarkeit dem edelsten Fürsten entgegen, |
 und
unseren Widersachern zum Trotz wollen wir beweisen, dass auch der der
Religion seiner Väter anhängliche Jude mit allen Fasern seines Herzens
zugleich ein guter Deutscher, ein guter Patriot sein kann.' Das waren
Worte, aus dem Herzen Aller gesprochen, und der große Applaus, der nicht
enden wollende Beifall, mit dem seine Rede und das Hoch auf den
Beschützer aller Konfessionen - Großherzog Friedrich - aufgenommen
wurde, sprach alles aus. Freude und Dankbarkeit las man aus aller Augen
und die frohe Stimmung klang aus in die Hymne: 'Heil unserm Fürsten,
Heil!'. und
unseren Widersachern zum Trotz wollen wir beweisen, dass auch der der
Religion seiner Väter anhängliche Jude mit allen Fasern seines Herzens
zugleich ein guter Deutscher, ein guter Patriot sein kann.' Das waren
Worte, aus dem Herzen Aller gesprochen, und der große Applaus, der nicht
enden wollende Beifall, mit dem seine Rede und das Hoch auf den
Beschützer aller Konfessionen - Großherzog Friedrich - aufgenommen
wurde, sprach alles aus. Freude und Dankbarkeit las man aus aller Augen
und die frohe Stimmung klang aus in die Hymne: 'Heil unserm Fürsten,
Heil!'.
Darauf ergriff Harr Kantor Goldberg das Wort, von dessen öfters mit
stürmischem Beifall aufgenommenen Rede wir Folgendes hervorheben: In
kurzen Zügen entwarf er ein Bild von der segensreichen Tätigkeit des
Großherzoglichen Oberrats für die Israeliten in Baden, hob besonders die
Besteuerungsordnung hervor, die Verteilung der allgemeinen Kirchensteuer,
durch welche die großen und leistungsfähigen Gemeinden an den Lasten der
kleinen tragen helfen, die Gründung der Synode; ferner verbreitete sich
der Redner über die Schaffung der Pensionskasse für Religionslehrer und
Kantoren Badens. Herr Kantor Goldberg erklärte ferner, dass, während in
anderen Ländern Kantoren, die wehmutsvoll ausrufen müssen - es ist mir
die Kehle verdorrt, ich habe meinen einzigen Reichtum, mein einziges
Juwel, mein ganzes Hab und Gut auf den Altar des Judentums niedergelegt,
ich bin machtlos, ich kann nicht weiter: Die Stimme, mein Brot, erstarb
mir im Munde! - keinen Anspruch auf Pensionierung haben und in Folge
dieses Mangels Witwen und Waisen nur zu oft völlig brotlos werden, Baden
eine rühmliche - vorbildliche - Ausnahme mache. Der Oberrat sei eine
Institution, wie sie seit der Diaspora der Israeliten in solcher
Vollkommenheit in keinem Lande zu finden wäre. (Na, Na! Red.). Mit einem
Hoch auf die Anwesenden schloss Herr Goldberg seine meisterhafte Rede.
Minutenlanger Applaus ist die verdiente Anerkennung. darnach ergriffen
noch die Herrn Rabbiner Dr. Levi - Freiburg, Hauptlehrer Wolfsbruck und Rechtsanwalt
Dreifuß das Wort.
In dem auf 8 Uhr Abends angesetzten Bankett waren alle wieder vollzählig
erschienen. Herr Präsident Veit hieß die Erschienen abermals willkommen
und gedachte in seiner Ansprache der verdienstvollen Arbeit der Dirigenten
und namentlich des Verbandsdirigenten, Herrn Goldberg. Der Raum gestattet
uns nicht auf die einzelnen Leistungen der Chöre nochmals näher
einzugehen, ebenso nicht auf die Vorträge des Herrn Bruchsaler und Frau
Dreifuß aus Bühl, nur die Tüchtigkeit des Herrn Wormser in Müllheim
wollen wir noch hervorheben. Bei Beginn seiner Solos lauscht in atemloser
Stille alles seinem Gesange und geht unser Urteil dahin, dass er mit dem
besten Opernsänger konkurrieren könnte. Warmer Beifall belohnte das
Können dieses Tüchtigen. Nicht unerwähnt dürfen wir schließlich die
Rede der Herrn Notars Welker (Christ) lassen, der manche Gedanken zum
Ausdruck brachte, um die uns viele beneiden werden. Ein wahrer Genuss sei
ihm geboten worden, würdig derer, welche die Festlichkeit veranstaltet,
würdig derer, die ihre Kunst in den Dienst der Allgemeinheit gestellt
hätten. Er entrollte im Folgenden ein Bild der glorreichsten Zeit der
Geschichte unseres Volkes. Bis 12 Uhr wurde das Bankett fortgesetzt.
Denjenigen, die außerdem in öffentlicher Form aufgetreten sind, oder sonst wie
ihr Schärflein zum würdigen Verlauf beigetragen haben, wenigstens ein
herzlicher Dank, nachdem es uns nicht möglich ist, alles bis ins detail
zu berichten. Nur unsern Goldberg möchten wir auch noch als Dichter
präsentieren und unsern Bericht mit seinem Refrain schließen: 'Ihr
lieben Gäste von Nah und Weit. Willkommen! Zum Feste rufen wir heut.
Denkt nicht der Sorgen, die's Fest mit sich bracht', Schön ist der Morgen
nach stürmischer Nacht, Und zieht ihr von dannen in des Schwarzwalds
Höh'n. So denket vom Feste: 'Es war doch so schön!'" |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni
1904: "Sulzburg, 8. Juni (1904). Das vierte oberbadische
Synagogenchorfest fand am Pfingstsonntag in Emmendingen statt.
Daran beteiligten sich außer dem festgebenden Vereine die Synagogenchöre
von Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier und Offenbarung,
im ganzen sieben Vereine mit 150 Sängern. Freundlich glänzte die
Maiensonne über dem schmucken Städtchen, als außer diesen Sängern noch
Hunderte von Gesangsfreunden von nah und fern zur Beteiligung
herbeiströmten. Nach vorangegangener Hauptprobe und Generalversammlung,
die in dem vom Gemeinderate bereitwilligst zur Verfügung gestellten
Rathaussaale stattfand, begann gegen 2 Uhr in dem reich verzierten Saalbau
zum Dreikönig in Anwesenheit von über 800 Zuhörern, worunter die
Vorstände des großherzoglichen Bezirksamts und Amtsgerichts, sowie
andere höhere Beamte waren, die Aufführung der synagogalen Gesänge. Von
mächtiger, erhebender Wirkung waren insbesondere die Gesamtchöre, welche
von Kantor Goldberg aus Emmendingen trefflich geleitet wurden. Unter den
Einzelchören leisteten naturgemäß die der Stadtgemeinden das beste.
Dabei rangen Freiburg, Bühl, Emmendingen und Offenburg um die Palme.
Freiburg verdient umso höhere Anerkennung, da die unmittelbar vorher
eingetretenen jugendlichen Sänger sich prächtig bewährten. Bühl ragte
durch die schönen und gut geschulten Damenstimmen hervor. Auch die Chöre
der Landgemeinden hatten weder Mühe noch Opfer gescheut, um ihrerseits
zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Unter ihnen verdient Kippenheim
ehrende Anerkennung. Bei den Solisten glänzten namentlich die Kantoren
Sommer - Freiburg, sodann Bruchsaler- Bühl und Goldberg - Emmendingen.
Als Solistin bewährte sich wieder Frau Dreyfuß-Hauser aus Bühl. In
andächtiger Stille lauschten die Gäste dem zweistündigen Konzerte, das
einen ebenso schönen als würdigen Verlauf nahm. An das Konzert schloss
sich ein überaus zahlreich besuchtes Festessen. Dabei hielten Vorsteher
Weil, Gemeinderat Günzburger, Vereinspräsident Veit, Kantor Goldberg,
Rechtsanwalt Dreifuß und Hauptlehrer Wolfsbruck - sämtlich aus
Emmendingen . beifällig aufgenommene Begrüßungsreden. Hauptredner war
Konferenzrabbiner Dr. Levin aus Freiburg, der als Delegierter des
Großherzoglichen Oberrats dem Feste anwohnte. Auch bei dem nachfolgenden
Bankett fehlte es nicht an Reden, worunter die des Großherzoglichen
Notars Welcker aus Emmendingen hervorzuheben ist. Durch launige
Knittelverse erfreute Kantor Goldberg die Gäste. Innig und
verständnisvoll trugen Frau Dreyfuß-Hauser und Kantor Bruchsaler - Bühl
ein Duett aus 'Jakob und seine Söhne' vor. Auch Kantor Wormser -
Müllheim bewährte sich als trefflicher Sänger. 'Es war doch schön!' So
lautete der Kehrreim des flott gesungenen Liedes, mit welchem Emmendingens
Synagogenchor das Bankett einleitete. Und in der Tat war das Fest so
schön, dass alle Teilnehmer in dankbarer, freudiger Erinnerung auf
dasselbe zurückblicken können. Bei aller Anerkennung bleibe indessen
folgendes nicht unerwähnt; die Auswahl der Chöre ist nach der
Verwendbarkeit im Gottesdienst zu treffen, und bei einigen Vereinen ist
auf die Reinheit des Tones und der Aussprache, sowie auf die Anforderung
der hebräischen Sprachlehre sorgfältiger zu achten. Dies sind kleine
Flecken an dem Gesangsgemälde, dessen Glanz und Schönheit darum nicht
minder leuchtend bleiben." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni
1904: "Sulzburg, 8. Juni (1904). Das vierte oberbadische
Synagogenchorfest fand am Pfingstsonntag in Emmendingen statt.
Daran beteiligten sich außer dem festgebenden Vereine die Synagogenchöre
von Bühl, Eichstetten, Freiburg, Kippenheim, Nonnenweier und Offenbarung,
im ganzen sieben Vereine mit 150 Sängern. Freundlich glänzte die
Maiensonne über dem schmucken Städtchen, als außer diesen Sängern noch
Hunderte von Gesangsfreunden von nah und fern zur Beteiligung
herbeiströmten. Nach vorangegangener Hauptprobe und Generalversammlung,
die in dem vom Gemeinderate bereitwilligst zur Verfügung gestellten
Rathaussaale stattfand, begann gegen 2 Uhr in dem reich verzierten Saalbau
zum Dreikönig in Anwesenheit von über 800 Zuhörern, worunter die
Vorstände des großherzoglichen Bezirksamts und Amtsgerichts, sowie
andere höhere Beamte waren, die Aufführung der synagogalen Gesänge. Von
mächtiger, erhebender Wirkung waren insbesondere die Gesamtchöre, welche
von Kantor Goldberg aus Emmendingen trefflich geleitet wurden. Unter den
Einzelchören leisteten naturgemäß die der Stadtgemeinden das beste.
Dabei rangen Freiburg, Bühl, Emmendingen und Offenburg um die Palme.
Freiburg verdient umso höhere Anerkennung, da die unmittelbar vorher
eingetretenen jugendlichen Sänger sich prächtig bewährten. Bühl ragte
durch die schönen und gut geschulten Damenstimmen hervor. Auch die Chöre
der Landgemeinden hatten weder Mühe noch Opfer gescheut, um ihrerseits
zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Unter ihnen verdient Kippenheim
ehrende Anerkennung. Bei den Solisten glänzten namentlich die Kantoren
Sommer - Freiburg, sodann Bruchsaler- Bühl und Goldberg - Emmendingen.
Als Solistin bewährte sich wieder Frau Dreyfuß-Hauser aus Bühl. In
andächtiger Stille lauschten die Gäste dem zweistündigen Konzerte, das
einen ebenso schönen als würdigen Verlauf nahm. An das Konzert schloss
sich ein überaus zahlreich besuchtes Festessen. Dabei hielten Vorsteher
Weil, Gemeinderat Günzburger, Vereinspräsident Veit, Kantor Goldberg,
Rechtsanwalt Dreifuß und Hauptlehrer Wolfsbruck - sämtlich aus
Emmendingen . beifällig aufgenommene Begrüßungsreden. Hauptredner war
Konferenzrabbiner Dr. Levin aus Freiburg, der als Delegierter des
Großherzoglichen Oberrats dem Feste anwohnte. Auch bei dem nachfolgenden
Bankett fehlte es nicht an Reden, worunter die des Großherzoglichen
Notars Welcker aus Emmendingen hervorzuheben ist. Durch launige
Knittelverse erfreute Kantor Goldberg die Gäste. Innig und
verständnisvoll trugen Frau Dreyfuß-Hauser und Kantor Bruchsaler - Bühl
ein Duett aus 'Jakob und seine Söhne' vor. Auch Kantor Wormser -
Müllheim bewährte sich als trefflicher Sänger. 'Es war doch schön!' So
lautete der Kehrreim des flott gesungenen Liedes, mit welchem Emmendingens
Synagogenchor das Bankett einleitete. Und in der Tat war das Fest so
schön, dass alle Teilnehmer in dankbarer, freudiger Erinnerung auf
dasselbe zurückblicken können. Bei aller Anerkennung bleibe indessen
folgendes nicht unerwähnt; die Auswahl der Chöre ist nach der
Verwendbarkeit im Gottesdienst zu treffen, und bei einigen Vereinen ist
auf die Reinheit des Tones und der Aussprache, sowie auf die Anforderung
der hebräischen Sprachlehre sorgfältiger zu achten. Dies sind kleine
Flecken an dem Gesangsgemälde, dessen Glanz und Schönheit darum nicht
minder leuchtend bleiben." |
Ein zionistischer Abend in Emmendingen (1925)
 Artikel
in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Januar 1925: "Emmendingen. Im
Auftrage der Zionischen Ortsgruppe Freiburg sprach am 11. Dezember im
neutralen Jüdischen Jugendbund Emmendingen in einer großen öffentlichen
Versammlung Herr Jakob Dränger aus Frankfurt am Main über: 'Die
Judenfrage am Scheidewege'. Ausgehend von der geschichtlichen
Entwicklung wies Herr Dränger auf die verschiedenen Epochen im Judentum
hin und beschäftigte sich insbesondere mit der neuesten Epoche des
jüdischen Volkes, die er als die nationale bezeichnete. Die Judenheit
steht heute am Scheideweg. Der eine Wegweiser zeigt nach Palästina und
bedeutet nationale Renaissance, und der andere weist nach Europa und
bedeutet nationalen Untergang. Es hängt nur von uns ab, ob wir die
Bedeutung der großen geschichtlichen Tage, welche wir augenblicklich
erleben, rechtzeitig erfassen. Der Referent betonte insbesondere, dass die
in den letzten Jahren erfolgte Belebung der Judenheit nur durch die
revolutionäre Kraft des Zionismus gelungen sei, der den Kernpunkt der
Judenfrage erfasste, während andere jüdische Ideologien keinen Mut zur
Wahrheit haben. Die lebendig-frischen Ausführungen des Herrn Dränger
wurden bis zum letzten Augenblick mit größter Aufmerksamkeit angehört
und hinterließen einen starken Eindruck. Nach dem Vortrag fand eine rege
Diskussion statt, woran sich die Herrn Kantor Marx und Weil einerseits –
und auf der anderen Seite die Herren Kahn und Voß beteiligten. Im
Schlusswort fasste Herr Dränger seinen Standpunkt in sehr treffenden
Worten zusammen und erinnerte nochmals an die Wichtigkeit der
Produktivierung der jüdischen Jugend, was bisher noch keiner Bewegung in
diesem Maße gelungen sei wie der zionistischen, da nur sie der Jugend ein
Ideal, Erez-Israel, gegeben hat. Der Abend kann als voller Erfolg und als
guter Anfang für die zionistische Arbeit in Emmendingen gebucht
werden." Artikel
in der "Jüdischen Rundschau" vom 2. Januar 1925: "Emmendingen. Im
Auftrage der Zionischen Ortsgruppe Freiburg sprach am 11. Dezember im
neutralen Jüdischen Jugendbund Emmendingen in einer großen öffentlichen
Versammlung Herr Jakob Dränger aus Frankfurt am Main über: 'Die
Judenfrage am Scheidewege'. Ausgehend von der geschichtlichen
Entwicklung wies Herr Dränger auf die verschiedenen Epochen im Judentum
hin und beschäftigte sich insbesondere mit der neuesten Epoche des
jüdischen Volkes, die er als die nationale bezeichnete. Die Judenheit
steht heute am Scheideweg. Der eine Wegweiser zeigt nach Palästina und
bedeutet nationale Renaissance, und der andere weist nach Europa und
bedeutet nationalen Untergang. Es hängt nur von uns ab, ob wir die
Bedeutung der großen geschichtlichen Tage, welche wir augenblicklich
erleben, rechtzeitig erfassen. Der Referent betonte insbesondere, dass die
in den letzten Jahren erfolgte Belebung der Judenheit nur durch die
revolutionäre Kraft des Zionismus gelungen sei, der den Kernpunkt der
Judenfrage erfasste, während andere jüdische Ideologien keinen Mut zur
Wahrheit haben. Die lebendig-frischen Ausführungen des Herrn Dränger
wurden bis zum letzten Augenblick mit größter Aufmerksamkeit angehört
und hinterließen einen starken Eindruck. Nach dem Vortrag fand eine rege
Diskussion statt, woran sich die Herrn Kantor Marx und Weil einerseits –
und auf der anderen Seite die Herren Kahn und Voß beteiligten. Im
Schlusswort fasste Herr Dränger seinen Standpunkt in sehr treffenden
Worten zusammen und erinnerte nochmals an die Wichtigkeit der
Produktivierung der jüdischen Jugend, was bisher noch keiner Bewegung in
diesem Maße gelungen sei wie der zionistischen, da nur sie der Jugend ein
Ideal, Erez-Israel, gegeben hat. Der Abend kann als voller Erfolg und als
guter Anfang für die zionistische Arbeit in Emmendingen gebucht
werden." |
Über
Personen und besondere Persönlichkeiten aus der jüdischen Gemeinde
Gantprozess über das Vermögen des Gemeindevorstehers
Lazar Bloch (1819)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1819 S. 566 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Untergerichtliche
Aufforderungen und Kundmachungen. Schuldenliquidationen.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1819 S. 566 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Untergerichtliche
Aufforderungen und Kundmachungen. Schuldenliquidationen.
Emmendingen. [Ganterkenntnis]. Gegen den bisherigen
Judenvorsteher Lazar Bloch dahier ist der Gantprozess erkannt, und
zur Liquidation seiner Schulden, sowie zum Versuche eines Nachlas- und
Stundungs-Vertrags, ist Tagfahrt auf Dienstag, den 15. künftigen Monats
Juni anberaumt worden. Es werden daher alle, welche aus irgendeinem
Rechtsgrunde an gedachten Lazar Bloch oder dessen Söhne, Elias und Josua Bloch,
die mit demselben in Handelsgemeinschaft standen, eine Forderung zu machen
haben, aufgefordert, ihre Ansprüche an besagtem Tage, des Morgens um 8
Uhr, vor Großherzoglichem Amtsrevisorate, unter Vorlegung der
Beweisurkunden, anzugeben und richtig zu stellen, über Vorzugsrechte zu
verhandeln, und sich über den gemacht werdenden Vorschlag zu
Abschließung eines Nachlas- und Stundungsvertrags zu erklären; unter dem
Rechtsnachteile, im Ausbleibungsfall von der Gantmasse ausgeschlossen zu
werden.
Zugleich werden diejenigen, welche in die Masse etwas schuldig sind,
benachrichtigt, dass sie, bei Vermeidung doppelter Zahlung, ihre
Schuldigkeit an Niemanden anders, als an den bestellten Güterpfleger,
Uhrenmacher Berblinger, bezahlen dürfen.
Emmendingen, den 15. Mai 1819. Großherzoglich Badisches
Bezirksamt." |
| |
|

|
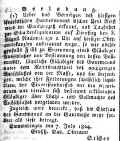
|
Gantprozess
über das Vermögen von Moses Weil (1821) - Anzeige
im "Großherzoglichen Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis"
vom 31. März 1821 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken
|
Gantprozess
über das Vermögen von Handelsmann Ascher Levi
Reiß (1824) - Anzeige im "Großherzoglich
Badischen
Anzeige-Blatt für den See-Kreis" vom 17. Juli 1824
(Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen)
Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken |
Der Kriegsdienstpflichtige Moses Bloch hat sich nicht
gemeldet und wird schwer bestraft (1840)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1841 S. 31 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Emmendingen [Straferkenntnis]. Nachdem sich Moses Bloch von
Emmendingen, Gefreiter bei großherzoglichem Leib-Infanterieregiment auf
öffentliche Aufforderung vom 29. September dieses Jahres nicht gestellt
hat, so wird derselbe der Desertion für schuldig erkannt, in die
gesetzliche Geldstrafe von 1.200 fl. verurteilt, des Ortsbürgerrechts
für verlustig erklärt und auf Betreten weitere persönliche Bestrafung
gegen ihn vorbehalten. Emmendingen, den 22. Dezember 1840.
Großherzogliches Oberamt. Rettig." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1841 S. 31 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Emmendingen [Straferkenntnis]. Nachdem sich Moses Bloch von
Emmendingen, Gefreiter bei großherzoglichem Leib-Infanterieregiment auf
öffentliche Aufforderung vom 29. September dieses Jahres nicht gestellt
hat, so wird derselbe der Desertion für schuldig erkannt, in die
gesetzliche Geldstrafe von 1.200 fl. verurteilt, des Ortsbürgerrechts
für verlustig erklärt und auf Betreten weitere persönliche Bestrafung
gegen ihn vorbehalten. Emmendingen, den 22. Dezember 1840.
Großherzogliches Oberamt. Rettig." |
Einberufung von Kriegsdienstpflichtigen (1841)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1841 S. 259 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Emmendingen
[Konskriptionspflichtige]. Nachstehende, zur Ergänzungskonskription pro
1841 gehörige, bei der Aushebungstagfahrt nicht erschienene Konskribierte
werden hiermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen von heute an dahier zu
stellen, widrigens sie als Refractärs behandelt werden, und die
gesetzliche Strafe gegen sie erkannt wird. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1841 S. 259 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen): "Emmendingen
[Konskriptionspflichtige]. Nachstehende, zur Ergänzungskonskription pro
1841 gehörige, bei der Aushebungstagfahrt nicht erschienene Konskribierte
werden hiermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen von heute an dahier zu
stellen, widrigens sie als Refractärs behandelt werden, und die
gesetzliche Strafe gegen sie erkannt wird.
Aus der Altersklasse von 1837.
.... Loos Nr. 175 Abraham Weil von Eichstetten....
Altersklasse von 1838
Loos Nr. 98 Elias Bloch von da (Emmendingen).
Aus der Altersklasse 1839
Loos Nr. 130 Jakob Hirsch von Niederemmendingen... " |
Die Untersuchung gegen Marx Bloch von Emmendingen wegen
Diebstahl an Salomon Bloch von Kirchen
endet "klagfrei" (1847)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch
von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu
Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.
baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für
klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu
verschonen.' V.R.W.
Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 8. Januar 1848 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Lörrach [Urteil] In Untersuchungssachen gegen Marx Bloch
von Emmendingen, wegen Diebstahls, wird auf amtspflichtiges Verhör zu
Recht erkannt: 'Marx Bloch sei der angeschuldigten Entwendung von 27 fl.
baren Geldes zum Nachteil des Salomon Bloch von Kirchen für
klagfrei zu erklären und mit den Untersuchungskosten zu
verschonen.' V.R.W.
Dessen zur Urkunde ist gegenwärtiges Urteil nach der Verordnung des
großherzoglichen badischen Hofgerichts des Oberrheinkreises ausgefertigt
und mit dem größeren Gerichtsinsiegel versehen worden.
So geschehen Freiburg, den 22. Oktober 1847 Woll. (L.S.) Buisson.
Kohlhagen." |
Das
hebräische Lesebüchlein von Lehrer M. H. Dreifuß (Endingen) wird in der
Buchdruckerei von M. Auerbach in Emmendingen verlegt (1859)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Oktober 1859: "Aus Süddeutschland, im September.
In der Buchdruckerei des Herrn M. Auerbach zu Emmendingen erscheint
die zweite Auflage des Chanuch Nearim, erstes hebräisches
Lesebüchlein von M. G. Dreifus, Lehrer zu Endingen
im Aargau (Schweiz). Es enthält dasselbe: 1) Übungen im mechanischen
Lesen des Hebräischen. 2) Lesestücke in jüdisch-deutscher Schrift
(Druck). 3) Sprachübungen über das Gegenstands-, Für-, Zahl- und
Zeitwort. - Das ganze Büchlein ist das Resultat vieljähriger Erfahrungen
und sind die Übungen aus den Bedürfnissen der Schule hervorgegangen. Was
nun den ersteren Teil betrifft, so ist es die Absicht des Verfassers, auch
in diesem Fache Gründlichkeit zu erzielen. Er will über das mechanische
Lesen nicht baldmöglichst hinwegeilen, sondern durch vielseitige Übungen
von dem Leichteren zum Schwereren, dem Einfachen zum Zusammengesetzten,
durch Wiederholung des schon Vorgenommenen in neuer Form und Darstellung
soll ein lückenloser Kurs im mechanischen Lesen gegeben werden, der den
Schüler zum fertigen Lesen befähigt.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Oktober 1859: "Aus Süddeutschland, im September.
In der Buchdruckerei des Herrn M. Auerbach zu Emmendingen erscheint
die zweite Auflage des Chanuch Nearim, erstes hebräisches
Lesebüchlein von M. G. Dreifus, Lehrer zu Endingen
im Aargau (Schweiz). Es enthält dasselbe: 1) Übungen im mechanischen
Lesen des Hebräischen. 2) Lesestücke in jüdisch-deutscher Schrift
(Druck). 3) Sprachübungen über das Gegenstands-, Für-, Zahl- und
Zeitwort. - Das ganze Büchlein ist das Resultat vieljähriger Erfahrungen
und sind die Übungen aus den Bedürfnissen der Schule hervorgegangen. Was
nun den ersteren Teil betrifft, so ist es die Absicht des Verfassers, auch
in diesem Fache Gründlichkeit zu erzielen. Er will über das mechanische
Lesen nicht baldmöglichst hinwegeilen, sondern durch vielseitige Übungen
von dem Leichteren zum Schwereren, dem Einfachen zum Zusammengesetzten,
durch Wiederholung des schon Vorgenommenen in neuer Form und Darstellung
soll ein lückenloser Kurs im mechanischen Lesen gegeben werden, der den
Schüler zum fertigen Lesen befähigt.
Die jüdisch-deutschen Lesestücke sind ganz der Fassungskraft der Kinder
von 7-9 Jahren angemessen und bestehen teils aus schon bekannten, teils
aus von dem Verfasser erdichteten Stücken.
Die Sprachübungen enthalten zunächst Wörter zum Memorieren,
Gegenstands-, Eigenschafts- und Zeitwort in planmäßiger Ordnung aller
Begriffe aus dem Anschauungskreise des Kindes. Die folgenden
Sprachübungen haben sodann den Zweck, den Grundstein zur hebräischen
Formenlehre zu legen und den Schüler zu befähigen, mit einiger Kenntnis
der Sprachformen an die Übersetzung des Pentateuchs gehen zu können,
damit er nicht, wie es noch häufig geschieht, mit bewusstlos mechanischer
Routine die Übersetzung des Hebräischen betreibe - was so mancher
jüdische Schulmann mit dem Ausdruck faktotischer Methode zu beschönigen
sucht. Ohne synthetisch analytische Übungen kein wahres und klares
Verständnis der Sprache! Die Übungsstücke sind so eingerichtet, dass
jedes Stück eine neue Form einübt und dabei Vorhergehendes wiederholt.
Das Büchlein wird von denjenigen Lehrern, welche es benutzen, als
praktisch zweckmäßig betrachtet. Es empfiehlt sich noch besonders durch
seinen billigen Preis steif broschiert zu 12 Kr." |
Der Bezirksälteste Breisacher wurde zum Mitglied des
Oberrates (der Israeliten Badens) ernannt (1859)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. Oktober 1859: "Die Ernennung des Herrn
Bezirksältesten Breisacher in Emmendingen, einem Manne von
ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung und klarer Anschauung, zum
Oberratsmitglied verspricht eine wohltätige Bewegung in die Oberländer
Judenheit sowohl als auch in sein Kollegium zu bringen, welche sich durch
eine im Laufe dieses Monats noch abzuhaltende Versammlung der jüdischen Notabeln
des badischen Oberlandes bereits bemerkbar machte; sind wir einmal aus der
bisherigen Stagnation herausgetreten, so ist von unserer erleuchteten
Regierung gewiss Abhilfe zu erwarten". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 17. Oktober 1859: "Die Ernennung des Herrn
Bezirksältesten Breisacher in Emmendingen, einem Manne von
ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung und klarer Anschauung, zum
Oberratsmitglied verspricht eine wohltätige Bewegung in die Oberländer
Judenheit sowohl als auch in sein Kollegium zu bringen, welche sich durch
eine im Laufe dieses Monats noch abzuhaltende Versammlung der jüdischen Notabeln
des badischen Oberlandes bereits bemerkbar machte; sind wir einmal aus der
bisherigen Stagnation herausgetreten, so ist von unserer erleuchteten
Regierung gewiss Abhilfe zu erwarten". |
Zum Tod des Bezirksältesten
L. Breisacher (1868)
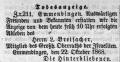 Artikel in der "Karlsruher
Zeitung"
vom 24. Oktober 1868: "Todesanzeige. Artikel in der "Karlsruher
Zeitung"
vom 24. Oktober 1868: "Todesanzeige.
Emmendingen. Auswärtigen Freunden und Bekannten erstatten wir die
Anzeige von dem heute früh 10 Uhr erfolgten Ableben des Herrn K.
Breisacher, Mitglied des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten.
Emmendingen, den 22. Oktober 1868. Die Hinterbliebenen". |
Zum Tod und der Beisetzung des aus Emmendingen stammenden
Jacob A. Auerbach (1887)
Jacob A. Auerbach (1810 Emmendingen - 1887
Frankfurt am Main), Theologe und Pädagoge; seit 1865 Direktor des
Julius-Flersheim'schen Instituts in Frankfurt; verfasste zahlreiche Schriften
pädagogischer, historischer und theologischer Art.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. November 1887: "Die
'Frankfurter Zeitung' berichtet: Heute Vormittag kurz nach 11 Uhr
verschied ohne vorausgegangene Krankheit plötzlich in Folge eines
Schlaganfalles Herr Dr. Jacob Auerbach. Er war am 14. November 1819
geboren, erreichte also fast das 78. Jahr. Sein Geburtsort war Emmendingen
im Großherzogtum Baden. Nachdem er das Pädagogium in Karlsruhe besucht
hatte, bezog er die Universität Heidelberg, musste aber sein Studium aus
Mangel an Mitteln unterbrechen. Von seinem Vetter, dem Dichter Berthold
Auerbach, wurde er bald wieder zur Vollendung seiner Studien nach
Heidelberg gerufen; die Freundschaftsbanden, die sich damals zwischen den
jungen Leuten knüpften und durch Verschwägerung noch verstärkt wurden,
dauerten fürs ganze Leben. 1835 wurde er als jüdischer Religionslehrer
nach Wiesbaden berufen; dort lernte er den Rabbiner Dr. Abraham Geiger
kennen, schätzen und lieben. Verwandtschaftliche Bande vereinigten
später die beiden Männer. 1836 wurde Auerbach Hauslehrer in der
Niedermann'schen Familie in Wien, 1843 berief ihn die hiesige
israelitische Gemeinde an das Philanthropin als Religionslehrer und
Prediger im Andachtssaal (gemeinsam mit Dr. J.M. Jost). 1848 wurde ihm der
hebräische Unterricht am Gymnasium übertragen. 1879 wurde er pensioniert
und bei dieser Gelegenheit auch von der Staatsregierung durch Verleihung
des Rothen Adler-Ordens ausgezeichnet. Literarisch war Auerbach durch
Aufsätze im Schulprogramm und in verschiedenen jüdischen
wissenschaftlichen Zeitschriften tätig. Er gab die Schul- und Hausbibel,
biblische Erzählungen etc. für jüdische Kreise heraus; auch beteiligt
er sich eifrig an verschiedenen Rabbiner-Versammlungen (an der
Rabbiner-Versammlung zu Frankfurt und an der Synagoge zu Augsburg, Red.).
Eine seiner letzten Veröffentlichungen waren die Briefe Berthold Auerbach's
an ihn, die er sichtete und in zwei Bänden publizierte. Sein scharfer
Verstand, sein klarer Geist, seine liebenswürdige Milde ließen ihn auch
im maurerischen Kreise die höchsten Würden und ungeteilte Anerkennung
erringen. Auerbach war von allen, die ihn kannten, geehrt und geliebt. –
Die Beerdigung findet Donnerstag 9 Uhr Morgens statt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. November 1887: "Die
'Frankfurter Zeitung' berichtet: Heute Vormittag kurz nach 11 Uhr
verschied ohne vorausgegangene Krankheit plötzlich in Folge eines
Schlaganfalles Herr Dr. Jacob Auerbach. Er war am 14. November 1819
geboren, erreichte also fast das 78. Jahr. Sein Geburtsort war Emmendingen
im Großherzogtum Baden. Nachdem er das Pädagogium in Karlsruhe besucht
hatte, bezog er die Universität Heidelberg, musste aber sein Studium aus
Mangel an Mitteln unterbrechen. Von seinem Vetter, dem Dichter Berthold
Auerbach, wurde er bald wieder zur Vollendung seiner Studien nach
Heidelberg gerufen; die Freundschaftsbanden, die sich damals zwischen den
jungen Leuten knüpften und durch Verschwägerung noch verstärkt wurden,
dauerten fürs ganze Leben. 1835 wurde er als jüdischer Religionslehrer
nach Wiesbaden berufen; dort lernte er den Rabbiner Dr. Abraham Geiger
kennen, schätzen und lieben. Verwandtschaftliche Bande vereinigten
später die beiden Männer. 1836 wurde Auerbach Hauslehrer in der
Niedermann'schen Familie in Wien, 1843 berief ihn die hiesige
israelitische Gemeinde an das Philanthropin als Religionslehrer und
Prediger im Andachtssaal (gemeinsam mit Dr. J.M. Jost). 1848 wurde ihm der
hebräische Unterricht am Gymnasium übertragen. 1879 wurde er pensioniert
und bei dieser Gelegenheit auch von der Staatsregierung durch Verleihung
des Rothen Adler-Ordens ausgezeichnet. Literarisch war Auerbach durch
Aufsätze im Schulprogramm und in verschiedenen jüdischen
wissenschaftlichen Zeitschriften tätig. Er gab die Schul- und Hausbibel,
biblische Erzählungen etc. für jüdische Kreise heraus; auch beteiligt
er sich eifrig an verschiedenen Rabbiner-Versammlungen (an der
Rabbiner-Versammlung zu Frankfurt und an der Synagoge zu Augsburg, Red.).
Eine seiner letzten Veröffentlichungen waren die Briefe Berthold Auerbach's
an ihn, die er sichtete und in zwei Bänden publizierte. Sein scharfer
Verstand, sein klarer Geist, seine liebenswürdige Milde ließen ihn auch
im maurerischen Kreise die höchsten Würden und ungeteilte Anerkennung
erringen. Auerbach war von allen, die ihn kannten, geehrt und geliebt. –
Die Beerdigung findet Donnerstag 9 Uhr Morgens statt." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. November 1887: "Frankfurt
am Main, 8. November (1887). Der unerwartete Tod Dr. Jacob Auerbachs hat
unter der großen Schar seiner ehemaligen Schüler die tiefste Trauer
hervorgerufen. Jacob Auerbach war das Ideal eines Religionslehrers. Mit
welch goldenen Worten hat er selbst den Beruf eines solchen Lehrers
geschildert. Ihm ist, sagt er, eine ebenso schöne als schwierige Aufgabe
gesetzt. Er soll dem Kinde die unvergleichlich herrliche, vom höchsten
Glanze des Idealen umflossene und doch wieder sich durchaus auf realem
Boden erhebende Wunderwelt der Bibel eröffnen, damit er sich ganz in sie
einleben und von ihr erfüllt werde. Dem Jüngling aber will er neben dem
poetischen Gehalt der heiligen Bücher besonders den reichen Schatz ihrer
ethischen Lehren, ihre tiefen und ewigen Wahrheiten vor Augen führen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. November 1887: "Frankfurt
am Main, 8. November (1887). Der unerwartete Tod Dr. Jacob Auerbachs hat
unter der großen Schar seiner ehemaligen Schüler die tiefste Trauer
hervorgerufen. Jacob Auerbach war das Ideal eines Religionslehrers. Mit
welch goldenen Worten hat er selbst den Beruf eines solchen Lehrers
geschildert. Ihm ist, sagt er, eine ebenso schöne als schwierige Aufgabe
gesetzt. Er soll dem Kinde die unvergleichlich herrliche, vom höchsten
Glanze des Idealen umflossene und doch wieder sich durchaus auf realem
Boden erhebende Wunderwelt der Bibel eröffnen, damit er sich ganz in sie
einleben und von ihr erfüllt werde. Dem Jüngling aber will er neben dem
poetischen Gehalt der heiligen Bücher besonders den reichen Schatz ihrer
ethischen Lehren, ihre tiefen und ewigen Wahrheiten vor Augen führen.
Von solchen Ideen geleitet, wirkte der hohe Mann. Keine Fülle des
positiven Materials gab er seinen Schülern, sondern getreu dem
Grundsatze, dass die Religions- wie alle Bildung in die Tiefe gehen soll,
'mehr einzelne, in sich abgeschlossene, aber lebenswahre Bilder', wie
sie die Hand des Künstlers liefert und 'die in ihrer individuellen
Gestaltung gleichsam das Ganze, dessen Teile sie sind, vorahnend aufnehmen
lassen.'
Er wählt einige Stellen der heiligen Schrift aus, am liebsten aus den
Psalmen, aus den nachbiblischen Sprüchen. Er erklärt ihren Inhalt, er
vergleicht sie mit anderen.
So wird dem Schüler der Sinn klar, oder er erhält wenigstens eine Ahnung
von der unendlichen Tiefe der geistigen und sittlichen Welt, die sich hier
offenbart.
Wir erinnern uns, wie er immer wieder und nie genug über den Satz redete:
Die Frommen aller Religionen gelangen zur ewigen Seligkeit. Die
Gleichberechtigung der Menschen also und deren Wert nach ihrem freien
sittlichen Streben hebt er mit Nachdruck hervor. Diese Grundlagen aller
echten menschlichen Frömmigkeit, diese ewigen Wahrheiten, zu welchen, wie
Abraham Geiger so schön sagt, die ganze Menschheit sich hinanringen soll,
das waren die Grundlagen seines Unterrichts in der Religion. Er übte sein
Lehramt nur im Allerheiligsten aus, ein Lehramt nicht des Buchstabens,
sondern des Geistes.
In den Herzen seiner Schüler aber hat sich der Verewigte durch diese
ideale Art des Unterrichtens, durch seine Herzensgüte und Milde und
gewiss auch durch den Zauber seiner ehrwürdigen Erscheinung ein festes
und unzerstörbares Denkmal gebaut. Auch er durfte so mit Horaz sagen:
Exegi momumentum aere perennius (= 'Ich habe ein Denkmal erschaffen,
dauerhafter als Erz'). Dr.jur.L.W." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. November 1887: "Bonn,
13. November. Man schreibt aus Frankfurt am Main vom 3. November: Das
Leichenbegängnis des Herrn Dr. Jakob Auerbach fand heute früh unter
außerordentlich zahlreicher Beteiligung statt. Vor dem Leichenwagen
schritten die obersten Klassen der Realschule der israelitischen Gemeinde;
den Freunden, Kollegen, früheren Schülern und Logenmitgliedern schloss
sich eine große Zahl von Equipagen an. Am Sarge sprach zuerst Herr
Rabbiner Dr. Brüll, um des Verstorbenen Verdienste um die Wissenschaft
des Judentums und den geistigen Fortschritt seiner Glaubensgenossen, seine
trefflichen Charaktereigenschaften und sein schönes Familienleben zu
beleuchten. Herr Direktor Dr. Baerwald legte namens der Realschule der
israelitischen Gemeinde einen Kranz mit rot-weißer Schleife nieder, idem
er Auerbachs Tätigkeit als Lehrer vorzugsweise schildert. Herr
Gymnasialdirektor Reinhardt spendete einen Kranz namens des
Lehrerkollegiums des Gymnasiums: er zollte dem wissenschaftlichen Streben
und dem liebevollen, lauteren Wesen des Verschiedenen hohe Anerkennung.
Namens der Julius- und Amalie Flersheim'schen Stiftung widmete Herr Dr.
Krakauer eine Palme, Dr. Rießer einen Kranz namens der Rießer-Stiftung;
dann folgten die Logen zum 'Frankfurter Adler' (Herr Ernst Rosenberg),
Karl zum Lindenberg (Herr Lincker), Sokrates zur Standhaftigkeit (Herr Dr.
Laquer) und die Großloge des eklektischen Bundes, der 14 hiesige und
auswärtige Logen umfasste (Herr Benjamin Reges): Am Grabe angelangt wurde
die Leiche von den Tönen eines Hornquartetts empfangen. Seitens der Loge
zur aufgehenden Morgenröte spendete Herr Rabbiner Dr. Plaut dem
verstorbenen, verdienstvollen Altmeister die üblichen Rosen. Abermals
ertönten die Klänge der Hörner und das Grab Auerbachs wurde
geschlossen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. November 1887: "Bonn,
13. November. Man schreibt aus Frankfurt am Main vom 3. November: Das
Leichenbegängnis des Herrn Dr. Jakob Auerbach fand heute früh unter
außerordentlich zahlreicher Beteiligung statt. Vor dem Leichenwagen
schritten die obersten Klassen der Realschule der israelitischen Gemeinde;
den Freunden, Kollegen, früheren Schülern und Logenmitgliedern schloss
sich eine große Zahl von Equipagen an. Am Sarge sprach zuerst Herr
Rabbiner Dr. Brüll, um des Verstorbenen Verdienste um die Wissenschaft
des Judentums und den geistigen Fortschritt seiner Glaubensgenossen, seine
trefflichen Charaktereigenschaften und sein schönes Familienleben zu
beleuchten. Herr Direktor Dr. Baerwald legte namens der Realschule der
israelitischen Gemeinde einen Kranz mit rot-weißer Schleife nieder, idem
er Auerbachs Tätigkeit als Lehrer vorzugsweise schildert. Herr
Gymnasialdirektor Reinhardt spendete einen Kranz namens des
Lehrerkollegiums des Gymnasiums: er zollte dem wissenschaftlichen Streben
und dem liebevollen, lauteren Wesen des Verschiedenen hohe Anerkennung.
Namens der Julius- und Amalie Flersheim'schen Stiftung widmete Herr Dr.
Krakauer eine Palme, Dr. Rießer einen Kranz namens der Rießer-Stiftung;
dann folgten die Logen zum 'Frankfurter Adler' (Herr Ernst Rosenberg),
Karl zum Lindenberg (Herr Lincker), Sokrates zur Standhaftigkeit (Herr Dr.
Laquer) und die Großloge des eklektischen Bundes, der 14 hiesige und
auswärtige Logen umfasste (Herr Benjamin Reges): Am Grabe angelangt wurde
die Leiche von den Tönen eines Hornquartetts empfangen. Seitens der Loge
zur aufgehenden Morgenröte spendete Herr Rabbiner Dr. Plaut dem
verstorbenen, verdienstvollen Altmeister die üblichen Rosen. Abermals
ertönten die Klänge der Hörner und das Grab Auerbachs wurde
geschlossen." |
Über Jonas Weil und sein Wirken in New York (1893)
Anmerkung: Jonas Weil ist im Mai 1837 in Emmendingen geboren als Sohn des
Ephraim Weil und am 11. April 1917 in Manhattan N.Y. gestorben. Genealogische
Informationen:
https://www.geni.com/people/Jonas-Weil/6000000176152936846. Seine Frau
Therese geb. Mayer ist am 11. Dezember 1840 in Altdorf geboren und am 19.
Juli 1927 in Queens N.Y. gestorben.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1893: "New
York, im
März. (Die Zichron Ephraim-Synagoge und das Lebanon-Hospital). Es wird
unsere Glaubensbrüder im deutschen Reiche gewiss interessieren, zu
erfahren, dass hier an der Spitze der Orthodoxie ein Deutscher, Herr Jonas
Weil aus Emmendingen in Baden steht. Derselbe kam vor ungefähr 30 Jahren
nach Amerika, um sich hier eine Existenz zu gründen. Das Glück war ihm
besonders günstig und er erwarb sich Vermögen und Ehren. Er war mehrere
Jahre Kultusvorstand einer der ehrenwertesten Gemeinde, der 57. Str.
Synagoge. Dieser edle Menschenfreund hat es für notwendig gefunden, auch
im oberen Teil der Stadt eine Synagoge im großartigen Stil erbauen zu
lassen und hat er dazu nicht nur mehr als fünfzig Tausend Dollar
gespendet, sondern trägt bis heute noch fast ganz allein mit nie
ermattender Kraft die große Arbeitskraft der Gemeinde. Unter seiner
Leitung und unter der Beihilfe seines Schwiegersohnes, Herrn Rabbiner Dr.
Drachman wird der jüdische Religionsunterricht in jeder Beziehung
gepflegt. Die Krone zu dem Allen hat sich dieser edle Jehudi damit
aufgesetzt, dass er ein imposantes Bauwerk in der 150. Str. für ein
jüdisches Hospital erbauen ließ, wo streng Koscher Küche
geführt und allen Nationalitäten und Religionen kostenfrei liebevolle
Pflege und Behandlung zuteil werden soll. Auch da spendete Herr Weil ca.
fünfzehn Tausend Dollar. Am 22. Februar, am Washington-Geburtstage, hat
die Einweihungsfeier stattgefunden und haben sich zahlreiche Förderer
dieses wohltätigen Unternehmens eingefunden. Nachdem die Erschienenen die
zahlreichen und schmucken Räume des Hospitals in Augenschein genommen
hatten, versammelte man sich in dem großen Saale des Riesenbaues, der bis
auf das letzte Plätzchen gefüllt war. Präsident Herr Jonas Weil betrat
die Rednertribüne und sprach mit herzlichen Worten die besten Wünsche
und Hoffnungen für das Wachsen und Gedeihen des Unternehmens aus. Es
folgte nun eine Reihe weiterer Reden u.a. von den Herren Rabbiner Dr.
Klein, Rev. Dr. Drachmann, Dr. Samuel Lloyd, Register Ferdinand Levy und
Superintendent Dr. G. Liebermann. Ein Damenkomitee, meistens aus
christlichen Damen bestehend, hatte sich gebildet, das zum Besten des
Libanon-Hospitals ein großes Fair veranstaltete und damit mehr als Dollar
2.000 erzielte. Schließlich erachte ich es als eine angenehme Pflicht der
aufopfernden Tätigkeit des Board of Directors zu gedenken. In erster
Reihe ist es der geachtete und hochgeschätzte Vizepräsident Herr N.
Peabody, ein Jehudi in des Wortes edelster Bedeutung. Seinen Bemühungen
und seiner Opferfreudigkeit ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass
dieser imposante Bau für seinen jetzigen Zweck dasteht, denn Herr Peabodi
hat dem Spitale durch Sammlungen nicht weniger als zwanzig Tausend Dollars
zugeführt. Herr Dr. Samuel Lloyd, ein edler Amerikaner, schenkte 50
Betten samt Zubehör. Herr Ferdinand Sultzberger liefert das
Koscher-Fleisch für drei Jahre gratis. Ph. Kraus." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1893: "New
York, im
März. (Die Zichron Ephraim-Synagoge und das Lebanon-Hospital). Es wird
unsere Glaubensbrüder im deutschen Reiche gewiss interessieren, zu
erfahren, dass hier an der Spitze der Orthodoxie ein Deutscher, Herr Jonas
Weil aus Emmendingen in Baden steht. Derselbe kam vor ungefähr 30 Jahren
nach Amerika, um sich hier eine Existenz zu gründen. Das Glück war ihm
besonders günstig und er erwarb sich Vermögen und Ehren. Er war mehrere
Jahre Kultusvorstand einer der ehrenwertesten Gemeinde, der 57. Str.
Synagoge. Dieser edle Menschenfreund hat es für notwendig gefunden, auch
im oberen Teil der Stadt eine Synagoge im großartigen Stil erbauen zu
lassen und hat er dazu nicht nur mehr als fünfzig Tausend Dollar
gespendet, sondern trägt bis heute noch fast ganz allein mit nie
ermattender Kraft die große Arbeitskraft der Gemeinde. Unter seiner
Leitung und unter der Beihilfe seines Schwiegersohnes, Herrn Rabbiner Dr.
Drachman wird der jüdische Religionsunterricht in jeder Beziehung
gepflegt. Die Krone zu dem Allen hat sich dieser edle Jehudi damit
aufgesetzt, dass er ein imposantes Bauwerk in der 150. Str. für ein
jüdisches Hospital erbauen ließ, wo streng Koscher Küche
geführt und allen Nationalitäten und Religionen kostenfrei liebevolle
Pflege und Behandlung zuteil werden soll. Auch da spendete Herr Weil ca.
fünfzehn Tausend Dollar. Am 22. Februar, am Washington-Geburtstage, hat
die Einweihungsfeier stattgefunden und haben sich zahlreiche Förderer
dieses wohltätigen Unternehmens eingefunden. Nachdem die Erschienenen die
zahlreichen und schmucken Räume des Hospitals in Augenschein genommen
hatten, versammelte man sich in dem großen Saale des Riesenbaues, der bis
auf das letzte Plätzchen gefüllt war. Präsident Herr Jonas Weil betrat
die Rednertribüne und sprach mit herzlichen Worten die besten Wünsche
und Hoffnungen für das Wachsen und Gedeihen des Unternehmens aus. Es
folgte nun eine Reihe weiterer Reden u.a. von den Herren Rabbiner Dr.
Klein, Rev. Dr. Drachmann, Dr. Samuel Lloyd, Register Ferdinand Levy und
Superintendent Dr. G. Liebermann. Ein Damenkomitee, meistens aus
christlichen Damen bestehend, hatte sich gebildet, das zum Besten des
Libanon-Hospitals ein großes Fair veranstaltete und damit mehr als Dollar
2.000 erzielte. Schließlich erachte ich es als eine angenehme Pflicht der
aufopfernden Tätigkeit des Board of Directors zu gedenken. In erster
Reihe ist es der geachtete und hochgeschätzte Vizepräsident Herr N.
Peabody, ein Jehudi in des Wortes edelster Bedeutung. Seinen Bemühungen
und seiner Opferfreudigkeit ist es hauptsächlich zuzuschreiben, dass
dieser imposante Bau für seinen jetzigen Zweck dasteht, denn Herr Peabodi
hat dem Spitale durch Sammlungen nicht weniger als zwanzig Tausend Dollars
zugeführt. Herr Dr. Samuel Lloyd, ein edler Amerikaner, schenkte 50
Betten samt Zubehör. Herr Ferdinand Sultzberger liefert das
Koscher-Fleisch für drei Jahre gratis. Ph. Kraus." |
Die von Jonas Weil finanzierten Einrichtungen heute:
|
 Park East Synagogue New York
(gegründet 1890 als Congregation Zichron Ephraim) Park East Synagogue New York
(gegründet 1890 als Congregation Zichron Ephraim)
Website mit Seite
zu ihrer Geschichte mit Nennung von Jonas Weil)
Foto:
Quelle |
 Bronx-Lebanon
Hospital Center (Website) Bronx-Lebanon
Hospital Center (Website)
|
 Presseartikel zum Tod von Jonas Weil 1917.
Presseartikel zum Tod von Jonas Weil 1917. |
Über den Wohltäter Jonas Weil (aus
Emmendingen, Artikel von 1902)
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 12. April 1902: "Ein
Wohltäter: Jonas Weil. Im Jahre 1859 verließ ein blutarmer junger Mann
seine Vaterstadt Emmendingen in Baden, um jenseits des großen Wassers sein
Glück zu versuchen. Durch außerordentlichen eisernen Fleiß und besondere
Tüchtigkeit gelang es ihm, das Gesuchte zu finden und sich ein Vermögen zu
erwerben. Dieser junge Mann war Jonas Weil, einer unserer Glaubensgenossen,
dessen jüdisches Herz ihn antrieb, in seinem Glück der Armen nicht zu
vergessen, sondern mit vollen Händen Wohltaten zu üben. Treu hat er allzeit
seiner Badischen Heimat, besonders seiner Geburtsstätte gedacht. Seit einer
langen Reihe von Jahren erhält die Gemeinde Emmendingen alljährlich
die Summe von 500 Mark zur Verteilung unter die Armen, ohne Rücksicht auf
deren Konfession. Daneben hat Herr Jonas Weil, dessen Bildnis wir vorstehend
unseren Lesern vorführen, auch der israelitischen Gemeinde beziehungsweise
deren Armen beträchtliche Zuwendungen im Laufe der Jahre gemacht. Aber noch
mehr als in seiner alten, ist Herr Weil in seiner neuen Heimat Amerika ein
Wohltäter der Armen. Vor ungefähr elf Jahren hat er ein Hospital fast
ausschließlich mit seinen Mitteln erstellt und sorgt seitdem als Präses des
Spitals, dem der Name Lebanon-Spital gegeben wurde, in unermüdlicher Arbeit
für die zeitgemäße Ausstattung desselben. Auch eine Synagoge (Sichron-Ephraim-Synagoge)
hat ihn zum Hauptgründer. Viele Wohltaten entziehen sich noch der
öffentlichen Kenntnis; denn er übt sie in reichste Maße im Stillen, wie es
die jüdische Lehre als besonders gottgefällig bezeichnet. Von seinen alten
Bekannten in Emmendingen wird Herr Weil als ein von Jugend auf mitleidiger
und gutmütiger Mensch geschildert. Er ist verheiratet; seine Frau stammt aus
Altdorf (Amt Ettenheim) und ist
die Ehe mit Kindern gesegnet, an denen das Elternpaar nur Freude erlebt.
Herr Weil erfreut sich bei einem Alter von 64 Jahren noch ziemlicher
körperlicher Rüstigkeit. Möge ihm noch ein recht langes glückliches Leben
beschieden sein."
Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 12. April 1902: "Ein
Wohltäter: Jonas Weil. Im Jahre 1859 verließ ein blutarmer junger Mann
seine Vaterstadt Emmendingen in Baden, um jenseits des großen Wassers sein
Glück zu versuchen. Durch außerordentlichen eisernen Fleiß und besondere
Tüchtigkeit gelang es ihm, das Gesuchte zu finden und sich ein Vermögen zu
erwerben. Dieser junge Mann war Jonas Weil, einer unserer Glaubensgenossen,
dessen jüdisches Herz ihn antrieb, in seinem Glück der Armen nicht zu
vergessen, sondern mit vollen Händen Wohltaten zu üben. Treu hat er allzeit
seiner Badischen Heimat, besonders seiner Geburtsstätte gedacht. Seit einer
langen Reihe von Jahren erhält die Gemeinde Emmendingen alljährlich
die Summe von 500 Mark zur Verteilung unter die Armen, ohne Rücksicht auf
deren Konfession. Daneben hat Herr Jonas Weil, dessen Bildnis wir vorstehend
unseren Lesern vorführen, auch der israelitischen Gemeinde beziehungsweise
deren Armen beträchtliche Zuwendungen im Laufe der Jahre gemacht. Aber noch
mehr als in seiner alten, ist Herr Weil in seiner neuen Heimat Amerika ein
Wohltäter der Armen. Vor ungefähr elf Jahren hat er ein Hospital fast
ausschließlich mit seinen Mitteln erstellt und sorgt seitdem als Präses des
Spitals, dem der Name Lebanon-Spital gegeben wurde, in unermüdlicher Arbeit
für die zeitgemäße Ausstattung desselben. Auch eine Synagoge (Sichron-Ephraim-Synagoge)
hat ihn zum Hauptgründer. Viele Wohltaten entziehen sich noch der
öffentlichen Kenntnis; denn er übt sie in reichste Maße im Stillen, wie es
die jüdische Lehre als besonders gottgefällig bezeichnet. Von seinen alten
Bekannten in Emmendingen wird Herr Weil als ein von Jugend auf mitleidiger
und gutmütiger Mensch geschildert. Er ist verheiratet; seine Frau stammt aus
Altdorf (Amt Ettenheim) und ist
die Ehe mit Kindern gesegnet, an denen das Elternpaar nur Freude erlebt.
Herr Weil erfreut sich bei einem Alter von 64 Jahren noch ziemlicher
körperlicher Rüstigkeit. Möge ihm noch ein recht langes glückliches Leben
beschieden sein." |
Auszeichnung für den Bäcker Jonas Weil für den
Dienst in der Feuerwehr (1893)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1893: "Aus
Baden.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog hat eine Anzahl Feuerwehrleute
für 25jährige Dienste mit Medaillen dekoriert, darunter finden sich
folgende Glaubensgenossen: Jonas Weil, Bäcker in Emmendingen, Elias
Dreifuß, Handelsmann in Kuppenheim, Isidor Lindemann, Medizinalrat in
Mannheim, Baruch Wolf, Handelsmann in Oestringen, Karl Blum, Kaufmann in
Sinsheim." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1893: "Aus
Baden.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog hat eine Anzahl Feuerwehrleute
für 25jährige Dienste mit Medaillen dekoriert, darunter finden sich
folgende Glaubensgenossen: Jonas Weil, Bäcker in Emmendingen, Elias
Dreifuß, Handelsmann in Kuppenheim, Isidor Lindemann, Medizinalrat in
Mannheim, Baruch Wolf, Handelsmann in Oestringen, Karl Blum, Kaufmann in
Sinsheim." |
Emanuel Schwarz als Soldat im Gefecht (1914)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1914:
"Emmendingen. Emanuel Schwarz, der als Unteroffizier in dem schweren
Gefecht bei Mülhausen mitbeteiligt war, wurde mit einem Gefreiten des
Abends von einer sechs Mann starken französischen Patrouille überfallen.
Die beiden schossen vier Mann nieder und nahmen die anderen zwei
gefangen." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1914:
"Emmendingen. Emanuel Schwarz, der als Unteroffizier in dem schweren
Gefecht bei Mülhausen mitbeteiligt war, wurde mit einem Gefreiten des
Abends von einer sechs Mann starken französischen Patrouille überfallen.
Die beiden schossen vier Mann nieder und nahmen die anderen zwei
gefangen." |
Beisetzung des "im Kampf für das Vaterland
gestorbenen" Otto Veit (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. November 1914: "Emmendingen, 6. November
(1914). Ein großer Leichenzug bewegte sich vom hiesigen Bahnhof zu dem
israelitischen Gottesacker hinauf, um die sterbliche Hülle des im Kampf
für das Vaterland gestorbenen Otto Veit zur letzten Ruhe zu
geleiten. Dem Leichenwagen voran marschierte die Stadtmusikkapelle, die in
den hiesigen Lazaretten untergebrachten Verwundeten (soweit sie
marschieren können), der Kriegerverein, die Sanitätskolonne, der
Jugendverein, die Sängerrunde Hochberg und der Turnverein. Den
Leichenwagen begleitete als Ehrenwache eine Abteilung Landsturmleute der
Bahnhofswache und hinter den Angehörigen folgte ein großer Zug sonstiger
Leidtragender. In zu Herzen gehenden Worten gedachte Rabbiner Dr. Zimels
aus Freiburg der hervorragenden Eigenschaften des Verstorbenen und hob
besonders dessen soldatische Tugenden hervor, die ihn bei seinen
Vorgesetzten beliebt machten und ihm rasche Beförderung zum Vizefeldwebel
der Reserve und Offizierstellvertreter brachten. Für sein tapferes
Verhalten vor dem Feinde wurde er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Während der Sarg hinabgesenkt wurde, präsentierte die Ehrenwache und
krachten drei Salven als letzter militärischer Gruß. Auch die
Stadtgemeinde hatte ihren Sohn durch einen Kranz mit Schleife in den
städtischen Farben geehrt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. November 1914: "Emmendingen, 6. November
(1914). Ein großer Leichenzug bewegte sich vom hiesigen Bahnhof zu dem
israelitischen Gottesacker hinauf, um die sterbliche Hülle des im Kampf
für das Vaterland gestorbenen Otto Veit zur letzten Ruhe zu
geleiten. Dem Leichenwagen voran marschierte die Stadtmusikkapelle, die in
den hiesigen Lazaretten untergebrachten Verwundeten (soweit sie
marschieren können), der Kriegerverein, die Sanitätskolonne, der
Jugendverein, die Sängerrunde Hochberg und der Turnverein. Den
Leichenwagen begleitete als Ehrenwache eine Abteilung Landsturmleute der
Bahnhofswache und hinter den Angehörigen folgte ein großer Zug sonstiger
Leidtragender. In zu Herzen gehenden Worten gedachte Rabbiner Dr. Zimels
aus Freiburg der hervorragenden Eigenschaften des Verstorbenen und hob
besonders dessen soldatische Tugenden hervor, die ihn bei seinen
Vorgesetzten beliebt machten und ihm rasche Beförderung zum Vizefeldwebel
der Reserve und Offizierstellvertreter brachten. Für sein tapferes
Verhalten vor dem Feinde wurde er mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Während der Sarg hinabgesenkt wurde, präsentierte die Ehrenwache und
krachten drei Salven als letzter militärischer Gruß. Auch die
Stadtgemeinde hatte ihren Sohn durch einen Kranz mit Schleife in den
städtischen Farben geehrt." |
Über den aus Emmendingen stammenden Mediziner Emil
Bloch (1847 in Emmendingen - 1920)
Der Freiburger, aus Emmendingen stammende HNO-Arzt richtete 1899 die
Universitätsohrenklinik in Freiburg ein; nachstehend ein Artikel über ihn aus
der Jewish Encyclopedia, der noch zu seinen Lebzeiten geschrieben wurde.
 "Bloch,
Emil: German otologist; born at Emmendingen, Baden, Dec. 11, 1847. He was
educated at the universities of Heidelberg, Würzburg, Vienna, and
Freiburg in Baden; being graduated from the last-named as doctor of
medicine in 1871. After a postgrauduate course at the University of Berlin
and in hospitals in London, he established himself as a pgysician in
Freiburg. In 1886 he took up the study of laryngology and rhinology under
Hack, and of otology under Thiry at the University of Freiburg. In the
following year he became assistant to Thiry, which position he held till
1892, when, ob the death of the latter, he became his successor as chief
physician at the otological dispensary and privat-docent at the university.
In 1894 Bloch was appointed assistant professor of otology; and under his
sipervision the clinic for this branch of medicine was opened in 1899. "Bloch,
Emil: German otologist; born at Emmendingen, Baden, Dec. 11, 1847. He was
educated at the universities of Heidelberg, Würzburg, Vienna, and
Freiburg in Baden; being graduated from the last-named as doctor of
medicine in 1871. After a postgrauduate course at the University of Berlin
and in hospitals in London, he established himself as a pgysician in
Freiburg. In 1886 he took up the study of laryngology and rhinology under
Hack, and of otology under Thiry at the University of Freiburg. In the
following year he became assistant to Thiry, which position he held till
1892, when, ob the death of the latter, he became his successor as chief
physician at the otological dispensary and privat-docent at the university.
In 1894 Bloch was appointed assistant professor of otology; and under his
sipervision the clinic for this branch of medicine was opened in 1899.
Bloch is the author of the following works and papers:
'Untersuchungen zur Physiologie der Nasenatmung.' Wiesbaden 1888;
'Pathologie und Therapie der Mundatmung', ib. 1889; 'Sprachgebrechen', ib.
1891; 'Über das Biaurale Hören' in: 'Zeitschrift für Ohrenheilkunde',
1893; 'Die Methode der Centripetalen Pressionen und die Diagnose der
Stapesfixation', ib. 1894; 'Einheitliche Bezeichnung der Otologischen
Punktionsprüfungsmethode und ihre Ergebnisse', Wiesbaden 1898.
Bibliography: Pagel, Biographisches Lexikon, s.v., Vienna 1901. F.T.H." |
Anzeigen jüdischer
Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Hinweis auf zwei in Emmendingen erschienene Publikation
(1860)
Anmerkung: beim Herausgeber M. Auerbach dürfte es sich um den damals in
Emmendingen tätigen Lehrer Auerbach handeln.
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
3. April 1860: "Bibelverse in hebräischer und deutscher
Sprache, zu Dr. Büdingers Leitfaden beim Unterricht in der israelitischen
Religion, herausgegeben von M. Auerbach. 2te Auflage. Emmendingen 1859.
geb. 5 Ngr. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
3. April 1860: "Bibelverse in hebräischer und deutscher
Sprache, zu Dr. Büdingers Leitfaden beim Unterricht in der israelitischen
Religion, herausgegeben von M. Auerbach. 2te Auflage. Emmendingen 1859.
geb. 5 Ngr.
Dreifus, erstes hebräisches Lesebüchlein für israelitische
Schulen. 2te Aufl. Emmendingen 1860. broch. 4 Ngr." |
Lehrlingsgesuche des Eisenwarengeschäftes Moritz
Günzburger (1891 / 1901 / 1904)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Lehrlings-Gesuch! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1891: "Lehrlings-Gesuch!
Für mein gemischtes Eisenwarengeschäft suche zum baldigen Eintritt einen
Lehrling unter günstigen Bedingungen. Kost und Logis im Hause.
Moritz Günzburger, Emmendingen (Baden)." |
| |
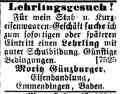 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November 1901:
"Lehrlingsgesuch!
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. November 1901:
"Lehrlingsgesuch!
Für mein Stab- und Kurzeisenwaren-Geschäft suche ich zum
sofortigen oder späteren Eintritt einen Lehrling mit guter Schulbildung.
Günstige Bedingungen.
Moritz Günzburger, Eisenhandlung, Emmendingen,
Baden." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1904: "Lehrling. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1904: "Lehrling.
Für mein Stab-, Kurzwaren- und Maschinen-Geschäft suche ich zum
sofortigen oder späteren Eintritt einen Lehrling unter günstigen
Bedingungen.
Moritz Günzburger, Emmendingen (Baden)." |
Anzeige der Wursterei Albert Veit
(1924)
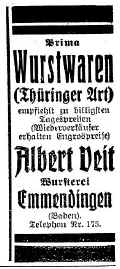 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 24.
Januar 1924: Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 24.
Januar 1924:
"Prima Wurstwaren (Thüringer Art)
empfiehlt zu billigsten Tagespreisen (
Wiederverkäufer erhalten Engrospreise)
Albert Veit
Wursterei
Emmendingen (Baden).
Telephon Nr. 175." |
Anzeige der Dampfbrennerei M. Heilbrunner (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. Juli 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. Juli 1924:
"Schwarzwälder Kirschwasser Zwetschenwasser
Mirabell- Heidelbeergeist
Weinbrände Edelliköre.
M. Heilbrunner
Emmendingen i.B.
Dampfbrennerei
Rührige Vertreter gesucht." |
| |
Ergänzend
dazu: Geschäftspostkarte
der Dampfbrennerei Heilbrunner (1922)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim / Ries) |
 |
 |
Die Geschäfts-Postkarte der Dampfbrennerei, Likörfabrik und Weingroßhandlung Max
Heilbrunner, wurde versandt am 4. Dezember 1922 an die Buchdruckerei Emil Wild in Endingen.
Max Heilbrunner wurde 1852 geboren und starb am 8. Oktober 1926. Er wurde
beigesetzt im jüdischen Friedhof in
Emmendingen. |
Weitere Dokumente
Schreiben
an den
Synagogenrat Emmendingen -
Wiederbesetzung der Stelle
des Bezirksältesten (1868)
(aus der Sammlung von Hansjörg Schwer,
Waldshut-Tiengen) |
 |
 |
Hinweis von
Hansjörg Schwer: "An dem Brief
ist interessant, dass er als 4 Kr-Nachnahme
geschickt wurde. Das wurde früher entweder
von armen Leuten praktiziert, die das Porto
nicht zahlen konnten und somit erstattet
bekamen. Oder von Personen /
Organisationen, die das Porto nicht zahlen
wollten (z.B. aus Geiz, Verärgerung, oder wie
eventuell hier wegen einer Mahnung) und es
sich durch die Nachnahme zurückerstatten
ließen. |
Das Schreiben wurde
versandt von
Breisach nach Emmendingen
am
7. Dezember 1868: Umschlag:
"An / den Synagogenrath / Emmendingen
Nachnahme Porto 3 cr
Tax 1
erhlten: vier Kr 4 cr
BzRbt Breisach
Weihs
|
Inhalt:
Bezirkssynagoge Breisach / den 7. Dez 1868
die Wiederbesezung des durch / Ableben
des Oberraths Breisacher / in Emmendingen
erledigten
/ Stelle eines Bezirksältesten (?)
/betr.
Es wird der Synagogenrath / Emmendingen die Erledigung / der anbr. betrf. Zuschrift hermit (?)
/ erinnert, mit Frist v. 3 Tagen.
Weihs" |
| |
|
|
Ansichtskarte
von Emmendingen,
versandt von Anna Weil nach Colmar (1902)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim /Ries) |
 |
 |
Die Ansichtskarte von Anna Weil wurde am 6. August 1902 nach Colmar
geschickt. Anna Weil ist am 29. Oktober 1874 geboren (später verheiratete
Valfer). Der Text der Karte: "Liebe Marie. Sehr leid hat es mir getan Sie nicht mehr persönlich zu sprechen und sage Ihnen auf diesem
Wege ein herzliches Lebewohl und auf baldiges Wiedersehen. Bitte grüßen Sie mir Ihre werte Frau Mutter.
Liebe Betty und Familie Bloch. Wie geht es Ihnen sonst. Würde mich sehr freuen auch von Ihnen einmal
etwas zu erfahren oder komme ich bald zur Hochzeit. Nochmals Gruß Anne."
Hinweis: es gab noch eine weitere Anna Weil, die in der Liste der Opfer der
NS-Zeit genannt wird: Anna Weil geb. Heim. Diese wohnte jedoch 1902 noch in
ihrem Müllheimer Elternhaus und
heiratete am 11. Februar 1907 Julius Weil (nach Informationen von
Dorothea Scherle vom 29.6.2021). |
| |
|
|
Geschäftskarte
der
Holzhandlung Simon Veit (1912)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim / Ries) |
 |
 |
|
Die Geschäftskarte der Holzhandlung Simon
Veit (Emmendingen) wurde verschickt am 30. Oktober 1912 an Herrn A. Zimber, Sägewerk in
Krozingen. Zur Person: Simon Veit wurde 1851 als Sohn des Handelsmanns David Veit von Niederemmendingen geboren.
Ab 1880 leitete leitete er mit die Geschicke der Israelitischen Gemeinde Emmendingen. 50 Jahre
- bis 1930 - übte er das Amt des Gemeindevorstehers aus. Ein Sohn von Simon Veit, dem die
Flucht nach Brasilien gelang, versuchte noch seinen Vater zur Ausreise zu bewegen,
jedoch ohne Erfolg. Simon Veit wurde am 22. Oktober 1940 zusammen mit den letzten noch in Emmendingen gebliebenen
jüdischen Mitbürgern nach Gurs deportiert. wo er unter den dort herrschenden unmenschlichen Zuständen
sein Leben verlor.
Zu seinem ehrenden Gedenken erhielt das Gemeindehaus der israelitischen Gemeinde am 12. Februar 2006
den Namen "Simon-Veit-Haus".
Quellen: www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/5592;
www.badische-zeitung.de/emmendingen/im-vorhof-zur-hoelle-auschwitz--36837326.html
http://ijonathan.de/juedgemem/?page_id=8
www.badische-seiten.de/emmendingen/simon-veit-haus.php. |
| |
Geschäftskarte
der Cigarrenfabrik
Max Bloch & Co. (1927)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim / Ries) |
 |
 |
|
Die Postkarte geschäftlicher Art der Emmendinger Cigarrenfabrik Max Bloch &
Co wurde versandt an Herrn Werthmann in Dillingen a.D. am 4. August 1927.
1887 hatte Max Bloch die 1860 von Karl Schwaner gegründete Cigarrenfabrik
erworben. Wie auf einem Briefkopf der Firma aus dem Jahr 1919 ersichtlich
ist, hatte das Unternehmen auch Filialen in Teningen, Köndringen, Heimbach und Ihringen. 1931 ging die Fa. Max Bloch & Co in Konkurs.
Max Bloch genoss hohes Ansehen in der Stadt. 1906 stiftete er ein Bild des Kaisers Wilhelm der Realschule. Heute kann man das gestiftete Bild im neugestalteten
Museum der Stadt betrachten.
Quellen: https://www.museum-digital.de/bawue/index.php?t=objekt&oges=1417
http://www.badische-zeitung.de/geschichten-erzaehlen-stadtgeschichte--31079959.html |
| |
|
|
Sonstiges
Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:
Grabstein in New York für Babette Weil
(ca. 1796 - 1870), Frau von Gumbel Weil aus Emmendingen
Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.
 |
Grabstein in deutsch:
"Hier ruht Babette Weil,
Frau des sel. Gumbel Weil
aus Emmendingen Grossherzogtum Baden,
gest. am 22 August 1870 im Alter von 74 Jahren.
An Seele rein, an Tagen reich,
weilt nun ihr verklärter Geist im Himmelreich". |
Erinnerung an die Deportation in das südfranzösische
Internierungslager Gurs (1940): Grabstein für Moritz Weil aus Emmendingen
 Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für (zweite Reihe
rechts) Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für (zweite Reihe
rechts)
Moritz Weil aus Emmendingen (lt. Grabstein 1884 -
1941)
lt. Gedenkbuch wurde aus Emmendingen nach Gurs deportiert und ist dort
umgekommen:
Moritz Weil, geb. 13. Mai 1855 in Emmendingen, am 12. Januar 1941 in Gurs
umgekommen.
Es wurden noch zwei andere Personen mit Name Moritz Weil aus Emmendingen
nach Gurs deportiert, doch wurden diese später in Auschwitz
ermordet. |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
1727 wurde ein Betsaal in
dem vom jüdische Händler Moses Gydeon gekauften Haus Kirchstraße 11
eingerichtet. 1754 wird dieses Haus als "Judenschule" bezeichnet, es gehörte
inzwischen Model Weil. Neben Gottesdiensten und Zusammenkünften finden hier
auch die religiösen Unterweisungen der Kinder statt. 1763 wurde das Haus zur
Synagoge umgebaut.
Für die wachsende jüdische Gemeinde wurde die bisherige
Synagoge nach wenigen Jahrzehnten zu klein. Nach Verhandlungen mit der Stadt und
dem Oberrat der Israeliten Badens konnte 1823 direkt vor dem Haus der
bisherigen Synagoge eine neue Synagoge erbaut werden. Die alte Synagoge diente
seitdem als Gemeindehaus mit Kantorenwohnung, Gemeindesaal und Unterrichtsräumen.
Seit 1830 war die jüdische Konfessionsschule hier untergebracht, später wurde
diese in die Karl-Friedrich-Straße 62 verlegt (bis zur Aufhebung der
Konfessionsschulen 1872). 1869 wurde die Synagoge erstmals renoviert, vergrößert
und mit einem würdevollen Festakt neu eingeweiht.
Neue Beleuchtung in der Synagoge - die alten Leuchter
werden zum Kauf angeboten (1886)
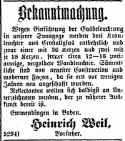 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886: "Bekanntmachung. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Oktober 1886: "Bekanntmachung.
Wegen Einführung der Gasbeleuchtung in unserer Synagoge werden drei
Kronleuchter als Kristallglas entbehrlich und zwar einer mit 36 Kerzen und
zwei mit je 18 Kerzen, ferner circa 12-16 zweiarmige, vergoldete
Wandleuchter. Sämtliche sind von neuester Konstruktion und moderner
Facon, da sie erst vor wenigen Jahren neu angeschafft wurden. Reflektanten
wollen sich baldigst an Unterzeichneten werden, der zu näherer Auskunft
bereit ist.
Emmendingen in Baden.
Heinrich Weil, Vorsteher." |
1899 berichtete die "Allgemeine Zeitung des
Judentums" von einer besonderen Feier in der Emmendinger Synagoge. Der New
Yorker Philanthrop Jonas Weil, der aus Emmendingen stammte, hatte der Gemeinde
eine Torarolle gestiftet, die am 1. Juli 1899 offiziell übergeben wurde. Der
feierliche Gottesdienst wurde mitgestaltet vom Emmendinger Synagogen-Männerchor
unter Leitung von Kantor Goldberg. Bezirksrabbiner Dr. Adolf Lewin aus Freiburg
hielt die Festpredigt und sprach das Weihegebet. Der Frauenverein der Gemeinde
hatte für die neue Tora einen Mantel im Atelier J. Bloch in Straßburg
anfertigen lassen. Am Nachmittag war die Gemeinde noch im Gasthaus zum Engel zu
einem Bankett zusammen.
Spende einer Torarolle für die jüdische Gemeinde durch den
aus Emmendingen stammenden Jonas Weil (New York, 1899)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1899: "Emmendingen,
Baden, 4. Juli (1899). Eine wahrhaft erhebende Feier beging die hiesige
israelitische Gemeinde am vergangenen Samstag. Der bekannte Philanthrop
Herr Jonas Weil in New York, ein geborener Emmendinger und Ehrenmitglied
unserer Religionsgemeinde, stiftete derselben eine Torarolle, welche am
letzten Samstag dem Kultus übergeben wurde. Eingeleitet wurde die Feier
durch das Lied: 'Harre meine Seele' von Cäsar Malau, vorgetragen vom
hiesigen Synagogen-Männerchor, unter Leitung des Herrn Kantor Goldberg;
darauf hielt der Bezirksrabbiner Herr Dr. A. Lewin eine in Form und Inhalt
gleich meisterhafte Predigt, welcher ein Sologesang des Opernsängers Herrn
Alfred Goltz aus Nürnberg folgte. Hierauf wurden sämtlich 'Sforim', 9 an der
Zahl, ausgehoben und der neuen Tora, welche im Gemeindezimmer in einem
improvisierten 'Hechal' aufgestellt war, entgegen getragen. In feierlichem
Zuge durch eine Allee prächtiger Bäume und Blumen wurde nun das 'Sefar'
unter einem Baldachin in die Synagoge gebracht. Kantor Goldberg rezitierte 'S'u Sch'orim' und der Synagogenchor sang
darauf 'Machet die Tore weit' von J. Heinr. Lützel. Die Torarollen
wurden eingehoben und der Herr Rabbiner sprach ein ergreifendes
Weihegebet. Der Wochenabschnitt wurde aus der neuen Tora gelesen, zu
welchem alle in der Synagoge anwesenden verheirateten Männer gerufen
wurden, wobei ca. 250 Mark an Spenden für die Wohltätigkeitsvereine
fielen. Der hiesige Frauenverein hat für die neue Tora ein Mäntelchen im
Atelier des Herrn J. Bloch, Straßburg, anfertigen lassen. Nachmittags
vereinigten sich die Familien im Gasthaus zum Engel zu einem Bankett, und
manches Glas feurigen Kaiserstühlers wurde auf das Wohl des edlen
Stifters, der neben seinem segensreichen Wirken in der neuen Welt seiner
Vaterstadt und seines Heimatortes in so schöner und pietätvoller Weise
gedenkt, geleert." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Juli 1899: "Emmendingen,
Baden, 4. Juli (1899). Eine wahrhaft erhebende Feier beging die hiesige
israelitische Gemeinde am vergangenen Samstag. Der bekannte Philanthrop
Herr Jonas Weil in New York, ein geborener Emmendinger und Ehrenmitglied
unserer Religionsgemeinde, stiftete derselben eine Torarolle, welche am
letzten Samstag dem Kultus übergeben wurde. Eingeleitet wurde die Feier
durch das Lied: 'Harre meine Seele' von Cäsar Malau, vorgetragen vom
hiesigen Synagogen-Männerchor, unter Leitung des Herrn Kantor Goldberg;
darauf hielt der Bezirksrabbiner Herr Dr. A. Lewin eine in Form und Inhalt
gleich meisterhafte Predigt, welcher ein Sologesang des Opernsängers Herrn
Alfred Goltz aus Nürnberg folgte. Hierauf wurden sämtlich 'Sforim', 9 an der
Zahl, ausgehoben und der neuen Tora, welche im Gemeindezimmer in einem
improvisierten 'Hechal' aufgestellt war, entgegen getragen. In feierlichem
Zuge durch eine Allee prächtiger Bäume und Blumen wurde nun das 'Sefar'
unter einem Baldachin in die Synagoge gebracht. Kantor Goldberg rezitierte 'S'u Sch'orim' und der Synagogenchor sang
darauf 'Machet die Tore weit' von J. Heinr. Lützel. Die Torarollen
wurden eingehoben und der Herr Rabbiner sprach ein ergreifendes
Weihegebet. Der Wochenabschnitt wurde aus der neuen Tora gelesen, zu
welchem alle in der Synagoge anwesenden verheirateten Männer gerufen
wurden, wobei ca. 250 Mark an Spenden für die Wohltätigkeitsvereine
fielen. Der hiesige Frauenverein hat für die neue Tora ein Mäntelchen im
Atelier des Herrn J. Bloch, Straßburg, anfertigen lassen. Nachmittags
vereinigten sich die Familien im Gasthaus zum Engel zu einem Bankett, und
manches Glas feurigen Kaiserstühlers wurde auf das Wohl des edlen
Stifters, der neben seinem segensreichen Wirken in der neuen Welt seiner
Vaterstadt und seines Heimatortes in so schöner und pietätvoller Weise
gedenkt, geleert." |
Eine der eindrücklichsten Veranstaltungen in der
Geschichte der Emmendinger jüdischen Gemeinde war am 8. Juni 1904.
Damals wurde das vierte oberbadische Synagogenchorfest in der Stadt
veranstaltet. Daran beteiligten sich die sieben Synagogenchöre aus Bühl,
Eichstetten, Emmendingen, Freiburg,
Kippenheim, Nonnenweier
und Offenburg mit zusammen 150 Sängern.
Hunderte von Gesangsfreunden strömten in die Stadt, um dem Ereignis
beizuwohnen. Die Veranstaltungen waren in dem vom Gemeinderat zur Verfügung
gestellten Rathaussaal und in dem mit über 800 Zuhörern besetzten Saalbau zum
Dreikönig. Kantor Goldberg leitete den Gesamtchor. Während des zweistündigen
Hauptkonzertes wurden synagogale Chorgesänge teilweise von den einzelnen Chören,
teilweise gemeinsam oder unter Begleitung von Solisten vorgetragen. Bei einem
nachfolgenden Bankett war Rabbiner Dr. Adolf Lewin (Freiburg) Hauptredner (siehe
Berichte oben).
Einweihung des Gefallenendenkmals in der Synagoge (1920)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Juli 1920: "Emmendingen,
16. Juli (1920). Seinen gefallenen und im Kriege verstorbenen Kameraden
setzte der hiesige Jüdische Jugendbund ein ehrendes und bleibendes
Denkmal. Der Initiative des Vorstandes des Jugendbundes, Herrn Berthold
Weil, ist es zu danken, dass in der Gemeinde die Mittel zusammengebracht
wurden für eine prachtvolle, künstlerisch in Muschelkalk ausgeführte
Gedenkplatte. Dieselbe wurde an der Ostwand in der Synagoge angebracht und
am 11. dieses Monats der Gemeinde übergeben. Leider viel zu umfangreich
musste die Tafel ausgeführt werden, vierzehn Namen tüchtiger und
begabter junger Männer zeugen davon, dass unsere Religionsgemeinde dem
Weltkrieg ihren Tribut gezollt hat. Die Übergabe war mit einem
Gedächtnisgottesdienst verbunden, dem Vertreter der Bezirks- und
Stadtverwaltung beiwohnten. Nach prächtig vorgetragenen Orgelstücken,
Chören und Solis übergab der Vorsitzende des Jugendbundes, Herr Berthold
Weil, mit einer markigen Ansprache die Tafel dem Synagogenrat in Obhut,
der sie mit Worten der Dankbarkeit durch Herrn Rechtsanwalt Dreifuß
übernehmen ließ. Im Mittelpunkt der Feier stand die Weihepredigt des
Herrn Bezirksrabbiners Dr. Zimels, die auf alle Beteiligten einen tiefen
Eindruck machte. Der Vorstand des Jugendbundes hat den Tag der Weihe
dieser Gedenktafel für alle Zeit als Jahrzeitstag für die Gefallenen
bestimmt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Juli 1920: "Emmendingen,
16. Juli (1920). Seinen gefallenen und im Kriege verstorbenen Kameraden
setzte der hiesige Jüdische Jugendbund ein ehrendes und bleibendes
Denkmal. Der Initiative des Vorstandes des Jugendbundes, Herrn Berthold
Weil, ist es zu danken, dass in der Gemeinde die Mittel zusammengebracht
wurden für eine prachtvolle, künstlerisch in Muschelkalk ausgeführte
Gedenkplatte. Dieselbe wurde an der Ostwand in der Synagoge angebracht und
am 11. dieses Monats der Gemeinde übergeben. Leider viel zu umfangreich
musste die Tafel ausgeführt werden, vierzehn Namen tüchtiger und
begabter junger Männer zeugen davon, dass unsere Religionsgemeinde dem
Weltkrieg ihren Tribut gezollt hat. Die Übergabe war mit einem
Gedächtnisgottesdienst verbunden, dem Vertreter der Bezirks- und
Stadtverwaltung beiwohnten. Nach prächtig vorgetragenen Orgelstücken,
Chören und Solis übergab der Vorsitzende des Jugendbundes, Herr Berthold
Weil, mit einer markigen Ansprache die Tafel dem Synagogenrat in Obhut,
der sie mit Worten der Dankbarkeit durch Herrn Rechtsanwalt Dreifuß
übernehmen ließ. Im Mittelpunkt der Feier stand die Weihepredigt des
Herrn Bezirksrabbiners Dr. Zimels, die auf alle Beteiligten einen tiefen
Eindruck machte. Der Vorstand des Jugendbundes hat den Tag der Weihe
dieser Gedenktafel für alle Zeit als Jahrzeitstag für die Gefallenen
bestimmt." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge verwüstet,
gesprengt und abgebrochen.
Bei Hundsnurscher/Taddey s. Lit. S. 76 ist zu lesen: "Am 10. November
1938 wurden auf Anordnung der Kreisleitung die Angehörigen der SA und der
SA-Reserve in Zivil zur Synagoge befohlen, wo auf Befehl des uniformierten
Bürgermeisters und SA-Sturmbannführers die Synagoge aufgebrochen, alle
Einrichtungsgegenstände mit Äxten zerschlagen und vor der Synagoge
aufgestapelt wurden. Das israelitische Gemeindehaus wurde in gleicher Weise
demoliert. Einer der Haupttäter lief dabei mit Chorhemd und Zylinder als
Rabbiner verkleidet herum und eiferte die Schuljugend zur Mithilfe an... Der
Haufen von zertrümmerten Bänken, von Gebetbüchern und anderen Ritualien wurde
schließlich angezündet. Die Synagoge wurde am Abend fachmännisch gesprengt".
Zu diesen Angaben erhielten wir folgende Mitteilung von Kreisarchivar Gerhard A.
Auer, Emmendingen (vom 2.8.2011): "Der damalige Bürgermeister Hirt ist
weder in Uniform aufgetreten, noch hat er sich an der Zerstörung der Synagoge
beteiligt. Gemeint ist vermutlich der Sturmbannführer Hauser, er war
stellvertretender Bürgermeister. Aber: in seinem Prozess konnte er zumindest
für das Gericht glaubhaft machen, dass er das Kommando bei der
Synagogenzerstörung nicht übernahm, sondern dass die Initiative von der
Kreisleitung, Kreisleiter Glas, ausging. - Die Sachlage ist insgesamt so komplex,
dass sie nicht in ein paar wenigen Sätzen beschrieben werden kann. Aber
eindeutig ist, dass sich Bürgermeister Hirt nicht an der Synagogenzerstörung beteiligt
hat."
Die
Sprengung der Synagoge wurde der jüdischen Gemeinde mit 4.179,45 RM in Rechnung
gestellt. Da die Gemeinde diesen Betrag nicht bezahlen konnte, wurde vom
Synagogenrat der Stadt angeboten, das Synagogengrundstück als Gegenleistung zu
übernehmen. Die Stadt nahm dieses Angebot an; das Gemeindehaus Kirchstraße 11
wurde ebenfalls enteignet. 1941 wurde dieses Gebäude in ein Mehrfamilienhaus
umgewandelt. 1945 wurde das Haus von der französischen Besatzungsmacht
beschlagnahmt und der Israelitischen Landesgemeinde Südbaden übergegeben.
Diese verkaufte das Haus 1954 der Stadt zum Preis von 14.000 Mark, da damals
nicht damit gerechnet werden konnte, dass jemals wieder Juden in Emmendingen ansässig
sein werden.
1968, 1988 und 1999 wurden an dem – jahrelang als
Parkplatz genutzten - Standort der Synagoge Gedenktafeln angebracht. Bei der
Erneuerung des Synagogenplatzes 1994 wurden die Umrisse der zerstörten Synagoge
markiert.
Zur neuen Gemeinde siehe folgende
Seite.
Fotos
Historische Fotos:
(Quellen: Foto alte Synagoge: Jüdische Gemeinde Emmendingen;
Fotos neue Synagoge: Foto Hirsmüller, Emmendingen)
 |
 |
|
Alte Synagoge in Emmendingen
(Kirchstraße 11) |
Der Schlossplatz in
Emmendingen,
links der Mitte die neue Synagoge |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
Neue Synagoge
Emmendingen |
Innenansicht mit
Blick zum Toraschrein |
Toraschrein
(Ausschnitt aus
Foto links) |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
|
|
 |
 |
 |
| Der Synagogenplatz |
Gedenkstätte für die
Synagoge |
Die 1968 angebrachte
Gedenktafel |
| |
|
|
|
Fotos 2003
(Hahn, Aufnahmedatum: 23.3.2003)
|

|

|
| |
Auf dem Platz der ehemaligen,
1938 zerstörten
Synagoge |
Gedenktafeln für die
ehemalige Synagoge |
| |
|
|
|

|

|

|
Metalltafel auf dem
ehemaligen Synagogenplatz |
Gedenktafel für die 1938
zerstörte Synagoge |
Weitere Gedenktafel |
| |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Mai 2010:
Auch in der neu konzipierten stadtgeschichtlichen
Sammlung wird an die jüdische Geschichte erinnert |
Zitate aus einem Bericht von
Sylvia-Karina Jahn in der "Badischen Zeitung" vom 14. Mai 2010 (Artikel,
Hervorhebungen unten durch den Webmaster): "Museumsbesuch soll Spaß machen.
Ein Rundgang durch die stadtgeschichtliche Sammlung vermittelt Geschichte komprimiert, unterhaltsam und überraschend.
'Es geht um den Augengenuss.' So beschreibt Hans-Jörg Jenne, Fachbereichsleiter Kultur bei der Stadtverwaltung, das neue Konzept für die stadtgeschichtliche Sammlung, die heute, Samstag, zum ersten Mal nach drei Jahren wieder geöffnet hat. Soll heißen: Texte werden sparsam und nur ergänzend verwendet und auf jegliche Form der elektronischen Präsentation wurde verzichtet. Statt dessen steht das Exponat, das Original im Mittelpunkt – und das Ergebnis lohnt nicht nur einen Besuch. Denn in den sieben Themenräumen erwartet die Besucher so manche Überraschung und nicht jede auf den ersten Blick.
Es lohnt sich also, zu stöbern und zu staunen, oft auch sich zu erinnern...
(In der Bürgerstube findet sich) ein lebensgroßes Porträt von Kaiser
Wilhelm. In der Ausstellung scheint der wohlwollend auf einen "Bollerwagen de Luxe" zu blicken, wie Jenne das pompöse Spielzeug nennt. Doch das kaiserliche Bild schmückte kein großbürgerliches Wohnzimmer, sondern die Realschule (in der es auch beschädigt wurde, aber von Soldaten, nicht von Schülern!) Der Schule war es
von einem jüdischen Bürger gestiftet worden – und wieder ist die Vernetzung da. Der letzte Raum ist dem
Nationalsozialismus gewidmet. Raum? Nein, eher ein schwarzer Schlauch. Drückende Enge empfängt den Besucher, "wählt Hitler" schreit ein feuerrotes Plakat von der Wand. Volksempfänger und Gasmaske grüßen, Fotos zeugen von Maiaufmärschen, vom Krieg (das eindrucksvolle Bild, als Soldaten zum Frankreichfeldzug durch die dörflichen Gassen zogen, stamme übrigens aus einer Lörracher Mülltonne, sagt Jenne), von Zwangsarbeitern, wobei die Ostarbeiter in den Haselmatten untergebracht waren. Ihre letzte noch stehende Baracke nutzen die Eisenbahnfreunde.
Die gekennzeichneten Ausweise der jüdischen Mitbürger markieren die Ausgrenzung als Anfang der grausamen Vernichtungsaktionen und der Blick durchs Fenster fällt auf den Grundriss der in der Reichspogromnacht zerstörten Synagoge – und weist vielleicht so manchem den Weg ins jüdische Museum nebenan. In der Stadtgeschichte haben die Nazis weitere Spuren hinterlassen: Ein drehbares Straßenschild zeigt, dass die netten Blumennamen in der
'Gartenstadt' Bleiche einst die Namen von Nazi-'helden' trugen, das Originalschild ist gar mit einem Hakenkreuz versehen..."
Info: Besuchszeitung des Museums der Stadt sonntags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr." |
| |
| Oktober 2012:
Erinnerung an die Deportation der jüdischen
Patienten der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen
|
Artikel von Dagmar Barber in der
"Badischen Zeitung" vom 23. Oktober 2012: "Mit den
Fäden der Vergangenheit die Zukunft weben.
Premiere im Psychiatriezentrum: Milton Matz' Stück 'Frühstück im
Regency' berührt, macht betroffen und nachdenken..."
Link
zum Artikel:
Mit den Fäden der Vergangenheit die Zukunft weben (veröffentlicht am Di, 23. Oktober 2012 auf badische-zeitung.de) auch eingestellt
als pdf-Datei |
| |
| November 2013:
Auf Grund von Bedenken aus
der jüdischen Gemeinde wird noch kein Beschluss zu
"Stolpersteinen" in Emmendingen gefasst |
| Artikel von Gerhard Walser: Stolpersteine sind nicht erwünscht (veröffentlicht am Mi, 27. November 2013 auf badische-zeitung.de) |
| |
| Juni 2014:
Werner Bloch zu Besuch in
Emmendingen |
Artikel von Marco Kupfer in der
"Badischen Zeitung" vom 28. Juni 2014:
Link zum Artikel: Eine Synagoge als letzter Wunsch (veröffentlicht am Sa, 28. Juni 2014 auf badische-zeitung.de) |
| |
|
Dezember 2015:
Ehrung für Carola Grasse
|
Artikel von Markus Zimmermann in der
"Badischen Zeitung" vom 4. Dezember 2015: "Sie hilft beim Abbau von
Vorurteilen. Carola Grasse, Vorsitzende des Vereins für jüdische
Geschichte, erhielt die Landesehrennadel..."
Link zum Artikel (eingestellt als pdf-Datei) |
| |
|
April - November
2016: "300 Jahre jüdisches Leben
in Emmendingen 1716-2016"
- eine Veranstaltungsreihe des Vereins für Jüdische
Geschichte und Kultur Emmendingen e.V. - Zum Programm siehe die rechte Seite des Flyers unten:
|
 |

|
|
Veranstaltung am 3. Mai 2016, 19 Uhr im Teschemacher-Saal,
Simon-Veit-Haus, Kirchstraße 11 in Emmendingen
"Jüdische Welten - Von Kantor bis Klezmer", Vortrag: Ruth Frenk,
Konstanz, Konzertsängerin und Gesangspädagogin.
Musik als "jüdische Musik" zu bezeichnen ist ein vergleichsweise junges Phänomen. Erst im 20. Jahrhundert taucht dieser Begriff in den Musik-Lexika auf. In ihrem Vortrag vermittelt die Konzertsängerin und Gesangspädagogin Ruth Frenk eine einführende Übersicht über verschiedene Aspekte
"jüdischer Musik", etwa der synagogalen Musik, der einzigen Musikrichtung, die diskussionslos als
"jüdisch" bezeichnet werden kann. Vorgestellt werden auch
aschkenasische, sefardische und chassidische Volkslieder, die Musik des jiddischen Theaters, Ghetto- und Widerstandslieder, Volks- und Kunstlieder aus Israel sowie die in Deutschland sehr populäre
Klezmer-Musik. |
| |
Veranstaltung
am 8. Mai 2016: "Die Günzburger – Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte"
Buchvorstellung, Hanneke Schmitz, geb. Günzburger & Peter Schmitz, Herne
Am Sonntag, 8. Mai 2016, 11.30 Uhr in Emmendingen, Simon-Veit-Haus, Kirchstraße 11, Teschemacher-Saal
Die Familie Günzburger kann ihre Wurzeln bis zu den Anfängen jüdischen Lebens in Emmendingen zurückverfolgen. In der Einleitung zu ihrem 2015 erschienenen Buch schreiben die Verfasser Hanneke und Peter Schmitz:
'Die Rekonstruktion der Familiengeschichten ist für uns nicht Selbstzweck. Wir fühlen uns dem Gedanken verpflichtet, dem nationalsozialistischen Projekt der Vernichtung des jüdischen Lebens, und damit auch dem versuchten Ausradieren der jüdischen Kultur in Europa, eine lebendige Erinnerungskultur entgegen zu
setzen." |
| |
|
September 2020:
Berichte vom "Europäischen Tag der
Jüdischen Kultur" |
 Artikel
in der "Badischen Zeitung" am 8. September 2020 von Michael Haberer:
"'Ich fliehe mit dem Auto' - Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur
erzählt Rabbiner Yudkowsky von seiner Arbeit..." Artikel
in der "Badischen Zeitung" am 8. September 2020 von Michael Haberer:
"'Ich fliehe mit dem Auto' - Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur
erzählt Rabbiner Yudkowsky von seiner Arbeit..."
Link zum Artikel |
 Artikel von Michael Adams im "Emmendinger Tor" vom 9. September 2020: "'Jüdische
Reisen' mit Kultur und Literatur..."
Artikel von Michael Adams im "Emmendinger Tor" vom 9. September 2020: "'Jüdische
Reisen' mit Kultur und Literatur..."
Link zur Ausgabe
des Emmendinger Tores (siehe Seite 4) |
|
Oben
zwei Berichte von den Veranstaltungen zum "Europäischen Tag der Jüdischen
Kultur" im September 2020:
Zum Lesen bitte Artikelabbildungen anklicken oder den Links folgen.
|
| |
| |
|
Januar 2024:
Neue Website 'juedisches-leben-in-emmendingen'
des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V.
|
 Pressetext
vom 31. Januar 2024 (Foto von der Präsentationsveranstaltung): "Der
Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V., Träger des
Jüdischen Museums Emmendingen, präsentiert seit Januar 2024 die neue Website
https://www.juedisches-leben-in-emmendingen.de. Sie basiert auf der
umfassenden Datenbank des Gedenkbuches in der Medienstation im Jüdischen
Museum Emmendingen. Die komplexe Datenbank wird nun für eine breite
Öffentlichkeit weltweit zugänglich und jederzeit nutzbar. Aktuell enthält
das Gedenkbuch biografische Einträge zu 534 Personen mit Bezug zu
Emmendingen, die den NS-Terror ab 1933 erleiden mussten, und berichtet über
ihr Lebensschicksal. Erinnert wird aber nicht nur an die Menschen, die in
Lagern starben oder ermordet wurden, sondern auch an die Menschen, die den
NS-Terror überlebt haben. Die Nutzer*innen der Website erhalten umfangreiche
Informationen über das Verfolgungsschicksal der porträtierten Menschen.
Zahlreiche Dokumente, Fotos, Videos, Interviews und Audiodateien rufen die
Menschen in Erinnerung und leisten einen Beitrag dazu, sie im kulturellen
Gedächtnis der Stadt, ihrer Bürger*innen und aller an jüdischem Leben in
Emmendingen Interessierten zu bewahren. Pressetext
vom 31. Januar 2024 (Foto von der Präsentationsveranstaltung): "Der
Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V., Träger des
Jüdischen Museums Emmendingen, präsentiert seit Januar 2024 die neue Website
https://www.juedisches-leben-in-emmendingen.de. Sie basiert auf der
umfassenden Datenbank des Gedenkbuches in der Medienstation im Jüdischen
Museum Emmendingen. Die komplexe Datenbank wird nun für eine breite
Öffentlichkeit weltweit zugänglich und jederzeit nutzbar. Aktuell enthält
das Gedenkbuch biografische Einträge zu 534 Personen mit Bezug zu
Emmendingen, die den NS-Terror ab 1933 erleiden mussten, und berichtet über
ihr Lebensschicksal. Erinnert wird aber nicht nur an die Menschen, die in
Lagern starben oder ermordet wurden, sondern auch an die Menschen, die den
NS-Terror überlebt haben. Die Nutzer*innen der Website erhalten umfangreiche
Informationen über das Verfolgungsschicksal der porträtierten Menschen.
Zahlreiche Dokumente, Fotos, Videos, Interviews und Audiodateien rufen die
Menschen in Erinnerung und leisten einen Beitrag dazu, sie im kulturellen
Gedächtnis der Stadt, ihrer Bürger*innen und aller an jüdischem Leben in
Emmendingen Interessierten zu bewahren.
Die Website 'juedisches-leben-in-emmendingen' ist eine Recherche- und
Kommunikationsplattform und versteht sich als partizipatives Projekt.
Weltweit können Nutzer*innen entsprechend ihren Bedürfnissen recherchieren.
Sie sind eingeladen, am Aufbau eines Netzwerkes der Erinnerung mitzuwirken,
ihr Wissen und ihre Erfahrung mit dem Projektteam zu teilen. Angesprochen
sind Nachfahr*innen jüdischer Familien aus Emmendingen, Forschende und am
Judentum Interessierte, ganz besonders aber auch junge Menschen. Die Website
steht für Projekte der schulischen und außerschulischen
historisch-politischen Bildungsarbeit zur Verfügung und ist ein Baustein für
die Entwicklung digitaler Lernangebote. Wir unterstützen Sie dabei gerne.
Das Gedenkbuch und die darauf basierende Website sind nicht abgeschlossen.
Bisher gibt es zu rund 70 Personen kleine Biografien. Bei der Mehrzahl der
534 porträtierten Menschen bieten wir Lebensdaten, Fotografien und andere
Materialien sowie die entsprechenden Quellenangaben. Wir laden alle
Interessierten ein, uns bei der weiteren Forschungsarbeit zu unterstützen.
Mit der Website fördern wir den engen Austausch und die Vernetzung mit
anderen Initiativen und Institutionen, die genealogische Forschung zu
jüdischen Familien betreiben und (virtuelle) Stolpersteine oder Gedenkbücher
gestalten.
Die neue Website wurde durch die Stadt Emmendingen und die LpB
Baden-Württemberg aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg finanziell
gefördert. Private Sponsoren haben zur Realisierung beigetragen.
Das Projektteam bilden: Carola Grasse Dipl.-Päd., Monika R.R. Miklis
M.A., Dorothea Scherle Dipl.-Theol. und der Gestalter der Website Steffen
Krauth Dipl. Des., lautschrift - atelier für visuelle Kommunikation & design.
Emmendingen, den 10.01.24 Carola Grasse, Erste Vorsitzende."
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 74-77. |
 | Ernst Hetzel: Die Anfänge der jüd. Gemende in
Emmendingen, in: Emmendinger Heimatkalender 1969. S. 41-44. |
 | Karl Zeis: Die israelitische Privatschule in
Emmendingen, in: Emmendinger Heimatkalender 1970, S. 46-47. |
 | nach 1971 fanden sich mehrere Jahre in den Artikeln "Kleines Emmendinger Einwohnerlexikon" im Emmendinger Heimatkalender
Charakterisierungen jüdischer Mitbürger). |
 | Karl Günther: Jüdische Familien in der Unterstadt
(Nieder-Emmendingen), in: Nieder-Emmendingen – Erinnerungen an ein Dorf.
1983. S. 37-39 |
 | ders.: Laubhütten in Nieder-Emmendingen, in: Emmendinger
Heimatkalender 1992. S. 44-48. |
 | Klaus Teschemacher: Juden in Emmendingen von
1716-1862 und Hubert Schilling, Juden in Emmendingen von 1862-1933, in:
"s'Eige
zeige" Jahrbuch des Landkreises Emmendingen für Kultur und Geschichte
3/1989 S. 117-137. |
 | Hans-Jörg Jenne: Amtliches von der Vertreibung der Juden
aus Emmendingen und Gerhard A. Auer: Persönliches von der Vertreibung der Juden aus
Emmendingen, in: "s'Eige zeige" 3/1989 S. 139-175. |
 | Gerhard Behnke: Das Geheimnis der Versöhnung ist
Erinnerung. Dokumentation zum Besuch der ehemaligen jüdischen Mitbürger
Emmendingens. 1989. |
 | Karl Günther: Juden aus Ihringen und Eichstetten
auf dem alten jüdischen Friedhof in Emmendingen, in: "s'Eige
zeige" 5/1991. S. 75-98. |
 | ders.: Nieder-Emmendinger Juden auf dem alten jüdischen
Friedhof in Emmendingen, in: "s'Eige zeige" 6/1992 S. 21-39. |
 | ders.: Emmendinger Juden auf dem alten jüdischen Friedhof
in Emmendingen, Teil 1: Von den Anfängen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts,
in: "s'Eige zeige" 7/1993 S. 27-63. |
 | ders.: Emmendinger Juden auf dem alten jüdischen Friedhof
in Emmendingen, Teil 2: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Schließung
des Friedhofs im Jahr 1899, in: "s'Eige zeige" 8/1994 S. 47-107. |
 | ders.: Jechiel, Sohn des Mose Eli - Daniel Heilbronn. Aus
den Anfängen der Jüdischen Gemeinde in Emmendingen, in: Emmendinger
Heimatkalender 1990. S. 88-93. |
 | ders.: Symbole auf jüdischen Grabsteinen, am Beispiel des
alten jüdischen Friedhofes in Emmendingen. in: Emmendinger Heimatkalender
1991. S. 57-63. |
 | Rosemarie Schwemmer: Die jüdischen Friedhöfe in
Emmendingen. Manuskript. 1989. |
 | Hannelore Künzl: Die Mikwe zu Emmendingen. Gutachten 1990.
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. |
 | Carola Grasse/ Helmut R. Merz/Christa Rutz: Jüdisches
Leben in Emmendingen. Orte, Schauplätze, Spuren. Reihe: Orte jüdischer
Kultur. Haigerloch 2001. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -
Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from
their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem
1986. S. 244-247. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 | 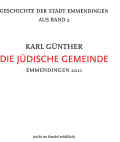 Stadtgeschichte
Emmendingen. Band II. ISBN 978-3-9811180-1-8. 34.90 € Stadtgeschichte
Emmendingen. Band II. ISBN 978-3-9811180-1-8. 34.90 €
Darin S. 589-724 ein ausführlicher Beitrag zur jüdischen Geschichte von Karl
Günther; Zitat aus einem Artikel
zur Buchvorstellung in der "Badischen Zeitung" von
Sylvia-Karina Jahn vom 26. Oktober 2011: "Karl Günther ist der wohl profundeste Kenner der jüdischen Gemeinde in Emmendingen, die 2016 vor 300 Jahren gegründet wurde. Sie zählte zu den größeren Gemeinden, gab es doch Mitte des 19. Jahrhunderts in Emmendingen 12,5 Prozent Juden. Günther befasst sich eingehend mit der Synagoge, deren Zerstörung seine Mutter miterlebt hat. 1938 war das, die 4000 Reichsmark für Verwüstung und Sprengung musste die jüdische Gemeinde aufbringen, über den Verkauf ihrer Grundstücke. 3000 Reichsmark wären ihr noch geblieben, aber die hat die Gemeinde nie gesehen. Und als der Sohn in den 60er-Jahren erste Artikel zum Thema in der Badischen Zeitung veröffentlichte, habe das hässliche Kommentare ausgelöst; ebenso, dass er das Honorar für eine erste Gedenktafel stiftete. "Es wäre angemessen, die Synagoge wieder zu errichten", sagte Günther und nannte den Platz einen sensiblen Ort, der Gradmesser sei für den Umgang mit diesem Kapitel Emmendinger
Vergangenheit." |
 |  Christiane
Twiehaus: Synagogen im Großherzogtum Baden (1806-1918). Eine
Untersuchung zu ihrer Rezeption in den öffentlichen Medien. Rehe: Schriften
der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Universitätsverlag Winter
Heidelberg 2012. Christiane
Twiehaus: Synagogen im Großherzogtum Baden (1806-1918). Eine
Untersuchung zu ihrer Rezeption in den öffentlichen Medien. Rehe: Schriften
der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Universitätsverlag Winter
Heidelberg 2012.
Zur Synagoge in Emmendingen S. 195-197. |
 | Michaela Schmölz-Häberlein:
Kleinstadtgesellschaft(en). Weibliche und männliche Lebenswelten im Emmendingen des 18. Jahrhunderts
(VSWG-Beihefte Bd.
220). Stuttgart 2012. (Habilitationsschrift). |
 | dies.: Ausbildung – Arbeit – Angehörige: Lebenszyklische und ökonomisch-politische Anlässe für jüdische Mobilität und Migration im 18.
Jahrhundert am Oberrhein, in: Jahrbuch für Regionalgeschichte 27 (2009), S. 51-66. |
 | dies.: Vom Westfälischen Frieden bis zum Ende des Alten Reiches, in: Geschichte der Stadt Emmendingen Bd. 1. Von den Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches, hrsg. von Hans-Jörg Jenne u.a., Emmendingen 2006, S. 279-456. |
 | dies.: Täufer, Juden und ländliche Gemeinden im badischen Oberamt Hochberg im 18.
Jahrhundert. In: Nachbarn, Gemeindegenossen und die anderen. Minderheiten und Sondergruppen im Südwesten des Reiches während der Frühen Neuzeit, hrsg. von André Holenstein und Sabine Ullmann (Oberschwaben - Geschichte und Kultur Bd.
12). Tübingen 2004. S. 275-299. |
 | dies.: Zwischen Integration und Ausgrenzung: Juden in der oberrheinischen Kleinstadt Emmendingen 1680-1800, in: Landjudentum im deutschen Südwesten während der frühen Neuzeit, hrsg. von Rolf Kießling und Sabine Ullmann
(Colloquia Augustana Bd.
10). Berlin 1999. S. 363-397. |
 | dies.: Ehrverletzung als Strategie? Zum sozialen Kontext von Injurien in der badischen Kleinstadt Emmendingen,
1650-1800. In: Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne. Studien zu Konflikten im südwestdeutschen Raum, hrsg. von Mark Häberlein (Konflikte und Kultur - Historische Perspektiven Bd.
2). Konstanz 1999. S. 131-149. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Emmendingen
Baden. Jews were present in the mid-16th century, and after expulsion in the
early 17th century a few returned after the Thirty Years War (1618-1648). None
seem to have been living there at the end of the century. A new settlement was
established in 1716 through the efforts of the Court Jew Josef Guenzburger. A
cemetery, the oldest in Upper Baden, was opened in 1717 and a synagogue was
dedicated in 1823. In 1801 the Jewish population reached 158 and in 1875 the
peak of 406 (total 3,487). In 1830-72 a Jewish elementary school was in
operation. Jews continued to earn their livelihood mainly from the cattle trade
and at the outset of the 20th century, 65 % were so engaged. In the same period
the Wertheimer distillery became the largest in the state. The Jewish population
dropping somewhat after 1925 with an exodus to the big cities, totaled 296 in
1933, including new settlers fleeing the Nazi persecutions. By October 1938, 147
had left, 100 of them emigrating. Another 111 (86 emigrating) left after Kristallnacht
(9-10 November 1938), when the synagogue and two cemeteries were wrecked and
Jews were taken to the Dachau concentration camp. The last 66 Jews were deported
to the Gurs concentration camp in October 1940, while 19 Jews who had previously
left the city were also deported from their places of refuge. In all, 23
survived the camps. In addition, the Germans murdered 25-30 patients at the
local Jewish insance asylum.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|