|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht "Synagogen im Stadt- und Landkreis Kassel"
Grebenstein mit
Immenhausen und (Immenhausen-)Holzhausen (Kreis
Kassel)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Grebenstein bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht
in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Doch gab es bereits im Mittelalter
einzelne jüdische Personen in der Stadt und im benachbarten Immenhausen: 1345
werden bei einem Streit drei Juden genannt (Gumpracht Sercken [?] aus
Immenhausen, Bonefant, jüdischer Bürger aus Grebenstein und Bonefant, der
Arzt, die letzteren französischer Herkunft.
Im 17. Jahrhundert sind 1629/31 einzelne Juden in der Stadt genannt
(namentlich Wolf der Jude bzw. Wolff Ganß), gleichfalls 1663 und 1696 (Simson
Bacharach und sein Vater Ruben Bacharach). 1704 werden vier Juden bzw. jüdische
Familien genannt (Ruben Bacharach, Levin Samuel, Abraham Ganß und Simson
Bacharach), 1730 waren es bereits 19 "Schutzjuden", die meisten
wohl mit Familie. Sie lebten u.a. vom Garn- und Lederhandel. Grebenstein spielte
damals offenbar eine zentrale Rolle für die Regen: 1773, 1776 und 1800 fanden
hier die hessischen Judenlandtage statt.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1812 13 jüdische Familien, 1826 98 jüdische Einwohner, 1835 105
(4,1 % von insgesamt 2.535), 1871 85 (3,6 % von 2.387), 1885 86 (3,8 % von
2.249), 1895 90 (in 24 Familien), 1896 96 (in 22 Familien), 1898 92 (in 21
Haushaltungen; von 2221 Einwohnern), 1899 79 (in 19 Haushaltungen), 1905 50 (2,2 % von 2.252). Zur Gemeinde
Grebenstein gehörten die in Holzhausen
(1835 10, 1861 15, 1905 18) und Immenhausen
(1835 9, 1861 13, 1905 7) lebenden jüdischen Personen.
Die jüdischen Familien lebten bis Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend vom
Vieh- und Warenhandel, einige waren als Metzger tätig (bereits 1776 werden 6 jüdische
Metzger in der Stadt genannt). Mitte des 19. Jahrhunderts gab es inzwischen
mehrere jüdische Handwerker, darunter einen Färbermeister (Simon Brandenstein),
einen Schreinermeister (Michael Rosenbaum), einen Schneidermeister (Jacob
Rosenbaum) und einen Buchbindermeister (Nathan Wolf Gans, der zugleich
Gemeindevorsteher war). In Immenhausen wird damals ein jüdischer
Tischlermeister genannt.
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische
Schule (von 1831 bis 1911 als Israelitische Elementarschule), ein
rituelles Bad sowie einen Friedhof. Dazu
wird um 1897/1903 eine Schülerbibliothek als Einrichtung der jüdischen Gemeinde
genannt. Um
1865 wird als Lehrer an der Israelitischen Elementarschule J. Gans (Quelle),
um 1868 Jacob Plaut genannt. 1877 besuchten die jüdischen Kinder vorübergehend
die Stadtschule. Seit 1878 war Heinemann Plaut Lehrer in Grebenstein (siehe
Artikel unten zu seiner Person). Er unterrichtete 1878 20, 1882 21, 1898 15,
1899 13, 1908 noch 6
Kinder. Gleichzeitig mit seiner Zurruhesetzung 1911 wurde die
israelitische Elementarschule aufgelöst. Danach bestand zunächst noch eine
Privat-Elementarschule der jüdischen Gemeinde (siehe Ausschreibung von 1911
unten) und spätestens ab 1919 noch eine Religionsschule (s.u. Ausschreibung von
1919), bis schließlich die nur noch wenigen jüdischen Kinder der Gemeinde durch
auswärtige Lehrer unterrichtet wurden (1924 s.u. durch den Lehrer aus
Meimbressen).
Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk
Niederhessen mit Sitz in Kassel. Kreisvorsteher des Kreises Hofgeismar innerhalb
des Rabbinatsbezirkes war über viele Jahre Salomon Rosenbaum aus Grebenstein (genannt
in dieser Funktion seit 1899; vgl. zu seinem
Tod 1930 siehe Artikel unten).
Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1894/1896 A. Mandelstein und H.
Neuhahn, um 1898 S. Rosenbaum und A. Mandelstein, um 1919 Herr Voremberg.
Von den jüdischen Vereinen werden genannt: der Israelitische
Wohltätigkeitsverein (um 1894/1897 unter Leitung von S. Neuhahn) und der
Israelitische Frauen-Verein (um 1894/1897 unter Leitung der Frau von S.
Rosenbaum).
Bis in die 1930er-Jahre gab es an jüdischen Gewerbetreibenden insbesondere:
Willi Möllerich (Gemischtwarenhandel), Lion Katz (Viehhandel), Louis Katzenberg
(Viehhandel), Bernhard Mandelstein (Friseur, Textilhandel), Rosalie Gans (Getränkehandel),
Jacob Simson Rosenbaum (Zahnarzt, Getreide-, Futter- und Düngemittelhandel),
Wilhelm David (Textilhandel), Goldwein (Pferdehandel), David Adler (Viehhandel),
Regenstein (Viehhandel, Michael Neuhahn (Frucht- und Getreidehandel, Textil- und
Möbelhandel), Willi Vorenberg (Viehhandel), Erwin Machol (Verkäufer bei
Familie Rosenbaum).
Um 1924, als 53 jüdische Einwohner gezählt wurden (2,1 % von 2.493),
waren die Gemeindevorsteher Gustav Neuhahn, Lion Katz und B. Möllerich. Der
Religionsunterricht der damals drei schulpflichtigen jüdischen Kinder wurde
durch Lehrer Herbold Löwenstein aus Meimbressen erteilt. 1932 waren
die Gemeindevorsteher Leo Katz (1. Vors.), Baruch Wormser (2. Vors., Vorbeter
der Gemeinde bis 1938) und Bernhard Mandelstein (Schatzmeister). An jüdischen Vereinen
bestand insbesondere der Israelitische Frauenverein (Chevroth Noschim;
1932 unter Leitung von Flora Rosenbaum; Zweck und Arbeitsgebiete: Hilfeleistung
bei Krankheiten, Todesfällen und Unterstützung jüdischer einheimischer Armer.
1924 gehörten aus Immenhausen 4 jüdische Personen, aus Holzhausen
8 zur Gemeinde in Grebenstein. 1932 waren es 7 beziehungsweise 5
Personen.
1933 lebten noch 50 jüdische Personen in Grebenstein. In den
folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der
zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise
ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 kam es in der Stadt zu schlimmen
Ausschreitungen: die Synagoge wurde verwüstet (s.u.), zahlreiche Wohn- und
Geschäftshäuser jüdischer Familien fast völlig zerstört. Eine fanatisierte
Menge prügelte jüdische Geschäftsinhaber durch die Stadt. 1939
wurden noch 10 jüdische Personen am Ort gezählt (0,3 % von 2.865), die
gleichfalls alsbald aus der Stadt verzogen sind. Von den ausgewanderten Personen
konnte eine Familie mit 4 Personen bereits 1934 nach Palästina, einzelne
Personen sind in die USA, in die Tschechoslowakei, nach Polen. Viele verzogen
nach Kassel und in andere Städte.
 Von den in Grebenstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie nach der Gedenktafel
im Stadtmuseum
Hofgeismar, Jüdische Abteilung, siehe Foto links): Rosalie Gans (1868),
Moritz Grünklee (1880), Helene Hamberg (1879), Lotte Jakobs geb. Rosenbaum
(1887), Marga Katz (1920), Selma Kahn geb. Neuhahn (1885), Gerson Katz (1887), Helma
(Helene) Katz (1922),
Ida Katz geb. Möllerich (1888), Ingeborg Katz (1926), Lion Katz (1887), Louis Katzenberg (1881),
Mathilde Katzenberg geb. Möllerich (1892),
Albert Katzenstein (1869), Klara Kaufmann geb. Weil (1889), Sally Levi
(1893), Johanna Mandelbaum (1864), Bernhard Mandelstein (1883), Else (Ettel)
Mandelstein geb. Kugelmann (1889), Erwin Meier (1908), Adolf Meyer (), Hermann
Meyer (1880), Jenny Meyer geb. Vorenberg (1880), Auguste Möllerich geb.
Gumbert (), Ludwig
Möllerich (1935), Martha Möllerich geb. Plaut (1909), Willi Möllerich (1893),
Emmy Neuhahn geb. Stein (1887), Frieda Neuhahn (1890), Moritz Neuhahn (1882), Dina Oberdorff
geb. Neuhahn (1890), Fritz Oberdorff (1890), Hildegard Petzal geb. Bieber (1898),
Flora Rosenbaum geb. Wertheim (1858), Max Rosenbaum (1882),
Antonie (Toni) Sassen geb. Katzenberg (1873), Emma Schnitzler geb. Katzenberg
(1878), Willi Vorenberg (1883), Frieda Weil geb. Rosenbaum (1889, von Köln
nach Lódz deportiert), Clara Wormser geb. Rosenbaum
(1884). Von den in Grebenstein geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie nach der Gedenktafel
im Stadtmuseum
Hofgeismar, Jüdische Abteilung, siehe Foto links): Rosalie Gans (1868),
Moritz Grünklee (1880), Helene Hamberg (1879), Lotte Jakobs geb. Rosenbaum
(1887), Marga Katz (1920), Selma Kahn geb. Neuhahn (1885), Gerson Katz (1887), Helma
(Helene) Katz (1922),
Ida Katz geb. Möllerich (1888), Ingeborg Katz (1926), Lion Katz (1887), Louis Katzenberg (1881),
Mathilde Katzenberg geb. Möllerich (1892),
Albert Katzenstein (1869), Klara Kaufmann geb. Weil (1889), Sally Levi
(1893), Johanna Mandelbaum (1864), Bernhard Mandelstein (1883), Else (Ettel)
Mandelstein geb. Kugelmann (1889), Erwin Meier (1908), Adolf Meyer (), Hermann
Meyer (1880), Jenny Meyer geb. Vorenberg (1880), Auguste Möllerich geb.
Gumbert (), Ludwig
Möllerich (1935), Martha Möllerich geb. Plaut (1909), Willi Möllerich (1893),
Emmy Neuhahn geb. Stein (1887), Frieda Neuhahn (1890), Moritz Neuhahn (1882), Dina Oberdorff
geb. Neuhahn (1890), Fritz Oberdorff (1890), Hildegard Petzal geb. Bieber (1898),
Flora Rosenbaum geb. Wertheim (1858), Max Rosenbaum (1882),
Antonie (Toni) Sassen geb. Katzenberg (1873), Emma Schnitzler geb. Katzenberg
(1878), Willi Vorenberg (1883), Frieda Weil geb. Rosenbaum (1889, von Köln
nach Lódz deportiert), Clara Wormser geb. Rosenbaum
(1884). |
| |
 Von
den in Holzhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Blumenthal geb.
Hammerschlag (1881),m Else Hammerschlag (1887), Jenny Hammerschlag
(1889), Julius Hammerschlag (1883), Meta Hammerschlag geb. Heilbrunn (1885), Richard Hammerschlag(1886), Sara Hammerschlag geb. Stern (1893),
Lieselotte (Liesel) Hammerschlag (1920), Alfred Hammerschlag (1893),
Siegmund Hammerschlag (1874). Von
den in Holzhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Bertha Blumenthal geb.
Hammerschlag (1881),m Else Hammerschlag (1887), Jenny Hammerschlag
(1889), Julius Hammerschlag (1883), Meta Hammerschlag geb. Heilbrunn (1885), Richard Hammerschlag(1886), Sara Hammerschlag geb. Stern (1893),
Lieselotte (Liesel) Hammerschlag (1920), Alfred Hammerschlag (1893),
Siegmund Hammerschlag (1874). |
| |
 Von
den in Immenhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lilli Jahn geb.
Schlüchterer (1900, siehe Literatur unten), Hedwig Uhlmann geb. Rosenbaum (1882). Von
den in Immenhausen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lilli Jahn geb.
Schlüchterer (1900, siehe Literatur unten), Hedwig Uhlmann geb. Rosenbaum (1882). |
Nach 1945 kehrten mehrere frühere jüdische Personen in die Stadt zurück
(Familie Wilhelm David). In den 1970er-Jahren war nur noch der jüdische
Textilkaufmann Erwin Machol in der Stadt (hatte 1949 das ehemalige Geschäft von
Bernhard Mandelstein übernommen und als Textilgeschäft geführt; gest. 1.
April 1980, beigesetzt im jüdischen Friedhof).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus
der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des
Religionslehrers, Vorbeters und Schochets (1911 / 1919)
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 7. September 1911: "Für die neu einzurichtende
israelitische Anzeige
in "Der Israelit" vom 7. September 1911: "Für die neu einzurichtende
israelitische
Privat-Elementarschule in Grebenstein
wird ein seminaristisch gebildeter
Lehrer gesucht, der zugleich Vorbeter sein muss und das Schächteramt
ausüben kann. Meldungen mit Zeugnisabschriften an das
Vorsteheramt der Israeliten zu Kassel." |
| |
 Anzeige
in der "Jüdischen Rundschau" vom 8. August 1919: "In der
Synagogen-Gemeinde Grebenstein (Bezirk Kassel) Anzeige
in der "Jüdischen Rundschau" vom 8. August 1919: "In der
Synagogen-Gemeinde Grebenstein (Bezirk Kassel)
soll die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schochets
alsbald besetzt werden. Festes Jahresgehalt 2000 Mk. Dem Stelleninhaber ist
eventuell Gelegenheit geboten, durch Erteilung des Religionsunterrichts und
Ausübung der Schechita in Nachbargemeinden sein Einkommen wesentlich zu
erhöhen. Bewerbungen sind zu richten an den Gemeindeältesten Voremberg." |
Die Entlassung des offenbar geisteskranken Lehrer Rosenhausel (Rosenhansel?)
wird bei der Regierung beantragt (1848)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 27. Juni 1848:
"Ein anderes, fast possierliches Stückchen ist Folgendes: Lehrer
Rosenhausel, ein sogenannter Freigeist, welcher früher in Jesberg,
später aber in Grebenstein Lehrer, Schochet und Vorbeter war,
welche Stellen er noch bekleidete, ist bei den Ständen mit den Bitte
eingekommen, 'da er schon so viele Jahre Lehrer auf dem Lande sei, und die
Händel der Jehudim genau kenne, wonach dieselben noch 10 Mal mehr
Verfolgungen verdienten als in der Tat über sie hereingebrochen seien,
ihn als 'geheimen Polizeiagenten' anzustellen, wodurch die
Kriminalbehörde Gelegenheit hätte, das Treiben der Jehudim am
Genauesten kennen zu lernen.' Der Ausschuss der Stände trug nach
Vorlesung dieser Eingabe an, da dieser Mensch entweder geisteskrank oder
im höchsten Grade demoralisiert sein müsse, in beiden Fällen aber
sich so wenig zum Lehrer und Jugenderzieher als zum Vorsänger eigne,
diesen Gesuch der Staatsregierung zu übergeben, mit der Bitte, die
sofortige Absetzung des Lehrers Rosenhausel von seinen bisherigen
Funktionen, anzuordnen." Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 27. Juni 1848:
"Ein anderes, fast possierliches Stückchen ist Folgendes: Lehrer
Rosenhausel, ein sogenannter Freigeist, welcher früher in Jesberg,
später aber in Grebenstein Lehrer, Schochet und Vorbeter war,
welche Stellen er noch bekleidete, ist bei den Ständen mit den Bitte
eingekommen, 'da er schon so viele Jahre Lehrer auf dem Lande sei, und die
Händel der Jehudim genau kenne, wonach dieselben noch 10 Mal mehr
Verfolgungen verdienten als in der Tat über sie hereingebrochen seien,
ihn als 'geheimen Polizeiagenten' anzustellen, wodurch die
Kriminalbehörde Gelegenheit hätte, das Treiben der Jehudim am
Genauesten kennen zu lernen.' Der Ausschuss der Stände trug nach
Vorlesung dieser Eingabe an, da dieser Mensch entweder geisteskrank oder
im höchsten Grade demoralisiert sein müsse, in beiden Fällen aber
sich so wenig zum Lehrer und Jugenderzieher als zum Vorsänger eigne,
diesen Gesuch der Staatsregierung zu übergeben, mit der Bitte, die
sofortige Absetzung des Lehrers Rosenhausel von seinen bisherigen
Funktionen, anzuordnen." |
Lehrer Heinemann Plaut geht in den Ruhestand - die
israelitische Schule wird aufgelöst (1911)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1911: Grebenstein, 27.
April (1911). Herr Lehrer H. Plaut trat am 1. April nach 33jährigem
Wirken am hiesigen Platze – vorher amtierte er schon an anderen Orten
– in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde die israelitische Schule mit
Genehmigung des Herrn Ministers aufgelöst." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Mai 1911: Grebenstein, 27.
April (1911). Herr Lehrer H. Plaut trat am 1. April nach 33jährigem
Wirken am hiesigen Platze – vorher amtierte er schon an anderen Orten
– in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde die israelitische Schule mit
Genehmigung des Herrn Ministers aufgelöst." |
Zum 85. Geburtstag von Lehrer L. Plaut (1927)
Anmerkung: bei Lehrer L. Plaut könnte es sich um einen älteren
Bruder von Lehrer Heinemann Plaut gehandelt haben, der jedoch vermutlich nicht
in Grebenstein unterrichtet hatte.
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1927: "Grebenstein,
28. Oktober (1927). Sein 85. Lebensjahr vollendete der pensionierte Lehrer
L. Plaut dahier in geistiger und körperlicher Frische." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1927: "Grebenstein,
28. Oktober (1927). Sein 85. Lebensjahr vollendete der pensionierte Lehrer
L. Plaut dahier in geistiger und körperlicher Frische." |
80. Geburtstag von Lehrer Heinemann Plaut - sowie
Goldene Hochzeit von ihm und seiner Frau Jeanette geb. Werthan (1925)
Anmerkung: genealogische Informationen siehe
https://www.geni.com/people/Heinemann-Plaut/6000000007948897798
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Grebenstein, 2. Mai (1925). In diesem Monat begeht der Nestor der jüdischen Lehrerschaft
Kurhessens, Herr Lehrer H. Plaut, der am 12. Oktober 80 Jahre alt geworden
ist, mit seiner Ehefrau, geb. Werthahn, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Beide sind gebürtig aus
Rotenburg a.d. Fulda und erfreuen sich
noch körperlicher Gesundheit und geistiger Frische." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Grebenstein, 2. Mai (1925). In diesem Monat begeht der Nestor der jüdischen Lehrerschaft
Kurhessens, Herr Lehrer H. Plaut, der am 12. Oktober 80 Jahre alt geworden
ist, mit seiner Ehefrau, geb. Werthahn, das seltene Fest der goldenen Hochzeit. Beide sind gebürtig aus
Rotenburg a.d. Fulda und erfreuen sich
noch körperlicher Gesundheit und geistiger Frische." |
77. Geburtstag der Lehrergattin Jeanette Plaut geb. Werthahn (1928)
Anmerkung: es handelt sich um die Frau von Lehrer Heinemann Plaut; genealogische
Informationen siehe
https://www.geni.com/people/Jeanette-Schönchen-Plaut/6000000003947095017.
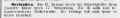 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 20. Januar 1928: "Grebenstein.
Am 13. Januar feierte die Lehrersgattin Frau Jeanette Plaut ihren 77.
Geburtstag. Sie ist noch von bewundernswerter Geistesfrische. Sie betätigt
sich noch heute in ihrem Haushalt." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 20. Januar 1928: "Grebenstein.
Am 13. Januar feierte die Lehrersgattin Frau Jeanette Plaut ihren 77.
Geburtstag. Sie ist noch von bewundernswerter Geistesfrische. Sie betätigt
sich noch heute in ihrem Haushalt." |
85. Geburtstag von Lehrer i.R. Heinemann Plaut (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928: "Grebenstein,
8. Oktober (1928). Am 12. Oktober feierte Lehrer Plaut i.R. seinen 85.
Geburtstag in größter Rüstigkeit und Geistesfrische. Am 1. Oktober
waren 50 Jahre verflossen, dass er als junger Lehrer hierher
kam." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928: "Grebenstein,
8. Oktober (1928). Am 12. Oktober feierte Lehrer Plaut i.R. seinen 85.
Geburtstag in größter Rüstigkeit und Geistesfrische. Am 1. Oktober
waren 50 Jahre verflossen, dass er als junger Lehrer hierher
kam." |
Zum Tod von Lehrer Heinemann Plaut (1929)
Anmerkung: Genealogische Informationen zu Heinemann Plaut siehe
https://www.geni.com/people/Heinemann-Plaut/6000000007948897798
Zu Dr. Karl Rosenthal siehe
http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=2515.
Bei dem genannten Ortspfarrer Uffelmann handelt es sich um den
evangelischen Pfarrer Rudolf Uffelmann (1873 Trendelburg - 1948 Grebenstein),
der von 1905 bis 1937 2. Pfarrer in Grebenstein und Burguffeln war.
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. März 1929: "Grebenstein (Persönliches). Hier
wurde der im Ruhestand lebende Lehrer H. Plaut, der im 85. Lebensjahr nach
längerer Krankheit verschied, unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise
zu Grabe geleitet. vier Jahrzehnte hat der Verewigte das Amt des Lehrers
und Kantors mit seltener Pflichttreue und ersprießlichen Erfolgen
bekleidet. Sein bescheidenes Wesen, seine Friedfertigkeit und Hilfsbereitschaft
haben ihm überall Freude erworben. Dies bezeugte die rege Beteiligung an
der Trauerfeier, die in der Synagoge stattfand." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"
vom 15. März 1929: "Grebenstein (Persönliches). Hier
wurde der im Ruhestand lebende Lehrer H. Plaut, der im 85. Lebensjahr nach
längerer Krankheit verschied, unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise
zu Grabe geleitet. vier Jahrzehnte hat der Verewigte das Amt des Lehrers
und Kantors mit seltener Pflichttreue und ersprießlichen Erfolgen
bekleidet. Sein bescheidenes Wesen, seine Friedfertigkeit und Hilfsbereitschaft
haben ihm überall Freude erworben. Dies bezeugte die rege Beteiligung an
der Trauerfeier, die in der Synagoge stattfand." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. März 1929: "Grebenstein.
Beerdigung des Lehrers Heinemann Plaut in Grebenstein. Es ist für den
Berichterstatter eine schwere Aufgabe, über das Begräbnis des Seniors der
jüdischen Lehrerschaft unserer Provinz zu berichten. Gar zu viel stürmte auf
alle Teilnehmer ein, als sie von dem inhaltsreichen Leben und der
Persönlichkeit des Verstorbenen in der Synagoge so herrliche Worte hörten,
und jeder Anwesende hatte das Gefühl, dass alle Worte aus dem Herzen kamen
und zu Herzen gingen. Das schöne Gotteshaus konnte die Trauergemeinde nicht
fassen; wir sahen die Vertreter des Magistrats, der Kreislehrerschaft, der
Gemeinden aus der Umgegend und viele andere Persönlichkeiten aus der Ferne,
die ihrem früheren Lehrer das letzte Geleit geben wollten. In
längerer, Inhaltsreicher Rede schilderte Lehrer (Herbold) Löwenstein aus
Meimbressen die Verdienste Plauts um
seine Gemeinde und das Gesamtjudentum, als Bürger, Führer der Lehrerschaft
und für seine Familie. Nach ihm betrat Dr. Karl Rosenthal, ein Neffe
des Verstorbenen und Prediger an der jüdischen Reformgemeinde in Berlin, die
Kanzel und dankte seinem Onkel für die ihm geschenkte Fürsorge, wie er die
Keime echten religiösen Lebens in ihm gepflanzt und für sein Fortkommen im
Leben gesorgt hatte. Waren die Herzen der Trauergemeinde durch Rosenthals
beredte Ausführungen schon erhoben, wurden sie es noch in erhöhtem Maße, als
der Ortspfarrer Uffelmann die Kanzel der Synagoge betrat und das
langjährige amtliche und persönliche Verhältnis zwischen ihm und Heinemann
Plaut schilderte. Diese Rede hatte reinste Humanität als Inhalt. Wie wirkte
es doch, als der Pfarrer den Anwesenden zurief: 'wir wollen nicht fragen,
was du bist, welcher Religion oder politischen Partei gehörst du an,
sondern nur, wie bist du!' So etwas hat man wohl selten in einer
Synagoge von einem Pfarrer gehört. Lehrer Nagel aus Kassel sprach den
Dank der freien Vereinigung jüdischer Lehrer bis Regierungsbezirks aus.
Kantor Horwitz umrahmte die Feier mit zwei hebräischen Gesängen. Vor drei
Jahren konnte Plaut noch seine Goldene Hochzeit feiern. Alt und lebenssatt
schied er im 85. Lebensjahre von uns. L. Hz." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. März 1929: "Grebenstein.
Beerdigung des Lehrers Heinemann Plaut in Grebenstein. Es ist für den
Berichterstatter eine schwere Aufgabe, über das Begräbnis des Seniors der
jüdischen Lehrerschaft unserer Provinz zu berichten. Gar zu viel stürmte auf
alle Teilnehmer ein, als sie von dem inhaltsreichen Leben und der
Persönlichkeit des Verstorbenen in der Synagoge so herrliche Worte hörten,
und jeder Anwesende hatte das Gefühl, dass alle Worte aus dem Herzen kamen
und zu Herzen gingen. Das schöne Gotteshaus konnte die Trauergemeinde nicht
fassen; wir sahen die Vertreter des Magistrats, der Kreislehrerschaft, der
Gemeinden aus der Umgegend und viele andere Persönlichkeiten aus der Ferne,
die ihrem früheren Lehrer das letzte Geleit geben wollten. In
längerer, Inhaltsreicher Rede schilderte Lehrer (Herbold) Löwenstein aus
Meimbressen die Verdienste Plauts um
seine Gemeinde und das Gesamtjudentum, als Bürger, Führer der Lehrerschaft
und für seine Familie. Nach ihm betrat Dr. Karl Rosenthal, ein Neffe
des Verstorbenen und Prediger an der jüdischen Reformgemeinde in Berlin, die
Kanzel und dankte seinem Onkel für die ihm geschenkte Fürsorge, wie er die
Keime echten religiösen Lebens in ihm gepflanzt und für sein Fortkommen im
Leben gesorgt hatte. Waren die Herzen der Trauergemeinde durch Rosenthals
beredte Ausführungen schon erhoben, wurden sie es noch in erhöhtem Maße, als
der Ortspfarrer Uffelmann die Kanzel der Synagoge betrat und das
langjährige amtliche und persönliche Verhältnis zwischen ihm und Heinemann
Plaut schilderte. Diese Rede hatte reinste Humanität als Inhalt. Wie wirkte
es doch, als der Pfarrer den Anwesenden zurief: 'wir wollen nicht fragen,
was du bist, welcher Religion oder politischen Partei gehörst du an,
sondern nur, wie bist du!' So etwas hat man wohl selten in einer
Synagoge von einem Pfarrer gehört. Lehrer Nagel aus Kassel sprach den
Dank der freien Vereinigung jüdischer Lehrer bis Regierungsbezirks aus.
Kantor Horwitz umrahmte die Feier mit zwei hebräischen Gesängen. Vor drei
Jahren konnte Plaut noch seine Goldene Hochzeit feiern. Alt und lebenssatt
schied er im 85. Lebensjahre von uns. L. Hz." |
Zum Tod von Lehrer Meier Rothschild
(1930)
Anmerkung: genealogische Informationen siehe
https://www.geni.com/people/Meier-Rothschild/6000000082722988108. Demnach
ist Meier Rothschild am 9. Mai 1861 in
Zimmersrode geboren als Sohn von Simon Rothschilde und der Gelle (Karoline)
geb. Blumenfeld. Er war verheiratet mit Bertha (Baechen) geb. Lorge (1863
Harmuthsachsen - 1931 Kassel).
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. August 1930: "Grebenstein.
Lehrer Rothschild wurde gestern hier bestattet. Ein zahlreiches Gefolge,
besonders aus Kassel, wie viele Amtsgenossen begleitete ihn zur Grabstätte.
Landrabbiner Dr. Walter schilderte unter Bezugnahme auf ein Prophetenwort
Rothschilds Leben und Wirken. Den guten Gatten, den treusorgenden Vater und
Lehrer. - Der Vorsitzende des Kreislehrervereins Grebenstein-Hofgeismar,
dankte dem Verstorbenen für die warme Anteilnahme an allen
Vereinsbestrebungen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. August 1930: "Grebenstein.
Lehrer Rothschild wurde gestern hier bestattet. Ein zahlreiches Gefolge,
besonders aus Kassel, wie viele Amtsgenossen begleitete ihn zur Grabstätte.
Landrabbiner Dr. Walter schilderte unter Bezugnahme auf ein Prophetenwort
Rothschilds Leben und Wirken. Den guten Gatten, den treusorgenden Vater und
Lehrer. - Der Vorsitzende des Kreislehrervereins Grebenstein-Hofgeismar,
dankte dem Verstorbenen für die warme Anteilnahme an allen
Vereinsbestrebungen." |
| |
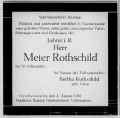 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. März 1930: "Statt
besonderer
Anzeige. Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. März 1930: "Statt
besonderer
Anzeige.
Plötzlich und unerwartet entschlief in Geestemünde mein geliebter Mann,
unser guter, treusorgender Vater, Schwiegervater und Großvater, der
Lehrer i.R. Herr Meier Rothschild im 70. Lebensjahr.
Im Namen der Tieftrauernden: Berta Rothschild geb. Lorge.
Grebenstein, den 4. August 1930. Frankfurt, Kassel, Geestemünde, Volkmarsen" |
Aus dem
jüdischen Gemeindeleben
Die Zeitschrift "Der Israelit" berichtet über
eine Auseinandersetzung zwischen dem Provinzialvorsteheramt Kassel und
Gemeindegliedern in Grebenstein (März 1878)
Anmerkung:
Die nachstehenden Berichte aus dem Jahr 1878 beschäftigen sich mit einem
Streit, der zwischen den beiden Gemeindevorstehern in Grebenstein ausgebrochen
war und in kurzer Zeit eskalierte, zumal verschiedene Behörden und
Einrichtungen in den Streit hineingezogen wurden. Die Dokumente zu diesem Streit werden
hier wiedergegeben, da eine Vielzahl von darin angegebenen Einzelheiten
Informationen enthalten: über das jüdische Gemeindeleben, über das
Eingebundensein in die damaligen Verwaltungsstrukturen wie über
Entscheidungskompetenzen, über einzelne Sitten und Gebräuche im
gottesdienstlichen Leben, über die Situation der jüdischen Schule in
Grebenstein u.a.m.. Als Einführung
in die gesamte Problematik empfiehlt sich, zunächst den Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878 (siehe Bericht unten)
zu lesen.
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1878: "Aus Hessen.
In unserer Provinz werden bekanntlich die Angelegenheiten der jüdischen
Gemeinden durch besondere Behörden verwaltet, die Israelitischen
Provinzialvorsteherämter. Die Organisierung dieser Ämter gründet sich
auf ein veraltetes, aus verflossenen kurfürstlichen Zeiten und
Anschauungen stammendes Gesetz von Jahre 1823. – Ein großer Teil dieses
Gesetzes ist durch neuere gesetzliche Bestimmung faktisch aufgehoben, die
Vorsteherämter aber existieren noch weiter. – Es soll nun nicht in
Abrede gestellt werden, dass eine derartige Behörde unter Umständen ganz
segensreich wirken kann, tatsächlich aber muss sie oft mit den billigsten
Forderungen der Neuzeit, welche überall auf das freie
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden dringt, in Widerspruch geraten. Dazu
kömmt noch, dass bei der tiefen Kluft, welche die Bekenner des
gesetzestreuen Judentums, von den Reformjuden trennt, der Zwang einer Behörde,
die der einen oder anderen Richtung ausschließlich angehört, doppelt drückend
empfunden wird. – Am ausgeprägtesten tritt dieser Missstand bei dem
Provinzialvorsteheramt zutage, welches in Kassel seinen Sitz hat. – Die
religiöse Richtung seiner Mitglieder ist genügend gekennzeichnet, wenn
man weiß, dass Herr Landrabbiner Dr. Adler den Vorsitz hat, und dass
ebenso sämtliche übrigen Mitglieder derselben Richtung angehören. Die jüdischen
Landgemeinden der Provinz gehören der großen Mehrzahl nach, dem
gesetzestreuen Judentum an. Das Vorsteheramt, welches die Ältesten dieser
Gemeinden ernennt und absetzt, Religionslehrer bestellt und die religiösen
Institutionen überwacht, muss, selbst wenn es bestrebt ist, bona fide zu
handeln, oft die Autonomie der Gemeinden verletzende Missgriffe tun. Dazu
kommt, dass die niederhessischen Gemeinden, das Bewusststein ein
derartiges Vorsteheramt zu besitzen,
noch mit ihrem Gelde durch eine besondere Provinzialsteuer, bezahlen müssen,
ein Umstand, der jedenfalls nicht geeignet ist, die Begeisterung für
dieses Institut zu erhöhen. Schon vor mehreren Jahren traten die
einzelnen Landgemeinden zusammen, um über Mittel und Wege zu beraten, die
sie am sichersten und leichtesten von dieser lästigen, ein freies
Gemeindeleben im Keime erstickenden Obervormundschaft befreiten. Doch
hatten diese Bestrebungen damals keinen greifbaren Erfolg. Seit dem
Inkrafttreten des Austrittsgesetzes, wurde die Eventualität eines
Ausscheiden aus dem Gemeinde-, respektive Provinzialverbande wiederholt
von einzelnen Landgemeinden ins Auge gefasst, und dieser Tage erklärte
ein Teil der Gemeinde Grebenstein,
offiziell seinen Austritt. Die Ausgetretenen haben bereits ein eigenes
Lokal für ihren Gottesdienst, und werden demnächst auch einen Lehrer
berufen, sowie die übrigen Institutionen beschaffen. Bei der
Unbeliebtheit des Vorsteheramtes besonders bei den Landgemeinden, bei der
Sympathie, welche diese Austrittserklärung in der ganzen Gegend als das
einziger Mittel findet, um diesen widernatürlichen, kostspieligen Zwang
zu brechen,
steht sicher zu erwarten, dass dieses Beispiel schon in allernächster
Zeit, vielfache Nachahmung finden wird. F.K." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. März 1878: "Aus Hessen.
In unserer Provinz werden bekanntlich die Angelegenheiten der jüdischen
Gemeinden durch besondere Behörden verwaltet, die Israelitischen
Provinzialvorsteherämter. Die Organisierung dieser Ämter gründet sich
auf ein veraltetes, aus verflossenen kurfürstlichen Zeiten und
Anschauungen stammendes Gesetz von Jahre 1823. – Ein großer Teil dieses
Gesetzes ist durch neuere gesetzliche Bestimmung faktisch aufgehoben, die
Vorsteherämter aber existieren noch weiter. – Es soll nun nicht in
Abrede gestellt werden, dass eine derartige Behörde unter Umständen ganz
segensreich wirken kann, tatsächlich aber muss sie oft mit den billigsten
Forderungen der Neuzeit, welche überall auf das freie
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden dringt, in Widerspruch geraten. Dazu
kömmt noch, dass bei der tiefen Kluft, welche die Bekenner des
gesetzestreuen Judentums, von den Reformjuden trennt, der Zwang einer Behörde,
die der einen oder anderen Richtung ausschließlich angehört, doppelt drückend
empfunden wird. – Am ausgeprägtesten tritt dieser Missstand bei dem
Provinzialvorsteheramt zutage, welches in Kassel seinen Sitz hat. – Die
religiöse Richtung seiner Mitglieder ist genügend gekennzeichnet, wenn
man weiß, dass Herr Landrabbiner Dr. Adler den Vorsitz hat, und dass
ebenso sämtliche übrigen Mitglieder derselben Richtung angehören. Die jüdischen
Landgemeinden der Provinz gehören der großen Mehrzahl nach, dem
gesetzestreuen Judentum an. Das Vorsteheramt, welches die Ältesten dieser
Gemeinden ernennt und absetzt, Religionslehrer bestellt und die religiösen
Institutionen überwacht, muss, selbst wenn es bestrebt ist, bona fide zu
handeln, oft die Autonomie der Gemeinden verletzende Missgriffe tun. Dazu
kommt, dass die niederhessischen Gemeinden, das Bewusststein ein
derartiges Vorsteheramt zu besitzen,
noch mit ihrem Gelde durch eine besondere Provinzialsteuer, bezahlen müssen,
ein Umstand, der jedenfalls nicht geeignet ist, die Begeisterung für
dieses Institut zu erhöhen. Schon vor mehreren Jahren traten die
einzelnen Landgemeinden zusammen, um über Mittel und Wege zu beraten, die
sie am sichersten und leichtesten von dieser lästigen, ein freies
Gemeindeleben im Keime erstickenden Obervormundschaft befreiten. Doch
hatten diese Bestrebungen damals keinen greifbaren Erfolg. Seit dem
Inkrafttreten des Austrittsgesetzes, wurde die Eventualität eines
Ausscheiden aus dem Gemeinde-, respektive Provinzialverbande wiederholt
von einzelnen Landgemeinden ins Auge gefasst, und dieser Tage erklärte
ein Teil der Gemeinde Grebenstein,
offiziell seinen Austritt. Die Ausgetretenen haben bereits ein eigenes
Lokal für ihren Gottesdienst, und werden demnächst auch einen Lehrer
berufen, sowie die übrigen Institutionen beschaffen. Bei der
Unbeliebtheit des Vorsteheramtes besonders bei den Landgemeinden, bei der
Sympathie, welche diese Austrittserklärung in der ganzen Gegend als das
einziger Mittel findet, um diesen widernatürlichen, kostspieligen Zwang
zu brechen,
steht sicher zu erwarten, dass dieses Beispiel schon in allernächster
Zeit, vielfache Nachahmung finden wird. F.K." |
Stellungnahme zu den Auseinandersetzungen von Seiten
des Provinzial-Vorsteheramtes in Kassel (April 1878)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1878: "Kassel, 8.
April (1878). Die Korrespondenz 'Aus Kurhessen' in Nr. 13 dieser
Zeitschrift wegen des Austritts von Mitgliedern der Synagogengemeinde
Grebenstein veranlasst uns zu nachstehender Berichtigung: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. April 1878: "Kassel, 8.
April (1878). Die Korrespondenz 'Aus Kurhessen' in Nr. 13 dieser
Zeitschrift wegen des Austritts von Mitgliedern der Synagogengemeinde
Grebenstein veranlasst uns zu nachstehender Berichtigung:
1. Wir haben, im Einverständnis mit den staatlichen Aufsichtsbehörden,
einen Ältesten der Synagogengemeinde Grebenstein wegen fortwährender
Konflikte mit dem Kreisvorsteher und Mitgliedern der Gemeinde entlassen müssen,
obschon nicht zu bezweifeln war, derselbe werde nach verfügter
Entlassung, in Gemäßheit der desfallsigen mündlichen Drohung, nebst
einigen Anhängern aus der Gemeinde austreten. Diese Drohung konnte umso
weniger berücksichtigt werden, als überdies auf Anregung des Gemeindeältesten,
welcher der Höchstbesteuerte ist und schulpflichtige Kinder nicht mehr
hat, die Gemeinde, wenngleich mit nur einigen Stimmen Majorität,
beschlossen hatte, die seit dem Jahre 1831 bestehende, dermalen erledigte
Schulstelle eingehen zu lassen und die schulpflichtigen Kinder in Folge
dessen schon seit längerer Zeit ohne Unterricht in Religion und im Hebräischen
sind. Nachdem die betreffenden Personen nunmehr ausgetreten, wird die
Schulstelle voraussichtlich alsbald wieder besetzt werden.
2. Die Würdigung der die Wirksamkeit des Landrabbinern Herrn Dr. Adler
betreffenden Bemerkung ergibt sich aus dem vom entlassenen Gemeindeältesten
und anderen Mitgliedern der Gemeinde Grebenstein am 20. Mai vorigen Jahres
gelegentlich des 25jährigen Dienstjubiläums desselben an Herrn Dr. Adler
gerichteten Gratulations- und Anerkennungsschreiben, dessen Inhalt mit der
betreffenden Bemerkung im direkten Widerspruch steht.
|
 Dasselbe
lautet: 'Am heutigen Tage, an welchem Euer Hochwürden mit froher
Genugtuung und stolzem Bewusstsein auf die Früchte eines segensreichen
25jährigen Wirkens in einem so verantwortlichen, aber ehrenvollen Beruf
herabblicken, zu dessen Feier aus allen Gegenden der Provinz und weit darüber
hinaus Glückwünsche und Adressen einlaufen werden, sei es auch uns vergönnt,
Ihnen zu ihrem 25jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche
darzubringen und durch folgendes kleine Gedenk unsere Verehrung für Sie
Ausdruck zu geben. Möge es Ihnen beschieden sein, auch gerner Ihrem Amte
mit aller bisherigen Willenskraft und Ausdauer obzuliegen und Ihr 50jähriges
Jubiläum in gleicher Frische und Gesundheit zu feiern." Dasselbe
lautet: 'Am heutigen Tage, an welchem Euer Hochwürden mit froher
Genugtuung und stolzem Bewusstsein auf die Früchte eines segensreichen
25jährigen Wirkens in einem so verantwortlichen, aber ehrenvollen Beruf
herabblicken, zu dessen Feier aus allen Gegenden der Provinz und weit darüber
hinaus Glückwünsche und Adressen einlaufen werden, sei es auch uns vergönnt,
Ihnen zu ihrem 25jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Glückwünsche
darzubringen und durch folgendes kleine Gedenk unsere Verehrung für Sie
Ausdruck zu geben. Möge es Ihnen beschieden sein, auch gerner Ihrem Amte
mit aller bisherigen Willenskraft und Ausdauer obzuliegen und Ihr 50jähriges
Jubiläum in gleicher Frische und Gesundheit zu feiern."
3. Den Kultus betreffende Anordnungen erlassen wir nicht nach eigenem
Ermessen, sondern auf Grund von Gutachten des Provinzial-Rabbinen bzw. des
Landrabbinats, bestehend aus dem Landrabbinen und den Provinzial-Rabbinen
zu Marburg, Fulda und Hanau.
4. An die Provinzial-Kasse, aus welcher die Kosten der hiesigen
Lehrerbildungsanstalt, die nach dem diesjährigen Voranschlag 'fünftausend
Mark' betragenden Zuschüsse zu den Kosten der israelitischen Schulen
unseres Bezirks, die Ausgaben für die Schulvisitationen des Herrn Landrabbinen, dessen Gehalt als Provinzial- und Landrabbiner usw.
bestritten werden, zahlt die Synagogengemeinde Grebenstein nach Maßgabe
der Steuerrollen pro 1876/78 jährlich 124 Mark 75 Pfg., erhält dagegen
aus derselben, wenn die Schulstelle besetzt ist, als Beitrag zum
Lehrergehalt jährlich 100 Mark. Die Leistung der Gemeinde an die
Provinzialkasse beträgt daher nur 24 Mark 75 Pfennig mehr als diejenige
der letzteren an die Gemeinde.
Derartige Ergebnisse werden nur dadurch ermöglicht, dass auf eine Anzahl
größere Synagogengemeinden, welche Leistungen zu ihren speziellen
Gunsten nicht bedürfen, der bei weitem bedeutendste Teil der
Provinzial-Abgaben entfällt. (Die Synagogengemeinde Kassel allein zahlt
mehr als die Hälfte.) Die kleineren Synagogengemeinden erhalten je nach
bedarf und Tunlichkeit Subventionen zu den Kosten ihrer Schulen, welche
nicht selten deren Provinzial-Steuern nicht nur ausgleichen, sondern
solche um mehr als das Vierfache und Fünffache übersteigen. Der bei
weitem größte Teil wird in dieser Weise subventioniert und hierdurch
allein zur Erhaltung der Schulen in den Stand gesetzt, weshalb der
Provinzialverband in finanzieller Beziehung denselben nicht zum Nachteil,
sondern im Gegenteil zum entschiedensten Vorteil gereicht.
Bei Aufhebung desselben würden die betreffenden Gemeinden aber nicht nur
ohne Schulen, sondern weil in der Regel die Lehrer allein zum ordnungsgemäßen
Vorbeten befähigt sind, in sehr vielen Fällen auch ohne würdigen und
erhebenden Gottesdienst sein und überdies die schulpflichtigen Kinder den
Unterricht in Religion und im Hebräischen entbehren müssen.
Nach im Jahre 1876 erfolgter Mitteilung Königlicher Staatsregierung an
den Landtag hat das Institut der Provinzial-Vorsteherämter sich vollständig
bewährt und sind auch aus anderen Provinzen Gesuche um Errichtung von
solchen eingegangen.
5. Die Ausgaben der diesseitigen Gemeinden und der Provinzial-Kasse
betreffen zum bei Weitem größten Teil diejenigen Etat-Positionen, zu
welchen die Ausgetretenen nach wie vor dauernd beizutragen gesetzlich
verpflichtet sind. Ob der Inhalt der Korrespondenz auf Mangel an
Sachkenntnis oder auf tendenziöser Absicht beruht, lassen wir dahin
gestellt. Vorsteheramt der Israeliten. Büding." |
Stellungnahme aus der Sicht des entlassenen
Gemeindevorstehers Rosenbaum (Mai 1878)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Grebenstein
(Provinz Hessen). Der 'Israelit' brachte in Nr. 13 einen Bericht über
Vorgänge in der hiesigen Gemeinde, und in Nr. 16 und 17 eine sich
Berichtigung nennende Darstellung seitens des Kasseler Vorsteheramtes.
Dieser letzteren Darstellung gegenüber drängt es mich, die bedauerlichen
Vorgänge innerhalb unserer Gemeinde und die Motive meines und meiner
Gesinnungsgenossen Austritts in aller Kürze der Wahrheit gemäß der
Beurteilung der jüdischen öffentlichen Meinung zu unterbreiten. Die
hiesige, aus ungefähr 20 Familien bestehende Gemeinde, als deren Gemeindeältester
ich 17 Jahre lang fungierte, lebte stets in Frieden und Eintracht. Das
gute Einvernehmen wurde erst gestört durch ein vor wenigen Jahren hierher
verzogenes Gemeindemitglied, das den Keim zu allen Zwistigkeiten dadurch
legte, dass es eine Änderung des Gebrauchs verlangte, nach welchem bis
jetzt zur Tora aufgerufen wurde. Um seine Pläne durchzusetzen, wandte das
Mitglied alle Mittel an, um Gemeindeältester zu werden. Da das Gesetz vom
Jahre 1823 die hessischen Gemeinden mundtot macht, und die Wahl der
Gemeindeältesten nicht der Gemeinde, sondern dem Kreisvorsteher zusteht,
so braucht ein Gemeindeältester in erster Reihe nicht das Vertrauen der
Gemeinde, sondern nur dasjenige des Kreisvorstehers zu besitzen. Jede
Gemeinde kann jeden Tag gewärtig sein, von dem Vorsteheramte die
Mitteilung zu erhalten, auf Vorschlag des Kreisvorstehers sei von nun an
Herr N.N. Ältester der Gemeinde. So erfuhr die Gemeinde ganz zufällig,
dass das oben genannte Mitglied vom Kreisvorsteher als zweiter Gemeindeältester
in Vorschlag gebracht sei. Fast die ganze Gemeinde erhob sich gegen diese
gewaltsame Aufoktroyierung. Eine Deputation der Gemeinde veranlasste den
Präsidenten des Vorsteheramtes, Herrn, Dr. Adler, hierher zu kommen und
einer ad hoc berufenen Gemeindeversammlung beizuwohnen. In dieser
Versammlung, welcher auch unser in Hofgeismar domizilierter Kreisvorsteher
beiwohnte, erklärte Herr Dr. Adler, dass er sich überzeugt habe, das vom
Kreisvorsteher vorgeschlagene Mitglied könne und dürfe kein Gemeindeältester
werden. Wir waren durch die Versprechungen des Herrn Landrabbiners
beruhigt und betrachteten die Angelegenheit als erledigt. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Grebenstein
(Provinz Hessen). Der 'Israelit' brachte in Nr. 13 einen Bericht über
Vorgänge in der hiesigen Gemeinde, und in Nr. 16 und 17 eine sich
Berichtigung nennende Darstellung seitens des Kasseler Vorsteheramtes.
Dieser letzteren Darstellung gegenüber drängt es mich, die bedauerlichen
Vorgänge innerhalb unserer Gemeinde und die Motive meines und meiner
Gesinnungsgenossen Austritts in aller Kürze der Wahrheit gemäß der
Beurteilung der jüdischen öffentlichen Meinung zu unterbreiten. Die
hiesige, aus ungefähr 20 Familien bestehende Gemeinde, als deren Gemeindeältester
ich 17 Jahre lang fungierte, lebte stets in Frieden und Eintracht. Das
gute Einvernehmen wurde erst gestört durch ein vor wenigen Jahren hierher
verzogenes Gemeindemitglied, das den Keim zu allen Zwistigkeiten dadurch
legte, dass es eine Änderung des Gebrauchs verlangte, nach welchem bis
jetzt zur Tora aufgerufen wurde. Um seine Pläne durchzusetzen, wandte das
Mitglied alle Mittel an, um Gemeindeältester zu werden. Da das Gesetz vom
Jahre 1823 die hessischen Gemeinden mundtot macht, und die Wahl der
Gemeindeältesten nicht der Gemeinde, sondern dem Kreisvorsteher zusteht,
so braucht ein Gemeindeältester in erster Reihe nicht das Vertrauen der
Gemeinde, sondern nur dasjenige des Kreisvorstehers zu besitzen. Jede
Gemeinde kann jeden Tag gewärtig sein, von dem Vorsteheramte die
Mitteilung zu erhalten, auf Vorschlag des Kreisvorstehers sei von nun an
Herr N.N. Ältester der Gemeinde. So erfuhr die Gemeinde ganz zufällig,
dass das oben genannte Mitglied vom Kreisvorsteher als zweiter Gemeindeältester
in Vorschlag gebracht sei. Fast die ganze Gemeinde erhob sich gegen diese
gewaltsame Aufoktroyierung. Eine Deputation der Gemeinde veranlasste den
Präsidenten des Vorsteheramtes, Herrn, Dr. Adler, hierher zu kommen und
einer ad hoc berufenen Gemeindeversammlung beizuwohnen. In dieser
Versammlung, welcher auch unser in Hofgeismar domizilierter Kreisvorsteher
beiwohnte, erklärte Herr Dr. Adler, dass er sich überzeugt habe, das vom
Kreisvorsteher vorgeschlagene Mitglied könne und dürfe kein Gemeindeältester
werden. Wir waren durch die Versprechungen des Herrn Landrabbiners
beruhigt und betrachteten die Angelegenheit als erledigt.
Nur wenige Wochen waren seitdem verflossen, als wir hörten, dass auf
wiederholten Antrag des Kreisvorstehers das Vorsteheramt in seiner nächsten
Sitzung den von seinem Präsidenten als unmöglich erklärten Gemeindeältesten
installieren wolle. Der Unterstützung der staatlichen Behörden hatten
wir es ausschließlich zu verdanken, dass auch dieses Mal der Plan unseres
Kreisvorstehers und seines Schützlings vereitelt wurde. – Woher die
Sympathien unseres Kreisvorstehers für das betreffende Gemeindemitglied
datieren, kann hier unerörtert bleiben, sowie dasjenige, was die
Volksstimme darüber urteilt. Es soll
hier nur hervorgehoben werden, dass der Kreisvorsteher öffentlich den
Sabbat entweiht, die Speisegesetze übertritt, nur ganz wenige Male im
Laufe des Jahres die Synagoge besucht etc. Das genügt zur richtigen Würdigung
unserer jüdischen Verhältnisse, die durch solche Hände geleitet und
geschützt werden sollen.
Die Willkür, mit welcher unsere religionsgesetzlichen Vorschriften
gehandhabt werden, mag durch folgendes Faktum dargelegt werden. Der
Kreisvorsteher verbietet uns – angeblich im Namen des Vorsteheramtes –
die Haftora von demjenigen sagen zu lassen, der zu Maftir aufgerufen wird,
und dekretiert ein Monopol auf das Vorlesen der Haftora, dessen einziger
Inhaber der zeitweilige Lehrer und Vorbeter ist. Als derselbe über
Samstag verreist war, kam es in Folge dessen vor, dass die Haftora gar
nicht gesagt wurde. Als Gemeindeältester war ich selbstverständlich
verpflichtet, solche irreligiöse Willkürlichkeiten zur Ausführung zu
bringen; über die Schwierigkeiten und schikanösen Nörgeleien, die mir
dabei gemacht wurden, habe ich einen ganzen Stoß amtlicher Korrespondenz,
durch deren Veröffentlichung unsere religiösen Zustände, wie kaum
sonst, treffend charakterisiert würden. Wiederholt erhielt ich ohne jede
begründete Veranlassung Strafandrohungen, falls ich die Vorschriften
meiner vorgesetzten Behörde nicht zu Ausführung brächte, wiederholt bat
ich um detaillierte Aufzählung dessen, was ich eigentlich begangen, und
um eine Gelegenheit, mich verantworten zu können. Ich erhielt nicht
einmal eine Antwort.
So sehr mir auch auf diese Weise mein Amt als Gemeindeältester verleidet
wurde, so hielt ich es dennoch für heilige Pflicht, in demselben so lange
auszuharren, bis ich desselben entsetzt wurde. Da ich aber mit größter
Vorsicht bedacht war, mir keine Pflichtverletzung zuschulden kommen zu
lassen, so schien eine solche Absetzung unmöglich. Inzwischen nahmen die
Agitationen gegen mich und meine Amtsführung einen immer schärferen
Charakter an. Da ein Teil der hiesigen Gemeinde aus armen Mitgliedern
besteht, so gelang es, dieselben im laufe der Zeit in eine Opposition zu
drängen, welche eine tiefe Spaltung unserer |
 kleinen
Gemeinde zur Folge hatte. Wenn ich erwähne, dass, wenn einer meiner
Gesinnungsgenossen vorbetete, nicht einmal mehr baruch hu ubaruch schmo ('gepriesen sei ER und gepriesen sein
Name') und Amen erwidert
wurde, so kann man aus diesem einen Faktum die Schärfe folgern, zu
welcher sich der Konflikt zugespitzt hatte. Es blieb uns, da mehrere
versuchte Vermittlungsvorschläge erfolglose geblieben waren, nichts übrig
als die bestehende Spaltung durch eine faktische Trennung erträglich zu
machen. Schon hatten wir die nötigen vorbereitenden Schritte dazu getan,
als durch meine vom Vorsteheramt verfügte Entlassung die letzte Rücksicht
gefallen war, welche meine Gesinnungsgenossen bis jetzt noch zum Verbleib
in der Gemeinde bestimmte. Die religiösen Bedenken, die jeden Juden erfüllen,
wenn er seine heiligsten Anliegen Behörden überantwortet weiß, deren
einzelne Mitglieder mit dem positiven Judentum grundsätzlich mehr oder
weniger entschieden gebrochen haben, diese religiösen Bedenken erreichten
für uns ihren höchsten Grad durch die Installierung eines Gemeindeältesten,
welcher der ausgesprochene Protegé eben dieser Behörden ist. Diese
religiösen Bedenken hatten unsere Austrittserklärung zur Folge. Obwohl
wir keinen Augenblick die Bedeutsamkeit und die Tragweite unseres
Schrittes unterschätzten, obwohl wir wussten, welche pekuniären Opfer
diese Konsequenz unserer religiösen Bedenken uns auferlegt, obwohl wir
endlich auch nicht darüber im Zweifel waren, dass unser Vorgehen verdächtigt,
unsere wahren Motive entstellt und uns unlautere insinuiert würden; - wir
könnten nicht anders handeln, als wir eben handelten. kleinen
Gemeinde zur Folge hatte. Wenn ich erwähne, dass, wenn einer meiner
Gesinnungsgenossen vorbetete, nicht einmal mehr baruch hu ubaruch schmo ('gepriesen sei ER und gepriesen sein
Name') und Amen erwidert
wurde, so kann man aus diesem einen Faktum die Schärfe folgern, zu
welcher sich der Konflikt zugespitzt hatte. Es blieb uns, da mehrere
versuchte Vermittlungsvorschläge erfolglose geblieben waren, nichts übrig
als die bestehende Spaltung durch eine faktische Trennung erträglich zu
machen. Schon hatten wir die nötigen vorbereitenden Schritte dazu getan,
als durch meine vom Vorsteheramt verfügte Entlassung die letzte Rücksicht
gefallen war, welche meine Gesinnungsgenossen bis jetzt noch zum Verbleib
in der Gemeinde bestimmte. Die religiösen Bedenken, die jeden Juden erfüllen,
wenn er seine heiligsten Anliegen Behörden überantwortet weiß, deren
einzelne Mitglieder mit dem positiven Judentum grundsätzlich mehr oder
weniger entschieden gebrochen haben, diese religiösen Bedenken erreichten
für uns ihren höchsten Grad durch die Installierung eines Gemeindeältesten,
welcher der ausgesprochene Protegé eben dieser Behörden ist. Diese
religiösen Bedenken hatten unsere Austrittserklärung zur Folge. Obwohl
wir keinen Augenblick die Bedeutsamkeit und die Tragweite unseres
Schrittes unterschätzten, obwohl wir wussten, welche pekuniären Opfer
diese Konsequenz unserer religiösen Bedenken uns auferlegt, obwohl wir
endlich auch nicht darüber im Zweifel waren, dass unser Vorgehen verdächtigt,
unsere wahren Motive entstellt und uns unlautere insinuiert würden; - wir
könnten nicht anders handeln, als wir eben handelten.
Was wir aber nicht wussten, was wir nicht für möglich gehalten hätten,
wenn es nicht schwarz auf weiß vorläge, das ist die Art und Weise, wie
eine amtliche Behörde, wie das Vorsteheramt in Nr. 16 und 17 dieses
Blattes sich erkühnt, uns und unser Tun zu diskreditieren, speziell mich
zu verleumden, und das Alles eine Berichtigung zu nennen. Gestatten Sie
mir, einige handgreifliche Unwahrheiten dieser Berichtigung hier folgen zu
lassen. Das Vorsteheramt behauptet I., man hätte mich wegen fortwährender
Konflikte mit dem Kreisvorsteher und den Gemeindemitgliedern entlassen müssen,
- so lautet die Berichtigung; meine Entlassungsurkunde dagegen lautet:
'Nr. 128 V.V.A.Pr. Nachdem
Herr Isaac Rosenbaum zu Grebenstein seit dem Jahre 1861 das Amt eines Ältesten
der israelitischen Gemeinde zu Grebenstein, Kreises Hofgeismar verwaltet,
ist derselbe vom 15. März laufenden Jahres an, da eine weitere
Erstreckung der in der Regel drei Jahre betragenden Amtsdauer untunlich
ist, von diesem Amte entbunden und ihm darüber die gegenwärtige
Entlassungsurkunde ausgefertigt worden. Kassel, am 18. Februar 1878.
Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler. F. Traube. Hirsch. Rinald. E.
Goldschmidt. Berger.'
Kommentar ist überflüssig; es wird sich jeder Einsichtsvolle selber
sagen, wenn mir ein unzulässiger Konflikt mit meine Vorgesetzten
nachzuweisen gewesen wäre, hätte man nicht nötig gehabt, sich so lächerlich
zu machen, und einen beamten nach 17jähriger Amtstätigkeit deshalb
abzusetzen, weil er eigentlich nur 3 Jahre amtieren sollte!
II. Die Behauptung, als hätte ich je mit meinem Austritt gedroht, falls
ich als Gemeindeältester entlassen würde, ist erloben. Dagegen
entspricht es der Wahrheit, dass ich mit einigen Gemeindemitgliedern Herrn
Dr. Adler zu seinem Dienstjubiläum beglückwünscht habe. Ich bedauere,
erst seit Kurzem eine richtige Ansicht über unseren Herrn Landrabbiner
bekommen zu haben; der größte Teil der Kasseler Gemeindemitglieder sowie
die Mehrzahl der Landgemeinden, welche sich an jenem Jubiläum nicht
beteiligten, haben Herr Dr. Adler jedenfalls schon damals richtiger zu
beurteilen gewusst.
III. Die Behauptung, als ob
auf meine Anregung die Schule eingehen solle, ist ebenfalls unwahr, was
aktenmäßig festzustellen ist. – In den von mir in Gemeinschaft mit dem
anderen Gemeindeältesten am 4. Juni 1877 und 15. Oktober 1877 an das königliche
Landratsamt zu Hofgeismar gerichtete Eingaben habe ich um Beibehaltung der
Schule gebeten. Die Gestattung zur Errichtung einer eigenen öffentlichen
Elementarschule ist vielmehr laut Verfügung königlicher Regierung zu
Kassel vom 6. Dezember 1877 in Folge des Berichtes des Vorsteheramtes vom
29. Oktober 1877 zurückgezogen. – Alle Eingaben, Berichte etc., in
Betreff der Schule sind nur unter Mitwirkung und im Einverständnis mit
dem anderen Gemeindeältesten und der Majorität der Gemeindemitglieder
gemacht. Auf Veranlassung des Vorsteheramtes hat am 11. Dezember 1877 in
Betreff der Elementarschule eine Gemeindeversammlung stattgefunden (während
die Schule bereits wie oben erwähnt am 6. Dezember 1877 aufgelöst war).
In dieser Versammlung hat zwar die Majorität der Mitglieder, deren Kinder
teils bereits schulpflichtig sind, teils es in der nächsten |
 Zeit
werden, gegen die Errichtung einer öffentlichen Elementarschule jedoch für
eine Religionsschule gestimmt, während ich mich für die Beibehaltung der
Schule ausgesprochen habe, aber gleichzeitig dem Bedenken Ausdruck gab,
dass die Gemeinde nicht imstande sei, die Kompetenz aus eigenen Mitteln
aufzubringen. – Obgleich seit dem Jahre 1874 keines meiner Kinder die
hiesige Schule besucht hat, so ist doch seit 1875 die Kompetenz des
Lehrers auf meine Veranlassung um 90 Mark erhöht worden.
Zeit
werden, gegen die Errichtung einer öffentlichen Elementarschule jedoch für
eine Religionsschule gestimmt, während ich mich für die Beibehaltung der
Schule ausgesprochen habe, aber gleichzeitig dem Bedenken Ausdruck gab,
dass die Gemeinde nicht imstande sei, die Kompetenz aus eigenen Mitteln
aufzubringen. – Obgleich seit dem Jahre 1874 keines meiner Kinder die
hiesige Schule besucht hat, so ist doch seit 1875 die Kompetenz des
Lehrers auf meine Veranlassung um 90 Mark erhöht worden.
Die Lehrerstelle ist seit dem 1. Oktober 1877 unbesetzt – und wenn bis
jetzt die Kinder ohne Unterricht im Hebräischen sind – so kann mich
sicherlich die Schuld hieran nicht treffen. Trotz meiner oben
ausgesprochenen Ansicht über Herrn Dr. Adler rufe ich denselben als
Zeugen dafür auf, wie ich mich wiederholt bemüht habe, dass den Kindern
wenigstens der nötigste Unterricht im Hebräischen erteilt werde, und war
es mir auch gelungen, einen geprüften Religionslehrer in Kassel zu
veranlassen, sich beim Vorsteheramt um die Erteilung des
Religionsunterrichts etc. an der hiesigen Schule zu bewerben – und in
Folge dessen derselbe auch vom Vorsteheramte unter Zustimmung der
Regierung hiermit beauftragt. – Wenn nun trotzdem der
Religionsunterricht bis jetzt noch nicht beginnen hat, so kann mich
sicherlich hierüber kein Vorwurf treffen.
IV. Wenn behauptet wird, dass das Vorsteheramt den Kultus
betreffende Anordnungen nicht nach eigenem Ermessen, sondern nur auf Grund
von Gutachten der Provinzialrabbinen und des Landrabbinats erlässt, so
erlaube ich mir die Frage, ob denn die widergesetzliche Anordnung des
Vorsteheramts, welche dem zu Maftir Aufgerufenen das Vortragen der
Haftorah verbietet, auch durch ein Gutachten des Landrabbinats
sanktioniert ist? Auf den übrigen Teil der Berichtigung, soweit er die
Gepflogenheit und Verwaltungsusancen des Vorsteheramts
im Allgemeinen zu rechtfertigen sucht, gehe ich hier nicht ein, obwohl
auch hier Manches zu berichten wäre. Ich beschränke mich – da ich
keine Veranlassung habe, den mir unbekannten Verfasser der Korrespondenz
in Nr. 13 zu verteidigen – auf die Konstatierung der Tatsache, dass die
Gemeinde zwar richtig ihre Abgaben an die Provinzialkasse alljährlich
leistet, aber noch nie einen Beitrag aus derselben zum Lehrergehalt
empfangen hat. Ich habe mich bei dieser meiner Darstellung auf das
Allernotwendigste beschränkt; doch hoffe ich, dass das Mitgeteilt genügt,
um den geschätzten Lesern des 'Israelit' ein objektives Urteil über
die vorliegenden Angelegenheit zu ermöglichen. J.S.
Rosenbaum." |
Das Provinzialvorsteheramt möchte die aus der Gemeinde
Ausgetretenen von der Beisetzungserlaubnis im Friedhof Grebenstein
ausschließen
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Aus Hessen. Die väterliche
Sorgfalt des Kasseler Vorsteheramtes dauert noch über das Grab hinaus.
Wer daran zweifeln wollte, verweisen wir auf zwei Anfragen desselben an
das Königliche Amtsgericht und die Bürgermeisterei zu Grebenstein vom
25. März, beziehungsweise 15. April. Wir lassen dieselben hier wörtlich
folgen: 'An das königliche Amtsgericht zu Grebenstein. Nach § 6 des
Gesetzes vom 28. Juli 1876 verbleibt den aus einer Synagogengemeinde
Ausgetretenen das Recht der Mitbenutzung des Begräbnisplatzes der
Synagogengemeinde nur so lang, als ihnen nicht die Berechtigung zur
Benutzung eines andern Begräbnisplatzes zusteht. Nachdem je 3 in
Grebenstein und in Immenhausen wohnende Mitglieder der Synagogengemeinde
Grebenstein aus derselben ausgetreten sind, erlauben wir uns in Folge
dessen das ergebenste Ersuchen um gefällige Auskunft, ob nach den Grundbüchern
die Stadtgemeinde Grebenstein und Immenhausen oder wer sonst Eigentümer
der Be- Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1878: "Aus Hessen. Die väterliche
Sorgfalt des Kasseler Vorsteheramtes dauert noch über das Grab hinaus.
Wer daran zweifeln wollte, verweisen wir auf zwei Anfragen desselben an
das Königliche Amtsgericht und die Bürgermeisterei zu Grebenstein vom
25. März, beziehungsweise 15. April. Wir lassen dieselben hier wörtlich
folgen: 'An das königliche Amtsgericht zu Grebenstein. Nach § 6 des
Gesetzes vom 28. Juli 1876 verbleibt den aus einer Synagogengemeinde
Ausgetretenen das Recht der Mitbenutzung des Begräbnisplatzes der
Synagogengemeinde nur so lang, als ihnen nicht die Berechtigung zur
Benutzung eines andern Begräbnisplatzes zusteht. Nachdem je 3 in
Grebenstein und in Immenhausen wohnende Mitglieder der Synagogengemeinde
Grebenstein aus derselben ausgetreten sind, erlauben wir uns in Folge
dessen das ergebenste Ersuchen um gefällige Auskunft, ob nach den Grundbüchern
die Stadtgemeinde Grebenstein und Immenhausen oder wer sonst Eigentümer
der Be- |
 gräbnisplätze
ist, auf welchen die christlichen Einwohner daselbst beerdigt werden.
Kassel, am 25. März 1878. Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler
vdt. Berger. gräbnisplätze
ist, auf welchen die christlichen Einwohner daselbst beerdigt werden.
Kassel, am 25. März 1878. Vorsteheramt der Israeliten: Dr. Adler
vdt. Berger.
S.p.! 2.n.a. Herrn Bürgermeister Tenne zu Grebenstein mit dem Ersuchen um
gefällige Auskunft, 1) wer Eigentümer des dortigen Totenhofes ist, und
2) ob und welche Bedenken der Beerdigung auf demselben der aus der
dortigen Synagogengemeinde ausgetretenen Kaufleute Isac und Abraham
Rosenbaum und des Handelsmanns Levi Brandenstein dortselbst und deren
Angehörigen entgegenstehen. Dagegen, dass falls dies angemessen erachtet
wird, die betreffenden Personen auf einer besonderen Abteilung des
Totenhofes beerdigt werden haben wir nichts zu erinnern. Kassen, 15. April
1878. Vorsteheramt der Israeliten: Büding.
Bei der bereits von uns hervorgehobenen destruktiven Tendenz der
Mitglieder des Vorsteheramtes wird man sich nicht über die
Ungeheuerlichkeit wundern, dass es gegen die Beerdigung von Juden auf
christlichem Totenhof nichts zu erinnern hat. Es bedarf keines Hinweises,
wie jeden jüdischen Gefühles bar, eine Behörde sein muss, die eben
gegen ein solches Verfahren nicht nur nichts zu erinnern hat, sondern es
auch dieses Weise auch indirekt empfiehlt. Da der in Rede stehende
christliche Friedhof ein rein konfessionell christlicher, also kein
Kommunal-Friedhof ist, so hat die Sorgfalt des Vorsteheramtes, für den
vorliegenden Fall weiter keine praktischen Folgen, als dass sie einen
Neuen Beitrag zur Charakterisierung der religiösen Anschauung dieser Behörde
liefert. Eine Frage sei jedoch hier zum Schluss noch gestattet. – Es ist
ja nicht nur die Gefühlssphäre, es ist ja das jüdische Religionsgesetz
selbst, das durch die Erklärung verletzt wird, es sei gegen die
Bestattung von Juden auf christlichen Friedhöfen, seitens einer jüdischen
Behörde nichts zu erinnern. Wie lässt sich eine derartige Erklärung mit
der in nr. 16 und 17 dieses Blattes abgegebene in Einklang zu bringen:
'Den Kultus betreffende Anforderungen erlassen wir nicht nach eigenem
Ermessen, sondern auf Grund von Gutachten des Provinzialrabbinen bzw des
Landrabbbinats.'?!
Solange das Vorsteheramt nicht ein Gutachten des Landrabbinats veröffentlicht,
welches die Beerdigung von Juden auf nichtjüdischen Totenhöfen für
religionsgesetzlich statthaft erklärt, darf es sich angesichts dieses
Widerspruchs seiner Erklärungen nicht wundern, wenn man in der Provinz
einstweilen glaubt, die Erklärungen des Vorsteheramts hätten kurze
Beine. F.K." |
Objektive Stellungnahme zu den Vorfällen
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878. "Aus
Hessen, 8. Mai. (Privatmitteilung). Das Austrittsgesetz hat wiederum
eine zwar längst ausgesprochene, jedoch in unserer Zeit fast ganz
vergessene biblische Lehre bestätigt, nämlich die Lehre: 'Viele
Gedanken sind in des Menschen Herz, aber des Ewigen Ratschluss, er hat
Bestand' oder: 'Der Herr zerstört die Pläne der Arglistigen.' Es
ist nämlich kein Zweifel und wird von ihnen selbst nicht geleugnet werden
wollen, dass die Urheber und Verteidiger des genannten Gesetzes damit
lediglich die Reform haben vernichten wollen. Sie dachten nämlich so: 'Die reformistisch gesinnten Gemeindeglieder sind nur von niedriger
Gesinnung und werden schon darum scher austreten, weil sie ihr Geld sparen
wollten, denn – so dachten sie – die Reformleute haben ja gar keine
Religion und bleiben in der Gemeinde nur, weil sie müssen. Die Religion
haben, also unsere Leute, die treten gewiss aus, weil sie nicht in einer
Gemeinde bleiben dürfen, die wir – wenn auch mit Unrecht – als eine götzendienerische
bezeichnen. Wenn aber so von beiden Seiten der Austritt erfolgt, so hören
die Reformgemeinden auf und mit ihnen die Reform. Wir Separatisten sind
alsdann die jüdischen Gemeinden und wir Separatisten-Rabbiner haben unser
Ziel erreicht. Weil sie selbst so dachten und in ihrem Sinne nur die
Reform durch das Gesetz gefährdet war: so waren sie taub gegen alle
Vorstellungen, wie nachteilig das Gesetz für die kleinen Gemeinden und
wie demoralisierend sein Einfluss sein könne. Wir glaubten bei den
Gegnern ebenso die Erhaltung als Motiv annehmen zu sollen, wie die
Vernichtung der Reform für sie das einzige bestimmte Motiv war. Wie ganz
anders ist es gekommen! Wie beschämt wurden die Vertreter des Gesetzes in
ihren falschen Voraussetzungen! In Staub und Asche müssten sie den
Reformern in den Gemeinden Abbitte tun! In keiner der größeren Gemeinden
ist ein die Gemeinde beunruhigender oder nur nennenswerter Austritt
erfolgt. Kein Mensch wird mehr in Zweifel sein, wie recht die Gegner
hatten, wenn sie nachdrücklich hervorgehoben, dass nur die kleinen Gemeinden,
ob orthodox oder reformistisch, bedroht seien, dass aber im Allgemeinen
das Gesetz korrumpierend und demoralisierend in den jüdischen Gemeinden
dadurch wirken müsse, weil gar Mancher der Versuchung nicht werde
widerstehen können, durch den Vorwand eines 'religiösen Bedenkens'
von seiner Kultussteuer sich zu befreien oder als Hochbesteuerter die
Gemeinde tyrannisieren zu wollen. Ein recht sprechendes Beispiel für das
Letztere bietet ein Vorgang in unserem Kreise, nämlich in der Gemeinde
Grebenstein, Kreis Hofgeismar, Regierungsbezirk Kassel. Ich teile das Tatsächliche
mit und zwar mich auf dieses beschränkend, zugleich die Personen mit
Namen anführend, damit dieselben einen etwaigen Irrtum berichtigen können
und wenn es nicht geschieht, hierdurch die Wahrheit der Mitteilung
anerkannt sei. In Folge der Freizügigkeit waren einige Israeliten aus Meimbressen nach Grebenstein übergesiedelt. Einer derselben, Herr
Neuhahn, war mit dem damaligen Gemeindeältesten (Vorsteher sehr
befreundet. Letzterer, Herr J. Rosenbaum, nahm daher keinen Anstand, die
zugezogenen Gemeindemitglieder, wie sie gleichmäßig besteuert wurden,
auch gleichmäßig in die Liste der Aufzurufenden (zur Tora) einzureihen,
d.h. wohin sie ihrem Alter nach gehörten. Damit waren alle übrigen
Gemeindeglieder auch einverstanden. Nach 1-2 Jahren entstand wegen einer
Geschäftsangelegenheit zwischen den beiden Genannten eine Disharmonie,
die zur Feindschaft ausartete. War tut nun Herr Rosenbaum? Er lässt die
Zugezogenen nicht mehr wie bisher in der Reihe nach ihrem Alter aufrufen,
sondern als die später Eingetretenen hinter die jüngeren
Gemeindeglieder. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Mai 1878. "Aus
Hessen, 8. Mai. (Privatmitteilung). Das Austrittsgesetz hat wiederum
eine zwar längst ausgesprochene, jedoch in unserer Zeit fast ganz
vergessene biblische Lehre bestätigt, nämlich die Lehre: 'Viele
Gedanken sind in des Menschen Herz, aber des Ewigen Ratschluss, er hat
Bestand' oder: 'Der Herr zerstört die Pläne der Arglistigen.' Es
ist nämlich kein Zweifel und wird von ihnen selbst nicht geleugnet werden
wollen, dass die Urheber und Verteidiger des genannten Gesetzes damit
lediglich die Reform haben vernichten wollen. Sie dachten nämlich so: 'Die reformistisch gesinnten Gemeindeglieder sind nur von niedriger
Gesinnung und werden schon darum scher austreten, weil sie ihr Geld sparen
wollten, denn – so dachten sie – die Reformleute haben ja gar keine
Religion und bleiben in der Gemeinde nur, weil sie müssen. Die Religion
haben, also unsere Leute, die treten gewiss aus, weil sie nicht in einer
Gemeinde bleiben dürfen, die wir – wenn auch mit Unrecht – als eine götzendienerische
bezeichnen. Wenn aber so von beiden Seiten der Austritt erfolgt, so hören
die Reformgemeinden auf und mit ihnen die Reform. Wir Separatisten sind
alsdann die jüdischen Gemeinden und wir Separatisten-Rabbiner haben unser
Ziel erreicht. Weil sie selbst so dachten und in ihrem Sinne nur die
Reform durch das Gesetz gefährdet war: so waren sie taub gegen alle
Vorstellungen, wie nachteilig das Gesetz für die kleinen Gemeinden und
wie demoralisierend sein Einfluss sein könne. Wir glaubten bei den
Gegnern ebenso die Erhaltung als Motiv annehmen zu sollen, wie die
Vernichtung der Reform für sie das einzige bestimmte Motiv war. Wie ganz
anders ist es gekommen! Wie beschämt wurden die Vertreter des Gesetzes in
ihren falschen Voraussetzungen! In Staub und Asche müssten sie den
Reformern in den Gemeinden Abbitte tun! In keiner der größeren Gemeinden
ist ein die Gemeinde beunruhigender oder nur nennenswerter Austritt
erfolgt. Kein Mensch wird mehr in Zweifel sein, wie recht die Gegner
hatten, wenn sie nachdrücklich hervorgehoben, dass nur die kleinen Gemeinden,
ob orthodox oder reformistisch, bedroht seien, dass aber im Allgemeinen
das Gesetz korrumpierend und demoralisierend in den jüdischen Gemeinden
dadurch wirken müsse, weil gar Mancher der Versuchung nicht werde
widerstehen können, durch den Vorwand eines 'religiösen Bedenkens'
von seiner Kultussteuer sich zu befreien oder als Hochbesteuerter die
Gemeinde tyrannisieren zu wollen. Ein recht sprechendes Beispiel für das
Letztere bietet ein Vorgang in unserem Kreise, nämlich in der Gemeinde
Grebenstein, Kreis Hofgeismar, Regierungsbezirk Kassel. Ich teile das Tatsächliche
mit und zwar mich auf dieses beschränkend, zugleich die Personen mit
Namen anführend, damit dieselben einen etwaigen Irrtum berichtigen können
und wenn es nicht geschieht, hierdurch die Wahrheit der Mitteilung
anerkannt sei. In Folge der Freizügigkeit waren einige Israeliten aus Meimbressen nach Grebenstein übergesiedelt. Einer derselben, Herr
Neuhahn, war mit dem damaligen Gemeindeältesten (Vorsteher sehr
befreundet. Letzterer, Herr J. Rosenbaum, nahm daher keinen Anstand, die
zugezogenen Gemeindemitglieder, wie sie gleichmäßig besteuert wurden,
auch gleichmäßig in die Liste der Aufzurufenden (zur Tora) einzureihen,
d.h. wohin sie ihrem Alter nach gehörten. Damit waren alle übrigen
Gemeindeglieder auch einverstanden. Nach 1-2 Jahren entstand wegen einer
Geschäftsangelegenheit zwischen den beiden Genannten eine Disharmonie,
die zur Feindschaft ausartete. War tut nun Herr Rosenbaum? Er lässt die
Zugezogenen nicht mehr wie bisher in der Reihe nach ihrem Alter aufrufen,
sondern als die später Eingetretenen hinter die jüngeren
Gemeindeglieder.
Die Beteiligten führen darüber Beschwerde beim Vorsteheramte. Dieses
wendet sich an das Landrabbinat, bestehend aus dem Landrabbiner Dr. Adler,
Provinzial-Rabbiner Felsenstein, Dr. Enoch s.A.,
Gersfeld s.A. und dem jetzt pensionierten vormaligen Kreisrabbiner
Wetzlar. Einstimmig erklärte das Landrabbinat das Verfahren des Rosenbaum
für ungültig und wurde dieser in Folge des Landrabbinatsbeschlusses vom
Vorsteheramte angewiesen, die frühere Reihenfolge fernerhin einzuhalten.
Rosenbaum wusste wohl, dass er hiergegen nichts machen könne, |
 versah
seine Funktion aber so, dass er fort und fort zu Beschwerden Anlass gab,
die nach stattgehabten Ermittlungen als begründet sich erwiesen. Der
Kreisvorsteher, Herr Sterner, beantragte die Bestellung eines zweiten
Gemeindeältesten und schlug einen Freund des Rosenbaum vor. Kaum waren
einige Wochen vergangen, so war Rosenbaum auch mit seinem Kollegen, weil
ihm dieser nicht in Allem willfahrte, verfeindet, Rosenbaum, der keine
schulpflichtigen Kinder mehr hat, der Höchstbesteuerte ist und auch dem
Lehrer der mit Neuhahn befreundet war, seine Gunst entzog, machte sich nämlich
zur Aufgabe, die Auflösung der Elementarschule herbeizuführen, was
jedoch sein Kollege Voremberg nicht wollte. Da nun zur Gemeinde
Grebenstein auch Israeliten aus Immenhausen und Holzhausen gehören,
welche teils keine schulpflichtigen Kinder haben, auch von Grebenstein zu
entfernt wohnen, um für ihre Kinder die Schule benutzen zu können, so
gelang es ihm einen Majoritätsbeschluss zu erzielen, der die Auflösung
der Schule zur Folge hatte. Der Lehrer bewarb sich um eine andere Stelle,
die er auch bekam und die Israeliten zu Grebenstein hatten und haben weder
Lehrer noch Vorbeter. Das gewalttätige, eigenmächtige Benehmen von
Rosenbaum führte nach oftmaligen Ermahnungen auf gesetzlichem Wege dessen
Entlassung als Gemeindeältesten herbei und die Bestellung eines anderen
Gemeindeältesten in der Person des oben genannten Neuhahn. In Folge
seiner Entlassung als Gemeindeältester erklärten er, sein Bruder und
einige Vettern in Immenhausen ihren Austritt aus der Gemeinde wegen
'religiösen Bedenkens'. Weder in der Liturgie noch in irgendeiner
anderen Beziehung ist eine Veränderung vorgenommen worden. Dass er seine
Gewalttätigkeit nicht ausführen, seine Rachsucht nicht hat befriedigen
und seine amtliche Stellung nicht hat missbrauchen können, das nennt er:
religiöses Bedenken. Die Behörden, die sehr wohl unterrichtet sind, dass
auch nicht eine Spur religiöser Differenz vorhanden ist, schütteln
bedenklich den Kopf und – denken sich ihren Teil. Die Gemeindeglieder
aber, in Grebenstein und in den benachbarten Gemeinden, die größtenteils
der orthodoxen Richtung angehören, sprechen es offen aus: Herr Rabbiner
Hirsch in Frankfurt mag ein recht frommer Mann sein, durch dieses Gesetz (sc.
das Austrittsgesetz) aber hat er sich schwer am Judentume versündigt." versah
seine Funktion aber so, dass er fort und fort zu Beschwerden Anlass gab,
die nach stattgehabten Ermittlungen als begründet sich erwiesen. Der
Kreisvorsteher, Herr Sterner, beantragte die Bestellung eines zweiten
Gemeindeältesten und schlug einen Freund des Rosenbaum vor. Kaum waren
einige Wochen vergangen, so war Rosenbaum auch mit seinem Kollegen, weil
ihm dieser nicht in Allem willfahrte, verfeindet, Rosenbaum, der keine
schulpflichtigen Kinder mehr hat, der Höchstbesteuerte ist und auch dem
Lehrer der mit Neuhahn befreundet war, seine Gunst entzog, machte sich nämlich
zur Aufgabe, die Auflösung der Elementarschule herbeizuführen, was
jedoch sein Kollege Voremberg nicht wollte. Da nun zur Gemeinde
Grebenstein auch Israeliten aus Immenhausen und Holzhausen gehören,
welche teils keine schulpflichtigen Kinder haben, auch von Grebenstein zu
entfernt wohnen, um für ihre Kinder die Schule benutzen zu können, so
gelang es ihm einen Majoritätsbeschluss zu erzielen, der die Auflösung
der Schule zur Folge hatte. Der Lehrer bewarb sich um eine andere Stelle,
die er auch bekam und die Israeliten zu Grebenstein hatten und haben weder
Lehrer noch Vorbeter. Das gewalttätige, eigenmächtige Benehmen von
Rosenbaum führte nach oftmaligen Ermahnungen auf gesetzlichem Wege dessen
Entlassung als Gemeindeältesten herbei und die Bestellung eines anderen
Gemeindeältesten in der Person des oben genannten Neuhahn. In Folge
seiner Entlassung als Gemeindeältester erklärten er, sein Bruder und
einige Vettern in Immenhausen ihren Austritt aus der Gemeinde wegen
'religiösen Bedenkens'. Weder in der Liturgie noch in irgendeiner
anderen Beziehung ist eine Veränderung vorgenommen worden. Dass er seine
Gewalttätigkeit nicht ausführen, seine Rachsucht nicht hat befriedigen
und seine amtliche Stellung nicht hat missbrauchen können, das nennt er:
religiöses Bedenken. Die Behörden, die sehr wohl unterrichtet sind, dass
auch nicht eine Spur religiöser Differenz vorhanden ist, schütteln
bedenklich den Kopf und – denken sich ihren Teil. Die Gemeindeglieder
aber, in Grebenstein und in den benachbarten Gemeinden, die größtenteils
der orthodoxen Richtung angehören, sprechen es offen aus: Herr Rabbiner
Hirsch in Frankfurt mag ein recht frommer Mann sein, durch dieses Gesetz (sc.
das Austrittsgesetz) aber hat er sich schwer am Judentume versündigt." |
Beschluss der Königlichen Regierung im Blick auf die
Beisetzungrechte auf den Friedhöfen (1879)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Aus Hessen. Die
Furcht vor einer Ausschließung von der Benutzung des jüdischen Begräbnisses
hat bis jetzt Manchen zurückgehalten, seinen religiösen Bedenken gerecht
zu werden und aus einer Gemeinde auszuscheiden, die diese Bedenken
geschaffen hat. Für Hessen ist diese Furcht nunmehr vollständig
gegenstandlos geworden, in Folge einer Eröffnung der Königlichen
Regierung in Kassel. Diese erfolgte auf Grund folgender Beschwerde der
Herren Rosenbaum und Brandenstein zu Grebenstein. Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Aus Hessen. Die
Furcht vor einer Ausschließung von der Benutzung des jüdischen Begräbnisses
hat bis jetzt Manchen zurückgehalten, seinen religiösen Bedenken gerecht
zu werden und aus einer Gemeinde auszuscheiden, die diese Bedenken
geschaffen hat. Für Hessen ist diese Furcht nunmehr vollständig
gegenstandlos geworden, in Folge einer Eröffnung der Königlichen
Regierung in Kassel. Diese erfolgte auf Grund folgender Beschwerde der
Herren Rosenbaum und Brandenstein zu Grebenstein.
Da diese Eingabe auch in
hohem Grade geeignet ist, das Kasseler Vorsteheramt der Israeliten zu
charakterisieren, so möge sie hier wörtlich folgen.
Grebenstein, 29. Juli 1878. Wir waren veranlasst notgedrungen unseren
Austritt aus der hiesigen Synagogengemeinde nach Maßgabe des Gesetzes vom
28. Juli 1876 zu erklären und auszuführen. Die Gründe zu diesem Schritte
mögen hier unerhört bleiben, die selben sind in den betreffenden Akten
dargelegt und motiviert.
Seit dieser Zeit sucht uns das Vorsteheramt in gehässiger Weise zu verfolgen
und scheut sich nicht (?), um diesen Zweck zu erreichen. Dasselbe hat unterm
17. vorigen Monats an die hiesigen Ältesten der jüdischen Gemeinde einen
Beschluss erlassen, wonach wir von der Mitbenutzung des hiesigen jüdischen
Totenhofes ausgeschlossen sein sollten. Wir müssen annehmen, dass dieser
Beschluss im Bewusstsein des zu begehenden Unrechts gegen uns geschehen ist.
Nach § 6 des Gesetzes vom 28. Juli 1876 ist dem aus einer jüdischen Gemeinde
Ausgetretenen ausdrücklich das Recht der Mitbenutzung des
Begräbnisplatzes so lange gewährt, bis dieselben eine Berechtigung
zur Benutzung eines anderen Totenhofes erworben haben. - Trotzdem, dass das
Vorsteheramt durch seine desfallsigen Korrespondenzen mit dem königlichen
Grundbuchamt dahier, über die Eigentumsverhältnisse des hiesigen
christlichen Friedhofes, mit dem hiesigen Bürgermeisteramt über die Frage,
ob der Letztere im Kommunaleigentum stehe von dem königlichen Konsistorium
in Kassel, respektive dem königlichen Landratsamte zu Hofgeismar belehrt
worden war, dass uns kein Recht zur Mitbenutzung des hiesigen christlichen
Totenhofes zusteht und zugestanden wird; hat sich das Vorsteheramt nicht
gescheut, den Beschluss vom 17. vorigen Monats zu erfassen.
Wir sind nicht aus dem Judentum ausgeschieden, haben vielmehr in
Gemeinschaft mit den in Immenhausen und Holzhausen wohnenden, aus der
hiesigen Synagogengemeinde ausgetretenen Personen eine zweite
Synagogengemeinde ausgebildet und halten unseren Gottesdienst nach
gesetzlicher Vorschrift; wir haben auch, abgesehen von der uns durch das
Gesetz gegebenen Befugnis ein erzwingbares Recht zur Mitbenutzung des
jüdischen Totenhofes; dieser steht nicht im Eigentum der hiesigen älteren
Gemeinde, der Grund und Boden ist nicht von der Synagogengemeinde erworben,
vielmehr haben teils wir selbst, teils unsere Vorfahren den Grund und Boden
erworben und bezahlt und ihn zum Begräbnisplatz bestimmt. Diese Rechtsfrage
wird erst praktisch werden, wenn in späteren Zeiten ein konfessionsloser
Kommunaltotenhof geschaffen sein sollte und die alte jüdische Gemeinde uns
oder unsere Nachkommen von der Mitbenutzung unseres Totenhofes ausschließen
würde.
Dieser Beschluss des israelischen Vorsteheramts (welche auch in öffentlichen
Blättern, namentlich im 'Israelit', der verbreitetsten jüdischen Zeitung,
seine wohlverdiente Rüge gefunden hat) ist umso auffallender als diese
jüdische Behörde weiß und wissen müsste, dass es nach den jüdischen
Religionsgesetz nicht erlaubt ist, einen Juden auf einem christlichen
Totenhofe zu beerdigen. Diese Behörde hat sogar in einem Erlass vom 15.
April dieses Jahres an das hiesige Bürgermeisteramt gelegentlich der Anfrage
über unsere Mietbenutzung des hiesigen christlichen Totenhofs den Ausdruck
gebracht:
'Dagegen, dass falls dieses angemessen erachtet wird, die betreffenden
Personen auf einer besonderen Abteilung des Totenhofes beerdigt werden,
haben wir nichts zu erinnern'.
Wir sollen nach diesem frommen Wunsche und dieser hochherzigen Erlaubnis
nach unserem Tode eine Behandlung erfahren, wie sie früher in Kurhessen nach
bestandener Vorschrift gegen die Selbstmörder eingehalten wurde. Nachdem wir
es noch sehr bezweifeln, dass dem israelischen Vorsteheramt gesetzlich
überhaupt ein Verwaltungs- oder Aufsichtsrecht über die Totenhöfe der
einzelnen Synagogengemeinden zusteht, bitten wir ganz gehorsamst:
'um Aufhebung des fraglichen Beschlusses des Vorsteheramtes und um Schutz in
unserer Berechtigung.
Einer ferneren diesbezüglichen Eingabe der genannten Aktenten vom 10.
Oktober 1878 entnehmen wir folgenden Passus:
Wir erwähnen gleichzeitig, dass inzwischen ein Sterbefall vorgekommen war;
und die Beerdigung auf dem israelitischen Totenhofe nur infolge des
Beistandes seitens des Herrn Bürgermeisters dahier ohne Störung
stattgefunden hat - nachdem zuvor die Gemeindeältesten ohne Genehmigung des
Vorsteheramtes die Beerdigung nicht zugeben wollten.
n |
 Hierauf
erfolgte der oben erwähnte Bescheid der Regierung: Hierauf
erfolgte der oben erwähnte Bescheid der Regierung:
Königliche Regierung. Kassel, den 19. Oktober 1878. Auf
die Vorstellung vom 10. dieses Monats wird Ihnen zum Bescheide und zur
Mitteilung an die übrigen Beschwerdeführer eröffnet, dass wir ihre
Beschwerde vom 20. August dieses Jahres für begründet erachtet und das
hiesige Vorsteheramt angewiesen haben, dafür zu sorgen, dass die
Bestimmungen des § 6 ad b Absatz 2 des Gesetzes vom 28. Juli 1876 betreffend
den Austritt aus den jüdischen Synagogengemeinden in Anwendung gebracht
und Ihnen das Recht der Mitbenutzung des Begräbnisplatzes nicht verschränkt
werde.
Obschon die zur aus Ausführung unseres Bescheides erforderliche Anweisung
seitens des hiesigen Vorsteheramtes durch entschuldbare Umstände sich bis
zum 26. vorigen Monats verzögert hat, ist in dem von Ihnen zur Anzeige
gebrachten Falle, wegen Beerdigung der totgeborenen Tochter des Aaron
Rosenbaum zu Immenhausen dennoch eine Mitwirkung des Bürgermeisters
nicht nötig gewesen, weil das Vorsteher telegraphisch die Zulassung der
Beerdigung sofort angeordnet hat.
Wir erachten hiermit die Sache für erledigt. Abteilung des Innern gezeichnet
Kühne.
Wir glauben nicht, dass das Vorsteher durch dieses Erkenntnis der
königlichen Regierung an Opportunität im Lande gewonnen hat. F.K.". |
Berichte zu einzelnen
Personen aus der Gemeinde
Zum 100. Geburtstag von Selig Goldschmidt (geb. 1828 in Grebenstein, gest. 1896
in Frankfurt; große Verdienste um den Neubau der Synagoge, siehe unten)
Anmerkung: Der Bruder des im Artikel Genannten - Jakob Goldschmidt -
hatte 1853 in Frankfurt am Main eine Antiquitätenhandlung gegründet, in die
vier Jahre später Selig Goldschmidt eintrat (Firma J. & S. Goldschmidt).
Nach dem frühen Tod von Jakob Goldschmidt wurde dessen Sohn Julius Goldschmidt
Mitinhaber. Nach dem Tod von Selig Goldschmidt war Julius Goldschmidt
Alleininhaber der Firma. Die Firma J. & S. Goldschmidt gehörte viele Jahre
in eine Reihe mit den berühmten Londoner, Paris und New Yorker Häusern des
Antiquitätenhandels (Zweigstellen in Berlin, Paris und New York). Durch die
Aktivitäten der Firma wurde Frankfurt zum Kunsthandelsplatz von internationaler
Bedeutung. Julius Goldschmidt starb 1932 in Frankfurt (im jüdischen Friedhof
Eckenheimer Landstraße beigesetzt).
Literatur: Paul Arnsberg: Die Geschichte der Frankfurter Juden Bd. 3 S.
160-161.
Link: Zur Geschichte
der Familie Goldschmidt aus Grebenstein (englische Seite) mit Seite
zur Familie Selig Goldschmidt und seinen Nachkommen
Genealogische Informationen (mit Foto)
https://www.geni.com/people/Selig-Goldschmidt/6000000001435760609
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928:
"Selig Goldschmidt. Ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstag am 16.
März 1928. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1928:
"Selig Goldschmidt. Ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstag am 16.
März 1928.
Stufenweise baut sich menschliche Erinnerung Entwicklung auf. Nur eines ist,
der aus dem Nichts unmittelbar Vollkommenheit schaffen kann. Wir schwache
Sterbliche müssen Ziegel auf Ziegel setzen, um unser inneres Wesen zu
vollenden. Glück und Vorteil werden dem zuteil, der im Elternhause, im
Umkreis seiner Jugendeindrücke einen fertigen Musterbau sieht. Selig
Goldschmidt, dem diese Zeilen in ehrfurchtsvollem Gedenken gewidmet
sind, besaß dieses Glück, diesen Vorteil. Sein Vater, Meyer Goldschmidt
in Grebenstein, war mit äußeren Schätzen nicht sehr reich
beladen. Er führte ein mühseliges Leben. Ein Leben mächtiger
Kraftanstrengung, um Frau und viele Kinder zu ernähren. Aber es gelang ihm.
Innerlich jedoch war er reich. Er hatte ein felsenfestes Gottvertrauen. Und
konnte vor Gott und Menschen jeden Pfennig als ehrlich erworben
verantworten. Spendete auch aus der tröstlichen Güte seines Gemütes allen
fein und freudig, die irgendwie seelisch belastet zu ihm und zu seiner ihn
in linder Weichheit ergänzenden Gattin kamen. Genoss verdientes hohes
Ansehen über das Lebensende hinaus. Schloss dieses Lebensende würdig und
rühmlich damit, dass er sich aus dem ihn zutiefst erquickenden Milieu
Frankfurts und aus der ihn beglückenden Umgebung seiner Kinder losriss, um
einen erblindeten Freund in Eschwege,
dem seine Worte bereits vorher Lebenselixier war, physisch und seelisch zu
betreuen.
In harter Arbeit hatten seine Söhne Jacob und Selig ihm den
äußeren Lebensweg gangbar und angenehm gemacht. Auch sie waren dem Drucke
nicht erlegen, sondern der Druck hatte eine stärkere Kraftanspannung in
ihnen hervorgerufen. Die sie auch befähigte, die Welt Firma J. und S.
Goldschmidt zu gründen. Ihr Urtrieb, den Vater der Bürde der Sorgen zu
entledigen, zeitigte herrliche Erfolge. Gottes Segen ruhte auf dem Werke
ihre Hände. Und Selig Goldschmidt vergaß auch diesen Gott nie. Sprach es
hundertmal aus, dass nur Gott Glück und Geschick gestaltet, dass es den
Juden höchstes Bestreben und unverlierbares Bewusstsein bleiben soll, so zu
handeln und zu leben, dass Gott beruhigt und freudig bei ihm weilen kann.
Vielleicht war das das Grundelement seines Wesens, um das sich andere
überkommene, ausgebaute und selbsterrungenen Tugenden schlossen. So der
davon beeinflusste unerschütterliche Gleichmut. Weiß man sich nur eins mit
seinem Schöpfer und Herrn, so erscheint einem ja alles nur als Ausfluss
himmlischer Liebe. Hier wuchs die Gestalt Seligs einmal ins Große,
Heldenhafte. In seinem tiefsten Schmerz, beim Tode seiner Gattin, fasste er
seine gewaltigste Kraft zusammen, stöhnte keine Klage, sondern dankte nur
Gott für die Gnade, ihm ein solches Glück solange gewährt zu haben. Dieser
große Rundblick über das Ganze des jüdischen Daseins war ihm auch im
Erwerbsleben Wegweiser. Es ließ ihn gleichgültig, ob eine Einzelunternehmung
glückte oder misslang. Nur redlich musste alles unternommen sein.
Geschäftliche Winkelzüge waren ihm fremd. Er war ja seines Vaters Sohn. Ging
immer schnurstracks und gradeaus. Seiner äußeren fürstlichen Erscheinung
entsprechend. Und er ging seinen Weg fröhlich. 'Gott in Freuden
dienen' - diesen köstlichen Ratschlag befolgte er. Diese köstliche Pflicht
erfüllte er. Heiterte damit auch auf und spornt an, was mühselig und
armselig schlich. Nähere und Fernere. Diese Fröhlichkeit quoll nicht nur aus
dem Gleichmut seiner Lebensanschauung. Nein, auch aus einer unendlichen
inneren Güte. Es beseligte ihn, sie walten zu lassen, je mehr, je lieber. Es
sind Dokumente seines Wohltuns vorhanden, die erhebend und zugleich
erschütternd sind. Nicht nur die öffentlichen, nicht nur die heute noch
tragenden Säulen. Wie etwa nur die Israelitische Volksschule (sc.
in Frankfurt), die er mit großer Hand schuf. Oder das Israelitische
Mädchenwaisenhaus. Oder alle die anderen hunderte von Institutionen hier
und auswärts, denen er Hauptförderer war. Vielleicht noch ergreifendere und
wertvollere Dokumente sind die verkümmerten Gräser, die er aufrichtete, sind
sie nach vielen tausenden zählenden Bedürftigen und Bedrückten, die ihm
nahten und denen er in einer sich bis zur äußersten Grenze herb bewahrten
Verschwiegenheit milde half. So als ob er nicht der großmütige Spender,
sondern der demütige Empfänger wäre. Die Mindestforderung, die er in diesem
Betracht geldlich an sich stellte und seinen ebenbürtigen Kindern und Enkeln
als edle Hinterlassenschaft einprägte, war die Absonderung und Verbindung
des Maaser (der "Zehnte", vgl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Terumat_hamaaser). Er war splendid, natürlich auch darüber hinaus. Aber er
betrachtete dieses Zehntgeld als Hekdeschgeld (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heqdesh), wog darum, ehe er gab.
Eine besondere Gottes Fügung gab ihm die Möglichkeit, sich innerlich immer
mehr zu befruchten, zu weiten, zu stolzer Höhe zu führen; ein Aufenthalt in
Frankfurt und seine Beziehungen zu Samson Rafael Hirsch (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch). Er war sein
verehrungsvoller Bewunderer. Und wurde auf Schritt und Tritt von ihm
beeinflusst. Die Vertiefung und Vereinigung seiner immerhin ursprünglich in
einem Landstädtchen entstandenen Weltanschauung ist zum großen Teil Samson
Rafael Hirsch zuzuschreiben. Er war es auch, der Selig Goldschmidt
Impuls, der Israelitischen Religionsgesellschaft Freund, Gönner,
hervorragendster Förderer zu sein, stärksten und stets neuen Antrieb
gab. Die Geschichte der Religionsgesellschaft, ihrer Schule, ihres Hörsaals,
ihres Matzenbackhauses, ihre gesamten Einrichtungen kann mit tausend
Zungen künden, was Selig Goldschmidt war. Hier trafen sich glücklich adäquate
Neigungen und ihre räumlich-geistige Verwirklichung. So mögen
denn am Schlusse dieser Betrachtung, die den Goldgehalt eines so reichen
Lebens nur flüchtig in Umrissen aufglänzen, keineswegs aber im entferntesten ganz herausschälen kann, als Ehrentafel einige der herrlichen
Worte stehen, die Samson Rafael Hirsch ihm zu seiner silbernen Hochzeit
widmete:
'Ihnen Glück wünschen heißt doch: Glück wünschen allen den leidenden,
gedrückten Menschenherzen, denen sie als der Trost und Hilfe, Beistand und Rettung bringende Wohltäter in so seltener Großartigkeit sich bewähren; heißt
doch alle dem Edeln und Guten Glück wünschen, für dessen Stütze und
Förderung Sie zu jeder Zeit die opferfreudigste Bereitwilligkeit in
hochherzigster Weise betätigen; heißt ja Glück wünschen all den Vereinen und
Anstalten wohltätiger Menschenliebe, die in Ihnen ihren hochherzigen
Gründer, ihren treuesten Verwalter, ihren hingebungsvollsten Mitträger
begrüßen; heißt vor allem ja unserer Religionsgesellschaft Glück wünschen,
die so glücklich ist, den Herrn Selig Goldschmidt als dasjenige Mitglied
ihres Gemeinwesens und ihrer Verwaltung zu zählen, dessen begeisterungsvolle
Hochherzigkeit überall voranleuchtet, wo es gilt, für
ihre hochheiligen Zwecke mit tatkräftiger Opferfreudigkeit einzutreten'. |
Zum Tod von Selig Goldschmidt (geb.
1827 in Grebenstein, gest. 1896)
 Artikel
in "Der Israelit" vom 16. Januar 1896: "Selig Goldschmidt -
seligen Andenkens. Artikel
in "Der Israelit" vom 16. Januar 1896: "Selig Goldschmidt -
seligen Andenkens.
Frankfurt am Main, 14. Januar. So ist nun der schwere Schlag gefallen! Selig
Goldschmidt, um dessen Leben eine ganze Gemeinde seit acht Tagen bangte,
dessen Genesung von so vielen erfüllt und ersehnt wurde, weilt nicht mehr
unter den Lebenden, gestern hauchte er seine reine Seele aus, und heute hat
ein unübersehbares Trauergefolge, Trauergefolge im wahren Sinne des Wortes,
seine sterbliche Hülle zu Grabe geleitet.
Selig Goldschmidt - seligen Andenkens - war eine Persönlichkeit, wie
sie nicht häufig im Laufe der Zeiten als Wohltäter der Menschheit
erscheinen. Die Laufbahn seines Lebens war eine merkwürdige, aber noch
merkwürdiger war das Zusammentreffen großartiger Herzenseigenschaften in
diesem Manne, bei dessen Hintritt sich eine ganze Gemeinde verwaist fühlt,
der weit, weit über Frankfurts Weichbild hinaus vermisst werden wird. Unter
sehr bescheidenen Verhältnissen im Jahre 1827 zu Grebenstein im
ehemaligen Kurhessen geboren, musste er schon früh für seinen
Lebensunterhalt sorgen. Er erzählte es oft selbst, und hatte dessen gar kein
Hehl, wie er als 15- oder 16-jähriger Knabe, wenn er um des Verdienstes
willen über Land musste, die Stiefel auf seinen Gängen auszog, um sein
Schuhwerk zu schonen. Zum Jüngling herangewachsen, ging er mit seinem
älteren, dem vor 20 Jahren verstorbenen Bruder nach Frankfurt, und aus sehr
kleinen Anfängen wuchs ein Handelshaus heran, das achtunggebietend in der
Welt dasteht, und welches regierende und nicht regierende Fürsten mit ihrer
Kundschaft beehren. Ich erinnere mich genau des Falles, wie der hochselige
Kaiser Friedrich, der oft dieses Haus mit seinen Einkäufen beehrte, als
Kronprinz einmal auf der Durchreise durch Frankfurt die kurze Zeit seines
Aufenthaltes dazu benutzte, in eigener Person in dem Geschäfte von J. und S.
Goldschmidt einen antiken Schmuck für seine Gemahlin auszuwählen. Talent,
unermüdlicher Fleiß und strenge Rechtlichkeit - das waren die treibenden
Kräfte, die unter Gottes sichtlichem Segen das Haus zu der großen Blüte
brachte, deren es sich heute erfreut. Und wie verhielt sich der Mann nun in
den Wechsel seines äußerlichen Geschickes? Er, der über Reichtümer
Gebietende, vergaß nie die Zeit, als er noch genötigt war, auf seinen Gängen
seine Stiefel zu schonen, und darum wusste er mit den Armen zu fühlen, und
je größer sein Reichtum wurde, desto fürstlicher wurden seine Spenden. Wer
hätte je, sei es für sich selbst, sei es für einen Armen Selig Goldschmidt
- seligen Andenkens - um eine Gabe gebeten und wäre unbefriedigt und
unerhört von ihm gegangen? Wo wäre irgendwo bei einer öffentlichen Kalamität
die Mithilfe wohltätiger Menschen in Anspruch genommen worden, ohne dass von
ihm eine fürstliche Spende eingesandt worden wäre? Welcher hiesige Verein,
ob jüdischer oder nichtjüdischer, der im Dienste allgemeiner Humanität
wirkt, zählte nicht ihn zu seinen vornehmsten und meistleistenden
Mitgliedern? Wo hätte er je gefehlt, wenn es galt vaterländische Interessen
zu fördern, oder die Liebe zum Vaterlande in patriotischen Opfern zu
betätigen?
Was war aber dieser Mann der Stadt Frankfurt, was war er in seiner Gemeinde?
Noch kürzlich konnte man in den Zeitungen lesen, welche kostbare Spenden er
in hochherziger Weise dem Archive und der Gewerbekunstschule zuwendete; wie
er sich an den wohltätigen und allgemein nützlichen Vereinen beteiligte, ist
schon erwähnt worden. Aber nicht nur spendend, ratend und tatend beteiligte
er sich am Vereinsleben, so war er Mitglied der Verwaltung der
israelitischen Waisenanstalt, ferner des Vereins, der für das Schulgeld
armer Schüler und Schülerinnen sorgt, der Kirchheim'schen Stiftung usw..
Seine ganz besondere Fürsorge wendete er aber der israelitischen Volksschule
zu; wie er schon bei deren Gründung, in die Verwaltung gewählt, eine reiche
Spende für sie hergab, so ließ er auf seine Kosten das prächtige Schulhaus
erbauen, das |
 sich
an der Bärenstraße erhebt. Alljährlich am Chanukka bereitete er den 400
Zöglingen dieser Schule ein schönes Fest und beschenkte die Kinder. Wie froh
weilte er noch diesen Chanukka unter dieser kleinen Schar, wie weidete er
sich an der Lust dieser Kleinen, hier musste man ihn sehen, und auch wer ihn
früher nie gekannt, musste den Eindruck empfangen: dieser Mann ist erst dann
recht glücklich, wenn er andere glücklich machen kann. Und so war es auch in
der Tat. Je höher er empor stieg, desto mehr suchte er seinen Dank gegen
Gott durch engeren Anschluss an seine Tora und seine Mizwot auszudrücken. Er
ehrte die Tora und ihre Träger und daher fühlte er sich besonders zu dem
Mann hingezogen, der hier der Tora wieder Achtung und Anerkennung
verschaffte, zu Rabbiner Hirsch seligen Andenkens und seinem
Werke, der israelitischen Religionsgesellschaft. Was er als eifriger
Förderer der selben getan, wird ewig unvergesslich bleiben alle
Institutionen der selben wurden von ihm königlich unterstützt, eine
fürstliche Summe, die er spendete, ermöglichte die Erbauung des prächtigen
Höhersaales und der unter dem selben befindlichen Matt so Bäckerei. Seit
einer langen Reihe von Jahren gehörte als Mitglied den verschiedenen Zweigen
der Verwaltung der Religionsgesellschaft an und sie durch sein ersprießliches Wirken gefördert. Zu dieser vielseitigen
opferfreudigen Tätigkeit kommt noch die hinzu, die er im Dienste
der Wohltätigkeit der Wahrheit übte, er war ein Mitglied der
Chewra Kadischa (heiligen
Bruderschaft), in welcher er in Eifer und Hingebung seine persönlichen
Dienste leistete. Doch nicht nur die religiösen Institutionen seiner Stadt
unterstützte eher, wo anderswo die Geldmittel fehlten, solche Einrichtungen
herzustellen, wie es die jüdische Gemeinde als unerlässlich verlangt, da
war er es, der seine spendende Hand auftat und mit großen Summen eingriff. Viele kleine Gemeinden wissen davon zu erzählen, auch die heilige
Stadt hat die Opferwilligkeit des Verstorbenen in reichem Maße erfahren. sich
an der Bärenstraße erhebt. Alljährlich am Chanukka bereitete er den 400
Zöglingen dieser Schule ein schönes Fest und beschenkte die Kinder. Wie froh
weilte er noch diesen Chanukka unter dieser kleinen Schar, wie weidete er
sich an der Lust dieser Kleinen, hier musste man ihn sehen, und auch wer ihn
früher nie gekannt, musste den Eindruck empfangen: dieser Mann ist erst dann
recht glücklich, wenn er andere glücklich machen kann. Und so war es auch in
der Tat. Je höher er empor stieg, desto mehr suchte er seinen Dank gegen
Gott durch engeren Anschluss an seine Tora und seine Mizwot auszudrücken. Er
ehrte die Tora und ihre Träger und daher fühlte er sich besonders zu dem
Mann hingezogen, der hier der Tora wieder Achtung und Anerkennung
verschaffte, zu Rabbiner Hirsch seligen Andenkens und seinem
Werke, der israelitischen Religionsgesellschaft. Was er als eifriger
Förderer der selben getan, wird ewig unvergesslich bleiben alle
Institutionen der selben wurden von ihm königlich unterstützt, eine
fürstliche Summe, die er spendete, ermöglichte die Erbauung des prächtigen
Höhersaales und der unter dem selben befindlichen Matt so Bäckerei. Seit
einer langen Reihe von Jahren gehörte als Mitglied den verschiedenen Zweigen
der Verwaltung der Religionsgesellschaft an und sie durch sein ersprießliches Wirken gefördert. Zu dieser vielseitigen
opferfreudigen Tätigkeit kommt noch die hinzu, die er im Dienste
der Wohltätigkeit der Wahrheit übte, er war ein Mitglied der
Chewra Kadischa (heiligen
Bruderschaft), in welcher er in Eifer und Hingebung seine persönlichen
Dienste leistete. Doch nicht nur die religiösen Institutionen seiner Stadt
unterstützte eher, wo anderswo die Geldmittel fehlten, solche Einrichtungen
herzustellen, wie es die jüdische Gemeinde als unerlässlich verlangt, da
war er es, der seine spendende Hand auftat und mit großen Summen eingriff. Viele kleine Gemeinden wissen davon zu erzählen, auch die heilige
Stadt hat die Opferwilligkeit des Verstorbenen in reichem Maße erfahren.
Und
wie spendete er? Freundlich und freudig, leutselig und liebenswürdig, so
war er ein Tröster und Berater der Armen, er spendete nicht nur mit der
Hand, er spendet ihm mit dem Herzen. So war dieser Mann die Verkörperung der
Güte und Menschen´liebe der wahrhaft Unfreundlichkeit und der Liebe zu Tora,
die sich nicht nur in der Verehrung zeigte, welche er den Benei Tora
(Toraschülern)
entgegenbrachte, sondern in dem Eifer, die Tora kennen zu lernen, in ihre
Gänge sich einweihen zu lassen. Wie ergriff er jede Gelegenheit, die sich
ihm bot, Tora zu lernen, wie dankbar war er, wenn man ihm eine Frage in den
Worten der Tora beantwortete oder ihm irgendeine treffende Erklärung, einen
schönen Gedanken aus dem Gebiete der Tora mitteilte. Mehr aber als in allem
zeigte sich seine unbegrenzte Liebe zur Tora darin, dass es ihm gelungen
ist, alle seine Kinder zu ernsten und pflichttreuen Juden zu erziehen.
Er ist dahin, den Verlust fühlen weite, weite Kreise. Die Familie beweint
die ihr entrissene Krone, die Gemeinde ihren Berater und Förderer, die Stadt
einen ihrer besten Bürger, die Armen ihren Helfer und Tröster, der große
Kreise der Bekannten ihren warmen Freund, in dessen Nähe man sich wohlig
und angeheimelt fühlte, so bezauberte er durch seine heitere
Liebenswürdigkeit, welche er jedem, hoch oder niedrig, entgegenbrachte.
Bei
seinem Leichenbegängnis, da zeigte es sich, wieviel Liebe er genossen, in
welch großer Achtung und in welchem Ansehen er in der Bevölkerung der Stadt,
bei Juden und Christen, gestanden. Der Oberbürgermeister sandte ein inniges
Beileidsschreiben an die Familie, aus aristokratische Kreisen kamen
vornehme Kranzspenden und es war wohl kein Stand, der beim Leichensbegängnisse nicht vertreten gewesen wäre.
Die Trauer ist eine allgemeine, viele
Tränen flossen; wie viele mögen es sein, die ungesehen von der großen Menge,
in kahlen Dachstübchen die Armut geweint hat. Seine Seele sei eingebunden in
den Bund des Lebens." |
Zum 90. Geburtstag von M. Neuhahn (1911)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1911: "Grebenstein,
7. November (1911). Übermorgen begeht Herr Rentier M. Neuhahn dahier in
seltener Körper- wie Geistesfrische seinen 90. Geburtstag. Der
angesehene, überall geachtete Greis ist ein gewissenhafter Jehudi." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1911: "Grebenstein,
7. November (1911). Übermorgen begeht Herr Rentier M. Neuhahn dahier in
seltener Körper- wie Geistesfrische seinen 90. Geburtstag. Der
angesehene, überall geachtete Greis ist ein gewissenhafter Jehudi." |
82. Geburtstag von Rickchen Rosenbaum (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Februar 1928: "Grebenstein. Fräulein Rickchen
Rosenbaum, genannt das 'Perlenrickchen', feiert am 22. Februar ihren
82. Geburtstag. Sie ist die älteste Jüdin von Grebenstein und besitzt
trotz ihres hohen Alters eine erstaunliche geistige und körperliche
Rüstigkeit: Lange Zeit unterrichtete sie alle jüdischen und christlichen
Kidner im Stricken und Häkeln. Wir wünschen ihr, dass sie ihren Lebensabend
in ungetrübter Freude verbringen möge." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. Februar 1928: "Grebenstein. Fräulein Rickchen
Rosenbaum, genannt das 'Perlenrickchen', feiert am 22. Februar ihren
82. Geburtstag. Sie ist die älteste Jüdin von Grebenstein und besitzt
trotz ihres hohen Alters eine erstaunliche geistige und körperliche
Rüstigkeit: Lange Zeit unterrichtete sie alle jüdischen und christlichen
Kidner im Stricken und Häkeln. Wir wünschen ihr, dass sie ihren Lebensabend
in ungetrübter Freude verbringen möge." |
74. Geburtstag von Kaufmann R. Rosenbaum (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. März 1927: "Grebenstein. Am 18. März feiert
der Kaufmann R. Rosenbaum hier seinen 74. Geburtstag. Herr
Rosenbaum, der bei Juden und Christen weit und breit beliebt und geachtet
ist, ist trotz seines hohen Alters noch früh und spät im Geschäft tätig. Er
bekleidet viele Ehrenämter, unter anderen das als Stadtverordneter, wo er
sehr segensreich wirkte. Auch als Kreisvorsteher ist er noch heute zur
größten Zufriedenheit aller tätig. Möge ihm, der sich noch in seltener
geistiger und körperlicher Frische befindet, noch lange Jahre in Gesundheit
beschieden sein. - Dank gütiger Spenden erhielt der
Friedhof in Grebenstein ein
neues Tor." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. März 1927: "Grebenstein. Am 18. März feiert
der Kaufmann R. Rosenbaum hier seinen 74. Geburtstag. Herr
Rosenbaum, der bei Juden und Christen weit und breit beliebt und geachtet
ist, ist trotz seines hohen Alters noch früh und spät im Geschäft tätig. Er
bekleidet viele Ehrenämter, unter anderen das als Stadtverordneter, wo er
sehr segensreich wirkte. Auch als Kreisvorsteher ist er noch heute zur
größten Zufriedenheit aller tätig. Möge ihm, der sich noch in seltener
geistiger und körperlicher Frische befindet, noch lange Jahre in Gesundheit
beschieden sein. - Dank gütiger Spenden erhielt der
Friedhof in Grebenstein ein
neues Tor." |
Auszeichnung des "Roten Kreuzes
Grebenstein" für Moritz Neuhahn, Hermann Meyer und Gustav Neuhahn sowie 72,
Geburtstag von Kaufmann Benjamin Möllerich (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. April 1927: "Aus Grebenstein. Anlässlich des
15jährigen Bestehens der Freiwilligen Sanitäts-Kolonne vom Roten Kreuz
Grebenstein wurden aus der hiesigen Gemeinde ausgezeichnet mit dem
Ehrenzeichen des Preußischen landesvereins vom Roten Kreuz für 10jährige
Tätigkeit im Dienst des Roten Kreuzes Moritz Neuhahn, Hermann Meyer, Gustav
Neuhahn. - am 23. April feierte der Kaufmann ´Benjamin Möllerich in
geistiger und körperlicher Rüstigkeit seinen 72. Geburtstag." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. April 1927: "Aus Grebenstein. Anlässlich des
15jährigen Bestehens der Freiwilligen Sanitäts-Kolonne vom Roten Kreuz
Grebenstein wurden aus der hiesigen Gemeinde ausgezeichnet mit dem
Ehrenzeichen des Preußischen landesvereins vom Roten Kreuz für 10jährige
Tätigkeit im Dienst des Roten Kreuzes Moritz Neuhahn, Hermann Meyer, Gustav
Neuhahn. - am 23. April feierte der Kaufmann ´Benjamin Möllerich in
geistiger und körperlicher Rüstigkeit seinen 72. Geburtstag." |
Zum Tod von Rickchen Rosenbaum (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Juni 1927: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Juni 1927: |
76. Geburtstag von Joseph Neuhahn (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Juni 1927: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 17. Juni 1927: |
76. Geburtstag von Rika
Vorenberg geb. Möllerich (Köln, 1927)
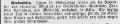 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. November 1927: "Grebenstein. Ihren 76.
Geburtstag feierte am 16. November das ehemalige Mitglied der Grebensteiner
Gemeinde, Frau Rika Vorenberg geb. Möllerich, wohnhaft in Köln. Sie
beging diesen Tag in seltener körperlicher und geistiger Frische im kreise
ihrer Kinder und Enkelkinder, geehrt und geliebt von allen wegen ihrer
großen Herzensgüte." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 18. November 1927: "Grebenstein. Ihren 76.
Geburtstag feierte am 16. November das ehemalige Mitglied der Grebensteiner
Gemeinde, Frau Rika Vorenberg geb. Möllerich, wohnhaft in Köln. Sie
beging diesen Tag in seltener körperlicher und geistiger Frische im kreise
ihrer Kinder und Enkelkinder, geehrt und geliebt von allen wegen ihrer
großen Herzensgüte." |
Zum Tod von Max Klee (geb. in Grebenstein, gest. in Chicago
(1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 3. Februar 1928: "Max Klee.
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 3. Februar 1928: "Max Klee.
Kassel. Am 29. Januar dieses Jahres ist nach längerem Leiden Max Klee in
Chicago verschieden, ein treuer Sohn des Hessenlandes, ein Philanthrop von
seltener Art. Er war im benachbarten Grebenstein geboren, besuchte
das israelitische Lehrerseminar in Kassel, begleitete noch kurze Zeit eine
Lehrstelle in Hausberge bei Minden (vgl.
Informationen) und siedelte dann nach Chicago über, wo er in das
Geschäft seiner Verwandten eintrat. Er wurde später Mitinhaber und hat das
Unternehmen durch seine Klugheit, seinen rastlosen Fleiß und strengste
Reellität zu großer Blüte gebracht. Aber das allein würde keinen Anlass
geben, in diesen Blättern voller Trauer dieses seltenen Menschen zu
gedenken. Viele Deutsche wandern nach Amerika aus und kommen dort zu Ansehen
und Vermögen. Aber wenige nur haben, wie er, in umfassendem Maße der alten
Heimat und der hilfsbedürftigen Menschheit drüben und hier ihre Mittel zur
Verfügung gestellt. In unzähligen Familien werden Tränen der Trauer fließen
um diesen edlen Wohltäter, der schon bald nach dem Kriege, ehe man an die
offiziellen amerikanischen Liebesgabensendungen dachte, nach
wohldurchdachtem Plane ein privates Hilfswerk inszenierte, das Unzähligen
einen Lichtstrahl in schweren Tagen brachte. Sendungen mit Garderobe,
Lebensmitteln und reiche Dollarspenden wanderten nach Deutschland zur
Linderung der Not. Seine engere Heimat wurde dabei natürlich in verstärktem
Maße bedacht und seine besondere Sorge galt dem Kreise seiner ehemaligen
Berufskollegen, ihren Witwen und Waisen, sowie allen denen, die vor dem
Kriege bessere Zeiten gesehen. Mit einer Herzensgüte und einem Zartgefühl,
die nicht zu übertreffen waren, auch wenn Undank oder Unverstand ihm zu
begegnen schien, mit einer nicht alltäglichen Menschenkenntnis und
Verstandesschärfe nahm er sich jedes einzelnen Falles an und war jeder
schematischen Behandlung abholt. Und dieses Hilfswerk, bei dessen
Durchführung ihm Freunde aus seiner Jugendzeit zur Seite standen, führte er
fort bis in die jüngste Gegenwart, und aus seinen Anweisungen die er gab,
konnte man entnehmen, wie dieser belesene und feingebildete Mann auch über
die wirtschaftlichen Verhältnisse Deutschlands auf das Genaueste
unterrichtet war, besser und weitblickender als mancher Deutsche. Alle paar
Jahre trieb es ihn in die alte Heimat zurück, mit der er aber auch jenseits
des Ozeans durch deutsche Zeitungen und Bücher in engster geistiger Fühlung
stand. Auch zahlreichen Wohlfahrtsinstitutionen unserer Stadt und unserer
Gemeinde hat er seine Fürsorge zugewendet und bei seinem Verweilen in Kassel
mit seinem Besuche Freude bereitet. Es bedarf wohl keines besonderen
Hinweises, dass er auch in seiner neuen Heimat als ein Vorbild werktätiger
Nächstenliebe allgemein geschätzt war und dass seine Geschwister und alle
Familienmitglieder - er selbst blieb unvermählt - zu ihm als dem Haupt der
Familie voller Verehrung und Liebe aufblickten. Nun hat das Herz, dass so
viel Liebe und Güte ausstrahlte, das so viel Glück und Hilfe bereitete, zu
schlagen aufgehört. Uns bleibt nur die Erinnerung an einen der besten und
günstigsten Menschen, der, ohne von sich reden zu machen, viel Leid gestillt
und viele Tränen getrocknet hat.
Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem, ich werde niemals seinesgleichen
sehen! Dr. K." |
77. Geburtstag von Fruchthändler J.
Neuhahn (1928)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juni 1928: "Grebenstein. Am 23.
Juni feierte der überaus beliebte Fruchthändler J. Neuhahn seinen 77.
Geburtstag in selten schöner Geistes- und Körperfrische. " Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juni 1928: "Grebenstein. Am 23.
Juni feierte der überaus beliebte Fruchthändler J. Neuhahn seinen 77.
Geburtstag in selten schöner Geistes- und Körperfrische. " |
86. Geburtstag von Minna Stern in Holzhausen (1928)
 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928:
"Kassel, 8. Oktober (1928). Ihren 86. Geburtstag beging Frau
Minna Stern
im benachbarten Holzhausen." Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. November 1928:
"Kassel, 8. Oktober (1928). Ihren 86. Geburtstag beging Frau
Minna Stern
im benachbarten Holzhausen." |
Curt Mandelstein erhielt bei den Jugendwettkämpfen ein
Ehrendiplom (1929)
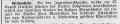 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. September 1929: "Grebenstein. Bei den
Jugendwettkämpfen, welche am 25. August sämtliche Schulen des Kreises
Hofgeismar veranstalten, erhielt von sämtlichen Knaben der hiesigen
Bürgerschulen als einziger der Schüler Kurt Mandelstein des siebenten
Schuljahres das vom Reichspräsidenten von Hindenburg gestiftete Ehrendiplom
für beste Leistung."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. September 1929: "Grebenstein. Bei den
Jugendwettkämpfen, welche am 25. August sämtliche Schulen des Kreises
Hofgeismar veranstalten, erhielt von sämtlichen Knaben der hiesigen
Bürgerschulen als einziger der Schüler Kurt Mandelstein des siebenten
Schuljahres das vom Reichspräsidenten von Hindenburg gestiftete Ehrendiplom
für beste Leistung." |
Zum Tod des langjährigen Kreisvorstehers Salomon
Rosenbaum (1930)
 Artikel in
der "Israelit" vom 4. Dezember 1930: "Grebenstein, 1. Dezember
(1930). Am 20. November dieses Jahres starb in Grebenstein Salomon
Rosenbaum inmitten seiner Tätigkeit. Er bekleidete über 35 Jahre das Amt
eines Kreisvorstehers der Israeliten für den Kreis Hofgeismar, bekleidete
außerdem verschiedene öffentliche Ehrenämter. Jahrelang war er
Stadtverordneter, gehörte bis zu seinem Lebensende dem Vorstand der Städtischen
Sparkasse an, sowie dem Steuerausschusse des Kreises. In den Nachrufen,
die ihm von verschiedene Behörden gewidmet wurden, wurden seine
umfassenden wirtschaftlichen Kenntnisse, sein objektives Urteil
hervorgehoben, es kam darin zum Ausdruck, dass er nicht nur mit dem
Verstand, sondern auch mit dem Herzen den Nöten unserer Zeit gerecht zu
werden suchte. In 48-jähriger glücklicher Ehe an der Seite seiner ihm würdigen
Gattin Flora geb. Wertheim, entsprossen dem Hause drei Töchter, die in
echt jüdischer Weise erzogen wurden und mit Männern verheiratet sind,
die streng auf dem Boden unserer heiligen Tradition stehen. Ehre dem
Andenken eines solchen Mannes, den wir mit Stolz als eine Zierde des
Judentums betrachten durften. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in
der "Israelit" vom 4. Dezember 1930: "Grebenstein, 1. Dezember
(1930). Am 20. November dieses Jahres starb in Grebenstein Salomon
Rosenbaum inmitten seiner Tätigkeit. Er bekleidete über 35 Jahre das Amt
eines Kreisvorstehers der Israeliten für den Kreis Hofgeismar, bekleidete
außerdem verschiedene öffentliche Ehrenämter. Jahrelang war er
Stadtverordneter, gehörte bis zu seinem Lebensende dem Vorstand der Städtischen
Sparkasse an, sowie dem Steuerausschusse des Kreises. In den Nachrufen,
die ihm von verschiedene Behörden gewidmet wurden, wurden seine
umfassenden wirtschaftlichen Kenntnisse, sein objektives Urteil
hervorgehoben, es kam darin zum Ausdruck, dass er nicht nur mit dem
Verstand, sondern auch mit dem Herzen den Nöten unserer Zeit gerecht zu
werden suchte. In 48-jähriger glücklicher Ehe an der Seite seiner ihm würdigen
Gattin Flora geb. Wertheim, entsprossen dem Hause drei Töchter, die in
echt jüdischer Weise erzogen wurden und mit Männern verheiratet sind,
die streng auf dem Boden unserer heiligen Tradition stehen. Ehre dem
Andenken eines solchen Mannes, den wir mit Stolz als eine Zierde des
Judentums betrachten durften. Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
|
|
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 28. November 1930: "Kreisvorsteher Salomon Rosenbaum.
Von Landrabbiner Dr. Walter. Der Kasseler Vorsteheramtsbezirk hat einen
schweren Verlust erlitten. Zu Grebenstein ist am 20. dieses Monats im
Alter von 78 Jahren der Kreisvorsteher Salomon Rosenbaum plötzlich in
seinen Arbeitsräumen verschieden. Unsere alten Lehrer bezeichnen diese
Todesart damit, dass sie sagen, Gott habe die Seele im Kusse zu sich
genommen, und erblicken in einem solchen Sterben das Vorzugslos der Frommen.
Tiefe Frömmigkeit und Religiosität bis ins einzelne hinein waren allerdings
hervorstechende Wesensseiten des Entschlafenen. Sie sind, wenn man sieht,
was die Fremdheit auf diesem Gebiete alles zuwege bringt, auch gar nicht zu
unterschätzende Eigenschaften bei jedem, der für unsere Glaubensgemeinschaft
zu wirken haben soll. Aber sie waren bei weitem nicht die einzigen, die ihn
zu dem Amte befähigten, das er über drei Jahrzehnte hindurch für die
israelitischen Gemeinden des Kreises Hofgeismar innegehabt hat. Das
überragende Ansehen, das er bei seinen Berufsgenossen des Getreide-, Futter-
und Düngermarktes genoss, die hohe Vertrauensstellung, die er bei den
weltlichen Behörden einnahm - auch den Landrat folgte seinem Sarge, seit der
Begründung der Reichsfinanzverwaltung gehörte er dem Steuerausschuss des
Hofgeismarer Finanzamtes als Mitglied an, er war lange Stadtverordneter und
im Vorstand der städtischen Sparkasse - schlugen unwillkürlich auf sein
Wirken in der im Glaubensgemeinschaft zurück, verstärkten dort die Kraft
seines Wortes und schärften andererseits seinen Blick für jede
Verwaltungsarbeit. Seiner hochragenden Gestalt entsprach ein aufrechter
innerer Charakter. So wird Salomon Rosenbaum in der Reihe der Kreisvorsteher
des Kasseler Vorsteheramtsbezirk ist stets einen Ehrenplatz behalten." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 28. November 1930: "Kreisvorsteher Salomon Rosenbaum.
Von Landrabbiner Dr. Walter. Der Kasseler Vorsteheramtsbezirk hat einen
schweren Verlust erlitten. Zu Grebenstein ist am 20. dieses Monats im
Alter von 78 Jahren der Kreisvorsteher Salomon Rosenbaum plötzlich in
seinen Arbeitsräumen verschieden. Unsere alten Lehrer bezeichnen diese
Todesart damit, dass sie sagen, Gott habe die Seele im Kusse zu sich
genommen, und erblicken in einem solchen Sterben das Vorzugslos der Frommen.
Tiefe Frömmigkeit und Religiosität bis ins einzelne hinein waren allerdings
hervorstechende Wesensseiten des Entschlafenen. Sie sind, wenn man sieht,
was die Fremdheit auf diesem Gebiete alles zuwege bringt, auch gar nicht zu
unterschätzende Eigenschaften bei jedem, der für unsere Glaubensgemeinschaft
zu wirken haben soll. Aber sie waren bei weitem nicht die einzigen, die ihn
zu dem Amte befähigten, das er über drei Jahrzehnte hindurch für die
israelitischen Gemeinden des Kreises Hofgeismar innegehabt hat. Das
überragende Ansehen, das er bei seinen Berufsgenossen des Getreide-, Futter-
und Düngermarktes genoss, die hohe Vertrauensstellung, die er bei den
weltlichen Behörden einnahm - auch den Landrat folgte seinem Sarge, seit der
Begründung der Reichsfinanzverwaltung gehörte er dem Steuerausschuss des
Hofgeismarer Finanzamtes als Mitglied an, er war lange Stadtverordneter und
im Vorstand der städtischen Sparkasse - schlugen unwillkürlich auf sein
Wirken in der im Glaubensgemeinschaft zurück, verstärkten dort die Kraft
seines Wortes und schärften andererseits seinen Blick für jede
Verwaltungsarbeit. Seiner hochragenden Gestalt entsprach ein aufrechter
innerer Charakter. So wird Salomon Rosenbaum in der Reihe der Kreisvorsteher
des Kasseler Vorsteheramtsbezirk ist stets einen Ehrenplatz behalten." |
Anstelle des verstorbenen Salomon Rosenbaum wird Louis
Heilbrunn aus Hofgeismar zum Kreisvorsteher gewählt (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 9. Januar 1931: "Hofgeismar. Neuer Kreisvorsteher.
Anstelle des verstorbenen Herrn Salomon Rosenbaum, Grebenstein,
wurde der bisherige Gemeindeälteste Herr Louis Heilbrunn (Hofgeismar)
zum Kreisvorsteher ernannt und vom Vorsteheramt
bestätigt."
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 9. Januar 1931: "Hofgeismar. Neuer Kreisvorsteher.
Anstelle des verstorbenen Herrn Salomon Rosenbaum, Grebenstein,
wurde der bisherige Gemeindeälteste Herr Louis Heilbrunn (Hofgeismar)
zum Kreisvorsteher ernannt und vom Vorsteheramt
bestätigt." |
Silberne Hochzeit von Wilhelm David
und seine Frau (1937)
Anmerkung: Wilhelm David war im Ersten Weltkrieg hoch dekoriert worden.
Zur Auszeichnung vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Militär-Verdienst-Kreuz.
 Artikel in "Das Schild" (hrsg. vom '"Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten") vom 30. Juli 1937: "Ehrentafel jüdischer Familien.
Grebenstein. Am 1. August begeht unser Kamerad Wilhelm David mit seiner
Gattin hier den Tag der Silbernen Hochzeit. Ihm gelten unsere herzlichsten
Glückwünsche. Über den Frontsoldaten Wilhelm David braucht nicht mehr gesagt
zu werden, als dass er Inhaber des preußischen Goldenen
Militärverdienstkreuzes ist, der höchsten und seltensten
Tapferkeitsauszeichnung, die es in der alten Wehrmacht für Unteroffiziere
und Mannschaften überhaupt gab." "
Artikel in "Das Schild" (hrsg. vom '"Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten") vom 30. Juli 1937: "Ehrentafel jüdischer Familien.
Grebenstein. Am 1. August begeht unser Kamerad Wilhelm David mit seiner
Gattin hier den Tag der Silbernen Hochzeit. Ihm gelten unsere herzlichsten
Glückwünsche. Über den Frontsoldaten Wilhelm David braucht nicht mehr gesagt
zu werden, als dass er Inhaber des preußischen Goldenen
Militärverdienstkreuzes ist, der höchsten und seltensten
Tapferkeitsauszeichnung, die es in der alten Wehrmacht für Unteroffiziere
und Mannschaften überhaupt gab." " |
Wegzug der Familie Rosenbaum nach Kassel (1938)
 Artikel
im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 16. September 1938:
"Grebenstein. Durch den Wegzug der Familie Rosenbaum
von hier nach Kassel, hat unsere Gemeinde einen großen Verlust erlitten.
Frau Rosenbaum (gemeint: Flora Rosenbaum geb. Wertheim, siehe Artikel
oben) hat die Gelegenheit als Gattin des verstorbenen langjährigen Kreisvorstehers
Herrn Salomon Rosenbaum nicht nur an Freud und Leid unserer Gemeinde,
sondern an dem aller Gemeinden des Kreises Hofgeismar regen Anteil zu
nehmen, im weitesten Sinne stets Rechnung getragen; sie stand so vielen
mit ihrem Rat zur Seite. Artikel
im "Jüdischen Gemeindeblatt Kassel" vom 16. September 1938:
"Grebenstein. Durch den Wegzug der Familie Rosenbaum
von hier nach Kassel, hat unsere Gemeinde einen großen Verlust erlitten.
Frau Rosenbaum (gemeint: Flora Rosenbaum geb. Wertheim, siehe Artikel
oben) hat die Gelegenheit als Gattin des verstorbenen langjährigen Kreisvorstehers
Herrn Salomon Rosenbaum nicht nur an Freud und Leid unserer Gemeinde,
sondern an dem aller Gemeinden des Kreises Hofgeismar regen Anteil zu
nehmen, im weitesten Sinne stets Rechnung getragen; sie stand so vielen
mit ihrem Rat zur Seite.
Lange Jahre war sie Vorsitzende des hiesigen Frauenvereins und hat viel
Not gelindert. Auch ihr Schwiegersohn, Herr Baruch Wormser (sc.
war verheiratet mit Clara Wormser geb. Rosenbaum), unser verehrter
Chasen (Vorbeter) soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, welcher
in den 10 Jahren seiner Zugehörigkeit zu unserer Gemeinde den
Vorbeterdienst, Religionsunterricht und das allsabbatliche Tora-Lernen mit
großem Eifer sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. An seiner Gattin fand er
auch diesem Gebiete stets gute Unterstützung. Seit 1931 gehörte er dem
Vorstande unserer Gemeinde an.
Wir wünschen der ganzen Familie Rosenbaum in ihrem neuen Heim viel Glück
und Segen. Der Vorstand." |
Hinweis auf Dr. Jakob Voremberg
(1896 in Grebenstein - 1973 in Trier; 1962 bis 1973 Vorsitzender der jüdischen
Gemeinde in Trier)
(Quelle:
https://www.trier-mitgestalten.de/node/11494) vgl. Beitrag von Günter
Heidt: "Es war eine
fürchterliche Überfahrt" - Gerd Vorembergs Emigration und Rückkehr nach Trier
(eingestellt als pdf-Datei).
Dr. Jakob Voremberg, geb. am 3. Juli 1896 in Grebenstein, eröffnete 1926
in Trier eine erfolgreiche Anwaltspraxis. Nachdem er Ende März 1933 wegen seines
jüdischen Glaubens für kurze Zeit in "Schutzhaft" genommen wurde, konnte er
aufgrund seiner Mitwirkung am Ersten Weltkrieg als sog. Frontkämpfer seine
Zulassung als Rechtsanwalt zunächst noch behalten. Weil aber die Verhältnisse in
Deutschland zunehmend unerträglicher wurden, emigrierte er im August 1938 mit
seiner Frau Liselotte und Sohn Gerd nach Palästina, kehrte jedoch schon bald
nach dem Krieg mit der Familie nach Trier zurück und nahm seine
Rechtsanwaltstätigkeit wieder auf. Dort war er vornehmlich auf dem Gebiet des
Restitutions- und Entschädigungsrechts tätig, vertrat also die Interessen seiner
überlebenden jüdischen Mitbürger gegenüber den deutschen Behörden. 1969 wurde er
zum Justizrat ernannt. Von 1962 bis 1973 war er Vorsitzender der Jüdischen
Gemeinde in Trier, außerdem war er mehrere Jahre Vorsitzender des
Landesverbandes Jüdischer Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Dr. Jakob Voremberg
engagierte sich besonders für den interreligiösen Dialog. So gehörte er zu den
Initiatoren der Trierer Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit,
deren Vorsitz er nach der Gründung 1969 zusammen mit Oberbürgermeister Josef
Harnisch und Andreas von Schubert übernahm. Als Jakob Voremberg am 31. Oktober
1973 starb, würdigte ihn Josef Harnisch im Namen der Stadt Trier als "Beispiel
an Menschlichkeit und gerechtem Denken". Er, Harnisch, habe selbst immer wieder
feststellen können, wie sehr Jakob Voremberg geholfen habe, "Brücken zwischen
Juden- und Christentum zu bauen".
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Manufaktur- und (Landes-)produkten-Geschäftes
J. S. Rosenbaum (1881 / 1885)
Anmerkung: es handelt sich um Salomon Rosenbaum, den oben genannten
langjährigen Kreisvorsteher (siehe Berichte zu seinem Tod 1930)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Februar 1881: "Für
mein Manufaktur- und Produkten-Geschäft (am Sabbat und an
Feiertagen geschlossen) suche ich zum als baldigen Eintritt einen tüchtigen
Kommis, der auch zeitweise Landkundschaft zu besuchen hat, sowie
einen Lehrling mit guten Schulkenntnissen. Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Februar 1881: "Für
mein Manufaktur- und Produkten-Geschäft (am Sabbat und an
Feiertagen geschlossen) suche ich zum als baldigen Eintritt einen tüchtigen
Kommis, der auch zeitweise Landkundschaft zu besuchen hat, sowie
einen Lehrling mit guten Schulkenntnissen.
J.S. Rosenbaum, Grebenstein." |
| |
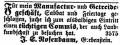 Anzeige
in "Der Israelit" vom 13. Juli 1885: "Für mein Manufaktur-
und Getreidegeschäft, Sabbat und Feiertage geschlossen, suche ich zum
als baldigen Eintritt einen tüchtigen Kommis, der auch Landkundschaft
zu besuchen hat. Anzeige
in "Der Israelit" vom 13. Juli 1885: "Für mein Manufaktur-
und Getreidegeschäft, Sabbat und Feiertage geschlossen, suche ich zum
als baldigen Eintritt einen tüchtigen Kommis, der auch Landkundschaft
zu besuchen hat.
J.S. Rosenbaum, Grebenstein. " |
| |
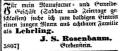 Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1886: "Für
mein Manufaktur- und Getreidegeschäft Klammer Sabbat und Feiertage
geschlossen) suche ich zum baldigen Eintritt einen jungen Mann aus achtbarer
Familie als Lehrling. Anzeige in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1886: "Für
mein Manufaktur- und Getreidegeschäft Klammer Sabbat und Feiertage
geschlossen) suche ich zum baldigen Eintritt einen jungen Mann aus achtbarer
Familie als Lehrling.
J.S. Rosenbaum, Grebenstein."
|
| |
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 21. November 1889: "Für mein
Manufaktur- und Getreidegeschäft - Sabbat und Feiertage geschlossen -
suche ich zum baldigen Eintritt per 1. Januar 1890 einen tüchtigen jungen
Mann für Reise und Komptoir. Bevorzugt werden solche, die bereits Land
Kundschaft mit Erfolg besucht haben. Anzeige
in "Der Israelit" vom 21. November 1889: "Für mein
Manufaktur- und Getreidegeschäft - Sabbat und Feiertage geschlossen -
suche ich zum baldigen Eintritt per 1. Januar 1890 einen tüchtigen jungen
Mann für Reise und Komptoir. Bevorzugt werden solche, die bereits Land
Kundschaft mit Erfolg besucht haben.
J.S. Rosenbaum, Grebenstein." |
Anzeige des Manufakturwaren- und
Produktengeschäftes Levi Katzenstein (1884)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 17. Juli 1884: "Ich
suche für mein Manufakturwaren- und Produktengeschäft per 1. August oder
später einen jungen Mann, welcher besonders im Stande ist, Landkundschaft zu
besuchen. Sonn- und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im Hause. Anzeige in "Der Israelit" vom 17. Juli 1884: "Ich
suche für mein Manufakturwaren- und Produktengeschäft per 1. August oder
später einen jungen Mann, welcher besonders im Stande ist, Landkundschaft zu
besuchen. Sonn- und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im Hause.
Levi Katzenstein, Grebenstein bei Kassel." |
| |
 Anzeige in "Der Israelit" vom 23. September 1886: "Ich
suche per 1. Oktober dieses Jahres für mein Manufaktur- und
Produktengeschäft, welches Samstag und Feiertage streng geschlossen ist,
einen tüchtigen erfahrenen Kommis, der Landkundschaft mit Muster zu
besuchen hat. Anzeige in "Der Israelit" vom 23. September 1886: "Ich
suche per 1. Oktober dieses Jahres für mein Manufaktur- und
Produktengeschäft, welches Samstag und Feiertage streng geschlossen ist,
einen tüchtigen erfahrenen Kommis, der Landkundschaft mit Muster zu
besuchen hat.
Levi Katzenstein, Grebenstein bei Kassel. " |
| |
 Anzeige in "Der Israelit" vom 11. Januar 1894: "
Für mein Manufaktur- und Getreidegeschäft, welches Schabbat und Feiertag
streng geschlossen, suche ich per sofort oder später einen tüchtigen Kommis,
welche auch Landtouren zu machen hat. Anzeige in "Der Israelit" vom 11. Januar 1894: "
Für mein Manufaktur- und Getreidegeschäft, welches Schabbat und Feiertag
streng geschlossen, suche ich per sofort oder später einen tüchtigen Kommis,
welche auch Landtouren zu machen hat.
Levi Katzenstein, Grebenstein bei Kassel. " |
Lehrerin als Nachfolgerin der bisherigen Lehrerin gesucht (Familie Rosenbaum, Immenhausen 1889)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1889:
"Für eine für höhere Töchterschule geprüfte Lehrerin,
musikalisch, welche seit 4 1/2 Jahren durch Erziehen und den Unterricht
meiner Kinder mit dem besten Erfolge leitet, suche passende Stellung per
Monat Juli oder später. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1889:
"Für eine für höhere Töchterschule geprüfte Lehrerin,
musikalisch, welche seit 4 1/2 Jahren durch Erziehen und den Unterricht
meiner Kinder mit dem besten Erfolge leitet, suche passende Stellung per
Monat Juli oder später.
M. Rosenbaum. Immenhausen - Kassel."
|
| |
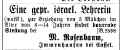 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Mai 1889: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 23. Mai 1889:
"Eine geprüfte israelitische Lehrerin (musik.),
zur Erziehung von 5 Mädchen im Alter von 6-14 Jahren findet dauernde
Stellung bei
M. Rosenbaum, Immenhausen bei Kassel."
|
Anzeige von Frau Rosenbaum (Immenhausen, 1898)
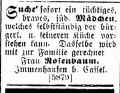 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1898:
"Suche sofort ein tüchtiges, braves, jüdisches Mädchen,
welches selbständig der bürgerlichen und feineren Küche vorstehen kann.
Dasselbe wird mit zur Familie gerechnet. Frau Rosenbaum,
Immenhausen bei Kassel." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1898:
"Suche sofort ein tüchtiges, braves, jüdisches Mädchen,
welches selbständig der bürgerlichen und feineren Küche vorstehen kann.
Dasselbe wird mit zur Familie gerechnet. Frau Rosenbaum,
Immenhausen bei Kassel." |
Anzeige von S. Katz (1898)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898:
"Ein junger, tüchtiger Bäckergeselle, 19 Jahre alt, sucht
zum 1. Oktober oder später Stellung. Auch ist derselbe in
Konditorei bewandert. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1898:
"Ein junger, tüchtiger Bäckergeselle, 19 Jahre alt, sucht
zum 1. Oktober oder später Stellung. Auch ist derselbe in
Konditorei bewandert.
S. Katz, bei M. Rosenbaum, Grebenstein, bei
Kassel." |
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes von Selig Neuhahn (1899)
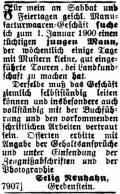 Anzeige in "Der Israelit" vom 30. November 1899: "Für
mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Manufakturwaren-Geschäft
suche ich zum 1. Januar 1900 eine tüchtigen jungen Mann, der
wöchentlich einige Tage mit Mustern kleine, gut eingeführte Touren, bei
Landkundschaft zu machen hat. Anzeige in "Der Israelit" vom 30. November 1899: "Für
mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Manufakturwaren-Geschäft
suche ich zum 1. Januar 1900 eine tüchtigen jungen Mann, der
wöchentlich einige Tage mit Mustern kleine, gut eingeführte Touren, bei
Landkundschaft zu machen hat.
Derselbe muss das Geschäft ziemlich selbstständig leiten können und
insbesondere auch vollständig mit der Buchführung und den vorkommenden
schriftlichen Arbeiten vertraut sein. Offerten erbitte mit Angabe der
Gehaltsansprüche und unter Einsendung der Zeugnisabschriften und der
Fotografie Selig Neuhahn, Grebenstein." |
Verlobungs- und Heiratsanzeige von
Baruch Wormser und Cläre geb. Rosenbaum (1926)
 Anzeige in "Der Israelit" vom 7. September 1926: "Statt
Karten Anzeige in "Der Israelit" vom 7. September 1926: "Statt
Karten
Cläre Rosenbaum - Baruch Wormser
Verlobte
Grebenstein Zürich - Karlsruhe" |
| |
 Anzeige
in "Der Israelit" vom 18. November 1926: Anzeige
in "Der Israelit" vom 18. November 1926:
"Baruch Wormser - Cläre Wormser geb. Rosenbaum
Vermählte
Grebenstein bei Kassel Trauung 23. November 1926
in Marburg (Lahn) bei Samuel Bacharach." |
Todesanzeige für Recha Neuhahn (1927)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. März 1927: "Statt besonderer Anzeige. Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. März 1927: "Statt besonderer Anzeige.
Gestern abend entschlief sanft meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Großmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau
Recha Neuhahn im 59. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen:
Joseph Neuhahn. Grebenstein, 24. Februar 1927." |
Danksagung von J. Meyer und Frau Jenny für die Glückwünsche zur Silbernen
Hochzeit (1928)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juni 1928: "Danksagung.
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 29. Juni 1928: "Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer silbernen Hochzeit erwiesenen
Aufmerksamkeiten sagen wir auf diesem Wege allen unseren Freunden und
Bekannten herzlichsten Dank.
Grebenstein, (Markt 123), den 26.6.1928.
J. Meyer und Frau Jenny." |
Verlobungsanzeige von Dina Neuhahn und Fritz Oberdorff
(1928)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 16. November 1928: "Statt Karten! Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 16. November 1928: "Statt Karten!
Dina Neuhahn - Fritz Oberdorff
Verlobte
Grebenstein Düsseldorf - zur Zeit Kassel." |
Zur Geschichte der Synagoge
Bereits im 18. Jahrhundert war angesichts der Zahl der jüdischen Einwohner ein
Betraum, vermutlich in einem der jüdischen Häuser vorhanden.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1840) kaufte die jüdische Gemeinde
das Haus des Schmiedes Wilhelm Persch und richtete darin die Israelitische
Elementarschule (seit 1831) und eine Synagoge ein. Es handelte sich bei dem Gebäude
um einen einfachen Fachwerkbau.
Eine neue Synagoge konnte 1895 auf Grund einer Spende des Frankfurter
Bankiers Goldschmidt (Sohn von Meyer Goldschmidt aus Grebenstein) auf dem
Grundstück des im Jahr zuvor abgebrochenen alten jüdischen Schul- und
Bethauses erbaut werden. Die Synagoge wurde am 28. Oktober 1895 eingeweiht.
Es handelte sich um einen imposanten Backsteinbau.
Dank einer großzügigen Spende
durch Selig und Falk Goldschmidt konnte der Synagogenbau erstellt werden (1893)
 Artikel
in "Die jüdische Presse" vom 16. November 1893: "Grebenstein, 8.
November (eigene Mitteilung) unsere Gemeinde befand sich in bedrängter Lage,
weil der missliche Bauzustand der Synagoge deren alsbaldige Schließung durch
die Baupolizei befürchten ließ. Der Gemeinde allein wäre es nicht möglich,
die Synagoge (in welcher auch ein Raum für die Volksschule, sowie die Mikwe
ist) zu erhalten, wenn nicht die Herren Selig und Falk Goldschmidt in
Frankfurt am Main in hochherzigster Weise unserer Gemeinde zum Neubau einer
Synagoge, Schule und Mikwe die Summe von fünftausend Mark bewilligt
hätten. Den Herren Goldschmidt, deren ganzes Leben eine ununterbrochene
Kette wahren Wohltuns ist, haben wir fortan die Existenz unserer
Gemeindeinstitutionen zu verdanken, denn ohne deren edle Beihilfe wäre es
nicht möglich, den Bau zu errichten. In Anerkennung dieses hohen Verdienstes
um die hiesige Gemeinde haben die Mitglieder derselben die Herren Selig und
Falk Goldschmidt zu Ehrenmitgliedern der Synagogengemeinde ihrer
Vaterstadt Grebenstein ernannt." Artikel
in "Die jüdische Presse" vom 16. November 1893: "Grebenstein, 8.
November (eigene Mitteilung) unsere Gemeinde befand sich in bedrängter Lage,
weil der missliche Bauzustand der Synagoge deren alsbaldige Schließung durch
die Baupolizei befürchten ließ. Der Gemeinde allein wäre es nicht möglich,
die Synagoge (in welcher auch ein Raum für die Volksschule, sowie die Mikwe
ist) zu erhalten, wenn nicht die Herren Selig und Falk Goldschmidt in
Frankfurt am Main in hochherzigster Weise unserer Gemeinde zum Neubau einer
Synagoge, Schule und Mikwe die Summe von fünftausend Mark bewilligt
hätten. Den Herren Goldschmidt, deren ganzes Leben eine ununterbrochene
Kette wahren Wohltuns ist, haben wir fortan die Existenz unserer
Gemeindeinstitutionen zu verdanken, denn ohne deren edle Beihilfe wäre es
nicht möglich, den Bau zu errichten. In Anerkennung dieses hohen Verdienstes
um die hiesige Gemeinde haben die Mitglieder derselben die Herren Selig und
Falk Goldschmidt zu Ehrenmitgliedern der Synagogengemeinde ihrer
Vaterstadt Grebenstein ernannt." |
| |
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1893: "Grebenstein.
In unserer Jetztzeit, in welcher man oft in der traurigsten Weise bestrebt
ist, an unseren heiligsten Institutionen zu rütteln, um zersetzend auf
das Judentum einzuwirken, ist es mehr denn je die Aufgabe einer jeden jüdischen
Gemeinde alles aufzubieten, um den religiösen Sinn in ihrem Kreise
anzufachen und zu beleben, damit eine Generation heranwachse, welche
gewappnet und gefeit ist gegen alle Anfeindungen von außen. Um dieses
letztere aber zu erreichen, ist es die heiligste Pflicht eines jeden
einzelnen Jehudi, dahin zu wirken und zu streben, dass in seiner Gemeinde Tora
und Gottesdienst blühe und
gedeihe. Zu diesem Zwecke nun ist es ein Haupterfordernis, dass jeder
Gemeinde Schule, Synagoge und Mikwe
erhalten bleibt, damit allen religiösen Leuten Gelegenheit geboten ist,
zu leben und zu wirken, wie es unsere heilige Religion vorschreibt. Um so
betrübender ist es für eine Gemeinde, in welcher noch wahrhaft religiöser
Sinn vorwaltet, wenn jene heiligen Institutionen, welche die Stützen
eines jeden jüdischen Gemeindelebens bilden, dem Verfalle nahe und nicht
die Mittel vorhanden sind, diese Gefahr abwenden zu können. In dieser so
bedrängten Lage befand sich die hiesige Gemeinde, deren Synagoge sich in
so misslichem Bauzustand befand, dass eine alsbaldige Schließung
derselben seitens der Baupolizei in Aussicht stand. Der Gemeinde allein wäre
es nicht möglich die Synagoge, (in welcher auch ein Raum für die
Volksschule, sowie die Mikwe-Einrichtung vorhanden) zu erhalten, wenn
nicht die Herren Selig und Falk Goldschmidt in Frankfurt am Main, diese in
weiten Kreisen als überaus wohltätig bekannte Herren, in hochherzigster
Weise unserer Gemeinde zum Neubau einer Synagoge, Schule und Mikwe die
Summe von fünftausend Mark bewilligt hätten. Den Herren Goldschmidt,
deren ganzes Leben eine ununterbrochene Kette wahren Wohltuns ist, haben
wir fortan die Existenz unserer Gemeindeinstitutionen zu verdanken, denn
ohne deren edle Beihilfe wäre es nicht möglich, den Bau zu errichten.
Mit dieser guten Tat haben die Herren Goldschmidt sich hier in ihrer
Vaterstadt ein ewiges Denkmal gesetzt und gleichzeitig damit eine wahre Heiligung
des Gottesnamens ausgeübt. In Anerkennung dieses hohen Verdienstes um
die hiesige Gemeinde haben die Mitglieder derselben, die Herren Selig und
Falk Goldschmidt zu Ehrenmitgliedern der Synagogengemeinde ihrer Vaterstadt
Grebenstein ernannt." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1893: "Grebenstein.
In unserer Jetztzeit, in welcher man oft in der traurigsten Weise bestrebt
ist, an unseren heiligsten Institutionen zu rütteln, um zersetzend auf
das Judentum einzuwirken, ist es mehr denn je die Aufgabe einer jeden jüdischen
Gemeinde alles aufzubieten, um den religiösen Sinn in ihrem Kreise
anzufachen und zu beleben, damit eine Generation heranwachse, welche
gewappnet und gefeit ist gegen alle Anfeindungen von außen. Um dieses
letztere aber zu erreichen, ist es die heiligste Pflicht eines jeden
einzelnen Jehudi, dahin zu wirken und zu streben, dass in seiner Gemeinde Tora
und Gottesdienst blühe und
gedeihe. Zu diesem Zwecke nun ist es ein Haupterfordernis, dass jeder
Gemeinde Schule, Synagoge und Mikwe
erhalten bleibt, damit allen religiösen Leuten Gelegenheit geboten ist,
zu leben und zu wirken, wie es unsere heilige Religion vorschreibt. Um so
betrübender ist es für eine Gemeinde, in welcher noch wahrhaft religiöser
Sinn vorwaltet, wenn jene heiligen Institutionen, welche die Stützen
eines jeden jüdischen Gemeindelebens bilden, dem Verfalle nahe und nicht
die Mittel vorhanden sind, diese Gefahr abwenden zu können. In dieser so
bedrängten Lage befand sich die hiesige Gemeinde, deren Synagoge sich in
so misslichem Bauzustand befand, dass eine alsbaldige Schließung
derselben seitens der Baupolizei in Aussicht stand. Der Gemeinde allein wäre
es nicht möglich die Synagoge, (in welcher auch ein Raum für die
Volksschule, sowie die Mikwe-Einrichtung vorhanden) zu erhalten, wenn
nicht die Herren Selig und Falk Goldschmidt in Frankfurt am Main, diese in
weiten Kreisen als überaus wohltätig bekannte Herren, in hochherzigster
Weise unserer Gemeinde zum Neubau einer Synagoge, Schule und Mikwe die
Summe von fünftausend Mark bewilligt hätten. Den Herren Goldschmidt,
deren ganzes Leben eine ununterbrochene Kette wahren Wohltuns ist, haben
wir fortan die Existenz unserer Gemeindeinstitutionen zu verdanken, denn
ohne deren edle Beihilfe wäre es nicht möglich, den Bau zu errichten.
Mit dieser guten Tat haben die Herren Goldschmidt sich hier in ihrer
Vaterstadt ein ewiges Denkmal gesetzt und gleichzeitig damit eine wahre Heiligung
des Gottesnamens ausgeübt. In Anerkennung dieses hohen Verdienstes um
die hiesige Gemeinde haben die Mitglieder derselben, die Herren Selig und
Falk Goldschmidt zu Ehrenmitgliedern der Synagogengemeinde ihrer Vaterstadt
Grebenstein ernannt." |
Einweihung der Synagoge (1895)
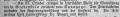 Artikel in "Allgemeine Israelitische ´Wochenschrift" vom 8. November 1895:
"Am 27. Oktober erfolgte in feierlicher Weise die Einweihung der in
Grebenstein errichteten neue Synagoge. Den Feierlichkeiten
wohnten der Regierungspräsident und der Landrat bei. Die Festpredigt hielt
Landrabbiner Dr. Prager aus Kassel." Artikel in "Allgemeine Israelitische ´Wochenschrift" vom 8. November 1895:
"Am 27. Oktober erfolgte in feierlicher Weise die Einweihung der in
Grebenstein errichteten neue Synagoge. Den Feierlichkeiten
wohnten der Regierungspräsident und der Landrat bei. Die Festpredigt hielt
Landrabbiner Dr. Prager aus Kassel." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Synagoge geschändet; die Inneneinrichtung zerstört und auf die Straße
geworfen. 1940 wurde das Gebäude abgebrochen, das Grundstück verkauft.
Auf ihm wurde 1941 eine Scheune errichtet.
Eine Gedenktafel ist
seit 1988 vorhanden (angebracht auf Initiative des Förderkreises des
Ackerbürgermuseums Grebenstein). Sie enthält den Text: "Hier stand die im
Jahre 1895 erbaute Synagoge der Jüdischen Gemeinde Grebenstein. Das Gebäude
wurde 1938 innen zerstört und später abgerissen". Die aus Keramik
hergestellte Gedenktafel wurde 1994 durch einen Ortsbewohner zerstört, der
jedoch schnell festgestellt werden konnte. Wenig später wurde eine Bronzetafel
zur Erinnerung an die Synagoge angebracht. Von der alten Synagoge sind noch drei
Dachziegel, ein Original-Fenster und die ehemalige Eingangstüre vorhanden, die
sich im Museum der Stadt ("Alte Meierei") befinden. Im Zusammenhang
mit einer Ausstellung 1995 wurden die Gegenstände erstmals gezeigt.
Adresse/Standort der Synagoge: Schachtener
Straße 2
Fotos
(Quelle: Foto obere Fotozeile links aus der Website
von Achim Hähnert s.u. bei Links; obere Fotozeile rechts aus der u. der Lit. genannten
Encyclopedia of Jewish Life Bd. I S. 452; Dokumente zweite Fotozeile: Museum Hofgeismar; neuere
Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 16.6.2008)
| Historische Darstellungen |
 |
 |
| |
Die Synagoge in
Grebenstein |
| |
|
|
 |
 |
 |
Programm für die
Einweihungs-Feier
der Synagoge Grebenstein am Montag,
den 28. Oktober 1895 |
Die Synagoge in Grebenstein |
Die zerstörte Synagoge |
| |
|
| |
|
|
Das
Synagogengrundstück
im Juni 2008 |
 |
 |
| |
Am
Fachwerkgebäude links sind die unten stehenden Hinweistafeln angebracht |
| |
|
| |
 |
 |
| |
Hinweistafel zur Erinnerung
an
die Synagoge |
Hinweistafel auf eine vor der
Synagoge
auf dem Grundstück stehende
mittelalterliche Kirche |
| |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
|
November 1977:
Gedenkstunde an den Novemberpogrom
mit dem Folklorechor aus Grebenstein |
 Artikel in "Yedi'ot shel Irgun 'Ole Breslau be-Yiśra'el
- ידיעת של ארגון עולי ברסלאו בישראל
von 1978 S. 37: Zum Lesen des Textes bitte Textabbildung anklicken.
Artikel in "Yedi'ot shel Irgun 'Ole Breslau be-Yiśra'el
- ידיעת של ארגון עולי ברסלאו בישראל
von 1978 S. 37: Zum Lesen des Textes bitte Textabbildung anklicken. |
| |
|
1981:
Über den Maler Alfred Goette in
Grebenstein und seine Beziehungen nach Israel
|
 Artikel in "Yedi'ot shel Irgun 'Ole Breslau be-Yiśra'el
- ידיעת של ארגון עולי ברסלאו בישראל von 1981 S. 33:
Zum Lesen des Textes bitte Textabbildung anklicken. Artikel in "Yedi'ot shel Irgun 'Ole Breslau be-Yiśra'el
- ידיעת של ארגון עולי ברסלאו בישראל von 1981 S. 33:
Zum Lesen des Textes bitte Textabbildung anklicken.
Zur Person Alfred Goette (1916-2005, Zahnarzt in Grebenstein) siehe
https://regiowiki.hna.de/Alfred_Götte |
| |
| April 2010:
Die Verlegung von "Stolpersteinen" ist
geplant |
Artikel in der "Hessischen
Allgemeinen" (hna.de) vom 24. April 2010 (Artikel):
"Erinnerung an jüdische Mitbürger wach halten. Stolpersteine gegen das Vergessen.
Hofgeismar. Mit so genannten Stolpersteinen soll die Erinnerung an ermordete jüdische Mitbürger in mehreren Kommunen im Landkreis Kassel wachgehalten werden.
Noch in diesem Jahr sollen in Grebenstein, Calden, Immenhausen und Espenau die ersten Steine verlegt werden...". |
| |
| Dezember 2010:
"Stolpersteine" werden verlegt
|
Artikel aus dtoday.de vom 1. Dezember 2010 (Artikel):
"Stolpersteinverlegung in Grebenstein
Am Donnerstag, dem 9. Dezember, werden in Grebenstein durch den Künstler Gunter Demnig zwanzig Stolpersteine verlegt, die an jüdische Menschen erinnern sollen, die einst in Grebenstein gelebt haben..." |
| |
Artikel in der "Hessischen Allgemeinen" vom 10. Dezember 2010 (Artikel):
"Stolpersteine erinnern an ermordete jüdische Nachbarn. 41 Tote haben ihre Namen zurück.
Grebenstein/Hofgeismar. Bis vor 70 Jahren betrieben Else und Bernhard Mandelstein im Haus Hochzeitsberg 6 in Grebenstein ein Textil-, Schuh- und Möbelgeschäft. Als die Repressalien der Nationalsozialisten immer schlimmer wurden, gelang es ihren Kindern Walter, Irma und Rudolf, nach Amerika und Palästina zu entkommen. Alle Versuche, ihre Eltern nachkommen zu lassen, scheiterten jedoch. Das Ehepaar Mandelstein musste Grebenstein 1939 verlassen, flüchtete nach Thüringen. 1942 wurden sie nach Leipzig befohlen und dann im Vernichtungslager Belzyce
ermordet..." |
| Link: Weiterer
Bericht mit Fotos in "Deutschland today" (dtoday.de). |
| |
| Mai 2011:
Auch in Immenhausen werden
"Stolpersteine" verlegt |
Artikel von Thomas Thiele in der "Hessischen Allgemeinen" vom
26. Mai 2011 (Artikel):
"Namenssteine erinnern an verfolgte jüdische Mitbürger - Ein Platz blieb leer.
Mit Kopf und Herz stolpern.
Immenhausen. Nach den Städten Grebenstein und Hofgeismar hat seit gestern auch Immenhausen seine Stolpersteine: Pflastersteine mit glänzender Namensplakette, die auf drei ehemalige Mitbürger hinweisen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Clara Haase, Gerhard Czaplinski und Dr. Lilli Jahn wurden zuvor in einer Feierstunde in der Gesamtschule gewürdigt..."
|
| Link: Weiterer
Bericht
zur Verlegung der "Stolpersteine" in Immenhausen mit Fotos und
Kurzvideo (dtoday.de) Link
zum Video |
| |
|
Januar 2019:
Erinnerung an die Synagoge in
Grebenstein |
Artikel in der "Hessischen Allgemeinen" vom
2019: "Das historische Foto. Gedenktafel erinnert: Synagoge Grebenstein
wurde 1940 abgerissen
Grebenstein. Fast 80 Jahre ist es her, dass die Synagoge in Grebenstein
abgerissen wurde. Früher hatten sich dort rund 80 Juden getroffen, um zu
beten.
Bevor es in Grebenstein eine Synagoge gab, hatte sich die damalige jüdische
Gemeinde im Schulhaus getroffen, um Gottesdienste zu feiern. Diese Schule
hat in unmittelbarer Nachbarschaft zur später errichteten Synagoge an der
Schachtener Straße gestanden. 1895 wurde durch eine Spende des Frankfurter
Bankiers Goldschmidt, ein Sohn eines in Grebenstein lebendem Juden, der Bau
der Synagoge ermöglicht, berichtet Wolfgang Tölle vom Ackerbürgermuseum
Grebenstein. Um 1900 gehörten rund 80 Personen der 'Israelitischen Gemeinde
Grebenstein' an. Juden aus Grebenstein, Immenhausen und Holzhausen kamen
hier zum Gebet zusammen. Da man keinen eigenen Rabbiner hatte, wurde die
Gemeinde von einem Kreisrabbiner geführt. Außerdem soll man sich mit einem
Vorsänger beholfen haben, der auch gleichzeitig Lehrer an der Judenschule
war. In der Reichspogromnacht der Nationalsozialisten im Jahre 1938 wurde
das Gebäude stark beschädigt und die Bestuhlung auf die Straße geworfen,
zwei Jahre später wurde das Gotteshaus schließlich abgerissen und das
Grundstück verkauft.
Nur eine Tafel erinnert an die Synagoge. Heute erinnert an die
Synagoge nur noch eine metallene Gedenktafel, die 1994 am Nachfolgebau
angebracht worden ist. Die vorherigen aus Keramik waren Jahrzehnte zuvor
zerstört worden.
1345 wurden erstmals Juden in Grebenstein erwähnt. Erst 1631 ist in
Dokumenten wieder von ihnen die Rede. Seit dieser Zeit lebten bis 1939 Juden
in der Kleinstadt. 1933 gab es noch 13 jüdische Geschäfte. Neben der
Synagoge gab es im Ort auch ein rituelles Bad, der
jüdische Friedhof am Burgberg
existiert heute noch."
Link zum Artikel |
| |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
| Hinweis
auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Grebenstein
mit Immenhausen und Holzhausen |
In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs
(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus
hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:
Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41
Zu Grebenstein sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur
Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):
HHStAW 365,376 Trauregister der Juden von Grebenstein
1827 - 1881; enthält auch Angaben zu Holzhausen und Immenhausen; die chronologische
Reihenfolge ist durcheinander, die älteren Einträge seit 1827 sind ab S.
27 nachgetragen
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3271670
HHStAW 365,377 Sterberegister der Juden von Grebenstein
1827 - 1882; enthält auch Angaben zu Holzhausen und Immenhausen; die
chronologische Reihenfolge ist durcheinander, die älteren Einträge seit
1827 sind ab S. 51 nachgetragen
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5494588
HHStAW 365,375 Geburtsregister der Juden von Grebenstein
1827 - 1900, enthält auch Angaben zu Holzhausen und
Immenhausen https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v2924718
HHStAW 365,378 Gräberverzeichnis des jüdischen Friedhofs auf
dem Burgberge in Grebenstein, aufgenommen im November 1936 und März 1937
durch Baruch Wormser von Grebenstein; Laufzeit 1851- 1934 (1936-1937);
enthält hebräische und deutsche Grabinschriften; enthält auch Angaben
zu Holzhausen und Immenhausen; darin auch: Hinweis auf die Anlegung des
jüdischen Friedhofs in Grebenstein 1851 und vorherige Nutzung des
jüdischen Friedhofs der Kultusgemeinde in Membressen https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5319767
|
Literatur:
 | Umfassende Literaturhinweise siehe bei Michael
Dorhs [Zsst.]: Bibliographie zur Kultur und Sozialgeschichte der
Jüdinnen und Juden im Bereich der alten Landkreise Hofgeismar, Kassel,
Wolfhagen und in der Stadt Kassel. Ausführliche Zusammenstellung. 208 S.
Eingestellt als pdf-Datei (Stand
30. Dezember 2024). |
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 276-277. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 76. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 413-415. |
 | Anke Schwarz: Jüdische
Gemeinden zwischen bürgerlicher Emanzipation und Obrigkeitsstaat. Studien über
Anspruch und Wirklichkeit jüdischen Lebens in kurhessischen Kleinstädten im
19. Jahrhundert. 2002. S. 128-131. |
 |  Hinweis
auf das Buch von Martin Doerry: "Mein verwundetes Herz".
Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. Deutscher Taschenbuch Verlag 2004. ISBN
13: 978-3423341462. 384 S. Hinweis
auf das Buch von Martin Doerry: "Mein verwundetes Herz".
Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. Deutscher Taschenbuch Verlag 2004. ISBN
13: 978-3423341462. 384 S.
Erschien auch in der SPIEGEL-Edition Band 27. 2007 (Abbildung links)
Zu diesem Buch: Lilly Jahn geb. Schlüchterer stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, wurde Ärztin, heiratete einen nicht-jüdischen Studienkollegen und gründete mit ihm eine erfolgreiche Arztpraxis in
Immenhausen bei Kassel. Das Paar bekommt fünf Kinder, doch dem zunehmenden Druck der Nazis auf die
'Mischehe' hält Lillys Mann nicht stand. 1942 lässt er sich scheiden und heiratet eine Kollegin.
Lilly Jahn wird in einem 'Arbeitserziehungslager' inhaftiert, und es beginnt ein umfangreicher Briefwechsel, der den verzweifelten Kampf der Mutter und ihrer Kinder um den Zusammenhalt der Familie, um die Aufrechterhaltung von »Normalität« und gegen die Hoffnungslosigkeit veranschaulicht. Doch 1944 ist das Schicksal der Familie besiegelt: Lilly Jahn wird nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Lilli Jahn geb. Schlüchterer war die Mutter von Gerhard Jahn,
Justizminister im Kabinett von Willi Brandt (siehe Wikipedia-Artikel
Gerhard Jahn).
Die Eltern von Lilli Jahn waren der Kölner Fabrikant Josef Schlüchterer
(Sohn des Herrenschneiders Anselm Schlüchterer in Zeitlofs)
und seine Frau Paula geb. Schloß (Tochter des Viehhändlers - in Oberlauringen,
dann in Halle an der Saale - Moritz Schloß).
|
 | Michael Dorhs: Der Mann mit den Inschriften. Eine
Erinnerung an Baruch Wormser (1873-1959) aus Grebenstein. Veröffentlicht
(ohne Anmerkungen) im Jahrbuch 2024 Landkreis Kassel. S. 64-680.
Eingestellt als pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Grebenstein
Hesse-Nassau. In nearby Immenhausen Jews fell victim to the Black Death
persecutions of 1348-49 and a community was not established in Grebenstein until
the 18th century. It numbered 105 (4 % of the total) in 1835. The Jews
maintained an elementary school (1831-1911) and dedicated a new synagogue in
1894. Affiliated with Kassel's rabbinate, the community dwindled to 50 in 1932
and the last ten Jews disposed of their synagogue before Kristallnacht
(9-10 November 1938). A few emigrated, but 34 of those who remained in Germany
perished during the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|