|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Heilbronn
Heilbronn
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Hier: Allgemeine Texte zur jüdischen
Geschichte der Stadt
sowie Texte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Hinweis: viele Texte auf dieser Seite
müssen noch abgeschrieben und teilweise mit Anmerkungen versehen werden,
können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.
Übersicht:
Allgemeine Texte zur jüdischen Geschichte in
Heilbronn
Rückblick auf die jüdische Geschichte der Stadt - erste
jüdische Personen sind wieder zugezogen (1845)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. September 1845: "21. August (1845). Zu Heilbronn am Neckar
wohnen seit einigen Jahren wieder etliche Juden. Über die früher dort
ansässig gewesenen entnehmen wir einem dortigen Blatt folgende Notizen aus
glaubwürdiger Hand. Die älteste Synagoge soll da gewesen sein, wo jetzt die
Neubauer'sche Apotheke steht. Sie wurde um das Jahr 1347 bei der
Judenverfolgung verbrannt. 1357 wurde eine neue Synagoge auf der Stelle der
Lohthorstraße erbaut, wo jetzt das Haus No. 456 steht; diese Straße hieß bis
1826 'Judenstraße'. Hinter diesem Haus war der Friedhof der Juden, bis diese
zwischen 1470-1476 vertrieben wurden. Die Synagoge wurde in ein Wohnhaus
verwandelt, das 1771 abbrannte. Bis dahin hatte es noch mehrere hebräische
Inschriften. Das Eckhaus schräg an der Lammgasse No. 686 war das Judenbad;
hierzu gehörte der Brunnen vor diesem Haus. Nach Vertreibung der Juden wurde
jenes eine öffentliche Badestube. 1837 wurde in der Nähe des Wilhelmskanals
ein nun 437 Jahr alter Grabstein aufgefunden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. September 1845: "21. August (1845). Zu Heilbronn am Neckar
wohnen seit einigen Jahren wieder etliche Juden. Über die früher dort
ansässig gewesenen entnehmen wir einem dortigen Blatt folgende Notizen aus
glaubwürdiger Hand. Die älteste Synagoge soll da gewesen sein, wo jetzt die
Neubauer'sche Apotheke steht. Sie wurde um das Jahr 1347 bei der
Judenverfolgung verbrannt. 1357 wurde eine neue Synagoge auf der Stelle der
Lohthorstraße erbaut, wo jetzt das Haus No. 456 steht; diese Straße hieß bis
1826 'Judenstraße'. Hinter diesem Haus war der Friedhof der Juden, bis diese
zwischen 1470-1476 vertrieben wurden. Die Synagoge wurde in ein Wohnhaus
verwandelt, das 1771 abbrannte. Bis dahin hatte es noch mehrere hebräische
Inschriften. Das Eckhaus schräg an der Lammgasse No. 686 war das Judenbad;
hierzu gehörte der Brunnen vor diesem Haus. Nach Vertreibung der Juden wurde
jenes eine öffentliche Badestube. 1837 wurde in der Nähe des Wilhelmskanals
ein nun 437 Jahr alter Grabstein aufgefunden." |
Turnfest in Heilbronn unter Teilnahme jüdischer Sportler
(1846)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. September 1846: "Aus Württemberg, 20. August.
(Privatmitteilung) Am 3. August fand in Heilbronn ein großes Turnfest statt,
wobei gegen 1000 Turner aus Stuttgart, Ulm, Ellwangen, Heidelberg, Mannheim,
Frankfurt, Mainz, Hanau, Köln, Schleswig usw. mitwirkten und durch die
Schönheit und Riesenhaftigkeit ihrer körperlichen Übungen allgemeine
Bewunderung erregten. Das Interessanteste am Feste war übrigens die
allgemeine Versammlung der Turner am Vorabende, die zur Beratung der für ein
kräftiges Gedeihen des Turnwesens förderlichen Interessen abgehalten wurde.
Hier galt es namentlich die geistige Seite des Turnens - die Heranbildung
eines kräftigen, gesitteten und für alles Gute empfänglichen, gleich
gesinnten deutschen Männerstammes - zu vertreten und wurden hierbei die
schönsten Reden gehalten. Diese Versammlung ist es aber auch, welche in
diesen Blättern Erwähnung verdient, denn hier zeichnete sich ein Israelit -
Hofgerichtsadvokat Eller von Mannheim - am Vorteilhaftesten aus. Derselbe
wusste durch die Herzlichkeit, Klarheit und Freisinnigkeit seiner Rede alle
Anwesenden so zu begeistern, dass er sich eines allgemeinen, fortwährenden
Beifalls zu erfreuen hatte. Unbeschreiblich gut war daher auch der Eindruck,
den das Auftreten eines solch wackern Israeliten auf das Volk machte.
Männer, die früher die abgeschmacktesten Vorurteile gegen Israeliten
äußerten, hört man jetzt mit Begeisterung von diesem Ehrenmanne sprechen und
so äußerte sich aller Orten eine günstige Rückwirkung hievon für Israeliten. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. September 1846: "Aus Württemberg, 20. August.
(Privatmitteilung) Am 3. August fand in Heilbronn ein großes Turnfest statt,
wobei gegen 1000 Turner aus Stuttgart, Ulm, Ellwangen, Heidelberg, Mannheim,
Frankfurt, Mainz, Hanau, Köln, Schleswig usw. mitwirkten und durch die
Schönheit und Riesenhaftigkeit ihrer körperlichen Übungen allgemeine
Bewunderung erregten. Das Interessanteste am Feste war übrigens die
allgemeine Versammlung der Turner am Vorabende, die zur Beratung der für ein
kräftiges Gedeihen des Turnwesens förderlichen Interessen abgehalten wurde.
Hier galt es namentlich die geistige Seite des Turnens - die Heranbildung
eines kräftigen, gesitteten und für alles Gute empfänglichen, gleich
gesinnten deutschen Männerstammes - zu vertreten und wurden hierbei die
schönsten Reden gehalten. Diese Versammlung ist es aber auch, welche in
diesen Blättern Erwähnung verdient, denn hier zeichnete sich ein Israelit -
Hofgerichtsadvokat Eller von Mannheim - am Vorteilhaftesten aus. Derselbe
wusste durch die Herzlichkeit, Klarheit und Freisinnigkeit seiner Rede alle
Anwesenden so zu begeistern, dass er sich eines allgemeinen, fortwährenden
Beifalls zu erfreuen hatte. Unbeschreiblich gut war daher auch der Eindruck,
den das Auftreten eines solch wackern Israeliten auf das Volk machte.
Männer, die früher die abgeschmacktesten Vorurteile gegen Israeliten
äußerten, hört man jetzt mit Begeisterung von diesem Ehrenmanne sprechen und
so äußerte sich aller Orten eine günstige Rückwirkung hievon für Israeliten.
Es ist erfreulich, diese rühmliche Anerkennung und Auszeichnung eines
Israeliten bei Gelegenheit eines Turnfestes mitteilen zu können. Möchten
diesem ehrenden Beispiele recht viele folgen und die Israeliten, um mit den
Worten eines unserer berühmtesten Abgeordneten zu sprechen, sich nicht so
sehr an die großen Machthaber anlehnen, als vielmehr sich mit dem Volke
befreunden und wir werden alsdann schneller und auf festerem Grunde
emanzipiert werden. Ein Turner aus Schwaben." |
In Heilbronn leben 12 jüdische Personen
(1847)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"
vom 7. März 1847: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"
vom 7. März 1847: |
In Heilbronn, Ulm und Esslingen bestehen wieder große
jüdische Gemeinden (1867)
 Artikel in der Zeitschrift "Chananja"
vom 15. Mai 1867: "Aus Württemberg, im Mai (1867). Die drei
größten ehemaligen Reichsstädte Württembergs
Ulm, Heilbronn und Esslingen, die durch ihre Judenhetzen und
Vertreibungen ihrer Mitbürger berüchtigt waren, beherbergen jetzt große
Judengemeinden. In Ulm haben die dortigen
Israeliten ein Haus um 30.000 fl. gekauft, um an dessen Stelle einen
israelitischen Tempel zu errichten. In Heilbronn wird eben ein
jüdischer Friedhof angelegt, in Esslingen
fällt der bisherige Friedhof in den
städtischen Bauplan und muss geschlossen werden. Der Stadtrat will der
jüdischen Gemeinde das Recht einräumen, ihre Toten in den allgemeinen
städtischen, bis jetzt spezifisch-christlichen Friedhof zu beerdigen, die
Juden aber wollen einen besonders abgeteilten Raum und der Stadtrat will auf
dem Totenfelde kein Ghetto dulden. Die Frage ist von ihrer rituellen Seite
noch nicht erledigt, man ist auf die Entscheidung gespannt, da Gutachten von
Rabbinen eingefordert sind" Artikel in der Zeitschrift "Chananja"
vom 15. Mai 1867: "Aus Württemberg, im Mai (1867). Die drei
größten ehemaligen Reichsstädte Württembergs
Ulm, Heilbronn und Esslingen, die durch ihre Judenhetzen und
Vertreibungen ihrer Mitbürger berüchtigt waren, beherbergen jetzt große
Judengemeinden. In Ulm haben die dortigen
Israeliten ein Haus um 30.000 fl. gekauft, um an dessen Stelle einen
israelitischen Tempel zu errichten. In Heilbronn wird eben ein
jüdischer Friedhof angelegt, in Esslingen
fällt der bisherige Friedhof in den
städtischen Bauplan und muss geschlossen werden. Der Stadtrat will der
jüdischen Gemeinde das Recht einräumen, ihre Toten in den allgemeinen
städtischen, bis jetzt spezifisch-christlichen Friedhof zu beerdigen, die
Juden aber wollen einen besonders abgeteilten Raum und der Stadtrat will auf
dem Totenfelde kein Ghetto dulden. Die Frage ist von ihrer rituellen Seite
noch nicht erledigt, man ist auf die Entscheidung gespannt, da Gutachten von
Rabbinen eingefordert sind" |
Zur Geschichte der Juden in Heilbronn (Beitrag von 1868)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. September 1868: "Zur Geschichte der Israeliten in Heilbronn. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. September 1868: "Zur Geschichte der Israeliten in Heilbronn.
Der israelitische Friedhof in Heilbronn, welcher am 31. v. M. (August)
feierlich eingeweiht wurde, ist die erste Eigentumserwerbung dieser erst
seit dem Januar 1862 kreierten israelitischen Gemeinde, welche bereits über
100 Familien zu ihren Genossen zählt, und in welche seit etlichen Jahren, um
ihrer Lage und Größe willen, der Sitz des Bezirksrabbinats, früher in
Lehren, vermöge allerhöchster
Entschließung verlegt worden ist. Die zweite Erwerbung wird wohl eine
Synagoge sein, wozu zur Zeit ein kürzlich neueingerichteter Saal in der
Deutschhofkaserne mietweise benützt wird. Es sei uns hierbei ein
historischer Rückblick gestattet. Aus den Geschichtswerken von Jäger,
Sattler und Kopp etc. geht hervor, dass die erste geschichtlich
verbürgte Nachricht über die Juden in Heilbronn dem Ende des 13.
Jahrhunderts angehört, während über die noch ältere Geschichte derselben die
Quellen schweigen. Übrigens war ihre Anzahl anno 1316 schon so bedeutend,
dass die von ihnen entrichtete Steuer 666 2/3 Pfund Heller betrug. Im Jahre
1348 waren sie eine so zahlreiche Menge, dass sie eine eigene Gasse vom
Hafenmarkt bis gegen das Lohtor inne hatten. Die dortige Synagoge wurde
damals ein Raub der Flammen; allein im Jahre 1357 hatte die Gemeinde schon
wieder eine neue Synagoge erbaut, obgleich die zu jener Zeit vorgekommenen
Erpressungen und Beraubungen dem Gedeihen dieser Corporation sehr hinderlich
gewesen waren. Im Jahre 1401 wohnten wieder nur 3 Judenfamilien in der
Stadt. Auch im Jahre 1417 muss die Anzahl der in Heilbronn wohnenden
Israeliten noch eine sehr geringe gewesen sein, da die gesamte an die Herren
von Weinsberg von ihnen zu zahlende Steuer damals nur 10 Gulden betrug. |
 Von
dem dortigen 'Judenkirchhofe', in welchen auch die Israeliten aus den
umliegenden Ortschaften gegen einen Zoll ihre Leichen brachten, nahm die
Stadt in jenem Jahre 1/4 jährig 8 Gulden auf. Der Rat der Stadt dehnte auch
auf sie das Stadtprivilegium aus, nach welchem keiner ihrer Einwohner vor
ein auswärtiges Gericht geladen werden sollte, indem z. B. der
Unterschreiber Ostertag von Heilbronn laut seinem Gewaltbriefe von
1473 vor dem Freigrafen von Brunkhausen erschien, um die Juden der Stadt von
einem ihnen angesetzten Rechtstage abzufordern. Dennoch treffen wir anno
1476 nur wenige Juden mehr in der Stadt an und 1490 überließ der kaiserliche
Kammerfiscal die 'Judenschule' und das 'Judenbegräbnis" dem Rate um 250
Gulden rheinisch, ungeachtet Philipp von Weinsberg gegen diesen Verkauf sich
aufgelehnt hatte. Der erwähnte Begräbnisplatz wurde später, nachdem die
Juden die Stadt gänzlich verlassen hatten, überbaut und zwar 1589 mit der
Amtswohnung des städtischen Syndicus (jetzt die Oberamtei) und 1765 mit dem
Stadtarchiv. Von den jüdischen Leichensteinen wurden mehrere bei der
Anlegung einer Schießstätte, da wo jetzt der neue Hafen ist, verwendet,
jedoch in umgekehrter Lage, und hierdurch blieben zwei derselben, von denen
der eine im städtischen Archive zu Heilbronn und der andere auf dem
Sontheimer israelitischen Begräbnisplatze
zu sehen ist, wohl erhalten. Sie datieren aus den Jahren 1408 und 1420.
(Sollten diese Denkmale nicht in den neuen hiesigen israelischen Friedhof
versetzt werden?) Erst vor etlichen Jahren fand man auch bei dem Umbau des
Hintergebäudes zum früheren 'Dreikönig' (an der Ecke der Kram- und
Gerberstraße) Bruchstücke von jüdischen Grabsteinen mit erhabenen
Buchstaben; es fehlte jedoch Namen und Jahreszahl auf dem Reste des
Grabdenkmals. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte in 'Heilprun"
der bedeutende Talmudist R. Salomo Spiro, wahrscheinlich als Rabbiner, der
später in gleicher Eigenschaft nach Landau
ging. Von
dem dortigen 'Judenkirchhofe', in welchen auch die Israeliten aus den
umliegenden Ortschaften gegen einen Zoll ihre Leichen brachten, nahm die
Stadt in jenem Jahre 1/4 jährig 8 Gulden auf. Der Rat der Stadt dehnte auch
auf sie das Stadtprivilegium aus, nach welchem keiner ihrer Einwohner vor
ein auswärtiges Gericht geladen werden sollte, indem z. B. der
Unterschreiber Ostertag von Heilbronn laut seinem Gewaltbriefe von
1473 vor dem Freigrafen von Brunkhausen erschien, um die Juden der Stadt von
einem ihnen angesetzten Rechtstage abzufordern. Dennoch treffen wir anno
1476 nur wenige Juden mehr in der Stadt an und 1490 überließ der kaiserliche
Kammerfiscal die 'Judenschule' und das 'Judenbegräbnis" dem Rate um 250
Gulden rheinisch, ungeachtet Philipp von Weinsberg gegen diesen Verkauf sich
aufgelehnt hatte. Der erwähnte Begräbnisplatz wurde später, nachdem die
Juden die Stadt gänzlich verlassen hatten, überbaut und zwar 1589 mit der
Amtswohnung des städtischen Syndicus (jetzt die Oberamtei) und 1765 mit dem
Stadtarchiv. Von den jüdischen Leichensteinen wurden mehrere bei der
Anlegung einer Schießstätte, da wo jetzt der neue Hafen ist, verwendet,
jedoch in umgekehrter Lage, und hierdurch blieben zwei derselben, von denen
der eine im städtischen Archive zu Heilbronn und der andere auf dem
Sontheimer israelitischen Begräbnisplatze
zu sehen ist, wohl erhalten. Sie datieren aus den Jahren 1408 und 1420.
(Sollten diese Denkmale nicht in den neuen hiesigen israelischen Friedhof
versetzt werden?) Erst vor etlichen Jahren fand man auch bei dem Umbau des
Hintergebäudes zum früheren 'Dreikönig' (an der Ecke der Kram- und
Gerberstraße) Bruchstücke von jüdischen Grabsteinen mit erhabenen
Buchstaben; es fehlte jedoch Namen und Jahreszahl auf dem Reste des
Grabdenkmals. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte in 'Heilprun"
der bedeutende Talmudist R. Salomo Spiro, wahrscheinlich als Rabbiner, der
später in gleicher Eigenschaft nach Landau
ging.
Um das Jahr 1524 bat ein jüdischer Arzt, Gumprecht von Löwenstein,
den Rat, seine Kunst und Arzenei ausüben, den Armen um Gottes Willen und den
Reichen um eine geziemende Belohnung dienen zu dürfen. Er motivierte seine
Bitte auch damit, der Rat möchte doch die gemeinen kranken Bürger und
Bürgerinnen der Stadt bedenken, dass sie ihn mit großen Kosten holen lassen
müssten. Ihm und einem andern jüdischen Arzte von
Wimpfen wurde der Zutritt gestaltet,
aber nur so lange es einem Rate gefalle. Die Judenschaft in
Neckarsulm bestand damals fast ganz
aus früher Heilbronner Juden, während jetzt nur ein Filial mit 4 - 5
Familien in der Nachbarstadt existiert, das allerdings noch Spuren
ehemaliger Größe besitzt, z. B. einen Friedhof, Thoraschmuck und
dergleichen. -
In den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges kamen auch
auswärtige Juden wieder in die Stadt. Es geschah am 21. August 1645, als das
feindliche schwedisch-französische Heer vor der Stadt ankam. Ein Aktenstoß
auf dem Stadtarchive enthält Mitteilungen hierüber. Im Jahre 1667 wurde über
diese Eingewanderten eine besondere Verordnung verfasst.
Im Jahre 1831 wurde erstmals ein Israelite der gegenwärtigen
israelitischen Kirchengemeinde Bürger der Stadt. Im Jahre 1861 waren bereits
21 jüdische Familien hier bürgerlich geworden und am 23. November desselben
Jahres bezogen sie provisorisch einen Betsaal in den Räumen des
ehemaligen Deutschordenkommando, dessen Gebäude jetzt zu einem Sitze des
Kreisgerichtshofs umgeschaffen wird. In Folge dieses Umbaues ist die
Synagoge, wie schon Eingangs erwähnt wurde, in einen andern Bau dieses
Staatsgebäudes verlegt und mit nicht unerheblichen Kosten von der
israelitischen Gemeinde hiezu eingerichtet worden. Heute besteht die
israelitischen Gemeinde aus 54 bürgerlichen und 57 domizilierenden Familien,
also aus etwa 555 Seelen.
Die Stadtgemeinde hat sich bei Anlegung des neuen Friedhofes vielfach
freundlich und unterstützend bewiesen. Der Stadtrat hat durch eine besondere
Kommission den schön gelegenen Acker zu dem jetzigen Begräbnisplatze
empfohlen; die bürgerlichen Kollegien haben vorläufig 300 fl. zu den Kosten,
die sich im Ganzen auf 10.000 fl. belaufen mögen, verwilligt und die Straße
und den Pfad vom Wärterhäuschen an bis zum Tore des Friedhofs auf
Stadtkosten schön herrichten lassen. Auch die K. Staatsbehörden dahier haben
das Werk gefördert, indem sie es bei Seiner Majestät dem Könige
befürworteten, dass ein Teil von dem Güterkomplexe zu diesem Zwecke käuflich
überlassen und die Pflanzen aus dem exotischen Garten zu Hohenheim um einen
ermäßigten Preis für den Friedhof abgegeben werden.
So konnte sich denn am Tage der Einweihung die ganze Einwohnerschaft
jeglicher Konfession und aller Stände an der Feier beteiligen, welche durch
die Reden sowohl des Rabbinen, Dr. Engelbert, als des Lehrers und
Vorsängers, J. Löwenstein, eine sehr würdige geworden ist. Es mögen 500
Personen im festlichen Zuge gewesen sein, und eine mindestens eben so große
Menge von Menschen sammelte sich vor der Umzäumung, um die Feierlichkeit mit
anzusehen, weil sie in der Eile sich nicht mehr festlich hatten umkleiden
können, als sie von der Einweihung Kunde erhalten hatten. Ern eingetretener
Sterbfall hatte solche Beschleunigung geboten.
Möge dieses Werk des Friedens ein ewiges Zeichen der Liebe und Harmonie
sein, in der hier die Einwohner verschiedener Religionen neben und
füreinander wirken und leben.". |
Zur
Geschichte der Juden in Heilbronn (Beitrag von
Bezirksrabbiner Dr. Beermann, 1919)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Juni 1919: "Aus Heilbronns jüdischer Vergangenheit. Von
Bezirksrabbiner Dr. Beermann (Heilbronn). Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Juni 1919: "Aus Heilbronns jüdischer Vergangenheit. Von
Bezirksrabbiner Dr. Beermann (Heilbronn).
Soeben ist der 19. Band des großen Werkes ' Württembergische
Geschichtsquellen" erschienen, den die Königliche Kommission für
Landesgeschichte herausgibt. Auch der Geschichtsschreiber des Judentums wird
das stattliche Buch von fast 890 Seiten gern befragen und hier wie bei den
vorhergehenden Zeilen des 'Urkundenbuches der Stadt Heilbronn' von der
zuverlässigen Darbietung Dr. Moritz v. Rauchs mancherlei Förderliches
erfahren.
Der 3. Band umfasst etwa die ersten 30 Jahre des 16. Jahrhunderts. — Ehe wir
hier die neu gebotenen Tatsachen aus der jüdischen Geschichte Heilbronns
bieten, wollen wir die wesentlichen Einzelheiten, die man über Juden in
Heilbronn bis zu dieser Zeit hat feststellen können, kurz skizzieren.
Ein Grabstein der Gutlis beweist, dass Juden bereits zur Römerzeit in der
Gegend Heilbronns wohnten. Gelegentlich der Judenverfolgung unter
Rindfleisch (1298) wird Heilbronn im Mainzer Memoirenbuch erwähnt.
1316 schenkt Ludwig der Bayer das an Juden Heilbronns geschuldete Geld der
Stadt Heilbronn.
1348 während des Schwarzen Todes werden Juden in der Lohtorstraße verbrannt
und ihre Synagoge zerstört.
1385 nimmt König Wenzel Heilbronner Juden gefangen und erpresst ihnen Geld.
1414 scheinen nur drei Juden in Heilbronn gelebt zu haben. 1467 wird einem
Juden Mose von Augsburg mit Gesinde
(Schulklopfer und Totengräber) die Aufenthaltserlaubnis gegeben und zu
gleicher Zeit werden in rabbinischen Quellen ein Rabbi Spiro und die
jüdischen Bewohner Heilpruns erwähnt.
1482 empfiehlt Kaiser Friedrich, dem Juden Levi das Wohnrecht in Heilbronn
zu geben-
So spärlich die Quellen fließen, sie zeigen, wie sehr die Juden Heilbronns
an dem schweren Schicksal teilhatten, das ihre Geschichte im
mittelalterlichen Deutschland so tief traurig gestaltete. Weiter: 1502
werden zwei Talheimer Juden misshandelt
und die Täter beim Torwart des Fleiner Tors gefangen gesetzt.
1521 beklagt sich ein Jude Abraham, dass man ihn nicht in Heilbronn
einlasse. Bernhard von Liebenstein bittet den Rat von Heilbronn, diesem
Juden Wohnrecht zu geben, da dieser Jude bei 30 Jahren im Lande gesessen sei
und sich keines Wuchers schuldig gemacht habe. Ebenso bittet Kunigunde von
Heimberg, ihre Juden in die Stadt zu lassen. Desgleichen verhandelt Eberhard
von Frauenberg seiner Juden halber mit dem Rat, die Juden an Markttagen
einzulassen, während die Juden gehalten seien, ihre Abzeichen öffentlich zu
tragen und das bestimmte Schirmgeld zu geben.
1523 soll nur noch der Jude Aron von
Wimpfen in die Stadt gelassen werden; zu dieser Zeit scheinen Juden als
ständige Bewohner in Heilbronn nicht Vorhanden gewesen zu sein, denn der Rat
erklärt, an Kaiser Karl kein Judengeld mehr geben zu müssen.
1529 müssen aber schon wieder Juden dort gewesen sein, denn die Barfüßer
beklagen sich über sie; ein jüdischer Arzt Gumprecht von Löwenstein wird
ausdrücklich erwähnt.
Der Vollständigkeit halber auch ein paar Data aus späterer Zeit:
1540 erfolgt eine Beschwerde an Kaiser Ferdinand gegen die unverschämte und
gräuliche Judenheit.
1712 schreibt der Rat, dass seit Menschengedenken keine Juden in Heilbronn
wohnen.
5. Mai 1831 wird der erste Jude wieder Bürger, am 23. November 1861 werden
21 Familien erwähnt mit einem Synagogensaal im Deutsch-Ordens-Kommando.
1865 schreibt Dr. Wiener im Jahrbuch 'Achawa" über die Juden in Heilbronn:
'Hoffentlich gelingt es der Gemeinde, eine selbständige Synagoge zu
errichten, um Gott in seiner heiligen Wohnung zu preisen, der die
Vereinsamten zur Heimat zurückbringt.'
Heute hat die Gemeinde Heilbronns nicht nur eine Prachtsynagoge, eine der
schönsten in ganz Deutschland, sondern sie ist zu der stattlichen Seelenzahl
von 1200 und zu 320 Familien angewachsen und zeichnet sich durch ein
vorbildliches Interesse auf allen Gebieten jüdischen Lebens und durch rege
Mitarbeit an allen vaterländischen Aufgaben aus." |
Publikation
von Dr. Oskar Mayer zur Geschichte der Juden in Heilbronn zum
50-jährigen Bestehen der Synagoge (1927)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Juni 1927: "Die Geschichte der Juden in Heilbronn. Festschrift
zum 50jährigen Bestehen der Synagoge in Heilbronn. Verfasst von Rechtsanwalt
Dr. Oskar Mayer. Heilbronn am Neckar. Mai 1927. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. Juni 1927: "Die Geschichte der Juden in Heilbronn. Festschrift
zum 50jährigen Bestehen der Synagoge in Heilbronn. Verfasst von Rechtsanwalt
Dr. Oskar Mayer. Heilbronn am Neckar. Mai 1927.
Das 78 Seiten starke Buch präsentiert sich äußerlich schon durch seine
vorzügliche Ausstattung. Es ist ja eine Festschrift. Dem entspricht auch der
innere Gehalt. Heilbronn kann auf ein hohes Alter der jüdischen Gemeinde
zurückschauen. Vom Jahre 1298 meldet das Nürnberger Memorbuch 243 Märtyrer
Heilbronns infolge der grässlichen Verfolgungen. Im Dreißigjährigen Krieg
finden die Juden von Neckarsulm Schutz
in Heilbronn, befürwortet vom französischen Kommandanten. Für die späteren
Jahrhunderte ist das Schutzjudenwesen maßgebend, bis es 1828 aufgegeben
worden ist. 1885 zählte Heilbronn 1013 jüdische Seelen. Von den 861
Mitgliedern der Gemeinde beim Kriegsausbruch (sc. 1914) nahmen 191 am Kriege
teil, davon 128 Frontsoldaten; gefallen sind 28, verwundet wurden 48. Für
den 1891 verstorbenen Rabbiner Dr. Engelbert übernahm Rabbiner Kahn -
Laupheim das Rabbinat. Seit 1913 amtiert
dort Rabbiner Dr. Beermann, früher Insterburg. Die Festschrift dürfte
namentlich in Württemberg hohes Interesse finden, da Heilbronn mit zu den
ersten Gemeinden des Landes zählt." |
Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Über den 1863 durch Lehrer und Vorsänger Jakob Löwenstein
gegründeten Armenunterstützungsverein
(1865)
Anmerkung: hebräische Zitate sind noch zu übersetzen
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Mai 1865: "Heilbronn am Neckar. Hervorgerufen durch die
unermüdete Tätigkeit für die Entwicklung der Gemeinde-Institute, welche
unser Lehrer und Vorsänger Löwenstein entfaltet, wurde im Jahr 1863 in
hiesiger Gemeinde auch ein Verein unter dem Namen Chewrat osrei
dalim (Armenunterstützungsverein) gegründet, der die Aufgabe hat,
auswärtigen hierher kommenden jüdischen Armen aus der durch die Beiträge der
Mitglieder gebildeten Kasse eine Unterstützung zu reichen, um hierdurch
zugleich den lästigen Hausbettel zu beseitigen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. Mai 1865: "Heilbronn am Neckar. Hervorgerufen durch die
unermüdete Tätigkeit für die Entwicklung der Gemeinde-Institute, welche
unser Lehrer und Vorsänger Löwenstein entfaltet, wurde im Jahr 1863 in
hiesiger Gemeinde auch ein Verein unter dem Namen Chewrat osrei
dalim (Armenunterstützungsverein) gegründet, der die Aufgabe hat,
auswärtigen hierher kommenden jüdischen Armen aus der durch die Beiträge der
Mitglieder gebildeten Kasse eine Unterstützung zu reichen, um hierdurch
zugleich den lästigen Hausbettel zu beseitigen.
Dem Vereine traten alsbald 36 Genossen bei, und heute ist die Zahl der
Mitglieder schon auf etwa 70 angewachsen, durch deren regelmäßige Beiträge
und Spenden die Kasse pr. Nissan 1863/64 circa 600 fl. in 510 Portionen, und
pr. 1864/65 ungefähr 850 fl. in 664 Gaben an in- und ausländische Armen
verabreichen konnte. — Man hat der Berichterstattung in den
Generalversammlungen der Vereinsmitglieder mit Vergnügen entnommen, dass die
Zahl der Württemberger von der der Fremden, die nicht bloß aus den
Nachbarländern und den übrigen deutschen Gebieten, sondern auch aus dem
fernen Osten, Westen und Süden Europas und dem Orient uns besuchen, kaum ein
Achtel beträgt. Sehen wir hier einerseits das Schriftwort ... in Erfüllung
gehen, so bewährt sich andererseits - Gott sei Dank - auch die
Verheißung: ..., indem nicht bloß wenige Inländer die Gaben suchen, sondern
in der Gemeinde selbst Keiner ist, der daraus Unterstützung empfängt und
nicht vielmehr einen Beitrag zur Linderung der menschlichen Leiden leistet.
... Dankenswert ist auch die Bereitwilligkeit, wie von Jahr zu Jahr
einzelne Bürger dem lästigen Geschäfte der Anweisung und Ausbezahlung der
Armengaben und der Buchführung hierüber sich unterziehen ... " |
Unruhe durch Veränderungen der Leichenordnung und der
Rabbinatsfrage (1866)
Anmerkung: hebräische Zitate sind noch zu übersetzen
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. August 1866: "In Heilbronn soll, wie man hört, die
Veränderung der bisherigen Leichenordnung, wonach bisher am Scheideorte, wo
die Mehrzahl der Begleiter den Leichenzug verlässt, während nur etliche
Verwandte bis auf den entfernten Friedhof mitgehen, Gebet und Leichenrede
gehalten worden sind, große Aufregung machen. Die lokalen Blätter haben die
Sache bereits ventiliert und eine Beschwerde gegen die Neuerung soll viele
Unterschriften erhalten haben. Ja, bei der jüngsten Beerdigung soll sogar
trotz der missliebigen, vom Rabbinen provozierten Anordnung, dennoch ... an
dem Scheideorte gebetet worden sein. .... — Auch die Rabbinatsfrage, die in
dieser Gemeinde so viel Zwiespalt erzeugt, ist noch immer nicht definitiv
erledigt und die hiesige politische Krisis ist nicht geeignet, große
Finanzoperationen zu unternehmen, weil die Zunahme der Gemeinde gehemmt und
der Wohlstand des Einzelnen großen Gefahren ausgesetzt ist. S." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. August 1866: "In Heilbronn soll, wie man hört, die
Veränderung der bisherigen Leichenordnung, wonach bisher am Scheideorte, wo
die Mehrzahl der Begleiter den Leichenzug verlässt, während nur etliche
Verwandte bis auf den entfernten Friedhof mitgehen, Gebet und Leichenrede
gehalten worden sind, große Aufregung machen. Die lokalen Blätter haben die
Sache bereits ventiliert und eine Beschwerde gegen die Neuerung soll viele
Unterschriften erhalten haben. Ja, bei der jüngsten Beerdigung soll sogar
trotz der missliebigen, vom Rabbinen provozierten Anordnung, dennoch ... an
dem Scheideorte gebetet worden sein. .... — Auch die Rabbinatsfrage, die in
dieser Gemeinde so viel Zwiespalt erzeugt, ist noch immer nicht definitiv
erledigt und die hiesige politische Krisis ist nicht geeignet, große
Finanzoperationen zu unternehmen, weil die Zunahme der Gemeinde gehemmt und
der Wohlstand des Einzelnen großen Gefahren ausgesetzt ist. S." |
5. Jahresbericht des Armenunterstützungsvereins
(1868)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Mai 1868: "Heilbronn. Am 5. Halbfeiertag von Pessach
wurde in der Generalversammlung der hiesigen chewrat osrei dalim
(Armenunterstützungsverein) der 5. Jahresbericht von dem Lehrer Löwenstein
daselbst erstattet. Die Einnahmen des Vereins, fl. 1310. 37 kr. betragend,
blieben hinter den Ausgaben für 1031 durchreisende Armen um fl. 3. 8 kr.
zurück, obschon die Hälfte des Reservefonds durch Verkauf einer der
Obligationen zu den laufenden Ausgaben verwendet worden und die Zahl der
Mitglieder des Vereins auf 88 gestiegen war. Das Kriegsjahr von 1866 und die
Hungersnot in den preußischen und russischen Provinzen hat die Zahl der
Armen, unter welchen sich Gott sei Dank nur 47 Inländer befanden,
leider bedenklich erhöht und den Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge
wirksam unterstützt. Fast alle Vereinsgenossen, deren Anzahl im laufenden
Jahre auf über 100 anwachsen wird, erhöhten ihre bisherigen regelmäßigen
Quartalzahlungen um 25 bis 100, ja 200 %, und der Ausschuss des Vereins (Chewra)
ist in die angenehme Lage versetzt, auch die Gaben in entsprechendem Maße zu
erhöhen. Diese Erhöhung wird aber nur dann von Dauer sein, wenn die Armen
dem lästigen und entehrenden Hausbettel ganz und gar entsagen, dessen
Aufhören die Wohltäter zur unerlässlichen Bedingung ihres löblichen
Entschlusses gemacht haben. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Mai 1868: "Heilbronn. Am 5. Halbfeiertag von Pessach
wurde in der Generalversammlung der hiesigen chewrat osrei dalim
(Armenunterstützungsverein) der 5. Jahresbericht von dem Lehrer Löwenstein
daselbst erstattet. Die Einnahmen des Vereins, fl. 1310. 37 kr. betragend,
blieben hinter den Ausgaben für 1031 durchreisende Armen um fl. 3. 8 kr.
zurück, obschon die Hälfte des Reservefonds durch Verkauf einer der
Obligationen zu den laufenden Ausgaben verwendet worden und die Zahl der
Mitglieder des Vereins auf 88 gestiegen war. Das Kriegsjahr von 1866 und die
Hungersnot in den preußischen und russischen Provinzen hat die Zahl der
Armen, unter welchen sich Gott sei Dank nur 47 Inländer befanden,
leider bedenklich erhöht und den Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge
wirksam unterstützt. Fast alle Vereinsgenossen, deren Anzahl im laufenden
Jahre auf über 100 anwachsen wird, erhöhten ihre bisherigen regelmäßigen
Quartalzahlungen um 25 bis 100, ja 200 %, und der Ausschuss des Vereins (Chewra)
ist in die angenehme Lage versetzt, auch die Gaben in entsprechendem Maße zu
erhöhen. Diese Erhöhung wird aber nur dann von Dauer sein, wenn die Armen
dem lästigen und entehrenden Hausbettel ganz und gar entsagen, dessen
Aufhören die Wohltäter zur unerlässlichen Bedingung ihres löblichen
Entschlusses gemacht haben.
Möge sich an den osrei dalim (Armenunterstützern) das Prophetenwort
bewähren: 'Bringet alle Zehnten in das Schatzhaus, dass Vorrat sei in meinem
Hause, und prüfet mich doch damit, spricht der Ewige der Heerscharen, ob ich
euch nicht öffne die Schleusen des Himmels und euch herabschütte Segen bis
zum Unmaße (Maleachi 3,10)."
Anmerkungen: Halbfeiertage
https://de.wikipedia.org/wiki/Chol_HaMoed |
Außerordentliche Generalversammlung des israelitischen
Wohltätigkeitsvereins (1868)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Oktober 1868: "Heilbronn, 8. Oktober. Am vorigen
Sonntag-Abend hielt der hiesige israelitische Wohltätigkeitsverein im
Saale zum 'Württemberger Hof' eine außerordentliche Generalversammlung
seiner Mitglieder ab, in welcher die - in Folge der Anlegung eines eigenen
israelitischen Friedhofs auf städtischer Markung nötig gewordene -
Revision seiner Statuten zur Beratung gebracht wurde. Der hierzu vom
Ausschuss vorgelegte Entwurf wurde von der Versammlung fast einstimmig
genehmigt und dabei den Prinzipien, welche bei Beerdigungen auf Einfachheit
und Pietät Rücksicht nehmen, der Vorzug eingeräumt. Dieser vor 7 Jahren
gegründete Verein, im Besitze eines rentierenden Vermögens von circa 1200
fl., zählt jetzt, einschließlich der neuesten Angemeldeten, 67 Mitglieder
und umfasst also etwa 2/3 aller Kirchen-Gemeindegenossen. Derselbe
übernimmt, obgleich seine Einnahmen sich aus ein Eintrittsgeld von 15 fl.,
einen Jahresbeitrag von 2 fl. 24 kr. und auf freiwillige Spenden
beschränken, für seine Mitglieder nicht nur sämtliche Beerdigungskosten, als
für Leichenwärter, Leichenschauer, Leichenordner, Sarg, Leichenwagen,
Begleitung, Träger, Totengräber und Grabfläche, sondern die Vereinskasse
stellt und bezahlt auch Krankenwärter, die Mitglieder besuchen die Kranken
nach einer bestimmten Reihenfolge, leisten Sterbenden den üblichen
religiösen Beistand und versammeln sich im Trauerhaus zu Gebeten und
Vorträgen zum Heile der Verstorbenen in der Trauerzeit. Es darf erwartet
werden, dass in Kurzem alle Gemeindegenoffen in ihrem eignen Interesse dem
Vereine beitreten werden und dann das Kirchenvorsteheramt in der Lage sein
wird, dem Verein die Überwachung und Ausführung der Leichenordnung für die
ganze Kirchengemeinde zu übertragen. Rühmlich verdient noch erwähnt zu
werden, dass die Vereinskasse im Bunde mit den meisten Gemeindemitgliedern
die Anlegung des eigenen Friedhofs auch durch niedrig zu verzinsende Anlehen
an die Gemeindepflege opferwillig und kräftig unterstützt hat." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 28. Oktober 1868: "Heilbronn, 8. Oktober. Am vorigen
Sonntag-Abend hielt der hiesige israelitische Wohltätigkeitsverein im
Saale zum 'Württemberger Hof' eine außerordentliche Generalversammlung
seiner Mitglieder ab, in welcher die - in Folge der Anlegung eines eigenen
israelitischen Friedhofs auf städtischer Markung nötig gewordene -
Revision seiner Statuten zur Beratung gebracht wurde. Der hierzu vom
Ausschuss vorgelegte Entwurf wurde von der Versammlung fast einstimmig
genehmigt und dabei den Prinzipien, welche bei Beerdigungen auf Einfachheit
und Pietät Rücksicht nehmen, der Vorzug eingeräumt. Dieser vor 7 Jahren
gegründete Verein, im Besitze eines rentierenden Vermögens von circa 1200
fl., zählt jetzt, einschließlich der neuesten Angemeldeten, 67 Mitglieder
und umfasst also etwa 2/3 aller Kirchen-Gemeindegenossen. Derselbe
übernimmt, obgleich seine Einnahmen sich aus ein Eintrittsgeld von 15 fl.,
einen Jahresbeitrag von 2 fl. 24 kr. und auf freiwillige Spenden
beschränken, für seine Mitglieder nicht nur sämtliche Beerdigungskosten, als
für Leichenwärter, Leichenschauer, Leichenordner, Sarg, Leichenwagen,
Begleitung, Träger, Totengräber und Grabfläche, sondern die Vereinskasse
stellt und bezahlt auch Krankenwärter, die Mitglieder besuchen die Kranken
nach einer bestimmten Reihenfolge, leisten Sterbenden den üblichen
religiösen Beistand und versammeln sich im Trauerhaus zu Gebeten und
Vorträgen zum Heile der Verstorbenen in der Trauerzeit. Es darf erwartet
werden, dass in Kurzem alle Gemeindegenoffen in ihrem eignen Interesse dem
Vereine beitreten werden und dann das Kirchenvorsteheramt in der Lage sein
wird, dem Verein die Überwachung und Ausführung der Leichenordnung für die
ganze Kirchengemeinde zu übertragen. Rühmlich verdient noch erwähnt zu
werden, dass die Vereinskasse im Bunde mit den meisten Gemeindemitgliedern
die Anlegung des eigenen Friedhofs auch durch niedrig zu verzinsende Anlehen
an die Gemeindepflege opferwillig und kräftig unterstützt hat." |
"Interessanter
Fall" bei der Ergänzungswahl von israelitischen Kirchenvorstehern (1869)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Mai 1869: "Heilbronn. In Folge der schon im Januar 1868
vorgenommenen Ergänzungswahl von zwei israelitischen Kirchenvorstehern
kam der allgemein interessante Fall vor, dass eine gleiche Stimmenzahl auf
zwei der Kandidaten sich ergab, wovon der eine hier nicht Bürger war,
sondern der Gemeinde bloß als Domizilierender angehörte, aber nach dem
Wahlergebnis für sich und seine Familie dieses Bürgerrecht erwarb, noch
bevor der Gegenkandidat oberamtlich bestätigt war. Der neue Bürger, im
Lebensalter der ältere, wurde nun in erster und zweiter Instanz,
gestützt auf neuere Vorgänge und ältere Ministerial-Entscheidung, vom
Königlichen Oberamte und von der Königlichen israelitischen
Oberkirchenbehörde bestätigt. Allein die beiden höheren und höchsten Rekursinstanzen,
das Kultministerium und endgültig der Königliche Geheimrat haben
übereinstimmend neuestens erkannt, dass ein Nichtbürger in der Gemeinde,
worin er bloß seinen Wohnsitz genommen hat, weder aktives noch passives
Wahlrecht besitze und die nachträgliche Erwerbung auf die vorgenommene
Wahlhandlung ohne Einfluss bleibe. Wahrscheinlich würden bei der
bevorstehenden Revision des Judengesetzes den Domizilianten mit der
Auferlegung gleicher Lasten auch dieselben Rechte wie den bis jetzt zu
ihrer Gemeinde höher besteuerten Ortsbürgern eingeräumt werden. Bei der
starken Übersiedlung aus den Dörfern in die Städte ohne
Bürgerrechtserwerbung muss künftig der Wohnsitz allein auch in den
israelitischen Kirchengemeinden maßgebend sein für Pflichten und
Rechte." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5.
Mai 1869: "Heilbronn. In Folge der schon im Januar 1868
vorgenommenen Ergänzungswahl von zwei israelitischen Kirchenvorstehern
kam der allgemein interessante Fall vor, dass eine gleiche Stimmenzahl auf
zwei der Kandidaten sich ergab, wovon der eine hier nicht Bürger war,
sondern der Gemeinde bloß als Domizilierender angehörte, aber nach dem
Wahlergebnis für sich und seine Familie dieses Bürgerrecht erwarb, noch
bevor der Gegenkandidat oberamtlich bestätigt war. Der neue Bürger, im
Lebensalter der ältere, wurde nun in erster und zweiter Instanz,
gestützt auf neuere Vorgänge und ältere Ministerial-Entscheidung, vom
Königlichen Oberamte und von der Königlichen israelitischen
Oberkirchenbehörde bestätigt. Allein die beiden höheren und höchsten Rekursinstanzen,
das Kultministerium und endgültig der Königliche Geheimrat haben
übereinstimmend neuestens erkannt, dass ein Nichtbürger in der Gemeinde,
worin er bloß seinen Wohnsitz genommen hat, weder aktives noch passives
Wahlrecht besitze und die nachträgliche Erwerbung auf die vorgenommene
Wahlhandlung ohne Einfluss bleibe. Wahrscheinlich würden bei der
bevorstehenden Revision des Judengesetzes den Domizilianten mit der
Auferlegung gleicher Lasten auch dieselben Rechte wie den bis jetzt zu
ihrer Gemeinde höher besteuerten Ortsbürgern eingeräumt werden. Bei der
starken Übersiedlung aus den Dörfern in die Städte ohne
Bürgerrechtserwerbung muss künftig der Wohnsitz allein auch in den
israelitischen Kirchengemeinden maßgebend sein für Pflichten und
Rechte." |
Die jüdischen Landesproduktenhandlungen wollen das
Sabbatgebot achten (1869)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. November 1869: "Heilbronn am Neckar. Das hiesige
Tagblatt vom 14. Nov. enthält die erfreuliche öffentliche Anzeige der 17
hiesigen israelitischen Firmen von Landesproduktenhandlungen, dass sie für
die Folge und zwar vom Samstag den 20. d. M. an am Sabbat keinerlei
Getreide annehmen noch abgeben werden und deshalb ihre Geschäftsfreunde und
Lieferanten bitten, hievon Notiz zu nehmen. Die Chefs dieser Handelshäuser
haben sich zu diesem löblichen Entschlusse sowohl für sich, als für ihr
israelitisches und christliches Dienstpersonal und die Sackträger
verbindlich gemacht, dass nämlich auch durch diese Gehilfen weder Ein- noch
Verkäufe abgeschlossen werden dürfen. Die Mitglieder haben sich hierzu nicht
nur durch ihr Ehrenwort, sondern auch dadurch in einer rechtsförmigen
Urkunde unterschriftlich verbindlich gemacht, dass Übertretungen mit einer
Konventional-Geldbuße von 25, 50 und 100 Gulden bestraft und solche Strafen
zu wohltätigen Zwecken verwendet werden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. November 1869: "Heilbronn am Neckar. Das hiesige
Tagblatt vom 14. Nov. enthält die erfreuliche öffentliche Anzeige der 17
hiesigen israelitischen Firmen von Landesproduktenhandlungen, dass sie für
die Folge und zwar vom Samstag den 20. d. M. an am Sabbat keinerlei
Getreide annehmen noch abgeben werden und deshalb ihre Geschäftsfreunde und
Lieferanten bitten, hievon Notiz zu nehmen. Die Chefs dieser Handelshäuser
haben sich zu diesem löblichen Entschlusse sowohl für sich, als für ihr
israelitisches und christliches Dienstpersonal und die Sackträger
verbindlich gemacht, dass nämlich auch durch diese Gehilfen weder Ein- noch
Verkäufe abgeschlossen werden dürfen. Die Mitglieder haben sich hierzu nicht
nur durch ihr Ehrenwort, sondern auch dadurch in einer rechtsförmigen
Urkunde unterschriftlich verbindlich gemacht, dass Übertretungen mit einer
Konventional-Geldbuße von 25, 50 und 100 Gulden bestraft und solche Strafen
zu wohltätigen Zwecken verwendet werden.
Möchten unsere Ellenwarenhandlungen, die am Schabbat ihre Läden offen
haben, diesem guten Beispiele bald folgen und so dieser heilige Tag seinem
beseligenden Zwecke zurückgegeben werden um zu halten den Schabbat als
ewigen Bund und als Zeichen, dass der Ewige am siebten Tag aufgehört und
gefeiert hat (2. Mose 31,15f)." |
Erstes Stiftungsfest des Synagogenchores
(1869)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Dezember 1869: "Heilbronn am Neckar. Am
Ausgang des Chanukka-Schabbats feierte der Synagogenchor sein erstes
Stiftungsfest mit Gesangsproduktion, musikalischer Unterhaltung und
Vorträgen, in denen insbesondere von dem Lehrer Löwenstein
hervorgehoben wurde, dass dieser Verein nur darum fast die ganze Gemeinde
als passive, materiell unterstützende Mitglieder umfasse, weil er sich bis
heute auf jüdischem Boden bewege und die historische Vergangenheit des
israelitischen Gottesdienstes mit den berechtigten Ansprüchen der Gegenwart
durch Einführung des vierstimmigen Männergesangs und Beachtung der
charakteristisch Responsorien zu verbinden sich bestreben. Die Teilnahme am
Feste im jüdischen Gasthause war eine allgemeine und der dabei betätigte
Eifer lässt hoffen, dass der Chor wie in der Hirsch'schen Synagoge zu
Frankfurt und andern orthodoxen Gemeinden zur Andacht der Betenden beitragen
und die reformistischen Gelüste unbeachtet werden. Der Charakter des
Vorstandes, Herrn W. Sondheimer, und der Geist der hervorragenden Mitglieder
des Chors lässt hoffen, dass es immer so bleiben werde." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Dezember 1869: "Heilbronn am Neckar. Am
Ausgang des Chanukka-Schabbats feierte der Synagogenchor sein erstes
Stiftungsfest mit Gesangsproduktion, musikalischer Unterhaltung und
Vorträgen, in denen insbesondere von dem Lehrer Löwenstein
hervorgehoben wurde, dass dieser Verein nur darum fast die ganze Gemeinde
als passive, materiell unterstützende Mitglieder umfasse, weil er sich bis
heute auf jüdischem Boden bewege und die historische Vergangenheit des
israelitischen Gottesdienstes mit den berechtigten Ansprüchen der Gegenwart
durch Einführung des vierstimmigen Männergesangs und Beachtung der
charakteristisch Responsorien zu verbinden sich bestreben. Die Teilnahme am
Feste im jüdischen Gasthause war eine allgemeine und der dabei betätigte
Eifer lässt hoffen, dass der Chor wie in der Hirsch'schen Synagoge zu
Frankfurt und andern orthodoxen Gemeinden zur Andacht der Betenden beitragen
und die reformistischen Gelüste unbeachtet werden. Der Charakter des
Vorstandes, Herrn W. Sondheimer, und der Geist der hervorragenden Mitglieder
des Chors lässt hoffen, dass es immer so bleiben werde." |
Generalversammlung des Israelitischen Wohltätigkeitsvereins
(1870)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Mai 1870: "Heilbronn. In den jüngst verflossenen
Halbfeiertagen feierte die hiesige Chewrat Gemilut Chassodim
(Wohltätigkeitsverein) nach Abfluss einer dreijährigen Rechnungsperiode ihre
ordentliche Generalversammlung unter Leitung des Herrn Liebmann Strauß, der
diesem zahl- und wirkungsreichen Vereine schon seit seiner Gründung
präsidiert und auch diesmal wieder einstimmig zum Vorstande berufen wurde.
Diese Chewra (Verein) leistet in der Krankheits-, Todes- und
Trauerzeit sehr wesentliche Dienste ... und unterstützt in außerordentlichen
Fällen auch fremde Arme, die im Spital der Stadt sich befinden, damit sie
koschere Kost erhalten. Es sind auf Anregung des Vereinsausschusses mit der
städtischen Spitalverwaltung Einleitungen besprochen worden, wie in diesem
großartigen Spital überhaupt den Israeliten, welche dort Aufnahme finden,
regelmäßige Koscherkost gereicht werden könnte und ist gute Aussicht
vorhanden, dass hiezu die erforderlichen Räumlichkeiten, als: Küche,
Speisekammer etc. etc. der israelitischen Gemeinde unentgeltlich überlassen
werden. In Zukunft übernimmt der Verein auch noch die Kosten einer zweiten
Chaise zum Friedhof, wenn der Rabbiner oder sein Stellvertreter die Leiche
eines Erwachsenen ex officio zu begleiten haben; bis zum 13. Lebensjahre
hingegen ist es Sache der Relikten, wenn sie die amtliche Begleitung wegen
Abhaltung einer Grabrede oder Gebete verlangen sollten, da, wie der Vorstand
und die Majorität motivierte, zwischen Wichtigem und Weniger
Wichtigem stets unterschieden worden sei z.B. .... Hingegen wendete der
anwesende Rabbiner Dr. Engelbert ein, dass, wenn man sich hier nach dem
Din (rabbinischen Gericht) richten wolle, man auch zwischen ...
unterscheiden müsste, was er später mit der Stelle zu begründen suchte: ...
Der Prinzipienkampf auf dem ... Standpunkt der Praxis und der ... war
interessant. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 4. Mai 1870: "Heilbronn. In den jüngst verflossenen
Halbfeiertagen feierte die hiesige Chewrat Gemilut Chassodim
(Wohltätigkeitsverein) nach Abfluss einer dreijährigen Rechnungsperiode ihre
ordentliche Generalversammlung unter Leitung des Herrn Liebmann Strauß, der
diesem zahl- und wirkungsreichen Vereine schon seit seiner Gründung
präsidiert und auch diesmal wieder einstimmig zum Vorstande berufen wurde.
Diese Chewra (Verein) leistet in der Krankheits-, Todes- und
Trauerzeit sehr wesentliche Dienste ... und unterstützt in außerordentlichen
Fällen auch fremde Arme, die im Spital der Stadt sich befinden, damit sie
koschere Kost erhalten. Es sind auf Anregung des Vereinsausschusses mit der
städtischen Spitalverwaltung Einleitungen besprochen worden, wie in diesem
großartigen Spital überhaupt den Israeliten, welche dort Aufnahme finden,
regelmäßige Koscherkost gereicht werden könnte und ist gute Aussicht
vorhanden, dass hiezu die erforderlichen Räumlichkeiten, als: Küche,
Speisekammer etc. etc. der israelitischen Gemeinde unentgeltlich überlassen
werden. In Zukunft übernimmt der Verein auch noch die Kosten einer zweiten
Chaise zum Friedhof, wenn der Rabbiner oder sein Stellvertreter die Leiche
eines Erwachsenen ex officio zu begleiten haben; bis zum 13. Lebensjahre
hingegen ist es Sache der Relikten, wenn sie die amtliche Begleitung wegen
Abhaltung einer Grabrede oder Gebete verlangen sollten, da, wie der Vorstand
und die Majorität motivierte, zwischen Wichtigem und Weniger
Wichtigem stets unterschieden worden sei z.B. .... Hingegen wendete der
anwesende Rabbiner Dr. Engelbert ein, dass, wenn man sich hier nach dem
Din (rabbinischen Gericht) richten wolle, man auch zwischen ...
unterscheiden müsste, was er später mit der Stelle zu begründen suchte: ...
Der Prinzipienkampf auf dem ... Standpunkt der Praxis und der ... war
interessant.
Am 2. Tage ... tagte die jährliche Generalversammlung der chewrat osrei
dalim, welche per April 1869/70 gegen 1700 fl. an circa 1600 Arme
verteilte, welche meistens aus dem östlichen und nördlichen Teile
Deutschlands die hiesige Stadt passierten. Das schwierige Amt der Anweisung
hat Herr Kaufmann J. Stern abermals freiwillig übernommen und dadurch den
ungeteilten Dank der ganzen Versammlung geerntet. Auch eine Anregung zur
Unterstützung der Bestrebungen der 'All. Isr. Univ" und des Gemeindetags,
insofern er Armenunterstützung im Auge hat, kam hierbei zur Sprache und wird
in besonderer Versammlung zur Beratung und Beschlussfassung kommen." |
Einige Eltern weigern sich, ihre Kinder konfirmieren
zu lassen (1870)
Anmerkungen: die Einführung der gemeinsamen Konfirmation in der jüdischen
Gemeinde - ähnlich dem Brauch evangelischer Gemeinden - anstelle der
traditionellen individuellen Bar-Mizwa- beziehungsweise Bat-Mizwa-Feier stieß
immer mehr auf den Widerstand konservativ-orthodox gesinnter jüdischer
Familien.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. Juni 1870: "Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,
wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das
heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das
Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der
Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In
Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei
Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern
glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die
Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre
größere Nachahmung finden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 1. Juni 1870: "Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,
wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das
heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das
Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der
Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In
Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei
Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern
glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die
Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre
größere Nachahmung finden.
Nachträglich erfahren wir, dass auch in
Lehrensteinsfeld, dem ehemaligen
diesseitigen Rabbinatssitz, alle Eltern der diesjährigen Konfirmanden
sich weigern, ihre Kindern konfirmieren zu lassen. Im Braunsbacher
Rabbinatssprengel haben sämtliche Gemeinden des Bezirks die Vornahme des
Konfirmationsaktes verweigert bis auf die Stadtgemeinde
Crailsheim, wo auch Reformgottesdienst
mit Harmonium eingeführt ist. Man sieht hieraus, wie wenig dieses
christliche Institut der Konfirmation in den jüdischen Gemeinden Wurzel zu
fassen vermochte, obgleich es schon seit 1831 zwangsweise in Württemberg
existiert und wie der erste Hauch der Freiheit wegfegt, was vier Jahrzehnte
nur durch kirchliche Gewalt sich zu erhalten vermochte." |
Die jüdische Gemeinde engagierte sich bei der Aufnahme von westrussischen
Waisen im Waisenhaus Wilhelmspflege in Esslingen (1870)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870:
"Heilbronn am Neckar, 19. Juni (1870). Unser diesem Datum hat der
Ausschuss der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege die
israelitischen Kirchenvorsteherämter Württembergs ersucht, nach
tunlichster Ausholung der Gemeindegenossen sich darüber zu äußern, ob
die Aufnahmen von 4-5 westrussischen Waisen in die Wilhelmspflege
gutgeheißen werde und ob die Gemeinde gewillt sein, einer jener Kinder
nach der Entlassung aus dieser Anstalt zum Zwecke weiterer Fürsorge an
Kindesstatt anzunehmen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juli 1870:
"Heilbronn am Neckar, 19. Juni (1870). Unser diesem Datum hat der
Ausschuss der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege die
israelitischen Kirchenvorsteherämter Württembergs ersucht, nach
tunlichster Ausholung der Gemeindegenossen sich darüber zu äußern, ob
die Aufnahmen von 4-5 westrussischen Waisen in die Wilhelmspflege
gutgeheißen werde und ob die Gemeinde gewillt sein, einer jener Kinder
nach der Entlassung aus dieser Anstalt zum Zwecke weiterer Fürsorge an
Kindesstatt anzunehmen.
Der Vorstand der Wilhelmspflege, der bekannte Philanthrop und
Oberkirchenvorsteher Dr. Adolf Levi in Stuttgart, setzt in seinem Zirkular
voraus, dass der Weheruf, der in Folge der Hungersnot der jüdischen
Bevölkerung Westrusslands sich vernehmen ließ, zweifelsohne zu allen
Gemeinden gedrungen und auch die Aufforderung, welche in neuester Zeit
seitens der 'Alliance Israelite' in Paris an die israelitischen Gemeinden
Europas und Amerikas in der Richtung und zu dem Zwecke ergangen ist, dass
dem Elend, in welchem Tausende von jüdischen Waisen aus jenen russischen
Provinzen ohne Nahrung, Pflege und Erziehung verkümmern, durch Adoption
solcher unglücklichen Wesen möglichst gesteuert werden möchte, in allen
Gemeinden kundbar geworden sei.
Die Leitung der israelitischen Waisenanstalt Wilhelmspflege, deren
finanzielle Kräfte es jetzt wohl verstatten würden und deren Hilfe für
inländische Waisen und verwahrloste Kinder zur Zeit in einem geringeren,
die Mitte des Instituts nicht absorbierenden Maße in Anspruch genommen
wird, wäre nun gerne bereit, im Sinne und Geiste von ganz Israel sind
Brüder in diese Kalamität durch Aufnahme von etwa 4-5 jener russischen
Waisen auch die Wilhelmspflege sich hilfreich erweisen zu lassen.
Da aber diese Anstalt nach ihren Statuten nur für solche israelitischen Waisen,
die dem Lande Württemberg angehören, bestimmt ist, so will es der
Ausschuss in diesem Falle nicht wagen, diese Schranke durch Aufnahme ausländischer
Kinder zum Zwecke unentgeltlicher Verpflegung zu durchbrechen, ohne sich
zuvor des Einverständnisses der jüdischen Bevölkerung des Landes, mit
deren Anschauung er einig gehen möchte, versichert zu haben. Diese
Rücksicht ist billig, da das Vermögen und die Einnahmen der
Wilhelmspflege aus Spenden, Gaben und Vermächtnissen der
württembergischen Israeliten erwachsen ist und besteht.
Überdies vermöchte der Ausschuss, die Zustimmung der Vorsteherämter
vorausgesetzt, zur einer derartigen Hilfereichung an auswärtige Waisen
sich nicht herbeizulassen, bevor er darüber Beruhigung und Sicherheit
hat, wenn diese nach ihrer dereinstigen Entlassung aus der Wilhelmspflege,
erfolge diese nach der Schulpflichtzeit oder aus dringlichen Gründen
schon früher, zum Zwecke weiterer Fürsorge den Gemeinden zuzuweisen sein
würden.
Das Vorsteheramt der israelitischen Gemeinde Heilbronn hat nun nicht nur
seine Zustimmung zur Aufnahme von wenigstens 4-5 solcher Waisen erteilt
und die spätere Annahme eines solchen Kindes versprochen, sondern sich
auch bereit erklärt, noch einige weitere dieser Kinder in der Wilhelmspflege
auf Kosten hiesiger Privatleute versorgen zu lassen, wenn der Raum und die
sonstigen Verhältnisse des Waisenhauses es gestatten, und wenn man
erfahren haben wird, welche Entschädigung per Kind und Jahr zu bezahlen
ist. Die Antwort ist noch abzuwarten. Möge dieses Beispiel andere
israelitische Waisenanstalten und Gemeinden zur Nachahmung aneifern und
sich allerwärts bewähren: 'nur in dir (sc. Gott) findet Liebe die
Waise' (Hosea 14,4)" |
Verschiedene Mitteilungen aus dem jüdischen Gemeindeleben
(1870)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juli 1870: "Heilbronn a. N. Aus der hiesigen einstigen
Reichsstadt, in der seit etwa einem Jahrzehnt die Zahl der Israeliten auf
ungefähr 130 Familien mit circa 650 Seelen angewachsen ist, schwindet
allmählich auch das Vorurteil, das noch immer insbesondere in sozialen
Verhältnissen gegen die Juden herrscht und sie von geselligen Vereinen und
städtischen Ehrenämtern ausschließt. Bei der Ende Juni vorgenommenen
Bürgerausschusswahl wurde der auch sonst beliebte Rechtsanwalt Schloß
hier in dieses Kollegium gewählt und, nachdem er sich das gesetzlich
erforderliche Ortsbürgerrecht erworben hatte, öffentlich mit den andern
christlichen Kollegen verpflichtet. Er ist der erste Israelit, der in
Heilbronn hauptsächlich von christlichen Stimmen berufen ist, in den
städtischen bürgerlichen Kollegien Sitz und Stimme zu nehmen. Dieses
Beispiel und die Wirksamkeit des Gewählten lassen hoffen, dass auch bei
künftigen Wahlen tüchtige und ehrenhafte israelitische Bürger in das
erwähnte zweite Kollegium und endlich in den Gemeinderat werden gewählt
werden. — Von geselligen Vereinen haben bis jetzt nur die 'Harmonia',
die 'grüne Stube' und die 'Eintracht' Juden ausgenommen.
Der 'Bürgerverein' hingegen verschließt noch immer jedem Israeliten,
der sich anmeldet, den Eintritt in seine Gesellschaft, obgleich vom Jahre
1848 her noch zwei Israeliten unter seinen Mitgliedern sich befinden." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juli 1870: "Heilbronn a. N. Aus der hiesigen einstigen
Reichsstadt, in der seit etwa einem Jahrzehnt die Zahl der Israeliten auf
ungefähr 130 Familien mit circa 650 Seelen angewachsen ist, schwindet
allmählich auch das Vorurteil, das noch immer insbesondere in sozialen
Verhältnissen gegen die Juden herrscht und sie von geselligen Vereinen und
städtischen Ehrenämtern ausschließt. Bei der Ende Juni vorgenommenen
Bürgerausschusswahl wurde der auch sonst beliebte Rechtsanwalt Schloß
hier in dieses Kollegium gewählt und, nachdem er sich das gesetzlich
erforderliche Ortsbürgerrecht erworben hatte, öffentlich mit den andern
christlichen Kollegen verpflichtet. Er ist der erste Israelit, der in
Heilbronn hauptsächlich von christlichen Stimmen berufen ist, in den
städtischen bürgerlichen Kollegien Sitz und Stimme zu nehmen. Dieses
Beispiel und die Wirksamkeit des Gewählten lassen hoffen, dass auch bei
künftigen Wahlen tüchtige und ehrenhafte israelitische Bürger in das
erwähnte zweite Kollegium und endlich in den Gemeinderat werden gewählt
werden. — Von geselligen Vereinen haben bis jetzt nur die 'Harmonia',
die 'grüne Stube' und die 'Eintracht' Juden ausgenommen.
Der 'Bürgerverein' hingegen verschließt noch immer jedem Israeliten,
der sich anmeldet, den Eintritt in seine Gesellschaft, obgleich vom Jahre
1848 her noch zwei Israeliten unter seinen Mitgliedern sich befinden." |
Generalversammlung des Armenunterstützungsvereines
(1872)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Mai 1872: "Heilbronn a. N. Am jüngsten ... hielt der hiesige
Armenunterstützungsverein (chewrat osrei dalim) ihre ordentliche
Generalversammlung, welche von den 120 vorjährigen Mitgliedern recht
zahlreich besucht war, weil außer dem statutarischen Rechenschaftsbericht
außergewöhnliche Anträge, insbesondere auf Verminderung der Gabenzahl und
Revision der Gabenskala, Bildung von Bezirks- und Landesvereinen, Anschluss
an den Gemeindetag und die 'Alliance isr. universelle' etc. auf der
Tagesordnung standen. In dem Jahre p. Nissan 1871-72 hatte der Verein eine
Einnahme von regelmäßigen Beiträgen, Spenden, Zinsen, Erlös aus Obligationen
etc. von 2868 fl. 20 kr und eine Ausgabe für Armenunterstützung,
Verwaltungskosten, Beitrag zur 'Alliance' u.s.w. von 2729 fl. 12 kr., so
dass der Kassenvorrat nur noch 139 fl. 8 kr. betragen hat. — Für die Armen
allein sind in 1825 Gaben 2413 fl. 55 kr. verausgabt worden. Unter dieser
Armenzahl befanden sich aber bloß 173 Armen aus Süddeutschland, während 1652
Wanderbettler meist aus dem fernen Osten Europas unsere Kasse in Anspruch
nahmen. Die Gaben, welche bisher an einen und denselben Armen jährlich
zweimal verabreicht wurden, bewegten sich innerhalb der Skala von 24 kr. bis
5 fl. - Die überwiegende Zahl der Gaben kommt in der Gabenhöhe zwischen 48
kr. und 1 fl. 30 kr. vor. - Dennoch hat das Vereinsvermögen durch die
notwendig gewordene Veräußerung von Staats- papieren um 464 fl. 23 tr.
abgenommen. — Die 'Generalversammlung hat deshalb beschlossen, einerseits
die Bereichsmitglieder zu einer Erhöhung ihrer Beiträge einzuladen,
andererseits aber beschlossen, nur süddeutsche Arme wir bisher jährlich
zweimal zu unterstützen, allen übrigen Armen aber, welche aus ferneren
Ländern kommen, nur 1 Gabe im Jahre reichen zu lassen und hierdurch den
Zuzug und die Mühe des Kassiers zu vermindern. Es hält stets schwer ein
anweisendes und ein auszahlendes Mitglied für den Ausschuss zu gewinnen.
Auch soll die Gabenskala unter Rücksicht auf die Einnahme und in dem Sinne
vom größeren Ausschuß (beuchend aus den Mitgliedern, welche seit 1863 schon
einmal im Ausschuss funktionirten revidirt werden, daß gnunde und junge
Leute und Bettelprofessionisten nur eine ganz kleine Gabe erhalten. Diesem
größeren Ausschuss bleibt auch die Ausführung des angeregten Gedankens der
Bildung von Bezirks- u. Provinzial- Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. Mai 1872: "Heilbronn a. N. Am jüngsten ... hielt der hiesige
Armenunterstützungsverein (chewrat osrei dalim) ihre ordentliche
Generalversammlung, welche von den 120 vorjährigen Mitgliedern recht
zahlreich besucht war, weil außer dem statutarischen Rechenschaftsbericht
außergewöhnliche Anträge, insbesondere auf Verminderung der Gabenzahl und
Revision der Gabenskala, Bildung von Bezirks- und Landesvereinen, Anschluss
an den Gemeindetag und die 'Alliance isr. universelle' etc. auf der
Tagesordnung standen. In dem Jahre p. Nissan 1871-72 hatte der Verein eine
Einnahme von regelmäßigen Beiträgen, Spenden, Zinsen, Erlös aus Obligationen
etc. von 2868 fl. 20 kr und eine Ausgabe für Armenunterstützung,
Verwaltungskosten, Beitrag zur 'Alliance' u.s.w. von 2729 fl. 12 kr., so
dass der Kassenvorrat nur noch 139 fl. 8 kr. betragen hat. — Für die Armen
allein sind in 1825 Gaben 2413 fl. 55 kr. verausgabt worden. Unter dieser
Armenzahl befanden sich aber bloß 173 Armen aus Süddeutschland, während 1652
Wanderbettler meist aus dem fernen Osten Europas unsere Kasse in Anspruch
nahmen. Die Gaben, welche bisher an einen und denselben Armen jährlich
zweimal verabreicht wurden, bewegten sich innerhalb der Skala von 24 kr. bis
5 fl. - Die überwiegende Zahl der Gaben kommt in der Gabenhöhe zwischen 48
kr. und 1 fl. 30 kr. vor. - Dennoch hat das Vereinsvermögen durch die
notwendig gewordene Veräußerung von Staats- papieren um 464 fl. 23 tr.
abgenommen. — Die 'Generalversammlung hat deshalb beschlossen, einerseits
die Bereichsmitglieder zu einer Erhöhung ihrer Beiträge einzuladen,
andererseits aber beschlossen, nur süddeutsche Arme wir bisher jährlich
zweimal zu unterstützen, allen übrigen Armen aber, welche aus ferneren
Ländern kommen, nur 1 Gabe im Jahre reichen zu lassen und hierdurch den
Zuzug und die Mühe des Kassiers zu vermindern. Es hält stets schwer ein
anweisendes und ein auszahlendes Mitglied für den Ausschuss zu gewinnen.
Auch soll die Gabenskala unter Rücksicht auf die Einnahme und in dem Sinne
vom größeren Ausschuß (beuchend aus den Mitgliedern, welche seit 1863 schon
einmal im Ausschuss funktionirten revidirt werden, daß gnunde und junge
Leute und Bettelprofessionisten nur eine ganz kleine Gabe erhalten. Diesem
größeren Ausschuss bleibt auch die Ausführung des angeregten Gedankens der
Bildung von Bezirks- u. Provinzial-
Armen-Unterstützungsvereinen und des beantragten Anschlusses an den
Gemeinde tag in Leipzig überlassen insofern dieser die Armenfrage in seinen
Bereich zieht. Der Beitrag zur 'Alliance isr. univ." soll wie bisher init 50
Frs. p. anno geleistet und dahin gestrebt werden, den Grundstock des Vereins
zu refun- diren und zu vergrößern, um in außerordentlichen Zeiten
leistungsfähig zu sein.
Möge andere dergleichen Vereine in gleichem Sinne ihr Augenmerk dem
Armenwesen in Israel zuwenden und an den Männern der Tat — js,ssdro
ervppppppppppppp — das Psalmwort sich bewähren: 'n lno^c' njn ora b“i
ba bwo nt ph." |
11. Generalversammlung des Armenunterstützungsvereins
(1874)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Mai 1874: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Mai 1874: |
Der Antisemitismus macht sich auch in Heilbronn
bemerkbar - Die Gemeinde führt eine neue Gottesdienstordnung ein
(1876)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Juli 1876: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 25. Juli 1876: |
Kritisches zur neuen Gottesdienstordnung aus
konservativ-orthodoxer Sicht (1876)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. August 1876: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 9. August 1876: |
Der Heilbronner Armenunterstützungsverein ist Vorbild auch
für andere Gemeinden (1877)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. April 1877: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. April 1877: |
Ein orthodoxes Gemeindeglied ist aus der
"Reformgemeinde" ausgetreten (1877)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. August 1877: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 8. August 1877: |
Hetze gegen die jüdischen Metzger im Schlachthaus
(1878)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. April 1878: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. April 1878: |
25-jähriges Jubiläum des "Wohltätigkeits-Vereins"
(1882)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Dezember 1882:
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Dezember 1882: |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Dezember 1882: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 26. Dezember 1882: |
6. und letzter Jahresbericht des "Vereins zur
Unterstützung armer durchreisender Israeliten"
(1884)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. April 1884: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. April 1884: |
Vortrag
des Schriftstellers Arnold Perls über den Prozess gegen den antisemitischen
Hofprediger Stöcker (1885)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. September 1885:
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 1. September 1885: |
 |
25-jähriges Bestehen des "Esrog-Vereins"
(1894)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1894: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Oktober 1894: |
Ball an Simchat Tora - organisiert vom Verein
"Einklang" (1886)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. November 1886: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. November 1886: |
Oberbürgermeister Hegelmeier besucht das Schlachthaus und
informiert sich über das Schächten (1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. April 1890:
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 16. April 1890: |
Gemeindeglieder aus Heilbronn unterstützen die landwirtschaftliche Schule in
Ahlem (1898)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1898:
"Würzburg, 13. März
(1898). 'Das Judentum und seine Teilnahme an der Bodenkultur' lautete das
Thema, das am 2. dieses Monats von Herrn Dr. Finkel im neuen Saalbau des
Herrn Hotelier Goldschmidt behandelt wurde. Alle Kreise der jüdischen
Bevölkerung waren vertreten und lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit
den interessanten Ausführungen des Redners. Als der lebhafte Beifall
verklungen war, entspann sich eine anregende Diskussion, die erkennen
ließ, dass man erfasst hatte, der Beruf des Gärtners und Landwirtes sei
von größter Wichtigkeit, und gerade ihm müsste die jüdische Jugend
mehr als bisher zugeführt werden. Als Musteranstalt für die Heranbildung
junger Leute zu tüchtigen Gärtnern und Landwirten wurde die bekannte
landwirtschaftliche Schule in Ahlem erwähnt. Da bei den meisten der
anwesenden Herren und Damen doch die Existenz dieser Anstalt als unbekannt
vorauszusetzen war, so übernahm es ein anwesender Prediger, der einige
Jahre vorher, einer Einladung des hochherzigen Gründers jener Schule
folgend, diese eingehend besichtigt, eine eingehende Schilderung derselben
zu geben. Die Diskussion förderte die sofortige Gründung eines Lokalkomitees, welches sich zur Aufgabe macht, für Erweiterung und
entsprechende Unterstützung der landwirtschaftlichen Schule in Ahlem nach
Kräften tätig zu sein. Das Komitee besteht vorläufig aus den Herren:
Fröhlich sen., Hanauer, Jakobi Apotheker Landauer, Rechtsanwalt Dr.
Alfred Oppenheimer, Vorsitzender der neugegründeten Loge, Rosenheim,
Rechtsanwalt Dr. Stern, 1. Vorsitzender hiesiger Gemeinde, Seminarlehrer
Weißbart. Herr Baron von Hirsch erklärte im Laufe der Diskussion in
bereitwilligster Weise, dem wichtigen Gegenstande sein Interesse fernerhin
bekunden zu wollen. Auch in anderen Städten, die der Redner mit einem
Vortrage bedacht, zeigte sich der Erfolg in der Bildung eines Komitees in
unmittelbarem Anschluss an den Vortrag. Ein solches setzte sich in Stuttgart-
Cannstatt zusammen aus den Herren: S. Ettlinger, Gustav Gottschalk,
Dr. A. Gutmann, Veit Kahn, Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner Dr. Stößel,
Isak Strauß. Ferner in Heilbronn aus den Herren: J. Erlanger,
Bankier Gumpel, Rabbiner Kahn, Adolf Oppenheimer, Rechtsanwalt Schloß, M.
Wachs. Möge es Herrn Dr. Finkel gelingen, auch in andere Gemeinden die
Überzeugung zu bringen, dass er einem überaus wichtigen Faktor für die
Weiterentwicklung des Judentums das Wort redet." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1898:
"Würzburg, 13. März
(1898). 'Das Judentum und seine Teilnahme an der Bodenkultur' lautete das
Thema, das am 2. dieses Monats von Herrn Dr. Finkel im neuen Saalbau des
Herrn Hotelier Goldschmidt behandelt wurde. Alle Kreise der jüdischen
Bevölkerung waren vertreten und lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit
den interessanten Ausführungen des Redners. Als der lebhafte Beifall
verklungen war, entspann sich eine anregende Diskussion, die erkennen
ließ, dass man erfasst hatte, der Beruf des Gärtners und Landwirtes sei
von größter Wichtigkeit, und gerade ihm müsste die jüdische Jugend
mehr als bisher zugeführt werden. Als Musteranstalt für die Heranbildung
junger Leute zu tüchtigen Gärtnern und Landwirten wurde die bekannte
landwirtschaftliche Schule in Ahlem erwähnt. Da bei den meisten der
anwesenden Herren und Damen doch die Existenz dieser Anstalt als unbekannt
vorauszusetzen war, so übernahm es ein anwesender Prediger, der einige
Jahre vorher, einer Einladung des hochherzigen Gründers jener Schule
folgend, diese eingehend besichtigt, eine eingehende Schilderung derselben
zu geben. Die Diskussion förderte die sofortige Gründung eines Lokalkomitees, welches sich zur Aufgabe macht, für Erweiterung und
entsprechende Unterstützung der landwirtschaftlichen Schule in Ahlem nach
Kräften tätig zu sein. Das Komitee besteht vorläufig aus den Herren:
Fröhlich sen., Hanauer, Jakobi Apotheker Landauer, Rechtsanwalt Dr.
Alfred Oppenheimer, Vorsitzender der neugegründeten Loge, Rosenheim,
Rechtsanwalt Dr. Stern, 1. Vorsitzender hiesiger Gemeinde, Seminarlehrer
Weißbart. Herr Baron von Hirsch erklärte im Laufe der Diskussion in
bereitwilligster Weise, dem wichtigen Gegenstande sein Interesse fernerhin
bekunden zu wollen. Auch in anderen Städten, die der Redner mit einem
Vortrage bedacht, zeigte sich der Erfolg in der Bildung eines Komitees in
unmittelbarem Anschluss an den Vortrag. Ein solches setzte sich in Stuttgart-
Cannstatt zusammen aus den Herren: S. Ettlinger, Gustav Gottschalk,
Dr. A. Gutmann, Veit Kahn, Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner Dr. Stößel,
Isak Strauß. Ferner in Heilbronn aus den Herren: J. Erlanger,
Bankier Gumpel, Rabbiner Kahn, Adolf Oppenheimer, Rechtsanwalt Schloß, M.
Wachs. Möge es Herrn Dr. Finkel gelingen, auch in andere Gemeinden die
Überzeugung zu bringen, dass er einem überaus wichtigen Faktor für die
Weiterentwicklung des Judentums das Wort redet." |
Gründung eines "Vereins für jüdische Geschichte"
(1899)
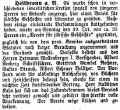 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. November 1899: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. November 1899: |
Vortrag
von Kirchenrat Dr. Kroner aus Stuttgart (1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November
1901:
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. November
1901: |
Orthodoxe Kritik an den zu liberalen
Zuständen in Synagoge und Gemeinde (1902)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. September 1902: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. September 1902: |
50-jähriges Jubiläum des Israelitischen
Wohltätigkeitsvereines (1907)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. November 1907: "" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. November 1907: "" |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. November 1907: "Heilbronn, 30. Oktober. Der Israelitische
Wohltätigkeitsverein darf in diesen Tagen auf ein halbes Jahrhundert
seines Bestehens zurückblicken, das er in würdiger Weise feierte, zugleich
damit verbindend das 50jährige Jubiläum seines Vorstandes Liebmann Strauß,
der seit dem Bestehen den Verein leitet und der einzige noch lebende
Mitbegründer ist. In einer hübschen Festschrift, von Rabbiner Kahn im
Auftrag des Ausschusses verfasst, wird ein anschauliches Bild von der
Entstehung, dem Wachstum und der Tätigkeit des Vereins gegeben. Die
Entstehung datiert in den November 1857 zurück. Den 7 Gründern schlossen
sich bald weitere Gemeindegenossen an, und im Jahre 1864 betrug die Zahl der
Mitglieder schon 36. Heute sind es deren über 200. Die Hauptaufgabe des
Vereins war und blieb immer die Fürsorge für Kranke, Sterbende und
Verstorbene; daneben ging eine förmliche Krankenpflege, die zunächst
ausschließlich auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhte, bis 1901 zwei
eigene Krankenpflegerinnen angestellt wurden, die gegebenenfalls auch
außerhalb des Vereins und der Gemeinde Dienste leisten. Herr Strauß sowie
der von ihm geführte Verein waren anlässlich der Jubelfeier der Gegenstand
zahlreicher Glückwünsche u. a. auch von Oberbürgermeister Göbel, der für die
Jubiläumsgabe des Vereins an die christlichen Armen der Stadt Heilbronn in
seinem Schreiben dankte. Ein Festmahl schloss die Reihe der Veranstaltungen,
bei welchem Herr Rabbiner Kahn und eine Reihe andeer Herren sprachen und das
der Synagogenchor unter Leitung des Herr Oberkantor Dreyfus durch treffliche
Darbietungen verschönte." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14. November 1907: "Heilbronn, 30. Oktober. Der Israelitische
Wohltätigkeitsverein darf in diesen Tagen auf ein halbes Jahrhundert
seines Bestehens zurückblicken, das er in würdiger Weise feierte, zugleich
damit verbindend das 50jährige Jubiläum seines Vorstandes Liebmann Strauß,
der seit dem Bestehen den Verein leitet und der einzige noch lebende
Mitbegründer ist. In einer hübschen Festschrift, von Rabbiner Kahn im
Auftrag des Ausschusses verfasst, wird ein anschauliches Bild von der
Entstehung, dem Wachstum und der Tätigkeit des Vereins gegeben. Die
Entstehung datiert in den November 1857 zurück. Den 7 Gründern schlossen
sich bald weitere Gemeindegenossen an, und im Jahre 1864 betrug die Zahl der
Mitglieder schon 36. Heute sind es deren über 200. Die Hauptaufgabe des
Vereins war und blieb immer die Fürsorge für Kranke, Sterbende und
Verstorbene; daneben ging eine förmliche Krankenpflege, die zunächst
ausschließlich auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhte, bis 1901 zwei
eigene Krankenpflegerinnen angestellt wurden, die gegebenenfalls auch
außerhalb des Vereins und der Gemeinde Dienste leisten. Herr Strauß sowie
der von ihm geführte Verein waren anlässlich der Jubelfeier der Gegenstand
zahlreicher Glückwünsche u. a. auch von Oberbürgermeister Göbel, der für die
Jubiläumsgabe des Vereins an die christlichen Armen der Stadt Heilbronn in
seinem Schreiben dankte. Ein Festmahl schloss die Reihe der Veranstaltungen,
bei welchem Herr Rabbiner Kahn und eine Reihe andeer Herren sprachen und das
der Synagogenchor unter Leitung des Herr Oberkantor Dreyfus durch treffliche
Darbietungen verschönte." |
50-jähriges Bestehen der israelitischen Gemeinde
(1911)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Dezember 1911: "Heilbronn. Unsere Gemeinde, die zweitgrößte
Württembergs, feierte am 25. November mit einem Festgottesdienst ihr
50- jähriges Bestehen. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Dezember 1911: "Heilbronn. Unsere Gemeinde, die zweitgrößte
Württembergs, feierte am 25. November mit einem Festgottesdienst ihr
50- jähriges Bestehen.
Mehrere Jahrhunderte war Heilbronn den Juden verschlossen. Erst um die
Hälfte des vorigen Jahrhunderts ließen sich wieder jüdische Familien nieder.
Bis 1861, in welchem Jahre sie sich als selbständige Gemeinde organisierten,
gehörten diese Familien der Gemeinde
Sontheim an. Die Zahl der Juden nahm dann sehr schnell zu und besteht
heute aus etwa 900 Seelen." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Dezember 1911: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 15. Dezember 1911: |
Über aktuelle Aktivitäten im jüdischen Vereinsleben
der Stadt - Vortrag von Nachum Goldmann im Jugendverein (1913)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Dezember 1913: "Heilbronner Brief. Wie überall, so hat auch
hier der Winter seinen Einzug gehalten, was sich u. a. in dem leider nicht
allzuregen jüdischen Vereinswesen bemerkbar macht. Allerdings gibt es hier
alle möglichen jüdischen Vereine, wie Bne Brith-Loge, Talmudtoraverein,
Literaturverein, Freie jüdische Vereinigung und Liberale Vereinigung;
letztere zwei aber bisher nur Wahlzwecken dienend. Außerdem besteht hier
noch ein 'neutraler jüdischer Jugendverein', der in den drei Jahren seines
Bestehens nur wenig geleistet hat. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 12. Dezember 1913: "Heilbronner Brief. Wie überall, so hat auch
hier der Winter seinen Einzug gehalten, was sich u. a. in dem leider nicht
allzuregen jüdischen Vereinswesen bemerkbar macht. Allerdings gibt es hier
alle möglichen jüdischen Vereine, wie Bne Brith-Loge, Talmudtoraverein,
Literaturverein, Freie jüdische Vereinigung und Liberale Vereinigung;
letztere zwei aber bisher nur Wahlzwecken dienend. Außerdem besteht hier
noch ein 'neutraler jüdischer Jugendverein', der in den drei Jahren seines
Bestehens nur wenig geleistet hat.
Nun ist im Jugendverein ein Wandel zum Besseren eingetreten. Seine Leitung
hat gewechselt, und seitdem ist er im Aufwärtsstreben begriffen. Als erster
Vorsitzender fungiert — horribile dictu — ein Zionist, Schon diese
Äußerlichkeit allein beweist, wie revolutionierend der Zionismus auch bei
den Indifferentesten wirkt.
Aber noch nicht genug damit.- Bei großer Beteiligung wurde heute ein Vortrag
von Nachum Goldmann - Frankfurt angehört, der es übernommen hatte, in
jener Reihe von Referaten über die Assimilation des Judentums zu sprechen.
Goldmann sprach in meisterhafter Form, und der ihm eigenen Begeisterung über
das Ghettojudentum vom Standpunkte des Historikers, ohne dabei seine
subjektive Auffassung der Sache in den Vordergrund zu stellen. Trotzdem
wandte sich Dr. Gumbel, Vorsitzender der liberalen Ortsgruppe, in der
Diskussion gegen die subjektive Darstellung des Themas. Die Behauptung
Goldmanns, dass der Ghettojude die Emanzipation gar nicht gewollt hätte, was
natürlich oberflächlichen Betrachtern der jüdischen Geschichte entgehe muss,
suchte er durch Riesser zu entkräften.
Goldmann erwiderte im Schlussworte, dass er es für eine Verletzung der
Neutralität und für ein Verbrechen an der Geschichte halten würde, wenn er
den Vortrag zu irgendwelchen tendenziösen Zwecken ausbeuten wollte und
protestierte entschieden gegen die Unterstellung Dr. Gumbel's. Er, so führte
er aus, sehe nicht die Geschichte mit der Brille des Parteimannes an,
sondern sei durch objektive Betrachtung derselben zu dem geworden, was er
heute ist.
Es ist zu wünschen, dass die übrigen Vorträge mit noch mehr Aufmerksamkeit
angehört werden, zumal ja der Vorsitzende des Vereins jetzt acht Tage vorher
eine Besprechung des betreffenden Themas vornehmen will.
Ob die ganze Sache überhaupt viel von Nutzen sein wird, scheint mir nicht so
leicht zu beantworten, da es einen gewaltigen Aufwand von Kräften erfordert,
das jüdische Interesse unseres hiesigen Publikums aufzurütteln." |
 Über
den Referenten 1913 im jüdischen Jugendverein Heilbronn siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahum_Goldmann Über
den Referenten 1913 im jüdischen Jugendverein Heilbronn siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahum_Goldmann
Nahum Goldmann (auch Nachum Goldmann oder Goldman; geboren am 10. Juli 1895
in Wischnewo, Gouvernement Wilna, Russisches Kaiserreich, heute Belarus;
gestorben am 29. August 1982 in
Bad Reichenhall) war als Gründer und langjähriger Präsident des
Jüdischen Weltkongresses (WJC) einer der führenden Zionisten seiner Zeit.
(Foto: Wikimedia Commons). |
Ansprache von Rabbiner Kahn bei der Vereidigung der Rekruten für alle Konfessionen (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1914: "Heilbronn, 15. September (1914). In
Friedenszeiten findet die Eidesleistung der Rekruten in den Kirchen der
verschiedenen Konfessionen statt; diesmal standen am 20. vorigen Monats
Evangelische, Katholiken und Israeliten gemeinsam zur Eidesleistung im
weiten Viereck im Kasernenhof, und die Militärgeistlichen aller drei
Konfessionen auf dem großen, mit Pflanzen und Waffen geschmückten
Feldaltar. Es war vereinbart, dass der Vertreter der Minderheit die
religiöse Ansprache halte, und so sprach denn Rabbiner Kahn über
die Heiligkeit des Eides und im Anschluss an alttestamentliche Worte und
Vorbilder über die Größe und den Ernst dieser unserer Zeit. Die
Vertreter der christlichen Kirchen sprachen das Eingangs- und das
Schlussgebet. 'Gott ist gegenwärtig' und 'Großer Gott, wir loben dich'
umrahmten die Feier, die wiederum unter Mitwirkung der Feierwehrkapelle
stattfand. Eine markige Ansprache des Kommandeurs schloss das Ganze ab.
Wie schwinden doch so viele Unterschiede und Gegensätze dahin in großen
schweren Zeiten. Als die Geistlichen im Talar gemeinsam zu der Feier
hinausfuhren und dann am Schluss nebeneinander an dem Altar standen, die
ging gewiss durch viele Herzen eine Ahnung davon, dass 'ein Ziel
erglänzt dem Pilgerlaufe' und 'ein Vater waltet über allen'.
Vaterlandsliebe und Gottesglaube - wir haben ihr Wachsen verspürt im
Sturm dieser Zeit; möchten sie mächtige Schwingen bleiben in unserem
Volksleben, dann werden die schweren Opfer nicht vergebens sein, von denen
jetzt jeder neue Tag uns Kunde bringt; dann erst werden wir Siegeslieder
singen können im höheren Chor." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1914: "Heilbronn, 15. September (1914). In
Friedenszeiten findet die Eidesleistung der Rekruten in den Kirchen der
verschiedenen Konfessionen statt; diesmal standen am 20. vorigen Monats
Evangelische, Katholiken und Israeliten gemeinsam zur Eidesleistung im
weiten Viereck im Kasernenhof, und die Militärgeistlichen aller drei
Konfessionen auf dem großen, mit Pflanzen und Waffen geschmückten
Feldaltar. Es war vereinbart, dass der Vertreter der Minderheit die
religiöse Ansprache halte, und so sprach denn Rabbiner Kahn über
die Heiligkeit des Eides und im Anschluss an alttestamentliche Worte und
Vorbilder über die Größe und den Ernst dieser unserer Zeit. Die
Vertreter der christlichen Kirchen sprachen das Eingangs- und das
Schlussgebet. 'Gott ist gegenwärtig' und 'Großer Gott, wir loben dich'
umrahmten die Feier, die wiederum unter Mitwirkung der Feierwehrkapelle
stattfand. Eine markige Ansprache des Kommandeurs schloss das Ganze ab.
Wie schwinden doch so viele Unterschiede und Gegensätze dahin in großen
schweren Zeiten. Als die Geistlichen im Talar gemeinsam zu der Feier
hinausfuhren und dann am Schluss nebeneinander an dem Altar standen, die
ging gewiss durch viele Herzen eine Ahnung davon, dass 'ein Ziel
erglänzt dem Pilgerlaufe' und 'ein Vater waltet über allen'.
Vaterlandsliebe und Gottesglaube - wir haben ihr Wachsen verspürt im
Sturm dieser Zeit; möchten sie mächtige Schwingen bleiben in unserem
Volksleben, dann werden die schweren Opfer nicht vergebens sein, von denen
jetzt jeder neue Tag uns Kunde bringt; dann erst werden wir Siegeslieder
singen können im höheren Chor." |
Vorträge von Rabbiner Dr. Tänzer (Göppingen) und
Rechtsanwalt Scheuer (Heilbronn) über die Palästinafrage
(1921)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. Oktober 1921: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. Oktober 1921: |
Die jüdischen Seminaristen des Heilbronner Lehrerseminars
nehmen an einem Ferienkurs für Rabbiner und Religionslehrer teil
(1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. April 1930: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24. April 1930: |
Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte
(1933)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Dezember 1933: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21. Dezember 1933: |
Das Strandbad ist für jüdische Besucher geschlossen
(1934)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Oktober 1934: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Oktober 1934: |
|