|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht:
"Synagogen im Rhein-Hunsrück-Kreis"
 Laufersweiler (VG
Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis)
Laufersweiler (VG
Kirchberg, Rhein-Hunsrück-Kreis)
mit Büchenbeuren (VG Kirchberg,
Rhein-Hunsrück-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Bitte besuchen Sie auch die Website des Förderkreises Synagoge Laufersweiler
e.V.
www.synagoge-laufersweiler.de
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Laufersweiler bestand eine jüdische Gemeinde bis
1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18. Jahrhunderts
zurück. 1748 wird berichtet, dass ein "fünfter" Jud im Ort
aufgenommen wurde.
Genaue Zahlen liegen jedoch erst aus dem 19. Jahrhundert vor:
1808 lebten 60 jüdische Personen in Laufersweiler (in acht Familien), 1847 waren es
101 (in 20 Familien), 1850 112 (davon 21 Männer, 21 Frauen und 70 Kinder), 1885 114
(16 % der Gesamteinwohnerschaft), 1889 110, 1899 160 (in 33 Haushaltungen). Die höchste Zahl jüdischer Einwohner
wurde 1895 mit 195 Personen erreicht (20 % der Gesamteinwohnerschaft).
Danach ging die Zahl durch Aus- und Abwanderung zurück. 1840 werden
an jüdischen Familienvorständen genannt: Joseph Gerson, Mayer Wittib
Frank, Joseph Löser, Wittib Straus, Michael Mayer, Mathias Mayer, Isaak Löser,
Simon Mayer, Jacob Mayer, Michael Frank, Adam Frank, Adam Maas, Adam Löser,
Michael Mayer II., Michael Heymann, Michael Gerson, David Gerson, Moses Fränkel
(damals Lehrer). Die jüdischen Familienväter waren überwiegend Viehhändler,
einige auch Metzger.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
Elementar- beziehungsweise Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Elementar-
beziehungsweise Religionslehrer
angestellt, der teilweise zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war (zu
einzelnen Lehrern und Stellenausschreibungen unterschiedlicher Jahre, aus denen
auch die jeweiligen Gemeindevorsteher hervorgehen, siehe unten).
Von den jüdischen Lehrern werden seit den 1860er-Jahren unter anderem genannt
(vgl. weitere Namen unten zu den Ausschreibungen): ab 1859 Israel Grab,
wenig später bis 1867 Herz Levy, danach Mendel Maßbacher (bis 1871), 1871 bis
1881
Moses Eisenkrämer, 1884 bis 1886 Moritz May, 1889 bis 1895 Israel Voss
(unterrichtete 1893 an der Religionsschule der Gemeinde noch 22 Kinder), 1902
bis 1911 Julius Levy; 1932 Lehrer Bernhard Lehmann aus
Simmern unterrichtete 1932 in Laufersweiler noch 13 Kinder
aus der Gemeinde.
Vorsteher der jüdischen Gemeinde waren u.a.: 1886/1893 Isaak Frank I, B. Mayer
und Marx Heymann; um 1899 M. Joseph, Marx Heymann, J. Frank, A. Seliger; 1932 Joseph Heimann I, Isak Lösser und Salomon Mayer, dazu Vorsitzender der Repräsentanz
August Joseph.
Zahlen der jüdischen Gemeindemitglieder: 1893 200 Personen (in 30
Familien); 1897 159 Personen; 1899 160 (in 33 Familien); 1932 80 Personen (von
insgesamt 820 Einwohnern), dazu 5 in Buchenbeuren.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Vizefeldwebel
Julius Baum (geb. 26.6.1889 in Laufersweiler, gef. 27.10.1918), Julius Heimann
(geb. 20.5.1895 in Laufersweiler, gef. 13.7.1918), Edmund Mayer (geb. 2.9.1895
in Laufersweiler, gef. 25.9.1915) und Moritz Mayer (geb. 17.2.1890 in
Laufersweiler, gef. 5.4.1915).
Um 1925, als 75 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (8,3 % der
Gesamteinwohnerschaft), waren die Vorsteher der Gemeinde Simon Braun, Isaak
Löser, Mayer Frank. Zur Repräsentanz gehörten Isaak Frank, August Joseph,
Leopold Baum, Joseph Simon, Moses Meyer, Salomon Meyer, David Meyer, Isaak Kahn,
Bernhard Heimann. Zur jüdischen Gemeinde
gehörten auch die in Buchenbeuren lebenden jüdischen Personen (1925 und 1932:
je 5 Personen).
An jüdischen Vereinen bestanden der Verein Chewra Kadischa
(Beerdigungsverein, Männerverein, um 1889/97 unter Leitung von J. Frank I, B. Mayer und M.
Heymann, 1899/1905 unter Leitung von G. Mayer), der Verein Chewrat Noschim
(Frauenverein, 1889/93 unter Leitung der Frau von M. Heimann. 1905 unter Leitung
von Frau Löser); der Verein Geminches
Chassodim (Ziel: Unterstützung Armer und Kranker; 1932 Vorsitzender Emanuel
Frank) sowie der Israelitische
Frauenverein (Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger; 1932 Vorsitzende Klara
Heimann).
Über die Zeit nach 1933 sind noch zusammenfassende Informationen zu
ergänzen; zu den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 siehe unten.
Die seit Ende der 1920er-Jahre letzten Mitteilungen in jüdischen Periodika zu
familiengeschichtlichen Ereignissen in Laufersweiler waren: Tpd von Jakob Löser
am 1.11.1927 (Israelitisches Familienblatt vom 24.11.1927; 80. Geburtstag von
Julius Seligmann am 4. Mai 1928 (Israelitisches Familienblatt vom 3.5.1928); Tod
der Frau von Bernhard Heimann (Israelitisches Familienblatt vom 7.12.1933);
Von den in Laufersweiler geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gerda (Gertrude) Ackermann geb. Kahn (1893),
Adolf Baum (1888), Karolina (Lina) Berney geb.
Löser (1890, vgl. Erinnerungsblatt
des "Aktiven Museums Spiegelgasse" Wiesbaden), Frieda Ermann geb. Meyer 1895), Elisabeth (Elsbeth) Frank (1903),
Fanny Frank geb. Kahn (1870), Isaak (Isaac) Frank (1865), Julius (Jules) Frank (1881), Chana
Gertner (1892), Else Händel geb. Löser (1900), Albert Hanau (1885), Hilde Hanau geb.
Löser (1892), Sara Klara Hanau geb. Mayer (1867, Foto des Grabsteines in
Gurs siehe unten), Gertrude Joseph geb. Hayum (1893), Max Joseph (1905), Ruth Josef
(1921), Sophie Kallmann geb. Baum (1899, "Stolperstein" in
Trier, Neustraße 92), Berta Levy geb. Heimann (1863), Magdalena (Lenchen) Löser geb.
Levi (1863), Sally Löwenstein (1887), Bernhard (Benni) Mayer
(1897), Eva Mayer (1929), Ferdinand Meyer (1883), Gerd Mayer (1930), Hedwig
Mayer (1896), Kurt Mayer (1937), Paula Mayer geb.
Franken (1901), Rosa Mayer (1895), Sally Mayer (1939), Ida Moxter geb. Mayer
(1894), Hildegard Papp geb. Frank (1895), Amalie Rosenthal geb. Baum (1886;
"Stolperstein" in Mörfelden), Emma Scholem geb. Sonnborn (1867), Ludwig (Lazarus) Scholem (1863), Gertrud Seelig geb. Hanau
(1922), Klara Tenzer geb. Rauner (1894), Moritz (Moses) Seiden-Tenzer (1890 oder
1894), Zacharias Weiler (1848).
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der
jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters
/ Schochet
Die
ersten in den vorliegenden Quellen genannten Lehrer waren Elias Jacob
(1802 genannt), Aron Anschel (1804 genannt), Natan Isaac (bis
1825). Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde noch in Privaträumen jüdischer
Häuser unterrichtet. 1825 bis 1837 war Lehrer Simon Scheuer in
der Gemeinde tätig (danach in Kirchberg/Hunsrück). Zu seiner Zeit
(um 1826/28) wurden Schulräume in dem vermutlich neuen Synagogengebäude
eingerichtet, das 1839 abgebrannt ist. Die nächsten Lehrer waren Moses
Fränkel (ab 1835; zu seiner Zeit besuchten 20 bis 25 Kinder die Schule). Er
wurde 1857 entlassen, die Stelle unter dem damaligen Gemeindevorsteher M.
Frank neu ausgeschrieben:
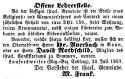 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1857:
"Offene Lehrerstelle. Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist
die Stelle eine Religions- und Elementarlehrers und Kantors mit einem
jährlichen Gehalt von circa Thaler 150, freier Wohnung, freiem
Brennmaterial, nebst einigen Ländereien zum Bebauen und üblichen
Nebeneinkünften, vakant. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1857:
"Offene Lehrerstelle. Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist
die Stelle eine Religions- und Elementarlehrers und Kantors mit einem
jährlichen Gehalt von circa Thaler 150, freier Wohnung, freiem
Brennmaterial, nebst einigen Ländereien zum Bebauen und üblichen
Nebeneinkünften, vakant.
Bewerber, welche hierzu befähigt sind, wollen sich an den Oberrabbiner
Herrn Dr. Auerbach in Bonn, oder an Herrn David Rothschild, Mitglied des
israelitischen Konsistoriums zu Simmern, wenden.
Laufersweiler (Regierungs-Bezirk Koblenz), 20. Juli 1857. Der Vorsteher
der israelitischen Gemeinde. M. Frank". |
| Anfang 1859 trat Israel Grab die
Stelle als Lehrer an, wenig später Herz Levy aus Hottenbach (1867
entlassen). Die Stelle wurde neu ausgeschrieben: |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1868: "Die
Synagogengemeinde Laufersweiler, Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz,
sucht einen jüdischen Elementar- und Religionslehrer und Vorsänger mit
einem jährlichen fixen Gehalt von 250 Talern nebst 50 Talern
Neben-Einkünften, 2 Klafter Holz, freie Wohnung und die Benützung
einiger Parzellen Ackerlandes. Die Stelle ist gleich zu besetzen.
Reflektierende belieben ihre Anmeldungen franko an Gottlieb Mayer I.
einzusenden. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Isaac Frank
I." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1868: "Die
Synagogengemeinde Laufersweiler, Kreis Simmern, Regierungsbezirk Koblenz,
sucht einen jüdischen Elementar- und Religionslehrer und Vorsänger mit
einem jährlichen fixen Gehalt von 250 Talern nebst 50 Talern
Neben-Einkünften, 2 Klafter Holz, freie Wohnung und die Benützung
einiger Parzellen Ackerlandes. Die Stelle ist gleich zu besetzen.
Reflektierende belieben ihre Anmeldungen franko an Gottlieb Mayer I.
einzusenden. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Isaac Frank
I." |
| Es folgte Mendel Maßbacher aus Gleicherwiesen (1868),
1871 - 1881 Moses Eisenkrämer. Zu seiner Zeit sollte die Schule
geschlossen werden, nachdem die Zahl der Schüler bereits stark
zurückgegangen war (siehe unten: Text
von 1877). 1881 wurde Eisenkrämer entlassen. Er blieb zunächst in
Laufersweiler und unterrichtete weiterhin sieben Kinder, während die
übrigen jüdischen Kinder die evangelische Schule besuchten. Wenig
später wechselte Moses Eisenkrämer nach Birkenfeld,
wo er bis zu seinem Tod 1919 als Lehrer blieb. Die
Lehrerstelle wurde 1881 als Religionslehrer-, nur noch fakultativ als Elementarlehrerstelle ausgeschrieben: |
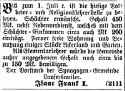 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1881: "Bis
zum 1. Juli dieses Jahres ist die hiesige Vorbeter- und
Religionslehrerstelle zu besetzten. Schächter erwünscht. Gehalt 450 Mark
nebst Nebenverdienst, welches mit dem Schächter-Einkommen circa auch Mark
200 einträgt. Ferner freie Wohnung und Benutzung einiger Stücke
Ackerland und Garten. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1881: "Bis
zum 1. Juli dieses Jahres ist die hiesige Vorbeter- und
Religionslehrerstelle zu besetzten. Schächter erwünscht. Gehalt 450 Mark
nebst Nebenverdienst, welches mit dem Schächter-Einkommen circa auch Mark
200 einträgt. Ferner freie Wohnung und Benutzung einiger Stücke
Ackerland und Garten.
Als Elementarlehrer würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch
circa bis zu 150 Mark bewilligen.
Der Vorstand der Synagoge-Gemeinde Laufersweiler. Isaac Frank
I." |
| Lehrer Eisenkrämer konnte seine Entlassung
nicht ganz akzeptieren, in einer erneuten Anzeige eine Woche nach der
obigen war zu lesen: |
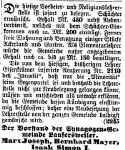 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1881: "Die
hiesige Vorbeter- und Religionslehrerstelle ist sofort zu besetzen.
Schächter erwünscht. Gehalt Mark 450 nebst Nebenverdienst, welches mit
dem Schächter-Einkommen auch ca. Mark 200 einträgt. Ferner freie Wohnung
und Benutzung einiger Stücke Ackerland und Garten. Als Elementarlehrer
würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch ca. bis zu Mark 150
bewilligen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juni 1881: "Die
hiesige Vorbeter- und Religionslehrerstelle ist sofort zu besetzen.
Schächter erwünscht. Gehalt Mark 450 nebst Nebenverdienst, welches mit
dem Schächter-Einkommen auch ca. Mark 200 einträgt. Ferner freie Wohnung
und Benutzung einiger Stücke Ackerland und Garten. Als Elementarlehrer
würde die Gemeinde außer angegebenem Gehalt noch ca. bis zu Mark 150
bewilligen.
Die von dem hiesigen, bisherigen Lehrer Eisenkrämer inserierte Äußerung
Nr. 2110 des 'Israelit', dass nur die 'Minorität' seine Gegenpartei sei
und deshalb die Lehrerstelle nicht zur Neubesetzung gelangen könne,
müssen wir entschieden als unwahr erklären, da die Gemeinde dessen
Kündigung einstimmig beschlossen; daher eine Neubesetzung der
Lehrerstelle von der ganzen Gemeinde baldigst gewünscht wird.
Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler. Marx Joseph, Bernhard
Mayer, Isaak Simon I." |
| Mit den Stellenbesetzungen in den
1880er-Jahren hatte die Gemeinde wenig Glück. Mehrere Lehrer lösten
einander, teils nach nur wenigen Monaten in der Gemeinde ab. 1882
begann man überraschenderweise die Stelle wieder als Elementarlehrerstelle
auszuschreiben. Überlegungen bestanden in der Gemeinde, die jüdische
Elementarschule wieder einzurichten. |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1882:
"Die Elementarlehrer- und Kantorstelle der Synagogen-Gemeinde zu
Laufersweiler, Reg.-Bez. Koblenz ist zu besetzen. Schächter erwünscht.
Reflektierende belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse und
Qualifikations-Atteste bei dem Vorstand zu melden. Gehalt nach
Übereinkommen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Februar 1882:
"Die Elementarlehrer- und Kantorstelle der Synagogen-Gemeinde zu
Laufersweiler, Reg.-Bez. Koblenz ist zu besetzen. Schächter erwünscht.
Reflektierende belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse und
Qualifikations-Atteste bei dem Vorstand zu melden. Gehalt nach
Übereinkommen.
Laufersweiler, 18. Februar 1882. Der Vorstand. Marx Joseph. Bernhard
Mayer." |
| Zwischen 1882 und 1889 waren die
Lehrer: Wolf Lotheim aus Niedenstein, Hirsch Hornik, 1884 bis
1886 Moritz May aus
Geldersheim (ab 1886 in Rhaunen), Levy Nußbaum aus Burghaun
(Zwei Artikel zum weiteren Lebenslauf von Levy Nußbaum siehe auf
Seite Burghaun). Die Ausschreibungen der Jahre 1884, 1887 und 1889 bezogen sich wieder auf eine reine Religionslehrerstelle: |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1884:
"Die Stelle als Religionslehrer der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler.
Regierungsbezirk Koblenz, wird zum 1. April vakant. Reflektierende
belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse etc. an den Vorstand zu
melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1884:
"Die Stelle als Religionslehrer der Synagogen-Gemeinde Laufersweiler.
Regierungsbezirk Koblenz, wird zum 1. April vakant. Reflektierende
belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse etc. an den Vorstand zu
melden.
Laufersweiler, den 1. Februar 1884. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde. Isak
Frank I. |
| |
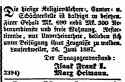 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:
"Die hiesige Religionslehrer-, Kantor- und Schächterstelle ist
baldigst zu besetzen. Fixer Gehalt Mark 600 nebst Mark 300 Nebenverdienste
und freier Wohnung. Reflektierende, nur Unverheiratete, belieben sich
unter Beifügung ihrer Zeugnisse zu melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:
"Die hiesige Religionslehrer-, Kantor- und Schächterstelle ist
baldigst zu besetzen. Fixer Gehalt Mark 600 nebst Mark 300 Nebenverdienste
und freier Wohnung. Reflektierende, nur Unverheiratete, belieben sich
unter Beifügung ihrer Zeugnisse zu melden.
Laufersweiler, 26. Juli 1887.
Der Synagogenvorstand: Isaak Frank I. Marx Heimann." |
| |
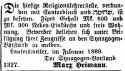 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1889:
"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Kantordienst und
Schechita (Schächten), ist zu besetzen. Fixes Gehalt Mark 600 und Mark
300 Neben-Einkünfte und freie Wohnung. Bewerber belieben sich unter
Beifügung ihrer Zeugnisse an den Synagogen-Vorstand zu melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1889:
"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Kantordienst und
Schechita (Schächten), ist zu besetzen. Fixes Gehalt Mark 600 und Mark
300 Neben-Einkünfte und freie Wohnung. Bewerber belieben sich unter
Beifügung ihrer Zeugnisse an den Synagogen-Vorstand zu melden.
Laufersweiler, im Februar 1889.
Der Synagogen-Vorstand Marx
Heimann". |
| Auf diese Ausschreibung hin konnte Israel
Voss aus Kerpen bei Köln angestellt werden. Er blieb bis 1895, danach
kamen in wiederum rascher Folge hintereinander Aron Katz aus
Waldgirmes, Hermann Ehrmann, Arnold Seliger aus
Gemünden
(Unterfranken), Max Levite, Isidor Popper aus Böhmen. |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1897:
"Die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und Schochet ist
sofort zu besetzen, eventuell bis zum 1. Oktober. Jährliches Gehaltsfixum
800 Mk. nebst ca. 300 Mk. Nebenverdienst. Reflektierende wollen ihre
Zeugnisse, sowie seminaristischen Prüfungs-Nachweis einsenden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1897:
"Die hiesige Stelle als Religionslehrer, Kantor und Schochet ist
sofort zu besetzen, eventuell bis zum 1. Oktober. Jährliches Gehaltsfixum
800 Mk. nebst ca. 300 Mk. Nebenverdienst. Reflektierende wollen ihre
Zeugnisse, sowie seminaristischen Prüfungs-Nachweis einsenden.
Laufersweiler, 2. Mai 1897. Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde:
Marx Joseph." |
| |
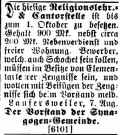 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:
"Die hiesige Religionslehrer & Kantorstelle ist bis zum 1.
Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst
und freier Wohnung. Bewerber, welche auch Schochet sein sollen, müssen im
Besitze von Elementarlehrerzeugnissen sein und wollen mit Beifügen der
Zeugnisse sich beim Vorstand melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1901:
"Die hiesige Religionslehrer & Kantorstelle ist bis zum 1.
Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst
und freier Wohnung. Bewerber, welche auch Schochet sein sollen, müssen im
Besitze von Elementarlehrerzeugnissen sein und wollen mit Beifügen der
Zeugnisse sich beim Vorstand melden.
Laufersweiler, 7. August (1901).
Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde." |
| |
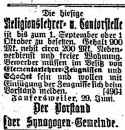 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1902: "Die
hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle ist bis zum 1. September oder 1.
Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst
und freier Wohnung. Bewerber müssen im Besitz von Elementarlehrer-Zeugnissen
und Schochet sein und wollen mit Einfügung der Zeugnisse sich beim
Vorstand melden. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1902: "Die
hiesige Religionslehrer- und Kantorstelle ist bis zum 1. September oder 1.
Oktober zu besetzen. Gehalt 900 Mark nebst circa 200 Mark Nebenverdienst
und freier Wohnung. Bewerber müssen im Besitz von Elementarlehrer-Zeugnissen
und Schochet sein und wollen mit Einfügung der Zeugnisse sich beim
Vorstand melden.
Laufersweiler, 29. Juni (1902).
Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde." |
| Auf letztere Anzeige hin folgte im September
1902 Julius Levy aus Illingen als Lehrer in Laufersweiler. Er blieb
bis 1911 in der Gemeinde. |
Lehrerkonferenz mit nur geringer
Beteiligung (1868)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der jüdische Lehrer" vom 2. September 1868: "Laufersweiler
im Hunsrück, 13. August. Zu der heute hier anberaumten Konferenz hatten
sich nur Lehrer W. Katz aus Hottenbach,
H. Levy, früherer Lehrer hier, M. Eppstein aus
Kirchberg, v. d. Walde aus
Wittlich, J. Eppstein aus
Gemünden und Laser aus
Sohren eingefunden. Diese beschlossen: Wir
seben ein, dass die Beteiligung der Herren Kollegen in hiesiger Gegend eine
viel zu geringe ist und müssten unser begonnenes Werk aufgeben, wenn wir
nicht hofften, dass unsere Kollegen der Bezirke Trier und Koblenz sich in
größerer Anzahl, als bisher uns anschließen, damit wir mit diesen einen
Bezirksverein bilden, der sich dann, sobald er lebensfähig geworden, einem
größeren Vereine anschließt. Artikel
in der Zeitschrift "Der jüdische Lehrer" vom 2. September 1868: "Laufersweiler
im Hunsrück, 13. August. Zu der heute hier anberaumten Konferenz hatten
sich nur Lehrer W. Katz aus Hottenbach,
H. Levy, früherer Lehrer hier, M. Eppstein aus
Kirchberg, v. d. Walde aus
Wittlich, J. Eppstein aus
Gemünden und Laser aus
Sohren eingefunden. Diese beschlossen: Wir
seben ein, dass die Beteiligung der Herren Kollegen in hiesiger Gegend eine
viel zu geringe ist und müssten unser begonnenes Werk aufgeben, wenn wir
nicht hofften, dass unsere Kollegen der Bezirke Trier und Koblenz sich in
größerer Anzahl, als bisher uns anschließen, damit wir mit diesen einen
Bezirksverein bilden, der sich dann, sobald er lebensfähig geworden, einem
größeren Vereine anschließt.
Behufs dessen soll dies, gleichzeitig als ein Aufruf gelten, in welchem die
Herrn Kollegen aus den genannten Bezirken und diejenigen aus dem
Birkenfeld'schen aufgefordert werden, sich bei dem Unterzeichneten zu
melden, ob sie gewillt sind, sich an der noch näher zu bestimmenden
Konferenz zu beteiligen.
Ebenso, wie wir lobend erwähnen müssen, dass Lehrer Levy, trotzdem er jetzt
Privatmann ist, sich noch recht warm der Sache annimmt und keine Kosten
scheute, uns den Aufenthalt in Laufersweiler angenehm zu machen - müssen wir
das Benehmen der Kollegen M. und C. aus Ph. tadeln, welche beide aus rein
egoistischen Gründen der Konferenz fern blieben.
Doch alles dies darf uns nicht abschrecken, wir dürfen den Mut nicht
verlieren das begonnene Werk zu fördern, sondern im Vertrauen am Gott und
unsere gute Sache hoffen wir, dass recht viele Kollegen von Rhein und Nahe,
von Mosel und Saar sich hier melden und uns ihre Hilfe zusagen.
Kirchberg, den 16. August 1868.
M. Eppstein, Lehrer." |
 Artikel aus der Zeit des Lehrers Moses Eisenkrämer (Foto aus Buch von
Johann s.Lit. S. 23)
Artikel aus der Zeit des Lehrers Moses Eisenkrämer (Foto aus Buch von
Johann s.Lit. S. 23)
Von den Aktivitäten christlicher
Judenmissionare in Laufersweiler - Bericht des jüdischen Lehrers Moses Eisenkrämer 1874
 Bericht
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1874:
"Korrespondenz - Treiben der Missionare. Laufersweiler, 2. Oktober.
Erlauben Sie mir, darauf aufmerksam zu machen, dass die (Kölner)
Missionare der Judenbekehrung wieder ganz frisch ihr Unweisen treiben, und
zwar auf ganz ungenierte Weise, wobei sie besonders dem Unwissenden zu
imponieren suchen, wie folgender Fall beweisen wird. Bericht
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Oktober 1874:
"Korrespondenz - Treiben der Missionare. Laufersweiler, 2. Oktober.
Erlauben Sie mir, darauf aufmerksam zu machen, dass die (Kölner)
Missionare der Judenbekehrung wieder ganz frisch ihr Unweisen treiben, und
zwar auf ganz ungenierte Weise, wobei sie besonders dem Unwissenden zu
imponieren suchen, wie folgender Fall beweisen wird.
Heute vor achte Tagen, am Rüsttage des Laubhüttenfestes, kam ein Fremder
in einem hiesigen jüdischen Wirtshause an und frug, ob er während der
Feiertage hier logieren könne. Der Wirt bejahte, wusste aber nicht,
wofür er ihn halten solle; denn obwohl er viel hebräisch sprach, wollte
er doch nicht Jude sein. Trotzdem verlangte er beim Nachtessen mit in der Sukka
(Laubhütte) zu essen. Hier kramte er nun viel Gelehrsamkeit aus, sodass
der Wirt und einige Nachbarn, welche hinzukamen, ihn für einen 'Lamden'
hielten. Er erkundigte sich nach der religiösen Richtung der Gemeinde,
und als er merkte, dass sie eine orthodoxe sei, äußerte er, morgen (1.
Tag Sukkot) in der Synagoge predigen zu wollen. Mein guter Mann kam nun
wirklich in die Synagoge; das Predigen wurde ihm aber natürlich nicht
gestattet.
Nach Beendigung des Gottesdienstes stellte er sich mir als Lehrer vor, und
nach einigen Worten steuerte er sofort auf sein Ziel (Bekehrungsversuche)
zu. So behauptete er u.a., um die Erbsünde zu beweisen, vor dem
Sündenfall habe die Erde Alles von selbst hervorgebracht, ohne
menschliche Beihülfe, das Weib habe beim Gebühren keine Schmerzen gehabt
und dergleichen Unsinn mehr.
Ich erwiderte ungefähr (kurz angedeutet), dass er die Bibel besser
studieren möge, wo es heißt: 'sie zu bearbeiten und zu bewahren'
(1. Mose 2,15). Er: la'awda heißt 'bedienen', nicht 'bearbeiten'. Ins
Lächerliche hieraus ziehend, sagte ich: 'Bringen Sie der Madam Erde
gefälligst ein Glas Wasser usw. usw.'. 'Ferner hat |
 hat Eva erst nach dem Sündenfall geboren und nicht vor demselben.' Nach
mehreren solchen, auch naturwissenschaftlichen Hieben ging er von mir weg.
Von Wissenschaft, Naturlehre etc. will er nichts wissen. Die Tora, sagte
er, um den Ungebildeten zu gewinnen, stehe höher, als alle Wissenschaft.
Auch ließ er merken, dass er lieber mit Lehmann'schen (= Orthodoxen) als
mit Philippson'schen Geistern (= Liberalen) zu tun habe. Etwas später
hörte ich, dass er vor der Wohnung des Herrn Vorstehers predige. Mit
einem Kollegen, Hermann Levy, gegenwärtig in Ferien hier, ging ich denn
auch hin, um ihn zu trümpfen und sein Spiel zu verderben.
hat Eva erst nach dem Sündenfall geboren und nicht vor demselben.' Nach
mehreren solchen, auch naturwissenschaftlichen Hieben ging er von mir weg.
Von Wissenschaft, Naturlehre etc. will er nichts wissen. Die Tora, sagte
er, um den Ungebildeten zu gewinnen, stehe höher, als alle Wissenschaft.
Auch ließ er merken, dass er lieber mit Lehmann'schen (= Orthodoxen) als
mit Philippson'schen Geistern (= Liberalen) zu tun habe. Etwas später
hörte ich, dass er vor der Wohnung des Herrn Vorstehers predige. Mit
einem Kollegen, Hermann Levy, gegenwärtig in Ferien hier, ging ich denn
auch hin, um ihn zu trümpfen und sein Spiel zu verderben.
Als wir kamen, war fast wirklich die ganze Gemeinde (Männer und
Jünglinge) um ihn versammelt und hörten andächtig schweigend zu. Er
erklärte eben, wir hätten zu viele Mizwoth (Gebote); und da wir
dieselben nicht mehr alle halten könnten, seien wir keine echte Juden
mehr, müssten deshalb eine Sühne (Christus) haben. Ich ließ ihn seine
gelehrten Schlussfolgerungen nicht zu Ende führen, sondern gab ihm die
bekannte Hillel'sche Antwort, dass wir Juden sein könnten, wenn wir das
Gebot der Nächstenliebe hielten; ja, wer nur an den einen Gott
glaubt, ist Jude. Aber der Jude kann nie und nimmer an eine dreiteilige
Gottheit glauben.
Nun kritisierte er unsere Gebete, Zeremonien etc. Besonders ging er auf
die Mizwah von Sukka (Gebot zum Bau der Laubhütte) selber
ein, wollte beweisen aus der Piutstelle: 'Achte die Mizwoth von Sukka
nicht gering, denn sie ist so wichtig wie alle anderen Mizwoth', dass wir
eben heutzutage die Mizwoth nicht mehr verständen. Herr Levy hat ihm klar
bewiesen, dass er nichts davon versteht, und dass der Pajtan mit
Recht diesen Ausspruch getan, weil uns die Sukka auf den alleinigen Schutz
Gottes verweist etc. Er ist dermaßen be- und geschlagen worden, dass er,
nachdem er einen vermeintlichen Trumpf aus Jesaja 53 aufgespielt, sofort
entschlüpfte, ohne eine Erwiderung abzuwarten.
Nun waren seine Hoffnungen und Absichten hier total vereitelt. Er wollte
die Feiertage (wenigstens zwei Tage) hier bleiben (die hiesige Gemeinde
war ihm jedenfalls als lohnend für seine Absichten geschildert worden),
und nun machte er sich sofort am ersten Tage nach dem Mittagessen aus dem Staube.
Er machte mir vorher noch einen Abschiedsbesuch und nannte sich
Rosenstrauch aus Köln, wogegen ich erwiderte, dass er, meiner Meinung
nach, ein getaufter Jude und Pastor Arenfeld aus Köln sei. A. nannte er
sich auch beim Wirte. - Ich riet ihm noch, er solle doch lieber in große
Städte gehen, z.B. nach Berlin, und dort, wo selbst evangelische
Geistliche die Dogmen der christlichen Kirche anfechten, predigen; aber
die Juden fernerhin mit seinem dummen Kram nicht mehr behelligen.
Dass er jüdischen unbebildeten Leuten imponiert, sie selbst frappiert,
ist sicher, denn er spricht das Hebräische nach polnisch-deutschem
Dialekt, nicht portugiesisch, wie es auf höhern Schulen gelehrt wird.
Auch ist er in allen rabbinischen Schriften ziemlich bewandert, gerade ein
Beweis, dass er ein getaufter Jude ist. Bei dieser Gelegenheit habe ich
auch endlich durchgesetzt, was ich schon öfter beantragt, dass die
Londoner Chamoschim endlich abgeschafft und durch die
Philippson'sche (Bibelanstalt) ersetzt werden. Eisenkrämer,
Lehrer" |
Der jüdische Lehrer Moses Eisenkrämer wird 1875
zeitweise Verwalter der
evangelischen Schule
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Juni
1875: "Laufersweiler (Rheinland), 4. Juni (1875). Angeregt durch die
Korrespondenz aus Laasphe in Nr. 23 Ihrer geschätzten Zeitung erlaube ich
mir, Ihnen denselben Fall von hier mitzuteilen. Hier ist ein junger
evangelischer Lehrer, der im Herbste 1873 seinen sechswöchentlichen
Dienst abzudienen hatte. Seine Schule wurde damals von einem benachbarten
evangelischen Lehrer verwaltet. In hiesigem Orte befindet sich noch eine
katholische und eine jüdische Schule.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Juni
1875: "Laufersweiler (Rheinland), 4. Juni (1875). Angeregt durch die
Korrespondenz aus Laasphe in Nr. 23 Ihrer geschätzten Zeitung erlaube ich
mir, Ihnen denselben Fall von hier mitzuteilen. Hier ist ein junger
evangelischer Lehrer, der im Herbste 1873 seinen sechswöchentlichen
Dienst abzudienen hatte. Seine Schule wurde damals von einem benachbarten
evangelischen Lehrer verwaltet. In hiesigem Orte befindet sich noch eine
katholische und eine jüdische Schule.
Ende Mai dieses Jahres musste der evangelische Lehrer zur Schießübung.
Nun fragte es sich, wer wird die Schule verwalten? Unser Herr
Bürgermeister schlug des Kostenpunkts wegen den katholischen Lehrer vor;
die Verwaltung wird aus dem Gemeindesäckel extra vergütet. Da nun der katholische
Lehrer von der Zivil-Gemeinde besoldet wird, hätte er es umsonst tun
müssen. Der Herr Kreisschulinspektor ließ aber durch den
Lokalschulinspektor (beide sind evangelisch Geistliche) mich bitten, die
Verwaltung zu übernehmen. Im Falle, dass ich sie nicht übernehmen wolle,
würde er (der Kreisschulinspektor) mir es als mein Schulinspektor
befehlen. Ich übernahm die Verwaltung natürlich freiwillig. Daraus ist
zu ersehen, dass doch nach und nach das Licht der Aufklärung und der
wahren Humanität überall siehen wird. Eisenkrämer" |
Zur Frage nach der Schließung der jüdischen Elementarschule 1877
 Bericht
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Dezember
1877: "Laufersweiler, im Dezember (1877). Die 'Allgemeine Zeitung des
Judentums' hat in ihrem langen Bestande stets nach dem Standpunkte der
Unparteilichkeit gestrebt, besonders auch aus der Ansicht heraus, dass,
wer wirklich bessern will, die Aufdeckung der wahren Ursachen einer
Erscheinung nicht scheuen dürfe. Darum gestatte ich mir auch folgende
Bemerkung. Als vor einiger Zeit die Aufhebung einiger jüdischer
Elementarschulen gemeldet wurde, zog man daraus einen Vorwurf für die
staatlichen Behörden, von denen schließlich diese Aufhebung ausgegangen
sei. Ich maße mir nicht an zu wissen, welche die Motive in den einzelnen
Fällen gewesen. Aber ein Vorgang am hiesigen Platze belehrte mich, dass
die Beseitigung einer solchen Anstalt bisweilen von jüdischer Seite
selbst ausgeht, und der staatlichen Behörde ein anderer Weg gar nicht
möglich ist. Die hiesige jüdische Elementarschule, mit welcher sowohl
der Lokal- und Kreisschulinspektor als auch die Gemeinde völlig zufrieden
waren, wurde im August dieses Jahres von Herrn Schul- und Regierungsrat Stiehl
aus Koblenz besucht; der Erfolg des Unterrichts genügte ihm vollständig,
aber die Einrichtung der Schule desto weniger, da beinah sämtliche in den
neuen Bestimmungen vorgeschriebene Lehrmittel fehlten. Es kam daher
kürzlich durch den Kreisschulinspektor die Aufforderung an den
israelitischen Vorstand, die fehlenden Sachen binnen vier Wochen
anzuschaffen. Was tat dieser nun? Er gab eigenmächtig das Gesuch ab, die
Schule aufzuheben. Niemand wusste hierum, und Lehrer und Gemeinde
erhielten davon erst durch ein Schreiben des Kreisschulinspektors Kunde,
durch welches die Schule dem Antrage des Vorstehers gemäß aufgehoben
wurde. Weder die anderen Vorsteher, noch die Repräsentanten wussten ein
Wörtchen davon. Dennoch erhob sich kein Widerspruch. Diejenigen, die
außen stehen und von diesem Vorgange keine Kenntnis haben, werden wieder
eine Tendenz der staatlichen Behörden darin erblicken, die doch gar nicht
anders verfahren konnte, und ich meine, es sei nur nützlich, eine solche
falsche Voraussetzung zu beseitigen. Das Motiv des Vorstehers ist leicht
zu erkennen. Die hiesige Gemeinde zählte 22 steuerfähige Familien. Wie
es in kleineren Gemeinden zu geschehen pflegt, gibt es da zu einer Zeit
eine größere Anzahl schulpflichtiger Kinder, die allmählich abnimmt und
erst in einer späteren Zeit wieder zunimmt, da der Anwachs nicht gleich
wieder vor sich geht. So zählte unsere Schule vor acht Jahren 45
Zöglinge, gegenwärtig nur 25. Das hierdurch verminderte Schulgeld machte
den Zuschuss aus der Gemeindekasse größer. Anstatt nun zu beachten,
dass, wenn die Schule sonst in gutem Zustande, der Unterricht bei einer
geringeren Schülerzahl nur um so erfolgreicher ist, scheuen die Familien,
die keine schulpflichtigen Kinder haben, den Mehranspruch der
Gemeindekasse und ziehen es vor, keine Schule zu haben; können doch die
Kinder durch irgend ein hergewandertes Subjekt notwendig 'oren' (beten)
lernen und aller übrige Religionsunterricht ist ja überflüssig. Wie
gesagt, man darf bei Betrachtung der Vorfälle nicht eher urteilen, als
bis man die Sachlage genauer kennen gelernt hat." Bericht
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Dezember
1877: "Laufersweiler, im Dezember (1877). Die 'Allgemeine Zeitung des
Judentums' hat in ihrem langen Bestande stets nach dem Standpunkte der
Unparteilichkeit gestrebt, besonders auch aus der Ansicht heraus, dass,
wer wirklich bessern will, die Aufdeckung der wahren Ursachen einer
Erscheinung nicht scheuen dürfe. Darum gestatte ich mir auch folgende
Bemerkung. Als vor einiger Zeit die Aufhebung einiger jüdischer
Elementarschulen gemeldet wurde, zog man daraus einen Vorwurf für die
staatlichen Behörden, von denen schließlich diese Aufhebung ausgegangen
sei. Ich maße mir nicht an zu wissen, welche die Motive in den einzelnen
Fällen gewesen. Aber ein Vorgang am hiesigen Platze belehrte mich, dass
die Beseitigung einer solchen Anstalt bisweilen von jüdischer Seite
selbst ausgeht, und der staatlichen Behörde ein anderer Weg gar nicht
möglich ist. Die hiesige jüdische Elementarschule, mit welcher sowohl
der Lokal- und Kreisschulinspektor als auch die Gemeinde völlig zufrieden
waren, wurde im August dieses Jahres von Herrn Schul- und Regierungsrat Stiehl
aus Koblenz besucht; der Erfolg des Unterrichts genügte ihm vollständig,
aber die Einrichtung der Schule desto weniger, da beinah sämtliche in den
neuen Bestimmungen vorgeschriebene Lehrmittel fehlten. Es kam daher
kürzlich durch den Kreisschulinspektor die Aufforderung an den
israelitischen Vorstand, die fehlenden Sachen binnen vier Wochen
anzuschaffen. Was tat dieser nun? Er gab eigenmächtig das Gesuch ab, die
Schule aufzuheben. Niemand wusste hierum, und Lehrer und Gemeinde
erhielten davon erst durch ein Schreiben des Kreisschulinspektors Kunde,
durch welches die Schule dem Antrage des Vorstehers gemäß aufgehoben
wurde. Weder die anderen Vorsteher, noch die Repräsentanten wussten ein
Wörtchen davon. Dennoch erhob sich kein Widerspruch. Diejenigen, die
außen stehen und von diesem Vorgange keine Kenntnis haben, werden wieder
eine Tendenz der staatlichen Behörden darin erblicken, die doch gar nicht
anders verfahren konnte, und ich meine, es sei nur nützlich, eine solche
falsche Voraussetzung zu beseitigen. Das Motiv des Vorstehers ist leicht
zu erkennen. Die hiesige Gemeinde zählte 22 steuerfähige Familien. Wie
es in kleineren Gemeinden zu geschehen pflegt, gibt es da zu einer Zeit
eine größere Anzahl schulpflichtiger Kinder, die allmählich abnimmt und
erst in einer späteren Zeit wieder zunimmt, da der Anwachs nicht gleich
wieder vor sich geht. So zählte unsere Schule vor acht Jahren 45
Zöglinge, gegenwärtig nur 25. Das hierdurch verminderte Schulgeld machte
den Zuschuss aus der Gemeindekasse größer. Anstatt nun zu beachten,
dass, wenn die Schule sonst in gutem Zustande, der Unterricht bei einer
geringeren Schülerzahl nur um so erfolgreicher ist, scheuen die Familien,
die keine schulpflichtigen Kinder haben, den Mehranspruch der
Gemeindekasse und ziehen es vor, keine Schule zu haben; können doch die
Kinder durch irgend ein hergewandertes Subjekt notwendig 'oren' (beten)
lernen und aller übrige Religionsunterricht ist ja überflüssig. Wie
gesagt, man darf bei Betrachtung der Vorfälle nicht eher urteilen, als
bis man die Sachlage genauer kennen gelernt hat." |
Artikel von Lehrer Moritz May (1887; 1884 bis 1886
Lehrer in Laufersweiler, ab August 1886
in Rhaunen) - ein bayerischer Lehrer in den Mühlen der preußischen
Behörden
Anmerkung: Moritz May stammte aus dem unterfränkischen Geldersheim
bei Schweinfurt.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Februar 1887: "Rhaunen,
14. Februar (1887). Ich erlaube mir, die Spalten Ihres geschätzten
Blattes in einer für dessen Leserkreis interessantes Unikum in etwas
ausgiebiger Weise in Ansprach zu nehmen; und hat dieses Unikum für meine
bayerischen Landesbrüder große Wichtigkeit, es gibt nämlich das das
Thema des Liedes: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Februar 1887: "Rhaunen,
14. Februar (1887). Ich erlaube mir, die Spalten Ihres geschätzten
Blattes in einer für dessen Leserkreis interessantes Unikum in etwas
ausgiebiger Weise in Ansprach zu nehmen; und hat dieses Unikum für meine
bayerischen Landesbrüder große Wichtigkeit, es gibt nämlich das das
Thema des Liedes:
Was ist des Deutschen Vaterland? einen eigentümlichen
Aufschluss:
Zur Sache! Ich wurde laut Dekret der Hohen Königlichen Regierung zu
Koblenz nach Einsendung meiner Zeugnisse über Führung und Qualifikation,
unbeanstandet im August 1884 als israelitischer Lehrer, Kantor und
Schächter im Orte Laufersweiler
genehmigt; fungierte hier mit bestem Erfolge laut Zeugnis zwei volle
Jahre. Im August 1886 bezog ich in gleicher Eigenschaft die eine Stunde
entfernt liegende Stelle zu Rhaunen auf dem Hunsrück. Am 13. August 1886
reichte ich meine Zeugnisse mit einem Gesuche an die Hohe Königliche
Regierung zu Trier um Genehmigung beim hiesigen Bürgermeisteramt ein, am
20. Oktober kam eine Verfügung der Königlichen Regierung an, dass in
Folge der Landratlichen Randbemerkung vom 30. September (47 Tage später)
auf Grund des § 71 Abschnitt II des Gesetzes für die Judenschaft vom 23.
Juli 1847 die Genehmigung versagt wird. Das Gesetz lautet:
Dass alle Nichtpreußen als Ausländer betrachtet und als israelitische
Kultusbeamte nicht zugelassen werden. Auf meine sofortige Rekursbeschwerde,
die ich statt direkt an den Königlichen Ober-Präsidenten nach Koblenz zu
machen irrtümlich an das Königliche Preußische Kultusministerium
richtete, dann später auf eine an den Ober-Präsidenten eigens nochmals
gerichtete Beschwerde und Bitte um Aufhebung besagter mir undenkbaren
Verfügung, habe ich auch nicht eine einzige Beantwortung erhalten.
Zweimal wiederholte ich sowohl beim Ober-Präsidenten als auch beim
Kultusminister meine Bitte, aber stets ohne Erfolg, stets das permanente Schweigen.
Endlich, als ich mich um Hilfe an den deutschen Reichskanzler gewendet,
bekam ich einige Tage darauf vom Kultusminister Nachricht, dass die
'Erörterungen noch nicht geschlossen seien. Dieses geschah im Monat
Dezember; seit dieser Zeit habe ich noch weiteres Stillschweigen trotz
wiederholter Anfrage beim Minister und beim Ober-Präsidenten zu
verzeichnen. Heute habe ich mich nochmals an den deutschen Reichskanzler
gewendet um Abhilfe respektive Beschleunigung. Auch habe ich, als Seine
Königliche Hoheit Prinz Luitpold von Bayern in Berlin war, mich an
denselben um Intervention gewendet, aber auch ohne Erfolg und ohne
Antwort. Bezeichnend ist noch, dass in den Regierungsbezirken Koblenz,
Düsseldorf und Wiesbaden überall 'Bayern' als israelitischer Lehrer und
Kultusbeamte angestellt und genehmigt sind. Ich frage nun: was ist des
Deutschen Vaterland nach der Ansicht der Regierung von Trier? Der Artikel
3 der deutschen Reichsverfassung sagt, dass Angehörige der Bundesstaaten
nicht als Ausländer betrachtet werden. Wer gibt mir einen Rat, was zur
Beschleunigung der Sache zu tun wäre? Für eine andere Stelle kann ich
mich nicht melden, weil der Oberpräsident in Koblenz meine Zeugnisse
(/Originale) mir noch nicht returniert hat.
Mein Vertrag ist zwar nach Ansicht des Königlichen Amtsgerichts auf Grund
des § 1184 des Cod.Cop. nicht ungültig, allein die Mitglieder der
israelitischen Religionsgesellschaft hier sind der Ansicht, wenn nicht
gedient wird, brauche man nicht zu zahlen, und haben zum Teil die Berufung
an das Königliche Landgericht Trier ergriffen. Wie es mir nun mit meiner
aus 6 Köpfen bestehenden Familie ohne Einkommen, fern von der Heimat
(nach Ansicht der Regierung zu Trier im fremden Lande), ohne
Existenzmittel zumute sein mag und ist, kann sich kein Mensch denken. Es
ist bezeichnend, dass der hiesige Bürgermeister auf strenge Befolgung der
Verfügung der Königlichen Regierung sieht. Er hat schon, als er
erfahren, dass ich während des Ablesens der heiligen Thora dem Vorleser
Fehler korrigiert, eigens den Polizeisergeanten am Sabbat-Morgen in die
Synagoge gesendet, welcher auch die ganze Dauer des Gottesdienstes dort
blieb. Derselbe hatte den Auftrag, sobald ich dieses Verbrechen nochmals
beginne, das als Kultusbeamtendienst angesehen werde, mich aus der
Synagoge gewaltsamer Weise zu entfernen. Ich habe alles Möglich, was in
meinen Kräften stand, getan, nun bitte ich alle meine Landsleute, alle
Bayern, die einigermaßen etwas
Einfluss |
 haben,
für mich einzutreten und zu intervenieren. Herr Wirklicher Geheimer
Medizinalrat Dr. Kristeller, Vorstand des israelitischen Gemeindebundes,
wollte sich nach der mir von Herrn Oberrabbiner Dr. Zuckermandel in Trier
zugegangenen Mitteilung für mich verwenden, mehr weiß ich nicht? Wer
ratet und hilft mir und wer löst mir das Rätsel? Moritz May, Lehrer." haben,
für mich einzutreten und zu intervenieren. Herr Wirklicher Geheimer
Medizinalrat Dr. Kristeller, Vorstand des israelitischen Gemeindebundes,
wollte sich nach der mir von Herrn Oberrabbiner Dr. Zuckermandel in Trier
zugegangenen Mitteilung für mich verwenden, mehr weiß ich nicht? Wer
ratet und hilft mir und wer löst mir das Rätsel? Moritz May, Lehrer." |
Anzeige von Religionslehrer Isidor Popper (1902)
Hinweis: Isidor Popper stammte aus Böhmen. Auf Grund seiner Anzeige fand er eine
Anstellung in Hellstein, wo er am 15. Juli
1902 eingestellt wurde. Wie lange er in Hellstein tätig blieb, ist nicht
bekannt. - Nach der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung" vom 20. Oktober
1927 S. 311f wurde im September 1927 eine Trauerfeier zum Gedenken an Isidor
Popper abgehalten. Möglicherweise sind die Personen identisch und Lehrer Isidor
Popper war zuletzt in der jüdischen Gemeinde München tätig.
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. März 1902: Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 20. März 1902:
"Seminaristisch geprüfter Lehrer, gesanglich geschulter Kantor, 36
Jahre alt, ledig, sucht per sofort Stelle (Süd- und
Mitteldeutschland).
Offerten an Lehrer Popper
Laufersweiler Rheinland." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Ein Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes wird unter Beteiligung des
Israelitischen Frauenvereins Laufersweiler gegründet (1932)
 Artikel
in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Mai
1932: "Simmern
(Hunsrück). (Eine jüdische Frauenversammlung.) Eine jüdische
Frauenversammlung von hier noch nicht erlebtem Ausmaß fand am 1. Mai in
Simmern statt. Der hiesige Israelitische Frauenverein hatte die
Nachbarvereine zu einem Vortrage eingeladen, den Frau M. Goldstein
aus Wiesbaden hielt. Der Einladung
waren jüdische Frauen aus sämtlichen Orten der Umgegend gefolgt. Die
Rednerin wusste die mit Interesse aufhorchende Frauenschar für die
gemeinsame Sache zu gewinnen. Lehrer Unikower, der den größten Teil
des Hunsrücks als Seelsorger und Religionslehrer betreut, gab dem Wunsche
Ausdruck, dass sich die jüdischen Frauen des Hunsrücks dem Jüdischen
Frauenbund anschließen möchten. Der Israelitische Frauenverein
Bad Kreuznach hatte Frau Dr.
Kullmann entsandt, von der über Fragen hauptsächlich organisatorischer
Art referiert wurde. Der Erfolg der Veranstaltung war der Zusammenschluss
der Vereine Simmern, Kirchberg
und Laufersweiler zu einem
Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes. Aus vereinstechnischen Gründen
musste der Anschluss der übrigen Nachbarvereine an den Gau noch vertagt
werden." Artikel
in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 19. Mai
1932: "Simmern
(Hunsrück). (Eine jüdische Frauenversammlung.) Eine jüdische
Frauenversammlung von hier noch nicht erlebtem Ausmaß fand am 1. Mai in
Simmern statt. Der hiesige Israelitische Frauenverein hatte die
Nachbarvereine zu einem Vortrage eingeladen, den Frau M. Goldstein
aus Wiesbaden hielt. Der Einladung
waren jüdische Frauen aus sämtlichen Orten der Umgegend gefolgt. Die
Rednerin wusste die mit Interesse aufhorchende Frauenschar für die
gemeinsame Sache zu gewinnen. Lehrer Unikower, der den größten Teil
des Hunsrücks als Seelsorger und Religionslehrer betreut, gab dem Wunsche
Ausdruck, dass sich die jüdischen Frauen des Hunsrücks dem Jüdischen
Frauenbund anschließen möchten. Der Israelitische Frauenverein
Bad Kreuznach hatte Frau Dr.
Kullmann entsandt, von der über Fragen hauptsächlich organisatorischer
Art referiert wurde. Der Erfolg der Veranstaltung war der Zusammenschluss
der Vereine Simmern, Kirchberg
und Laufersweiler zu einem
Hunsrück-Gau des Jüdischen Frauenbundes. Aus vereinstechnischen Gründen
musste der Anschluss der übrigen Nachbarvereine an den Gau noch vertagt
werden." |
Zu einzelnen
Personen aus der jüdischen Gemeinde
Erinnerung an die Deportation in das südfranzösische
Internierungslager in Gurs - Grabstein für Sara Hanau geb. Mayer (1867-1940)
 Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für Grabstein
im Friedhof des ehemaligen Internierungslagers Gurs für
Sara Hanau geb. Mayer,
geb. am 22. September 1867 in Laufersweiler, später wohnhaft in Merzig;
am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert, wo sie am 31. Dezember 1940
umgekommen ist.
(Foto von Bernhard Kukatzki) |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige der Mazzenbäckerei August Joseph (1927)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1927: Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1927:
"Die Mazzot-Bäckerei Aug. Joseph
Laufersweiler (Hunsrück)
untersteht für die kommende Saison meiner Aufsicht.
Rabbiner Dr. Jacobs, Bad Kreuznach." |
Todesanzeige für Emma Mayer geb.
Vogel (1931)
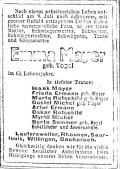 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 24.
Juli 1931: "Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am 9. Juli nach
schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden meine liebe unvergessliche
Frau, unsere teure Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwiegertochter,
Schwägerin, Tante und Großmutter Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 24.
Juli 1931: "Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief am 9. Juli nach
schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden meine liebe unvergessliche
Frau, unsere teure Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwiegertochter,
Schwägerin, Tante und Großmutter
Emma Mayer geb. Vogel
im 63. Lebensjahre.
In tiefster Trauer: Isaak Mayer Frieda Ermann geb. Mayer
Marta Rotschild geb. Mayer Gustel Michel geb. Mayer Artur
Ermann Oskar Rotschild Myrtil Michel
Berta Sommer geb. Vogel Enkelkinder und Anverwandte.
Laufersweiler, Rhaunen,
Saarlouis, Willingen,
Bacharach.
Gleichzeitig danken wir für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim
Heimgange unserer lieben Verstorbenen." |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine ältere Synagoge, die vermutlich erst nach 1825
erbaut oder eingerichtet wurde, ist bei einem großen Brand in Laufersweiler 1839
abgebrannt. Im Synagogengebäude befand sich auch die jüdische Schule. An
Einrichtungsgegenständen fielen dem Brand unter anderem zum Opfer: neben den Betstühlen,
Büchern und Betmänteln: fünf kupferne Leuchter, ein Vorlesetisch, ein
Toraschrank mit vier Torarollen, gemalte Tücher, eine Decke für den
Vorlesetisch, zehn Bänke zum Sitzen, zwei Stühle für den Vorsänger, ein
wertvoller Torazeiger, eine Torakrone. Die jüdische Gemeinde beschloss bald
nach dem Brand, eine neue Synagoge zu bauen, wenngleich dies große finanzielle
Schwierigkeiten mit sich brachte. Mit Genehmigung der Behörden konnte eine
Kollekte in anderen jüdischen Gemeinden durchgeführt werden. 1840 wurde
Baumeister Hahn aus Külz mit der Zeichnung von Plänen zur neuen Synagoge
beauftragt. Zwischen 1841 und 1844 konnte die neue Synagoge neben dem heutigen
Grundstück "Neuer Weg 3" erstellt werden.
Am 16./17. August 1844 konnte die wieder aufgebaute Synagoge durch Rabbiner
Dr. Auerbach aus Bonn eingeweiht werden. Die "Allgemeine Zeitung des
Judentums" berichtete am 16. September 1844:
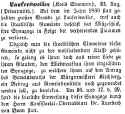 Laufersweiler
(Kreis Simmern), 22. August. Bei dem im Jahre 1839 statt gehabten großen Brande
zu Laufersweiler, traf auch die israelitische Gemeinde daselbst das Missgeschick,
ihre Synagoge in Folge der verheerenden Flammen zu verlieren. Laufersweiler
(Kreis Simmern), 22. August. Bei dem im Jahre 1839 statt gehabten großen Brande
zu Laufersweiler, traf auch die israelitische Gemeinde daselbst das Missgeschick,
ihre Synagoge in Folge der verheerenden Flammen zu verlieren.
Obgleich nun die israelitischen Einwohner dieser Gemeinde nicht zu der
wohlhabenderen Klasse gehören, so gelang es ihnen doch aus reiner Liebe zu
ihrem Glauben, den Wiederaufbau ihrer eingeäscherten Synagoge, zu welchem ihnen
auf den Antrag des Gemeinderats der Bürgermeisterei Kirchberg, ein Beitrag aus
Gemeindemitteln noch zugewendet werden soll, zu bewirken. Am 16. und 17. dieses
Monats fand die feierliche Einweihung dieser Synagoge durch den Herrn
Konsistorial-Oberrabbiner Dr. Auerbach von Bonn statt. |
In der Beilage zur Kölnischen Zeitung vom
1. September 1844 wird derselbe Bericht gegeben, jedoch fortgesetzt:
"...Am 16. und 17. des Monats fand die Einweihung dieser Synagoge
statt. Der Herr Konsistorial-Oberrabbiner Dr. Auerbach von Bonn und der
Herr Kreisvorsteher Stadtrat Rotschild von Simmern hatten sich auf die an
sie zur Einweihungsfeier ergangene Einladung dort eingefunden. Nachdem der
Herr Oberrabbiner von der dortigen israelitischen Schuljugend mit einer
passenden Anrede feierlichst in Empfang genommen wurde, traf sich die Gemeinde
des Nachmittags um 3 Uhr zum Vesper-(Mincha-)Gebet in die in dem Hause des
dortigen Einwohners Joseph Löser bisher befindliche Betstube, woselbst
der Herr Oberrabbiner beim Verlassen derselben einige zu Herzen gehende
Abschiedsworte sprach.
Der Zug, dem sich der sehr würdige evangelische Geistliche, Herr Pfarrer
Lang, daselbst anschloss, bewegte sich nun in folgender Ordnung zur neuen
Synagoge: Das Musikchor, der Vorsänger, die Schuljugend, die
Schlüsselträgerin, die Ältesten mit den Gesetzesrollen, der
Oberrabbiner, der evangelische Geistliche, der Vorsteher der
israelitischen Gemeinde, sowie der Kreisvorsteher und die Festteilnehmer.
Bei der Ankunft an der neuen Synagoge überreichte die Schlüsselträgerin
dem Herrn Oberrabbiner den Schlüssel zur Eröffnung, während der
Vorsänger unter Musikbegleitung mehrere Psalmen absang.
Hierauf sprach der Herr Oberrabbiner mit wahrhaft inbrünstigem Gefühle
ein Gebet, und nachdem die Gesetzesrollen in die heilige Lade eingebracht
waren, folgten die Weihepredigt und das Gebet für unseren allverehrten Landesvater.
Der Weihepredigt des Herrn Oberrabbiners schlossen sich die sehr gut
gewählten Worte des würdigen evangelischen Geistlichen Herrn lang an.
Beide empfahlen mit der eindringlichsten Herzlichkeit, auch für die Folge
in gegenseitiger Liebe und Eintracht zu beharren. Als der Herr
Oberrabbiner weiter erwähnte, dass diese Einweihungsfeier mit der
göttlichen Hilfe und unter dem Schutze eines hochherzigen Königs und
Landesvaters, dessen teures, geheiligtes Leben durch ruchlose Mörderhand
unlängst bedroht war, statt finde, da trat bei allen Zuhörern eine
sichtbare Rührung hervor, welche die aufrichtigste Liebe für König und
Vaterland bekundete.
In der am Morgen des folgenden Tages statt gehabten Predigt sprach Herr
Oberrabbiner über die Glaubenslehren des Judentums, dass diese nur im
Glauben an das Dasein Gottes, an eine göttliche Offenbarung durch Moses
und in dem Glauben an Belohnung und Bestrafung der Menschlichen Handlungen
beständen.
Nach beendigtem Gottesdienste versammelten sich die Gemeindeglieder zu
einem festlichen Mahle, dem der Herr Pfarrer Lang und mehrere andere
christliche Einwohner von Laufersweiler beiwohnten. So endete denn eine
Festlichkeit, die in den herzen der Anwesenden und ohne Unterschied des
Glaubens die gegenseitige Liebe und Achtung noch mehr erhöhte." |
In der neuen Synagoge befand sich der Betsaal im
oberen Stock, ein Schulraum im Erdgeschoss. Der Schulsaal hatte eine Fläche von
6 mal 5 m. In der Synagoge hatte es nach einem Bericht von 1856 insgesamt 150
bis 160 Sitzplätze. Im Keller befand sich ein rituelles Bad. Um 1900 war der
Bau in einem schlechten Zustand. Der Kreisschulinspektor empfahl entweder das
Gebäude gründlich zu renovieren oder einen Neubau zu erstellen. Darauf
entschloss sich die Gemeinde, das Gebäude auf Abbruch zu verkaufen. Es wurde im
Juli 1909 abgebrochen.
Eine neue Synagoge wurde 1910/11 nach Entwürfen
des Hirschfelder Baumeisters Nikolaus Elz im Baustil des Historismus erbaut. Die
Einweihung der Synagoge war am 1. und 2. Juni 1911. Ein Bericht von der
Einweihung findet sich leider nicht in den damaligen überregionalen jüdischen
Periodika. Bei der Synagoge handelt es sich um einen zweigeschossigen Massivbau,
11.70 m lang und 9.80 m breit. Die südliche Längsseite zur Kirchgasse zeigt im
Obergeschoss drei einfache und im Untergeschoss drei gekoppelte
Rundbogenfenster. Die nördliche Seitenfront weist zwei einfache und zwei
gekoppelte Rundbogenfenster auf, da es im Bereich des Treppenhauses keine
Fenster gibt. Der Bau wird bestimmt durch Lisenen in den Längsfronten, die
turmartig über das Traufgesims hinausragen und im Westen steinerne Aufsätze in
Schweifhaubenform über einem kassetierten, achteckigen Block haben.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von
SA-Leuten aus Laufersweiler und Umgebung geschändet und im
Inneren völlig zerstört. Das Gebäude entging einer Brandschatzung nur, weil durch ein
eventuelles Feuer auch die umliegenden Anwesen hätten in Gefahr kommen können.
Nach 1945: Nach Klärung des Restitutionsverfahrens erwarb die politische Gemeinde
Laufersweiler im
September 1955 das ehemalige Synagogengebäude für 2.500 DM und
nahm mehrere Umbauten und Veränderungen vor. So wurde im Erdgeschoss eine Wäscherei
und Gefrieranlage eingebaut, im Untergeschoss entstand ein Unterrichtsraum, der
in späteren Jahren einer Frauengruppe der katholischen Kirchengemeinde als Versammlungsraum diente.
Im April
1985 wurde die Synagoge unter Denkmalschutz gestellt. Im folgenden Jahr begann
man mit den Restaurierungsarbeiten, die im Dezember 1987 abgeschlossen waren.
Am 31. Januar 1988 wurden die Arbeiten mit einer Feier abgeschlossen. An
den Gesamtkosten in Höhe von ca. 270.000 DM beteiligten sich neben der
Ortsgemeinde Laufersweiler der Rhein-Hunsrück-Kreis, das Landesamt für
Denkmalpflege und die Verbandsgemeinde Kirchberg mit erheblichen Zuschüssen.
2001 mussten abermals umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Gebäude durchgeführt
werden (neue Dacheindeckung, Putzarbeiten innen und außen, Erneuerung der Außentreppe
und Einbau einer Heizungsanlage).
In der ehemaligen Synagoge befindet sich im Erdgeschoss seit
Abschluss der Renovierung ein
Gedenkraum mit Museum und einer Dauerausstellung (Thema "Sie gehörten zu
uns"), die vom "Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V."
erstellt wurde. Dieser Förderkreis wurde 1989 gegründet mit dem Ziel, die
Erinnerung an die jüdischen Gemeinden in Laufersweiler und Umgebung (Hunsrück)
im ehemaligen Synagogengebäude zu wahren:
Der übersichtliche Gedenkraum mit der Dauerausstellung soll dazu dienen
aufzuklären und zum Nachdenken anzuregen, damit sich eine ähnliche Katastrophe
nicht wiederholt. Die ausgewählten Exponate, also Schautafeln mit Fotos,
Dokumenten und Texten sowie in Glasvitrinen untergebrachte gegenständliche
Ausstellungsstücke informieren vor allem über das jüdische Leben im 19. und
20. Jahrhundert im Hunsrück. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht jedoch die jüdische
Gemeinde Laufersweiler. An ihr wird beispielhaft die Stationen des jüdischen
Lebens aufgezeigt. Einen breiten Raum nimmt notwendigerweise die Darstellung der
NS-Zeit ein. In der ehemaligen Toranische, wurde von dem Kirn-Sulzbacher Künstler
Karl-Heinz Brust ein aus drei Teilen bestehendes Bronzerelief geschaffen, das an
jene 25 jüdischen Einwohner von Laufersweiler erinnern soll, die in
Konzentrationslagern ermordet wurden. Die Darstellung auf dem Mittelstück zeigt
eine Mutter, die ihr Kind umklammert. Ihr Blick soll den Wahnsinn symbolisieren,
den sie voraussieht. Der Mann, der die Hände nach oben streckt, soll eine
Hoffnung auf die Menschlichkeit ausdrücken.
Das in der Synagoge untergebrachte Material soll zum einen zur Erforschung
der geschichtlichen, religiösen, politischen und sozialen Vergangenheit der
Juden im Hunsrück dienen und zum anderen auch zu einem Ort des Lernens
werden: Über die Geschichte (die eigene und die jüdische), über
gesellschaftliches Verhalten und über den möglichen Umgang einer
Mehrheitsgesellschaft mit Minderheiten. Gerade durch die ausgestellten Dokumente
kann man die Geschichte der jüdischen Bevölkerung des Hunsrücks "hautnah"
erleben. Die fast heimelige Atmosphäre bietet Gruppen, insbesondere
jugendlichen Besuchern, die Möglichkeit, sich intensiv mit einzelnen Themen auseinander
zu setzen und die gewonnenen Ausstellungseindrücke noch vor Ort
diskutieren zu können.
In der ehemaligen
Synagoge wurde 2014 das "Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum für das
Landjudentum" eingerichtet.
Dazu Artikel in der "Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 22. Februar 2014:
"Laufersweiler: In der Synagoge entsteht ein neues Studienzentrum
Laufersweiler - Zum kulturellen Erbe Deutschlands gehören auch die jüdischen Gemeinden auf dem flachen Land. Laufersweiler ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Landjudentum. Ein Viertel der Bevölkerung war zeitweise jüdischen Glaubens. Um das weiter zu erforschen, zu dokumentieren und für kommenden Generationen zu bewahren, entsteht in dem Dorf ein "Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum".
Link
zum Artikel. Zur Eröffnung siehe Artikel unten.
 | Adresse/Standort der Synagoge: Forst-Mayer
Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum, Kirchgasse 6,
55487 Laufersweiler |
 | Kontakt zum Förderverein: Förderverein der
Synagoge Laufersweiler e. V., Mail: info@synagoge-laufersweiler.de |
 | Besichtigung / Öffnungszeiten: nach
Vereinbarung mit der Ortsgemeinde (Tourist-Information Kirchberg) Tel.
06763-910144 |
 | Nutzungsmöglichkeiten: Der Ausstellungsraum
im Erdgeschoss, mit etwa 50 bis 60 Sitzplätzen bietet Möglichkeiten für
kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art, z.B. Lesungen,
Buchvorstellungen, Vorträge, kleine Konzerte, Ausstellungen etc.
Kontakt über Ortsbürgermeister Faust, Laufersweiler, Tel.:
0-6543-3777 oder über die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Tel.
0-6763-9100). |
Fotos / Pläne / Dokumente
Hinweis auf Foto in http://www.holocaustcenterbuff.com/henryjmementos.html:
unmittelbar nach dem Novemberpogrom 1938 mit dem Wohnhaus der Familie Joseph im
Hintergrund (alle Fenster wurden zerstört).
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Juni 2011:
Die ehemalige Synagoge wird 100 Jahre
alt |
Artikel im "Trierischen
Volksfreund" vom 6. Juli 2011 (Artikel): "Die Juden im Hunsrück: Synagoge wird 100 Jahre alt
Die einzige Synagoge im Rhein-Hunsrück-Kreis, die noch als solche erkennbar ist, wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Sie dient heute als Ort der Erinnerung, Begegnung und des kulturellen Austausches.
Der Förderkreis Synagoge Laufersweiler erinnert mit vielen Aktionen an die jüdische Geschichte im Hunsrück. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Jubiläumsveranstaltung am 25. September. Aus diesem Anlass schreibt der Förderkreis einen künstlerischen Wettbewerb gegen das Vergessen für Jugendliche und Kinder aus. Jeder Teilnehmer wählt ein jüdisches Gedicht aus und fertigt dazu ein Bild oder eine Zeichnung an. Auch ein eigenes Gedicht kann als Grundlage dienen. Es muss sich aber um jüdisches Leben im Hunsrück drehen. Infos unter Telefon 06543/3420. red." |
| |
| September 2011:
Interreligiöse Gedenkfeier zum 100-jährigen
Bestehen der Synagoge |
Artikel in der
"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 27. September 2011: "Laufersweiler
würdigt jüdische Geschichte.
Laufersweiler. Beim hundertsten Geburtstag der Synagoge Laufersweiler
war die Festgemeinde zu einem jüdisch-christlichen Gebet in der
evangelischen Kirche zusammengekommen, um der ehemaligen jüdischen
Mitmenschen zu gedenken. Zelebriert wurde die Feier von Pfarrerin Sandra
Menzel, Diakon Franz Kahn und Kantor Joseph Pasternak von der jüdischen
Gemeinde Koblenz.
Link
zum Artikel |
| |
Weiterer Artikel in der
"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 27. September 2011: "Synagoge
steht bereits seit 100 Jahren in Laufersweiler.
Laufersweiler. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Synagoge
Laufersweiler fand in der evangelischen Kirche ein jüdisch-christliches
Gebet statt. Wegen der vielen Gäste ging man für den Festakt in die
Bürgerhalle. Mit einem Festzug wurde im Juni 1911 die Synagoge in
Laufersweiler eingeweiht. Neue Torarollen wurden stolz den christlichen
Nachbarn und Mitbewohnern präsentiert. Wenige Jahrzehnte später, in der
Reichspogromnacht 1938, wurde die Synagoge geschändet. 25 Lauferweilerer
Mitbürger jüdischen Glaubens, die sich durch Flucht nicht der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entziehen konnten, wurden in
Konzentrationslagern ermordet. In der Nachkriegszeit erinnerten nur der
Friedhof und das Gebäude der ehemaligen Synagoge an die untergegangene
jüdische Kultur im Dorf...."
Link
zum Artikel |
| |
| April 2014:
In der Synagoge entsteht ein neues
Studienzentrum |
Artikel in der
"Rhein-Hunsrück-Zeitung" vom 22. Februar 2014: "Laufersweiler: In der Synagoge entsteht ein neues Studienzentrum
Laufersweiler - Zum kulturellen Erbe Deutschlands gehören auch die jüdischen Gemeinden auf dem flachen Land. Laufersweiler ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Landjudentum. Ein Viertel der Bevölkerung war zeitweise jüdischen Glaubens. Um das weiter zu erforschen, zu dokumentieren und für kommenden Generationen zu bewahren, entsteht in dem Dorf ein "Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum".
Link
zum Artikel |
Weiterer Artikel im "Trierischen
Volksfreund" vom 27. März 2014: "In Synagoge Laufersweiler
entsteht Zentrum für das Landjudentum..."
Link zum Artikel |
| |
| Juli 2014:
Das "Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum
für das Landjudentum" wurde eröffnet |
Artikel von Werner Dupuis in der
"Rhein-Zeitung" vom 8. Juli 2014: "Laufersweiler hat ein Zentrum des Gedenkens
Laufersweiler – Mit einem umfangreichen Programm ist am Sonntag das Forst-Mayer Studien- und Begegnungszentrum für das Landjudentum in Laufersweiler eröffnet worden. In die ehemalige Synagoge waren neben den Vertretern des öffentlichen Lebens auch 32 Nachfahren von in Laufersweiler und Kastellaun lebenden jüdischen Familien eigens zur Eröffnung aus den USA, England, Holland und Israel angereist.
"Sie wohnen nicht mehr hier, aber sie fühlen, dass sie vieles mit dieser Synagoge, mit diesen beiden Orten und mit der Region verbindet", unterstrich Christof Pies, der Initiator und Motor des Dokumentationszentrums.
Das Forst-Mayer Zentrum ist nach den zwei jüdischen Familien Forst und Mayer benannt, die überwiegend in Kastellaun und Laufersweiler beheimatet waren, aber auch seit vielen Generationen im Hunsrück und an der Mosel lebten. Mit der Flucht in alle Welt konnten sich viele von ihnen rechtzeitig vor der Gewaltherrschaft der Nazis retten. Viele wurden aber auch während des Holocausts bestialisch ermordet. Trotz unermesslichen Leids haben Überlebende und ihre Nachkommen seit mehr als drei Jahrzehnten ihrer alten Heimat die Hand zur Versöhnung gereicht und tragen gemeinsam mit dem Förderkreis Synagoge Laufersweiler, mit Schulen, Initiativen und privaten Unterstützern zur Erinnerungsarbeit bei..."
Link
zum Artikel |
Artikel im "Trierischen
Volksfreund" vom 14. Juli 2014: "Ein neuer Ort des Gedenkens..."
Link zum Artikel |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 |  Hans-Werner
Johann: Die ehemalige Synagoge Laufersweiler - ein Lern- und
Gedenkort. Hg.: Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V. 2004. Hans-Werner
Johann: Die ehemalige Synagoge Laufersweiler - ein Lern- und
Gedenkort. Hg.: Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V. 2004. |
 | ders.: Die Laufersweiler Synagoge 1826-1990. 1990. 11
Seiten (Inhalt ist in obige Veröffentlichung eingegangen) |
 | Gustav Schellack: Das jüdische Schulwesen in den
ehemaligen Kreisen Simmern und St. Goar im 19. Jahrhundert. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 5. Jahrgang, Ausgabe 2/95 S. 23-27. Beitrag
online zugänglich (pdf-Datei). |
 | Ders.: Die israelitische Schule in Laufersweiler. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 7. Jahrgang Ausgabe 2/1997 Heft Nr. 14 S. 51-53. Online
eingestellt (pdf-Datei). |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 231-233 (mit weiteren Literaturangaben).
|


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Laufersweiler Rhineland.
Individual Jews were probably present in the 17th century. The Jewish population
was 36 in 1909 and reached a peak of 156 (total 799) in 1895. Jews were cattle
traders and butchers. A new synagogue was built after a fire in 1839 destroyed
the old one along with ten Jewish homes. In 1911 a third synagogue was built. A
Jewish school enrolled 48 children in 1903. On the eve of the Nazi rise to power
in 1933, about 80 Jews lived in Laufersweiler. In 1936, 56 remained, many
leaving before 1940. The synagogue was destroyed on Kristallnacht (9-10
November 1938). In 1942, seven were deported to the east and ten to the
Theresienstadt ghetto. It may be assumed that all those who did not make it in
time to safe havens perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|