|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht "Synagogen im
Kreis Bad Kreuznach"
Bad Sobernheim (Kreis
Bad Kreuznach)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Bitte besuchen Sie auch die Website des Kulturforums Bad
Sobernheim
(mit zahlreichen Seiten zur jüdischen Geschichte und zur Erinnerungsarbeit vor
Ort):
https://kulturforum-bad-sobernheim.de/
Überblick:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem seit 1330 zur Stadt erhobenen und zum Erzbistum Mainz gehörenden
Sobernheim lebten jüdische Personen/Familien bereits im Mittelalter. Zu
Beginn des 14. Jahrhunderts sind erstmals Juden nachweisbar (1301). Während
der Verfolgung in der Pestzeit 1348/49 wurden auch hier Juden ermordet.
1357 nahm der Mainzer Erzbischof Gerlach zwei Juden in seinen Schutz und überließ
es ihnen, sich in Bingen
oder Sobernheim niederzulassen. Sicher werden 1384 wiederum Juden in der
Stadt genannt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren es vier
oder fünf jüdische Familien. Die Familien lebten vom Geldverleih. 1418
zahlten vier jüdische Familien je 10 Gulden, eine Frau zusätzlich 4 Gulden
sowie drei arme Juden 4 Gulden an Jahressteuern (an die Mainzer Kellerei in
Sobernheim beziehungsweise ans Reich). 1429 wurden die Juden zu
Sobernheim (genannt werden Hirtz, Gomprecht, Smohel, Mayer, Smohels Mutter und
andere Juden und Jüdinnen) zusammen mit denen des ganzen Erzstifts Mainz
gefangengenommen. Zu einer Vertreibung kam es vermutlich nicht, doch lebten
Mitte des 16. Jahrhunderts offensichtlich keine Juden in Sobernheim.
Zur Gründung der neuzeitlichen Gemeinde kam es seit dem 17./18. Jahrhundert.
In dieser Zeit lebten bis zu fünf Familien mit insgesamt 20 bis 30 Personen in
der Stadt. Nach der Französischen Revolution wuchs die Gemeinde von 64
Personen (1808) auf 135 Personen (1895, Höchstzahl) an. Seit Ende des
19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und
Abwanderung zurück.
Im 19./20. Jahrhundert gab es unter den jüdischen Sobernheimern Viehhändler,
Metzger, Kaufleute für Textilien und Agrarprodukte, Schuhmacher und Lederhändler
sowie Kaufhausbesitzer und Strumpffabrikanten (von besonderer Bedeutung die
Strumpffabrik Marum).
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Elementar- und Religionsschule (mit der Lehrerwohnung im Haus
Marumstraße 20; das Gebäude hatte Isaac Werner nach Einweihung der Synagoge
1859 der jüdischen Gemeinde als Schulgebäude geschenkt), ein rituelles Bad
(eine vermutlich ins Mittelalter zurückgehende ehemalige Mikwe wurde 1996 im
Haus Großstraße 53 entdeckt) sowie einen eigenen
Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein jüdischer Elementarlehrer
(Volksschullehrer) (zuletzt nur ein Religionslehrer) angestellt, der in der
Gemeinde zugleich als Vorbeter (Kantor), vermutlich auch als Schochet (Schächter)
tätig war. Bei Neubesetzungen wurde die Stelle immer wieder ausgeschrieben. Der
Ausschreibungstext von 1853 lautete:
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1853:
"Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 1. September dieses
Jahres einen tüchtigen Elementarlehrer und Kantor. Derselbe muss
Inländer sein, erhält 160 Thaler Gehalt, nebst freier Wohnung und
Heizung. Reflektanten wollen sich baldigst melden, und eine Abschrift
ihrer Prüfungs- und Dienstzeugnisse beifügen." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. August 1853:
"Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum 1. September dieses
Jahres einen tüchtigen Elementarlehrer und Kantor. Derselbe muss
Inländer sein, erhält 160 Thaler Gehalt, nebst freier Wohnung und
Heizung. Reflektanten wollen sich baldigst melden, und eine Abschrift
ihrer Prüfungs- und Dienstzeugnisse beifügen."
Sobernheim in Rheinpreußen. Der Schulvorstand. J. Werner, J.
Klein". |
Auf diese Ausschreibung hin bewarb sich erfolgreich
Alexander Cahn, der über mehrere Jahrzehnte in Sobernheim wirkte, die
prägende Gestalt des jüdischen Gemeindelebens in der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts war und hier auch erfolgreich ein Israelitisches
Knaben-Pensionat betrieb (s.u.). Seit 1890 war Lehrer Simon Berendt in
der Gemeinde tätig. Mit ihm feierte die Gemeinde die Wiedereinweihung der
Synagoge 1904 (siehe Bericht unten). 1915 konnte er sein 25-jähriges
Ortsjubiläum in Sobernheim feiern (siehe Berichte unten).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Rudolf
Hesse (geb. 26.7.1876 in Sobernheim, gef. 24.4.1917), Gefreiter Richard Feibelmann
(geb. 26.11.1889 in Meddersheim, gef. 21.11.1917), Dr. Joseph Rosenberg (geb.
4.4.1886 in Sobernheim, gest. an der Kriegsverletzung 4.5.1922) und Kurt Metzler. Ihre Namen stehen auf dem
Gefallenendenkmal des jüdischen Friedhofes.
Mitte der
1920er-Jahren gehörten zur jüdischen Gemeinde Bad Sobernheim noch etwa 80
Personen bei einer
Gesamteinwohnerschaft von ca. 3.850 Personen (2,1 %). Zur Sobernheimer Gemeinde
gehörten auch die in Meddersheim lebenden Juden (Mitte der 1920er-Jahre
16 Personen). Die Synagogenvorsteher waren damals Leopold Loeb, Heinrich
Kallmann und Gustav Hesse. Als Kantor und Religionslehrer war inzwischen Julius Katzenstein
angestellt. Er erteilte den Religionsunterricht an öffentlichen Schule der
Stadt für 14 jüdische Kinder. An jüdischen Vereinen gab es einen Israelitischen
Frauenverein
(Aufgabe war die Wohlfahrtspflege), den Verein Chewroth (Aufgabe war die
Kranken- und Beerdigungsfürsorge) und einen Liberalen Jugendbund. Die Gemeinde
gehörte zum Rabbinatsbezirk Koblenz. Anfang der 1930er-Jahre waren die
Vorsitzenden der Gemeinde Alfred Marum, Heinrich Kallmann und Herr Haas. Zur
Repräsentanz gehörten neun Mitglieder (unter dem Vorsitz von Richard Wolf und
Moses Fried). Kantor war inzwischen Felix Moses.
1933 wurden noch 83 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt. Auf Grund
der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, zunehmender Repressalien und der
Entrechtung ging ihre Zahl durch Aus- und Abwanderung bis zum Novemberpogrom
1938 auf 45 zurück. 1942 wurden die letzten 12 jüdischen
Einwohner Sobernheims deportiert.
Anmerkung: Hinweis auf ein
Verzeichnis der jüdischen Personen, die sich aus dem Amtsbezirk Bad Sobernheim
(Bad Sobernheim, Staudernheim, Meddersheim) im Jahr 1942 zum "Weitertransport"
(sc. Deportation) in Bad Kreuznach melden mussten (pdf-Datei der an den
Internationalen Suchdienst von der Stadt- und Amtsverwaltung Sobernheim 1962
mitgeteilten Liste von 19 Personen).
Von den in Sobernheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Rosa Bergheim geb. Schrimmer (1868), Frieda Cohen
geb. Gerson (1887), Anna (Anni) Feibelmann geb. Bergheim (1895), Emmy
Frankfurter geb. Metzler (1878), Bertha Fried geb. Kahn (1876), Moses
Fried (1866), Elisabeth Gerothwohl geb. Herz (1889), Ignatz Gerothwohl (1881), Klementine Haas
geb. Abraham (1877), Anna Hartheimer geb. Siegel (1880), Selma Heimbach geb.
Glaser (1885), Benno Heymann (1910), Therese Kahn (1869), Elise Kallmann geb.
Herz (1873), Friedel Katzenstein (1920), Markus Klein (1868), Emilie Landau geb. Gerson (1882), Nathan Landau (1878),
Clara Lehmann geb. Wolf (1885), Johanna Lichtenstein geb. Herz (1877), Heinrich Marum
(1848), Johanna Mayer (1880), Clementine Mendel (1883), Ernst Metzler (1895),
Gertrud(e)
Metzler geb. Kann (1888), Judith Metzger (1933), Jakob Ostermann (1872), Johanna Ostermann
geb. Mayer (1872), Dorothea Pappenheim geb. Klein (1875), Rita J. Rothschild
geb. Wolf (1879), Paula Salm
geb. Wolf (1886), Melanie Schönwald geb. Haas (geb. 1905), Martha
Sondermann geb. Wolf (1892), Arthur Wolf (1890), Bertha Wolff geb.
Oppenheimer (1856), Emilie Wolff (1885), Friederike Wolff geb. Fröhlich (1873), Hugo Wolf
(1881), Otto Wolf (1890).
Berichte aus der
Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Der
jüdische Lehrer Alexander Cahn und sein Israelitisches Knaben-Pensionat
(Bericht von 1869)
Alexander Kahn war seit 1853 Lehrer in Sobernheim, wo er nach einigen
Jahren ein Israelitisches Knaben-Pensionat eröffnete. Bei diesem
Knaben-Pensionat handelte es sich um ein Internat für auswärtige jüdische
Schüler, die entweder das Gymnasium in Sobernheim besuchen wollten und in Kahns
Institut zusätzliche Begleitung erfuhren oder die die von Cahn betreute
jüdische Elementarschule in Sobernheim besuchten und dabei zusätzlich im
Institut Förderung erfuhren. Das Knaben-Pensionat wurde - wie die Anzeigen in
der orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" zeigen - orthodox-jüdisch
geführt.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September
1869: "Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung
der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten
Freunde und Gönner das 25jährige Jubiläum seiner lehramtlichen
Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Fester vor der Rufini'schen Kapelle
dem Jubilar dargebrachten Serenade und der Illumination des von Letzterem
bewohnten, der Feier des Tages entsprechend geschmückten Hauses,
eingeleitet, erfolgte, nach einem noch vorangegangenen Frühständchen, um
10 Uhr Vormittags der von dem Prediger der israelitischen Gemeinde zu
Neuß Herr Dr. J. Hulisch vollzogene Hauptakt der Tagesfeier. In beredter
und überzeugungsvoller Weise sprach der Redner nach dem einleitenden
Gesange der Schüler des Jubilars über die Bedeutung des Lehrerberufes in
religiöser, politischer und sozialer Beziehung, und beleuchtete die
segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach diesen verschiedenen
Richtungen hin. Der Festrede unmittelbar reihten sich die
Beglückwünschungen der verschiedenen Deputationen und die dankbare
Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang diese ernste, die
ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der bevorstehenden
heitern Platz zu machen. Das darauf folge Festmahl, an welchem sich die
Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in erfreulicher
Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange nach
Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl- und sinnreiche
Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. Sicherlich wird der
erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit wie in ihren
Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der
Erinnerung derselben fortdauern." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. September
1869: "Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung
der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten
Freunde und Gönner das 25jährige Jubiläum seiner lehramtlichen
Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Fester vor der Rufini'schen Kapelle
dem Jubilar dargebrachten Serenade und der Illumination des von Letzterem
bewohnten, der Feier des Tages entsprechend geschmückten Hauses,
eingeleitet, erfolgte, nach einem noch vorangegangenen Frühständchen, um
10 Uhr Vormittags der von dem Prediger der israelitischen Gemeinde zu
Neuß Herr Dr. J. Hulisch vollzogene Hauptakt der Tagesfeier. In beredter
und überzeugungsvoller Weise sprach der Redner nach dem einleitenden
Gesange der Schüler des Jubilars über die Bedeutung des Lehrerberufes in
religiöser, politischer und sozialer Beziehung, und beleuchtete die
segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach diesen verschiedenen
Richtungen hin. Der Festrede unmittelbar reihten sich die
Beglückwünschungen der verschiedenen Deputationen und die dankbare
Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang diese ernste, die
ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der bevorstehenden
heitern Platz zu machen. Das darauf folge Festmahl, an welchem sich die
Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in erfreulicher
Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange nach
Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl- und sinnreiche
Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. Sicherlich wird der
erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit wie in ihren
Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der
Erinnerung derselben fortdauern." |
Anzeigen zum Israelitischen Knabenpensionat von
Alexander Cahn in Bad Sobernheim 1859 bis 1881
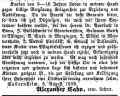 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. August 1859: "Knaben von 9-16 Jahren finden in meinem
Hause gegen billige Vergütung Gelegenheit zur Erziehung und Ausbildung.
Da die Praxis die beste Garantie bietet, so bitte ich gefälligst
diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beehren wollen, bei den Herren
Dr. Auerbach in Bonn, J. Goldschmidt in Ehrenbreitenstein,
Salomon Barth in Illingen, N.
Stern in Monzingen, H. Michel
in Meddersheim, H. Werner
hierselbst, S. Strauß in Dusemond,
deren Kinder oder Pflegebefohlenen ich erzogen und größtenteils jetzt
noch in meinem Hause erziehe, Erkundigung über mich einziehen zu wollen.
Es mag noch besonders Erwähnung verdienen, dass der hiesige Ort in einer
sehr reizenden und gesunden Lage sich befindet und besonders Kindern
geeignet ist, die zur Stärkung und Kräftigung ihrer Gesundheit eine
Ortsveränderung vornehmen sollen. Sobernheim, 8. August 1859. Alexander
Cahn, conc. Lehrer." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 22. August 1859: "Knaben von 9-16 Jahren finden in meinem
Hause gegen billige Vergütung Gelegenheit zur Erziehung und Ausbildung.
Da die Praxis die beste Garantie bietet, so bitte ich gefälligst
diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beehren wollen, bei den Herren
Dr. Auerbach in Bonn, J. Goldschmidt in Ehrenbreitenstein,
Salomon Barth in Illingen, N.
Stern in Monzingen, H. Michel
in Meddersheim, H. Werner
hierselbst, S. Strauß in Dusemond,
deren Kinder oder Pflegebefohlenen ich erzogen und größtenteils jetzt
noch in meinem Hause erziehe, Erkundigung über mich einziehen zu wollen.
Es mag noch besonders Erwähnung verdienen, dass der hiesige Ort in einer
sehr reizenden und gesunden Lage sich befindet und besonders Kindern
geeignet ist, die zur Stärkung und Kräftigung ihrer Gesundheit eine
Ortsveränderung vornehmen sollen. Sobernheim, 8. August 1859. Alexander
Cahn, conc. Lehrer." |
| |
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juli 1865:
"Es können wieder zwei Knaben zur Erziehung und Bildung Aufnahme in
meinem Hause finden. Französische und englische Konversation. Die Herren
B. Rothschild in Trier, S. Sternfeld in Düsseldorf, G. Schönholz in
Köln, Herr W. O. v. Horn in Wiesbaden, sowie der Herr Redakteur dieser
Zeitung werden gern Auskunft über mich erteilen. Preis sehr mäßig. Sehr
reizende Gegend. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Juli 1865:
"Es können wieder zwei Knaben zur Erziehung und Bildung Aufnahme in
meinem Hause finden. Französische und englische Konversation. Die Herren
B. Rothschild in Trier, S. Sternfeld in Düsseldorf, G. Schönholz in
Köln, Herr W. O. v. Horn in Wiesbaden, sowie der Herr Redakteur dieser
Zeitung werden gern Auskunft über mich erteilen. Preis sehr mäßig. Sehr
reizende Gegend.
Sobernheim, in Juni 1865. Alexander Cahn." |
| |
 Unklar
ist, warum A. Cahn 1871 plante, sein Pensionat nach Mainz zu verlegen. In
den folgenden Jahren blieb es jedenfalls in Sobernheim bestehen. Am 22.
November 1871 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit"
jedenfalls die folgende Anzeige: Unklar
ist, warum A. Cahn 1871 plante, sein Pensionat nach Mainz zu verlegen. In
den folgenden Jahren blieb es jedenfalls in Sobernheim bestehen. Am 22.
November 1871 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit"
jedenfalls die folgende Anzeige:
"Mit dem 1. Januar 1872 gedenke ich mein Pensionat nach Mainz zu
verlegen, und finden Knaben, die die unter der Leitung des Herrn Rabbiner
Dr. Lehmann stehende Anstalt, oder andere Anstalten besuchen wollen, in
meinem Hause, unter sorgfältiger Pflege, Aufnahme und die notwendige
Nachhilfe. Herr Rabbiner Dr. Lehmann und Herr Bertram Bondi in Mainz, Herr
Rabbiner Dr. Schwarz in Köln, sowie Herr S. Bürger in Siegburg geben
gern Auskunft. Sobernheim, im November 1871. A. Cahn". |
| |
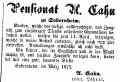 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Pensionat
A. Cahn zu Sobernheim. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Mai 1872: "Pensionat
A. Cahn zu Sobernheim.
Knaben, welche das hiesige, vollberechtigte, das Zeugnis zum einjährigen
Dienste erteilende Gymnasium besuchen wollen, müssen bis zum 11. April,
diejenigen, welche in meine Anstalt eintreten, gleich nach Pessach hier
eintreffen. Anmeldungen erwünsche ich recht bald.
Ein Lehrer, der im Englischen und in der Musik tüchtig ist, und
darüber Zeugnisse vorlegen kann, findet bei mir eine gute, dauernde
Stelle.
Sobernheim, im März 1872. A. Cahn, conc.
Lehrer." |
| |
| Wie bereits in der Ausschreibung von 1872
hervorgeht, unterrichtete neben A. Cahn mindestens ein weiterer Lehrer in seinem Institut: |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874: "Ein Lehrer, der Mathematik und Naturwissenschaft findet
sogleich bei mir eine gute, dauernde Stelle. Solche, die Musik und
Englisch verstehen, erhalten den Vorzug. Sobernheim. A. Cahn,
Instituts-Vorsteher". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Mai 1874: "Ein Lehrer, der Mathematik und Naturwissenschaft findet
sogleich bei mir eine gute, dauernde Stelle. Solche, die Musik und
Englisch verstehen, erhalten den Vorzug. Sobernheim. A. Cahn,
Instituts-Vorsteher". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. März 1876:
"Israelitisches Knaben-Pensionat A. Cahn zu Sobernheim. Knaben,
welche das hiesige vollberechtigte Gymnasium oder meine Schule besuchen
wollen, finden Aufnahme und die nötige Nachhilfe. Referenzen: Herr
Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. M.C. Wahl in Erfurt, Herr Advokat
- Anwalt Dr. Eich und Herr Rabbiner Dr. Philippson in Bonn. Das Nähere im
Prospekt". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. März 1876:
"Israelitisches Knaben-Pensionat A. Cahn zu Sobernheim. Knaben,
welche das hiesige vollberechtigte Gymnasium oder meine Schule besuchen
wollen, finden Aufnahme und die nötige Nachhilfe. Referenzen: Herr
Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. M.C. Wahl in Erfurt, Herr Advokat
- Anwalt Dr. Eich und Herr Rabbiner Dr. Philippson in Bonn. Das Nähere im
Prospekt". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:
"Pensionat A. Cahn in Sobernheim fördert schnell solche Knaben, die
in den Klassen zurückgeblieben sind, gesunde, kräftige Pflege, sehr
reizende Lage. Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. Philippson in
Bonn, Herr Direktor Dr. Wahl in Erfurt, dessen Sohn auch hier ist, geben
gern Auskunft". Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:
"Pensionat A. Cahn in Sobernheim fördert schnell solche Knaben, die
in den Klassen zurückgeblieben sind, gesunde, kräftige Pflege, sehr
reizende Lage. Herr Rabbiner Dr. Lehmann in Mainz, Herr Dr. Philippson in
Bonn, Herr Direktor Dr. Wahl in Erfurt, dessen Sohn auch hier ist, geben
gern Auskunft". |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881:
"Knabenpensionat A. Cahn zu Sobernheim bildet zum Kaufmanne und zum
Studium durch Besuch des vollberechtigten Progymnasiums vor. Ein
Hauslehrer und verschiedene andere Lehrer assistieren. Mäßige Preise.
Die besten Referenzen des In- und Auslandes." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1881:
"Knabenpensionat A. Cahn zu Sobernheim bildet zum Kaufmanne und zum
Studium durch Besuch des vollberechtigten Progymnasiums vor. Ein
Hauslehrer und verschiedene andere Lehrer assistieren. Mäßige Preise.
Die besten Referenzen des In- und Auslandes." |
25-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Alexander Cahn (1869)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom8. September 1869:
"Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung
der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten
Freunde und Gönner, das 25-jährige Jubiläum seiner lehramtlichen
Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Festes dargebrachten Serenade und
der Illumination des von Letzterem bewohnten, der Feier des Tages
entsprechend geschmückten Hauses eingeleitet, erfolgt nach
vorangegangenem Frühständchen um 10 Uhr vormittags der von Herrn Dr.
Hulisch, Prediger der israelitischen Gemeinde zu Neuß, vollzogene
Hauptakt der Tagesfeier. In beredter und überzeugungsvoller Weise sprach
der Redner nach dem einleitenden Gesange der Schüler des Jubilars über
die Bedeutung des Lehrerberufs in religiöser, politischer und sozialer
Beziehung und beleuchtete die segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach
verschiedenen Richtungen hin (Anmerkung: Wie wir hören, wird die
obgedachte Festrede demnächst zum Besten der Hinterbliebenen der im
Plauen'schen Grunde Verunglückten im Drucke erscheinen]. Der Festrede
unmittelbar reihten sich die Beglückwünschungen der verschiedenen
Deputationen und die dankbare Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang
diese ernste, die ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der
bevorstehenden heitern Platz zu machen. Das darauf folgende Festmahl, an
welchem sich die Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in
erfreulicher Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange
nach Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl und
sinnreiche Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. - Sicherlich
wird der erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit und in
ihren Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der
Erinnerung derselben fortdauern."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom8. September 1869:
"Sobernheim, 19. August (1869). Gestern feierte der Lehrer der
jüdischen Gemeinde, Herr Alexander Cahn, unter allgemeiner Beteiligung
der hiesigen Bürgerschaft, sowie seiner aus Nah und Fern herbeigeeilten
Freunde und Gönner, das 25-jährige Jubiläum seiner lehramtlichen
Tätigkeit. Mit einer am Vorabend des Festes dargebrachten Serenade und
der Illumination des von Letzterem bewohnten, der Feier des Tages
entsprechend geschmückten Hauses eingeleitet, erfolgt nach
vorangegangenem Frühständchen um 10 Uhr vormittags der von Herrn Dr.
Hulisch, Prediger der israelitischen Gemeinde zu Neuß, vollzogene
Hauptakt der Tagesfeier. In beredter und überzeugungsvoller Weise sprach
der Redner nach dem einleitenden Gesange der Schüler des Jubilars über
die Bedeutung des Lehrerberufs in religiöser, politischer und sozialer
Beziehung und beleuchtete die segensreiche Wirksamkeit des Gefeierten nach
verschiedenen Richtungen hin (Anmerkung: Wie wir hören, wird die
obgedachte Festrede demnächst zum Besten der Hinterbliebenen der im
Plauen'schen Grunde Verunglückten im Drucke erscheinen]. Der Festrede
unmittelbar reihten sich die Beglückwünschungen der verschiedenen
Deputationen und die dankbare Erwiderung des Jubilars an, worauf ein Schlussgesang
diese ernste, die ganze Zuhörerschaft erhebende Feier beendigte, um der
bevorstehenden heitern Platz zu machen. Das darauf folgende Festmahl, an
welchem sich die Notabeln des Ortes ohne konfessionellen Unterschied in
erfreulicher Weise beteiligten, vereinigte die Festgesellschaft bis lange
nach Mitternacht in der heitersten Stimmung, welche durch zahl und
sinnreiche Toaste und Festlieder wesentlich gehoben wurde. - Sicherlich
wird der erhebende Eindruck, den diese Feier in ihrer Gesamtheit und in
ihren Einzelheiten bei allen Beteiligten hervorgerufen, noch lange in der
Erinnerung derselben fortdauern." |
Über Dr. Emanuel Hecht's
"Übersetzungslehrer", neu bearbeitet und vermehrt von Alexander Cahn
in Sobernheim (1877)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "Dr. Emanuel Hecht's
'Übersetzungslehrer'. Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des
Pentateuchs und der Pessach Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und
Echa. Nebst einem hebräischen Lehr- und Übungsbuche für Schulen. Dritte
Auflage. Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn, Lehrer
und Leiter eines Instituts in Sobernheim. Kreuznach 1877.
Voigtländer. Mit Recht sagt Herr Cahn in seiner Vorrede, ein die dritte
Auflage erforderndes Buch hat sich als praktisch bewährt, und dafür
erkennen auch wir die vorliegende Schrift gern an. Die Befürchtung, dass
der Lehrer durch die Bequemlichkeit, welche das Buch ihm und dem Schüler
bietet, sich verleiten lässt, allzu wenig auf die Erlernung der Grammatik
zu dringen, wir durch den Anhang: 'Kleine hebräische Grammatik nach
unterrichtlichen Grundsätzen' (S. 127-180) beseitigt. Der Schüler
erhält hier Vers nach Vers von jedem Worte das Grundwort und dessen
Bedeutung, sowie die im Verse vorkommende Form des Wortes mit ihrer
Bedeutung. In der Voraussetzung, dass die Grundwörter auswendig gelernt
werden, nimmt deren Angabe ab. Die kleine Grammatik in Beispiel, Belehrung
und Übung ist für den Unterricht in den Elementen sehr angemessen
angelegt. Statt der Bücher Esther, Ruth und echa hätten wir die
hautsächlichsten Gebete in gleicher Weise bearbeitet
gewünscht." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "Dr. Emanuel Hecht's
'Übersetzungslehrer'. Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des
Pentateuchs und der Pessach Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und
Echa. Nebst einem hebräischen Lehr- und Übungsbuche für Schulen. Dritte
Auflage. Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn, Lehrer
und Leiter eines Instituts in Sobernheim. Kreuznach 1877.
Voigtländer. Mit Recht sagt Herr Cahn in seiner Vorrede, ein die dritte
Auflage erforderndes Buch hat sich als praktisch bewährt, und dafür
erkennen auch wir die vorliegende Schrift gern an. Die Befürchtung, dass
der Lehrer durch die Bequemlichkeit, welche das Buch ihm und dem Schüler
bietet, sich verleiten lässt, allzu wenig auf die Erlernung der Grammatik
zu dringen, wir durch den Anhang: 'Kleine hebräische Grammatik nach
unterrichtlichen Grundsätzen' (S. 127-180) beseitigt. Der Schüler
erhält hier Vers nach Vers von jedem Worte das Grundwort und dessen
Bedeutung, sowie die im Verse vorkommende Form des Wortes mit ihrer
Bedeutung. In der Voraussetzung, dass die Grundwörter auswendig gelernt
werden, nimmt deren Angabe ab. Die kleine Grammatik in Beispiel, Belehrung
und Übung ist für den Unterricht in den Elementen sehr angemessen
angelegt. Statt der Bücher Esther, Ruth und echa hätten wir die
hautsächlichsten Gebete in gleicher Weise bearbeitet
gewünscht." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "Im Verlage von R. Voigtländer in
Kreuznach erschien soeben: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 7. August 1877: "Im Verlage von R. Voigtländer in
Kreuznach erschien soeben:
Dr. Emanuel Hecht's Übersetzungslehrer.
Ein methodisches Hilfsmittel zum Übersetzen des Pentateuchs und der
Pessach-Hagadah, wie der Bücher: Esther, Ruth und Echa. Nebst einem
hebräischen Lehr- und Übungsbuch für Schulen. Dritte Auflage.
Neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von A. Cahn. Preis 1 Mark
50 Pf.
Herr A. Cahn, der bewährte Leiter des Sobernheimer Erziehungsinstitutes
hat das Hecht'sche Werk einer durchgreifenden Bearbeitung unterworfen. Das
Buch kann in seiner jetzigen Gestalt sowohl allen Schulen zur Einführung
bestens empfohlen werden, wie es auch von Vätern, welche selbst ihre
Kinder in die heiligen Schriften einführen wollen, freudig begrüßt
werden wird.
Bei Neueinführungen stellt die Verlagshandlung gern Freiexemplare für
ärmere Schüler zur Verfügung.
Jede solide Buchhandlung ist in Stand gesetzt, Exemplare zur Einsicht zu
liefern." |
25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer und Kantor Simon Berendt (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:
"Sobernheim, 7. März (1915). Am 1. April blickt Herr Lehrer und
Kantor S. Berendt auf eine 25-jährige segensreiche Tätigkeit in der
hiesigen Kultusgemeinde zurück. Im Hinblick auf die schweren Zeiten hat
er sich jegliche Feier verbeten. Doch willen es sich seine Freunde nicht
nehmen lassen, ihm nach dem Kriege eine seinem ersprießlichen Wirken
entsprechende Feier zu veranstalten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1915:
"Sobernheim, 7. März (1915). Am 1. April blickt Herr Lehrer und
Kantor S. Berendt auf eine 25-jährige segensreiche Tätigkeit in der
hiesigen Kultusgemeinde zurück. Im Hinblick auf die schweren Zeiten hat
er sich jegliche Feier verbeten. Doch willen es sich seine Freunde nicht
nehmen lassen, ihm nach dem Kriege eine seinem ersprießlichen Wirken
entsprechende Feier zu veranstalten." |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und
Kantor (1924)
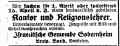 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 13.
März 1924: Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 13.
März 1924:
"Wir suchen für 1. April oder spätestens 15. April dieses Jahres
einen seminaristisch gebildeten
Kantor und Religionslehrer. Unverheiratete bevorzugt. Zeugnisse mit
Bild und Gehaltsansprüchen erheben.
Israelitische Gemeinde Sobernheim. Leopold Loeb,
Vorsteher." |
70. Geburtstag von Lehrer i.R. Simon Berendt (1934)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Dezember 1934: "Bad Ems,
10. Dezember (1934). Herr Lehrer und Kantor Simon Berendt, früher
in Sobernheim und Veitshöchheim,
der jetzt seinen wohlverdienten Ruheabend im Lehrerheim zu Bad Ems
genießt, begeht am 24. Dezember seinen 70. Geburtstag. Wir
wünschen dem verdienten Beamten und Jugendbildner weitere Jahre
ungetrübten Lebens. (Alles Gute) bis 120 Jahre."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 13. Dezember 1934: "Bad Ems,
10. Dezember (1934). Herr Lehrer und Kantor Simon Berendt, früher
in Sobernheim und Veitshöchheim,
der jetzt seinen wohlverdienten Ruheabend im Lehrerheim zu Bad Ems
genießt, begeht am 24. Dezember seinen 70. Geburtstag. Wir
wünschen dem verdienten Beamten und Jugendbildner weitere Jahre
ungetrübten Lebens. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |
| Kennkarte
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgende Kennkarte ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarte
des 1935/39 in Sobernheim tätigen
Rabbiner Dr. Moritz Lorge |

|
|
Kennkarte (Mainz) für Rabbiner Dr. phil.
Moritz Lorge (geb. 6. Oktober 1874 in Harmuthsachsen). Moritz Lorge
war nach dem Besuch der Schule in Harmuthsachsen Schüler an der Israelitischen
Präparandenschule in Burgpreppach. 1892 bis 1892 studierte er am
Lehrerseminar in Kassel. Er war zwischen 1900 und 1904 jeweils kürzere
Zeit Lehrer in Wolfenbüttel, dann Lehrer und Prediger in Petershagen
sowie Lehrer in Hamm in Westfalen. Ab 1904 studierte er in Berlin und
Tübingen (Promotion 1907). Von 1908 bis 1933 war er Oberlehrer und
Studienrat für Religion, Deutsch und Geschichte in Mainz an der Höheren
Töchterschule. 1935 Bezirksrabbiner in Sobernheim. 1939 in die USA
emigriert und in den folgenden Jahren in Cincinatti und New York Vortrags-
und Lehrtätigkeit zur Geschichte der Juden in Deutschland und den USA.
War verheiratet mit Hedwig geb. Steinweg (Sohn: der 1916 geborene Ernst Mordechai Lorge
wurde gleichfalls Rabbiner, siehe Artikel unten). Moritz Lorge starb 1948 in New
York.
|
|
|
|
 Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang
Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:
"Stets hoffnungsvoll und furchtlos.
Hinweis auf den Artikel von Gabriele Hannah, Hans-Dieter Graf und Wolfgang
Bürkle in der "Allgemeinen Zeitung Mainz" vom 27. Mai 2016:
"Stets hoffnungsvoll und furchtlos.
Auswanderer. Ernst Mordecai Lorge flüchtete aus Mainz in die USA /
Seelsorger für KZ-Überlebende..."
Artikel zum 100. Geburtstag von Ernst Mordechai Lorge.
Der Artikel ist eingestellt als Bilddatei (links) und als pdf-Datei.
|
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Hinweis für arme, durchreisende Juden (1886)
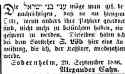 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Oktober 1886: "Die
Armen im Volk Israel möge man gefälligst benachrichtigen, dass sie an
hiesigem Orte, wenn anders ihre Papiere geordnet sind, nicht mehr zu
befürchten haben, eingesperrt zu werden. Dieselben holen sich bei dem
Vorsteher S. Löb hier eine Anweisung, die ich, der Kassierer, ausbezahlen
werde. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Oktober 1886: "Die
Armen im Volk Israel möge man gefälligst benachrichtigen, dass sie an
hiesigem Orte, wenn anders ihre Papiere geordnet sind, nicht mehr zu
befürchten haben, eingesperrt zu werden. Dieselben holen sich bei dem
Vorsteher S. Löb hier eine Anweisung, die ich, der Kassierer, ausbezahlen
werde.
Sobernheim, 29. September 1886. Alexander Cahn". |
Chanukka-Abend der Religionsschule (1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:
"Sobernheim, 10. Dezember (1901). Zu welcher Beliebtheit die
Chanukka-Veranstaltungen der unter Leitung unseres Herrn Lehrers
Berendt stehenden Religionsschule es bei den hiesigen und bei den in
den Nachbargemeinden wohnenden Glaubensgenossen gebracht haben, bewies die
große Zahl der Besucher, welche der geräumige Saal der 'Hohen Burg' am
Samstag Abend, 7 Uhr, kaum zu fallen vermochte. Das Programm war mit
vielem Geschick zusammengestellt, und entledigte sich Herr Berendt seiner
keineswegs leichten Aufgabe mit bekannter
Meisterschaft.
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:
"Sobernheim, 10. Dezember (1901). Zu welcher Beliebtheit die
Chanukka-Veranstaltungen der unter Leitung unseres Herrn Lehrers
Berendt stehenden Religionsschule es bei den hiesigen und bei den in
den Nachbargemeinden wohnenden Glaubensgenossen gebracht haben, bewies die
große Zahl der Besucher, welche der geräumige Saal der 'Hohen Burg' am
Samstag Abend, 7 Uhr, kaum zu fallen vermochte. Das Programm war mit
vielem Geschick zusammengestellt, und entledigte sich Herr Berendt seiner
keineswegs leichten Aufgabe mit bekannter
Meisterschaft.
Eingeleitet wurde die Feier durch ein von Herrn Gerichtsschreiber Höning
künstlerisch gespieltes Präludium für Pianoforte. Hierauf folgte die
Festrede des Herrn Berendt. Alle Anwesenden folgten mit größter
Aufmerksamkeit den Ausführungen des beliebten Redners, der zum Schlusse
die Jugend ermahnte, das teure Gut, für das die Makkabäer gerungen, sich
zu eigen zu machen, sich zu vertiefen in die reichen Schätze unserer
Religion, Geschichte und Literatur, zu lernen, was es heißt, 'Jude', ein
Nachkomme jenes Juda Makkabi zu sein. Alsdann sang Herr Berendt mit seiner
volltönenden, wohlgebildeten Baritonstimme die 'Brochaus' und entzündete
die Lichter. Es war ein entzückender Anblick, als darauf sämtlich
Knaben, 28 an der Zahl . de Chanukkalichter an ihren eigenen Leuchtern
anzündeten. Letztere waren ein Geschenk von der vorjährigen
Chanukkafeier. Nach 'Maous zur jeschuosi' wurden Deklamationen und Lieder
vorgetragen, und kam bei letzteren die vortreffliche, gesangliche
Disziplin zu herrlicher Entfaltung.
Die Hauptnummer der Aufführungen bildete das von Alexander Simeon verfasste
Festspiel für die Jugend: 'Der Weg der Treue'. Hier trat die treffliche
Schulung so recht ins Licht und ließ dieses Stück zu einer vollendeten Glanzleistung
gedeihen, welche sämtliche Zuhörer zu brausendem Beifall hinriss. Nach
dem gemeinsamen Gesang des Liedes 'Schirm und Schutz' von Lewandowski,
folgte die Chanukka-Bescherung. Um 11 Uhr verließ die Versammlung, voll
befriedigt von dem Gehörten und Gesehenen, den Festsaal in dem
Bewusstsein, dass hier auf wirklich erhebende und über den Rahmen des
Alltäglichen und der gewöhnlichen Leistung 3einer Schule hinausgehenden
Weise Chanukka würdig gefeiert worden sei. In Anerkennung seiner
Verdienste um das Gelingen wurde dem Herrn Berendt von den hiesigen Damen
ein sehr wertvolles Geschenk überreicht." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Ferdinand Wolff, Teilhaber der Firma Gebr.
Jacob Wolff in Sobernheim (1857)
Nachruf des Lehrers Alexander Cahn: "Einen solchen Leichenzug von Juden und Christen aus der Nähe und
Ferne hat unsere Stadt noch nie gesehen"
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November
1857: "Nekrolog. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November
1857: "Nekrolog.
Sobernheim, 19. November (1857). Wie Köln in
diesem Jahre den Hintritt eines Mannes beweinte, dessen edles Streben für
alles Gute und Schöne allgemein ge- und erkannt war, ich meines des Herr
Isaac Kaufmann, der es wohl verdiente, in diesem Blattes, welches man mit
Recht unsere Chronik nennen kann, rühmlichst erwähnt zu werden, ... und
dem nur Herr Klein, wofür er sich gewiss den Dank Vieler erworben, ein
Denkmal in seinem diesjährigen Kalender gesetzt - so haben auch wir die
irdische Hülle eines Biedermannes zur Erde bestattet, der allgemein
geachtet und geliebt, nun der Gegenstand der Trauer, ich darf sagen, der
ganzen Stadt und Umgebung ist. Es starb nämlich dieser Tage nach einem
langen und schmerzlichen Leiden der Herr Ferdinand Wolff, Teilhaber
des Geschäftes unter der Firma Gebrüder Jacob Wolff, Förderer alles
Guten; ohne erst von anderer Seite dazu ermuntert und angespornt zu
werden, spendete er reichlich die Gaben der Milde, und glaubte dennoch, nie
genug getan zu haben; seine angenehmsten Besuche waren, trotz seiner
angesehenen Stellung, die, welche er den armen, leidenden Familien
machte, und wohltuend war es für mich und gewiss für jeden
Menschenfreund, wenn ich ihn Sabbats mit diesen Leuten an ihrer Türe
sitzen und sich eifrig und angenehm mit ihnen unterhalten sah, und gewiss
ist es, dass er ihnen nicht nur eine materielle, sondern auch eine
geistige Stütze war, denn diese seine Handlungsart war Ausfluss eines
nicht nur weltlich, sondern auch religiös gebildeten, und besonders in
den jüdischen Schriften sehr bewanderten Geistes, so zwar, dass er einen
hebräischen Brief und sogar ein Gedicht in hebräischer Sprache
abzufassen verstand. Einen solchen Leichenzug von Juden und Christen
aus der Nähe und Ferne hat unsere Stadt noch nie gesehen; selten aber
auch sind die Menschen, die, so wie er, ihr Wohl und ihr Interesse
beiseite setzend, sich ausschließlich der leidenden Menschheit weihen. Um
nur ein kleines Beispiel zu geben: als diese Zeitung in diesem Jahre das
Unglück der Familie des Lehrers Levisohn aus Fulda meldete, da wurde,
ohne dass ich etwas vorzutragen nötig hatte, mir von obiger Firma eine
reichliche Gabe ins Haus geschickt; allein das schien noch nicht genug zu
sein, ich musste bei dem Herrn Redakteur dieses Blattes anfragen, (was
auch geschehen, wie der Herr Dr. Philippson gern bezeugen wird) was man
vielleicht für diese Familie noch mehr ihrerseits tun könnte, und gewiss
bin ich, hätte man ein größeres als ein Geldopfer verlangt, es wäre
gebracht worden. Trotz seiner Gewandtheit in Musik und fremden Sprachen
und Wissenschaften war doch die jüdische Lektüre seine liebste
Beschäftigung, und waren es besonders die Werke des Herrn Dr. Philippson
und dessen Zeitung, die er mit besonderem Eifer, mit besonderer Lust
durchsah, sodass er kaum die Zeit erwarten konnte, bis das Blatt wöchentlich
ankam; selbst ein interessanter Humorist, vermochte ein Witz im
Volksblatte ihn Tage hindurch zu erheitern und so Herr Redakteur, haben
Sie, ohne es zu wissen, einen Freund und Gönner in dem Verstorbenen
besessen, und so haben Sie, ohne es zu wissen, diese Freundschaft durch
die verschaffte Erheiterung erwidert. Dass ich den Satz: De mortuis nil
nisi bene nicht unterschreibe, das wissen Alle, die mich genauer
kennen; ich könnte nicht aufhören, wollte ich die Tugenden des
Verstorbenen aufzählen. Der Herr des Himmels und der Erde hat sie
eingeschrieben in das Buch des Lebens die Wohltaten, die er geübt, und
die Gesinnungen, die er durch seine letzte Verfügung noch an den Tag
gelegt, Er wird dafür seine Seele einschließen in den Bund des Lebens.
Amen. Sit terra ei levis. Alexander Cahn". |
Zum Tod von Philipp Jacob Wolff
(1859)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Oktober 1859:
"Todesanzeige. Allgemein betrauert, starb in diesen Tagen zu unserem
großen Leidwesen der auch in fernen Kreisen bekannte biedere,
gottesfürchtige, allseitig gebildete Philipp Jacob Wolff. Wer den
Verewigten gekannt, wird den Schmerz zu rechtfertigen wissen, den sein
Dahinscheiden über die Seinigen sowohl, als über die Menge seiner
Freunde und Bekannten gebracht, und vielleicht Mancher, dem durch diese
Zeilen die traurige Kunde zugeführt wird, kann eine Träne des Mitleids
ihm nicht versagen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Oktober 1859:
"Todesanzeige. Allgemein betrauert, starb in diesen Tagen zu unserem
großen Leidwesen der auch in fernen Kreisen bekannte biedere,
gottesfürchtige, allseitig gebildete Philipp Jacob Wolff. Wer den
Verewigten gekannt, wird den Schmerz zu rechtfertigen wissen, den sein
Dahinscheiden über die Seinigen sowohl, als über die Menge seiner
Freunde und Bekannten gebracht, und vielleicht Mancher, dem durch diese
Zeilen die traurige Kunde zugeführt wird, kann eine Träne des Mitleids
ihm nicht versagen.
Sobernheim, 3. Oktober 1859. A. Cahn." |
Zum Tod der Witwe Ludwig Michel von Sobernheim (1885)
"allen tat sie wohl, allen war sie eine Retterin, eine Stütze"
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1885:
"Sobernheim, 3. Juni (1885). Wir haben verloren, was wir nicht wiederfinden, eine Eschet chajal (tüchtige Frau) im wahren Sinne
des Wortes; die Frau Witwe Ludwig Michel von hier ist nicht mehr
unter den Lebenden, sie ist hinüber gewandert zu ihrem himmlischen Vater,
den sie hier kindlich geliebt und verehrt hat, sie war eine Rechtschaffene
in jeder Beziehung, nicht nur im Gebete, sie war zu jeder Zeit die Erste
und die Letzte in der Synagoge, mehr noch bewahrte sie sich als Hausmutter,
ihr ebenso braver Mann, der ihr vorausgeeilt ist zum Himmel, und der seine
Bestimmung als rechtschaffener Ehemann auch in seinem ganzen Leben
erfüllte, heiratete seine brave Frau als Witwer und brachte sechs Kinder
mit in die Ehe, die sie, nicht wie eine Stiefmutter, sondern wie die
leibliche Mutter mit ihren eigenen fünf Kindern erzog, und es ist ein
Genuss, zu sehen, und sich zu überzeugen, wie alle ihre Kinder mit Liebe
an ihr hingen und ihr das Leben, wie sie es verdiente, versüßten. Arme,
Witwen und Waisen waren ihre Hausgenossen, allen tat sie wohl, allen
war sie eine Retterin, eine Stütze. Gestern, bei ihrer Beerdigung,
zeigte es sich; die Tränen, die bei dem überaus großen Leichenzuge, der
von Nahe und Fern Leidtragende aller Konfessionen vereinte, fielen,
bewiesen, dass man brav und fromm leben müsse, um betrauert, geachtet und
hochgeehrt sterben zu können. Ihre Seele sie eingebunden in den Bund
des Lebens". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juni 1885:
"Sobernheim, 3. Juni (1885). Wir haben verloren, was wir nicht wiederfinden, eine Eschet chajal (tüchtige Frau) im wahren Sinne
des Wortes; die Frau Witwe Ludwig Michel von hier ist nicht mehr
unter den Lebenden, sie ist hinüber gewandert zu ihrem himmlischen Vater,
den sie hier kindlich geliebt und verehrt hat, sie war eine Rechtschaffene
in jeder Beziehung, nicht nur im Gebete, sie war zu jeder Zeit die Erste
und die Letzte in der Synagoge, mehr noch bewahrte sie sich als Hausmutter,
ihr ebenso braver Mann, der ihr vorausgeeilt ist zum Himmel, und der seine
Bestimmung als rechtschaffener Ehemann auch in seinem ganzen Leben
erfüllte, heiratete seine brave Frau als Witwer und brachte sechs Kinder
mit in die Ehe, die sie, nicht wie eine Stiefmutter, sondern wie die
leibliche Mutter mit ihren eigenen fünf Kindern erzog, und es ist ein
Genuss, zu sehen, und sich zu überzeugen, wie alle ihre Kinder mit Liebe
an ihr hingen und ihr das Leben, wie sie es verdiente, versüßten. Arme,
Witwen und Waisen waren ihre Hausgenossen, allen tat sie wohl, allen
war sie eine Retterin, eine Stütze. Gestern, bei ihrer Beerdigung,
zeigte es sich; die Tränen, die bei dem überaus großen Leichenzuge, der
von Nahe und Fern Leidtragende aller Konfessionen vereinte, fielen,
bewiesen, dass man brav und fromm leben müsse, um betrauert, geachtet und
hochgeehrt sterben zu können. Ihre Seele sie eingebunden in den Bund
des Lebens". |
Auszeichnung für Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges Richard Feibelmann
(1915)
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1915:
"Sobernheim, 1. Januar. Mit dem 'Eisernen Kreuz' ausgezeichnet und
zum Gefreiten befördert wurde der im Westen kämpfende Richard
Feibelmann, Sobernheim, 10. Komp. Infanterie-Regiment Nr. 68". Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1915:
"Sobernheim, 1. Januar. Mit dem 'Eisernen Kreuz' ausgezeichnet und
zum Gefreiten befördert wurde der im Westen kämpfende Richard
Feibelmann, Sobernheim, 10. Komp. Infanterie-Regiment Nr. 68". |
Auszeichnung für Unteroffizier Lippmann Ullmann
(1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1915:
"Sobernheim, 30. Januar (1915). Der Unteroffizier im 1. bayerischen
Reserve-Infanterie-Regiment, Lippmann Ullmann, Teilhaber der Firma
Reinemann-Lichtinger in München, wurde auf dem westlichen
Kriegsschauplatz mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet; außerdem wurde ihm
der bayerische Militär-Verdienstorden mit Schwertern
verliehen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1915:
"Sobernheim, 30. Januar (1915). Der Unteroffizier im 1. bayerischen
Reserve-Infanterie-Regiment, Lippmann Ullmann, Teilhaber der Firma
Reinemann-Lichtinger in München, wurde auf dem westlichen
Kriegsschauplatz mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet; außerdem wurde ihm
der bayerische Militär-Verdienstorden mit Schwertern
verliehen." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrer Alexander Cahn kann einen Lehrling vermitteln (1859)
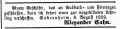 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. September 1859: "Einem Geschäfte, das an Sabbat- und
Feiertagen geschlossen, kann ich sofort einen gut vorgebildeten Lehrling
verschaffen.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 12. September 1859: "Einem Geschäfte, das an Sabbat- und
Feiertagen geschlossen, kann ich sofort einen gut vorgebildeten Lehrling
verschaffen.
Sobernheim, 8. August 1859. Alexander Cahn."
|
Anzeige der "Koscher-Wurstfabrik" von Israel Metzler in
Sobernheim (1879)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November
1879): "Koscher - Wurst-Fabrik - Koscher von Is.
Metzler in Sobernheim a.d. Nahe empfiehlt Cervelat-,
Lyoner-, Fleisch-, und Knoblauch-Würste, beste Qualität, sowie Rauch-
und Pökelfleisch, Roulade und Zungen zu den billigsten Preisen." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November
1879): "Koscher - Wurst-Fabrik - Koscher von Is.
Metzler in Sobernheim a.d. Nahe empfiehlt Cervelat-,
Lyoner-, Fleisch-, und Knoblauch-Würste, beste Qualität, sowie Rauch-
und Pökelfleisch, Roulade und Zungen zu den billigsten Preisen." |
Werbeanzeigen für die Strumpf-Fabrik A. Marum Witwe (1936/37)
Anmerkung: in verschiedenen jüdischen Periodika inserierte die Firma Marum
regelmäßig, teilweise wöchentlich, bis zum Oktober 1938.
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30. April 1936:
Werbeanzeige für "AMARSO Strümpfe - sind immer richtig - für Frühjahr und
Herbst..." Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 30. April 1936:
Werbeanzeige für "AMARSO Strümpfe - sind immer richtig - für Frühjahr und
Herbst..." |
| |
 Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 1.
April 1937: "Strumpf-Fabriken A. Marum Witwe.
Aktien-Gesellschaft. Sobernheim (Rheinland)." Anzeige
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins) vom 1.
April 1937: "Strumpf-Fabriken A. Marum Witwe.
Aktien-Gesellschaft. Sobernheim (Rheinland)." |
Zur Geschichte der Synagoge
Über mittelalterliche Einrichtungen ist nichts bekannt. Doch
dürfte - bei vier bis fünf jüdischen Familien in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts - ein Betraum vorhanden gewesen sein.
Auch die neuzeitliche Gemeinde seit dem 17./18. Jahrhundert hatte zunächst
einen Betsaal. Seit 1816 befand er sich
in einem Privathaus (Haus Werner, Marumstraße 20). Bereits Ende der
1830er-Jahre drohte die Baupolizei mit der Schließung des etwa 25 am großen
Raumes, da er die größer gewordene Gemeinde nicht mehr fasste. Zunächst
bemühte man sich um ein Grundstück in der Marumstraße (Fläche des späteren Hauses
Bottlinger), doch erwies sich dieses zu klein für einen Neubau. Erst 1858
wurde unter großen finanziellen Opfern eine Synagoge in der heutigen
Gymnasialstraße auf dem Gelände einer früheren Scheune erbaut. Es handelte
sich um einen spätklassizistischen Sandsteinquaderbau mit Rundbogenfenstern und
Pyramidaldach. Das
ursprüngliche Gebäude war - verglichen mit dem erhaltenen - um eine
Fensterachse kleiner, auf dem verbleibenden Platz sollte ein Schulhaus
entstehen.
Über die Einweihung der Synagoge am 18. Juni 1858, die Oberrabbiner Dr.
Auerbach gemeinsam mit dem Sobernheimer Kantor und Lehrer Alexander Cahn
durchführte, liegt ein Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums" vom 19. Juli 1858 vor, der von "Maurermeister S. Hadra"
verfasst wurde:
 "Sobernheim, 18. Juni (1858). Am heutigen Tage feierte die hiesige
israelitische Gemeinde die Einweihung ihres neu erbauten Gotteshauses.
Dasselbe ist im Verhältnis der nicht sehr zahlreichen jüdischen
Einwohnerschaft sehr geräumig erbaut, sodass bei einer noch so großen
Vermehrung derselben es nicht an Raum mangeln dürfte. Das Gebäude selbst
ist in einem passenden modernen Stil erbaut. - Die Gemeinde scheute keine
Kosten, ihr Gotteshaus auf die würdigste Weise auszustatten. Auch hatte
sie sich wertvoller Geschenke und Beiträge auswärtiger Mitglieder zu
erfreuen. Die Einweihungs-Feierlichkeiten wurden mit großen Pomp
begangenen. Zahlreiche Freunde von Nah und Fern hatten sich eingefunden,
um diesem Festtage beizuwohnen.
"Sobernheim, 18. Juni (1858). Am heutigen Tage feierte die hiesige
israelitische Gemeinde die Einweihung ihres neu erbauten Gotteshauses.
Dasselbe ist im Verhältnis der nicht sehr zahlreichen jüdischen
Einwohnerschaft sehr geräumig erbaut, sodass bei einer noch so großen
Vermehrung derselben es nicht an Raum mangeln dürfte. Das Gebäude selbst
ist in einem passenden modernen Stil erbaut. - Die Gemeinde scheute keine
Kosten, ihr Gotteshaus auf die würdigste Weise auszustatten. Auch hatte
sie sich wertvoller Geschenke und Beiträge auswärtiger Mitglieder zu
erfreuen. Die Einweihungs-Feierlichkeiten wurden mit großen Pomp
begangenen. Zahlreiche Freunde von Nah und Fern hatten sich eingefunden,
um diesem Festtage beizuwohnen.
Der festliche Zug bewegte sich von dem alten Bethause nach der neuen
Synagoge. Voran unter dem prachtvollen Baldachin der Oberrabbiner, Herr
Dr. Auerbach aus Bonn und der hiesige Kantor und Lehrer, Herr Cahn,
gefolgt von den Trägern des Gesetzrollen. Hierauf folgte das hier neu
errichtete Sängerchor von den Jungfrauen und Männern Sobernheims, die zu
dieser Festlichkeit geladenen Beamten und die übrigen Mitglieder der
Gemeinde. Die Synagoge war bei dieser denkwürdigen Feierlichkeit mit Laub
und Blumengewinden vom Referenten geschmückt worden. Herr Oberrabbiner
Dr. Auerbach hielt eine tief ergreifende Predigt, die Wichtigkeit des
heutigen Tages schildernd. Am Samstage darauf predigte der Lehrer und
Kantor der israelitischen Gemeinde Herr Kahn über das Thema: 'Bauet mir
ein Gotteshaus und ich werde wohnen unter Euch.' S. Hadra,
Maurermeister." |
1904 wurde die Synagoge umfassend renoviert und nach Westen erweitert.
Über den Abschluss der Arbeiten und die Wiedereinweihung des Gotteshauses am
11. und 12. November 1904 liegt ein Bericht aus der Zeitschrift "Der
Israelit" vom 24. November 1904 vor:
 Sobernheim.
14. November (1904). Der 11. und 12. November waren hohe Festtage für die
hiesige Gemeinde, galt es doch an diesen Tagen, die erweiterte und verschönerte
Synagoge einzuweihen. Zu den Feierlichkeiten waren viele Gäste von hier und von
auswärts eingeladen und erschienen. Der am Freitag Nachmittag abgehaltene
Weihegottesdienst, an dem unter anderen auch der Bürgermeister, das
Stadtverordneten-Kollegium, der Königliche Kreisschulinspektor, der Direktor
der hiesigen Realschule sowie die Vertreter der Schulverbände teilnahmen, wurde
eröffnet durch die vom Synagogenchor vorgetragene Motette: "Gesegnet sei, wer
da kommt im Namen des Herrn." Hierauf verlas der Lehrer der Gemeinde, Herr
Berendt, mit erhebend ausdrucksvoller Stimme Psalm 110. Nachdem der Chor alsdann
Mah towu gesungen, trug die älteste Tochter des Vorstandsmitgliedes
Herrn Michel in mustergültiger Weise einen Prolog vor und überreichte dem
Gemeindevorsitzenden, Herrn M. Marum, den Schlüssel zur heiligen Lade. Dieser
hielt eine Ansprache und dankte in kurzen, aber herzlichen Worten allen denen,
die zur Ausführung des Baues beigetragen haben. Darauf öffnete Herr Marum die
heilige Lage und übergab sie dem zeremoniellen Gebrachte. Während der Chor Wajehi
benisa sang, entnahm das Vorstandsmitglied, Herr Löb, eine der Torarollen
und übergab sie Herrn Berendt, welcher mit feierlicher Stimme folgendes sprach:
"Und dies ist die Lehre, welche Moses den Kindern Israels vorgelegt, und in
dieser Lehre steht das Wort, welches Israel auf seiner langen Wanderung durch
die Geschichte als Banner gedient, um welches es sich geschart, das Wort,
welches Sein Leitstern war in freundlichen und in trüber Tagen: Höre Israel,
der Ewige, unser Gott, der Ewige, ist einzig." – Nachdem Chor und Gemeinde die
letzten Worte in hebräischer Sprache wiederholt hatten, wurde die Torarolle
unter geeignetem Chorgesang in die heilige Lade gestellt. Tief ergreifend und
ernst durchdacht war die hierauf folgende Festpredigt des Herrn Berendt über
das Wort des Propheten Jesajas: beiti beit tefila jekare lekol haAmim "Mein
Haus soll sein ein Bethaus und ein Haus für alle Völker". Nach der hierauf von
ihm vorgenommenen Weihe und der Verlesung des allgemeinen Bittegebets wurde
sodann der aronitische Segen in hebräischer und deutscher Sprache erteilt und
vom Chore der Weihgesang vorgetragen. Der Festgottesdienst hinterließ bei allen
Teilnehmern ersichtlich einen der Würde der Feier voll entsprechenden Eindruck.
Nach einer kurzen Pause fand kabbalat schabbat (Empfang des Schabbat)
statt, wobei ebenso wie am Nachmittag unser prächtiges Gotteshaus in herrlichem
elektrischem Lichterglanze erstrahlte. Am Samstag Vormittag fand ein
Hauptgottesdienst statt, mit welchem die religiöse Feier abschloss. Nachmittags
4 Uhr begann im Saale der "hohen Burg" ein Bankett. In schönster Weise verlief
auch diese Veranstaltung, sodass das Fest sich zu einem harmonischen Ganzen
gestaltete, welches seinen Arrangeuren Ehre machte und bei allen Teilnehmern
eine dauernde Erinnerung bilden wird. An der Ausschmückung des Gotteshauses
haben sich ein besonderes Verdienst erworben: Frau Jakob Kaufmann geb. van
Geldern, die durch Sammlung bei der Frauen die Anschaffung eines großartigen
Parochet (Toravorhang) ermöglichte; Herr Ferdinand Herz, der eine kostbare
Schulchandecke (Decke für das Vorlesepult) stiftete; Frau Else Jakobi geb.
Marum von Grünstadt und Herr B. Steinherb aus Aachen, welche je ein
reichgeziertes Toramäntelchen schenkten. Die Familie Jakob Marum aus Karlsruhe
gab einen seltenen Teppich, der das Innere des Gotteshauses ziert.
Sobernheim.
14. November (1904). Der 11. und 12. November waren hohe Festtage für die
hiesige Gemeinde, galt es doch an diesen Tagen, die erweiterte und verschönerte
Synagoge einzuweihen. Zu den Feierlichkeiten waren viele Gäste von hier und von
auswärts eingeladen und erschienen. Der am Freitag Nachmittag abgehaltene
Weihegottesdienst, an dem unter anderen auch der Bürgermeister, das
Stadtverordneten-Kollegium, der Königliche Kreisschulinspektor, der Direktor
der hiesigen Realschule sowie die Vertreter der Schulverbände teilnahmen, wurde
eröffnet durch die vom Synagogenchor vorgetragene Motette: "Gesegnet sei, wer
da kommt im Namen des Herrn." Hierauf verlas der Lehrer der Gemeinde, Herr
Berendt, mit erhebend ausdrucksvoller Stimme Psalm 110. Nachdem der Chor alsdann
Mah towu gesungen, trug die älteste Tochter des Vorstandsmitgliedes
Herrn Michel in mustergültiger Weise einen Prolog vor und überreichte dem
Gemeindevorsitzenden, Herrn M. Marum, den Schlüssel zur heiligen Lade. Dieser
hielt eine Ansprache und dankte in kurzen, aber herzlichen Worten allen denen,
die zur Ausführung des Baues beigetragen haben. Darauf öffnete Herr Marum die
heilige Lage und übergab sie dem zeremoniellen Gebrachte. Während der Chor Wajehi
benisa sang, entnahm das Vorstandsmitglied, Herr Löb, eine der Torarollen
und übergab sie Herrn Berendt, welcher mit feierlicher Stimme folgendes sprach:
"Und dies ist die Lehre, welche Moses den Kindern Israels vorgelegt, und in
dieser Lehre steht das Wort, welches Israel auf seiner langen Wanderung durch
die Geschichte als Banner gedient, um welches es sich geschart, das Wort,
welches Sein Leitstern war in freundlichen und in trüber Tagen: Höre Israel,
der Ewige, unser Gott, der Ewige, ist einzig." – Nachdem Chor und Gemeinde die
letzten Worte in hebräischer Sprache wiederholt hatten, wurde die Torarolle
unter geeignetem Chorgesang in die heilige Lade gestellt. Tief ergreifend und
ernst durchdacht war die hierauf folgende Festpredigt des Herrn Berendt über
das Wort des Propheten Jesajas: beiti beit tefila jekare lekol haAmim "Mein
Haus soll sein ein Bethaus und ein Haus für alle Völker". Nach der hierauf von
ihm vorgenommenen Weihe und der Verlesung des allgemeinen Bittegebets wurde
sodann der aronitische Segen in hebräischer und deutscher Sprache erteilt und
vom Chore der Weihgesang vorgetragen. Der Festgottesdienst hinterließ bei allen
Teilnehmern ersichtlich einen der Würde der Feier voll entsprechenden Eindruck.
Nach einer kurzen Pause fand kabbalat schabbat (Empfang des Schabbat)
statt, wobei ebenso wie am Nachmittag unser prächtiges Gotteshaus in herrlichem
elektrischem Lichterglanze erstrahlte. Am Samstag Vormittag fand ein
Hauptgottesdienst statt, mit welchem die religiöse Feier abschloss. Nachmittags
4 Uhr begann im Saale der "hohen Burg" ein Bankett. In schönster Weise verlief
auch diese Veranstaltung, sodass das Fest sich zu einem harmonischen Ganzen
gestaltete, welches seinen Arrangeuren Ehre machte und bei allen Teilnehmern
eine dauernde Erinnerung bilden wird. An der Ausschmückung des Gotteshauses
haben sich ein besonderes Verdienst erworben: Frau Jakob Kaufmann geb. van
Geldern, die durch Sammlung bei der Frauen die Anschaffung eines großartigen
Parochet (Toravorhang) ermöglichte; Herr Ferdinand Herz, der eine kostbare
Schulchandecke (Decke für das Vorlesepult) stiftete; Frau Else Jakobi geb.
Marum von Grünstadt und Herr B. Steinherb aus Aachen, welche je ein
reichgeziertes Toramäntelchen schenkten. Die Familie Jakob Marum aus Karlsruhe
gab einen seltenen Teppich, der das Innere des Gotteshauses ziert.
|
1929 wurde das Dach der Synagoge erneuert. Im August
1930 wurde eine Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
aus Sobernheim in der Synagoge angebracht.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge demoliert und geschändet.
Die Gebetbücher wurden verbrannt. Die Torarollen und der Vorhang des
Toraschreines konnten gerettet werden. Die zerschlagene Gefallenengedenktafel
wurde von Alfred Marum in
Sicherheit gebracht. (Sie wurde von ihm wieder zusammengesetzt und am 15. Oktober 1950 an
dem Denkmal auf dem Friedhof im
zerbrochenen Zustand befestigt. Die Jüdische Kultusgemeinde für die
Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld hat die beschädigte Tafel durch eine
originalgetreue Neuanfertigung im Januar 2005 ersetzt).
1939 wurde die Synagoge an die Stadt
verkauft, die das Gebäude zur Aula für das Gymnasium machen will. Im Zweiten
Weltkrieg wird die ehemalige Synagoge allerdings als Lagerraum für die
Wehrmacht zweckentfremdet.
Nach 1945: 1953 wurde das Gebäude an den Inhaber des Kaufhauses Schmidt
verkauft und danach als Möbellager verwendet. Dazu wurden zwei Zwischendecken
eingezogen. 1971 drohte der Abbruch des Gebäudes. Eine breite Umgehungsstraße
sollte nach den damaligen Plänen über das Grundstück der Synagoge führen. Nur mit
großer Mühe konnte der Unterschutzstellungsantrag beim Landesamt für
Denkmalpflege durchgesetzt werden. Die Stadt und der Eigentümer legten
(vergeblich) Widerspruch ein.
1986 wurde das Gebäude wiederum verkauft und als
Getränkelager und zur Vorratshaltung verwendet. Am 9. November 1989
wurde der Förderverein Synagoge Sobernheim e.V. gegründet. Er setzte sich zum Ziel, das
Vermächtnis der jüdischen Kultur in Bad Sobernheim zu bewahren. Von vornherein
stand
die Erhaltung und Renovierung der Synagoge im Mittelpunkt. Das Gotteshaus sollte
einer sinnvollen, der Würde des Gebäudes entsprechenden Nutzung zugeführt
werden. Diese Nutzung konnte darin gefunden werden, dass in dem Gebäude die städtische
Bibliothek und die Bibliothek der Kirchengemeinde zusammengefasst werden sollten
und dabei der frühere Betsaal in seinen Dimensionen erhalten blieb (keine durchgezogene
Zwischendecke).
2001 wurde von der Stadt Bad Sobernheim die Synagoge erworben.
Durch einen Nutzungs- und Unterhaltungsvertrag kam das Gebäude in die Obhut der
Fördervereins. 2002 wurden das Dach und die Fenster repariert. Von Nachkommen
der Familie Marum wurde ein neuer Davidsstern für das Dach gespendet. Alsbald
fanden in dem zunächst noch wenig ansehnlichen Innenraum mehrere
Gedenkveranstaltungen, Konzerte und auch jüdische Gottesdienste statt. Enge
Kontakte wurden in diesem Zusammenhang geknüpft zwischen dem Verein und der Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland (mit dem Max-Willner-Haus in Bad Sobernheim) und der Jüdischen Kultusgemeinde in
Bad Kreuznach. 2003
fand der erste jüdische Gottesdienst in der Synagoge nach 65 Jahren statt.
Zwischen 2005 und 2010 konnte die Restaurierung der ehemaligen Synagoge als
eines Kulturhauses Synagoge" durchgeführt werden. Die feierliche
Einweihung des "Kulturhauses Synagoge" war am 30. Mai 2010.
Adresse: Förderverein Synagoge Sobernheim e.V., zu
Hdn. von Hans-Eberhard Berkemann, Auf
dem Kolben 4, 55566 Bad Sobernheim. Tel. 06751/3795.
Spendenkonto: Sparkasse
Rhein-Nahe (BLZ 560 501 80) Nr. 1 009 760 E-Mail.
Adresse/Standort der Synagoge: Gymnasialstraße 9
Fotos
(Fotos um 1980 aus "und dies ist die Pforte..."
s.Lit. S. 95.97)
Fotos 2005: Hahn, Aufnahmedatum am "Tag des offenen
Denkmals", 11.9.2005)
| Der alte Betsaal / das
Schulgebäude in der Marumstraße |
|
 |
 |
 |
Im Gebäude
Marumstraße 20 (ehemaliges Haus der Familie Werner) befand sich
vor
Einweihung der Synagoge 1858 der Betsaal |
Erinnerung an die
Strumpffabrik Marum
in der Marumstraße |
| |
|
Historisches zur 1858
eingeweihten Synagoge |
 |
 |
| |
Innenansicht
der Synagoge |
Toravorhang aus Bad
Sobernheim, ausgestellt in
der ehemaligen Synagoge
in Meisenheim |
| |
|
|
Die ehemalige Synagoge
um 1980 |
 |
 |
| |
Links der ehemaligen Synagoge
befindet
sich noch der Anbau mit einer Einfahrt |
Möbellager im Inneren der
ehemaligen Synagoge |
| |
|
|
| Die ehemalige Synagoge 2005
- vor den Renovierungsarbeiten |
|
 |
 |
 |
Die Synagoge von Südwesten
gesehen,
links der Eingangsbereich |
Synagoge und Kirche
im
Gegenüber |
Die Synagoge von
Osten gesehen |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Ansicht von Nordosten |
Der 2002 aufgesetzte
Davidstern,
gestiftet von Nachkommen
der Familie Marum |
Der Stab für den alten
Davidsstern;
der Stern wurde von der Dachspitze
in der NS-Zeit
"abgeschossen" |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Der Eingangsbereich |
Die Portalinschrift, in der
Mitte auf hebräisch "Haus Gottes"; links die hebräische
Jahreszahl für 1858. |
Hinweistafel |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Im Bereich des Erdgeschosses |
Erster Stock auf Höhe der
Frauenempore |
Unter dem Dach |
| |
|
|
 |
 |
|
Zeichnung der alten
Gefallenengedenktafel,
die in der Pogromnacht 1938 zerschlagen
wurde
(siehe die Kopie der Tafel auf
dem Friedhof) |
Fotos und Namen der deportierten
Sobernheimer Juden im Bereich des
Toraschreines |
|
| |
| |
|
|
 |
 |
|
| Aufgefundene
Grabsteine. |
|
| |
|
Die ehemalige
Synagoge
im Juni 2008
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 27.6.2008) |
 |
 |
| |
Die
ehemalige Synagoge, von Osten (links) und Südwesten (rechts) gesehen |
| |
|
 |
 |
 |
| Eingang mit
der Portalinschrift |
Westliche Seite mit
Eingangsbereich |
| |
|
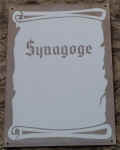 |
 |
 |
| |
Hinweistafel |
Der 2002 aufgesetzte
Davidstern |
| |
|
|
| |
|
|
Nach Abschluss
der Renovierungsarbeiten: die ehemalige Synagoge
am Tag der Eröffnung als "Kulturhaus Synagoge" am 31. Mai
2010
(Fotos: Hahn) |
|
 |
 |
 |
| Ansichten des
Gebäudes von Osten / Nordosten |
Ansicht von der
Gymnasialstraße |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick auf den
Eingangsbereich |
Hinweistafel "Kulturhaus
Synagoge" |
| |
|
|
 |
 |
|
| Das Eingangstor mit
Portalinschrift |
Das Davidstern auf dem
Gebäude |
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Ansichten des
Erdgeschosses des vor allem als Bücherei genützten "Kulturhauses
Synagoge" |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Auf Höhe der
früheren Frauenempore |
Über dem
ehemaligen Toraschrein:
Rundfenster mit Davidstern |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Blick auf den
ehemaligen Toraschrein |
Von der Familie Marum zur
Einweihung als
Kulturhaus zurückgegebene Torarolle |
Fotos von jüdischen
Einwohnern Sobernheims,
die in der NS-Zeit ermordet wurden |
| |
|
|
 |
 |
 |
Ein Harmonium, wie es bis 1938
auf
der Empore der Synagoge stand |
Modell der
ehemaligen Synagoge von Gottfried Kneib |
| |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Hoch verdient um die
Restaurierung der
ehemaligen Synagoge: Hans-Eberhard
Berkemann im
Gespräch |
|
| |
|
|
| |
|
|
Erinnerungen an die
Familie Marum |
 |
 |
| |
Straßenschild der
Marumstraße, in der sich bis heute die Gebäude der
ehemaligen
Strumpffabrik Marum befinden |
| |
|
|
 |
 |
 |
Der "Marum-Park",
ehemals Privatgarten der Familie Marum, dann der Stadt geschenkt mit einem
Gedenkstein für Arnold Marum,
gewidmet von seinen Eltern Alfred und
Amelie Marum (1952) |
| |
|
|
| |
|
|
Fotos vom August 2025
(erstellt von Dagmar Bluthardt) |
 |
 |
| |
Im Bereich der
ehemaligen Synagoge sind im Sommer 2025 umfangreiche Straßenbauarbeiten im
Gang |
| |
|
|
 |
 |

 |
| |
|
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte ab 2012
| 2014: Der
Sobernheimer Synagogen-Förderverein feiert 25-jähriges Bestehen |
Wir gratulieren Hans-Eberhard Berkemann
und dem Förderverein für die in diesen Jahren geleistete großartige
Arbeit!
Vgl. Artikel von Stefan Munzlinger in der "Rhein-Zeitung" vom
11. Januar 2014: "Vor 25 Jahren von Synagogen-Freunden gegründet:
Förderverein wurde anfangs auch skeptisch beäugt...."
Link
zum Artikel |
| |
| März 2016:
Förderverein Synagoge wird Arbeitskreis im
'Kulturforum Bad Sobernheim e.V.' |
Artikel von Wilhelm Meyer in der
"Allgemeinen Zeitung" (Bad Sobernheim) vom 2. April 2016: "Bad Sobernheim.
Förderverein Synagoge wird Arbeitskreis im 'Kulturforum Bad Sobernheim
e.V.'
BAD SOBERNHEIM - Seine Eigenständigkeit als 'Förderverein Synagoge Sobernheim
e.V.', so hatten die Teilnehmer der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober vergangenen Jahres beschlossen, sollte der Verein zugunsten eines Aufgehens im Kulturforum Bad Sobernheim e.V. aufgeben. Hintergrund dieser
'einschneidenden Veränderung', wie es der Fördervereinsvorsitzende Hans-Eberhard Berkemann in der Einladung geschrieben hatte, sei
'die Tatsache, dass die meisten Mitglieder des jetzigen Vorstandes aus Altersgründen bei der Neuwahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten
werden'..."
Link
zum Artikel |
Artikel von Wilhelm Meyer in der
"Allgemeinen Zeitung" vom 11. April 2016: "Förderverein wird zum
Arbeitskreis
BAD SOBERNHEIM - Nach 35-jährigem Bestehen hat sich der Förderverein
Synagoge als eigenständiger Verein aufgelöst. Als Arbeitskreis Synagoge im
Kulturforum allerdings wird er, befreit vom Formalen einer Vereinsführung,
seine Arbeit weiter verfolgen. Nach Erreichen seiner Hauptziele, so die
Hoffnung des früheren Fördervereinsvorsitzenden Hans-Eberhard Berkemann,
sieht er in der neuen Verortung eine weit größere Chance. Der Arbeitskreis
Priorhof im Kulturforum habe es vorgemacht, erläuterte dessen Vorsitzender
Uwe Engelmann in seiner Vorstellung der 'neuen Heimat' der Förderer. Auch
hier arbeitet eine von Vereinsformalien befreite Gruppe im Rahmen des
Kulturvereins mit großem Erfolg. Nicht anders der Arbeitskreis
Stadtgeschichte. Erstmals sei in einer Sobernheimer Chronik das jüdische
Leben der Stadt überhaupt wahrgenommen worden.
Ein Besuch von Dr. Frances Henry Anfang Juni ist dabei ein wegweisendes
Ereignis. Henry, Enkeltochter von Jakob und Johanna Ostermann, hat das Buch
'Nachbarn und Opfer', Erinnerungen an eine Kleinstadt (Sobernheim) im
Nationalsozialismus, geschrieben, das der Förderverein herausgegeben hat.
Sie bringt Briefe mit, die ihr Großvater aus Sobernheim den in Sicherheit
befindlichen Kindern, also auch ihren Eltern, geschickt hatte. Das tragische
Schicksal ihrer verbliebenen Großeltern, die schließlich in Theresienstadt
ermordet wurden, ist Teil der Sobernheimer Geschichte. Vieles ist noch
unerzählt, so hat ein Fund Berkemanns die Rolle des Sobernheimer
evangelischen Pfarrers in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Oder dass
das Katholische Pfarrhaus lange das Zentrum der Versorgung der jüdischen
Bevölkerung mit Fleisch gewesen sei.
HAUPTAKTEURE: Auf die neben dem Förderverein beim Erhalt der Synagoge
tätigen Hauptakteure machte Berkemann gesondert aufmerksam. Da sei das
Engagement des damaligen Bürgermeisters Hans-Georg Janneck zu nennen, das
Land, das den Großteil der Mittel beigesteuert und die evangelische Kirche,
die sich mit 30 000 Euro für die Restaurierung eingesetzt habe.
Der Jahresrückblick weitete sich zwar an manchen Stellen zu einer
Generalerinnerung, der Kassenbericht aber hatte nichts davon. Überprüft und
einwandfrei vorgefunden worden war Gottfried Kneibs Kasse von Ernst Fechter
und Dr. Hans-Gert Dhonau. Entsprechend einstimmig konnte die Entlastung
ausgesprochen werden. Das Vereinsvermögen war schon vorab zur Verwendung für
den AK Synagoge dem Kulturforum überwiesen worden. Hans-Peter Koch übernahm
den formalen Teil der Vereinsauflösung und die Wahl der Liquidatoren, zu
denen einstimmig Berkemann und Kneib gewählt wurden. Sie haben im Laufe des
folgenden Jahres die Vorstandsaufgaben zu erfüllen, bevor der Verein dann
endgültig erlöschen kann. Den Schlusspunkt setzte Bürgermeister Michael
Greiner. Den Dank der Stadt trug er vor, aber auch einen ganz persönlichen.
Die Begegnung mit der jüdischen Geschichte der Stadt, wie sie erst durch die
beharrliche Arbeit des Fördervereins sichtbar gemacht worden sei, habe auch
für ihn eine bedeutende Rolle gespielt."
Link zum Artikel |
| |
Februar
2020: Nachkommen der
jüdischen Familie Ostermann aus
Meddersheim/Bad Sobernheim besuchen den Ort
Anmerkung: zu Prof. Frances Henry vgl.
https://www.yorku.ca/fhenry/background.htm
Frances Henry ist als Franziska Ostermann im Frühjahr 1939 im Alter von
sieben Jahren in die USA emigriert. Mitte der 1970er-Jahre kam sie erstmals
zurück nach Sobernheim. Sie verfasste das Buch:
Frances Henry: Nachbarn und Opfer. Erinnerungen an eine Kleinstadt im
Nationalsozialismus. Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 1992. 256 S.
|
Artikel von Wilhelm Meyer in der "Allgemeinen
Zeitung" vom 4. Juni 2016:
"Auf der Suche nach den Wurzeln
BAD SOBERNHEIM/MEDDERSHEIM - Das wievielte Mal sie nun in Bad
Sobernheim gewesen ist, wisse sie gar nicht mal genau, erzählte Frances
Henry aus Toronto, in Deutschland als Franziska Ostermann geborene Jüdin,
bei ihrer Lesung im Tennensaal von Menschels Vitalresort. Aus den
Erfahrungen ihrer ersten beiden Besuche an der Nahe hat die bis in ihr
siebtes Lebensjahr in Bad Kreuznach aufgewachsene Autorin und emeritierte
Professorin der Anthropologie auf der Suche nach ihren Wurzeln ein Buch
geschrieben, das für die Geschichte Sobernheims von beträchtlicher Bedeutung
ist. Doch 'Nachbarn und Opfer' ist – auch wenn es die Geschehnisse
aufgezeichnet hat, wie sie die Sobernheimer Bewohner und die der Vernichtung
entkommenen ehemaligen jüdischen Sobernheimer ihr berichteten – nicht nur
Lokalgeschichte. 'Erinnerung an eine Kleinstadt im Nationalsozialismus', so
der Untertitel, weist auch auf das Exemplarische der von Henry zunächst in
Amerika publizierten Arbeit. Kein geringerer als Willy Brandt schrieb damals
das Vorwort.
Eltern des Vaters sterben in Theresienstadt. Die Lesung war der
Abschluss ihres Aufenthaltes an der Nahe und ein familiärer dazu. Einige
Zuhörer, frühere Meddersheimer oder Sobernheimer, waren zur Lesung von
weither angereist, und nicht wenige im Tennensaal hatten das kleine hübsche
Mädchen Franziska noch gekannt. Auf die Frage des Kreuznacher Pfarrers
Dietrich Humrich, ob ihre Eltern ihr damals von den Geschehnissen in
Deutschland erzählt hätten, antwortet Henry 'Nie, sie waren ja noch so
jung!' Im Gegensatz dazu hatten die von ihr für 'Nachbarn und Opfer'
Befragten in Sobernheim ausgiebig erzählt. In Deutschland wird Henry
begleitet von ihrer Freundin Irma Fechter, Mitglied des vormaligen
Fördervereins Synagoge, die heute in Bad Homburg lebt. Mit ihr und
Hans-Eberhard Berkemann hat Frances Henry in den drei Tagen ihres Besuchs
ein beachtliches Programm absolviert. Nicht zuletzt, um ihrer Enkelin Tianna,
die sie nach Deutschland begleitet hat, von den Wurzeln zu berichten, die
auch die ihren sind.
Henrys Vater, Arzt in Bad Kreuznach
(sc. Dr. Wilhelm/William Ostermann, 1902-1972), ist in Meddersheim
geboren, wie mehrere weitere Verwandte auch. Die Großeltern Jakob und
Johanna Ostermann (sc. Johanna Ostermann geb. Mayer aus
Staudernheim) lebten in
Sobernheim (sc. Wilhelmstraße 11)
und waren Ziel so vieler Besuche ihrer Enkelin. Ihnen war es nicht mehr
gelungen, aus Nazi-Deutschland zu fliehen. Sie gehörten schließlich zu den
nach Theresienstadt Deportierten. Ihre Großmutter, schon altersschwach und
gebrechlich, starb bald danach. Ihr Großvater, ein kräftiger starker Mann,
habe wohl noch über ein Jahr weitergelebt. Das Mädchen konnte 1939 mit ihren
Eltern in die USA fliehen. Für die Geschichte Sobernheims bedeutende
Dokumente hatte Henry dabei und übergab sie Berkemann für das Archiv: Briefe
ihres Großvaters. Noch ist der Einblick in das Leben ihrer Sobernheimer
Großeltern, den die hier übergebenen Briefe gewähren, nicht abzuschätzen.
Sütterlinschrift und eine zunehmende Entfernung von der deutschen Sprache
haben es der Enkelin bislang verwehrt, zu erfahren, was ihr Großvater im
Jahr 1941 aus Sobernheim nach Amerika zu den glücklich geretteten Verwandten
geschrieben hat. Ein hoffnungsvoller Programmpunkt dieser Tage war ein
Gespräch in der ehemaligen Sobernheimer Synagoge. 53 Kinder der
Lichtigfeld-Schule in Frankfurt füllten den Raum. Nicht der erste Besuch war
es für Lea Wolf und Sigal Markhoff, die, wenn sie mit Schülern im Jüdischen
Erholungsheim sind, einen Besuch in der Bad Sobernheimer Synagoge nie
auslassen. Doch für beide war es diesmal etwas ganz Besonderes. Hatten ihre
Eltern doch ein gleiches Schicksal, Exil, erfahren, wie Frances Henry, die
mit sieben Jahren ohne ein Wort Englisch zu können, in New York ihr Schiff
verließ. Erschrocken musste Henry bei ihrem Besuch in Bad Sobernheim sehen,
wie das ehedem schöne Haus ihrer Großeltern in der Wilhelmstraße verfällt. "
Link zum Artikel
. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Germania Judaica II,2 S. 768; III,2 S. 1374-1376. |
 | Informationsblätter des Fördervereins Synagoge Sobernheim e.V. |
 | Frances Henry: Nachbarn und Opfer - Erinnerungen an eine Kleinstadt
im Nationalsozialismus. Mit einem Vorwort von Willy Brandt. Hrsg. vom Förderverein
Synagoge Sobernheim. Bonn 1992. 256 S. |
 | Hans-Eberhard Berkemann: Gedenkfeier zum 50.
Jahrestag der letzten Deportation aus Sobernheim am 26. Juli 1992.
Gedenkgottesdienst vom 26. Juli 1992 in der Matthias-Kirche. Bericht zu den
Ereignissen am 26. Juli 1942. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach 4. Jahrgang. Ausgabe 2/1994 Heft Nr. 7 S. 24-28. Online
eingestellt (pdf-Datei). |
 | ders.: Der Innenraum der
Sobernheimer Synagoge. Zum Gemälde von Hans Marum. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 4. Jahrgang Ausgabe 3/1994 S. 42-43. Online
eingestellt (pdf-Datei). |
 | Chanan Peled, vormals Hans-Hermann Feibelmann:
Meine Kindheit im III. Reich, das Novemberpogrom von 1938 und meine Flucht
aus Deutschland. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 8. Jahrgang
Ausgabe 2/1998 Heft Nr. 16. S. 35-37. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Hans-Eberhard Berkemann: 60 Jahre Novemberpogrom in
Bad Sobernheim. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 8. Jahrgang
Ausgabe 2/1998 Heft Nr. 16. S. 35-37. Online
zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 95-97 (mit weiteren Literaturangaben). |
 | Einzelne Presseartikel aus der "Allgemeinen
Zeitung" (siehe Berichte auf einer weiteren
Seite) |
 | 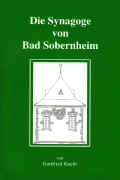 Gottfried
Kneib: "Die Synagoge von Bad Sobernheim". Erschien
2013. Gottfried
Kneib: "Die Synagoge von Bad Sobernheim". Erschien
2013.
Erhältlich
gegen eine Spende beim Förderverein Synagoge. Tel. 06751-3795.
Sonderdruck aus dem "Jahrbuch für westdeutsche
Landesgeschichte". Schriftenreihe des Landeshauptarchivs in
Koblenz.
Vgl. Presseartikel: "Die spannende Geschichte der Sobernheimer
Synagoge" in "Rhein-Zeitung" vom 24.1.2013. Link
zum Artikel. |
 | Martin Geisz: Harmonium – Instrumente in Synagogen – Musik für Harmonium in
Synagogen. Mettlach: Arbeitskreis Harmonium in der Gesellschaft der
Orgelfreunde. November 2015. Beitrag
ist eingestellt (pdf-Datei).
Der Autor Martin Geisz zeigt anhand einiger Beispiele, daß das Harmonium auch zum jüdischen Kulturerbe gehört. Harmoniums waren von 1810 bis zur Reichsprogromnacht am 9./10. November 1938 in verschiedenen Synagogen jüdisch-reformierter Gemeinden als einziges Begleitinstrument oder zusätzlich zur Orgel vorhanden. Anhand einiger Beispiele wird die Geschichte und Nutzung der Harmoniums in Synagogen nachgezeichnet, daneben gibt der Autor zahlreiche Hinweise zu Komponisten und Literatur dieses Repertoires.
Erschienen im November 2015. Das Harmonium in Bad Sobernheim wird
ausführlich vorgestellt. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Sobernheim
Rhineland. Jews are first mentioned in
1336 and were victims of the Black Death persecutions of 1348-49. Settlement was
soon renewed, with Jews earning their livelihoods as moneylenders, wine and
textile merchants, and livestock traders. In 1808 a local Jew was chosen as a
deputy to the Assembly of Jewish Notables in Paris. A synagogue was consecrated
in 1859 but the community remained under the jurisdiction of the Bad Kreuznach
regional congregation, only becoming independent in 1926. A Jewish elementary
school was in operation by 1840. During the 19th century, Jews began opening
stores and business establishments, mainly dealing in textiles. One store became
the largest department store in the town and a small, domestic sock-knitting
business, started by Sarah Maron, a widow with nine children, became a huge
family enterprise employing 800 workers. The Jewish population was 131 in 1843
and 109 (total 3,479) in 1905. In 1888, a Jew was first elected to the municipal
council. Afterwards, Jews also served as deputy mayors (mostly members of the
wealthy Marom family). The Zionists were active between the World Wars but the
majority of the community did not identify with the movement. In religion, most
were Liberal (15 % being considered Orthodox). Harmonious relations generally
prevailed with the non-Jewish population. These, however, eroded somewhat during
the Weimar period.
In the March 1933 Reichstag elections, 42 % of the local vote went to the Nazi
Party. In 1933, the 34 families in Sobernheim owned 19 businesses. All were
subjected to boycott pressures and most closed in 1935-36, the last of them in
1938 (including the Marom factory, sold at the end of the year) along with homes
and land still in Jewish hands. Social ostracization accompanied the boycott as
Jews were insulted, spat upon, and beaten in the streets. Only a small minority
continued to help the Jews. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the
synagogue and Jewish homes were seriously damaged and the Jewish cemetery was
desecrated. The last 13 Jews were moved to five houses and in spring and summer
1942 deported to the east where they died. Of the 150 Jews present in Sobernheim
in the Nazi period, 76 emigrated (46 to the United States) while 23 left for
other German cities. At least 31 perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|