|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Wilhelmshaven mit
Bant und Rüstringen (Niedersachsen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Wilhelmshaven, einer nach 1853 angelegten Hafenstadt (Stützpunkt der
Preußischen Marine an der Nordsee, seit 1869 Wilhelmshaven genannt), zogen um
1870 erste jüdische Personen zu. Sie ließen sich in Wilhelmshaven und dem
unmittelbar benachbarten Rüstringen nieder. Ihre Zahl wuchs in den folgenden
Jahrzehnten an (1876 10, 1885 47, 1910 131, 1925 239). Zunächst benutzte man die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde
in Neustadtgödens. Ein offizieller Vertrag
zwischen der "Wilhelmshavener Gruppe" und der Gemeinde Neustadtgödens wurde Anfang 1876 abgeschlossen. Die Zuständigkeit für die
beiden preußischen
Gemeinden (Neustadt-Gödens und Wilhelmshaven) lag seitdem beim Landrabbinatsbezirk
Emden.
Um 1895 erklärten sich die Wilhelmshavener Juden zur "Israelitischen
Vereinigung Wilhelmshaven" und traten 1899 geschlossen aus der
Gemeinde Neustadt-Gödens aus. Die offizielle Gründung einer selbständigen
"Synagogen- und Religionsschulgemeinde mit dem Sitze Wilhelmshaven"
war am 1. April 1901. Die ersten beiden Gemeindevorsitzenden waren Louis
Leeser (bis mind. 1904) und Jacob Müller (1908-1919).
In dem 1911 zunächst nach Rüstringen eingemeindeten heutigen Wilhelmshavener
Stadtteil Bant war 1905 gleichfalls
eine jüdische Gemeinde gegründet worden. Bei der Sitzung des Jüdischen
Landesgemeinderates in Oldenburg im April
1905 wurde Bant als selbständige Gemeinde bestätigt (siehe Bericht unten). Bis
spätestens 1908 fusionierte die jüdische Gemeinde in Bant mit der Gemeinde in
Wilhelmshaven zur Israelitischen Gemeinde Wilhelmshaven-Bant (siehe
Ausschreibung der Lehrerstelle unten von 1908). Nach Eingemeindung von Bant nach
Rüstringen nannte sich die Gemeinde Synagogengemeinde
Wilhelmshaven-Rüstringen (siehe Ausschreibung der Lehrerstelle von
1929).
An Einrichtungen gab es einen Betsaal, seit 1915 eine Synagoge (s.u.),
eine Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der jüdischen Gemeinde
wurden bis 1908 in Jever, seitdem auf einem
eigenen Friedhof in
Schortens-Heidmühle beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Max Frühauf
(geb. 16.2.1883 in Walldorf, Werra, gef. 4.6.1917) und Karl Weinberg (geb.
17.2.1890 in Sögel, gef.
29.9.1918).
Mitte der 1920er-Jahre lebten in Wilhelmshaven
ca. 100 jüdische Personen, in Rüstringen (mit Bant) gleichfalls etwa 100
Personen. Dem Gemeindevorstand Wilhelmshaven gehörten Julius Margoniner
(Vorsitzender von 1919-1925),
Leo Bein und Jacob Strauß an; die Juden von Rüstringen hatten mit Max Jakobs
und den Herren Nissenfeld und Pfeffer noch eigene Vorstände. Leo Bein war nach
Julius Margoniner von 1925-1931 erster Gemeindevorsitzender. Als Lehrer und
Schochet war Max Ruda für beide Teilgemeinden angestellt. Er unterrichtete an
der "Israelitischen Religionsschule" zwölf Kinder und hielt den
jüdischen Religionsunterricht am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium der Stadt. Zwei
jüdische Vereine hatten sich inzwischen gebildet: die Wohltätigkeitsvereine Chewra
Kadischa (gegr. 1902) und der Jüdische Frauenverein (gegr. 1906). Später
kamen noch ein "Jugendbund" und ein "Literaturverein" dazu.
Anfang der 1930er-Jahre hatte die Gemeinde Wilhelmshaven-Rüstringen inzwischen
einen gemeinsamen Vorstand. Erster Vorsitzender war Jonas Fränkel, 2.
Vorsitzender Hermann Müller, 3. Vorsitzender A. Paul. Der Repräsentanz
gehörten an: S. Gunst, A. Gutenberg. Lehrer und Kantor war Herrmann Hartogsohn. Die
jüdischen Familien hatten eine nicht unbedeutende Stellung im wirtschaftlichen
Leben der Stadt. Anfang der 1930er-Jahre waren unter den jüdischen Einwohnern
70 Kaufleute, Händler oder in diesem Berufsbereich Angestellte, acht
Schlachter, ein Konditor, ein Apotheker, ein Soldat, ein Theaterdirektor, drei Landwirte,
ein Schneidermeister u.a.m. Die knapp 50 kleinen und großen Geschäfte der
jüdischen Gewerbetreibenden waren schwerpunktmäßig in den Einkaufsbereichen
Gökerstraße/Bismarckplatz und Marktstraße/Wilhelmshavener Straße
angesiedelt.
1933 lebten noch 191 jüdische Personen in der Stadt. Die zunehmende
Bedrückung und Entrechtung sowie der wirtschaftliche Boykott führten dazu,
dass bis 1938 etwa 100 Juden die Stadt verließen. Beim Novemberpogrom 1938
wurden die bis dahin noch bestehende jüdische Geschäfte sowie jüdische
Wohnhäuser verwüstet oder zerstört. Zahlreiche der jüdischen Einwohner
wurden aus den Wohnungen geholt, misshandelt und durch die Straßen zur
damaligen "Jahn-Halle" getrieben. Einigen wurden Pappschilder mit der
Aufschrift "Ich bin eine Judensau!" umgehängt. Zuschauer warfen mit
Steinen auf die Gruppe oder bespuckten sie. 34 Männer wurden über Oldenburg in
das KZ Sachsenhausen gebracht und dort wochenlang festgehalten. Bis Mai 1939
konnten weitere 45 jüdische Einwohner der Stadt emigrieren. Die noch Verbliebenen wurden in den folgenden Jahren deportiert und ermordet.
Von den in Wilhelmshaven geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Adele Bachrach geb. Pels
(1892), Simon Salomon Bäumer (1904), Fritz Behnel (), Clara ter Berg geb. Voß
(1878), Levie ter Berg (1882), Rita Sophie ter Berg (1906), Marianne Berliner
geb. Cohen (1870), Moses Salomon Lazarus Berliner (1882), Marek Brenner (geb. ca. 1930),
Leib Charytan (1889),
Rachel Charytan geb. Stelzer (1889), Martha Cibulski geb. Wolf (1909),
Henny Citrin geb. Bertenthal (1890), Leo (Luser) Citrin (geb. 1890), Artur Cohen
(1901), Bernhard Cohen (1868), Hannelore Cohen (1935), Ilse Cohen geb. Schirling
(1907), Ingrid Cohen (1929), Johanna Cohen geb. Juchenheim (1858), Moritz Cohen
(1880), Philipp Cohen (1888), Ida Ehrlich geb. Schönwetter (1913), Silvia Eichenbronner geb. Neu
(1898), Julius Feilmann (1900), Max Feybusch (1877), Ignaz Fränkel (), Jenni Fränkel
(1880), Jonas Fränkel (1874), Karl-Heinz Fränkel (1922), Julie Friede (1862),
Herta Frost geb. Voss (1913), Salomon Gazan (1904), Erna Goldberg (1909), Reta
Goldberg (1910), Reha Ruth Goldmann (1931), Margarete Goldstein (1902), Lotte
Gottschalk (1911), Jacob Grünbaum (1861), Lea Grünbaum geb. Levy (1871), Lipot Haasz
(1899), Henny Hartog geb. Scheuer (1897), Hermann Hartog (1887), Iwan
Hess (1893), Leo Hirschberg (1898), Lucie Hirschberg (1925),
Lotte (Slata, Slate) Hirschberg geb. Findling (1896), Friedrich Hoffmann (1899),
Jenny Janover geb. Leffmann (1870), Saul Janover (1865), Zita Leczes (1921),
Arno Jonge (1903), Bertha Juchenheim (1859), Veronica Kariel geb.
Cleffmann (1892), Johanna Kannenberg geb. Wohl (1878), Ludwig Kariel (1899), Mary Lauenger
(1922), Moritz Lauenger (), Kurt Leeser (1899), Nina Leeser (1895), Else
Leffmann (), Goldine Levie (1881), Marie Levie (1880), Martha Rahel Levy geb. Schwabe
(1885), Johanna Lowitz geb. Rubens (1907), Walter Lowitz (1904), Antonie Magnus
(1921), Gottlieb Magnus (1883), Margarete Magnus geb. Schiff (), Siegfried Margoniner
(1880), Anni Mayer geb. Oberschützky (1898), Emilie Mehnen geb. Schmolka (1887),
Walter Menkel (1890), Hermann Müller (1884), Grete Nissenfeld (1908), Minna
Anna Obermeier geb. Rosenthal (1882), Käthe Paul (1905), Chaja Pfeffer geb. Citrin
(Cytrin, 1886), Erna Pfeffer (1913), Salomon Pfeffer (1882), Rosalie Pinto geb. Juchenheim
(1864), Gisela Polak geb. Kornblum (1905), Moses Roseboom (1906), Walter Roseboom
(1901), Clara (Klara) Sagan geb. Brock (1883), Moses Sagan (1882), Frida Salomons geb. Vohs
(1911), Adolf
Scheuer (1867), Robert Scheyer (1884), Frieda Schirling geb. Stern (1881), Fanny
Silberberg geb. Bargebuhr (1877), Elieser Stern (1877), Jacob Strauss (1872), Hulda Strauss geb. Eichberg
(1875), Ernst de Taube (1889), Frieda de Taube geb. ter Berg (1912), Ella
Verständig geb. Reisner (1902), Hannelore Verständig (1936), Hermann (Hersch) Verständig
(1901), Luise Verständig (1931), Thekla Voß geb. Hecht (1887), Henny Waldmann
(1884), Friederike Weinberg (1892), Alfred Wohl (1885), Ella Wohl (1890), Julius Wohl
(1876), Blüma Wolf geb. Seelenfreund (1877), Jenny Wolf (1907), Moses Wolf
(1877), Berta Zabner geb. ter Berg (1909), Hildegard Zabner (1929), Moschek
Josek Zabner (1899), Hermann Zander (1917), Karl Zilversmit (1888).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1897 /
1908 / 1929
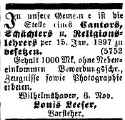 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1896: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. November 1896:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines Kantors, Schächters und
Religionslehrers per 15. Januar 1897 zu besetzen.
Gehalt 1.000 Mark ohne
Nebeneinkommen. Bewerbungsschreiben, Zeugnisse sowie Photographie erbeten.
Wilhelmshaven, 6. November (1896).
Louis Leeser, Vorsteher." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober 1908: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober 1908:
"Die
hiesige Religions-Lehrer, Kantor und Schächterstelle
ist möglichst bald
zu besetzen. Das fixe Gehalt beträgt p.a. 2.000 Mark, außerdem
erhebliche Nebeneinnahmen aus Schechita etc. Bewerber mit guten
Stimmmitteln wollen ihre Gesuche mit Zeugnisabschriften möglichst
umgehend an den unterzeichneten Vorstand richten. Reisekosten werden
vergütet.
Israelitische Gemeinde Wilhelmshaven-Bant, Jacob Müller, Wilhelmshaven." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1929:
"In unserer Gemeinde ist die Stelle eines
Religionslehrers, Kantors
und Schochets
zum 1. Oktober zu besetzen. Die Gehaltsfrage wird nach
stattlichen Grundsätzen geregelt. Als Bewerber kommen reichsdeutsche,
orthodoxe, jüngere, verheiratete Herren in Frage. Wir bitten um
lückenlose Offerten mit Zeugnisabschriften. Referenzen und Bild
einzureichen.
Der Vorstand der Synagogengemeinde
Wilhelmshaven-Rüstringen. Leo
Bein." |
Hinweis auf den Lehrer Siegfried Wetzler
(1880-1942)
Anmerkung: der Lehrer Siegfried Wetzler wurde am 4. Juni 1880 in Binswangen geboren. Er hatte noch
elf Geschwister. Als Kantor, Schochet (Schächter) und Lehrer zog sein Vater Moses
Wechsler 1883 mit der Familie nach Kronach. 1921 setzten sich die Eltern zur Ruhe und zogen zu ihrem Sohn Max nach Frankfurt.
Max' Sohn Rudi gehörte der Reichsbannerbewegung an, die sich schon früh den Nazis widersetzte. 1934 floh er nach Amerika. Max war der Vater der bekannten amerikanischen Liedermacherin und Folkloresängerin Laura Wetzler, die vor allem auch jüdische Lieder aus aller Welt singt. Sie besuchte mehrmals Deutschland und trat u.a. in Kronach auf – in Erinnerung an ihren Urgroßvater Moses Wetzler. Einige der 12
'Wetzler-Kinder' überlebten den Holocaust, andere nicht, darunter auch Siegfried.
Siegfried Wetzler heiratete Rebekka geb. Danziger (geb. 6. Oktober 1886 in
Hassfurt). Er wurde Lehrer wie sein Vater und lebte zunächst in
Wilhelmshaven. Hier war er
möglicherweise ab 1908/09 (vgl. Stellenausschreibung oben vom 1. Oktober 1908).
In der Zeit des Ersten Weltkrieges war er zum Kriegsdienst eingezogen; an seiner
Stelle wurde in Wilhelmshaven der ungarische Lehrer Jakob Teßler
vertretungsweise für Siegfried Wetzler angestellt. Danach war Wetzler in Aurich
tätig. Aus dem Jahr 1925 liegt ein Dokument des Gymnasiums Ulricianum Aurich
vor, wonach sich Lehrer Wetzler Ende August 1925 über antisemitische
Übergriffe von Mitschülern gegen seiner Sohn beschwerte. Nach der Zeit in
Aurich wirkte Siegfried Wetzler seit 1926 in Frielendorf,
dann in Königstein (siehe weitere
Informationen in der Seite zu Königstein).
In der NS-Zeit wurde Siegfried Wetzler am 11. Juni 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert, seine Frau Rebekka am 6. November 1942 mit Transport 901/36.
Beide wurden ermordet.
Lehrer Max Ruda erhält einen Ruf als Religionslehrer und Kantor in Zürich
(1929)
Anmerkung: Max Ruda war nach seiner Zeit in Wilhelmshaven von 1929 bis 1972
Lehrer und Kantor (Chason) bei der Israelitischen
Religionsgesellschaft Zürich.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,
5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer
Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer
und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit
lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge
leistet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,
5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer
Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer
und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit
lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge
leistet." |
Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Sitzung
des Jüdischen Landesgemeinderates in Oldenburg mit Bestätigung einer
selbständigen Gemeinde in Bant (1905)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
April 1905: "Oldenburg (Großherzogtum), 16. April (1905). Die
diesjährige Sitzung des Jüdischen Landesgemeinderates, der man, wie
immer, in allen Gemeinden mit großem Interesse entgegensah, fand am 9.
dieses Monats statt. Der Vorsitzende, Landrabbiner Dr. Mannheimer,
eröffnete die Sitzung mit einer bemerkenswerten Ansprache an die
Vertreter der Gemeinden. Er betonte den Segen, der durch die Einrichtung
eines Landesgemeinderates für unsere jüdischen Gemeinden erwachse, indem
durch diese Selbstverwaltung auf breitester Grundlage die Gemeinden in der
Lage seien, alle Angelegenheiten unter sich zu ordnen, ohne, wie dies in
Preußen der Fall sei. Regierungsorgane oft mit unerquicklichen
Angelegenheiten zu behelligen. Deshalb bat der Vorsitzende die Vertreter,
auch die Meinungen und Ansichten etwaiger Gegner innerhalb der Gemeinden
wohlwollend zu behandeln, da Gegenansichten absolut nichts schaden, es
müsse nur alles vermieden werden, Gemeindeangelegenheiten in
öffentlichen Zeitungen auszutragen, nur so könne dem Antisemitismus der
Boden entzogen werden. Darum sei auch er als Vorsitzender stets bereit, im
Landesgemeinderate diesem Prinzip zu huldigen. Von den Vorlagen wurde vor
allem die seit einigen Jahren schwebende Frage 'Bant als eigene
Gemeinde mit einer Vertretung im Landesgemeinderate zu errichten',
endgültig gelöst. Da der Vorsitzende im Namen des Staatsministeriums die
Genehmigung zusagen konnte, so wurde Bant mit 27 jüdischen
Familien einstimmig als eigene Gemeinde proklamiert. Nachdem ferner der
Landesgemeinderat in geheimer Sitzung Herrn Landesrabbiner Dr. Mannheimer
in dessen Abwesenheit eine erhebliche Gehaltserhöhung bewilligte,
erklärte der Landrabbiner bei seinem Wiedererscheinen, dass er von nun ab
auf sämtliche im § 24 d. Gs. Beschl. festgelegten Gebühren für
Trauungen, Beerdigungen und Geburtsscheine verzichte, damit er voll und
ganz rein ideal in Freud und Leid seinen Gemeinden als Seelsorger zur
Seite stehen könne. Diese Erklärung machte auf alle Anwesenden einen
erhebenden Eindruck. Zum Delegierten für den Gemeintag wurde der
Vorsitzende für die Synagogengemeinden der Herzogtümer bestimmt. Der
Vorstand einer Gemeinde hatte beschlossen, am Sabbat und an den Feiertagen
beim Hauptgottesdienste nur solche selbständigen Herren zur Tora
aufzurufen, welche einen Zylinderhut tragen. Gegen diesen Beschluss war
eine Petition von einem Gemeindemitglied an den Landesgemeinderat
eingereicht worden, welche auf Aufhebung dieses Beschlusses hinzielte. Die
Petition wurde abgelehnt; im Gegenteil man fand dies Verlangen des
betreffenden Vorstandes sehr zeitgemäß und nachahmenswürdig. Nach
einigen anderen Vorlagen und nach der Verteilung des Staatszuschusses und
den Bewilligungen für Kultus- und Unterrichtszwecke wurde die Versammlung
geschlossen, auf die ein gemeinsames Essen folgte."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
April 1905: "Oldenburg (Großherzogtum), 16. April (1905). Die
diesjährige Sitzung des Jüdischen Landesgemeinderates, der man, wie
immer, in allen Gemeinden mit großem Interesse entgegensah, fand am 9.
dieses Monats statt. Der Vorsitzende, Landrabbiner Dr. Mannheimer,
eröffnete die Sitzung mit einer bemerkenswerten Ansprache an die
Vertreter der Gemeinden. Er betonte den Segen, der durch die Einrichtung
eines Landesgemeinderates für unsere jüdischen Gemeinden erwachse, indem
durch diese Selbstverwaltung auf breitester Grundlage die Gemeinden in der
Lage seien, alle Angelegenheiten unter sich zu ordnen, ohne, wie dies in
Preußen der Fall sei. Regierungsorgane oft mit unerquicklichen
Angelegenheiten zu behelligen. Deshalb bat der Vorsitzende die Vertreter,
auch die Meinungen und Ansichten etwaiger Gegner innerhalb der Gemeinden
wohlwollend zu behandeln, da Gegenansichten absolut nichts schaden, es
müsse nur alles vermieden werden, Gemeindeangelegenheiten in
öffentlichen Zeitungen auszutragen, nur so könne dem Antisemitismus der
Boden entzogen werden. Darum sei auch er als Vorsitzender stets bereit, im
Landesgemeinderate diesem Prinzip zu huldigen. Von den Vorlagen wurde vor
allem die seit einigen Jahren schwebende Frage 'Bant als eigene
Gemeinde mit einer Vertretung im Landesgemeinderate zu errichten',
endgültig gelöst. Da der Vorsitzende im Namen des Staatsministeriums die
Genehmigung zusagen konnte, so wurde Bant mit 27 jüdischen
Familien einstimmig als eigene Gemeinde proklamiert. Nachdem ferner der
Landesgemeinderat in geheimer Sitzung Herrn Landesrabbiner Dr. Mannheimer
in dessen Abwesenheit eine erhebliche Gehaltserhöhung bewilligte,
erklärte der Landrabbiner bei seinem Wiedererscheinen, dass er von nun ab
auf sämtliche im § 24 d. Gs. Beschl. festgelegten Gebühren für
Trauungen, Beerdigungen und Geburtsscheine verzichte, damit er voll und
ganz rein ideal in Freud und Leid seinen Gemeinden als Seelsorger zur
Seite stehen könne. Diese Erklärung machte auf alle Anwesenden einen
erhebenden Eindruck. Zum Delegierten für den Gemeintag wurde der
Vorsitzende für die Synagogengemeinden der Herzogtümer bestimmt. Der
Vorstand einer Gemeinde hatte beschlossen, am Sabbat und an den Feiertagen
beim Hauptgottesdienste nur solche selbständigen Herren zur Tora
aufzurufen, welche einen Zylinderhut tragen. Gegen diesen Beschluss war
eine Petition von einem Gemeindemitglied an den Landesgemeinderat
eingereicht worden, welche auf Aufhebung dieses Beschlusses hinzielte. Die
Petition wurde abgelehnt; im Gegenteil man fand dies Verlangen des
betreffenden Vorstandes sehr zeitgemäß und nachahmenswürdig. Nach
einigen anderen Vorlagen und nach der Verteilung des Staatszuschusses und
den Bewilligungen für Kultus- und Unterrichtszwecke wurde die Versammlung
geschlossen, auf die ein gemeinsames Essen folgte." |
Gründung einer (sc. zionistischen) Ortsgruppe (1905)
 Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 17. Mai 1905: "Wilhelmshaven. Nach einem Vortrage des
Fräulein Berliner - Hannover, wurde hier eine Ortsgruppe
gegründet". Mitteilung im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 17. Mai 1905: "Wilhelmshaven. Nach einem Vortrage des
Fräulein Berliner - Hannover, wurde hier eine Ortsgruppe
gegründet". |
Gründung eines jüdischen Literaturvereines (1920)
 Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1920:
"Wilhelmshaven, 15. Mai. In hiesiger jüdischer Gemeinde wurde ein
Literaturverein gegründet, der bereits 60 Mitglieder zählt. Als erster
Vorsitzender wurde Herr Lehrer Siegfried Wetzler gewählt." Meldung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1920:
"Wilhelmshaven, 15. Mai. In hiesiger jüdischer Gemeinde wurde ein
Literaturverein gegründet, der bereits 60 Mitglieder zählt. Als erster
Vorsitzender wurde Herr Lehrer Siegfried Wetzler gewählt." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von Schlachtermeister S. Vohs (1901)
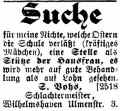 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901: "Suche Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1901: "Suche
für meine Nichte, welche Ostern die Schule verlässt (kräftiges
Mädchen), eine Stelle als Stütze der Hausfrau, es wird
mehr auf gute Behandlung als auf Lohn gesehen.
S. Vohs, Schlachtermeister,
Wilhelmshaven, Ulmenstraße 3." |
Verlobungs- und Heiratsanzeige von Irma Schirling und
Arthur Cohen (1928)
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 6. Januar 1928:
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 6. Januar 1928:
"Irma Schirling - Arthur Cohen
Verlobte
Hoof - Wilhelmshaven".
|
| |
 Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 21. Dezember 1928:
Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen
und Waldeck"
vom 21. Dezember 1928:
"Arthur Cohen Irma Cohen geb. Schirling
Vermählte
Wilhelmshaven-R. Hoof bei Kassel
Trauung in Hoof am 25. Dezember
1928". |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst besuchte man die Gottesdienste in Neustadtgödens.
Spätestens seit 1897 bestand ein eigener Betsaal beziehungsweise
eine Synagoge in einem gemieteten Raum.
Die Synagoge in Wilhelmshaven war auch für die jüdischen Soldaten der Stadt
(insbesondere die Marinesoldaten) als Ort des Gottesdienstes wie auch der
Eidesleistung bestimmt:
Vereidigung der Rekruten in der Synagoge (1903)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: "Wilhelmshaven,
im November (1903). Seit Bestehen der Gemeinde fand in diesem Jahre zum
ersten Male die Vorbereitung zur Eidesleistung der jüdischen Rekruten in
der hiesigen Synagoge statt. Die Rekruten wurden von Vorgesetzten zum
Gottesdienste geführt. Dem Gottesdienste wohnten Vertreter der Behörde
und die ganze Gemeinde bei. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November 1903: "Wilhelmshaven,
im November (1903). Seit Bestehen der Gemeinde fand in diesem Jahre zum
ersten Male die Vorbereitung zur Eidesleistung der jüdischen Rekruten in
der hiesigen Synagoge statt. Die Rekruten wurden von Vorgesetzten zum
Gottesdienste geführt. Dem Gottesdienste wohnten Vertreter der Behörde
und die ganze Gemeinde bei.
Das Schreiben der Marinebehörde, worin dem Ersuchen zur Abhaltung des
Gottesdienstes Folge geleistet wird, hat folgenden Wortlaut: 'Kommando d.
R. B. etc. Wilhelmshaven, 21. Oktober 1903. Auf das gefällige
Schreiben vom 14. dieses Monats. Die Vereidigung der Oktoberrekruten
findet am 24. dieses Monats statt. Die Rekruten jüdischen Glaubens 1) von
der zweiten Matrosendivision und 2) von der Stammkompanie des dritten
Seebataillons werden Anweisung erhalten, sich am 23. dieses Monats,
vormittags 10 Uhr zur kirchlichen Vorbereitung in der Synagoge
einzufinden.
Von Seiten des Stationskommandos. Der Chef des Stabes: Paschen.
An Herrn Lehrer und Prediger S. Meyer hier, Börsenstraße
16." |
Die jüdischen Soldaten in Wilhelmshaven sind zum Gottesdienstbesuch kommandiert
(1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904:
"Wilhelmshaven. Der 'Deutschen Israelitischen Zeitung' wird
von hier geschrieben: Weitere jüdische Kreise mag wohl die Tatsache
interessieren, dass seit einigen Wochen die jüdischen Mannschaften
hiesiger Garnison regelmäßig jeden Sabbat zum Gottesdienst kommandiert
und auch während des ganzen Tages vom Dienste dispensiert sind. Auf eine
diesbezügliche Eingabe des Predigers Herrn S. Meyer, hier, wurde
demselben folgender Kommandanturbefehl seitens des Kaiserlichen Kommandos
zugesandt. Kommandanturbefehl Nr. 21. Dienstag, den 26. Januar 1904.
Parole für Donnerstag: Paris. Offizier vom Ortsdienst: Lt. z.S. Jürst.
Israelitischer Gottesdienst: Anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät
des Kaisers findet in der Synagoge hier - Börsenstraße 3 - am Mittwoch,
den 27. dieses Monats, vormittags 9 1/2 Uhr, jüdischer Festgottesdienst
statt. ferner findet an jedem Samstag, vormittags 8 1/2 Uhr, jüdischer
Gottesdienst statt. Den Mannschaften jüdischen Glaubens ist Gelegenheit
zur regelmäßigen Teilnahme des Gottesdienstes zu geben. Beauftragt mit
Wahrnehmung der Geschäfte des Festungskommandanten. In Vertretung: gez.
Scheder, Kontre-Admiral."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. März 1904:
"Wilhelmshaven. Der 'Deutschen Israelitischen Zeitung' wird
von hier geschrieben: Weitere jüdische Kreise mag wohl die Tatsache
interessieren, dass seit einigen Wochen die jüdischen Mannschaften
hiesiger Garnison regelmäßig jeden Sabbat zum Gottesdienst kommandiert
und auch während des ganzen Tages vom Dienste dispensiert sind. Auf eine
diesbezügliche Eingabe des Predigers Herrn S. Meyer, hier, wurde
demselben folgender Kommandanturbefehl seitens des Kaiserlichen Kommandos
zugesandt. Kommandanturbefehl Nr. 21. Dienstag, den 26. Januar 1904.
Parole für Donnerstag: Paris. Offizier vom Ortsdienst: Lt. z.S. Jürst.
Israelitischer Gottesdienst: Anlässlich des Geburtstags Seiner Majestät
des Kaisers findet in der Synagoge hier - Börsenstraße 3 - am Mittwoch,
den 27. dieses Monats, vormittags 9 1/2 Uhr, jüdischer Festgottesdienst
statt. ferner findet an jedem Samstag, vormittags 8 1/2 Uhr, jüdischer
Gottesdienst statt. Den Mannschaften jüdischen Glaubens ist Gelegenheit
zur regelmäßigen Teilnahme des Gottesdienstes zu geben. Beauftragt mit
Wahrnehmung der Geschäfte des Festungskommandanten. In Vertretung: gez.
Scheder, Kontre-Admiral." |
Der Bau und die Einweihung einer neuen Synagoge 1914/15
1914/15 konnte eine
repräsentative Synagoge erbaut und am 7. September 1915 eingeweiht
werden. Die Grundsteinlegung war am 24. Juni 1914. Trotz des Beginns des
Ersten Weltkrieges konnte der Bau bis Anfang September 1915 fertiggestellt
werden.
Grundsteinlegung der neuen Synagoge (1914)
 Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1914:
"In Wilhelmshaven ist am 24. Juni in Gegenwart von Vertretern der
städtischen und militärischen Behörden der Grundstein für die Synagoge
der jüdischen Gemeinde gelegt worden." Mitteilung
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1914:
"In Wilhelmshaven ist am 24. Juni in Gegenwart von Vertretern der
städtischen und militärischen Behörden der Grundstein für die Synagoge
der jüdischen Gemeinde gelegt worden." |
Der Neubau der Synagoge geht seinem Ende entgegen (1915)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1915: "Wilhelmshaven
- Rüstringen, 20. August (1915). Der Neubau der Synagoge, welche
einen schönen Bau darstellt, geht seinem Ende entgegen. Gleichzeitig ist
ein Schulraum und ein rituelles Tauchbad errichtet worden. Die Einweihung
findet am Dienstag, 7. September nachmittags halb 4 Uhr statt. Der
Gottesdienst war seither in einem gemieteten Raume abgehalten worden, was
wegen der zahlreichen jüdischen Seesoldaten - es sind ca. 2-300 Mann
momentan hier - für die Dauer nicht mehr genügte. Mit großen Opfern ist
nunmehr ein herrlicher Bau entstanden, welcher zu den schönsten Synagogen
unseres Vaterlandes gerechnet werden
kann." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1915: "Wilhelmshaven
- Rüstringen, 20. August (1915). Der Neubau der Synagoge, welche
einen schönen Bau darstellt, geht seinem Ende entgegen. Gleichzeitig ist
ein Schulraum und ein rituelles Tauchbad errichtet worden. Die Einweihung
findet am Dienstag, 7. September nachmittags halb 4 Uhr statt. Der
Gottesdienst war seither in einem gemieteten Raume abgehalten worden, was
wegen der zahlreichen jüdischen Seesoldaten - es sind ca. 2-300 Mann
momentan hier - für die Dauer nicht mehr genügte. Mit großen Opfern ist
nunmehr ein herrlicher Bau entstanden, welcher zu den schönsten Synagogen
unseres Vaterlandes gerechnet werden
kann." |
Bei der Einweihung der Synagoge am 7. September 1915
hielt die Weiherede der großherzogliche Landesrabbiner Dr. David
Mannheimer aus Oldenburg zum Thema "Der Tempel
des Friedens" (inmitten des Ersten Weltkrieges!). Anwesend waren Vertreter
der hohen Militär- und Zivilbehörden, des jüdischen Landesgemeinderates des
Herzogtums Oldenburg sowie der jüdischen Gemeindevorstände Hannover und Emden.
Auch mehrere Vertreter der Kirchen waren erschienen. Oberkantor Linhardt aus
Hannover sowie der Synagogenchor aus Hannover umrahmten die gottesdienstliche
Feier.
 Bericht
zur Einweihung der Synagoge in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1915 (vgl.
unten bei den Abbildungen den parr. Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums"): "Wilhelmshaven-Rüstringen, 13. September. Die
Einweihung der neuerbauten Synagoge fand am 7. September in Anwesenheit der
hohen Militär- und Zivilbehörden und vieler Gäste statt. Vor dem Portale
sprach Herr Vorsteher Jakob Müller und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die
gottesdienstliche Feier wurde von dem Großherzoglichen Landesrabbiner Dr.
Mannheimer aus Oldenburg geleitet, der zum Schluss seiner hinreißenden
Weiherede zum Andenken an die Gefallenen die ewige Lampe anzündete. Den
gesanglichen Teil der Feier leitete Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit
einigen Herren des Synagogenchors aus Hannover. Der Bau, welcher 130 Tausend
Mark kostet, ist ein Prachtwerk und besonders ist die Einrichtung des rituellen
Tauchbades geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die
verhältnismäßig kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat, auch für die
innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl jüdischer Marinesoldaten
sind in Wilhelmshaven, welche soweit sie nicht auf hoher See waren, zur Feier
beurlaubt worden waren. Bericht
zur Einweihung der Synagoge in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1915 (vgl.
unten bei den Abbildungen den parr. Bericht in der "Allgemeinen Zeitung des
Judentums"): "Wilhelmshaven-Rüstringen, 13. September. Die
Einweihung der neuerbauten Synagoge fand am 7. September in Anwesenheit der
hohen Militär- und Zivilbehörden und vieler Gäste statt. Vor dem Portale
sprach Herr Vorsteher Jakob Müller und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die
gottesdienstliche Feier wurde von dem Großherzoglichen Landesrabbiner Dr.
Mannheimer aus Oldenburg geleitet, der zum Schluss seiner hinreißenden
Weiherede zum Andenken an die Gefallenen die ewige Lampe anzündete. Den
gesanglichen Teil der Feier leitete Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit
einigen Herren des Synagogenchors aus Hannover. Der Bau, welcher 130 Tausend
Mark kostet, ist ein Prachtwerk und besonders ist die Einrichtung des rituellen
Tauchbades geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die
verhältnismäßig kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat, auch für die
innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl jüdischer Marinesoldaten
sind in Wilhelmshaven, welche soweit sie nicht auf hoher See waren, zur Feier
beurlaubt worden waren. |
| |
 Bericht zur Einweihung der
Synagoge in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
22.9.1915: "Wilhelmshaven-Rüstringen, 15. September (1915).
Die Einweihung der neu erbauten Synagoge fand am 7. dieses Monats in
Anwesenheit der hohen Militär- und Zivilbehörden und des jüdischen
Landesgemeinderates des Herzogtums Oldenburg sowie der Vorstände von
Hannover und Emden statt. Auch der Chef der Marinestation der Nordsee,
Seine Exzellenz Admiral von Krosigk, der Marineoberpfarrer Erdmann sowie
die Leiter der höheren Schulen und zahlreiche Ehrengäste aller
Konfessionen waren erschienen. Vor dem Portal überreichte Fräulein
Hedwig de Taube durch einen Prolog den Schlüssel in Abwesenheit des zur
Fahne berufenen Architekten. Hierauf sprach Herr Vorsteher Jakob Müller
und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die gottesdienstliche Feier wurde
von dem großherzoglichen Landesrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg
geleitet. Seine Weiherede hatte den Text des Propheten Haggai: 'An dieser
Stätte verleihe ich Frieden: spricht der Herr Zebaoth.' Der geistliche
Redner verstand in geradezu hinreißender Weise, die Weihe mit dem Kriege
zu verbinden, und zündete am Schluss der Rede zum Andenken an die
Gefallenen die ewige Lampe an. Den gesanglichen Teil der Feier leitete
Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit einigen Herrn des
Synagogenchores aus Hannover. Der Bau, welcher 130.000 Mark kostet, ist
ein Prachtwerk, und besonders ist die Einrichtung des rituellen Tauchbades
geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die
verhältnismäßig kleine kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat
auch für die innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl
jüdischer Marinesoldaten ist in Wilhelmshaven, welche, soweit sie
nicht auf hoher See waren, zur Feier beurlaubt worden waren." Bericht zur Einweihung der
Synagoge in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
22.9.1915: "Wilhelmshaven-Rüstringen, 15. September (1915).
Die Einweihung der neu erbauten Synagoge fand am 7. dieses Monats in
Anwesenheit der hohen Militär- und Zivilbehörden und des jüdischen
Landesgemeinderates des Herzogtums Oldenburg sowie der Vorstände von
Hannover und Emden statt. Auch der Chef der Marinestation der Nordsee,
Seine Exzellenz Admiral von Krosigk, der Marineoberpfarrer Erdmann sowie
die Leiter der höheren Schulen und zahlreiche Ehrengäste aller
Konfessionen waren erschienen. Vor dem Portal überreichte Fräulein
Hedwig de Taube durch einen Prolog den Schlüssel in Abwesenheit des zur
Fahne berufenen Architekten. Hierauf sprach Herr Vorsteher Jakob Müller
und dann der Magistratssyndikus Tägert. Die gottesdienstliche Feier wurde
von dem großherzoglichen Landesrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg
geleitet. Seine Weiherede hatte den Text des Propheten Haggai: 'An dieser
Stätte verleihe ich Frieden: spricht der Herr Zebaoth.' Der geistliche
Redner verstand in geradezu hinreißender Weise, die Weihe mit dem Kriege
zu verbinden, und zündete am Schluss der Rede zum Andenken an die
Gefallenen die ewige Lampe an. Den gesanglichen Teil der Feier leitete
Herr Oberkantor Linhardt aus Hannover mit einigen Herrn des
Synagogenchores aus Hannover. Der Bau, welcher 130.000 Mark kostet, ist
ein Prachtwerk, und besonders ist die Einrichtung des rituellen Tauchbades
geradezu hervorragend. Man muss es hoch anerkennen, was die
verhältnismäßig kleine kleine Gemeinde für große Opfer gebracht hat
auch für die innere Ausstattung der Synagoge. Eine große Anzahl
jüdischer Marinesoldaten ist in Wilhelmshaven, welche, soweit sie
nicht auf hoher See waren, zur Feier beurlaubt worden waren." |
| |
Ergänzend eingestellt:
Foto von Oberkantor Gerson Linhardt aus Hannover,
der die Einweihung der Synagoge in Wilhelmshaven gestaltete.
Das vermutlich bei einem Kuraufenthalt in Bad Kissingen erstellte Foto
überreichte Linhardt an seinen Kollegen Oberkantor Jakob Weisz bei einem
Aufenthalt in Karlsbad am 13. August 1908. Jakob Weisz war seinerzeit
Oberkantor in Karlsbad (gest. 1914)
(Foto erhalten von Suzanne Hecker, USA) |
 |

|
Das Bauwerk, das, wie in obigem Bericht berichtet wird, 130.000 Mark kostete, vereinigte
verschiedene Elemente der modernen Architektur vor dem Ersten Weltkrieg: Das
Untergeschoss war mit Bossenquadern verkleidet. Darüber erhob sich ein fast
quadratischer Bau, der in Ziegeln gemauert und verputzt war; auf einem sehr
niedrigen Tambour saß das hohe Kuppeldach. Ungewöhnlich waren die Fenstern,
Nach einem damaligen Bericht zeigten sie auch figurale Szenen, was in Synagogen
sehr selten ist. An der Ostseite waren die Gebotstafeln, der Davidstern und ein
goldener Becher dargestellt; an der Westseite Moses mit der Gebotstafeln, eine
Krone und der Sabbatleuchter; die beiden anderen Seiten waren mit symbolischen
Darstellungen der zwölf Stämme Israels dekoriert.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von SA-Leuten und Mitgliedern
anderer NS-Organisationen niedergebrannt. Dabei wurde am frühen Morgen des 10.
November um 3 Uhr die Synagoge vermutlich durch eine größere Menge
ausgegossenes Benzin in Brand gesetzt. Die Feuerwehr
war zur Sicherung der umliegenden Gebäude anwesend. Offenbar musste man einige
Stunden später erneut das Feuer entfachen, erst gegen 10.30 Uhr brannte der
Dachstuhl. Später wurden die Umfassungsmauern gesprengt. Rituelle
Gegenstände aus der Synagoge wurden auf der Straße zur Schau gestellt.
 Bericht von der Zerstörung
der Synagoge (Ausschnitt) in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom
11.11.1938: "Wilhelmshavens Synagoge brannte nieder. Spontane
antijüdische Kundgebungen in unserer Kriegsmarinestadt - Juden wurden in
Schutzhaft genommen - Erregte Demonstrationen vor den
Judengeschäften..." Bericht von der Zerstörung
der Synagoge (Ausschnitt) in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom
11.11.1938: "Wilhelmshavens Synagoge brannte nieder. Spontane
antijüdische Kundgebungen in unserer Kriegsmarinestadt - Juden wurden in
Schutzhaft genommen - Erregte Demonstrationen vor den
Judengeschäften..." |
Der Synagogenplatz wurde in den 1970er-Jahren als Gedenkstätte
hergerichtet. Am 10. November 1980 wurde zusätzlich zu der schon vorhandenen Bodeninschrift eine Informationstafel
aufgestellt: "Synagogenplatz - eingeweiht am 10. November 1980 - zur
Erinnerung an die im Jahre 1915 erbaute Synagoge. Sie wurde in der
Reichskristallnacht am 9. November 1938 von der NSDAP niedergebrannt und
zerstört".
Adresse/Standort der Synagoge: Börsenstraße/Ecke Parkstraße.
Fotos
(Foto oben links aus: H. Hammer-Schenk. Synagogen in
Deutschland Bd. II Abb. 443; Foto in der Mitte sowie mittlere Reihe rechts aus
H. Büsing s.Lit. Umschlagbilder; Fotos untere Reihe: Hahn, Aufnahmedatum August
1987)
 |
 |
 |
| Die ehemalige Synagoge in
Wilhelmshaven |
Modell der Synagoge von bet-tfila.org |
| |
|
| Die
Zerstörung der Synagoge beim Novemberpogrom 1938 |
 |
|
| |
Die brennende Synagoge am
Vormittag
des 10. November 1938 |
|
| |
|
|
| Die Gedenkstätte am
Synagogenplatz |
|
 |
 |
 |
| Das
Synagogengrundstück als Gedenkstätte im Sommer 1987 |
Inschrift zum Gedenken
an die
Synagoge |
| |
| |
|
| |
 |
|
| |
Gedenkstein
von 1980 |
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| Oktober 2012:
In Wilhelmshaven sollen "Stolpersteine"
verlegt werden |
Artikel in der "Wilhelmshavener
Zeitung" vom 22. Oktober 2012: "Wilhelmshaven - Stolpersteine sollen an Wilhelmshavener Juden erinnern
Sogenannte Stolpersteine erinnern an Menschen, die von den Nazis verfolgt oder getötet wurden. Christian Menz regt an, solche Steine auch in Wilhelmshaven zu verlegen.
Wilhelmshaven/zy - Der Wilhelmshavener Christian Menz hat die Stadt Wilhelmshaven offiziell gebeten, vor dem Haus Marktstraße 50 einen so genannten Stolperstein verlegen zu dürfen. Diese Stolpersteine werden vor Häusern oder Geschäften von verfolgten. verschleppten und ermordeten Juden und anderen in der Nazizeit verfolgten Gruppen in das Gehsteigpflaster eingesetzt, um an deren Schicksal zu erinnern.
Im Haus Marktstraße 50 war einst das Kaufhaus der jüdischen Familie Margoniner angesiedelt. Das Haus gehört jetzt der Familie Heise, die dort früher ein Café betrieben hat.
Sowohl die Eigentümer Heise als auch Heiner Kock vom Dobben Café stehen diesem Projekt positiv gegenüber. Kock hat sogar angeboten, die Verlegung des Stolpersteins durch eine besondere Aktion seiner Konditorei zu unterstützen, um gegebenenfalls für weitere Steine Geld zu sammeln. Stolpersteine deshalb, weil man bei dem Spaziergang durch eine Stadt sinnbildlich darüber
'stolpert' und der Besucher sich genau in diesem Moment mit dem 'Mahnmal' befasst und zwar nicht an einer zentralen Gedenkstätte (dies kann ergänzend zu den Stelen auf dem Synagogenplatz und Gedenkstätten wie Lager Schwarzer Weg/Alter Banter Deichsweg sein), sondern
'unterwegs'. Die Steine werden ebenerdig zur Pflasterung verlegt. Man kann nicht wirklich darüber stolpern, sondern nur sinnbildlich...
Menz würde gerne zusammen der Stadt, mit Hartmut Büsing und eventuell einer Schulklasse das Projekt
'Stolpersteine' vorantreiben. Vielleicht sei ja auch eine Schule daran interessiert, diesen Teil der Wilhelmshavener Geschichte auf diese Art aufzuarbeiten und sich zum Beispiel auf die Suche im Internet nach Nachfahren von Verfolgten zu machen. Ein Stolperstein kostet 120 ? Euro plus Verlegung/Spesen. Da nun die kalte Jahreszeit anfängt und man ja auch einen gewissen zeitlichen Vorlauf brauche, schlägt Menz vor, die Aktion im Frühjahr/Sommer 2013 zu starten."
Link
zum Artikel |
| |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Handbücher der jüdischen Gemeindeverwaltung. |
 | Harold Hammer-Schenk: Synagogen in Deutschland. Geschichte einer
Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert. Teil I und II. 1981. |
 |  Hartmut Büsing: "...soviel unnennbare Leiden erduldet".
Zur Geschichte der Rüstringer und Wilhelmshavener Juden. Wilhelmshaven
1986. Hartmut Büsing: "...soviel unnennbare Leiden erduldet".
Zur Geschichte der Rüstringer und Wilhelmshavener Juden. Wilhelmshaven
1986. |
 |  Reise
ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -
Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.
04941-179957 E-Mail:
kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.
Kostenlos beziehbar. Reise
ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -
Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.
04941-179957 E-Mail:
kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.
Kostenlos beziehbar.
Internet: www.ostfriesischelandschaft.de
"Reise ins jüdische Ostfriesland" ist ein gemeinsames Projekt im Rahmen des dritten kulturtouristischen Themenjahres
"Land der Entdeckungen 2013". Am 9. November 2013 jährte sich zum 75. Mal die Pogromnacht von 1938 in Deutschland. Dies haben 17 Einrichtungen, davon neun Museen und fast alle ehemaligen Synagogengemeinden zum Anlass genommen, sich unter dem Titel
"Reise ins jüdische Ostfriesland" zusammenzuschließen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschwand die jüdische Kultur im Vergleich zum übrigen Deutschland hier bemerkenswert schnell aus dem bis dahin gemeinsamen Alltagsleben von Juden und Nichtjuden.
"Reise ins jüdische Ostfriesland" will an das einst lebendige jüdische Leben in der Region erinnern.
Die Projekte zeigen in beeindruckender Weise, wie ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Allen jedoch geht es insbesondere darum, dem vielfältigen jüdischen Leben in Ostfriesland bis zur Shoah und darüber hinaus wieder ein Gesicht zu geben. Denn Erinnerung ist ein Weg zur Heilung und damit zur Versöhnung. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Wilhelmshaven. Built on
territory acquired from Oldenburg in 1853 and named in honor of William I,
Wilhelmshaven soon became one of Germany's most important naval bases. The ten
Jews living there in 1876 grew to 47 in 1885, 131 in 1910, and 239 in 1925. A
new synagogue was dedicated in 1910. During and after Worldwar I, the
community's religious teacher served as chaplain to Jewish sailors. There were
anti-Jewish incidents, often involving navy personnel, and in 1922, two
ultra-nationalists made an attempt on the life of Maximilian Harden, a prominent
Jewish writer who edited Die Zukunft. In June 1933, there were 191 Jews
in Wilhelmshaven. The Jewish community responded to Nazi pressure by
intensifying its communal and Zionist activity. Nearly 100 Jews left before Kristallnacht
(9-10 November 1938). During the pogrom the synagogue was destroyed and Jewish
businesses were looted. After Jews had been driven through the streets and
pelted with rocks, 34 were transported to the Sachsenhausen concentration camp.
By May 1939, a total of 45 Jews hat emigrated from Wilhelmshaven (nearly 30 to
England and other safe havens); one joined the International Brigade in Spain
and, later, the French Resistance. At least 16 of those who remained after 1939
perished in the Holocaust.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|