|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Mittelfranken"
Altenmuhr (Gemeinde
Muhr am See, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Altenmuhr bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938.
Ihre Entstehung geht in die Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück.
Die ersten Juden, die sich am Ort niederließen, waren Flüchtlinge aus dem
Ansbachischen. Sie wurden durch die Ritter von Lentersheim aufgenommen. Starken
Zuzug erlebt die jüdische Gemeinde bereits im 18. Jahrhundert, als die Zahl der
jüdischen Familien von 12 (1732) auf 42 (beziehungsweise 188 Personen 1796).
Die Familien standen nun unter dem Schutz der Freiherren von Hardenberg. Die meisten
der Familien lebten bis um 1800 in sehr armen Verhältnissen. Ihre Blütezeit
erlebte die jüdische Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Danach verzogen viele der jüdischen Einwohner in die Städte oder wanderten
aus. Folgende Zahlen liegen vor: 1811/12 206 jüdische Einwohner (32,3 % von
insgesamt 637 Einwohnern), 1837 Höchstzahl von 250 (34,7 % von insgesamt
720), 1867 163 (21 % von insgesamt 775), 1880 116 (14,6 % von 795) und 1900
105 (14,1 % von 744).
Die jüdischen Familien lebten zunächst in beengten Verhältnissen im sogenannten Judenhof. Der
Bereich des Judenhofes liegt nahezu ringförmig um den Platz des ehemaligen
Schlosses in Mittelmuhr. Die Häuser tragen kleine Sattel- und Walmdächer.
Fünf dieser Häuser und die damalige Judenschule wurden vor 1807
errichtet. Seit 1790 konnten jüdische Familien auch außerhalb des Judenhofes
leben.
Die jüdische Gemeinde hatte an Einrichtungen eine Synagoge (s.u.),
eine Mikwe und eine Israelitische Volksschule (Elementarschule; bis 1924). Die Toten der Gemeinde wurden bis 1906 in Bechhofen,
danach in Gunzenhausen beigesetzt. Die Gemeinde
gehörte bis 1845 zum Rabbinatsbezirk Gunzenhausen, danach zum Rabbinatsbezirk
Ansbach.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war neben dem
israelitischen Volksschullehrer (Elementarlehrer) zeitweise ein Vorbeter angestellt,
der auch als Schächter und "Kultusdiener" tätig war. Seit 1893 waren
diese Ämter miteinander verbunden. Die Stelle war immer wieder neu zu besetzen
(vgl. unten Anzeigen zur Ausschreibung der Stelle). Unter den Lehrern haben längere Zeit
gewirkt: Simon Krämer (1831 bis 1866), Pinchas/Phineas/Philipp Seligsberger
(bis 1861 in Redwitz, danach in Altenmuhr
bis zu seinem Ruhestand, vermutlich 1893, gest. nach Recherchen von E. Böhrer
1907 in Bad Kissingen), Jakob Nußbaum (1894-1917)
und als sein Nachfolger der später in München tätige Max Adler. Nach
Auflösung der jüdischen Volksschule 1924 bestand noch eine Religionsschule
(Lehrer Victor Herz, wechselte zum 1. April 1929 nach
Wiesloch).
Seit 1929 hatte die jüdische Gemeinde Altenmuhr einen gemeinsamen Lehrer
mit der Nachbargemeinde Windsbach.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Isak Fleischmann
(geb. 5.5.1885 in Altenmuhr, gef. 19.7.1916), Julius Weinmann (geb. 3.2.1893 in
Altenmuhr, gef. 7.6.1917). Ihre Namen standen bis 1938 auf einer seitdem
vermutlich vernichteten Gedenktafel in der Synagoge des Ortes. Seit 1958 stehen
die Namen auf einem Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Kriege (linke der
sechs Tafeln) an der Einmündung des Judenhofes in die Kirchenstraße, etwa 200
m östlich der evangelischen Pfarrkirche St.
Johannis.
1926 lebten noch zwölf jüdische Familien in Altenmuhr, von denen neun
als Händler tätig waren (davon sieben als Viehhändler), drei als Metzger. An
jüdischen Vereinen bestanden eine Heilige Bruderschaft (Chewra, Ziel:
Unterstützung Hilfsbedürftiger) und eine Heilige Schwesternschaft
(Frauenverein, Ziel: Unterstützung Hilfsbedürftiger), außerdem gab es zwei
Stiftungen (Bronemann-Stiftung und Seller-Stiftung). Um 1925 bildeten den
Vorstand der jüdischen Gemeinde die Herren David Richard, Louis Mohr, H.
Weinmann, J. Fleischmann und A. Fleischmann. Als Religionslehrer, Schochet und
Kantor war der schon genannte Victor Herz tätig. Er erteilte damals sechs jüdischen Kindern
Religionsunterricht. 1932 war 1. Vorsteher der jüdischen Gemeinde David
Richard, 2. Vorsteher Adolf Fleischmann. Damals erhielten noch drei
jüdische Kinder Religionsunterricht.
1933 wurden noch 29 jüdische Einwohner gezählt. In den folgenden Jahren
verzog der große Teil von ihnen auf Grund der Auswirkungen des wirtschaftlichen
Boykotts (seit 1936 durften die jüdischen Einwohner ihre lebensnotwendigen
Waren nicht mehr in Altenmuhr einkaufen) in andere Orte oder konnte noch
emigrieren.
Im November 1938 lebten noch neun jüdische Personen in Altenmuhr. Beim Novemberpogrom
1938 wurden diese Personen von SA-Leuten aus den Häusern geholt und in ein Haus
neben dem Stadttor gebracht, in dem die jüdische Gemeinden ihren Leichenwagen
aufbewahrte. Mehrere Stunden wurden sie hier festgehalten, später nach
Gunzenhausen abtransportiert.
Von den in Altenmuhr geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch Angaben von W. Jung s. Lit.): Alice
Fleischmann (1930), Amalie Fleischmann geb. Thormann (1865), Heinrich
Fleischmann (1883), Jakob Fleischmann (1886), Klara Fleischmann geb. Wild
(1894), Max Fleischmann (1875), Josef Flink (1868), Louis Flink (1872), Sofie
Heidecker geb. Weissmann (1878), Clara Kaufmann geb. Richard (1860), Helene Kürzinger
geb. Seller (1870), Carola Lachmann (1816), Herbert Lachmann (1912), Jacob
Lachmann (1881), Thekla Lein geb. Weinmann (1887), Louis Mohr (1872), Salomon
Mohr (1858), Sara Mohr (1866), Else Neuburger geb. Fleischmann (1884), Ida Rau
geb. Fleischmann (1887, vgl. Dokumente und Foto auf
Seite zu Ermershausen), Frieda Richard (1887), Louis Richard (1880), Sara
Rosenbach geb. Thormann (1864), Arthur Seller (1876), Amalie Thorma geb. Cohen
(1874), Emma Thormann (1871), Frieda Uhlfelder geb. Flink (1883), Ernestine
Weinmann geb. Weinmann (1857), Emma Wilmersdörfer geb. Fleischmann (1883).
Zum Schicksal von Emma Wilmersdörfer siehe
die Informationen in der Seite zu Michelfeld (Oberpfalz):
https://regens-wagner-michelfeld.de/ueber-regens-wagner/erinnerungs-orte/aktion-t4-emma/
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der
Geschichte der jüdischen Schule und der Lehrer
Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und Schächters 1885 / 1893 /
1924 / 1929
Anmerkung: die beiden nachstehenden Ausschreibungen von 1885
und 1893 wurden von dem damaligen Vorsteher namens Flink unterzeichnet. 1885
wurde neben dem damals vorhandenen Elementarlehrer zusätzlich ein
"Vorbeter, Schächter und Kultusdiener" gesucht. 1893 waren die
Ämter des Vorbeters und Schächters - auf Grund der immer kleiner gewordenen
Gemeinde, die sich nur noch einen Kultusbeamten leisten konnte - gemeinsam mit
der Elementarlehrerstelle verbunden.
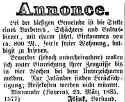 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. März 1885: "Annonce. Bei der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines Vorbeters, Schächters
und Kultusdiener, mit einem jährlichen Einkommen von ca. 800 Mark, sowie freier
Wohnung, baldigst zu besetzen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. März 1885: "Annonce. Bei der hiesigen Gemeinde ist die Stelle eines Vorbeters, Schächters
und Kultusdiener, mit einem jährlichen Einkommen von ca. 800 Mark, sowie freier
Wohnung, baldigst zu besetzen.
Bewerber (jedoch unverheiratete) wollen sich unter Einreichung ihrer Zeugnisse
bis in vier Wochen bei dem Unterzeichneten melden. Nur Inländer finden Berücksichtigung;
Reisekosten werden nicht erstattet.
Altenmuhr (Bayern), 23. März 1885. Flink,
Vorstand." |
| |
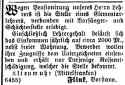 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1893:
"Wegen Pensionierung unseres Herrn Lehrers ist die Stelle eines
Elementarlehrers, verbunden mit Vorsänger- und Schächterstelle
erledigt. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1893:
"Wegen Pensionierung unseres Herrn Lehrers ist die Stelle eines
Elementarlehrers, verbunden mit Vorsänger- und Schächterstelle
erledigt.
Einschließlich Lehrergehalt beläuft sich das Einkommen jährlich auf
circa 2.000 Mark, nebst freier Wohnung. Bewerber wollen ihre Zeugnisse dem
Unterzeichneten einsenden und erhält nur Derjenige Reiseentschädigung,
welcher die Stelle bekommt.
Altenmuhr (Mittelfranken). Flink, Vorstand." |
| Auf die Anzeige von 1893 hin hat sich
erfolgreich Lehrer Jakob Nußbaum beworben (s.u.), der bis 1917 in
der Gemeinde blieb. |
| |
 Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 28. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 28. Februar 1924:
"Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr (Bayern) sucht einen
Religionslehrer, Kantor und Schächter.
Besoldung nach den Leitsätzen des Verbandes bayerischer israelitischer
Gemeinden. Große freie Wohnung. Bewerbungen sind zu richten an den
Vorstand. Richard." |
| |
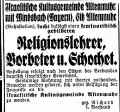 Anzeige
in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 13.
September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr mit
Windsbach (Bayern), Sitz Altenmuhr (Bahnstation), sucht baldigst einen
seminaristisch gebildeten Religionslehrer, Vorbeter und Schochet. Anzeige
in der Zeitschrift des "Central-Vereins" (CV-Zeitung) vom 13.
September 1929: "Israelitische Kultusgemeinde Altenmuhr mit
Windsbach (Bayern), Sitz Altenmuhr (Bahnstation), sucht baldigst einen
seminaristisch gebildeten Religionslehrer, Vorbeter und Schochet.
Anstellung erfolgt nach den Sätzen des Verbandes bayrisch israelitischer
Gemeinden. Geräumige Wohnung mit Garten vorhanden. Bewerber werden
gebeten sich unter Beifügung der Zeugnisse an die israelitische
Kultusgemeinde Altenmuhr zu wenden.
gez. Richard, 1. Vorstand." |
Zum Tod des langjährigen Lehrers Rabbi Anselm Weinschenk (1854)
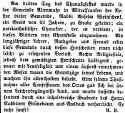 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1855:
"Am dritten Tag des Chanukkafestes (= 18. Dezember 1854) wurde in der
Gemeinde Altenmuhr in Mittelfranken der Nestor dieser Gemeinde, Rabbi
Anselm Weinschenk, ein Greis von 93 Jahren, zu Grabe geleitet; ein
patriarchalischer Charakter, der es verdient, in diesen Blätter eine
Ehrenstelle einzunehmen. Als langjähriger Lehrer, Ratgeber und Freund
erlitt diese Gemeinde durch dessen Hinscheiden einen nicht leicht zu
ersetzenden Verlust. Echte Religiosität, jedoch dem gemäßigten
Fortschritte huldigend, gepaart mit Leutseligkeit und einem äußerst
einnehmenden Wesen waren die Grundzüge seines Lebens, und machten ihn
allenthalben beliebt. Eine seltene Teilnahme aller Konfessionen des Ortes
gab sich bei seinem Leichenbegängnisse kund, und wurde dasselbe besonders
durch eine inhaltsreiche Grabrede der Herrn Rabbinen Grünebaum aus
Ansbach verherrlicht. Er ruhe sanft!. H.B." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1855:
"Am dritten Tag des Chanukkafestes (= 18. Dezember 1854) wurde in der
Gemeinde Altenmuhr in Mittelfranken der Nestor dieser Gemeinde, Rabbi
Anselm Weinschenk, ein Greis von 93 Jahren, zu Grabe geleitet; ein
patriarchalischer Charakter, der es verdient, in diesen Blätter eine
Ehrenstelle einzunehmen. Als langjähriger Lehrer, Ratgeber und Freund
erlitt diese Gemeinde durch dessen Hinscheiden einen nicht leicht zu
ersetzenden Verlust. Echte Religiosität, jedoch dem gemäßigten
Fortschritte huldigend, gepaart mit Leutseligkeit und einem äußerst
einnehmenden Wesen waren die Grundzüge seines Lebens, und machten ihn
allenthalben beliebt. Eine seltene Teilnahme aller Konfessionen des Ortes
gab sich bei seinem Leichenbegängnisse kund, und wurde dasselbe besonders
durch eine inhaltsreiche Grabrede der Herrn Rabbinen Grünebaum aus
Ansbach verherrlicht. Er ruhe sanft!. H.B." |
Aus der Zeit des Lehrers
Simon Krämer
Über die "Volksschriften" von Lehrer Simon
Krämer (1844 / 1845)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 16. Juli 1844: "München,
4. Juli (1844). Da Ihr Literaturblatt nur wenig Raum für Volksschriften
erübrigen kann, so wäre es vielleicht nicht unbillig, wenn dergleichen
Schriften wenigstens in den Literaturberichten kurz erwähnt würden,
damit sie wenigstens zur Kunde des Publikums kommen. Der Schreiben unserer
Geschichte, namentlich die der modernen israelitischen Kultur und
Literatur, wird in späteren Zeiten Ihr Literaturblatt als einzige Quelle
ansehen, um daraus wenigsten sein Material kennen zu lernen, und schon um
deswillen dürfte keine Erscheinung ganz fehlen. Ich erlaube mir daher,
hier eine Reihe von Volksschriften aufzuzählen, mit der Bitte, dass Sie
bei denjenigen, die Sie nie zur Anzeige von den Autoren oder Verlegern
erhalten, ein Sternchen bei dessen Titel beizusetzen, was wohl den Einen
oder den Andern aufmuntern würde, sein Werkchen einzusenden. Hier die
aufgezählten Schriften: 1. MiZearei Gäwar, oder: Hofagent Maier,
der Jude des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Volksschrift für Israeliten
verfasst von Simon Krämer, (Lehrer an der israelitisch-deutschen Schule
zu Altenmuhr). Nördlingen 1844. 12. C. H. Beck. Es ist derselbe
Verfasser, der die Volksschrift: 'die Schicksale der Familie Hoch usw.'
geschrieben." Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 16. Juli 1844: "München,
4. Juli (1844). Da Ihr Literaturblatt nur wenig Raum für Volksschriften
erübrigen kann, so wäre es vielleicht nicht unbillig, wenn dergleichen
Schriften wenigstens in den Literaturberichten kurz erwähnt würden,
damit sie wenigstens zur Kunde des Publikums kommen. Der Schreiben unserer
Geschichte, namentlich die der modernen israelitischen Kultur und
Literatur, wird in späteren Zeiten Ihr Literaturblatt als einzige Quelle
ansehen, um daraus wenigsten sein Material kennen zu lernen, und schon um
deswillen dürfte keine Erscheinung ganz fehlen. Ich erlaube mir daher,
hier eine Reihe von Volksschriften aufzuzählen, mit der Bitte, dass Sie
bei denjenigen, die Sie nie zur Anzeige von den Autoren oder Verlegern
erhalten, ein Sternchen bei dessen Titel beizusetzen, was wohl den Einen
oder den Andern aufmuntern würde, sein Werkchen einzusenden. Hier die
aufgezählten Schriften: 1. MiZearei Gäwar, oder: Hofagent Maier,
der Jude des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Volksschrift für Israeliten
verfasst von Simon Krämer, (Lehrer an der israelitisch-deutschen Schule
zu Altenmuhr). Nördlingen 1844. 12. C. H. Beck. Es ist derselbe
Verfasser, der die Volksschrift: 'die Schicksale der Familie Hoch usw.'
geschrieben." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 13. August 1844: "MiZearei
Gäwar oder: Hofagent Maier, der Jude des neunzehnten Jahrhunderts.
Eine Volksschrift für Israeliten verfasst von Simon Krämer, Lehrer an
der israelitisch-deutschen Schule zu Altenmuhr. Nördlingen, 1844. 16.
C.H. Beck'sche Buchhandlung. Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 13. August 1844: "MiZearei
Gäwar oder: Hofagent Maier, der Jude des neunzehnten Jahrhunderts.
Eine Volksschrift für Israeliten verfasst von Simon Krämer, Lehrer an
der israelitisch-deutschen Schule zu Altenmuhr. Nördlingen, 1844. 16.
C.H. Beck'sche Buchhandlung.
Mit wahrem Vergnügen gehe ich an die Anzeige dieser trefflichen Schrift
für unsere Jugend. Dieser Zweig unserer Volksliteratur ist noch so kahl,
dass jeder Bearbeiter dieses Zweiges Unterstützung und Aufmunterung
verdient. Es ist diese Schrift aber auch für Erwachsene, die sich ein
anschauliches Bild vom Leben eines wahren Juden des 19. Jahrhunderts
verschaffen wollen, höchst interessant. In der Person des Hofagenten
Maier sehen wir einen Mann, der ein sanftes jüdisch-religiöses Leben
führt, seinem Glauben die Vorteile der Welt opfert und - was der
Hauptpunkte ist - der mit deutscher Bildung und Gesittung innig vertraut
ist. Das Familienleben dieses Israeliten wird mit einer solchen Anmut und
Einfachheit geschildert, häusliche Feste wie Brit-Mila (Beschneidung) und
Chanukka-Fest werden so anziehend dargestellt, dass diese Schrift
nachhaltiger als alle Religionsbücher auf das empfängliche Gemüt der
Jugend wirken muss. Zugleich wird der junge Leser mit mehreren trefflichen
Volksschriften, z.B. mit den 'Stufengesängen' von Stein, dem
'Andachtsbüchlein' von Formstecher, und durch die eingestreuten
hebräischen Gedichte mit dem Werte der hebräischen Sprache bekannt
gemacht. Ich wünsche von Herzen, dass Herr Krämer ferner für die
Lektüre unserer Jugend sorge, und dass die Herren Rabbiner und Lehrer
diesen gewandten Jugendschriftsteller kräftig unterstützen mögen. Soll
unsere Literatur gedeihen, so müssen einige geistig, andere materiell
mitwirken." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "...
- Volksschriften machen unter Juden wenig Glück. Der wackere Schulmann
und Schriftstellen fürs Volk, Krämer in Altenmuhr, wird sogar von
den Pseudogebildeten verfolgt, weil er, in seiner neuesten Schrift, den
Wucher aufdeckt und verpönt." Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "...
- Volksschriften machen unter Juden wenig Glück. Der wackere Schulmann
und Schriftstellen fürs Volk, Krämer in Altenmuhr, wird sogar von
den Pseudogebildeten verfolgt, weil er, in seiner neuesten Schrift, den
Wucher aufdeckt und verpönt." |
| |
| Hinweis: Simon Krämer: Bilder aus dem
jüdischen Volksleben. Altenmuhr 1845. Die
Publikation ist online zugänglich |
Über die schriftstellerische Tätigkeit von Simon Krämer
(1845)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1845:
"Aus Mittelfranken, im November. Der Lehrer S. Krämer in Altenmuhr,
Verfasser der auch in diesen Blättern rezensierten 'Familie Hoch' und
'Hofagent Maier', gibt jetzt 'Bilder aus dem jüdischen Volksleben'
heraus, die wir, um das Werk zu fördern, zur Subskription empfehlen
wollen. In der Vorrede sagt der Verfasser: Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Februar 1845:
"Aus Mittelfranken, im November. Der Lehrer S. Krämer in Altenmuhr,
Verfasser der auch in diesen Blättern rezensierten 'Familie Hoch' und
'Hofagent Maier', gibt jetzt 'Bilder aus dem jüdischen Volksleben'
heraus, die wir, um das Werk zu fördern, zur Subskription empfehlen
wollen. In der Vorrede sagt der Verfasser:
"In unserer Zeit, in welcher die frommen Gebräuche der Vorvordern
und mit ihnen vielfach auch der Sinn für still-gemütliches, jüdisches
Familienleben aus unseren Kreisen immer mehr schwinden, ohne dass etwas
Erhebenderes, Heiligenderes an ihre Stelle tritt; in einer Zeit, in
welcher der im ländlichen Vaterhaus einsprechende Handlungslehrling über
den zeremoniebeflissenen Vater lächelt und spöttelt, und die aus der
Pension heimkehrende Tochter den Sabbat-Segen der Mutter verschmäht: da
wird es nötig, jede mögliche Vorkehrung zu treffen, damit der gewaltige
Strom der Zeit nur loses Gerölle und Gestrüppe, nicht auch Goldkörner
und Perlenmuscheln mit fortreiße, und die nützlichen, nährenden
Pflanzen an seinen Ufern unaufhaltsam wegspüle. Den religiösen Moment,
welcher fast einem jeden jüdischen Monat einwohnt, dergestalt in eine
Familiengeschichte einzukleiden, dass er in ansprechender Form erscheint,
die Berührungspunkte des im Schwinden begriffenen jüdischen Lebens samt
den im Schwunge gehenden Volksmeinungen mit dem neuen sich gestaltenden so
in einen Familien-Roman zu verflechten, dass dieses mehr in leichter,
nachahmungswerter Gestalt gegen jenes erscheint, also dass er auch von
unseren Jünglingen und Jungfrauen gern und mit Nutzen gelesen werden mag,
und darin die Zeitfragen verweben, damit sie auch dem Gleichgültigen zum
Bewusstsein gebracht werden: das ist, unseres Bedünkens, in unserer
leselustigen Zeit ein noch zu erringendes Verdienst, welches durch
nachstehende Erzählungen angestrebt wird." |
Warum Simon Krämer seinen Sohn nach Gabriel Riesser
benannte (1849)
Anmerkung: nähere Informationen zu Gabriel Riesser siehe Wikipedia-Artikel
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. April
1849: "Altenmuhr (Bayern). Der Unterzeichnete erlaubt sich Ihnen
nachstehende Mitteilung zu beliebigem Gebrach für die Allgemeine Zeitung
des Judentums zu machen.
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. April
1849: "Altenmuhr (Bayern). Der Unterzeichnete erlaubt sich Ihnen
nachstehende Mitteilung zu beliebigem Gebrach für die Allgemeine Zeitung
des Judentums zu machen.
Schon lange, wie jeder Israelite, voll Hochachtung gegen Herrn Gabriel
Riesser wegen seiner unermüdlichen Bestrebungen für die Emanzipation der
deutschen Juden, haben mich dessen desfallsige Leistungen in der
Paulskirche, wodurch er seinen vieljährigen Bemühungen gleichsam die
Krone der Vollendung aufsetzte, mit wahrer Verehrung gegen ihn erfüllt.
Dieser habe ich durch folgenden Akt Ausdruck zu geben gesucht, was
vielleicht Nachahmung finden dürfte.
Ich gab nämlich meinem mir vor wenigen Tagen geboren gewordenen Knaben
Riessers Vornamen Gabriel und habe die desfallsige Vormerkung im
Zivilstandsregister gemacht. Israel schuldet Riessern viel; er war es
vornehmlich, der durch seine Schriften die öffentliche Meinung
bearbeitet, der besonders die verschiedenen Vorurteile niedergekämpft und
unser gutes Recht überall geltend zu machen suchte, sodass die neuen
Ereignisse diese Frage vollkommen abgeklärt fanden; er war es, der durch
das Leidenschaftslose seines Polemik, von einer liebenswürdigen
Persönlichkeit unterstützt Alles besiegte; er war es, der in der
Paulskirche als Jude für die Juden auftrat, also dass die Worte eines
einzigen Gegners auch nicht eine Stimme der Unterstützung fanden.
Über ein Kleines werden alle deutschen Juden entknechtet und frei sein,
und frei wirken für deutsche Freiheit und Einheit.
Israel ist dankbar, aber es vermag keine Denkmäler aus Erz zu setzen, am Wenigsten
noch die, welche derartige Verdienste am Besten zu schätzen wissen. Von
Alters her hat es seinen Dank gegen welthistorische Wohltäter, selbst
heidische, dadurch bewiesen, dass es den neugeborenen ihre Namen beilegte.
Zeuge dessen sind die Namen Alexander, Kosmann etc.
Wohlan! heben wir allen im Laufe eines Jahres geboren werdenden Knaben,
den Namen des Wohltäters unserer Zeit, unserer Glaubensgenossen, den
Namen Gabriel. Ist der Gedanke gut - und er dünkt es mir zu sein - so ist's
ja gleich von wem er ausgegangen. Krämer."
|
Lehrer Krämer möchte seine "Jüdischen
Erzählungen" publizieren (1850) V
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1850: "Von literarischen Novitäten ist wenig zu
berichten. Herr Dr. Adler in Kissingen,
dessen Name durch seine neuesten Streitschriften einen guten Klang in
Israel gewonnen hat, will die Birke
Abot mit Erläuterungen, Biographien etc. herausgeben. Lehrer
Krämer, Verfasser mehrerer israelitischer Volksschriften, gedenkt 'Jüdische
Erzählungen' in seiner frühern Weise und mit Vermeidung dessen, was
in manchen Kreisen böses Blut gemacht hat, in die Öffentlichkeit treten
zu lassen. Zu diesen wenigen Erscheinungen findet sich aber leider nur ein
kleines kauflustiges Publikum vor, und die Herren Buchhändler gehen nicht
tiefer, als sie festen Grund sehen. K." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 29. Juli 1850: "Von literarischen Novitäten ist wenig zu
berichten. Herr Dr. Adler in Kissingen,
dessen Name durch seine neuesten Streitschriften einen guten Klang in
Israel gewonnen hat, will die Birke
Abot mit Erläuterungen, Biographien etc. herausgeben. Lehrer
Krämer, Verfasser mehrerer israelitischer Volksschriften, gedenkt 'Jüdische
Erzählungen' in seiner frühern Weise und mit Vermeidung dessen, was
in manchen Kreisen böses Blut gemacht hat, in die Öffentlichkeit treten
zu lassen. Zu diesen wenigen Erscheinungen findet sich aber leider nur ein
kleines kauflustiges Publikum vor, und die Herren Buchhändler gehen nicht
tiefer, als sie festen Grund sehen. K." |
Vorbemerkungen zu der
neuen Volksschrift "Jüdische Erzählungen" vom Simon
Krämer (1851)
Anmerkung: Nachfolgend werden nur die ersten Zeilen dieser
Vorbemerkungen wiedergegeben.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Mai 1851:
"Altenmuhr in Mittelfranken, 6. April (1851). Indem ich einer sehr
verehrlichen Redaktion ein Exemplar meiner neuen Volksschrift für
Israeliten 'Jüdische Erzählungen' zur Würdigung und Beurteilung übersende,
kann ich's nicht lassen, zur Einführung derselben einige Zeilen mit der
Bitte beizufügen, denselben ein Plätzchen in Ihrem Blatte
einzuräumen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Mai 1851:
"Altenmuhr in Mittelfranken, 6. April (1851). Indem ich einer sehr
verehrlichen Redaktion ein Exemplar meiner neuen Volksschrift für
Israeliten 'Jüdische Erzählungen' zur Würdigung und Beurteilung übersende,
kann ich's nicht lassen, zur Einführung derselben einige Zeilen mit der
Bitte beizufügen, denselben ein Plätzchen in Ihrem Blatte
einzuräumen.
Von der Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit derartigen Volksschriften noch
immer fest überzeugt und dieses Bedürfnis von besseren Kräften noch
nicht befriedigt sehend, übergebe ich dem jüdischen Publikum wieder drei
Erzählungen, welche das jüdische Leben in seinen verschiedenen
Entwicklungsperioden, gegenüber den staatlichen Verhältnissen in
Familiengeschichten zur Anschauung bringen in einer Form, geeignet Ideen,
Zeitfragen, Vorkommnisse etc. in solchen Kreisen anzuregen, in welchen sie
sonst fast unbeachtet vorübergehen, und mit Vermeidung alles dessen, was
die Pietät verletzen und gegebene Verhältnisse beeinträchtigen
könnte...." |
| |
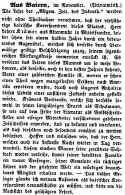 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1853: "Aus Bayern, im November (1853). Die Leser der 'Allgemeinen
Zeitung des Judentums' werden nicht ohne Teilnahme vernehmen, dass die
vieljährige bayerische Korrespondent dieses Blattes, Herr Lehrer Krämer
aus Altenmuhr in Mittelfranken, leider schon seit einem halben Jahre durch
ein bedeutendes Augenübel, welches sich derselbe durch übermäßige
geistige Beschäftigung zuzog, seinem segensreichen Wirkungskreise
momentan entrückt ist. Es verdient das Leiden dieses Mannes umso mehr
Bedauern, als derselbe, noch in den besten Jahren stehend, Vater einer
zahlreichen Familie ist, wovon er schon einen Teil wegen mangelhafter
Existenz nach Amerika expedieren musste, durch noch längeres Anhalten
dieses Übels einer unsicheren Zukunft anheim gestellt würde. Krämers
Verdienste, welche sich derselbe sowohl in seiner langjährigen Praxis als
Schulmann, sowie auf dem Felde der Literatur als Volksschriftsteller und
eifriger Mitarbeiter verschiedener gelehrter Zeitschriften erworben, sind
zu bekannt und anerkannt, als dass dieselben noch besonders erwähnt zu
werden bedürften. Hoffen und wünschen wir, dass der Herr, welcher auch
die finsterste Nacht wieder in Tag verwandelt, diesem wackeren Manne seine
zerrüttete Sehkraft wieder verleihe, damit seiner betrübten Familie ein
treuer Versorger, seiner Gemeinde ein tüchtiger Lehrer und der gelehrten
Welt ein würdiges brauchbares Mitglied erhalten werde...". Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. November
1853: "Aus Bayern, im November (1853). Die Leser der 'Allgemeinen
Zeitung des Judentums' werden nicht ohne Teilnahme vernehmen, dass die
vieljährige bayerische Korrespondent dieses Blattes, Herr Lehrer Krämer
aus Altenmuhr in Mittelfranken, leider schon seit einem halben Jahre durch
ein bedeutendes Augenübel, welches sich derselbe durch übermäßige
geistige Beschäftigung zuzog, seinem segensreichen Wirkungskreise
momentan entrückt ist. Es verdient das Leiden dieses Mannes umso mehr
Bedauern, als derselbe, noch in den besten Jahren stehend, Vater einer
zahlreichen Familie ist, wovon er schon einen Teil wegen mangelhafter
Existenz nach Amerika expedieren musste, durch noch längeres Anhalten
dieses Übels einer unsicheren Zukunft anheim gestellt würde. Krämers
Verdienste, welche sich derselbe sowohl in seiner langjährigen Praxis als
Schulmann, sowie auf dem Felde der Literatur als Volksschriftsteller und
eifriger Mitarbeiter verschiedener gelehrter Zeitschriften erworben, sind
zu bekannt und anerkannt, als dass dieselben noch besonders erwähnt zu
werden bedürften. Hoffen und wünschen wir, dass der Herr, welcher auch
die finsterste Nacht wieder in Tag verwandelt, diesem wackeren Manne seine
zerrüttete Sehkraft wieder verleihe, damit seiner betrübten Familie ein
treuer Versorger, seiner Gemeinde ein tüchtiger Lehrer und der gelehrten
Welt ein würdiges brauchbares Mitglied erhalten werde...". |
Lehrer Krämer wehrt sich gegen antisemitische
Presseartikel (1865)
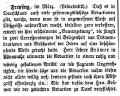 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. März 1865: "Freising, im März (1865). Dass es
in Deutschland auch viele gesinnungstüchtige Redaktionen gibt, welche,
wenn man sie in angemessener Weise auf Missgriffe aufmerksam macht,
dieselben gern verbessern, erweist die hier erscheinende 'Bauernzeitung',
die jüngst in zwei Korrespondenzen bei Gelegenheit von Dismembrationen
und Viehhandel der Juden auf eine beschimpfende Weise gebracht hatte. Herr
Lehrer Krämer in Altenmuhr erinnerte die Redaktion in einem ruhig und
würdig gehaltenen Artikel an die flagrante Ungerechtigkeit, die hierin
läge und die Redaktion nahm diesen nicht allein willig auf, sondern
gestand auch ihren Missgriff offenherzig ein. Wir sind dafür dem Herrn
Krämer wie der gedachten Redaktion zu Dank
verpflichtet."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. März 1865: "Freising, im März (1865). Dass es
in Deutschland auch viele gesinnungstüchtige Redaktionen gibt, welche,
wenn man sie in angemessener Weise auf Missgriffe aufmerksam macht,
dieselben gern verbessern, erweist die hier erscheinende 'Bauernzeitung',
die jüngst in zwei Korrespondenzen bei Gelegenheit von Dismembrationen
und Viehhandel der Juden auf eine beschimpfende Weise gebracht hatte. Herr
Lehrer Krämer in Altenmuhr erinnerte die Redaktion in einem ruhig und
würdig gehaltenen Artikel an die flagrante Ungerechtigkeit, die hierin
läge und die Redaktion nahm diesen nicht allein willig auf, sondern
gestand auch ihren Missgriff offenherzig ein. Wir sind dafür dem Herrn
Krämer wie der gedachten Redaktion zu Dank
verpflichtet."
|
Aus der Zeit des Lehrers Jakob Nußbaum
Werbung für die Schülerpension von Lehrer Jakob Nußbaum
(1899)
Anmerkung: Jakob Nußbaum war Lehrer in Altenmuhr von 1894 bis 1917. Er
eröffnet in dieser Zeit auch ein Schülerpensionat und war Lehrer der
allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr.
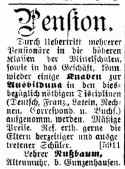 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1899 - Lehrer
Nußbaum wirbt für seiner Schülerpensionat -: "Pension. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1899 - Lehrer
Nußbaum wirbt für seiner Schülerpensionat -: "Pension.
Durch
Übertritt mehrerer Pensionäre in die höheren Klassen der Mittelschulen,
sowie in das Geschäft, können wieder einige Knaben zur Ausbildung in den
diesbezüglich nötigen Disziplinen (Deutsch, Französisch, Latein,
Rechnen, Korrespondenz und Buchführung) aufgenommen werden. Mäßige
Preise. Referenzen erteilen gerne die Eltern derzeitiger und ausgetretener
Schüler.
Lehrer Nußbaum, Altenmuhr, bei Gunzenhausen." |
Hauptlehrer Nußbaum unterhält eine
Pension für Zurückgebliebene und Schwachbegabte Schüler (1915)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:
"Zurückgebliebene und Schwachbegabte finden sichere
Förderung und gute Pflege bei Hauptlehrer Nußbaum,
Altenmuhr (Mittelfranken). Beste Empfehlungen." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:
"Zurückgebliebene und Schwachbegabte finden sichere
Förderung und gute Pflege bei Hauptlehrer Nußbaum,
Altenmuhr (Mittelfranken). Beste Empfehlungen." |
Lehrer Jakob Nußbaum wechselt nach Neumarkt (Oberpfalz) (1917)
 Notiz
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Februar 1917:
"Die israelitische Kultusgemeinde Neumarkt
(Oberpfalz) wählte als Nachfolger des verstorbenen verdienstvollen
Hauptlehrers Oppenheimer seligen Andenkens den Herrn Hauptlehrer Nußbaum
in Altenmuhr zum Lehrer der israelitischen Volksschule und Kantor." Notiz
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Februar 1917:
"Die israelitische Kultusgemeinde Neumarkt
(Oberpfalz) wählte als Nachfolger des verstorbenen verdienstvollen
Hauptlehrers Oppenheimer seligen Andenkens den Herrn Hauptlehrer Nußbaum
in Altenmuhr zum Lehrer der israelitischen Volksschule und Kantor." |
Nachruf zum Tod von Lehrer Jakob Nußbaum (1937)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Februar 1937: "Jakob Nußbaum seligen Andenkens. Am 25. Januar
verschied plötzlich unser lieber Freund, Oberlehrer i.R. Jakob Nußbaum, Neumarkt. Seit 1888, also fast 50 Jahre, gehörte er unserem Bruderbunde
(gemeint: Lehrerverband) als treues Mitglied an. Ein überaus tüchtiger
Schulmann, der neben seiner Schultätigkeit noch jahrzehntelang ein weit
und breit bekanntes und beliebtes Schülerpensionat leitete, ist mit ihm
dahingegangen. In den Gemeinden, in denen er tätig war - Burgebrach von
1888-1894, Altenmuhr 1894-1917, Neumarkt, Oberpfalz seit 1917
wurden ihm wegen seines leutseligen Wesens, seines friedfertigen
Charakters Liebe und Verehrung im weitgehendsten Maße zuteil. Mit Rat und
Tat stand er jedem einzelnen Mitgliede seiner Gemeinden in liebevollster
Weise zur Verfügung. Der Schriftleiter, der Nußbaums Nachfolger in
Altenmuhr war, war oft Zeuge der großen Verehrung, die alt und jung ihrem
Lehrer und Freunde Jakob Nußbaum entgegenbrachte und spürte es so
deutlich wie groß der Vorteil ist, der Nachfolger eines klugen, angesehenen
und pflichteifrigen Lehrers zu sein. Nußbaum war auch ständig auf seine
Weiterbildung bedacht. Er besuchte noch als fast 50jähriger Mann die
Gewerbelehrerkurse in Nürnberg und München und war der Leiter der
allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr. In Lehrerkreisen war er
als kluger, vornehmer Kollege sehr angesehen und gerne hörte man auf
seinen Rat. Im Ruhestand widmete er sich mit besonderer Liebe
gemeindlichen Arbeiten und wurde von der Kultusgemeinde Neumarkt mit dem
Amte des Kultusvorstandes betraut. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
Februar 1937: "Jakob Nußbaum seligen Andenkens. Am 25. Januar
verschied plötzlich unser lieber Freund, Oberlehrer i.R. Jakob Nußbaum, Neumarkt. Seit 1888, also fast 50 Jahre, gehörte er unserem Bruderbunde
(gemeint: Lehrerverband) als treues Mitglied an. Ein überaus tüchtiger
Schulmann, der neben seiner Schultätigkeit noch jahrzehntelang ein weit
und breit bekanntes und beliebtes Schülerpensionat leitete, ist mit ihm
dahingegangen. In den Gemeinden, in denen er tätig war - Burgebrach von
1888-1894, Altenmuhr 1894-1917, Neumarkt, Oberpfalz seit 1917
wurden ihm wegen seines leutseligen Wesens, seines friedfertigen
Charakters Liebe und Verehrung im weitgehendsten Maße zuteil. Mit Rat und
Tat stand er jedem einzelnen Mitgliede seiner Gemeinden in liebevollster
Weise zur Verfügung. Der Schriftleiter, der Nußbaums Nachfolger in
Altenmuhr war, war oft Zeuge der großen Verehrung, die alt und jung ihrem
Lehrer und Freunde Jakob Nußbaum entgegenbrachte und spürte es so
deutlich wie groß der Vorteil ist, der Nachfolger eines klugen, angesehenen
und pflichteifrigen Lehrers zu sein. Nußbaum war auch ständig auf seine
Weiterbildung bedacht. Er besuchte noch als fast 50jähriger Mann die
Gewerbelehrerkurse in Nürnberg und München und war der Leiter der
allgemeinen Fortbildungsschule in Altenmuhr. In Lehrerkreisen war er
als kluger, vornehmer Kollege sehr angesehen und gerne hörte man auf
seinen Rat. Im Ruhestand widmete er sich mit besonderer Liebe
gemeindlichen Arbeiten und wurde von der Kultusgemeinde Neumarkt mit dem
Amte des Kultusvorstandes betraut.
Um den so plötzlich Heimgegangenen klagt nicht nur seine Gattin, die ihm
stets die treueste Lebensgefährtin war, seine Kinder, die jüdische
Lehrerschaft Bayerns, seine vielen Schüler und seine Gemeinden, sondern
darüber hinaus trauert um ihn eine große Anzahl Freunde, die die Liebe,
die sie ihm im Leben entgegenbrachten, ihm auch übers Grab hinaus
bewahren werden. Der jüdische Lehrerverein Bayern wird ihm ein treues
Gedenken bewahren. A." |
Über
Lehrer Max Adler (bis 1923 Lehrer in Altenmuhr)
(Quelle: Barbara Kowalzik: Lehrerbuch. Die Lehrer und Lehrerinnen des
Leipziger Schulwerks 1912-1942. Leipzig 2006. S. 129; vgl. Strätz
Biographisches Handbuch Würzburger Juden I S. 51)
| Max Adler (geb. 1894 in Brückenau,
ermordet nach Deportation in Kaunas im November 1941): Ausbildung in der
Präparandenschule in Burgpreppach
und 1910 bis 1913 an der ILBA in Würzburg;
1914 bis 1918 beim Militärdienst; nach Rückkehr aus dem Kriegsdienst
Lehrer in Gochsheim, dann bis 1923
in Altenmuhr; seit 1921 verheiratet mit Else geb. Blatt (Tochter
des Oberlehrers der jüdischen Schule in Obbach
Nathan Blatt); 1923/24 an der Israelitischen Mädchenschule in Leipzig;
seit 1924 Lehrer an der Münchener orthodoxen jüdischen Volksschule,
später Leiter dieser Schule; war Vorstandsmitglied der israelitischen
Kultusgemeinde München. Mit Ehefrau und Sohn Raphael nach Kaunas
deportiert und ermordet. |
Zur Frage nach der
Zugehörigkeit Altenmuhrs zu einem Rabbinatsbezirk nach dem Tod von Rabbiner
Abraham Böhm in Gunzenhausen (1845)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1846: "Dieser Tage verstarb in Gunzenhausen der Rabbiner Abraham
Böheim (eigentlich Böhm) in einem Alter von 78 Jahren. Im Jahre 1814 war
ihm die 'interimistische Versehung' der Stelle verliehen worden, welche
ihm auch, da die Gemeinden mit ihm zufrieden war, bis zu seinem Ende
verblieb. Die Wiederbesetzung dieser Stelle mit einem tüchtigen Manne
wäre freilich das Erwünschteste, indes ist dazu wenig Hoffnung
vorhanden. Es werden sich die drei diesen Bezirk bildenden Gemeinden,
Gunzenhausen, Altenmuhr und Cronheim,
wahrscheinlich benachbarten Rabbinaten anschließen, wodurch diesen ein
erwünschter Zufluss zuteil werden wird."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar
1846: "Dieser Tage verstarb in Gunzenhausen der Rabbiner Abraham
Böheim (eigentlich Böhm) in einem Alter von 78 Jahren. Im Jahre 1814 war
ihm die 'interimistische Versehung' der Stelle verliehen worden, welche
ihm auch, da die Gemeinden mit ihm zufrieden war, bis zu seinem Ende
verblieb. Die Wiederbesetzung dieser Stelle mit einem tüchtigen Manne
wäre freilich das Erwünschteste, indes ist dazu wenig Hoffnung
vorhanden. Es werden sich die drei diesen Bezirk bildenden Gemeinden,
Gunzenhausen, Altenmuhr und Cronheim,
wahrscheinlich benachbarten Rabbinaten anschließen, wodurch diesen ein
erwünschter Zufluss zuteil werden wird." |
Artikel zu einzelnen Gemeindegliedern
Über
Simon Mohr und seine Erfolge als Ökonomie-Besitzer (1837)
 Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung des Judentums" vom 25. November 1837: "Altenmuhr im bayerischen
Rezatkreis, 8. November (1837). Am 12. September dieses Jahres hat der Comité
des landwirtschaftlichen Vereines im Rezatkreise dem israelitischen Ökonomie-Besitzer,
Herrn Simon Mohr von hier, die große, silberne Vereinsdenkmünze samt Fahne als
zweiten Preis für seine ausgezeichneten Kulturunternehmungen öffentlich
zuerkannt. Derselbe hatte nämlich eine, in hiesiger Flurmarkung gelegene, 19
Morgen große Ödung, deren Kultivierung der Staat, als sie noch sein Eigentum
war, vergebens versucht hatte, an sich gekauft, und sie durch Sachkenntnis und
Kostenaufwand, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, auf einen sehr hohen Stand von
Kultur gebracht. Artikel in der "Allgemeinen
Zeitung des Judentums" vom 25. November 1837: "Altenmuhr im bayerischen
Rezatkreis, 8. November (1837). Am 12. September dieses Jahres hat der Comité
des landwirtschaftlichen Vereines im Rezatkreise dem israelitischen Ökonomie-Besitzer,
Herrn Simon Mohr von hier, die große, silberne Vereinsdenkmünze samt Fahne als
zweiten Preis für seine ausgezeichneten Kulturunternehmungen öffentlich
zuerkannt. Derselbe hatte nämlich eine, in hiesiger Flurmarkung gelegene, 19
Morgen große Ödung, deren Kultivierung der Staat, als sie noch sein Eigentum
war, vergebens versucht hatte, an sich gekauft, und sie durch Sachkenntnis und
Kostenaufwand, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, auf einen sehr hohen Stand von
Kultur gebracht.
Eine solche Erscheinung ehrt nicht nur den Preisempfänger und das unparteiische
Preisgericht, welches einen christlichen Bewerber dem jüdischen nachstehen ließ,
sondern zeigt auch, dass der bayerische Israelit nirgends zurückbleibt, und
widerlegt die Vorurteile, welche von Hohen und Niedern gegen uns gehegt werden." |
Brief eines in Jerusalem sich aufhaltenden jungen
Mannes aus Altenmuhr in seine Heimat (1847)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 7. September
1847: "Soeben wird mir ein jüdisch-deutscher Brief, den ein junger
Mann aus Altenmuhr von Jerusalem aus, an seine Verwandten schrieb -
[hebräisches Datum des Briefes] - mir scheint dieser Brief so
interessant, dass ich ihn übertragen und Ihnen zusenden werde, wenn Sie
es wünschen. Der Schreiber, ein Schneider von Profession, ist mir
bekannt, da Altenmuhr bei Gunzenhausen, nur 9 Stunden von hier entfernt
ist, und der Mann selbst hier gearbeitet hat. Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 7. September
1847: "Soeben wird mir ein jüdisch-deutscher Brief, den ein junger
Mann aus Altenmuhr von Jerusalem aus, an seine Verwandten schrieb -
[hebräisches Datum des Briefes] - mir scheint dieser Brief so
interessant, dass ich ihn übertragen und Ihnen zusenden werde, wenn Sie
es wünschen. Der Schreiber, ein Schneider von Profession, ist mir
bekannt, da Altenmuhr bei Gunzenhausen, nur 9 Stunden von hier entfernt
ist, und der Mann selbst hier gearbeitet hat.
Altenmuhr ist wie alle Gemeinden im Altmühlgrund streng orthodox,
wenngleich der Korrespondent aus Mittelfranken im 'Israelit des 19.
Jahrhundert' Herr Krämer, Lehrer daselbst ist". |
Zum Tod von David Richard (1868)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1868: "Altenmuhr
in Mittelfranken. Die Nachricht von dem Hinscheiden eines echt religiösen
Israeliten soll das Herz eines jeden Gläubigen mit Trauer erfüllen;
zugleich soll aber auch eine solche Nachricht die Triebfeder sein,
anzueifern, dem verstorbenen Muster und Vorbild nachzuahmen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1868: "Altenmuhr
in Mittelfranken. Die Nachricht von dem Hinscheiden eines echt religiösen
Israeliten soll das Herz eines jeden Gläubigen mit Trauer erfüllen;
zugleich soll aber auch eine solche Nachricht die Triebfeder sein,
anzueifern, dem verstorbenen Muster und Vorbild nachzuahmen.
So schloss dahier am 1. Schewat (= 25. Januar 1868) ein Mann namens
David Richard seine irdische Laufbahn in einem Alter von 72 Jahren, von
denen er 40 Jahre in glücklicher Ehe verlebte. Er war ein treuer Gatte
und liebevoller Vater, und mit vollem Rechte flossen reichliche
Tränenströme von seiner zurückgelassenen Gattin und seinen Kindern,
welche Letztere aus der Ferne herbeieilten, um den Geliebten auf seinem
letzten Gange zu begleiten. Er war ein ehrenwertes Mitglied seiner
Glaubensgemeinde. Seine Hingebung und Treue an dieselbe hat ihm die
Achtung aller erworben und herb ist der Schmerz seines Verlustes. Viele,
viele Jahre hindurch versah er an den ehrfurchtgebietenden Tagen
die Stelle des ehrenamtlichen Vorbeters. Und mit welcher Andacht
und mit welcher Innigkeit stand er das vor seinem himmlischen Herrn; alle,
die ihn hörten, wurden zur Andacht hingezogen. Als Verantwortlicher
für die Wohltätigkeit genoss er das vollkommenste Vertrauen und wie
freue er sich, wenn viele Armengelder eingingen, um dadurch das Wege
anderer nach Umständen lindern zu können. Auch das Amt als Kassier der Erez-Israel-Gelder
versah er, und ganze Tage legte er sein häusliches Geschäft beiseite, um
diese Liebeshaben dahier einzuheben. Und diese Tage, wo ihm die Spenden in
Fülle gereicht wurden, das waren seine Freudentage.
Sein Seelenheil ging ihm über alles Vergängliche, sein religiöser Sinn
bewährte sich in allen Lagen des Lebens; ncihts konnte ihn beirrten, die
Bahn der Tugend zu zu verlassen, denn das Licht der (göttlichen)
Weisung und der Tora war (sein) Licht. Sein ganzes Leben war ein
liebevolles Benehmen gegen jedermann mit herzliches Offenheit und
Redlichkeit. Im letzten Augenblicke - das Augen nach oben gerichtet -
spielte ein heiliges Lächeln auf seinem Angesichte und er starb - mit
einem Kuss (Gottes). Ihm, den nun in den höheren Regionen Wohnenden,
rufen wir zu. 'und es zieht voran deine Gerechtigkeit, und die
Herrlichkeit des Ewigen schließt deinen Zug' (Jesaja 58,8)." |
Handelsmann L. Feldmann rettete den Taglöhner Denzinger vor dem Ertrinken
(1872)
 Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872:
"Aus Bayern. Der Taglöhner Johann Denzinger von Altenmuhr ritt am
25. dieses Monats (gemeint Juli 1872), Abends 5 Uhr, das Pferd seines
Dienstherrn, des Handelsmanns Herrn L. Feldmann von da, in die Schwemme.
Um seine Gewandtheit im Reiten vor seinem ihn begleitenden Herrn zu
zeigen, lenkte er das Pferd auf eine Stelle in der Altmühl, die wegen
ihrer gefährlichen Tiefe allgemein bekannt ist. Auf einmal verschwanden
Pferde und Reiter vor den Augen des Herrn Feldmann. Nach einiger Zeit kam
wohl das Pferd, aber nicht der Mann an die Oberfläche des Wassers. Ohne
sich noch lange zu besinnen, sprang Feldmann in seinem ganzen Anzug in das
Wasser und rettete mit eigener Lebensgefahr den Denzinger. Dieser edle
Liebesdienst verdient auch in entfernteren Kreisen bekannt zu
werden." Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872:
"Aus Bayern. Der Taglöhner Johann Denzinger von Altenmuhr ritt am
25. dieses Monats (gemeint Juli 1872), Abends 5 Uhr, das Pferd seines
Dienstherrn, des Handelsmanns Herrn L. Feldmann von da, in die Schwemme.
Um seine Gewandtheit im Reiten vor seinem ihn begleitenden Herrn zu
zeigen, lenkte er das Pferd auf eine Stelle in der Altmühl, die wegen
ihrer gefährlichen Tiefe allgemein bekannt ist. Auf einmal verschwanden
Pferde und Reiter vor den Augen des Herrn Feldmann. Nach einiger Zeit kam
wohl das Pferd, aber nicht der Mann an die Oberfläche des Wassers. Ohne
sich noch lange zu besinnen, sprang Feldmann in seinem ganzen Anzug in das
Wasser und rettete mit eigener Lebensgefahr den Denzinger. Dieser edle
Liebesdienst verdient auch in entfernteren Kreisen bekannt zu
werden." |
Zum Tod von Jakob Weissmann (1876)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1876:
"Altenmuhr, im November. 'Gefallen ist die Krone von unserem
Haupte'. Eine Zierde unserer Gemeinde ist uns durch den Tod entrissen
worden, und der Dahingeschiedene - obwohl Bescheidenheit seine Parole war
- ist es wert, von seinem edlen Leben und Streben in die Öffentlichkeit
treten zu lassen, ihm zur Ehre, den Hinterbliebenen zum Troste und der
Gemeinde zum Muster und zur Nachahnung. Am 12. Mascheschwan (= 30.
Oktober 1876) rief unerwartet und schnell der Tod einen geradsinnigen
und rechten Mann - Jakob Weißmann von hier, in einem Alter von 72
Jahren, vom Schauplatze dieser Welt ab, um dort im reichlichen Maße die
Früchte seiner Taten zu genießen. Anspruchslos versah er 50 Jahre
lang die Stelle eines ehrenamtlichen Vorbeters an den heiligen ehrfurchtgebietenden
Tagen (d.i. zwischen den Festtagen im Herbst) in gottgefälliger
Andacht mit Innigkeit und religiösem Sinne, wissend, was er betete, und
erweckte er so das Herz sämtlicher Zuhörer. In der Nähe der Synagoge
wohnend, war er ein guter Nachbar, denn stets war er Einer der
Ersten in der Synagoge, und (im Sinne von:) 'erkenn, vor wem du
stehst' harrte er aus bis zum Schlusse. Unsere Heilige Tora war
seine Lieblings-Lektüre, woraus derselbe seinen Durst nach Kenntnis
stillte, nicht um darauf stolz zu sein, sondern um dies zu
bewahren und zu tun. Von der Tugend des Friedens wich er - der
Aronsschüler - keinen Augenblick und das Gebot, nie jemanden mit der
Zunge zu verleumden (frei übs.) ward nie von ihm verletzt. Er war ein
treuer Gatte, ein sorgsamer Familienvater... Der Dahingeschiedene hing mit
ungeteiltem Herzen an seiner Gattin und so hauchte er auch seine edle
Seele in den Armen seiner treuen Frau aus. Die allgemeine Trauer und
Teilnahme um den Verklärten ist das beste Zeugnis für seinen guten
Namen (frei übs.). Friede seiner Asche! Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1876:
"Altenmuhr, im November. 'Gefallen ist die Krone von unserem
Haupte'. Eine Zierde unserer Gemeinde ist uns durch den Tod entrissen
worden, und der Dahingeschiedene - obwohl Bescheidenheit seine Parole war
- ist es wert, von seinem edlen Leben und Streben in die Öffentlichkeit
treten zu lassen, ihm zur Ehre, den Hinterbliebenen zum Troste und der
Gemeinde zum Muster und zur Nachahnung. Am 12. Mascheschwan (= 30.
Oktober 1876) rief unerwartet und schnell der Tod einen geradsinnigen
und rechten Mann - Jakob Weißmann von hier, in einem Alter von 72
Jahren, vom Schauplatze dieser Welt ab, um dort im reichlichen Maße die
Früchte seiner Taten zu genießen. Anspruchslos versah er 50 Jahre
lang die Stelle eines ehrenamtlichen Vorbeters an den heiligen ehrfurchtgebietenden
Tagen (d.i. zwischen den Festtagen im Herbst) in gottgefälliger
Andacht mit Innigkeit und religiösem Sinne, wissend, was er betete, und
erweckte er so das Herz sämtlicher Zuhörer. In der Nähe der Synagoge
wohnend, war er ein guter Nachbar, denn stets war er Einer der
Ersten in der Synagoge, und (im Sinne von:) 'erkenn, vor wem du
stehst' harrte er aus bis zum Schlusse. Unsere Heilige Tora war
seine Lieblings-Lektüre, woraus derselbe seinen Durst nach Kenntnis
stillte, nicht um darauf stolz zu sein, sondern um dies zu
bewahren und zu tun. Von der Tugend des Friedens wich er - der
Aronsschüler - keinen Augenblick und das Gebot, nie jemanden mit der
Zunge zu verleumden (frei übs.) ward nie von ihm verletzt. Er war ein
treuer Gatte, ein sorgsamer Familienvater... Der Dahingeschiedene hing mit
ungeteiltem Herzen an seiner Gattin und so hauchte er auch seine edle
Seele in den Armen seiner treuen Frau aus. Die allgemeine Trauer und
Teilnahme um den Verklärten ist das beste Zeugnis für seinen guten
Namen (frei übs.). Friede seiner Asche! |
Zum Tod von Jette Neustädter geb. Feldmann (geb. in Altenmuhr, gest. 1934 in
Demmelsdorf)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1934:
"Sulzbürg, 12. November
(1934). Hier wurde Frau Jette Neustädter geb. Feldmann im Alter
von fast 79 Jahren auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebracht. In Altenmuhr
geboren, gründete sie in Sulzbürg
an der Seite ihres noch heute in der Erinnerung der Gemeinde unvergessenen
Jakob David Neustädter eine Ehegemeinschaft, in der tiefste Frömmigkeit,
vorbildliche Rechtlichkeit und geradezu patriarchalische Häuslichkeit und
Schlichtheit herrschten. Eine große Anzahl von Kindern wurde dem Ehepaar
geschenkt. Sie alle zogen in die weite Welt hinaus und sie alle bereiteten
dem Namen ihrer Eltern als treue Juden und wackere, tadellose Menschen
Ehre. Bereits vor 19 Jahren ist ihr Gatte ihr im Tode vorausgegangen, und
sie stand allein. Aber sie war nicht allein. Die vielen Kinder in allen
Gegenden des Landes wetteiferten miteinander, sie mit ihrer Liebe zu
überhäufen und ihr ein Teil dessen zu vergelten, was sie als aufopfernde
Mutter ihnen getan. So verbrachte sie ihren Lebensabend in der liebvollen
Umgebung und Pflege der Familien ihrer Kinder, bald hier, bald dort; und
überall war sie geboren. Bei einer ihrer Töchter in Demmelsdorf,
die wenige Wochen vorher erst selbst furchtbar durch den Tod ihres braven
Mannes heimgesucht war, erreichte sie trotz hingebungsvoller Pflege das
Ende, dem sie in frommer Ergebung sein Jahren schon ruhig entgegengeschaut
hatte. Und pietätvoll erfüllte man ihren letzten Wunsch und brachte sie
hier in Sulzbürg an der Seite ihres
Gatten zur ewigen Ruhe. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg aus Regensburg fand
am Grabe herzliche und aufrichtige Worte des Abschiedes für diese seltene
Frau, die stets auch als eine treue Freundin seines Hauses sich bewiesen
hat."
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November 1934:
"Sulzbürg, 12. November
(1934). Hier wurde Frau Jette Neustädter geb. Feldmann im Alter
von fast 79 Jahren auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebracht. In Altenmuhr
geboren, gründete sie in Sulzbürg
an der Seite ihres noch heute in der Erinnerung der Gemeinde unvergessenen
Jakob David Neustädter eine Ehegemeinschaft, in der tiefste Frömmigkeit,
vorbildliche Rechtlichkeit und geradezu patriarchalische Häuslichkeit und
Schlichtheit herrschten. Eine große Anzahl von Kindern wurde dem Ehepaar
geschenkt. Sie alle zogen in die weite Welt hinaus und sie alle bereiteten
dem Namen ihrer Eltern als treue Juden und wackere, tadellose Menschen
Ehre. Bereits vor 19 Jahren ist ihr Gatte ihr im Tode vorausgegangen, und
sie stand allein. Aber sie war nicht allein. Die vielen Kinder in allen
Gegenden des Landes wetteiferten miteinander, sie mit ihrer Liebe zu
überhäufen und ihr ein Teil dessen zu vergelten, was sie als aufopfernde
Mutter ihnen getan. So verbrachte sie ihren Lebensabend in der liebvollen
Umgebung und Pflege der Familien ihrer Kinder, bald hier, bald dort; und
überall war sie geboren. Bei einer ihrer Töchter in Demmelsdorf,
die wenige Wochen vorher erst selbst furchtbar durch den Tod ihres braven
Mannes heimgesucht war, erreichte sie trotz hingebungsvoller Pflege das
Ende, dem sie in frommer Ergebung sein Jahren schon ruhig entgegengeschaut
hatte. Und pietätvoll erfüllte man ihren letzten Wunsch und brachte sie
hier in Sulzbürg an der Seite ihres
Gatten zur ewigen Ruhe. Bezirksrabbiner Dr. Weinberg aus Regensburg fand
am Grabe herzliche und aufrichtige Worte des Abschiedes für diese seltene
Frau, die stets auch als eine treue Freundin seines Hauses sich bewiesen
hat." |
Zum Tod von Thekla Richard (1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1936:
"Altenmuhr (2. Januar). Am 31. Dezember verschied nach kurzem Leiden
im Alter von nur 53 Jahren die Gattin unseres Parnes (Gemeindevorstehers),
Frau Thekla Richard. Eine brave, fromme Frau ist unserer kleinen Kehilloh
(Gemeinde) entrissen worden. Ihr Haus war stets der Mittelpunkt der
jüdischen Gemeinde, ja bis vor kurzem der Mittelpunkt des ganzen Ortes.
Hier fand man sich zusammen, wenn man Rat und Hilfe brauchte, hier fanden
die armen und Dürftigen freundliche Aufnahme und reichliche
Unterstützung, hier wurde in vornehmer und vorbildlicher Weise wahre
jüdische Zedokoh (Gerechtigkeit) geübt. So war sie in allen
Kreisen der Bevölkerung, in jüdischer und nichtjüdischer, geschätzt
und geehrt. Ihr Haus machte sie zu einem Heiligtum, in dem sie als
Priesterin in selbstloser und bescheidener Weise ihres Amtes waltete.
Ihrem Gatten schenkte sie die denkbar schönste Ehe und ihren drei
Söhnen, die sie in Gottesfurcht und Menschenliebe erzog, war sie die
vorbildlichste, besorgteste Mutter. So hatte sie das große Glück, ihre
Kinder zu treuen, frommen Juden, voll tiefen jüdischen Wissens und zu
angesehenen Menschen heranreifen zu sehen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1936:
"Altenmuhr (2. Januar). Am 31. Dezember verschied nach kurzem Leiden
im Alter von nur 53 Jahren die Gattin unseres Parnes (Gemeindevorstehers),
Frau Thekla Richard. Eine brave, fromme Frau ist unserer kleinen Kehilloh
(Gemeinde) entrissen worden. Ihr Haus war stets der Mittelpunkt der
jüdischen Gemeinde, ja bis vor kurzem der Mittelpunkt des ganzen Ortes.
Hier fand man sich zusammen, wenn man Rat und Hilfe brauchte, hier fanden
die armen und Dürftigen freundliche Aufnahme und reichliche
Unterstützung, hier wurde in vornehmer und vorbildlicher Weise wahre
jüdische Zedokoh (Gerechtigkeit) geübt. So war sie in allen
Kreisen der Bevölkerung, in jüdischer und nichtjüdischer, geschätzt
und geehrt. Ihr Haus machte sie zu einem Heiligtum, in dem sie als
Priesterin in selbstloser und bescheidener Weise ihres Amtes waltete.
Ihrem Gatten schenkte sie die denkbar schönste Ehe und ihren drei
Söhnen, die sie in Gottesfurcht und Menschenliebe erzog, war sie die
vorbildlichste, besorgteste Mutter. So hatte sie das große Glück, ihre
Kinder zu treuen, frommen Juden, voll tiefen jüdischen Wissens und zu
angesehenen Menschen heranreifen zu sehen.
Vor dem Trauerhause gab Herr Bezirksrabbiner Dr. Munk, Ansbach, der
allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Am Grabe zeichnete Herr Hauptlehrer
Adler, München, ein früherer Lehrer unserer Gemeinde und ein treuer
Freund der Familie Richard, ein Bild der Heimgegangenen. Ihre Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Verlobungs- und Hochzeitssanzeige von Herta Gutmann und Justin Richard
(1933)
Anmerkung: in der Hochzeitsanzeige ist Richard in Ruhard
verschrieben
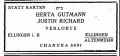 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1933: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1933:
"Statt Karten - Gott sei gepriesen - Herta Gutmann - Justin
Richard - Verlobte.
Ellingen i.B. - Ellingen
/ Altenmuhr. Chanukka 5694". |
| |
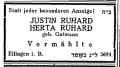 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1934:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Mai 1934:
"Statt jeder besonderen Anzeige! Gott sei gepriesen.
Justin Richard - Herta Richard geb. Gutmann. Vermählte.
Ellingen in Bayern. Lag BaOmer 5694 ( = 3. Mai 1934)". |
Verlobungsanzeige von Ilse Hirschberger und Simon Richard
(1938)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938: "Gott
sei gepriesen. Wir haben uns verlobt: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938: "Gott
sei gepriesen. Wir haben uns verlobt:
Ilse Hirschberger - Simon Richard.
Stadtlauringen / 675 Westend Ave 4B New York City
- Altenmuhr / 72 Samner Ave Brooklyn - N.Y." |
Zur Geschichte der Synagoge
Ein Betraum war bereits
im 18. Jahrhundert vorhanden. 1803 errichtete die jüdische
Gemeinden im Judenhof eine Synagoge. Diese war 18 Meter lang und achteinhalb
Meter breit und hatte ein Walmdach. Im Westteil wurde eine Wohnung für den
Vorbeter eingerichtet. Die Wohnung wurde später als Bibliothek genutzt. Ende
des 19. Jahrhunderts war hier auch eine Schreinerei, in der ein nichtjüdischer
Schreiner die Särge für die verstorbenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde
zimmerte. In der Synagoge war Platz für achtzig Männer und 40 Frauen. Der
Eingang war an der Südseite des Gebäudes. An der Nordseite wurde nach dem
Ersten Weltkrieg eine Gedenktafel für die gefallenen jüdischen Soldaten aus
Altenmuhr angebracht.
Über 130 Jahre war die Synagoge in Altenmuhr Mittelpunkt des religiösen Lebens der jüdischen
Gemeinde. Einzelne Berichte über gottesdienstliche Feiern liegen noch vor. So
erschien am 1. März 1886 in der Zeitschrift "Der Israelit" ein Artikel, in dem
über die Einweihung einer neuen Torarolle und über eine Goldene Hochzeit in
der Synagoge in Altenmuhr berichtet wurde:
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. März 1886: "Altenmuhr in
Mittelfranken. Wenn bis jetzt keine Berichte vom hiesigen Platze zur Veröffentlichung
im ‚Israelit’ kamen, so ist dieses mehr der Bescheidenheit zuzuschreiben, da
z.B. im vorigen Jahre (1885) dahier eine Toraweihe stattfand, die sich
derartigen Feierlichkeiten an größeren Plätzen zur Seite hätte stellen können,
sowohl hinsichtlich der frommen Absicht, als auch des äußerlichen Vollzugs
derselben. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. März 1886: "Altenmuhr in
Mittelfranken. Wenn bis jetzt keine Berichte vom hiesigen Platze zur Veröffentlichung
im ‚Israelit’ kamen, so ist dieses mehr der Bescheidenheit zuzuschreiben, da
z.B. im vorigen Jahre (1885) dahier eine Toraweihe stattfand, die sich
derartigen Feierlichkeiten an größeren Plätzen zur Seite hätte stellen können,
sowohl hinsichtlich der frommen Absicht, als auch des äußerlichen Vollzugs
derselben.
Eine goldene Hochzeitsfeier, die am 17. dieses Monats (Februar 1886) dahier
stattfand, verdient jedoch zur Offenkunde in einem jüdischen Blatte gebracht zu
werden, schon wegen der Feier selbst, als auch wegen der regen Beteiligung, die
damit verbunden war. Der israelitische Handelsmann Veis Flink von hier, ein
Greis von nahe 80 Jahren feierte an der Seite seiner Ehehälfte auf Anregung
treuliebender Söhne und Töchter dieses Fest. Der Jubilar versieht seit langen
Jahren den Posten des Baal tefila
(Vorbeter) an den heiligsten Festtagen, wozu ihn das Organ und das richtige
Verständnis des Wortlautes befähigt und der es auch versteht, die Andacht der
Zuhörer zu erregen und zu erheben. Der Jubilar war selbst in beschränkten
Lebensverhältnissen ein treuer und hilfreicher Sohn seiner Eltern und findet
sich dadurch der Schlusssatz des fünften Gebotes bewahrheit lemaan jirbu jameicha (‚auf dass du lange lebest’). Von seite
des Herrn Rabbiners Grünbaum in Ansbach wurde dem Feste eine besondere Weihe
verliehen, indem er das Jubelpaar in die Synagoge begleitet, wobei zuerst das Mincha-Gebet
(Mittags-Gebet) verrichtet, einige Psalmen rezitiert, dann die Festpredigt mit
Zugrundlegung des Textes säh hajom asah
(‚dies ist der Tag, den er gemacht hat…’) gehalten und wurde der Sinn des
Verses in meisterhafter Weise erklärt. Hierauf folgte eine Rezitation zweier
anderer Psalmen nebst einem Schlussworte des Herrn Kanzelredners, womit die dem
Tage entsprechende religiöse Feier ihren Abschluss fand. Das Gotteshaus war,
obwohl die Feier mittags um 1 Uhr stattfand, festlich beleuchtet und von den Gläubigen
aller Konfessionen von hier und nächster Umgebung so anfüllt, dass Kopf an
Kopf stand. Ein herrliches Mahl versammelte die Festteilnehmer; alles verlief in
fröhlicher Stimmung, wobei aber auch eine Sammlung für eine Wohltätigkeits-Anstalt
vorgenommen wurde. Möge dem Jubelpaar noch eine lange Zeit zur Erinnerung
dieses Tages gegönnt werden." |
Nach einer 1934 erstellten Liste der Ritualien waren in der
Synagoge vorhanden: zehn Torarollen, zwanzig bestickte Toramäntel, sechs
Torakronen, fünf Toraschilder, fünf Lesefinger und eine Ester-Rolle. Es gab
sechs Messingleuchter und einen prächtigen Chanukkaleuchter.
Ein Gedenkstein wurde am 21. November 1986 aufgestellt. Er
trägt die Inschrift: "Hier stand bis 1968 eine Synagoge. 1985. Zum
Gedenken an die jüdische Gemeinde, die über 300 Jahre in Altenmuhr
bestand." Der Gedenkstein wurde nach einem Entwurf von Jörg Kutzer
(Ansbach) gestaltet. Die Jahreszahl 1985 (trotz Aufstellung 1986) auf dem
Gedenkstein erinnert daran, dass sich die ursprünglich geplante Aufstellung
1985 verzögert hatte.
Adresse/Standort der Synagoge: Judenhof 25
Fotos
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 30.7.2006)
 |
 |
 |
Blick in einen Teilbereich
des
"Judenhofes" |
Das Gebäude der ehemaligen
jüdischen Schule |
Hausnummer am ehemaligen
jüdischen Schulhaus |
| |
|
|
 |
 |
 |
Eingang zur ehemaligen
jüdischen Schule |
Blick auf das Grundstück der
ehemaligen Synagoge |
Der 1986 aufgestellte
Gedenkstein |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 155-156. |
 | Wilfried Jung: Ehemalige Judengemeinden - Altenmuhr
(Mittelfranken). In: Der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in
Bayern. Januar 1987 S. 23. |
 | ders.: Die Juden in Altenmuhr. Heft 44 1988 der Reihe
"Alt Gunzenhausen". S. 113-212. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 143-144. 1992² S.
150. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 266-268.
|
 |  "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010. "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band II:
Mittelfranken.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt, Cornelia Berger-Dittscheid,
Hans-Christof Haas und Angela Hager, unter Mitarbeit von
Frank Purrmann und Axel Töllner. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern, Teilband 2: Mittelfranken. Lindenberg im Allgäu 2010.
Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu.
ISBN 978-3-89870-448-9. Abschnitt zu Altenmuhr S. 39-44.
|
 | Mamiko Ikenaga: Die Ghettogeschichte von Simon
Krämer, "Götz Silber". Online
zugänglich (pdf-Datei) |
 |
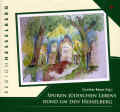 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,
Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de.
|
 | Franziska Heyde: Das Leben der Fanny Birkenruth
geb. Freundlich. 2022. ISBN 978-3-00-073862-3. € 18,00. Kontakt-Bestellung:
c.f.heyde@t-online.de
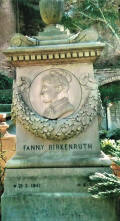 Zu
dieser Publikation: "Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie, oft über
Generationen gehütet, bis durch Zufall aufkommt, was wirklich war. Fanny
Birkenruth geb. Freundlich (1841-1912), entstammt dem orthodoxen
Landjudentum aus Wittelshofen nahe
dem mittelfränkischen Dinkelsbühl. Gezwungenermaßen, als Folge einer
Liebesziehung zu ihrem jüdischen Cousin aus Altenmuhr, verlässt sie
als junge Frau ihren Geburtsort und wird sich später als Salonière in
aristokratisch-protestantischen Kulturkreisen Roms der Jahrhundertwende
etablieren. Ihr imposantes Grabmal auf dem berühmten römischen Friedhof, 'Cimitero
acattolico' (Foto links) neben denen ihrer nächsten Freundin, der
damals prominenten Schriftstellerin Malwida von Meysenbug und neben August
v. Goethe Filius, zeugen noch heute davon. Aber Fanny beginnt früh,
Geheimnisse um ihre Person zu spinnen, belastend für ihre unmittelbaren
Nachkommen und dann lebensrettend in der NS-Diktatur, Geheimnisse, die
unaufgelöst bis in spätere Generationen wirken werden. Zu
dieser Publikation: "Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie, oft über
Generationen gehütet, bis durch Zufall aufkommt, was wirklich war. Fanny
Birkenruth geb. Freundlich (1841-1912), entstammt dem orthodoxen
Landjudentum aus Wittelshofen nahe
dem mittelfränkischen Dinkelsbühl. Gezwungenermaßen, als Folge einer
Liebesziehung zu ihrem jüdischen Cousin aus Altenmuhr, verlässt sie
als junge Frau ihren Geburtsort und wird sich später als Salonière in
aristokratisch-protestantischen Kulturkreisen Roms der Jahrhundertwende
etablieren. Ihr imposantes Grabmal auf dem berühmten römischen Friedhof, 'Cimitero
acattolico' (Foto links) neben denen ihrer nächsten Freundin, der
damals prominenten Schriftstellerin Malwida von Meysenbug und neben August
v. Goethe Filius, zeugen noch heute davon. Aber Fanny beginnt früh,
Geheimnisse um ihre Person zu spinnen, belastend für ihre unmittelbaren
Nachkommen und dann lebensrettend in der NS-Diktatur, Geheimnisse, die
unaufgelöst bis in spätere Generationen wirken werden.
Das vorliegende, akribisch recherchierte Werk macht es sich zur Aufgabe,
dieses Gespinst an Geheimnissen aufzulösen, durch Nachlass-Aufarbeitungen,
Entschlüsselung historischer Dokumente, Archiv-Einsichten sowie
Korrespondenzen, persönliche Gespräche mit Nachfahren und spezialisierten
Historikern und mit Hilfe ihres familientherapeutischen Hintergrundwissens:
Die Autorin deckt auf, wie Fannys Familiengeheimnis posthum für ihre
jüdischen Nachkommen während der Shoah zur dramatischen Rettung wird und
dadurch dessen Geheimhaltung nochmals verstärkt. Dieses Spannungsfeld der
Ungereimtheiten nimmt die Autorin zeitlebens wahr und es gelingt ihr zu
großen Teilen, die Wahrheiten sukzessive zu entfalten und ein beeindrucken
realistisches Tableau vor dem Hintergrund der Herkunft aus dem fränkischen
Landjudentum zu entwerfen. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Altenmuhr Middle Fanconia. A
Jewish community was present in the first half of the 18th century, reaching a
population of 250 in 1837 (total 720). A synagogue was built in 1815. In 1933
the Jewish population was 29. In the face of the Nazi economic boycott the Jews
were forced to buy their food and coal outside the village. By 1937, 25 had left.
In Kristallnacht (9-10 November 1938) the synagogue was vandalized and the last
three Jews soon emigrated to the United States.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|