|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Bad Kissingen
Weitere Seiten:
Bad Kissingen (Kreisstadt)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte Bad Kissingens
Kultusbeamte - Gemeinde- und Vereinsleben - Berichte zu einzelnen Personen
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Bad Kissingen wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Übersicht:
 | Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer
Kultusbeamten
- Ausschreibung
der Vorsängerstelle (1867)
- Ausschreibung
der Stelle des Schochet (1870)
- Ausschreibungen
der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1873)
- Anzeige von
Lehrer Ehrenreich (1876)
- Ausschreibung
der Stelle des Religionslehrers und Vorsängers (1892)
- Dienstanweisung
für einen israelitischen Lehrer im Bezirk unter Rabbiner Dr. Seckel
Bamberger (1903)
- Lehrer
Ludwig Steinberger verlässt die Gemeinde (1912)
- Ausschreibung
der Stelle des Schochet, Hilfsvorbeters und Synagogendieners (1920)
- 4.
Mitgliederversammlung des Schochtimverbandes Bayern in Bad Kissingen (1929)
- Bericht
des Kissinger Schochet Gustav Neustädter über die Arbeit des 1930
gegründeten "Reichsverbandes der Schochtim" (1931)
- Bezirkslehrerkonferenz
in Bad Kissingen (1932)
- Lehrer
Ludwig Steinberger verlässt Bad Kissingen (1937) |
 | Berichte
aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
- Veränderung
bezüglich des Israelitischen Spitalfonds (1872)
- Gottesdienstliche
Dankfeier für die Errettung von Fürst Bismarck bei einem Attentatsversuch
(1874)
- Feier
zum 100. Geburtstag des Wohltäters Sir Moses Montefiori in Bad Kissingen
(1884)
- Der
Regierungspräsident erhält zu seiner silbernen Hochzeit einen Pokal der
Israelitischen Gemeinde (1894)
- Kritik
an Plänen für das städtische Schlachthaus wegen der Beeinträchtigung
jüdischer Einrichtungen (1896)
- 50-jähriges
Jubiläum der Israelitischen Wohltätigkeitsvereine (1910)
- Trauerfeier
zum Tod von Reichspräsident von Hindenburg (1934)
- 75.
Jahrestag der Gründung des Wohltätigkeitsvereins (1935)
- Nach
1945:
Emigrantentreffen in New York (1949)
|
 | Berichte zu einzelnen Personen aus der
Gemeinde und zu einzelnen Kurgästen
-
Spende von Lehrer Jacob Salzer in
Ermershausen
anlässlich der Verlobung seiner Sohnes Abraham Salzer - Sofer in Bad
Kissingen - mit Nanni Fleischmann (1871)
- Zum
Tod von Dr. Joseph Heinemann, Oberlehrer der Hamburger
Talmud-Tora-Realschule (gest. in Bad Kissingen, 1908)
- Moses
Herzfeld führt das Hotel seiner Mutter fort (1900)
- Der
Chief-Rabbi von London - Dr. Hermann Adler - ist in Bad Kissingen zur Kur
und besucht von hier aus Bad Homburg (1901)
- Zum
Tod von Dina Ehrenreich (1901)
- Erinnerung
an die Kurgäste Martha und Milly Rawitscher sowie Frau R. Kosack
(1905)
- Hinweis auf den Augenarzt
Dr. Ludwik Zamenhof, Schöpfer des
Esperanto (1911 zur Kur in Bad Kissingen)
-
D. Karpfen, Gründer des jüdischen
Restaurants Neptun in Bad Kissingen, eröffnet auch in Worms ein koscheres Hotel und Restaurant
(1912)
- Stiftung
einer aus Odessa stammenden jüdischen Frau und ihre Beisetzung im
jüdischen Friedhof Bad Kissingen (1913)
- Eisernes
Kreuz für den Stabs- und Regimentsarzt, Badearzt Dr. Wahle (1915)
- Auszeichnung
für den Gemeindevorsteher Kaufmann Samuel Hofmann (1920)
- Zum Tod von Klara
Seelig (1920)
- 96.
Geburtstag von Frau Wittekind (1921)
- Todesanzeige
für Isaac Seelig (1923)
- Im
Haus Ehrenreich wird eine Sanatoriumsabteilung eröffnet (1927)
- Samuel
Guggenheim aus Worms ist zum 50. Mal Kurgast in Bad Kissingen (1927)
- Zum
Tod von Rechtsanwalt Dr. Koffy Silberschmidt (1928)
- Dr.
J. Bamberger ist 25 Jahre als Arzt in Bad Kissingen tätig (1928)
- Todesanzeige
für Henriette Rosenthal (1928)
- Gedächtnisfeier
zum Todestag des Würzburger Rabbiners Seligmann Bär Bamberger (1928)
- Zum Tod von Rifka
Jeidel (1929)
- 25-jähriges
Amtsjubiläum von Nathan Bretzfelder als Stadtrat (1931)
- Zum
Tod des Großíndustriellen und Philanthrop - Kurgast in Bad Kissingen -
Michael Nassatisin (1931)
- Der
Philanthrop und Kunstsammler Dr. James Simon - Kurgast in Bad Kissingen -
feiert seinen 80. Geburtstag (1931)
- Zum
Tod des "Wilkomirer Raw" - Kurgast in Bad Kissingen (1935)
|
 | Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
- Anzeigen
des Speisewirts David Hartmann (1845 / 1846 / 1847)
- Anzeigen
der Restauration von G. Maier (1868 / 1872)
- Lob
für J. Schatt aus Tauroggen, Schochet in Bad Kissingen (1870)
- Anzeige
des Israelitischen Hotels Schwed (1872 / 1874 / 1885)
- Stellungnahme
des Israelitischen Hotels "Europäischer Hof" zu einer Anzeige von
Rabbiner Bamberger (1884)
- Werbung
für die jüdischen Restaurationen (1890)
- Anzeige des Hotels
Herzfeld (1902)
- Ansichtskarte
des Hotels Herzfeld (1906)
- Ansichtskarte:
Speisesaal des Hotels Herzfeld (um 1920-1930)
- Verlobungsanzeige
von Rifka Ehrenreich und Emil Jeidel (1903)
- Anzeige
der Bäckerei H. Baumblatt (1903)
- Anzeigen
von Bade-Arzt Dr. Münz (1904)
- Anzeige von Frau
Eisenburg (1905)
- Anzeigen des Hotels
Ehrenreich (1904 / 1911) sowie Bericht über Veränderungen im Hotel (1906)
- Hochzeitsanzeige
für Selma Selka und Joseph Bamberger (1912)
- Anzeige
des Manufaktur- und Wäschegeschäftes Arthur Grünebaum (1912/1929)
sowie Postkarte (1901)
- Anzeige
der Damenschneiderei Max Kissinger (1924)
- Ansichtskarte
des Sanatoriums Dr. Apolant (1931) und weitere Dokumente zur
Geschichte des Sanatoriums und der Familie Apolant
- Hochzeitsanzeige
von Fritz Löwenthal und Flora Grünebaum sowie Norbert Grünebaum und Dina
Jeidel (1931)
- Verlobungsanzeige
von Herta Nussbaum und Fritz Nussbaum (1931)
- Verlobungsanzeige
von Fanny Grünebaum und Oskar Katzenstein (1936)
- Anzeige der Pension
Tachauer (1937) |
 | Weitere
Erinnerungen an jüdische Gewerbebetriebe und Einzelpersonen (Sammlung Peter Karl
Müller, Kirchheim/Ries)
-
Postkarte von Schneidermeister Hermann Leuthold in Kissingen an
"Herren Heinrich Katz & Schuster" in Hammelburg (1874/75)
- Postkarte
aus Bamberg an David Schwed in Kissingen (1881)
- Postkarte
aus Haßfurt an David Schwed in Kissingen (1882)
-
Besuchsankündigungskarte von Bernhard Rosenau (1886)
- Postkarte
von Johanna Federlein nach Augsburg (1888)
- Karte
des Kaufmanns Heß Eisenburg (Bad Kissingen) an die Fa. Schloß &
Kohn in Halle (1890)
- Bestellung
des Kaufmann Hermann Holländer (1893)
- Bestellung
des Bäckers Hermann Baumblatt (1897)
- Ansichtskarte aus Bad Kissingen, geschrieben von Josa Ezechel
im Hotel Ehrenreich an Frl. Hertha Levy in Hamburg (1899)
- Fotokarte
von Kurgästen, verschickt aus Bad Kissingen an Monsieur Rotschild in Paris
(1899)
-
Postkarte von H.F. Kugelmann
in Bad Kissingen an Nathan Laubner in Schonungen (1899)
- Ansichtskarte
vom Schützenhaus - Familienpensionat Solms Heymann in Bad Kissingen
(1900)
-
Ansichtskarte von Bad Kissingen - geschrieben von Otto Goldstein
(1901)
- Ansichtskarte
von Bad Kissingen an Gitta Nordschild in Niederwerrn (1902)
- Ansichtskarte
Bad Kissingen vom Staffelberg, versandt von Ida Landsberger (1905)
-
Ansichtskarte mit der Oberen Marktstraße - Bezirksamt und Wohnhaus /
Metzgerei von Wolf Hamburger (um 1905)
- Postkarte
an Felix Gutmann in Bad Kissingen aus Dänemark (1908)
- Postkarte
der "Vieh-Export - Milchkuranstalt Oskar Eisenburg" (1908)
- Besuchs-Anzeige-Karte
der Firma Zentner & Kissinger, versandt von Nürnberg nach
Zürich (1908)
- Postkarte,
versandt von Lina Offenbacher nach Schopfloch (1911): Saalepartie mit
der Lindesmühlpromenade
- Postkarte
an Dr. Münz in Bad Kissingen (1911)
- Firmenkarte
der Firma "Leimindustrie Felix Gutmann" (um 1922/23)
- Historische Ansichtskarte:
Marktplatz Bad Kissingen mit dem Kurzwarengeschäft Wittekind (1902)
- Historische
Ansichtskarte vom Markt in Bad Kissingen mit Geschäften von Max
Kissinger und Moses Hofmann
- Historische Ansichtskarte: Marktplatz in Bad Kissingen mit
Geschäften von S. Leubold und S. Wittekinn
- Historische
Ansichtskarte der Kurhausstraße in Bad Kissingen mit dem Haus Rosenau
(1908)
- Historische
Ansichtskarte (1908) der unteren Marktstraße mit dem Textilgeschäfte
von Samuel Hofmann
- Historische
Ansichtskarte: Ludwigstraße mit dem Modehaus Felix Ehrlich (vor
1910)
- Foto von
1938 vor dem Modehaus Felix Ehrlich
-
Historische Ansichtkarte - Partie bei der Post - mit der Feinen
Herrenschneiderei von Hermann Stern (1915)
-
Historische Ansichtskarte mit dem Modewarengeschäft von Michael Goldstein
(um 1915-1925)
-
Historische Ansichtskarte mit dem Bank- und Wechselgeschäft A. Löwenthal
jr. (1924)
- Grußkarte
eines Kurgastes aus der "Villa Löwenthal" (1920)
- Historische
Ansichtskarte: Marktplatz Bad Kissingen mit dem Konfektionsgeschäft Solms
Heymann (ca. 1925/30)
- Das
Geschäft Holländer-Stern auf dem Bad Kissinger Markt
- Historische
Ansichtskarte: Marktplatz Bad Kissingen mit dem Modehaus Kissinger (ca.
1925/30)
- Postkarte an Max
Kissinger (1913)
- Postkarte an Ernst
Kissinger (1915)
- Briefumschlag
der Herren- und Damen-Schneiderei Max Kissinger (1915)
- Überschwemmter
Marktplatz in Bad Kissingen mit dem Geschäft von Max
Kissinger (1909)
- Der
Marktplatz mit dem Geschäft von Nathan Hamburger (um 1915/20)
- Grußkarte
des Velociped-Clubs in Bad Kissingen mit Unterschrift von Armand
Wittekind (1919)
- Ansichtskarte
mit dem Bankgeschäft Louis Hofmann (1929)
- Briefumschlag der
Glencairn Mainreef Gold Mining Company aus Johannesburg an Louis
Hofmann in Bad Kissingen (1913)
- Rechnungen der
Firma Max Kissinger (1913 und 1914) und weitere Anzeigen
(1879)
- Ansichtskarte
der Villa Gleissner (Geschwister Federlein, 1924)
- Ansichtskarte
der Villa Holländer, versandt nach Nürnberg (1937) |
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer Kultusbeamten
Ausschreibung der Vorsängerstelle (1867)
Anmerkung: die Ausschreibung erfolgte sowohl in der liberal geprägten
"Allgemeinen Zeitung des Judentums" wie auch in der
orthodox-konservativen Zeitschrift "Der Israelit":
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6.
November 1867: "Vakanz. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6.
November 1867: "Vakanz.
Die hiesige Vorsängerstelle soll demnächst neu besetzt werden, und dem
Anzustellenden auch die Erteilung des Religions-Unterrichts an der
hiesigen Schuljugend übertragen werden. Die Anstellung ist vorerst
provisorisch mit einem Gehalte von 400 Gulden jährlich, und betragen die
teils fixierten Nebenbezüge mindestens ebensoviel. Hierauf Reflektierende
wollen ihre Anmeldungen nebst Zeugnissen über religiösen Lebenswandel
und Befähigung in beiden Fächern bis zum 1. Dezember dieses Jahres an
Herrn Distrikts-Rabbiner M.L. Bamberger dahier franko einsenden.
Kissingen, den 24. Oktober 1867. Die israelitische Kultusverwaltung." |
| |
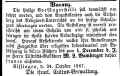 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. November 1867: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. November 1867:
Derselbe Text wie in der Zeitschrift "Der Israelit", siehe
oben. |
Ausschreibung der Stelle des Schochet
(1870)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19.
Januar 1870: "Bekanntmachung. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 19.
Januar 1870: "Bekanntmachung.
In Kissingen die die Stelle eines Schächters baldigst zu besetzen.
Dieselbe bietet ein Einkommen von ca. 500 – 600 Gulden und wollen tüchtig
qualifizierte Persönlichkeiten ihre Zeugnisse franko spätestens Ende
Januar an die unterzeichnete Verwaltung einsenden.
Die israelitische Kultus-Verwaltung. Kissingen."
|
Ausschreibungen
der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1873)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1873:
"Vakanz. Bei der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen ist
die Religionslehrer- und Vorsängerstelle, womit auch die
Gemeindeschreiberei verbunden, vakant und soll dieselbe alsbald mit
einem tüchtig qualifizierten Manne besetzt werden. Gehalt:
Fünfhundert Gulden, außerdem freie Wohnung, sowie Schul- und
Besoldungsholz und die üblichen Emolumente aus dem Vorsängerdienste.
Bewerber belieben ihre Meldungsgesuche nebst Zeugnissen bis spätestens
zum 1. März dieses Jahres einzusenden an Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1873:
"Vakanz. Bei der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen ist
die Religionslehrer- und Vorsängerstelle, womit auch die
Gemeindeschreiberei verbunden, vakant und soll dieselbe alsbald mit
einem tüchtig qualifizierten Manne besetzt werden. Gehalt:
Fünfhundert Gulden, außerdem freie Wohnung, sowie Schul- und
Besoldungsholz und die üblichen Emolumente aus dem Vorsängerdienste.
Bewerber belieben ihre Meldungsgesuche nebst Zeugnissen bis spätestens
zum 1. März dieses Jahres einzusenden an
die israelitische Kultusverwaltung dahier. Kissingen, den 5.
Februar
1873." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Juni 1873: "Die israelitische Religionsstelle in Kissingen,
mit welcher die Funktion als Vorsänger und Gemeindeschreiber verbunden
ist, wird bei wiederholter Erledigung neuerdings zur öffentlichen
Bewerbung ausgeschrieben. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 10. Juni 1873: "Die israelitische Religionsstelle in Kissingen,
mit welcher die Funktion als Vorsänger und Gemeindeschreiber verbunden
ist, wird bei wiederholter Erledigung neuerdings zur öffentlichen
Bewerbung ausgeschrieben.
Die Schule zählt 45 Werktags- und 12 Feiertagsschüler. Der jährliche
fixe Gehalt des Lehrers ist festgesetzt auf 600 fl. an barem Gelde mit
freier Wohnung und dem nötigen Schul- und Besoldungsholze. Dazu kommen an
Nebenerträgnissen: der zweite Gottesdienst für Kurgäste, das Aufrufen
zur Tora mit 60 fl., zusammen ungefähr 200 fl., die Emolumente als
Vorsänger und die Einnahme aus Privatstunden und Instruktionen.
Gesuche mit den vorschriftsmäßigen Belegen versehen, sind bis längstens
1. Juli laufenden Jahres entweder bei der königlichen
Distrikts-Schulinspektion Kissingen in Stangenroth (Post Burkardroth) oder
bei dem Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde Kissingen
einzureichen.
Kissingen, den 5. Juni 1873. Für die Kultus-Verwaltung: L.
Holländer, Vorstand." |
Anzeige von Lehrer Ehrenreich (1876)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876: "Bad
Kissingen. Kurgemäßen und streng religiösen Privatkosttisch
verabreicht während der Saison Ehrenreich, Lehrer und
Kantor." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876: "Bad
Kissingen. Kurgemäßen und streng religiösen Privatkosttisch
verabreicht während der Saison Ehrenreich, Lehrer und
Kantor." |
Anmerkung: Mit diesem
"Privatkosttisch" des Lehrers Eliezer Lazarus Ehrenreich, der
als Lehrer und Vorbeter von Autenhausen* nach Bad Kissingen gekommen war,
begann die Geschichte des späteren, streng koscher geführten Hotels
Ehrenreich. Ehrenreich führte das Hotel gemeinsam mit seiner Frau
Dina geb. Lonnerstädter (zu ihrem Tod siehe Bericht
unten von 1901).
*In der Matrikelliste Autenhausen von 1817 wird als "Judenvorsinger"
Lazarus Jacob Ehrenreich genannt, 55 Jahre alt mit Frau und einem Sohn. |
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und Vorsänger
(1892)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
28. April
1892: "In der israelitischen Kultusgemeinde Bad Kissingen ist die Stelle
eines Religionslehrers und Vorsängers neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt
– abgesehen von nicht unerheblichen Nebeneinkommen – Mark 1.200 nebst
freier Wohnung und Beheizung. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
28. April
1892: "In der israelitischen Kultusgemeinde Bad Kissingen ist die Stelle
eines Religionslehrers und Vorsängers neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt
– abgesehen von nicht unerheblichen Nebeneinkommen – Mark 1.200 nebst
freier Wohnung und Beheizung.
Bewerber wollen ihre Gesuche nebst Befähigungszeugnis und Nachweis über
bisherige Tätigkeit bis längstens 30. Mai an die unterfertigte
Kultusverwaltung einsenden.
Bad Kissingen, im April 1892.
Israelitische Kultusverwaltung: (gez.) Hermann Löwenthal,
Vorstand." |
Dienstanweisung für einen israelitischen Lehrer im
Bezirk unter Rabbiner Dr. S. Bamberger (1903)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21.
September 1903: "Kissingen, im September (1903). (Subordination
des Chordirigenten und Religionslehrers unter den Distrikts-Rabbiner.)
Im Jahrbuch des. D.J.G.B. (Deutschen Jüdischen Gemeindebundes) mitgeteilt
durch Herrn Distriktsrabbiner Dr. Bamberger in Kissingen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 21.
September 1903: "Kissingen, im September (1903). (Subordination
des Chordirigenten und Religionslehrers unter den Distrikts-Rabbiner.)
Im Jahrbuch des. D.J.G.B. (Deutschen Jüdischen Gemeindebundes) mitgeteilt
durch Herrn Distriktsrabbiner Dr. Bamberger in Kissingen.
Bad Kissingen, den 28. Februar 1903. Königliches Bezirksamt Kissingen.
Nr. 1157.
An die israelitische Kultusverwaltung N.N.
Auf erhobene Beschwerdevorstellung des Distriktsrabbiners Dr. S. Bamberger
dahier vom 21. vorigen Monats ist dem israelitischen Lehrer und Vorbeter
N.N. in N.N. gegen vorzulegenden Nachweis zu eröffnen, dass er
a) den Chorgesang in der Synagoge nach den Weisungen des
Distriktsrabbiners einzurichten, daher auch die Mitglieder des Chors von
den Anordnungen des Distriktsrabbiner in Kenntnis zu setzen hat,
b) dem Distriktsrabbiner Lehr- und Stundenplan der Religionsschule
einzureichen hat,
c) bei jeder Verhinderung bezüglich des Schul- und Synagogendienstes
vorher die Genehmigung des Distriktsrabbiners einzuholen hat, in besonders
dringlichen Fällen wenigstens sofortige Anzeige von der Verhinderung an
den Distriktsrabbiner zu erstatten hat, in jedem Falle aber die Person
seines Stellvertreters zu benennen hat.
Maßgebend für vorstehende Anordnung waren diese Erwägungen: N.N. ist
Lehrer an der israelitischen Religionsschule und Vorbeter in der Synagoge
in N.N.
In ersterer Eigenschaft ist maßgebend für sein Verhältnis zu dem
Distriktsrabbiner Dr. S. Bamberger das Ausschreiben der königlichen
Regierung zu Unterfranken und Aschaffenburg vom 4. Dezember 1860,
betreffend das israelitische Religionsschulwesen (Königliches Amtsblatt
S. 1425ff), welches in § 19 besagt, dass die israelitischen
Religionsschulen gleichmäßig unter der Aufsicht der königlichen
Distriktsschulinspektoren und der Distriktsrabbiner stehen. Aus den Ausführungen
des N.N. geht hervor, dass er sich des Unterordnungsverhältnisses gegenüber
der staatlichen Schulbehörde bewusst ist. Aus dem oben angeführten Satze
erhellt, dass das gleich Unterordnungsverhältnis für ihn gegenüber dem
Distriktsrabbiner besteht.
Gemäß Absatz 5 der Ministerialentschließung vom 29. Juni 1863, die Verhältnisse
der israelitischen Kultusgemeinden betreffend, stehen der
Religionsunterricht, die sämtlichen Kultusanstalten und Kultusdiener
unter Aufsicht des Bezirksrabbiners.
Bezüglich des Religionsunterrichts wird also hiermit das in der obenan
zitierten Regierungs-Entschließung Festgestellte bestätigt.
Um die Religionsschule beaufsichtigen zu können, muss der
Distriktsrabbiner wissen, wann der Unterricht stattfindet und was der
Lehrer die Kinder lehren will, es müssen ihm also auch die hierzu nötigen
Behelfe – also auch Lehr- und Stundenplan – durch den Lehrer, und zwar
nicht nur in einer unter gebildeten Leuten üblichen Form, sondern in der,
in welcher ein Untergebener seinem Vorgesetzten zu begegnen pflegt,
geliefert werden. Dem Unterordnungsverhältnis entspricht es auch, dass
der Lehrer in Fällen der Verhinderung den Rabbiner um die Genehmigung zur
zeitweisen Einstellung seiner Lehrtätigkeit bäte; um nicht ein Missverständnis
auf irgendeiner Seite aufkommen zu lassen, schien es nötig, aufzustellen,
dass allerdings Fälle denkbar sind, z.B. plötzlicher Tod eines auswärts
wohnenden nahen Verwalten bei gleichzeitiger amtlicher Abwesenheit des
Rabbiners etc., in denen das Abwarten der Genehmigung des
Distriktrabbiners nur unter Verletzung anderer Pflichten, z.B. derjenigen
der Pietät möglich wäre; für solche besonders dringliche Fälle und
nach Lage der Sache äußerst seltene Fälle, erschien eine Anzeige behufs
nachträglicher Genehmigung genügend.
Da dem Distriktsrabbiner die Aufsicht über alle Kultusdiener und
die Approbation und Autorisation derselben zusteht, also auch nur
stellvertretungsweise Funktionierenden, so ist ihm jedes Mal die Person
des Stellvertreters zu benennen, um die Genehmigung zu Vornahmen von
Kultushandlungen erteilen oder verweigern zu können.
Als Vorbeter ist N.N. Kultusdiener der Gemeinde N.N. und steht als solcher
unter Aufsicht des Distriktsrabbiners und hat in kirchlicher Beziehung
dessen Anordnungen zu befolgen (auch Regierungsentschließung vom 1.
Oktober 1894 Nr. 19045 in Betreff der Verhältnisse der israelitischen
Kultusgemeinde in A. hier der Vorbeterdienste). N.N. hatte daher auch die
Anordnungen des Distriktsrabbiners bezüglich des Chorgesanges als eines
Teiles des Gottesdienstes zu befolgen und als Dirigent des Chors die
Mitglieder desselben von den Anordnungen des Distriktsrabbiners in
Kenntnis zu setzen.
Über die Frage, bei welchen Stellen Chorgesang nötig ist oder
nicht, ist als eine Frage über die Form des Gottesdienstes gemäß § 38
der zweiten Verfassungsbeilage hier nicht zu entscheiden. Es mag hier nur
noch bemerkt werden, dass diese Frage jedenfalls auch nicht auf Grund des
§ 11 der Synagogenordnung |
 entschieden
werden können, da dieser nur besagt, dass bei den zu rezitierenden
Gebeten entsprechende Ordnung obwalten muss, was jedoch beim Singen wie
Sprechen gleichmäßig der Fall sein kann. entschieden
werden können, da dieser nur besagt, dass bei den zu rezitierenden
Gebeten entsprechende Ordnung obwalten muss, was jedoch beim Singen wie
Sprechen gleichmäßig der Fall sein kann.
Dem Vorbeter N.N. wird nahe gelegt, jeglicher Renitenz gegen den
Distriktsrabbiner in Zukunft sich zu enthalten, da dies unliebsame Folgen
für ihn haben könnte.
Nachweis über die Eröffnung wird binnen sechs Tagen gewärtigt.
I.V. (gez.) Freiherr von Eyb." |
Lehrer Ludwig Steinberger verlässt die Gemeinde
(1912)
Anmerkung: Lehrer Steinberger hat seine Pläne, Bad Kissingen zu verlassen, dann
jedoch entweder gar nicht umgesetzt oder er ist wenig später wieder
zurückgekehrt, da er auch in der Folgezeit Lehrer in Bad Kissingen war.
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 6.
September 1912: "Kissingen. Unter Lehrer und Kantor Ludwig
Steinberger gibt seine Stelle auf, um in das Geschäft seiner Brüder in
Buenos Aires einzutreten." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 6.
September 1912: "Kissingen. Unter Lehrer und Kantor Ludwig
Steinberger gibt seine Stelle auf, um in das Geschäft seiner Brüder in
Buenos Aires einzutreten." |
Ausschreibung der Stelle des Schochet, Hilfsvorbeters
und Synagogendieners (1920)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18.
November 1920: "Für Anfang 1921 wird in hiesiger Gemeinde ein zuverlässiger
Schochet, Hilfsvorbeter und Synagogendiener, welcher von orthodoxem
Rabbiner autorisiert ist, gesucht. Herren, welche längere Praxis als
Schochet hinter sich haben und gut porschen können, wollen baldigst
Bewerbung mit Zeugnisabschriften belegt unter Angabe ihrer Ansprüche bei
freier Dienstwohnung einreichen. Stelle ist pensionsberechtigt. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18.
November 1920: "Für Anfang 1921 wird in hiesiger Gemeinde ein zuverlässiger
Schochet, Hilfsvorbeter und Synagogendiener, welcher von orthodoxem
Rabbiner autorisiert ist, gesucht. Herren, welche längere Praxis als
Schochet hinter sich haben und gut porschen können, wollen baldigst
Bewerbung mit Zeugnisabschriften belegt unter Angabe ihrer Ansprüche bei
freier Dienstwohnung einreichen. Stelle ist pensionsberechtigt.
Die israelitische Kultusverwaltung Bad Kissingen. I.A. Samuel Hofmann." : |
4. Mitgliederversammlung des Schochtimverbandes Bayern in Bad Kissingen (1929)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24.
Dezember 1929: "Bad Kissingen, 22. Dezember (1929). Der
Schochtimverband Bayerns hält am 5. Januar – so Gott will -
seine 4. Mitgliederversammlung im Gemeindelokal in Kissingen ab, zu
der auswärtige Kollegen herzlichst eingeladen sind. Beginn 11 Uhr
vormittags." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 24.
Dezember 1929: "Bad Kissingen, 22. Dezember (1929). Der
Schochtimverband Bayerns hält am 5. Januar – so Gott will -
seine 4. Mitgliederversammlung im Gemeindelokal in Kissingen ab, zu
der auswärtige Kollegen herzlichst eingeladen sind. Beginn 11 Uhr
vormittags." |
Bericht des Kissinger Schochet Gustav Neustädter über die Arbeit des 1930
gegründeten "Reichsverbandes der Schochtim" (1931)
Anmerkung: von 1924 bis 1939 war als Kultusbeamter in Bad Kissingen Gustav
Neustädter; zu seiner Biographie
https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/lehrerbiografien/gustav-neustaedter/;
Gustav Neustädter ist in Sulzbürg geboren,
lernte an der jüdischen
Präparandenschule in Höchberg, 1913 Religionslehrerprüfung in Regensburg;
1913-14 Religionslehrer in Cham, 1914 bis 1918
als Soldat im Ersten Weltkrieg, wohnte danach in
Adelsdorf; verheiratet seit 1920 mit Paula
geb. Bacharach aus Rhina; 1920 bis 1924
Religionslehrer in Maßbach; ab 1924 bis 1938
Religionslehrer, Hilfskantor und Schochet in Bad Kissingen, nach der
Emigration von Ludwig Steinberger zuletzt erster Kantor und Lehrer ebd.; 1942
wurden Gustav und Paula Neustädter mit Sohn Ernst nach Izbica deportiert und
ermordet.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10.
September 1931. "Zur Jahreswende. Rückblick und Ausschau. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10.
September 1931. "Zur Jahreswende. Rückblick und Ausschau.
Von Gustav Neustädter in Bad Kissingen.
Das erste Verbandsjahr des Reichsverbandes von Schochtim in Deutschland
ist abgelaufen und es gebührt sich wohl, ein Wort über seine Tätigkeit,
die sich, wie es bei so jungen Organisationen nicht anders zu erwarten
war, im Stillen vollzogen hat, zu reden, wenn auch nicht alle Hoffnungen,
die bei der in Mainz stattgefundenen Gründungsfeier gehegt wurden, in Erfüllung
gingen.
Vier Landesverbände mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern sind dem
Reichsverband angeschlossen und haben trotz mancher Schwierigkeiten,
besonders finanzieller Art, viel Ersprießliches geleistet. Insbesondere
sei hier der Einführung von Lern- und Fortbildungskonferenzen gedacht,
die sicherlich dazu beitragen werden, Schochtim heranzubilden, die unseren
Mindestforderungen, der Schochet müsse ein Jodea Sefer (Torakundiger)
sein, entsprechen; eine Forderung, die bis heute bei der Erteilung der
Kaboloh sehr oft vermisst wird.
Der wirtschaftliche Kampf vieler Schochtim und die nur sehr spärlich zur
Verfügung gestellten Mittel anderer Organisationen gestatten es leider
nicht, dass diese Lernkonferenzen in regelmäßigen Zeitabschnitten
stattfinden können. Es wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn diverse
Verbände, wie Agudas Jisroel, Freie Vereinigung, Verband gesetzestreuer
Gemeinden in Halberstadt, Bayerischer Landesverband, gemeinsam diese
gewiss gute Sache fordern würden.
Die Verbandstätigkeit selbst bestand zunächst darin, möglichst
viele Landesverbände zu gründen und möglichst alle Berufskollegen auf
diese Weise für einen Zusammenschluss zu gewinnen. Aus Gleichgültigkeit
stehen bis heute noch sehr viele Schochtim unserem Verbande fern, Egoismus
hält noch sehr viele davon zurück, das kleine Opfer eines minimalen
Jahresbeitrages zu bringen, von deren Eingang das Erscheinen der
Verbandszeitung bedingt ist. Ist es an und für sich sehr bedauerlich,
dass es heute noch Beamte gibt, die sich nicht dazu aufringen können, ein
kleines Opfer zu leisten, das der gewöhnlichste Fabrikarbeiter zu bringen
bereit ist, so begrüßen wir es umso mehr, dass unsere Mitglieder
bereitwilligst das von ihnen geforderte Opfer gebracht und uns in der
Arbeit unterstützt haben.
In den einzelnen Landesverbänden fanden wiederholt
Mitgliederversammlungen statt, über deren harmonischen Verlauf regelmäßig
an der Reichsverband berichtet wurde; in jüngster Zeit durch den Verband
Westfalen-Reinland am 16. August und Verband Ostfriesland am 23. August
(ausführlicher Bericht darüber folgt).
Zusammenfassend darf wohl gesagt werden, das erste Verbandsjahr des
Reichsverbandes von Schochtim in Deutschland kann als ein erfolgreiches
bezeichnet werden. Möge das die noch außenstehenden Kollegen aufrütteln
– mah loch Nirdom! Unseren Mitgliedern aber wünschen wir ein Schnas
brochoh!
Ich bitte alle Kollegen, mir über Jubiläen unserer Mitglieder
nicht immer erst nachträglich zu berichten!" |
Bezirkslehrerkonferenz in Bad Kissingen (1932)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14.
Juli 1932. "Unsleben, 6. Juli (1932). In der am 3. Juli dieses
Jahres zu Bad Kissingen tagenden Bezirkslehrerkonferenz benützten
die anwesenden Lehrer und Kultusbeamten die Gelegenheit, dem ab 1. Juli in
den Ruhestand getretenen ehrwürdigen Bezirksrabbiner Herrn Dr. Bamberger,
durch ihren Obmann, Herrn Oberlehrer Israel Wahler, Neustadt (Saale),
einige Worte des Dankes und der Ehrung zu widmen. Herr Oberlehrer Wahler
verlieh den Gefühlen der Versammelten in herzlichen und treffenden Worten
beredten Ausdruck. Zunächst sprach er im Sinne der Lehrer und
Kultusbeamten sein tiefstes Bedauern aus, dass der hochgeschätzte
Toragelehrte auf Grund seiner erreichten Dienstaltersgrenze in den
Ruhestand treten musste. Er pries in erster Linie in unserem ehrwürdigen
Herrn Rabbiner den hochverehrten Raw als Godel bejiosroel (bedeutenden
Menschen im Judentum) im vollsten Sinne des Wortes und betonte hierbei,
dass die in seinem gastlichen Hause veranstalteten Lernkonferenzen stets
zu den schönsten Erinnerungen unseres Berufserlebens zählten. Hier wurde
nicht nur Mischnah und Talmud gelernt, sondern auch die einschlägigen
Tagesfragen aus dem Kultus- und Schulleben wurden zur Erörterung gestellt
und einheitlich geregelt. Ganz besonders betonte Kollege Wahler das stets
erfreuliche und harmonische Verhältnis innerer Verbundenheit zwischen
Rabbiner und Lehrer und würdigte speziell noch dessen große
Bescheidenheit im dienstlichen und privaten Verkehr mit den Lehrern, wo er
in dem Lehrer den Chower (Ehrenrabbiner) erblickte und in seiner ihm
gewohnten Liebenswürdigkeit und Herzensgüte jeden Schein des
Vorgesetzten vermied. Und dieses kollegiale Verhältnis verschaffte ihm
unsere Liebe und Anhänglichkeit und Wertschätzung im höchsten Maße,
sodass uns sein Ausscheiden aus dem Amte als Bezirksrabbiner ganz
besonders tief bewegt. Wir bleiben Herrn Rabbiner Dr. Bamberger zu höchstem
Danke verpflichtet. Mit dem Wunsche an den Herrn Rabbiner, auch fernerhin
für den Klal Jisroel zum Segen des gesamten Judentums und zur Verbreitung
der Tora ad meo schonoh (bis 100 Jahre) in steter Gesundheit und
Geistesfrische tätig sein zu können, schloss der Redner seine Worte der
Verehrung. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 14.
Juli 1932. "Unsleben, 6. Juli (1932). In der am 3. Juli dieses
Jahres zu Bad Kissingen tagenden Bezirkslehrerkonferenz benützten
die anwesenden Lehrer und Kultusbeamten die Gelegenheit, dem ab 1. Juli in
den Ruhestand getretenen ehrwürdigen Bezirksrabbiner Herrn Dr. Bamberger,
durch ihren Obmann, Herrn Oberlehrer Israel Wahler, Neustadt (Saale),
einige Worte des Dankes und der Ehrung zu widmen. Herr Oberlehrer Wahler
verlieh den Gefühlen der Versammelten in herzlichen und treffenden Worten
beredten Ausdruck. Zunächst sprach er im Sinne der Lehrer und
Kultusbeamten sein tiefstes Bedauern aus, dass der hochgeschätzte
Toragelehrte auf Grund seiner erreichten Dienstaltersgrenze in den
Ruhestand treten musste. Er pries in erster Linie in unserem ehrwürdigen
Herrn Rabbiner den hochverehrten Raw als Godel bejiosroel (bedeutenden
Menschen im Judentum) im vollsten Sinne des Wortes und betonte hierbei,
dass die in seinem gastlichen Hause veranstalteten Lernkonferenzen stets
zu den schönsten Erinnerungen unseres Berufserlebens zählten. Hier wurde
nicht nur Mischnah und Talmud gelernt, sondern auch die einschlägigen
Tagesfragen aus dem Kultus- und Schulleben wurden zur Erörterung gestellt
und einheitlich geregelt. Ganz besonders betonte Kollege Wahler das stets
erfreuliche und harmonische Verhältnis innerer Verbundenheit zwischen
Rabbiner und Lehrer und würdigte speziell noch dessen große
Bescheidenheit im dienstlichen und privaten Verkehr mit den Lehrern, wo er
in dem Lehrer den Chower (Ehrenrabbiner) erblickte und in seiner ihm
gewohnten Liebenswürdigkeit und Herzensgüte jeden Schein des
Vorgesetzten vermied. Und dieses kollegiale Verhältnis verschaffte ihm
unsere Liebe und Anhänglichkeit und Wertschätzung im höchsten Maße,
sodass uns sein Ausscheiden aus dem Amte als Bezirksrabbiner ganz
besonders tief bewegt. Wir bleiben Herrn Rabbiner Dr. Bamberger zu höchstem
Danke verpflichtet. Mit dem Wunsche an den Herrn Rabbiner, auch fernerhin
für den Klal Jisroel zum Segen des gesamten Judentums und zur Verbreitung
der Tora ad meo schonoh (bis 100 Jahre) in steter Gesundheit und
Geistesfrische tätig sein zu können, schloss der Redner seine Worte der
Verehrung.
Von den Ausführungen des Redners sichtbar gerührt, dankte Herr Rabbiner
Dr. Bamberger für die Ehrung und Danksagung mit dem versprechen, auch
fernerhin seine ganze Kraft für die Verbreitung der Tora zur Verfügung
stellen zu wollen und die bisherigen Lernschiurim in seinem Hause weiter
forterhalten zu wollen." |
Lehrer Ludwig Steinberger verlässt Bad Kissingen
(1937)
 Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15.
Mai 1937: "In den ersten Tagen des Mai wandert Kollege Ludwig Steinberger
– Bad Kissingen nach USA aus. Wir wünschen dem scheidenden Kollegen
alles Gute. Die Stelle Bad Kissingen soll, wie wir hören, nicht mehr
besetzt werden." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15.
Mai 1937: "In den ersten Tagen des Mai wandert Kollege Ludwig Steinberger
– Bad Kissingen nach USA aus. Wir wünschen dem scheidenden Kollegen
alles Gute. Die Stelle Bad Kissingen soll, wie wir hören, nicht mehr
besetzt werden." |
Berichte aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Veränderung
bezüglich des Israelitischen Spitalfonds (1872)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Januar 1872: "Bekanntmachung. Nach Beschluss der
unterfertigten Verwaltung soll der aus den Jahren 1861/62 dahier
vorhandene israelitische Spitalfonds - im Betrage von ungefähr 250 fl. -
dem in spätern Jahren gegründeten, gleichen Zweck anstrebenden
israelitischen Spitalfond einverleibt werden. - Hiervon erhalten
die betreffenden seinerzeitigen Geber hiermit Kenntnis, unter Freistellung
einer vierwöchentlichen Reklamationsfrist. Nach Umlauf dieser Zeit wird
allgemeine Zustimmung angenommen. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Januar 1872: "Bekanntmachung. Nach Beschluss der
unterfertigten Verwaltung soll der aus den Jahren 1861/62 dahier
vorhandene israelitische Spitalfonds - im Betrage von ungefähr 250 fl. -
dem in spätern Jahren gegründeten, gleichen Zweck anstrebenden
israelitischen Spitalfond einverleibt werden. - Hiervon erhalten
die betreffenden seinerzeitigen Geber hiermit Kenntnis, unter Freistellung
einer vierwöchentlichen Reklamationsfrist. Nach Umlauf dieser Zeit wird
allgemeine Zustimmung angenommen.
Kissingen, am 1. Januar 1872. Die israelitische
Kultus-Verwaltung". |
Gottesdienstliche
Dankfeier für die Errettung von Fürst Bismarck bei einem Attentatsversuch
(1874)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. Juli 1874: "Kissingen, 15. Juli (1874). Zur
Abhaltung einer gottesdienstlichen Dankfeier für die Errettung des
deutschen Reichskanzlers, Fürsten Bismarck, auf den am hiesigen Kurorte
die Hand des Verbrechers vor zwei Tagen das mörderische Geschoss
gerichtet hat, war die Synagoge heute Nachmittag zwischen drei und vier
Uhr von einer dichtgedrängten Menge Andächtiger gefüllt. Und es war
eine Feier, in welcher das Gefühl des Schmerzes über den
verbrecherischen Anschlag, das Gefühl des Dankes für das gnadenreiche
Walten der Vorsehung eine geeignete, würdige Aussprache fand. Mit
beredten Worten schilderte Herr Lokal- und Distriktsrabbiner Bamberger die
Bedeutung des gefeierten Kämpfers im deutschen Reiche und zeichnete den
Verlust desselben, der so nahegerückt erschien, mit dem Gedächtnisworte,
das der König David dem gefallenen Saul widmete: 'O, wie sind doch die
Helden gefallen!' Dreimal, so führte der Redner aus, wiederholt sich
dieser Ruf: er gilt dem Helden im Frieden, im Kriege und in der dauernden
Kampfbereitschaft, das Errungene und Wiedererlangte zu bewahren. Vor und
nach der Predigt wurden der Situation entsprechende Psalmen von dem
Gemeindechor unter Leitung des Gemeindekantors Herrn Ehrenreich und des
hier als Kurgast anwesenden Kantors Herrn Hoffmann aus Hannover
intoniert."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. Juli 1874: "Kissingen, 15. Juli (1874). Zur
Abhaltung einer gottesdienstlichen Dankfeier für die Errettung des
deutschen Reichskanzlers, Fürsten Bismarck, auf den am hiesigen Kurorte
die Hand des Verbrechers vor zwei Tagen das mörderische Geschoss
gerichtet hat, war die Synagoge heute Nachmittag zwischen drei und vier
Uhr von einer dichtgedrängten Menge Andächtiger gefüllt. Und es war
eine Feier, in welcher das Gefühl des Schmerzes über den
verbrecherischen Anschlag, das Gefühl des Dankes für das gnadenreiche
Walten der Vorsehung eine geeignete, würdige Aussprache fand. Mit
beredten Worten schilderte Herr Lokal- und Distriktsrabbiner Bamberger die
Bedeutung des gefeierten Kämpfers im deutschen Reiche und zeichnete den
Verlust desselben, der so nahegerückt erschien, mit dem Gedächtnisworte,
das der König David dem gefallenen Saul widmete: 'O, wie sind doch die
Helden gefallen!' Dreimal, so führte der Redner aus, wiederholt sich
dieser Ruf: er gilt dem Helden im Frieden, im Kriege und in der dauernden
Kampfbereitschaft, das Errungene und Wiedererlangte zu bewahren. Vor und
nach der Predigt wurden der Situation entsprechende Psalmen von dem
Gemeindechor unter Leitung des Gemeindekantors Herrn Ehrenreich und des
hier als Kurgast anwesenden Kantors Herrn Hoffmann aus Hannover
intoniert." |
Feier zum 100. Geburtstag des Wohltäters Sir Moses
Montefiori in Bad Kissingen (1884)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
3.
November 1884: "Im Bade Kissingen hielt Herr Distrikts-Rabbiner
Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus Anlass des 100. Geburtstages
von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm
an den Jubilar. - Sämtliche Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und
Kuratoren der Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an
den allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen
bei Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle
Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
3.
November 1884: "Im Bade Kissingen hielt Herr Distrikts-Rabbiner
Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus Anlass des 100. Geburtstages
von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm
an den Jubilar. - Sämtliche Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und
Kuratoren der Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an
den allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen
bei Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle
Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute." |
Der Regierungspräsident erhält zu seiner silbernen
Hochzeit einen Pokal der Israelitischen Gemeinde (1894)
Anmerkung:
es ging um die Silberne Hochzeit von Friedrich Graf von Luxburg (1829-1905)und
seiner Frau Luise Prinzessin von Schoenaich-Carolath-Beuthen (vgl. Wikipedia-Artikel
zu Friedrich Graf von Luxburg) der seit 1874 im Schloss Aschach bei Bad
Bocklet residierte.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
5.
November 1894: "Kissingen, im Oktober (1894). Aus Anlass der
silbernen Hochzeit des Regierungspräsidenten von Unterfranken und
Aschaffenburg, Graf von Luxburg und seiner Gemahlin, geb. Prinzessin von
Schönaich-Carolath (nicht:
Charolath), begab sich der Distriktsrabbiner Bamberger mit dem
Vorstand der israelitischen Kultusverwaltung nach Schloss Aschach, dem
Sommeraufenthalt des Grafen, um im Namen der israelitischen Gemeinde
Kissingen einen silbernen Pokal zu überreichen. Dieser, ein Prunkstück
im Renaissancestil gehalten, zeigt das Gräflich Luxburgsche und das Fürstlich
Schönaich-Carolatsche (nicht: Carlothsche)
Wappen mit den Jahreszahlen 1869-1894 und trägt die Inschrift: ‚Zur
freundlichen Erinnerung von der dankbaren israelitischen Kultusgemeinde
Bad Kissingen’. Der Regierungspräsident war sehr erfreut über die Gabe
und sprach den beiden Herren seinen lebhaften Dank aus. Er versicherte die
israelitische Gemeinde seines lebhaftesten Interesses und erkundigte sich
besonders über den Stand der Synagogen-Angelegenheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
5.
November 1894: "Kissingen, im Oktober (1894). Aus Anlass der
silbernen Hochzeit des Regierungspräsidenten von Unterfranken und
Aschaffenburg, Graf von Luxburg und seiner Gemahlin, geb. Prinzessin von
Schönaich-Carolath (nicht:
Charolath), begab sich der Distriktsrabbiner Bamberger mit dem
Vorstand der israelitischen Kultusverwaltung nach Schloss Aschach, dem
Sommeraufenthalt des Grafen, um im Namen der israelitischen Gemeinde
Kissingen einen silbernen Pokal zu überreichen. Dieser, ein Prunkstück
im Renaissancestil gehalten, zeigt das Gräflich Luxburgsche und das Fürstlich
Schönaich-Carolatsche (nicht: Carlothsche)
Wappen mit den Jahreszahlen 1869-1894 und trägt die Inschrift: ‚Zur
freundlichen Erinnerung von der dankbaren israelitischen Kultusgemeinde
Bad Kissingen’. Der Regierungspräsident war sehr erfreut über die Gabe
und sprach den beiden Herren seinen lebhaften Dank aus. Er versicherte die
israelitische Gemeinde seines lebhaftesten Interesses und erkundigte sich
besonders über den Stand der Synagogen-Angelegenheit." |
| |
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. September 1894: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 28. September 1894:
Derselbe Bericht wie im "Israelit" - siehe oben. |
Kritik an Plänen für das städtische Schlachthaus wegen der
Beeinträchtigung jüdischer Einrichtungen (1896)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
1. Oktober 1896: "Kissingen, im September (1896). Während man in
allen namhaften Städten und insbesondere in den Badeorten mit Recht
bestrebt ist, etwas noch bestehende Missstände in Bezug auf Salubrität
und sanitäre Verhältnisse zu beseitigen, trägt man sich hier, in dem
bekanntesten und besuchtesten Bade Bayerns, mit der Idee, das alte
Schlachthaus, das allen hygienischen Anforderungen zum Trotz im Innern der
Stadt in einem Gewinkel von Gässchen liegt, auch noch zu erweitern. Statt
es aus diesem ältesten und in sanitärer Hinsicht jedenfalls am übelsten
bestellten Bezirke zu entfernen und außerhalb der Stadt zu verlegen,
sollen die seither schon oft beklagten Missstände noch vermehrt werden,
trotz der wiederholten Abweisung durch das königliche Bezirksamt, trotz
des vernichtenden Urteils des königlichen Bezirksarztes, trotz der
dringlichsten Einsprache der israelitischen Kultusgemeinde und sämtliche
Adjacenten. Kaum glaublich, aber war!
Die Stadt, die bei einer Musterkanalisation keine Opfer scheute, soll nun
gegen den Willen aller vernünftig Denkenden vor angeblich zu hohen Kosten
bewahrt werden, während der Umbau und die Vergrößerung, die sich ja
doch schon in absehbarer Zeit ungenügend erweisen werden, kaum
wesentliche Ersparnisse gegenüber einer vollständigen Verlegung ergeben.
Es würden dadurch nicht nur die kleineren Nachbarhäuser, die seither
schon durch diese unsaubere Nachbarschaft beim vermieten Schaden erlitten,
in ihrem Erwerbe auf das Schwerste geschädigt, sondern es wäre auch eine
krasse Rücksichtslosigkeit gegen die israelitische Gemeinde, da das anstoßende
Haus die Synagoge ist und neben dem Eingang zum Bethause in Zukunft der
Eintrieb der zu schlachtenden Rinder und Schweine sein würde. Nach
eingezogener Information ist aber eine Verlegung der Synagoge auf mehr als
zehn Jahre hinaus nicht zu erwarten. Auch eine unserer besuchtesten
Heilanstalten würde durch die unheimliche Nachbarschaft auf das schwerste
betroffen werden. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom
1. Oktober 1896: "Kissingen, im September (1896). Während man in
allen namhaften Städten und insbesondere in den Badeorten mit Recht
bestrebt ist, etwas noch bestehende Missstände in Bezug auf Salubrität
und sanitäre Verhältnisse zu beseitigen, trägt man sich hier, in dem
bekanntesten und besuchtesten Bade Bayerns, mit der Idee, das alte
Schlachthaus, das allen hygienischen Anforderungen zum Trotz im Innern der
Stadt in einem Gewinkel von Gässchen liegt, auch noch zu erweitern. Statt
es aus diesem ältesten und in sanitärer Hinsicht jedenfalls am übelsten
bestellten Bezirke zu entfernen und außerhalb der Stadt zu verlegen,
sollen die seither schon oft beklagten Missstände noch vermehrt werden,
trotz der wiederholten Abweisung durch das königliche Bezirksamt, trotz
des vernichtenden Urteils des königlichen Bezirksarztes, trotz der
dringlichsten Einsprache der israelitischen Kultusgemeinde und sämtliche
Adjacenten. Kaum glaublich, aber war!
Die Stadt, die bei einer Musterkanalisation keine Opfer scheute, soll nun
gegen den Willen aller vernünftig Denkenden vor angeblich zu hohen Kosten
bewahrt werden, während der Umbau und die Vergrößerung, die sich ja
doch schon in absehbarer Zeit ungenügend erweisen werden, kaum
wesentliche Ersparnisse gegenüber einer vollständigen Verlegung ergeben.
Es würden dadurch nicht nur die kleineren Nachbarhäuser, die seither
schon durch diese unsaubere Nachbarschaft beim vermieten Schaden erlitten,
in ihrem Erwerbe auf das Schwerste geschädigt, sondern es wäre auch eine
krasse Rücksichtslosigkeit gegen die israelitische Gemeinde, da das anstoßende
Haus die Synagoge ist und neben dem Eingang zum Bethause in Zukunft der
Eintrieb der zu schlachtenden Rinder und Schweine sein würde. Nach
eingezogener Information ist aber eine Verlegung der Synagoge auf mehr als
zehn Jahre hinaus nicht zu erwarten. Auch eine unserer besuchtesten
Heilanstalten würde durch die unheimliche Nachbarschaft auf das schwerste
betroffen werden. |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
8. Oktober
1896: "Bad Kissingen. Schon seit einer Reihe von Jahren bestehen in
hiesiger Stadt bezüglich des städtischen Schlachthauses, welches zu
klein und derzeitigen Anforderungen nicht mehr entsprechend ist, zwei
Parteien: Während die eine à tout prix das bisherige Schlachthaus vergrößert
haben will, besteht die andere auf Neubau eines Schlachthauses außerhalb
der Stadt. Wie dies nun gewöhnlich bei solchen lokalen Angelegenheiten zu
gehen pflegt, muss da auch die Presse, die so genannten öffentliche
Meinung, herhalten. So wurde auch von den Anhängern eines Neubaus jüngst
ein Artikel durch verschiedene Zeitungen gejagt, welcher die Schrecknisse
des gegenwärtigen Schlachthauses in den grellsten Farben ausmalte. –
Nun hätte diese rein interne Angelegenheit für die Leser des
‚Israelit’ kein besonderes Interesse, wenn nicht dieser famose
Artikel, welcher seinen Weg auch in dieses Blatt gefunden – den Passus
enthielt: ‚Nach eingezogener Information ist aber eine Verlegung der
Synagoge (welche sich nächst dem Schlachthause befindet) auf mehr als 10
Jahre hinaus nicht zu erwarten’. – Viele Leser des ‚Israelit’,
welche zu unseren Badegästen gehören und die Unzulänglichkeit unserer
Synagoge kennen, dürften dies auffallend finden und daher gerne die
Versicherung entgegennehmen, dass eine solche Information unmöglich bei
zuständiger Stelle eingeholt sein kann. Die berufenen Organe der hiesigen
israelitischen Gemeinde sind vielmehr mit Erfolg bemüht, die Hindernisse,
welche sich bisher dem Synagogenbau entgegenstellten, zu beseitigen, um so
bald als möglich dem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
8. Oktober
1896: "Bad Kissingen. Schon seit einer Reihe von Jahren bestehen in
hiesiger Stadt bezüglich des städtischen Schlachthauses, welches zu
klein und derzeitigen Anforderungen nicht mehr entsprechend ist, zwei
Parteien: Während die eine à tout prix das bisherige Schlachthaus vergrößert
haben will, besteht die andere auf Neubau eines Schlachthauses außerhalb
der Stadt. Wie dies nun gewöhnlich bei solchen lokalen Angelegenheiten zu
gehen pflegt, muss da auch die Presse, die so genannten öffentliche
Meinung, herhalten. So wurde auch von den Anhängern eines Neubaus jüngst
ein Artikel durch verschiedene Zeitungen gejagt, welcher die Schrecknisse
des gegenwärtigen Schlachthauses in den grellsten Farben ausmalte. –
Nun hätte diese rein interne Angelegenheit für die Leser des
‚Israelit’ kein besonderes Interesse, wenn nicht dieser famose
Artikel, welcher seinen Weg auch in dieses Blatt gefunden – den Passus
enthielt: ‚Nach eingezogener Information ist aber eine Verlegung der
Synagoge (welche sich nächst dem Schlachthause befindet) auf mehr als 10
Jahre hinaus nicht zu erwarten’. – Viele Leser des ‚Israelit’,
welche zu unseren Badegästen gehören und die Unzulänglichkeit unserer
Synagoge kennen, dürften dies auffallend finden und daher gerne die
Versicherung entgegennehmen, dass eine solche Information unmöglich bei
zuständiger Stelle eingeholt sein kann. Die berufenen Organe der hiesigen
israelitischen Gemeinde sind vielmehr mit Erfolg bemüht, die Hindernisse,
welche sich bisher dem Synagogenbau entgegenstellten, zu beseitigen, um so
bald als möglich dem längst gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen." |
50-jähriges Jubiläum der Israelitischen
Wohltätigkeitsvereine (1910)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom
8. April
1910: "Kissingen. Am 27. März (1910) feierten die beiden
Israelitischen Wohltätigkeitsvereine der Frauen und Männer (Chewros
gemilas chassodim) ihre 50-jährigen Jubiläen. In der Synagoge fand im
Anschluss an das Morgengebet ein Festgottesdienst statt, bei welchem
Rabbiner Dr. Bamberger die Festrede hielt. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom
8. April
1910: "Kissingen. Am 27. März (1910) feierten die beiden
Israelitischen Wohltätigkeitsvereine der Frauen und Männer (Chewros
gemilas chassodim) ihre 50-jährigen Jubiläen. In der Synagoge fand im
Anschluss an das Morgengebet ein Festgottesdienst statt, bei welchem
Rabbiner Dr. Bamberger die Festrede hielt.
Der Festakt begann um 10 Uhr in dem dekorierten Saale des Hotels
Ehrenreich. Der 1. Vorstand N. Bretzfelder hielt die Begrüßungsansprache
und gab den Festbericht. Die eigentliche Festrede hielt Lehrer L.
Steinberger. Alsdann wurden den noch lebenden Gründern und ersten
Mitgliedern der beiden Vereine Diplome überreicht, in welchen die
Ehrenmitgliedschaft zuerkannt werden; es sind das: Sabine Holländer,
Jette Mainzer, Hannchen Goldstein, Fanny Hofmann, Klara Wittekind, Josef
Gutmann und Mayer Kissinger. Frau Jeanette Kissinger wurde in Anbetracht
ihrer 25-jährigen Tätigkeit als Vorstandsdame ebenfalls zum
Ehrenmitgliede ernannt. Der Festakt war durch Harmoniumspiel und
Chorgesang unter Leitung Rechtsanwalts Dr. Silberschmidt verschönt
worden.
Mit einem Festmahle im Hotel Ehrenreich fanden des Abends die
Feierlichkeiten ihren harmonischen Abschluss. Hier sprachen Felix Ehrlich,
A. Löwenthal jun. Und toasteten M. Herzfeld, Albert Kissinger, Mayer Löwenthal,
Julius Hofmann, Rabbiner Dr. Bamberger, N. Bretzfelder. Von den bei der
Tafel verlesenen Glückwunschdepeschen und – schreiben, sei das
Schreiben des Bürgermeisters Hofrat von Fuchs erwähnt, das sehr warm
gehalten war." |
| |
 Dazu
eingestellt: Einschreiben-Brief vom "Israelitischen Wohltätigkeitsverein Bad
Kissingen" – versandt am 30. Juli 1919 an Herrn Siegmund Popper in
Meiningen. Dazu
eingestellt: Einschreiben-Brief vom "Israelitischen Wohltätigkeitsverein Bad
Kissingen" – versandt am 30. Juli 1919 an Herrn Siegmund Popper in
Meiningen.
(Quelle: Sammlung Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
|
Trauerfeier zum Tod von Reichspräsident von Hindenburg
(1934)
 Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1.
September 1934: "Bad Kissingen. Am Dienstagabend, den 7. August
1934, fand unter überaus großer Beteiligung der Gemeindemitglieder sowie
der anwesenden jüdischen Kurgäste in der hiesigen Synagoge eine würdige
Trauerfeier für den dahingeschiedenen Reichspräsidenten von Hindenburg
statt. Im Mittelpunkt stand eine Ansprache des Herrn Rabbiners Dr.
Ephraim, der den Verblichenen als einen wahrhaft Großen feierte, der
nicht nur das Schwer zu führen verstand, sondern vor allem dem
Wiederaufbau Deutschlands seine ganze Kraft widmete. Seine Persönlichkeit
war gestaltet durch tiefe Religiosität, durch wahrhafte
Gottverbundenheit, die sich oft im Gebet bewährte und die ihn bis in die
letzten Stunden zu unseren heiligen Psalmen und Propheten hinzog. Er war
ein Held der Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Ritterlichkeit, auch uns
Juden gegenüber, und so hielt er seinen jüdischen Frontkämpfern stets
Treue gegen Treue. Die Feier war umrahmt von feierlichen Psalmvorträgen
durch Herrn Lehrer Steinberger und von weihevollen Gesängen des
Synagogenchors unter Leitung des Herrn Heymann." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1.
September 1934: "Bad Kissingen. Am Dienstagabend, den 7. August
1934, fand unter überaus großer Beteiligung der Gemeindemitglieder sowie
der anwesenden jüdischen Kurgäste in der hiesigen Synagoge eine würdige
Trauerfeier für den dahingeschiedenen Reichspräsidenten von Hindenburg
statt. Im Mittelpunkt stand eine Ansprache des Herrn Rabbiners Dr.
Ephraim, der den Verblichenen als einen wahrhaft Großen feierte, der
nicht nur das Schwer zu führen verstand, sondern vor allem dem
Wiederaufbau Deutschlands seine ganze Kraft widmete. Seine Persönlichkeit
war gestaltet durch tiefe Religiosität, durch wahrhafte
Gottverbundenheit, die sich oft im Gebet bewährte und die ihn bis in die
letzten Stunden zu unseren heiligen Psalmen und Propheten hinzog. Er war
ein Held der Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Ritterlichkeit, auch uns
Juden gegenüber, und so hielt er seinen jüdischen Frontkämpfern stets
Treue gegen Treue. Die Feier war umrahmt von feierlichen Psalmvorträgen
durch Herrn Lehrer Steinberger und von weihevollen Gesängen des
Synagogenchors unter Leitung des Herrn Heymann." |
75. Jahrestag der Gründung des Wohltätigkeitsvereins
(1935)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23.
Mai 1935: "Bad Kissingen, 10. Mai (1935). Der Wohltätigkeitsverein
(Chewrah) Bad Kissingen konnte in diesem Jahre die 75. Wiederkehr seiner
1860 erfolgten Gründung begehen. Wenn auch die Gegenwart für laute Feste
nicht geeignet erscheint, so wurde das für die hiesige Gemeinde denkwürdige
Ereignis doch in der einfachen, aber durch Grün und Blumen stimmungsvoll
geschmückten Synagoge durch einen ‚Festgottesdienst’ würdig
gefeiert. Nach einem Ma tauwu des Synagogenchores begrüßte der Vorstand
der Gemeinde, Herr Nathan Bretzfelder, die erschienenen Gemeindemitglieder
und auswärtigen Gäste. Er gab einen kurzen Rückblick über die
Geschichte und das Wirken des für die Gemeinde und die jüdischen Kurgäste
Bad Kissingens segensreichen Vereins. Ohne die Verdienste der Einzelnen
besonders hervorzuheben, betonte der Redner mehr die persönliche, nicht
an die Öffentlichkeit tretende Tätigkeit der Mitglieder im Dienste der Nächstenliebe.
Er benutzte die Gelegenheit, wirkungsvoll auf die zeitnahen Aufgaben des
Vereins hinzuweisen und schloss mit dem Wunsche, dass die Feier des 100.
Geburtstages in glücklicheren Zeiten erfolgen möge. Die Rezitation des
113. Psalms durch Herrn Kantor und Lehrer Steinberger und den
Synagogenchor leitete über zur Festpredigt der Herr Bezirksrabbiner Dr.
Ephraim. Unter Zugrundlegung der Psalmstelle Kap. 89 Vers 3: ‚Aulom
chesed jibone’, ‚die Welt besteht durch die Liebe’ würdigte er in
ausführlichen und nachdrücklichen Darlegungen die hohen Pflichten einer
Chewroh gegen Arme, Kranke und Verstorbene. Der Prediger richtete die
Aufforderung an die Gemeinde, allseitig wie einstens in der Gründungszeit
des Vereins auch heute wieder die Verpflichtungen ganz in altjüdischem
Sinne auf sich zu nehmen und zu tragen. Worte, die zur rechten Stunde
gesprochen, ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Es erfolgte sodann eine
Gedenkfeier für die verstorbenen Vorstandsmitglieder. Mit dem gemeinsamen
Gesang des Jigdal schloss der feierliche Gottesdienst." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23.
Mai 1935: "Bad Kissingen, 10. Mai (1935). Der Wohltätigkeitsverein
(Chewrah) Bad Kissingen konnte in diesem Jahre die 75. Wiederkehr seiner
1860 erfolgten Gründung begehen. Wenn auch die Gegenwart für laute Feste
nicht geeignet erscheint, so wurde das für die hiesige Gemeinde denkwürdige
Ereignis doch in der einfachen, aber durch Grün und Blumen stimmungsvoll
geschmückten Synagoge durch einen ‚Festgottesdienst’ würdig
gefeiert. Nach einem Ma tauwu des Synagogenchores begrüßte der Vorstand
der Gemeinde, Herr Nathan Bretzfelder, die erschienenen Gemeindemitglieder
und auswärtigen Gäste. Er gab einen kurzen Rückblick über die
Geschichte und das Wirken des für die Gemeinde und die jüdischen Kurgäste
Bad Kissingens segensreichen Vereins. Ohne die Verdienste der Einzelnen
besonders hervorzuheben, betonte der Redner mehr die persönliche, nicht
an die Öffentlichkeit tretende Tätigkeit der Mitglieder im Dienste der Nächstenliebe.
Er benutzte die Gelegenheit, wirkungsvoll auf die zeitnahen Aufgaben des
Vereins hinzuweisen und schloss mit dem Wunsche, dass die Feier des 100.
Geburtstages in glücklicheren Zeiten erfolgen möge. Die Rezitation des
113. Psalms durch Herrn Kantor und Lehrer Steinberger und den
Synagogenchor leitete über zur Festpredigt der Herr Bezirksrabbiner Dr.
Ephraim. Unter Zugrundlegung der Psalmstelle Kap. 89 Vers 3: ‚Aulom
chesed jibone’, ‚die Welt besteht durch die Liebe’ würdigte er in
ausführlichen und nachdrücklichen Darlegungen die hohen Pflichten einer
Chewroh gegen Arme, Kranke und Verstorbene. Der Prediger richtete die
Aufforderung an die Gemeinde, allseitig wie einstens in der Gründungszeit
des Vereins auch heute wieder die Verpflichtungen ganz in altjüdischem
Sinne auf sich zu nehmen und zu tragen. Worte, die zur rechten Stunde
gesprochen, ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Es erfolgte sodann eine
Gedenkfeier für die verstorbenen Vorstandsmitglieder. Mit dem gemeinsamen
Gesang des Jigdal schloss der feierliche Gottesdienst." |
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1935: Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1935:
Derselbe Bericht wie in der Zeitschrift "Der Israelit". |
Nach
1945: Emigrantentreffen in New York (1949)
 Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:
"Bad Kissingen - Brückenau
- Hammelburg - Gerolzhofen.
Anzeige in der Zeitschrift "Aufbau" vom 22. April 1949:
"Bad Kissingen - Brückenau
- Hammelburg - Gerolzhofen.
Samstag, den 30. April ab 7.30 Uhr abends. Treffen in
Begelo's Café-Restaurant
3801 Broadway (158 St.), l Treppe. Tel.: WA 8-9654". |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde und zu einzelnen Kurgästen
Spende von Lehrer Jacob Salzer
anlässlich der Verlobung seiner Sohnes Abraham Salzer - Sofer in Bad Kissingen - mit Nanni Fleischmann
(1871)
Anmerkung: Die Mitteilung steht innerhalb einer Liste von "Spenden für das
Heilige Land". Abraham Salzer ist am 28. Juni 1846 in
Ermershausen geboren, er war verheiratet
mit Nanette (Nanni) geb. Fleischmann. Genealogische Informationen siehe
https://www.geni.com/people/Abraham-Salzer/6000000000630364913. Sofer ist
ein Torarollenschreiber.
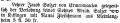 Mitteilung in
"Der Israelit" vom 8. November 1871: "Lehrer Jakob Salzer von
Ermershausen gelegentlich der
Verlobung seines Sohnes Abraham Salzer Sofer in Kissingen
mit Nanni Fleischmann aus Kleinlangheim
3 fl. 30 kr." Mitteilung in
"Der Israelit" vom 8. November 1871: "Lehrer Jakob Salzer von
Ermershausen gelegentlich der
Verlobung seines Sohnes Abraham Salzer Sofer in Kissingen
mit Nanni Fleischmann aus Kleinlangheim
3 fl. 30 kr." |
Zum
Tod von Dr. Joseph Heinemann, Oberlehrer der Hamburger Talmud-Tora-Realschule
(gest. in Bad Kissingen, 1908)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 24. Juli 1908): "Hamburg. In Kissingen, wo er
zur Kur weilte, verschied an einem Herzschlage Dr. Joseph Heinemann,
Oberlehrer an der hiesigen Talmud-Thora-Realschule". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 24. Juli 1908): "Hamburg. In Kissingen, wo er
zur Kur weilte, verschied an einem Herzschlage Dr. Joseph Heinemann,
Oberlehrer an der hiesigen Talmud-Thora-Realschule".
|
Moses Herzfeld führt das Hotel seiner Mutter fort
(1900)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. September 1900: "Bad Kissingen, 13. September
(1900). Wie wir von hier erfahren, hat Herr Moses Herzfeld, Sohn
der Witwe Herzfeld aus Darmstadt, deren Hotel in Bad Kissingen
übernommen. Derselbe führt es in streng ritueller Weise fort und ist das
Hotel nun das ganze Jahr geöffnet." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 17. September 1900: "Bad Kissingen, 13. September
(1900). Wie wir von hier erfahren, hat Herr Moses Herzfeld, Sohn
der Witwe Herzfeld aus Darmstadt, deren Hotel in Bad Kissingen
übernommen. Derselbe führt es in streng ritueller Weise fort und ist das
Hotel nun das ganze Jahr geöffnet." |
Der Chief-Rabbi von London - Dr. Hermann Adler - ist in Bad Kissingen zur Kur
und besucht von hier aus Bad Homburg (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1901: "Homburg
v.d.H., 27. August (1901). Der Chief-Rabbi von London, Herr Dr.
Hermann Adler, der in Kissingen zur Kur weilte, ist hierher geeilt, um
seine Schwester, Frau Kommerzienrat Israel, die hier erkrankte, zu
besuchen. Als er morgens am Brunnen erschien, bemerkte ihn der König von
England, ging auf ihn zu und begrüßte ihn auf das Herzlichste. Dr. Adler
erbat sich eine Audienz und verweilte darauf am Nachmittage längere Zeit
bei dem Könige in dessen Hotel" Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1901: "Homburg
v.d.H., 27. August (1901). Der Chief-Rabbi von London, Herr Dr.
Hermann Adler, der in Kissingen zur Kur weilte, ist hierher geeilt, um
seine Schwester, Frau Kommerzienrat Israel, die hier erkrankte, zu
besuchen. Als er morgens am Brunnen erschien, bemerkte ihn der König von
England, ging auf ihn zu und begrüßte ihn auf das Herzlichste. Dr. Adler
erbat sich eine Audienz und verweilte darauf am Nachmittage längere Zeit
bei dem Könige in dessen Hotel" |
Zum Tod
von Dina Ehrenreich geb. Lonnerstädter (1901)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
19. Dezember 1901: "Bad Kissingen. Am Rosch Chodesch Kislew (= 12.
November 1901) hat die in weitesten Kreisen rühmlichst bekannte Frau Dina
Ehrenreich ihre letzte Ruhe gefunden. Sie war die Gattin des leider
vor zehn Jahren so früh verstorbenen jüdischen Gemeindelehrers, des
Herrn E. (= Eliezer Lazarus) Ehrenreich. Sie hat es aufs Beste verstanden, ein echt
jüdisches Haus zu führen, nachdem sie im elterlichen Hause als
Tochter des ausgezeichneten Lehrers und Rabbiners Mordechai
Lonnerstädter - Gott vermehre seine Tage und Jahre - in Veitshöchheim
bei Würzburg, ein so herrliches Beispiel vor sich gesehen hatte, und mit
reichem jüdischen Wissen in die Ehe getreten war. Viel, viel musste die
Dahingeschiedene in ihrem Leben ertragen. Sie musste in den besten Jahren
den teuren Gatten verlieren, mit dem sie in harmonischer Ehe so viel Gutes
in ihrer Gemeinde gewirkt hatte. Zwei Söhne sind der Verewigten gestorben.
All das vermochte sie nicht niederzudrücken und gab ihrer Gottesfurcht
nur neue Nahrung. Mit doppelter Energie und Gewissenhaftigkeit war sie nun
allein darauf bedacht, ihre Kindern in Tora und Gottesfurcht zu
erziehen. Ihr Restaurant, das sie seinerzeit gemeinsam mit ihrem Gatten
auf Veranlassung von Frau Dr. J. Hildesheimer begründet, hat sie aus
kleinen Anfängen zu einem mustergültigen Hotel emporgehoben. Es ist
überflüssig, ein Wort über dessen Bedeutung anzufügen, nachdem es in
der jüdischen Welt einen so ausgezeichneten Ruf genießt. In diesem
Berufe hat Frau Ehrenreich ihren Wohltätigkeitssinn reichlich betätigt
an Armen jeder Konfession, ohne dass die Öffentlichkeit, bis nach ihrem
Tode, viel davon erfahren hätte. Für die Gesamtheit wirkte sie ebenso
energisch, trotz ihrer vielen, häuslichen Pflichten, als Mitglied des
'Jüdischen Frauenvereins'. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
19. Dezember 1901: "Bad Kissingen. Am Rosch Chodesch Kislew (= 12.
November 1901) hat die in weitesten Kreisen rühmlichst bekannte Frau Dina
Ehrenreich ihre letzte Ruhe gefunden. Sie war die Gattin des leider
vor zehn Jahren so früh verstorbenen jüdischen Gemeindelehrers, des
Herrn E. (= Eliezer Lazarus) Ehrenreich. Sie hat es aufs Beste verstanden, ein echt
jüdisches Haus zu führen, nachdem sie im elterlichen Hause als
Tochter des ausgezeichneten Lehrers und Rabbiners Mordechai
Lonnerstädter - Gott vermehre seine Tage und Jahre - in Veitshöchheim
bei Würzburg, ein so herrliches Beispiel vor sich gesehen hatte, und mit
reichem jüdischen Wissen in die Ehe getreten war. Viel, viel musste die
Dahingeschiedene in ihrem Leben ertragen. Sie musste in den besten Jahren
den teuren Gatten verlieren, mit dem sie in harmonischer Ehe so viel Gutes
in ihrer Gemeinde gewirkt hatte. Zwei Söhne sind der Verewigten gestorben.
All das vermochte sie nicht niederzudrücken und gab ihrer Gottesfurcht
nur neue Nahrung. Mit doppelter Energie und Gewissenhaftigkeit war sie nun
allein darauf bedacht, ihre Kindern in Tora und Gottesfurcht zu
erziehen. Ihr Restaurant, das sie seinerzeit gemeinsam mit ihrem Gatten
auf Veranlassung von Frau Dr. J. Hildesheimer begründet, hat sie aus
kleinen Anfängen zu einem mustergültigen Hotel emporgehoben. Es ist
überflüssig, ein Wort über dessen Bedeutung anzufügen, nachdem es in
der jüdischen Welt einen so ausgezeichneten Ruf genießt. In diesem
Berufe hat Frau Ehrenreich ihren Wohltätigkeitssinn reichlich betätigt
an Armen jeder Konfession, ohne dass die Öffentlichkeit, bis nach ihrem
Tode, viel davon erfahren hätte. Für die Gesamtheit wirkte sie ebenso
energisch, trotz ihrer vielen, häuslichen Pflichten, als Mitglied des
'Jüdischen Frauenvereins'.
Von der tiefen Trauer um ihren Heimgang gab die große Teilnahme an ihrer
Bestattung beredten Ausdruck. Mit Rücksicht auf den Rosch Chodesch
(Monatsbeginn) mussten die Herren Dr. Tachauer - Würzburg und
Distrikts-Rabbiner Dr. Stein Schweinfurt, am Grabe selbst von einem
würdigenden Nachrufe absehen. Herr Dr. Stein hat dann während der
Trauerwoche im Trauerhause in innigen Worten ein Lebensbild der
Verstorbenen gezeichnet und der großen Trauer um sie Ausdruck
verliehen. Möge der Allgütige der alten Mutter, den Geschwistern
und den Kindern der frommen Verstorbenen Trost verleihen und ihnen die
Kraft geben, den schweren Verlust zu ertragen, und möge ihr Andenken den
Kindern, die ganz in ihrem Sinne fortleben und wirken, zum Segen
gereichen." |
| |
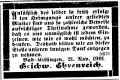 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. November 1901:
"Anlässlich des leider so früh erfolgten Heimgangs unserer
geliebten Mutter sind uns so zahlreiche Beweise aufrichtiger Teilnahme
geworden, dass es uns unmöglich ist, jedem Einzelnen, wie wir es wohl
möchten, zu danken. Deshalb bitten wir an dieser Stelle unseren innigen
Dank entgegen zu nehmen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. November 1901:
"Anlässlich des leider so früh erfolgten Heimgangs unserer
geliebten Mutter sind uns so zahlreiche Beweise aufrichtiger Teilnahme
geworden, dass es uns unmöglich ist, jedem Einzelnen, wie wir es wohl
möchten, zu danken. Deshalb bitten wir an dieser Stelle unseren innigen
Dank entgegen zu nehmen.
Bad Kissingen, 21. November 1901. Geschwister Ehrenreich". |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16.
Dezember 1901: "Bad Kissingen. Hôtel Ehrenreich. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16.
Dezember 1901: "Bad Kissingen. Hôtel Ehrenreich.
Durch verschiedene Anfragen sehen wir uns veranlasst, unsere werten
Gäste und Bekannten ergebenst mitzuteilen, dass wir das von unseren
Eltern - seligen Andenkens - dahier betriebene Restaurant in
derselben, streng religiösen Weise weiterführen werden. Wir danken für
das unseren seligen Eltern entgegengebrachte Vertrauen und bitten,
dasselbe auch auf uns übertragen zu wollen. Hochachtend! Geschwister
Ehrenreich". |
Erinnerung
an die Kurgäste Martha und Milly Rawitscher sowie Frau R. Kosack (1905)
Hinweis auf den Augenarzt Dr.
Ludwik Zamenhof, Schöpfer des
Esperanto (1911 zur Kur in Bad Kissingen)
(Hinweis von Roland Schnell, Zamenhofs
Blog )
 Der Augenarzt Dr. Ludwik Leizer Zamenhof (1859-1917)
war im Juli 1911 erstmals zur Kur in Bad Kissingen. Damals war er im
Gästehaus Franconia untergebracht. Er war der Schöpfer des Esperanto:
1887 hatte er in Warschau eine Broschüre mit den Grundlagen dieser
Kunstsprache vorgestellt. An ihn erinnert seit 1991 in Bad Kissingen der
"Esperanto-Platz" beim ehemaligen Gästehaus Franconia an der
Ecke Schonbornstraße/südliche Bismarckstraße. Der Augenarzt Dr. Ludwik Leizer Zamenhof (1859-1917)
war im Juli 1911 erstmals zur Kur in Bad Kissingen. Damals war er im
Gästehaus Franconia untergebracht. Er war der Schöpfer des Esperanto:
1887 hatte er in Warschau eine Broschüre mit den Grundlagen dieser
Kunstsprache vorgestellt. An ihn erinnert seit 1991 in Bad Kissingen der
"Esperanto-Platz" beim ehemaligen Gästehaus Franconia an der
Ecke Schonbornstraße/südliche Bismarckstraße.
vgl.Artikel vom 18. Juli 2011 in der "Main-Post": "Der
Esperanto-Erfinder war Kurgast in Bad Kissingen". Link
zum Artikel.
Link zu dem oben eingestellten Foto
von Dr. Ludwig und Klara Zamenhof in Bad Kissingen (Esperanto-Muzeo).
vgl. auch Wikipedia-Artikel
zu Dr. Zamenhof. |
D. Karpfen, Gründer des jüdischen Restaurants Neptun in Bad Kissingen,
eröffnet auch in Worms ein koscheres Hotel und Restaurant
(1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar
1912: "Allgemeine Mitteilungen Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar
1912: "Allgemeine Mitteilungen
Worms, wegen seiner historischen jüdischen
Stätten das Strebziel so vieler Touristen, hat endlich ein modernes
jüdisches Hotel-Restaurant erhalten. Herr D. Karpfen, der Gründer
desselben, erwarb sich in seiner langjährigen Tätigkeit im Restaurant
Beermann - Reichenhall
seine fachmännischen Kenntnisse und gründete dann das Restaurant Neptun in
Kissingen, das sich in kurzer Zeit
einen glänzenden Ruf erwarb." |
Stiftung einer aus Odessa stammenden jüdischen Frau und ihre Beisetzung im
jüdischen Friedhof Bad Kissingen (1913)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
5. September 1913: "Bad Kissingen, 29. August (1913).
Eine aus Odessa stammende jüdische Frau testiert die Zinsen ihres
1.600.000 Frank betragenden Vermögens für Kurzwecke mit der Bestimmung,
das 3/4 des Ertrages jüdischen, 1/4 christlichen Kurbedürftigen zukommen
sollte. Vor dreißig Jahren hatte die Frau in Kissingen die einzige
Tochter verloren. Auf einer Erholungsreise war die Frau im Winter zu Genf
plötzlich verstorben und auf dem kommunalen Friedhofe beigesetzt worden.
In dem Testamente hatte die Verstorbene den Wunsch ausgedrückt, an der
Seite ihres Kindes begraben zu werden. Die Leiche wurde daher ausgegraben
und vor einigen Tagen unter großer Beteiligung auf dem israelitischen
Friedhofe zu Kissingen beigesetzt. Herr Distriktsrabbiner Dr. S. Bamberger
widmete der großen Wohltäterin einen warm empfundenen Nachruf. Auch der
Vertreter der Stadtgemeinde brachte den Dank für die hochherzige Stiftung
und den bekundeten Edelsinn zum Ausdruck." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
5. September 1913: "Bad Kissingen, 29. August (1913).
Eine aus Odessa stammende jüdische Frau testiert die Zinsen ihres
1.600.000 Frank betragenden Vermögens für Kurzwecke mit der Bestimmung,
das 3/4 des Ertrages jüdischen, 1/4 christlichen Kurbedürftigen zukommen
sollte. Vor dreißig Jahren hatte die Frau in Kissingen die einzige
Tochter verloren. Auf einer Erholungsreise war die Frau im Winter zu Genf
plötzlich verstorben und auf dem kommunalen Friedhofe beigesetzt worden.
In dem Testamente hatte die Verstorbene den Wunsch ausgedrückt, an der
Seite ihres Kindes begraben zu werden. Die Leiche wurde daher ausgegraben
und vor einigen Tagen unter großer Beteiligung auf dem israelitischen
Friedhofe zu Kissingen beigesetzt. Herr Distriktsrabbiner Dr. S. Bamberger
widmete der großen Wohltäterin einen warm empfundenen Nachruf. Auch der
Vertreter der Stadtgemeinde brachte den Dank für die hochherzige Stiftung
und den bekundeten Edelsinn zum Ausdruck." |
Eisernes Kreuz für den Stabs- und Regimentsarzt,
Badearzt Dr. Wahle (1915)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. März 1915: "Seligenstadt, 3. März (1915). Dem Stabs-
und Regimentsarzt im 8. Bayerischen Infanterie-Regiment, 2. Armeekorps
Herrn Dr. med. Wahle, Badearzt in Bad Kissingen, wurde das Eiserne
Kreuz verliehen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 11. März 1915: "Seligenstadt, 3. März (1915). Dem Stabs-
und Regimentsarzt im 8. Bayerischen Infanterie-Regiment, 2. Armeekorps
Herrn Dr. med. Wahle, Badearzt in Bad Kissingen, wurde das Eiserne
Kreuz verliehen." |
Auszeichnung
für den Gemeindevorsteher Kaufmann Samuel Hofmann (1920)
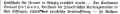 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Februar 1920: "Der Kaufmann Samuel Hofmann,
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde in Bad Kissingen, erhielt das
preußische Verdienstkreuz". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 6. Februar 1920: "Der Kaufmann Samuel Hofmann,
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde in Bad Kissingen, erhielt das
preußische Verdienstkreuz". |
Zum Tod von Klara Seelig (1920)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.
April 1920: "Bad Kissingen, 8. April (1920). Im hohen Alter
von fast 75 Jahren starb nach schwerem Leiden Frau Klara Seelig,
die Gattin des langjährigen hiesigen Schochet Isaak Seelig. Eine
würdige, bescheidene Frau, die durch ihr feines Wesen, gepaart mit
echtjüdischer Frömmigkeit, allseits bekannt und hochgeschätzt war.
Ihrem Manne stand sie als wahre wackere Frau, ihren Kindern, die
sie in ihrem Sinne zu echten Jehudim erzog, als treusorgende Mutter zur
Seite. Bei der Beerdigung, die ein getreues Bild gab von der großen
Beliebtheit der Verstorbenen, schilderte Herr Distriktsrabbiner Dr. S.
Bamberger an der Hand kerniger Toraworte das vorbildliche Wesen
dieser edlen Frau unter Berücksichtigung der Zeit, die eine eigentliche Trauerrede
untersagte. Alsdann nahm in ergreifenden Worten der Sohn der Verblichenen,
Lehrer Seelig aus Bad Orb, Abschied von
der geliebten Mutter. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.
April 1920: "Bad Kissingen, 8. April (1920). Im hohen Alter
von fast 75 Jahren starb nach schwerem Leiden Frau Klara Seelig,
die Gattin des langjährigen hiesigen Schochet Isaak Seelig. Eine
würdige, bescheidene Frau, die durch ihr feines Wesen, gepaart mit
echtjüdischer Frömmigkeit, allseits bekannt und hochgeschätzt war.
Ihrem Manne stand sie als wahre wackere Frau, ihren Kindern, die
sie in ihrem Sinne zu echten Jehudim erzog, als treusorgende Mutter zur
Seite. Bei der Beerdigung, die ein getreues Bild gab von der großen
Beliebtheit der Verstorbenen, schilderte Herr Distriktsrabbiner Dr. S.
Bamberger an der Hand kerniger Toraworte das vorbildliche Wesen
dieser edlen Frau unter Berücksichtigung der Zeit, die eine eigentliche Trauerrede
untersagte. Alsdann nahm in ergreifenden Worten der Sohn der Verblichenen,
Lehrer Seelig aus Bad Orb, Abschied von
der geliebten Mutter. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
96.
Geburtstag von Frau Wittekind (1921)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 3. November 1921: "Kissingen. Frau Wittekind
vollendet Anfang November ihr 96. Lebensjahr. Sie ist körperlich und
geistig frisch, und wer die hellen, klugen Augen der Greisin sieht und
ihre wohlüberlegten Worte hört, dem fällt es schwer, zu glauben, dass
sie bereits ein solch hohes Alter hat. Sie hat ihr ganzes Leben in
Kissingen verbracht, und auch ihr Mann war ein
Kissinger." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 3. November 1921: "Kissingen. Frau Wittekind
vollendet Anfang November ihr 96. Lebensjahr. Sie ist körperlich und
geistig frisch, und wer die hellen, klugen Augen der Greisin sieht und
ihre wohlüberlegten Worte hört, dem fällt es schwer, zu glauben, dass
sie bereits ein solch hohes Alter hat. Sie hat ihr ganzes Leben in
Kissingen verbracht, und auch ihr Mann war ein
Kissinger." |
Todesanzeige für Isaac Seelig (1923)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom
23. August 1923: Anzeige in der Zeitschrift "Der
Israelit" vom
23. August 1923:
"Unser geliebter Vater, Schwiegervater, Großvater und Bruder
Herr Isaac Seelig - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen
-
wurde uns nach dreitägiger Krankheit durch den Tod entrissen.
Bad Kissingen, Friedberg i.H., 3. Elul 5683 / 15. August 1923.
In tiefem Schmerze: Familien Seelig und Tachauer."
|
Im Haus Ehrenreich wird eine Sanatoriumsabteilung
eröffnet (1927)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Mai 1927: "Bad Kissingen, 26. April (1927). Einem
oft geäußerten Wunsche Rechnung tragend, wird Anfang Mai in Bad
Kissingen im Hause Ehrenreich (dem früheren Dr. von Sohlern'schen
Sanatorium) eine Sanatoriumsabteilung eröffnet werden. Die
Küchenführung untersteht der Familie Jeidel (welche ihr bekanntes
Hotel-Restaurant Ehrenreich unverändert weiterführt); die ärztliche
Leitung übernimmt der bekannte Badearzt und Facharzt für innere Medizin
Dr. M. Ehrenreich. Die Behandlung durch andere Kissinger Ärzte ist aber
auch gestattet. Unsere Glaubensgenossen werden gerne vernehmen, dass ihnen
hierdurch Gelegenheit geboten ist, die berühmten Kissinger Kurmittel in
einem Sanatorium genießen zu können, in welchem auch den strengsten
religiösen Ansprüchen Genüge geleistet wird." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Mai 1927: "Bad Kissingen, 26. April (1927). Einem
oft geäußerten Wunsche Rechnung tragend, wird Anfang Mai in Bad
Kissingen im Hause Ehrenreich (dem früheren Dr. von Sohlern'schen
Sanatorium) eine Sanatoriumsabteilung eröffnet werden. Die
Küchenführung untersteht der Familie Jeidel (welche ihr bekanntes
Hotel-Restaurant Ehrenreich unverändert weiterführt); die ärztliche
Leitung übernimmt der bekannte Badearzt und Facharzt für innere Medizin
Dr. M. Ehrenreich. Die Behandlung durch andere Kissinger Ärzte ist aber
auch gestattet. Unsere Glaubensgenossen werden gerne vernehmen, dass ihnen
hierdurch Gelegenheit geboten ist, die berühmten Kissinger Kurmittel in
einem Sanatorium genießen zu können, in welchem auch den strengsten
religiösen Ansprüchen Genüge geleistet wird." |
Samuel Guggenheim aus Worms ist zum 50. Mal Kurgast in Bad
Kissingen (1927)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
2. Juni 1927: "Bad Kissingen, 19. Mai (1927). Unser Bad
kann von dem seltenen Ereignis berichten, dass ein Gast zum fünfzigsten
Male zum Kurgebrauch Einkehr hält. Es ist dies unser Glaubensgenosse Herr
Samuel Guggenheim aus Worms. Die Räume des Hotel Ehrenreich, in
welchem der Jubilar seit Jahren wohnt, hatten sich aus diesem Anlass in
einen Blumengarten verwandelt. Möge es dem rüstigen Herrn noch oft vergönnt
sein, die heilkräftigen Quellen unserer schönen Saalestadt aufsuchen zu
können." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
2. Juni 1927: "Bad Kissingen, 19. Mai (1927). Unser Bad
kann von dem seltenen Ereignis berichten, dass ein Gast zum fünfzigsten
Male zum Kurgebrauch Einkehr hält. Es ist dies unser Glaubensgenosse Herr
Samuel Guggenheim aus Worms. Die Räume des Hotel Ehrenreich, in
welchem der Jubilar seit Jahren wohnt, hatten sich aus diesem Anlass in
einen Blumengarten verwandelt. Möge es dem rüstigen Herrn noch oft vergönnt
sein, die heilkräftigen Quellen unserer schönen Saalestadt aufsuchen zu
können." |
Zum Tod von Rechtsanwalt Dr. Koffy Silberschmidt
(1928)
 Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. April 1928: Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. April 1928:
"Am 30. März verstarb in Frankfurt am Main nach längerem, mit
großer Geduld ertragenem Leiden
Herr Rechtsanwalt Dr. Koffy Silberschmidt
Bad Kissingen, stellvertretender Vorsitzender der Tagung des Verbandes
Bayerischer Israelitischer Gemeinden.
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen einen Mann, der die eifrigste
Hingabe an die Aufgaben des Verbandes mit dem strengsten
Gerechtigkeitsgefühl und der lautersten Gesinnung verband. Wie er seiner
Gemeinde und seinem Bezirke stets ein kluger Berater und aufopfernder
Freund war, so stellte er seine ganze Persönlichkeit der religiösen
Gemeinschaft des Landes in unermüdlicher und tatkräftiger Arbeit zur
Verfügung. Wir werden sein Andenken stets in Ehren behalten. München,
12. April 1928.
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dr. Neumeyer - Dr.
Silberschmidt." |
| |
 Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1. Mai 1928: "Bad Kissingen. (Aus technischen Gründen
verspätet). Am 30. März verschied nach mehrmonatiger schwerer Krankheit
im jüdischen Krankenhaus zu Frankfurt am Main, noch nicht fünfzig Jahre
alt, Herr Rechtsanwalt Dr. Silberschmidt von Bad Kissingen. Ein
Mann von gerader, vornehmer Gesinnung, ein treuer Bekenner des
konservativen Judentums ist mit ihm dahingegangen. Im bayerischen Judentum
hat er sich als stellvertretender Präsident der Tagung des bayerischen
Landesverbandes einen geachteten Namen erworben. Am 2. April fand auf dem
Frankfurter jüdischen Friedhof die Beerdigung statt. In Anbetracht des
Monats Nissan beschränkte sich Herr Rabbiner Dr. Horowitz
(Frankfurt am Main) auf wenige Worte des Dankes an den Verblichenen und
des Trostes an die Hinterbliebenen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Bamberger (Bad
Kissingen) sprach im Namen der Gemeinde und des Israelitischen Kurhospizes
in Bad Kissingen, dessen Vorstandschaft der Verstorbene angehört und dem
er durch Rat und Tat seine Dienste gewidmet hat. Im Auftrage der
Kultusgemeinde Bayreuth, der Heimatgemeinde des Entschlafenen,
überbrachte Herr Rabbiner Dr. Salomon (Bayreuth)
den Angehörigen den Ausdruck herzlicher Teilnahme. Dem trauernden Bruder
will die Gemeinde für seine treue, hingebungsvolle, ehrendienstliche
Arbeit Dank und Verehrung darbringen. In der Zeit seiner beruflichen
Ausbildung hatte der Verblichene dank seiner musikalischen Befähigung den
Gottesdienst durch Chorgesang ausgestaltet und verschönt. Ein Ehrengrab,
das die Gemeinde angeboten, konnte von der Familie leider nicht angenommen
werden. Namens des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden
würdigte Herr Justizrat Dr. E. Strauß (München) die Verdienste
des Entschlafenen. Seit Beginn der Tätigkeit des Verbandes stand er als
zweiter Präsident der Tagung an hervorragender Stelle und hat noch auf
der letzten Tagung in Fürth in mühevoller Arbeit umsichtig und
verbindlich die Verhandlungen geleitet. Seinen Rat und seine Arbeit wird
der Verband sehr vermissen. Abschiedsgrüße überbrachten noch Herr Justizrat
Dr. Bulheller von Bad Kissingen im Auftrage der dortigen Anwälte, Herr
Oberstudienrat Freudenberger (Würzburg) für die Franken-Loge und
Herr Dr. med. Mayer von Bad Kissingen für Burschenbund Wirzeburgia.
Durch alle Reden klang die Trauer um einen Mann, der das Reine ehrte, die
Treue wahrte und seinem Judentum lebte. Seiner Gemeinschaft wie der
Gesamtheit diente er mit gleicher Liebe. Ehre seinem Andenken! Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1. Mai 1928: "Bad Kissingen. (Aus technischen Gründen
verspätet). Am 30. März verschied nach mehrmonatiger schwerer Krankheit
im jüdischen Krankenhaus zu Frankfurt am Main, noch nicht fünfzig Jahre
alt, Herr Rechtsanwalt Dr. Silberschmidt von Bad Kissingen. Ein
Mann von gerader, vornehmer Gesinnung, ein treuer Bekenner des
konservativen Judentums ist mit ihm dahingegangen. Im bayerischen Judentum
hat er sich als stellvertretender Präsident der Tagung des bayerischen
Landesverbandes einen geachteten Namen erworben. Am 2. April fand auf dem
Frankfurter jüdischen Friedhof die Beerdigung statt. In Anbetracht des
Monats Nissan beschränkte sich Herr Rabbiner Dr. Horowitz
(Frankfurt am Main) auf wenige Worte des Dankes an den Verblichenen und
des Trostes an die Hinterbliebenen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Bamberger (Bad
Kissingen) sprach im Namen der Gemeinde und des Israelitischen Kurhospizes
in Bad Kissingen, dessen Vorstandschaft der Verstorbene angehört und dem
er durch Rat und Tat seine Dienste gewidmet hat. Im Auftrage der
Kultusgemeinde Bayreuth, der Heimatgemeinde des Entschlafenen,
überbrachte Herr Rabbiner Dr. Salomon (Bayreuth)
den Angehörigen den Ausdruck herzlicher Teilnahme. Dem trauernden Bruder
will die Gemeinde für seine treue, hingebungsvolle, ehrendienstliche
Arbeit Dank und Verehrung darbringen. In der Zeit seiner beruflichen
Ausbildung hatte der Verblichene dank seiner musikalischen Befähigung den
Gottesdienst durch Chorgesang ausgestaltet und verschönt. Ein Ehrengrab,
das die Gemeinde angeboten, konnte von der Familie leider nicht angenommen
werden. Namens des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden
würdigte Herr Justizrat Dr. E. Strauß (München) die Verdienste
des Entschlafenen. Seit Beginn der Tätigkeit des Verbandes stand er als
zweiter Präsident der Tagung an hervorragender Stelle und hat noch auf
der letzten Tagung in Fürth in mühevoller Arbeit umsichtig und
verbindlich die Verhandlungen geleitet. Seinen Rat und seine Arbeit wird
der Verband sehr vermissen. Abschiedsgrüße überbrachten noch Herr Justizrat
Dr. Bulheller von Bad Kissingen im Auftrage der dortigen Anwälte, Herr
Oberstudienrat Freudenberger (Würzburg) für die Franken-Loge und
Herr Dr. med. Mayer von Bad Kissingen für Burschenbund Wirzeburgia.
Durch alle Reden klang die Trauer um einen Mann, der das Reine ehrte, die
Treue wahrte und seinem Judentum lebte. Seiner Gemeinschaft wie der
Gesamtheit diente er mit gleicher Liebe. Ehre seinem Andenken! Seine
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
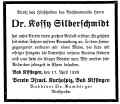 Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1. Mai 1928: Anzeige in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung"
vom 1. Mai 1928:
"Durch das Hinscheiden des Rechtsanwalts Herrn
Dr. Koffy Silberschmidt
hat unser Verein einen großen Verlust erlitten. Er gehörte seit vielen
Jahren unserer Verwaltung an. In dem Heimgegangenen verlieren wir einen
Mann, der stets mit eifriger Hingabe die Interessen unseres Vereins
förderte und uns stets ein kluger Berater war. Wir werden sein Andenken
jederzeit in Ehren behalten.
Bad Kissingen, den 17. April 1928.
Verein Israelitisches Kurhoospiz, Bad Kissingen. Rabbiner Dr.
Bamberger, Vorsitzender." |
Dr. J. Bamberger ist 25 Jahre als Arzt in Bad Kissingen tätig
(1928)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.
April 1928: "Kissingen, 15. April (1928). Mit Beginn der Saison
1928 sieht Herr Dr. J. Bamberger auf seine 25-jährige Tätigkeit
als Arzt in Bad Kissingen zurück." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.
April 1928: "Kissingen, 15. April (1928). Mit Beginn der Saison
1928 sieht Herr Dr. J. Bamberger auf seine 25-jährige Tätigkeit
als Arzt in Bad Kissingen zurück." |
Todesanzeige für Henriette Rosenthal (1928)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15.
November 1928: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15.
November 1928:
"Unsere innigstgeliebte Mutter, Großmutter, Schwester und Tante
Frau Henriette Rosenthal
verschied am Heiligen Schabbat Paraschat Chaje Sara (= 10.
November 1928) unerwartet rasch kurz vor vollendetem 70. Lebensjahr.
Bad Kissingen, Halberstadt, Berlin, Frankfurt am Main, 11. November
1928.
Im Namen der Trauernden Hinterbliebenen:
Hermann Rosenthal und Frau, Hugo Rosenthal und Frau, Heinrich Adler und
Frau nebst Enkelkindern." |
Gedächtnisfeier zum Todestag des Würzburger
Rabbiners Seligmann Bär Bamberger (1928)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
1. November 1928: "Bad Kissingen, 17. Oktober (1928). Am
zweiten Tage von Sukkot, dem 50. Todestage des unvergesslichen
Würzburger Raw seligen Andenkens, fand in der hiesigen Synagoge im
Anschluss an Mussaf eine Gedächtnisfeier zu Ehren des großen Führers
in Israel statt. Frei von jeder Trauerstimmung - wie er ausdrücklich
erwähnte - schilderte Herr Rabbiner Dr. Bamberger das Lebensbild des
großen Führers der damaligen Gemeinde Würzburg, ja, der deutschen
Judenheit und zeigte an Hand vieler Beispiele, welch großen Einfluss der
große Raw bei allen behördlichen Stellen hatte. - Sein Wirken und
Schaffen, das heute noch segensreichen Einfluss ausübt, möge auch uns
zum Verdienst sein." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
1. November 1928: "Bad Kissingen, 17. Oktober (1928). Am
zweiten Tage von Sukkot, dem 50. Todestage des unvergesslichen
Würzburger Raw seligen Andenkens, fand in der hiesigen Synagoge im
Anschluss an Mussaf eine Gedächtnisfeier zu Ehren des großen Führers
in Israel statt. Frei von jeder Trauerstimmung - wie er ausdrücklich
erwähnte - schilderte Herr Rabbiner Dr. Bamberger das Lebensbild des
großen Führers der damaligen Gemeinde Würzburg, ja, der deutschen
Judenheit und zeigte an Hand vieler Beispiele, welch großen Einfluss der
große Raw bei allen behördlichen Stellen hatte. - Sein Wirken und
Schaffen, das heute noch segensreichen Einfluss ausübt, möge auch uns
zum Verdienst sein." |
Zum Tod von Rifka Jeidel (1929)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. August 1929: "Frau Rifka Jeidel - sie ruhe in
Frieden. Kissingen, 12. August (1929). Weit über Deutschland hinaus,
man darf sagen, in allen Weltteilen, wo in jüdischem Kreise das Heilbad
Kissingen und damit verbunden das 'Haus Ehrenreich' bekannt ist, wird die
Kunde vom Heimgang der Frau Rifka Jeidel bitteren Schmerz
auslösen. Vor zwei Jahren ging ihr Gatte, Emil Jeidel, der wiese
Talmudgelehrte, der edle Mensch und Musterjude, zu früh von dannen.
Wie Frau Rifka Jeidel, Tochter eines vornehmen jüdischen Hauses in
Kissingen, die Gesinnung, die Ideale, die Arbeit des seltenen Mannes im
Betriebe, in der Familie, in der Erziehung der Kinder, in der Erhaltung
des Torageistes im Hause, in der Ausübung stiller Wohltat in einem langen
glücklichen Eheleben teilte, so setzte sie nach seinem Tode sein Werk
fort. Ein schweres Leiden verhinderte seit anderthalb Jahrzehnten ihre
Bewegungsfreiheit. Aber sie blieb mit Herz und Hand am Werke, vom
Hintergrunde aus mit einem Mutterauge voller Liebe das Ganze überschauend
und betreuend. Wahre Mutter war sie auch den Gästen, die von weit und
breit sich in den Sommermonaten im Hause einfanden, denen am meisten, die
ihres Rates und ihrer Hilfe bedurften. Viele Institutionen, auch in
Frankfurt, wissen ihr goldenes Herz zu preisen, wenn sie auch nicht davon
reden durften, ohne ihr Feingefühl zu verletzen. Das Andenken von Vater
und Mutter lebt in den Kindern, die ganz Geist von ihrem Geiste sind.
Dieser Geist wird auch fernerhin das Haus, die Familie wie die Stätte der
jüdischen Gastlichkeit beseelen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 15. August 1929: "Frau Rifka Jeidel - sie ruhe in
Frieden. Kissingen, 12. August (1929). Weit über Deutschland hinaus,
man darf sagen, in allen Weltteilen, wo in jüdischem Kreise das Heilbad
Kissingen und damit verbunden das 'Haus Ehrenreich' bekannt ist, wird die
Kunde vom Heimgang der Frau Rifka Jeidel bitteren Schmerz
auslösen. Vor zwei Jahren ging ihr Gatte, Emil Jeidel, der wiese
Talmudgelehrte, der edle Mensch und Musterjude, zu früh von dannen.
Wie Frau Rifka Jeidel, Tochter eines vornehmen jüdischen Hauses in
Kissingen, die Gesinnung, die Ideale, die Arbeit des seltenen Mannes im
Betriebe, in der Familie, in der Erziehung der Kinder, in der Erhaltung
des Torageistes im Hause, in der Ausübung stiller Wohltat in einem langen
glücklichen Eheleben teilte, so setzte sie nach seinem Tode sein Werk
fort. Ein schweres Leiden verhinderte seit anderthalb Jahrzehnten ihre
Bewegungsfreiheit. Aber sie blieb mit Herz und Hand am Werke, vom
Hintergrunde aus mit einem Mutterauge voller Liebe das Ganze überschauend
und betreuend. Wahre Mutter war sie auch den Gästen, die von weit und
breit sich in den Sommermonaten im Hause einfanden, denen am meisten, die
ihres Rates und ihrer Hilfe bedurften. Viele Institutionen, auch in
Frankfurt, wissen ihr goldenes Herz zu preisen, wenn sie auch nicht davon
reden durften, ohne ihr Feingefühl zu verletzen. Das Andenken von Vater
und Mutter lebt in den Kindern, die ganz Geist von ihrem Geiste sind.
Dieser Geist wird auch fernerhin das Haus, die Familie wie die Stätte der
jüdischen Gastlichkeit beseelen.
Die Bestattung gestaltete sich am Donnerstag Nachmittag zu einer
imposanten Kundgebung der Trauer und Verehrung. Neben der gesamten
Gemeinde Kissingen waren auch viele auswärtige Trauergäste erschienen
und wohl alle hier in den beiden unter Aufsicht stehenden Häusern
weilenden Kurgäste. In der Friedhofshalle entwarf zuerst Herr
Distriktsrabbiner Dr. Bamberger in längerer Rede ein ergreifendes
Lebensbild von der würdigen Frau des unvergesslichen Mannes, die, wie sie
seinen Lebensweg teilte, ihm nun nach kurzer Zeit in die Ewigkeit folgt.
Erschütternd wirkte es, als danach der greise 'Wilkomirer Raw' in
der Sprache und Melodie seiner Heimat Klage über die seltene Frau
anstimmte, erschütternd auch auf diejenigen, die, ohne Sprache und Art
des Rabbi zu verstehen, doch herausfühlten, wie sich hier ehrliche Trauer
um ein gutes Menschenherz, das zu schlagen aufhörte, spontan Bahn brach.
Zuletzt wusste Herr Redakteur S. Schachnowitz, Frankfurt am Main,
ein langjähriger Freund der Familie, warme Töne der Trauer anzuschlagen
und letzten Dank auszusprechen im Namen vieler, die heute da waren oder
von der Trauerkunde erst später erreicht werden.
Die Sonne senkte sich zur Neige, als wir die letzten Schollen auf den
frischen Grabhügel warfen. Möge ihr Sechus (Verdienst) ihren Kindern
beistehen und auf ihrem Werke ruhen. Ihre Seele sei eingebunden in den
Bund des Lebens." |
25-jähriges Amtsjubiläum von Nathan Bretzfelder als Stadtrat
(1931)
 Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Januar 1931: "Jubiläum und Ehrung von Stadtrat
Bretzfelder in Bad Kissingen. Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Januar 1931: "Jubiläum und Ehrung von Stadtrat
Bretzfelder in Bad Kissingen.
Bad Kissingen, Januar 1931. Eine seltene Feier konnte Herr Stadtrat N.
Bretzfelder hier am Neujahrstage begehen. Es jährt sich zum 25. Mai der
Tag, seitdem Herr Bretzfelder ununterbrochen ehrenamtlich der Stadtverwaltung
Bad Kissingen angehört. Vom Jahre 1905 bis Mitte 1919 war er Mitglied des
Kollegiums der Gemeindebevollmächtigten, von da ab Stadtratsmitglied. Zu
Ehren des Jubilars und seines verdienstvollen Wirkens beschloss der
Stadtrat in der Sitzung vom 23. Dezember vorigen Jahres, ihm eine
künstlerisch gefertigte Anerkennungsurkunde zu verleihen; ebenso wurde
der Vorschlag des Vorsitzenden gebilligt, an den Jubilar Einladung zur
Einzeichnung in das Goldene Buch der Stadt ergehen zu lassen.
Oberbürgermeister Dr. Pollwein begab sich am Neujahrstage in das Haus
Bretzfelder, um dem Jubilar in dessen Familienkreise die
Anerkennungsurkunde persönlich zu überreichen und ihn gleichzeitig in
das Goldene Buch einzeichnen zu lassen. Unter gleichzeitiger Überreichung
eines Blumenkorbes hielt das Stadtoberhaupt eine längere ehrende
Ansprache, in der es unter anderem zum Ausdruck brachte, dass der Ehrentag
ein berechtigter Anlass zu dreifacher Freude sein könnte, für den
Jubilar selbst, für die Familienangehörigen, aber auch für die
Stadtverwaltung; für letztere sei das Jubiläum aber auch Gelegenheit zur
Bekundung aufrichtigen Dankes für das uneigennützige, verdienstvolle
Wirken im Dienste des Gemeindewohles im Laufe von zweieinhalb Jahrzehnten.
Herr Stadtrat Bretzfelder dankte in bewegten Worten dem Vertreter der
Stadt für die ehrenvolle Auszeichnung und stellte eine Spende für
wohltätige gemeinnützige Zwecke zur Verfügung." |
| |
 Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar
1931: "Bad Kissingen (Jubiläum und Ehrung). Eine seltene
Feier konnt Herr Stadtrat N.
Bretzfelder hier am Neujahrstage begehen. Es jährt sich zum 25. Mai der
Tag, seitdem Herr Bretzfelder ununterbrochen ehrenamtlich der Stadtverwaltung
Bad Kissingen angehört. Vom Jahre 1905 bis Mitte 1919 war er Mitglied des
Kollegiums der Gemeindebevollmächtigten, von da ab Stadtratsmitglied. Zu
Ehren des Jubilars und seines verdienstvollen Wirkens beschloss der
Stadtrat in der Sitzung vom 23. Dezember vorigen Jahres, ihm eine
künstlerisch gefertigte Anerkennungsurkunde zu verleihen; ebenso wurde
der Vorschlag des Vorsitzenden gebilligt, an den Jubilar Einladung zur
Einzeichnung in das Goldene Buch der Stadt ergehen zu lassen.
Oberbürgermeister Dr. Pollwein begab sich am Neujahrstage in das Haus
Bretzfelder und hielt eine längere ehrende Ansprache.
Herr Stadtrat Bretzfelder dankte in bewegten Worten dem Vertreter der
Stadt für die ehrenvolle Auszeichnung und stellte eine Spende für
wohltätige gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Herr Stadtrat
Bretzfelder ist seit 28 Jahren Mitglied der Kultusverwaltung und seit 30
Jahren Vorstand des Männervereins (Chewra). Der Vereinigung für das
liberale Judentum ist er ebenfalls ein langjähriges treues Mitglied,
sodass wir ihm auch an dieser Stelle unsere besten Glückwünsche
aussprechen".
Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar
1931: "Bad Kissingen (Jubiläum und Ehrung). Eine seltene
Feier konnt Herr Stadtrat N.
Bretzfelder hier am Neujahrstage begehen. Es jährt sich zum 25. Mai der
Tag, seitdem Herr Bretzfelder ununterbrochen ehrenamtlich der Stadtverwaltung
Bad Kissingen angehört. Vom Jahre 1905 bis Mitte 1919 war er Mitglied des
Kollegiums der Gemeindebevollmächtigten, von da ab Stadtratsmitglied. Zu
Ehren des Jubilars und seines verdienstvollen Wirkens beschloss der
Stadtrat in der Sitzung vom 23. Dezember vorigen Jahres, ihm eine
künstlerisch gefertigte Anerkennungsurkunde zu verleihen; ebenso wurde
der Vorschlag des Vorsitzenden gebilligt, an den Jubilar Einladung zur
Einzeichnung in das Goldene Buch der Stadt ergehen zu lassen.
Oberbürgermeister Dr. Pollwein begab sich am Neujahrstage in das Haus
Bretzfelder und hielt eine längere ehrende Ansprache.
Herr Stadtrat Bretzfelder dankte in bewegten Worten dem Vertreter der
Stadt für die ehrenvolle Auszeichnung und stellte eine Spende für
wohltätige gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Herr Stadtrat
Bretzfelder ist seit 28 Jahren Mitglied der Kultusverwaltung und seit 30
Jahren Vorstand des Männervereins (Chewra). Der Vereinigung für das
liberale Judentum ist er ebenfalls ein langjähriges treues Mitglied,
sodass wir ihm auch an dieser Stelle unsere besten Glückwünsche
aussprechen". |
Zum Tod des Großindustriellen und Philanthrop - Kurgast in Bad Kissingen - Michael
Nassatisin (1931)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20.
August 1931: "Bad Kissingen. Plötzlich verstarb hier der
in London ansässige Großindustrielle und zionistische Philanthrop
Michael Nassatisin. Er kam unter zahlreicher Beteiligung auf den
Friedhof zu Bad Kissingen zur letzten Ruhe. Nach der Gedenkrede des Herrn
Distriktsrabbiners Dr. Bamberger, ergriff Ussischkin das Wort zu einer
ergreifenden Ansprache, in der er u.a. mitteilte, dass die Gebeine des
Verstorbenen nach Erez Jisroel überführt werden
sollen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20.
August 1931: "Bad Kissingen. Plötzlich verstarb hier der
in London ansässige Großindustrielle und zionistische Philanthrop
Michael Nassatisin. Er kam unter zahlreicher Beteiligung auf den
Friedhof zu Bad Kissingen zur letzten Ruhe. Nach der Gedenkrede des Herrn
Distriktsrabbiners Dr. Bamberger, ergriff Ussischkin das Wort zu einer
ergreifenden Ansprache, in der er u.a. mitteilte, dass die Gebeine des
Verstorbenen nach Erez Jisroel überführt werden
sollen." |
 Links
Foto von Links
Foto von
Michael Nassatisin
aus dem
Wikipedia-Artikel
zu Michael Nassatisin. |
Rechts: Grabstein
für
Michael Nassatisin im
jüdischen Friedhof in
Bad Kissingen
(Fotos: Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries, 2012) |
 |
 |
Der Philanthrop und Kunstsammler Dr. James Simon - Kurgast in
Bad Kissingen - feiert seinen 80. Geburtstag (1931)
 Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Oktober 1931: "Bad Kissingen. Anlässlich
des 80. Geburtstages des in diesen Tagen viel gefeierten Philanthropen und
Kunstsammlers Dr. h.c. James Simon ließ die Israelitische
Kultusgemeinde Bad Kissingen dem Jubilar, der sich hier zur KUr aufhielt,
ein Blumenarrangement mit einem Glückwunschschreiben
überreichen." Artikel in der "Bayerischen israelitischen Gemeindezeitung"
vom 15. Oktober 1931: "Bad Kissingen. Anlässlich
des 80. Geburtstages des in diesen Tagen viel gefeierten Philanthropen und
Kunstsammlers Dr. h.c. James Simon ließ die Israelitische
Kultusgemeinde Bad Kissingen dem Jubilar, der sich hier zur KUr aufhielt,
ein Blumenarrangement mit einem Glückwunschschreiben
überreichen." |
Zum Tod des "Wilkomirer Raw" - Kurgast in Bad Kissingen - (1935)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Dezember 1935: "Rabbi Arjeh Leib Ruin, der 'Wilomirer
Raw' - das Andenken des Gerechten ist zum Segen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 5. Dezember 1935: "Rabbi Arjeh Leib Ruin, der 'Wilomirer
Raw' - das Andenken des Gerechten ist zum Segen.
Nach dem rasch aufeinander erfolgten Heimgang weltberühmter Gaonim
blieben uns noch einige wenige große Toraführer in der Welt, zu denen
wir in doppelter Verehrung hinaufschauten. Nun hat sich auch dieser kleine
Kreis wieder gelichtet. Der Wilkomirer Raw, Rabbi Arjeh Leib Rubin, ist am
Mittwoch, den 1. Kislew, von uns gegangen...
Zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken.
|
 |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeigen des Speisewirts David Hartmann (1845 / 1846 / 1847)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
23. Juni 1845: "Empfehlung. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
23. Juni 1845: "Empfehlung.
Nachdem ich meine Speisewirtschaft derart erweitert und eingerichtet habe,
dass ich allen Anforderungen verehrlicher Badegäste bestens entsprechen
zu können im Stande bin, so zeige ich dieses unter dem Beifügen an, dass
ich für gute Speisen und Getränke, sowie für gute Bedienung die
möglichste Sorge tragen werde. Es wird jeden Mittag table d'hôte und
Abend nach der Karte in einem großen geräumigen Saale meines Hauses
gespeist. Auch bin ich erbötig, Logis-Bestellungen zu übernehmen und
aufs Beste zu besorgen.
David Hartmann, israelitischer Speisewirt in Bad
Kissingen." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22.
Juni 1846: "Empfehlung. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22.
Juni 1846: "Empfehlung.
Bei der bevorstehenden Badesaison beehrt sich Unterzeichneter den
verehrlichen israelitischen Badegästen, seine sehr zweckmäßig
eingerichtete Speisewirtschaft zu empfehlen. Ich werde für gute Speisen
und Getränke, sowie für gute Bedienung alle mögliche Sorge tragen und
wird jeden Mitte table d'hôte und Abend à la carte gespeist.
David Hartmann, israelitischer Speisewirt in Bad
Kissingen." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 15. Juni 1847: Anzeige
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 15. Juni 1847:
Derselbe Text wie 1846. |
Anzeigen der Restauration von G. Maier (1868 / 1872)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6.
Mai 1868: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6.
Mai 1868:
"Restauration G. Maier in Bad Kissingen,
Ostendstraße Nr. 340,
neu und bequem eingerichtet, mit Garten beim Hause, empfiehlt sich den
verehrlichen israelitischen Bade-Gästen unter Zusicherung reeller und
aufmerksamer
Bedienung." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1872: "Bad
Kissingen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1872: "Bad
Kissingen.
Die israelitische Restauration von G. Mayer, Ostendstraße Nr. 340,
streng religiös und nach den Vorschriften der Bade-Ärzte eingerichtet,
empfiehlt sich den verehrlichen Badegästen aufs Angelegentlichste und
verspricht reelle und aufmerksame Bedienung. Eröffnung am 15.
Mai." |
Lob für J. Schatt aus Tauroggen, Schochet in
Bad Kissingen (1870)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
August 1870: "Ehre dem Ehre gebührt. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
August 1870: "Ehre dem Ehre gebührt.
Bei einem mehrwöchentlichen Aufenthalt in Kissingen hatte Einsender
dieses Gelegenheit, den dortigen Schochet, Herrn J.
Schatt aus Tauroggen, näher kennen zu lernen. Derselbe verbindet mit
streng-religiöser Lebensweise und Charakterfestigkeit
bewunderungswürdige theoretische und praktische Fachkenntnis, sodass die
Gemeinde Kissingen, sowie das zahlreich nach Kissingen kommende jüdische
Badepublikum sich glücklich schätzen können, dass es den
uneigennützigen Bemühungen des dortigen hochgeehrten Distrikts-Rabbiners
gelungen ist, diese so hochwichtige religiöse Funktion in so bewährte
Hände gebracht zu haben. Ein Badegast." |
Anzeigen des Israelitischen Hotels Schwed (1872 / 1874 / 1885)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872:
"Das koschere Hôtel Schwed in Bad Kissingen ist seit Eröffnung der
Eisenbahn auch außer der Kurzeit das ganze Jahr geöffnet und empfiehlt
sich den verehrten israelitischen Geschäftsreisenden, sowie Familien zu
Hochzeitsfesten mit der Versicherung billiger und bester
Bedienung." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872:
"Das koschere Hôtel Schwed in Bad Kissingen ist seit Eröffnung der
Eisenbahn auch außer der Kurzeit das ganze Jahr geöffnet und empfiehlt
sich den verehrten israelitischen Geschäftsreisenden, sowie Familien zu
Hochzeitsfesten mit der Versicherung billiger und bester
Bedienung." |
| |
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5.
Mai 1874: "Bad Kissingen. Israelitisches Hôtel 'Schwed' mit
Pavillon, seit 1826 bestehend, empfiehlt sich auch für dieses
Jahr allen verehrlichen Badegästen hochachtungsvollst." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5.
Mai 1874: "Bad Kissingen. Israelitisches Hôtel 'Schwed' mit
Pavillon, seit 1826 bestehend, empfiehlt sich auch für dieses
Jahr allen verehrlichen Badegästen hochachtungsvollst." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar
1885: "Bad Kissingen. Koscheres Hôtel Schwed, Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar
1885: "Bad Kissingen. Koscheres Hôtel Schwed,
auch im Winter geöffnet.
Koscheren Wein aus Jerusalem.
Versehen mit Stallung für Equipage der Herren Geschäftsreisenden.
Gratisbillard für Wein- und Stammgäste. Verehrten Gönnern bestens
empfohlen." |
Stellungnahme des Israelitischen Hotels
"Europäischer Hof" zu einer Anzeige von Rabbiner Bamberger
(1884)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli
1884: "Zur Abwehr! Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli
1884: "Zur Abwehr!
Der Herr Distrikts-Rabbiner Bamberger dahier hat folgende Annonce in der
jüdischen Zeitung 'Israelit' bekannt gegeben:
'Sehe mich zur Bekanntgabe veranlasst, dass in dem israelitischen Hotel
'Europäischer Hof' dahier Fleisch von auswärts bezogen wird, für dessen
Kascherus ich natürlich keine Verantwortung tragen kann. Bad
Kissingen Rabbiner Bamberger.'
Das Interesse meines Geschäftes, welches Herr Rabbiner Bamberger
hierdurch zu verdächtigen und zu schädigen sucht, zwingt mich zur
folgenden Erklärung:
Dessen 'Grundangabe' Fleisch von auswärts zu beziehen ist diese
verschleierte Abfassung zu weitgehend und von Herrn Rabbiner Bamberger
absichtlich so geschehen, auf dass keine gerichtliche Klage erhoben werden
könne.
Man könnte ja Wunder denken, woher ich das Fleisch beziehe, allein Herr
Rabbiner Bamberger weiß ganz genau, dass ich das Fleisch von Herrn Metzgermeister
Max Oppenheimer von Schweinfurt erhalte, der seinerzeit seinem seligen
Vater, dem berühmten Rabbiner Seligmann Bär Bamberger Jahre lang das
Fleisch besorgte und von dessen Bruder Josef Oppenheimer in Würzburg der
jetzige Rabbiner Bamberger, das jüdische Seminar und die frömmsten
Israeliten in Würzburg das Fleisch beziehen, und berechtigt dieses mit
Sicherheit zur Annahme, dass überhaupt die Familie Oppenheimer für streng
gewissenhaft in ihren Geschäften renommiert ist. Der Herr Rabbiner
Bamberger weiß auch so gut wie Jedermann hier, dass gerade die hiesigen
Metzger am Samstag und an höchsten Feiertagen wie an Werktagen das
Fleisch verkaufen etc. - und dem Anscheine nach kann Herr Rabbiner
Bamberger dafür trotzdem die Verantwortung tragen, da er dasselbe von
ihnen bezieht.
Folgendes Zeugnis des Herrn Distrikts-Rabbiner Lebrecht in
Schweinfurt wird mich rechtfertigen:
'Auf Ersuchen des Restaurateurs Morck von Kissingen wird bezeugt, dass
der Metzger Herr Oppenheimer dahier, von welchem jener, nach
beiderseitiger Aussage, sein Fleisch bezieht, sowie auch der hiesige
Schächter Herr Ledermann einen so ungetrübten religiösen Leumund
besitzen, als irgend ein anderer Metzger oder Schächter, dass ich demnach
die Verantwortung für das von demselben als koscher geliferte Fleisch so
weit übernehme, als man überhaupt für Menschen Verantwortlichkeit
übernehmen kann.
Schweinfurt, am 30. Juni 1884. Lebrecht, Distrikts-Rabbiner.' ...
Im Besitze obigen Zeugnisses des Herrn Rabbiner Lebrecht und zur
Veröffentlichung des wahren Sachverhaltes, glaube ich, dass die
Bekanntgabe des Herrn Rabbiner Bamberger auch für den frömmsten
Israeliten gegenstandslos sein werde...
Bad Kissingen. Leopold Morck." |
| Hinweis: nach http://www.bookmaps.de/lib/all/s/i/sib_2.html
verfasste Leopold Morck auch das Buch: "Sibirien in Kissingen: d. dt.
Volke kund u. zu wissen, d. grausame, ... Behandlung d. armen kranken
Arbeiter, ... von d. Bezirks- u. Oberstabsarzt a. D. Glaser in Bad
Kissingen. Bad Kissingen. Selbstverlag 1896 VIII. 165
S." |
| Leopold Morck (geb. 7.9.1840, gest.
27.6.1898) wurde im jüdischen
Friedhof Bad Kissingen beigesetzt (R 10-10). . |
Werbung für die jüdischen Restaurationen
(1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
25. August 1890: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
25. August 1890: |
Anzeige des Hotels Herzfeld (1902)
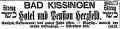 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
31. Juli 1902: "Streng Koscher - Bad Kissingen - Streng
Koscher. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
31. Juli 1902: "Streng Koscher - Bad Kissingen - Streng
Koscher.
Hotel und Pension Herzfeld.
Großes Restaurant; das ganze Jahr offen. - Maxstraße, unweit der neuen
Synagoge. Telephon 103." |
| |
|
Ansichtskarte
des Hotels Herzfeld (1906)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
|
|
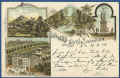 |
 |
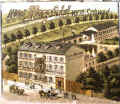 |
|
Die Litho-Ansichtskarte von Bad Kissingen mit dem
"Hôtel Herzfeld vorm. Schwed" wurde versandt am 27. Juni 1906 an Paul
Sussmann, Berlin. Das israelitische Hotel Schwed bestand seit 1826 (vgl.
auch die Anzeigen oben) und wurde am 13. September 1900 Moses Herzfeld
übernommen, ein Sohn der Witwe Herzfeld aus Darmstadt. |
| |
|
|
|
Ansichtskarte:
Speisesaal des Hotels Herzfeld (um 1920-1930;
aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries)
|
 |
 |
Die Vorderseite der
obigen Karte zeigt den Speisesaal des Hotels Herzfeld in Bad Kissingen. Als Verlag
wird angegeben : Julius Hoffmann, Photograf, Bad Kissingen.
Anmerkung: Am 20. Dezember 1937 erhielten alle 20 jüdische Kurbetriebe die Auflage, dass sich
der Betrieb ausschließlich auf Juden zu beschränken habe und ein diesbezügliches
für jeden Eintretenden leicht sichtbares Hinweisschild mit der Aufschrift -
"Aufenthalt und Verpflegung nur für jüdische Kurgäste" im Innern des Eingangbereichs als auch an der Außenseite des Hauses anzubringen.
Zudem durfte im gesamten Fremdenbeherbungsbetrieb kein "deutschblütiges" weibliches
Personal unter 45 Jahren beschäftigt werden. Mitte März 1938 wurde allen jüdischen
Kurbetrieben die Konzession zur Weiterführung verweigert - bis auf das Hotel der Geschw.
Seelig, das Haus Apolant, das Kurheim Klara Rosenau und das Kurheim Bella Regensburger und nachträglich
noch das Kurheim Dr. Münz und das Kurheim Isaak Tachauer. Davon betroffen auch die Israelitische Kinderheilstätte und die Israelitische Kurhospiz.
Julius und Martha Hoffmann, die ein Photographen - Geschäft in Bad Kissingen führten
wanderten bereits Anfang November 1933 nach Italien aus.
Quelle: Hans-Jürgen Beck/Walter Rudolf: Jüdisches Leben in Bad Kissingen. Bad Kissingen 1990. - S. 89-92, S. 144. |
Verlobungsanzeige
von Rifka Ehrenreich und Emil Jeidel (1903)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April
1903:
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. April
1903:
"Statt besonderer Anzeige:
Rifka Ehrenreich - Emil Jeidel
Verlobte.
Bad Kissingen Theresienstraße - London Nr.
46 Pyrland Rd. Canonbury." |
Anzeige der Bäckerei H. Baumblatt
(1903)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
19. November 1903: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
19. November 1903: |
Anzeigen
von Bade-Arzt Dr. Münz (1904)
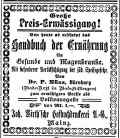 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18.
April 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18.
April 1904: |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25.
Mai 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25.
Mai 1904: |
Anzeige von Frau Eisenburg (1905)
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom
14. April 1905: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom
14. April 1905: |
Anzeigen des Hotels Ehrenreich (1904 / 1911) - sowie Bericht über
Veränderungen im Hotel (1906)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1904: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1904:
"Metzger gesucht.
Hotel Ehrenreich, Bad Kissingen." |
| |
 Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. April 1906:
"Bad Kissingen. Hotel Ehrenreich, welches den israelitischen
Kurgästen als vorzügliches Haus nicht unbekannt sein dürfte, ist durch
Ankauf eines Nebenhauses mit Garten bedeutend vergrößert worden und
bietet seinen Besuchern jeden Komfort der
Neuzeit." Anzeige
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. April 1906:
"Bad Kissingen. Hotel Ehrenreich, welches den israelitischen
Kurgästen als vorzügliches Haus nicht unbekannt sein dürfte, ist durch
Ankauf eines Nebenhauses mit Garten bedeutend vergrößert worden und
bietet seinen Besuchern jeden Komfort der
Neuzeit." |
| |
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom
13. Januar 1911: "Für die Saison 1911 suche ich mehrere
streng religiöse junge Mädchen für Küche und Büffet. Offerten
nebst Angabe der bisherigen Tätigkeit, des Alters und der
Gehaltsansprüche, unter Beifügung von Bild und Zeugnisabschriften
erbeten. Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom
13. Januar 1911: "Für die Saison 1911 suche ich mehrere
streng religiöse junge Mädchen für Küche und Büffet. Offerten
nebst Angabe der bisherigen Tätigkeit, des Alters und der
Gehaltsansprüche, unter Beifügung von Bild und Zeugnisabschriften
erbeten.
Einige Kochlehrmädchen werden ohne gegenseitige Vergütung
angenommen. Hotel Ehrenreich, Bad Kissingen." |
Hochzeitsanzeige
für Selma Selka und Joseph Bamberger (1912)
Anmerkung: Joseph Aharon Bamberger (geb. 1875 in Bad Kissingen, gest. 1944 in
Jerusalem) war ein Sohn von Rabbiner Moses Löb Bamberger und seiner Frau Sara
geb. Ettlinger. Er heiratete Selma geb. Selka (geb. 1882 in Breslau, gest. 1973
in Jerusalem), mit der er vier Kinder hatte: Salomon, Moshe, Rosel und
Ben-Zion.
 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Dezember 1912: "Statt besonderer Anzeige. Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 20. Dezember 1912: "Statt besonderer Anzeige.
Die Trauung unserer Kinder Selma und Joseph
findet - so Gott will - am Dienstag, 24. Dezember in Berlin, Marinehaus,
statt.
Salomo Selka und Frau, Berlin. Frau Rabbiner M.L. Bamberger, Bad Kissingen."
|
Anzeige des Manufaktur- und Wäschegeschäftes Arthur
Grünebaum (1912 / 1929) sowie
Postkarte (1901)
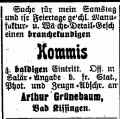 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 8. November 1912: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 8. November 1912:
"Suche für mein Samstag und israelitische Feiertage geschlossenes
Manufaktur- und Wäsche-Detail-Geschäft einen branchekundigen
Kommis
zum baldigen Eintritt. Offerten mit Salär-Angabe bei freier
Station, Photo und Zeugnis-Abschriften an
Arthur Grünebaum, Bad
Kissingen." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7.
Februar 1929: "Suche zum baldigen Eintritt, spätestens Mai einen kräftigen
Lehrling. Samstag und Feiertage geschlossen. Kost und Logis außer dem
Hause. Vergüte über Tarif. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7.
Februar 1929: "Suche zum baldigen Eintritt, spätestens Mai einen kräftigen
Lehrling. Samstag und Feiertage geschlossen. Kost und Logis außer dem
Hause. Vergüte über Tarif.
Arthur Grünebaum, Bad Kissingen, Manufaktur- und
Wäschegeschäft." |
| |
Postkarte (1901)
(aus der Sammlung von
Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries) |
 |

|
|
Anmerkung: Die Postkarte
geschäftlicher Natur wurde am 10. Juli 1901 von Arthur Grünebaum nach
Münchberg gesandt. Der aus Wenkheim bei
Tauberbischofsheim stammende Arthur Grünebaum war Textilhändler und führte
in Bad Kissingen ein Manufaktur- und Wäschegeschäft im Haus Boxberger direkt
neben der Boxberger-Apotheke. Arthur Grünebaum war verheiratet mit Sophie
geb. Schaalmann aus Eichstätt. Das
Ehepaar hatte sechs Kinder, wovon die Tochter Elsa bereits wenige Tage nach
der Geburt starb (April 1902). Norbert Grünebaum wurde am 20. Februar 1903
geboren, Frieda Grünebaum 1904, Flora Grünebaum 1905, Hermann Grünebaum 1906
und Fanny Grünebaum 1908. Norbert Grünebaum hat das Geschäft von seinem
Vater übernommen. Arthur Grünebaum starb 1935 in Bad Kissingen. Bereits 1933
mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten begannen die ersten
Boykott-Aktionen gegen die jüdischen Geschäfte in Bad Kissingen, denen im
Laufe der Zeit weitere Schikanen folgten. Beim Novemberpogrom 1938 wurde
Norbert Grünebaum zusammen mit seinem Onkel Sigmund Grünebaum verhaftet und
eine Zeitlang im KZ Dachau inhaftiert. Ende Februar 1939 emigrierte Norbert
Grünebaum mit seiner Frau Dina geb. Jeidel und Sohn Josef über London in die
USA. Der Witwe Sophie Grünebaum gelang mit Tochter Flora die Flucht nach New
York.
Quellen:
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=176
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=177
https://www.historisches-unterfranken.uni-wuerzburg.de/juf/Datenbank/detailsinclude.php?global=;search;37349.
|
Anzeige
der Damenschneiderei Max Kissinger (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. Juli 1924: "Max
Kissinger - Bad Kissingen.
Anzeige in der "CV-Zeitung" ( Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 24. Juli 1924: "Max
Kissinger - Bad Kissingen.
Damenschneiderei. Mantelkleider, kleine
Gesellschaftstoiletten, Abendmäntel, Pelze, Kostüme, Leder- und
Sportbekleidung. Eleganteste Anfertigung nach Originalen der tonangebenden
Modellhäuser des In- und Auslandes. Hervorragende Modellkollektion.
Herrenschneiderei. Maßanfertigung in höchster Vollendung. Frack-,
Smoking- und Tanzanzüge, Pelze, Straßen- und Sportbekleidung. Englische
und deutsche Stoffe -
nur die edelsten Fabrikate - in hervorragender
Auswahl." |
Hochzeitsanzeige von Fritz Löwenthal und Flora
Grünebaum sowie Norbert Grünebaum und Dina Jeidel (1931)
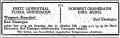 Anzeige in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
Oktober 1931: "Gott sei gepriesen. Anzeige in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
Oktober 1931: "Gott sei gepriesen.
Fritz Löwenthal - Flora Grünebaum. Wuppertal - Ronsdorf - Bad
Kissingen
Norbert Grünebaum - Dina Jeidel. Bad Kissingen
geben ihre - so Gott will - am Sonntag, den 11. Oktober 1931 - am
1./2. Chäschwan - im Hotel Ehrenreich, Bad Kissingen stattfindenden
Trauungen bekannt.
Wir bitten, uns freundlichst zugedachte Telegramme abzulösen." |
Ansichtskarte
des Sanatoriums Dr. Apolant (1931) und weitere Dokumente zum Sanatorium bzw. zur
Familie Apolant
(Karten, Abbildungen und Texte von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)
|
Die Ansichtskarte mit dem Foto des Sanatoriums Dr.
Apolant in Bad Kissingen wurde versandt von Bad Kissingen nach Ansbach am 13. August 1931.
Das Sanatorium Apolant wurde 1906 in der Menzelstrasse 8 in Bad Kissingen als
Kurhaus Dr. Apolant erbaut. Es war ein Sanatorium für innere Krankheiten und Diätkuren, dessen Betrieb sich nur über die Monate von Anfang März bis Ende Oktober des Jahres erstreckte.
1912/1913 wurde auf Grund steigender Nachfrage das Anwesen durch ein zweites größeres Gebäude (Menzelstrasse 10) erweitert.
Die Pläne für das Stammhaus ebenso wie die Pläne vom Nachbarhaus - Erweiterungsbau 1912/1913
- wurden vom Architekten Paul Schultze-Naumburg gefertigt (zu seiner
Person, auch als Wegbereiter der NS-Zeit siehe Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Schultze-Naumburg).
In den Zeiten des 1. Weltkriegs diente das Sanatorium als Reservelazarett. Das Sanatorium wurde bis Beginn des 2. Weltkriegs 1939 betrieben,
allerdings zeigten die vom Reichsinnenministerium im Juli 1937 erlassenen restriktiven Richtlinien bezüglich der Aufnahme von Juden in Heilbädern
im Dezember 1937 in Form von vom Kissinger Stadtrat für die 20 jüdischen Kurbetriebe verfassten Auflagen seine ersten Niederschläge
(vgl. Hans Jürgen Beck und Rudolf Walter: Jüdisches Leben in Bad Kissingen.
S. 89). Am 3. März 1938 einigte sich der Kissinger Baubeirat, nur noch
vier jüdischen Betrieben die Konzession zu erteilen, verbunden mit einem Beschäftigungsverbot für "arisches" Personal und einer Kennzeichnung der
jüdischen Betriebe (S. 91), - übrig blieben das Sanatorium Apolant, das Hotel Seelig und die Kurheime von Klara Rosenau und Bella Regensburger.
Nach der Enteignung 1939 durch die Nationalsozialisten fand des Sanatorium in den Kriegszeiten Verwendung als Flüchtlingsheim.
In den Jahren von 1955 - 1978 fand das Sanatorium Apolant mit der LVA Hessen als Träger eine weitere Nutzung. Seit 1978 steht das Sanatorium Apolant leer
und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen.
Sanitätsrat Dr. med. Edgar Apolant von Berlin (Sohn von Alexander Apolant und seiner Frau
Bertha geb. Memmelsdorf) war der Bauherr und Namensgeber des Sanatoriums Apolant. Er starb 1929 in Berlin, wo er auch nach dem Bau des Sanatoriums seinen Wohnsitz behielt.
Nach seinem Ableben ging das Erbe auf den Sohn Edgar Sigmund Apolant über. Trotzdem, dass die Familie zum Protestantismus konvertiert war, blieb
Edgar Sigmund Apolant aufgrund der Rassegesetze keine andere Möglichkeit als die Emigration (1935) nach Port Washington
N.Y. in die USA, wo er 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm,
Ella Apolant (geb. 1. Januar 1871 in Samter) war die Schwester von Edgar Apolant. Sie war die ganzen Jahre hindurch von 1916 (Klinikeröffnung) bis
1938 (kurz vor der Enteignung) als Empfangsdame im Sanatorium tätig und dort auch für die kaufmännische Leitung zuständig,
behielt aber ihren Hauptwohnsitz - wie auch der Bruder - in Berlin. Im Oktober 1938 verzog
sie nach Frankfurt. Im September 1942 erfolgte die Deportation nach Theresienstadt,
wo sie am 18. März 1944 umgekommen ist. Heute erinnert ein Stolperstein in der Menzelstrasse 8 an Ella Apolant und ihr Schicksal.
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Sanatorium_Apolant_(Bad_Kissingen)
http://www.infranken.de/regional/bad-kissingen/Das-Apolant-in-Bad-Kissingen-kann-abgerissen-werden;art211,368591
http://www.hnp-architekten.com/referenzen/machbarkeitsstudien/revitalisierung-ehem-sanatorium-apolant-bad-kissingen.html
http://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Ella-Apolant;art766,5470165
https://www.badkissingen.de/de/tourismus-kurort-bayern/kultur/veranstaltungen/bad-kissinger-stolpersteine/liste/biographien/16836.ELLA-APOLANT-1871-1944-Empfangsdame-Menzelstrasse-8.html
Genealogische Informationen zu Familie Apolant: Einstieg zum Beispiel
über Edgar Apolant
https://www.geni.com/people/Edgar-Apolant/6000000172703509592
|
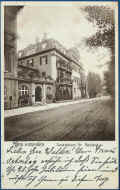 |
 |
 |
Ansichtskarte
mit einem Foto des Sanatoriums Dr. Apolant (1931)
|
Anzeigen in der
"Jüdischen Rundschau 1936 Nr. 35 vom
1. Mai 1936 mit einer Anzeige des Sanatoriums Apolant in Bad
Kissingen |
| |
|
 |

 |

 |
Ansichtskarte
des Kurhauses "Apolant", versandt
am 1. März 1973, fünf Jahre vor der Schließung |
Eindrücke des Gebäudes des ehemaligen Sanatoriums/Kurhauses Apolant in der Gegenwart
(seit 1978 leerstehend) |
| |
|
|

 |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|

|
 |
|
| Postkarte
aus dem "Haus Apolant" in Bad Kissingen, versandt am 14. August 1908 in Bad
Kissingen mit Postankunftsstempel Hamburg am 15. August 1908. |
|
| |
|
|
 Links:
Briefumschlag an Frau "Eva Schröder, z.Z. – Bad Kissingen – San. Dr. Apolant".
Eva Schröder war die 1898 geborene Tochter von Edgar Apolant und seiner Frau
Emma geb. Wolff. Edgar Apolant war der Erbauer und Beteiber des Sanatoriums
Apolant. Der Briefumschlag trägt einen Sonderstempel der Stadt München –
München – "Hauptstadt der Bewegung – 20. April 1937 – Geburtstag des
Führers". Zu dieser Zeit war Eva Schröder in Bad Kissingen im Sanatorium
Apolant als Privatsekretärin von Dr. Benno Latz tätig, der damals die
ärztliche Leitung des Sanatoriums hatte. Eva Schröder wurde noch im Februar
1945 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie überlebte Theresienstadt
dank ihrer sportlichen Kondition, zog sich dort aber schwere chronische
Krankheiten zu. Im Januar 1949 kehrte Eva Schröder mit ihrem Mann und ihren
drei Kindern nach Bad Kissingen zurück. Links:
Briefumschlag an Frau "Eva Schröder, z.Z. – Bad Kissingen – San. Dr. Apolant".
Eva Schröder war die 1898 geborene Tochter von Edgar Apolant und seiner Frau
Emma geb. Wolff. Edgar Apolant war der Erbauer und Beteiber des Sanatoriums
Apolant. Der Briefumschlag trägt einen Sonderstempel der Stadt München –
München – "Hauptstadt der Bewegung – 20. April 1937 – Geburtstag des
Führers". Zu dieser Zeit war Eva Schröder in Bad Kissingen im Sanatorium
Apolant als Privatsekretärin von Dr. Benno Latz tätig, der damals die
ärztliche Leitung des Sanatoriums hatte. Eva Schröder wurde noch im Februar
1945 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie überlebte Theresienstadt
dank ihrer sportlichen Kondition, zog sich dort aber schwere chronische
Krankheiten zu. Im Januar 1949 kehrte Eva Schröder mit ihrem Mann und ihren
drei Kindern nach Bad Kissingen zurück.
Quellen:
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=659.
https://www.geni.com/people/Eva-Schröder/6000000172704602327 |
Verlobungsanzeige von Herta Nussbaum und Fritz
Nussbaum (1931)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.
November 1931: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.
November 1931:
"Mit Gottes Hilfe. Herta Nussbaum - Fritz Nussbaum.
Verlobte.
Schabbat Paraschat Wajischlach 5692 (= 28. November 1931)
Fulda Lindenstr. 29 - Bad Kissingen/Berlin NW 87 Wikinger Ufer
4,3". |
Verlobungsanzeige
von Fanny Grünebaum und Oskar Katzenstein (1936)
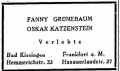 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
27. August 1936: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
27. August 1936: |
Anzeige der Pension Tachauer (1937)
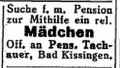 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
Juni 1937: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3.
Juni 1937:
"Suche für meine Pension zur Mithilfe ein religiöses Mädchen.
Offerten an Pension Tachauer, Bad Kissingen."
|
Weitere Erinnerungen an jüdische Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
(wenn nicht anders erwähnt: aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; die Anmerkungen zu
den Karten auf Grund der Recherchen von Peter Karl Müller)
Postkarte
von Schneidermeister Hermann Leuthold
in Kissingen an "Herren Heinrich Katz & Schuster"
in Hammelburg (1874/75) |
 |
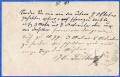
|
 |
 |
|
Der Absender der Karte war der Bad Kissinger
(jüdische) Schneidermeister Hermann Leuthold, der Empfänger der Karte
das Geschäft Heinrich Katz & Schuster in
Hammelburg, deren Geschäftsbereich der Verkauf von Kleiderstoffen,
Cattun und Baumwollwaren war. Rechts - Werbung und Namensliste - aus dem
Adressbuch Bad Kissingen – 1865. Schneidermeister Hermann Leuthold wohnte
nach dem Adressbuch in der Mauergasse 178.
Hermann Leuthold war verheiratet mit Karoline (Kaja) geb. Schwed. Ihr Sohn
Salomon Leuthold war Inhaber eines Textilfachgeschäfts am Marktplatz 2. Die
jüdische Familie Leuthold war eine seit fünf Jahrhunderten alteingesessene
Bad Kissinger Familie. Zu den Herren Heinrich Katz & Schuster - Im
Anzeigenblatt des "Hammelburger Journals" (1854 – 1904) findet sich der Name
Katz & Schuster: 1875: Heinrich Katz & Schuster, Verkauf von
Bordeaux-Rotweinen, Rheinweinen, Zwetschgenankauf sowie 1876: Heinrich Katz
& Schuster, Verkauf von Kleiderstoffen, Cattun und Baumwollwaren.
Links: Biographisches Gedenkbuch Bad Kissingen -
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=370
sowie
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=368
Im "Hammelburger Album":
http://www.hammelburger-album.de/index.php/lebensweise/112.html.
|
| |
|
|
Postkarte
aus Bamberg an
David Schwed in Kissingen (1881) |
 |
 |
|
Die Postkarte aus Bamberg wurde an Herrn David
Schwed in Bad Kissingen am 5. Juli 1881 verschickt. David Schwed war Inhaber
eines Hotels in Kissingen (vgl. nachfolgende Karte; auch auf seinem
Grabstein ist er als Hotelbesitzer genannt. David Schwed wurde am 10.
November 18.. geboren; er starb am 28. Dezember 1888 und wurde im jüdischen
Friedhof Bad Kissingen beigesetzt.
Vgl. auch oben die Anzeigen
des Israelitischen Hotels Schwed (1872/1874/1885) und die Ansichtskarte Hotel Herzfeld vormals Schwed.
Bereits 1844 nennt J.B. Niedergesees in seiner Beschreibung "Beschreibung von Kissingen und seinen Umgebungen, mit Angabe alles Nöthigem was dem Badegast von Interesse seyn könnte"
unter der Rubrik "Israelitische Garküchen" zwei Garküchen, - Meier und Salomon Schwed und David Hartmann.
In seinem Buch "Kissingen mit seinen Heilquellen und Bädern in mehreren Beziehungen" aus dem Jahr 1839 erwähnt Dr. Heinrich Carl Welsch ein
an der Straße nach Bad Bocklet von Koppel Schwed errichtetes besonderes Speisehaus für israelitische Gäste.
Text der Rückseite der obigen Karte: "Meine Lieben. Der Auftrag ist
für den hies. Platz ein schwieriger und kann vielleicht morgen wenn Markt
ist, Eurem Besuch entsprochen werden.
Hoffentlich seid Ihr beim besten Wohle, was auch hier bei uns G.s.D. (Gott sei Dank) der Fall ist.
Auch werdet ihr hoffentlich hinlänglich beschäftigt sein und eure Rechnung finden.
Unser Gruß an Alle, auch von meiner lieben Frau bin ich Euer ........
Laßmann. Bamberg, 5.7.81." |
| |
|
|
Postkarte
aus Haßfurt an
David Schwed in Kissingen (1882) |
 |
 |
|
Die Postkarte an Herrn David Schwed, Hotel Schwed,
wurde versandt von Haßfurt am 11. Mai 1882 nach Bad Kissingen
Text der Rückseite: "Haßfurt den 11. Mai 1882. Geehrter Herr
Schwed. Die Karte habe ich erhalten und daraus ersehen daß Sie mit dem Bau des Hauses noch nicht fertig
sind setze Sie daher in Kenntnis daß ich am ersten Juni eintreten werde. Es grüßt Sie nebst Ihrer werthen Familie
Ihre ergebenst Elise Kehl." |
| |
|
|
Besuchsankündigungskarte
von Bernhard Rosenau (1886) |
 |
 |
|
Es handelt sich dabei um eine
Besuchsankündigung eines Vertreters von Bernhard Rosenau aus Bad Kissingen.
Die Karte wurde am 19. Oktober 1886 von Bad Kissingen nach Aalen geschickt.
Bernhard Rosenau, von Beruf Gerber, stammt aus einer alteingesessenen
jüdischen Familie in Bad Kissingen, deren Wurzeln sich bis ins 18.
Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Er wurde am 9. Mai 1837 in Bad Kissingen
geboren. Seine Eltern waren Samuel Rosenau (geb. 28. April 1810 in Bad
Kissingen) und Esther geb. Rau (geb. 25. Februar 1809 in
Baiersdorf). Bernhard Rosenau war in
erster Ehe verheiratet mit Julie Glaser (geb. 22. Juni 1838 in
Thüngen. Aus dieser Ehe gingen zwei
Kinder hervor: - Emma B. verh. Jakobson (geb. 12. März 1865 in Bad
Kissingen) und Nathan (geb. 25. September 1863 in Bad Kissingen). Julie
Rosenau starb bereits im Alter von nur 27 Jahren am 26. September 1865.
Bernhard Rosenaus zweite Ehefrau war Ottilie geb. May (geb. 1846 in
Wallstadt. Aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor: Felix (geb. 19. Mai
1868), Hedwig verh. Löbenthal (geb. 21.Nov.1869 - ermordet in Auschwitz im
Mai 1944), Ida (geb. 8. August 1871, gest. 20. Mai 1872), Max (geb.
15. Januar 1873), Siegfried (geb. 13. Juni 1874), Selma verh. Hessenberger (geb.
11. November 1875), Hugo (geb. 2. März 1877) und Salomon (geb. 2. Februar
1885). Bernard Rosenau starb am 15. Mai 1913. Ottilie Rosenau folgte ihm am
5. März 1921. Das Paar fand seine letzte Ruhestätte auf dem
jüdischen Friedhof in Bad Kissingen.
Quellen:
https://www.geni.com/people/Bernhard-Rosenau/6000000040365222459
Biografisches Gedenkbuch der Bad Kissinger Juden während der NS-Zeit -
Kurzbiografien
Friedhof Bad Kissingen: Reihe 5/4:
Grabstein für Bernhard Rosenau und Ottilie Rosenau |
| |
|
|
Postkarte
von Johanna Federlein
nach Augsburg (1888) |
 |
 |
| Es
handelt sich um eine Postkarte, verschickt am 19. April 1888 von Frau Johanna Federlein aus Bad Kissingen nach Augsburg
an die Herrn Leiter & Neuburger, Modes (vermutlich Inhaber eines
Modengeschäftes). Die Geschwister Federlein waren die Besitzer der "Villa Gleißner"
(vgl. unten Dokument von 1934). Rückseitiger Text der Karte: "Ersuche Sie dringend mir umgehend das Hütchen zu schicken, indem ich
nicht mehr länger warten kann, andernfalls mir umgehend Nachricht zu geben.
Auch wollen Sie mir etwas zur Auswahl in schottischem Stoff, Band oder in ......
senden, was Sie am hübschesten auf Lager haben. Achtungsvoll. Johanna Federlein.
Bad Kissingen, den 18. April. 88.". |
| |
|
|
Karte
des Kaufmanns Heß Eisenburg
(Bad Kissingen) an die Fa. Schloß & Kohn
in Halle (1890) |
 |
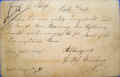 |
|
Die von
Kaufmann Heß Eisenburg verfasste ist datiert auf den 23. März 1890 und wurde verschickt
an die Fa. Schloß & Kohn in Halle an der Saale. Ein Kaufmann
Eisenburg findet sich bereits unter den für Kissingen im Jahr 1817 45 festgesetzten Judenmatrikeln;
er war damals Inhaber eines Wollen - und Viehhandels. Der Kartenempfänger
Moritz Schloss war ein bedeutender Viehhändler in Halle. Er hatte zusammen
mit seiner Frau Ellen Elise acht Kinder, darunter auch den Kinderarzt Dr. Josef
Schloss.
Links: Seite
im Gedenkbuch der Stadt Halle an der Saale für den Kinderarzt Dr. Josef
Schloss.
Seite
mit weiteren Informationen zur Familie von Dr. Josef Schloss anlässlich
der "Stolpersteine"-Verlegung in Halle 2010 (pdf-Datei)
|
| |
|
|
Bestellung
des Kaufmanns Hermann
Holländer (1893)
(Geschäft am Marktplatz
Holländer-Stern, Kurzwaren usw.) an die
Eisenhandlung J. Eisenheimer in Schweinfurt |
 |
 |
|
Die Bestellung
Hermann Holländers wurde am 18. Oktober 1893 nach Schweinfurt geschickt.
Anmerkung: Hermann Holländer wurde ungeachtet seines schlechten
Gesundheitszustandes in der Pogromnacht November 1938 verhaftet.
Holländer hatte beim Versuch, seine brennende Garage zu löschen, einen
schweren Zusammenbruch erlitten. Trotz einer umgehenden Operation verstarb
er zwei Tage nach der Operation. Er wurde, da alle Männer verhaftet
waren, von Frauen der Gemeinde beigesetzt (Beck/Walter: Jüd. Leben S.
127-129; Binder/Mence: Nachbarn der Vergangenheit S. 138).
|
| |
|
|
Bestellung
des Bäckers Hermann Baumblatt
(1897) (Badgasse in Bad Kissingen) an
die
Eisenhandlung J. Eisenheimer in
Schweinfurt |
 |
 |
|
Die Bestellung
Hermann Baumblatts wurde am 7. Januar 1897 nach Schweinfurt geschickt;
Anmerkung: Hermann Baumblatt und seine Frau Sara geb. Neuburger wurden im
Mai 1942 in das Jüdische Unterkunftshaus nach Würzburg gebracht, von
hier im September 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie umgekommen
sind. Der Töchter Martha gelang Anfang Januar 1937 die Auswanderung nach
Tel Aviv (Beck/Walter Jüd. Leben S. 143).
|
| |
|
|
Ansichtskarte
aus Bad Kissingen, geschrieben von
Josa Ezechel im Hotel Ehrenreich
an Frl. Hertha Levy in Hamburg (1899) |

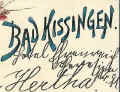 |
 |
|
Die Ansichtskarte (Lithografie) von Bad
Kissingen wurde geschrieben am 27. Juli 1899 von Josa Ezechel im Hotel
Ehrenreich, Theresienstraße 11 an Frl. Hertha Levy aus Hamburg.
Ausgangsadresse der Karte war das Hotel Ehrenreich in der Theresienstraße 11 in Bad
Kissingen. Die Anfänge des Hotels gehen zurück bis ins Jahr 1876, als der von
Autenhausen nach Bad Kissingen gekommene Lehrer und Vorbeter
Eliezer Lazarus Ehrenreich in einer Anzeige für seinen "kurgemäßen und streng
religiösen Privatkosttisch während der Kursaison" warb. Später wurde daraus das vom Ehepaar Ehrenreich streng koscher geführte "Hotel Ehrenreich".
Die Absenderin der Karte war die Tochter von Moritz Moshe Ezechel und Henriette Riekchen
geb. Jacobsen, Josabeth (Josabath) Ezechel aus Hamburg (geb. 28. Juni 1887 in Hamburg,
verh. mit dem Textilkaufmann Hermann Heckscher). Hermann Heckscher starb 1938.
1939 Heirat von Josaphat geb. Ezechel mit Felix Halberstadt. Felix Halberstadt hatte eine
Schwester: Fanny Halberstadt, verheiratet mit Leopold Levy.
Da über die Kartenempfängerin Hertha Levy keine weiteren Informationen bekannt sind, außer dass
sie keiner Oldesloer Familie entstammt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Briefkontakt zwischen Josabeth Ezechel und Hertha Levy familiärer Art war.
Da es sich bei Oldesloe ebenso wie Bad Kissingen um eine Kurstadt (Kurbad) handelt und die Anschrift "Altes Logirhaus"
eine bekannte Logier-Adresse für Bade-Gäste war, ist es gut möglich, dass Hertha Levy nur als Bade-Gast in Oldesloe weilte.
Der Deportationstermin für Felix und Josabeth Halberstadt war angesetzt auf den 4. Dezember 1941 nach Riga-Jungfernstadt - Außenlager Ghetto Riga.
Als Zeitpunkt ihres Todes (ihrer Ermordung) ist angegeben: nach Dezember 1941.
An das Schicksal des Ehepaaes Halberstadt erinnern Stolpersteine in der Hallerstraße 76 in Hamburg.
Quellen: https://www.geni.com/people/Josabeth-Halberstadt/6000000051472876158
https://www.geni.com/people/Fanny-Levy/6000000002743012055
http://www.stolpersteine-hamburg.de/?&MAIN_ID=7&r_name=halberstadt&r_strasse=&r_bezirk=&r_stteil=&r_sort=Nachname_AUF&recherche=recherche&submitter=suchen&BIO_ID=772
Auskunft von Frau Dr. Sylvana Zander, Archiv der Stadt Bad Oldesloe. |
| |
|
|
Fotokarte
von Kurgästen, verschickt aus Bad Kissingen
an Monsieur Rotschild in Paris (1899) |
 |
 |
| Die
Fotokarte mit Kurgästen wurde aus Bad Kissingen im August 1899 verschickt
an Monsieur Rotschild, Avenue de l'Opera 12 in Paris. |
| |
|
|
Postkarte
von H.F. Kugelmann in Bad Kissingen
an Nathan Laubner in Schonungen (1899) |

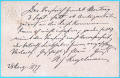 |
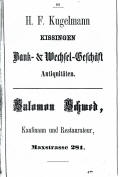 |
|
Die Postkarte an Herrn Nathan Laubner in
Schonungen wurde versandt von H.F.
Kugelmann in Bad Kissingen am 28. August 1899. Zum Text der Karte: "Der
Verkauf findet Montag 3. Sept. statt. Ob Antiquitäten zuerst an die Reihe
kommen kann ich nicht erfahren; jedenfalls nimmt der Verkauf nach
Anwesenheit der betreff. Liebhaber seinen vorgesehenen Verlauf. Geschäft ist
flau. – Gruß – H.F. Kugelmann. 28 Aug. 1899". Im Adressbuch von
Kissingen aus dem Jahr 1865 findet sich im Annoncenteil eine Werbeanzeige
vom "Bank- und Wechselgeschäft - Antiquitäten - H.F. Kugelmann" (siehe
oben).
Im Verzeichnis I – Geschäfts-, Handel- und Gewerbsstand findet sich unter
"Antiquitätenhändler" – Hr. Kugelmann, H.F. – ebenso unter "Banquier".
Die Familie Kugelmann war eine alt eingesessene jüdische Familie in Bad
Kissingen. Schon im Kissinger Adressbuch 1838 findet sich in der Rubrik
"Israelitische Handlungen" der Name von Feibel Kugelmann. Der
Postkartenempfänger Nathan Laubner in Schonungen war von Beruf Antiquar. Er
war verheiratet mit Fanny geb. Blümlein. Das Ehepaar hatte einen Sohn –
Jakob Laubner, der am 15.07.1942 aus München nach Theresienstadt deportiert
wurde und am 08.09.1942 in Theresienstadt umgekommen ist.
Quelle:
https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=personenliste&tx_mucstadtarchiv_stadtarchivkey%5Bopferid%5D=7166&tx_mucstadtarchiv_stadtarchivkey%5Baction%5D=showopfer&tx_mucstadtarchiv_stadtarchivkey%5Bcontroller%5D=Archiv&cHash=8370e1b7e9d6205a2abc0d070331ee81
|
| |
|
|
Ansichtskarte
vom Schützenhaus - Familienpensionat
Solms Heymann in Bad Kissingen (1900) |
 |
|
|
Vgl. dazu auch die Postkarte
unten mit der Abbildung des Marktplatzes mit dem Konfektionsgeschäft von
Solms Heymann. Die obige Ansichtskarte zeigt das Schützenhaus,
Familienpensionat - Sommer und Winter geöffnet - von Solms Heymann. Sie
ist handschriftlich datiert vom 3. August 1900. Zumindest für eine
begrenzte Zeit führte Solms Heymann neben seinem Konfektionsgeschäft am
Marktplatz (siehe unten) auch eine Familienpension mit Restaurant und
Kaffee mit Bier- und Weinausschank.
Quellen: https://www.badkissingen.de/de/stadt/geschichtliches/bad-kissinger-stolpersteine/37094.SOLMS-HEYMANN-1858-1944-Textilkaufmann-und-ADELE-HEYMANN-1866-1943-geb.-Baum-Marktplatz-2.html
https://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Solms-und-Adele-Heymann;art766,5320112
.
|
| |
|
|
Ansichtskarte
von Bad Kissingen -
geschrieben von Otto Goldstein (1901) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte von Bad Kissingen wurde von
Otto Goldstein (1889-1933) am 18. Juli 1901 und damit am Tag vor
seinem 12. Geburtstag geschrieben.
Weitere Informationen zu seiner Person:
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Goldstein und
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/kurzbiographien/datenbank/38566.Kurzbiografien.html?detID=172
siehe auch unten -
Dokument mit Ansicht des Modewarengeschäftes von Otto Goldstein.
|
| |
|
|
Ansichtskarte
von Bad Kissingen an
Gitta Nordschild in Niederwerrn (1902) |
 |
 |
|
Die
Karte an Gitta Nordschild in Niederwerrn
wurde am 9. Juli 1902 von einem Herrn Arthur Appel verschickt. Weitere Informationen zu diesen
Personen wurden nicht gefunden.
|
| |
|
|
Ansichtskarte
Bad Kissingen vom Staffelberg,
versandt von Ida Landsberger (1905) |
 |
|
|
Die Ansichtskarte - Bad Kissingen vom
Staffelberg wurde versandt von Ida Landsberger am 3. August 1905 an Frl. Meivers aus Berlin nach Zingst an der Ostsee bei Frau Kalwer
Ida Landsberger geb. Grosser ist am 1. Oktober 1881 als Tochter des aus Oberschlesien stammenden
Vertragsbuchhändlers Eugen Grosser und seiner aus Strassburg stammenden Frau
Cecile geb. Blum in Berlin geboren. Sie war verheiratet mit dem Arzt
Kurt Landsberger aus Liegnitz. Das Ehepaar hatte eine Tochte: Kaete
(geb. 17. Januar 1911 in Berlin).
Ida Landsberger und Kurt Landsberger wurden am 21. September 1942 von Berlin nach Theresienstadt
deportiert, am 28. Oktober 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz und dort ermordet.
Ida Landsbergers Bruder war der Kinderarzt und Wissenschaftler Paul
Grosser.
Quellen: https://www.geni.com/people/Ida-Landsberger/6000000032721606024
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Grosser
http://www.juedische-pflegegeschichte.de/index.php?limiter=network&cmd=limitPerson&dataId=58883228449164&id=131724555879435
http://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/20220-ida-landsberger/ |
| |
|
|
Ansichtskarte
mit der Oberen Marktstraße
- Bezirksamt und Wohnhaus / Metzgerei von
Wolf Hamburger (um 1905) |
 |

|
|
Auf der Ansichtskarte Bad Kissingen – Obere
Marktstrasse mit Bezirksamt aus der Zeit um 1905 ist im Hintergrund das
Wohnhaus/Metzgerei mit der Aufschrift "Wolf Hamburger" zu sehen. Die
Familie Hamburger gehörte zu den alteingesessenen jüdischen Familien Bad
Kissingens. Bereits im Kissinger Adressbuch von 1838 wird der Metzgermeister
Salomon Hamburger in der Spitalgasse erwähnt. Im Kissinger Adressbuch von
1865 finden sich dann drei jüdische Metzgermeister: Löb Hamburger,
Weingasse 148, Simon Hamburger, Untere Marktstrasse 138 und Wolf
Hamburger, Bachgasse
149.
Wolf Hamburger war verheiratet mit Luisa geb. Kraus. In seine
Nachfolge als Metzgermeister trat dann sein ältester Sohn Isaak Hamburger,
der die Metzgerei vom Vater übernahm. In den 1920er Jahren führte Isaak
Hamburgers jüngster Sohn Heinrich Hamburger die Familientradition
fort und führte die Metzgerei bis er schließlich 1937 mit seiner Familie in
die USA flüchtete.
Wolf Hamburger liegt begraben auf dem
jüdischen Friedhof in Bad Kissingen. Auch Isaak und Regina Hamburger
fanden auf dem jüdischen Friedhof Bad Kissingen ihre letzte Ruhe.
Quellen: Adressbücher Bad Kissingen 1838 und 1865; Biografisches Gedenkbuch
Bad Kissingen:
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/datenbank/38559.Datenbank.html?detID=211&text=&biografischeshandbuch%5Bmaedchenname%5D=&biografischeshandbuch%5Bgeburtsort%5D=&biografischeshandbuch%5Bdeportationsziel%5D=&kt%5Bsb%5D=&kt%5Bsd%5D=&kt%5Blt%5D=H&page_biografischeshandbuch=0;
Zu den Grabsteinen der Familie Hamburger siehe Fotos auf der
Seite zum jüdischen Friedhof Bad
Kissingen. |
| |
|
|
Postkarte
an Felix Gutmann in
Bad Kissingen aus Dänemark (1908) |
 |
 |
 |
|
Die Postkarte aus Kopenhagen in Dänemark
wurde an Felix Gutmann in Bad Kissingen am 17. Juni 1908 verschickt. Der Text der Karte
lautet:
"Kopenhagen 17. Juni 1908 - Herrn Felix Gutmann Bad Kissingen
Ihren geehrten Brief habe ich soeben erhalten und kann ich es mir einrichten via Berlin über Kissingen zu fahren.
Voraussichtlich käme ich um ca. 4 oder ca. 8 Uhr Abends dorten an; ich kann es hier im Fahrplan nicht recht
ersehen. Ich telegraphier Ihnen meine Ankunft. Inzwischen grüße ich Hochachtend
- Freitag - Felix Tamberger (vielleicht auch Lamberger)."
Zu Felix Gutmann liegen aus dem Buch "Jüdisches Leben in Bad Kissingen" folgende
Informationen vor: Am 31. August 1935 findet eine Durchsuchung der Büroräume des Kaufmanns Felix Gutmann durch die Kissinger
Polizei auf Grund einer Anordnung der Bayerischen Politischen Polizei von München statt, alle jüdischen Auskunfteien
zu überprüfen bezüglich ihrer Einstufung die Kreditwürdigkeit parteiamtlich tätiger Geschäftsleute betreffend.
Die Überprüfung sämtlicher Unterlagen brachte ein völlig korrektes und nicht zu beanstandendes Handeln von Felix Gutmann
als Ergebnis. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in der Zeit von 3 bis 5 Uhr morgens zur Festnahme
von 28 Kissinger Juden, unter anderem auch Felix Gutmann. Am 24. April 1942 bei der Deportation jüdischer Männer und Frauen
aus dem Landkreis Bad Kissingen nach Würzburg waren neben 21 anderen aus dem Landkreis auch 23 Kissinger Juden dabei,
darunter Felix Gutmann und seine Frau Erna. Am 28. April wurden Sie eingesperrt in einen Transportzug zusammen mit
800 Juden aus Mainfranken nach Izbica deportiert.
Im Mai 2013 werden bei der 6. Stolpersteinverlegung in Bad Kissingen auch
zwei Stolpersteine für Felix Gutmann und seine Frau Erna Luzie verlegt, die
drei Jahrzehnte in der Kurhausstraße 37 in Bad Kissingen wohnten. |
| |
|
|
Postkarte
der "Vieh-Export -
Milchkuranstalt Oskar Eisenburg" (1908) |
 |
|
|
Die Ansichtskarte des Gebäudes "Vieh-Export - Milchkuranstalt Oskar Eisenburg"
in Bad Kissingen wurde versandt nach Leer in Ostfriesland am 18. Oktober 1908.
Oskar Eisenburg (geb. 12. April 1874 in Bad Kissingen als Sohn von Hess Eisenburg und Betty
geb. Rödelheimer) war verheiratet mit Rosa Eisenburg geb. Kissinger
(geb. 1875 als Tochter von Max Kissinger und Ernestine geb. Frank; Vorname
wird unterschiedlich angegeben: Rosa [Geni s.u.], Selina [Steve Morse,
s.u.] oder Selma [Buch
"Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger..."]). Das Ehepaar hatte
vier Kinder: Erna verheiratete Marx (geb. 29. April 1900, gest. 26. April 1968 in Sydney,
Australien), Carl Eisenburg, Betty Eisenburg und Max Eisenburg.
Oskar Eisenburg starb 1940 im Alter von 66 Jahren in Buenos Aires, Argentinien.
Seine Frau Rosa starb 1948 im Alter von 73 Jahren in Montevideo, Uruguay.
Oskar Eisenburg betrieb in Bad Kissingen einen Vieh-Export-Handel und eine Milchkuranstalt in der Promenadenstraße 5.
Er und seine Frau zogen 1939 nach Köln und schafften noch die Emigration in die USA.
Quellen: https://www.geni.com/people/Oskar-Eisenburg/6000000009752710938
https://stevemorse.org/germanjews/germanjews.php?=&offset=28001 |
| |
|
|
Besuchs-Anzeige-Karte
der Firma Zentner & Kissinger,
versandt von Nürnberg nach Zürich (1908) |
 |
 |
|
Die Besuchs-Anzeige-Karte der Fa. Zentner &
Kissinger wurde versandt von Nürnberg nach Zürich am 29. Juni 1908.
Isidor Kissinger war Teilhaber der Fa. Zentner & Kissinger, einer Specialfabrik von Taschenspiegeln, Taschen-Necessaires und Taschenbürsten.
Er ist am 18. Mai 1870 in Bad Kissingen geboren als Sohn von Meier Kissinger und seiner Frau
Jeanette geb. Uhlfelder (Gräber im jüdischen
Friedhof Bad Kissingen). Er war verheiratet in erster Ehe mit Sophie
geb. Schaller, geboren am 12. Dezember 1874. Das Ehepaar hatte acht
Kinder: Kurt, Martha, Rudolf, Albert, Wilhelm, Thekla, Ernst und
Max. Sophie Kissinger starb am 2. Januar 1914 im Alter von 39 Jahren. Im März 1918 heiratete Isidor Kissinger seine zweite Frau
Else geb. Kissinger, geboren in Bad Kissingen am 17. Juni 1879 als Tochter von
Carl Koppel Kissinger und seiner Frau Jeanette geb. May (Gräber
im jüdischen Friedhof Bad Kissingen).
Isidor Kissinger starb am 2. September 1935. Else Kissinger musste in den Jahren ab 1935 mehrmals umziehen, zuletzt in die
Blumenstrasse 11 in Nürnberg, wo Sie zusammen mit ihren alleinstehenden Geschwistern Sigfried Kissinger und Emma Kissinger wohnte. Am 24. März wurde Else Kissinger von Nürnberg ins Ghetto – Durchgangslager Izbica deportiert. Dort verlieren sich ihre Spuren.
Sie gilt seitdem als verschollen. An ihr Schicksal wurde erinnert mit einem Stolperstein in der Hemmerichstrasse 8 in Bad Kissingen.
Quellen: https://www.badkissingen.de/de/stadt/geschichtliches/bad-kissinger-stolpersteine/37048.ELSE-KISSINGER-1879---1942-geb.-Kissinger-Hausfrau-Hemmerichstrasse-8.html
https://www.geni.com/people/Isidor-Kissinger/6000000037792766895
https://www.geni.com/people/Sophie-Kissinger/6000000037792729056. |
| |
|
|
Postkarte,
versandt von Lina Offenbacher nach Schopfloch (1911):
Saalepartie mit der Lindesmühlpromenade |

 |
|
|
Die Karte aus Bad Kissingen mit einer
Ansicht "Saalepartie mit der Lindesmühlpromenade" wurde versandt von
Lina Offenbacher nach Schopfloch bei Dinkelsbühl am 8. Juni 1911.
Lina Offenbacher wurde am 4. Februar 1888 in Fürth geboren als Tochter von
Julius Juda Offenbacher und seiner Frau Adelheid geb. Schopflocher.
Lina Offenbacher war seit 1919 (in Schopfloch)
verheiratet mit Ludwig Julius Kohn (geb. 27. August 1883 in Baiersdorf
als Sohn von Benjamin (Benny) Kohn und seiner Frau Karoline Lina
geb. Strauss). Ludwig Kohns Vater Benjamin war Stadtrat, Feuerwehrkommandant und prominentes Rot-Kreuz-Mitglied.
Auch Ludwig Kohn war Mitglied der Feuerwehr und letzter Sprecher der jüdischen Gemeinde bis
1932/33. Mit der Plünderung und Demolierung ihres Wohnhauses und Warenlagers am
9. November 1938 begann der Leidensweg von Ludwig und Lina Kohn, der letztendlich über Fürth mit dem Abtransport am
25. März 1942 nach Izbica, einem Außenlager des Vernichtungslagers Belzec führt. Dort verliert sich die Spur des Ehepaars.
In der Lindesmühlpromenade befand sich auch der Eingang zum Laden des Hofjuweliers Simon Hermann Rosenau und seiner Söhne von der Kurhausstraße 10.
Quellen: https://www.geni.com/people/Lina-Kohn/6000000010150590369
http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20349/Baiersdorf%20Gemeinhardt%20Rede%20Kohn.pdf |
| |
|
|
|
Postkarte
an Dr. Münz in Bad Kissingen (1911) |
 |
 |
| Die
Postkarte geschäftlicher Art wurde am 18. Mai 1911 vom Kolonial-Waren - Delikatessen-Geschäft
S. Hahn an Dr. Münz innerorts in Bad Kissingen verschickt. |
| |
|
|
Firmenkarte
der Firma
"Leimindustrie Felix Gutmann" (um 1922/23) |
 |
 |
|
Ergänzend zur obigen Karte aus Dänemark
an Felix Gutmann: Firmenkarte der Firma " Leimindustrie Felix Gutmann Bad Kissingen",
die zwischen Mai 1922 und September 1923 versandt wurde (nur in diesem begrenzten Zeitraum war die Briefmarke gültig).
Die Karte wurde an die "Pinselfabrik Hermann Ichenhäuser " in Nürnberg
versandt. Diese Pinselfabrik Hermann Ichenhäuser wurde bereits 1891 gegründet und war eine der zahlreichen in Nürnberg ansässigen jüdischen Firmen.
Quellen: http://www.nuernberginfos.de/industrialisierung-in-nuernberg/pinselindustrie-nuernberg.html |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte (1902)
Marktplatz Bad Kissingen
mit dem
Kurzwarengeschäft Wittekind
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries) |
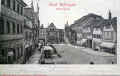 |
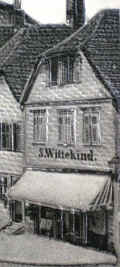 |
|
Abgebildet ist
eine sogenannte Präge- oder Relief-Karte, die am 24. Juli 1902 von Bad
Kissingen
nach Frankfurt am Main verschickt wurde.
Familie Wittekind war mindestens seit Anfang des 18. Jahrhunderts in Bad Kissingen
ansässig.
|
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte vom Markt
in Bad Kissingen mit Geschäften von
Max Kissinger und Moses Hofmann |
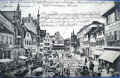 |
 |
 |
|
Die Karte zeigt die Marktszenerie in
Bad Kissingen mit dem Geschäft von Max Kissinger (vgl. eine
weitere Karte unten) und dem Textilwarengeschäft von Moses Hofmann handelt
(in der damaligen Unteren Marktstraße 2). Zu Familie Hofmann gibt es in
Bad Kissingen inzwischen zwei "Stolpersteine", die für seinen Sohn
Louis Hofmann und dessen Frau verlegt wurden. Louis Hofmann führte ein Bankhaus im
Familienanwesen und war aktiv in der jüdischen Gemeinde tätig. Im Prospekt der
fünften Stolpersteinverlegung wird seine Aktivität des Geldsammelns für einen neuen Leichenwagen für die Chewra
Kadischa beschrieben. Sein Schicksal war tragisch, vgl. weitere
Informationen über Louis Hofmann und seine Familie.
|
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte
Marktplatz
in Bad Kissingen mit Geschäften
von S. Leubold und S. Wittekind |
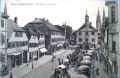 |
 |
 |
|
Die Karte zeigt (wie oben) einerseits das
Kurzwarengeschäft der Familie Wittekind, andererseits das Textilgeschäft von Salomon Leuthold.
Zur Biografie von Salomon Leuthold siehe Informationen
der "Stolpersteine"-Initiative in Bad Kissingen. Salomon
Leuthold wurde am 25. Mai 1862 in Bad Kissingen geboren und war mit Rosa Bergmann von
Völkersleier verheiratet. Sie hatten
drei Kinder: Leo, Martha und Gertrud.
Um 1926 verkaufte Salomon Leuthold sein Haus an Solms Heymann, behielt sich jedoch das Wohnrecht im Gebäude, in dem er bis zu seiner
Deportation verblieb. In der Pogromnacht im November 1938 wurde Salomon Leuthold zusammen mit weiteren 27 jüdischen
Einwohnern Bad Kissingens verhaftet. Dem Zwangsumzug am 1. Mai 1942 nach Würzburg in
das dortige "jüdische Altersheim" folgte am 24. September 1942 der Transport
in das Ghetto Theresienstadt. Hier ist er am 9. April 1943
umgekommen.
|
| |
Historische
Ansichtskarte der Kurhausstraße in Bad Kissingen
mit dem Haus Rosenau (1908) |
|
|
 |

 |

 |
|
Auf der Ansichtskarten oben (Karte von 1908)
ist die Kurhausstrasse in Bad Kissingen zu sehen, links (Kurhausstraße
10) das Haus Simon Rosenau. Deutlich erkennbar sind die Schriftlettern
"Passage-Rosenau", angebracht auf dem schmiedeeisernen Gitter im oberen Bereich des Torbodens.
Simon Rosenau wurde am 1. Mai 1839 als Sohn von Samuel und Esther Rosenau in Bad Kissingen geboren.
Er war verheiratet mit Henriette Rosenau geb. Rosenberg. Das Paar hatte
neun Kinder: Nathan Rosenau (geb. 9. Januar 1864), Louis Rosenau (geb. 18.
August 1866), Philipp Rosenau (geb. 27. März 1868), Hugo Rosenau (geb.
1872), Selmar Rosenau (geb. 19. Februar 1875), Thekla Rosenau (geb. 12.
Februar 1877), Irma Rosenau (geb. 21. Mai 1884), Paula Rosenau
(geb. 19. September 1885) und Erna Rosenau.
Simon Rosenau war Hofantiquar und ein bekannter Gold- und Silberschmied, der für seine Arbeiten internationale Preise erhielt.
Er fertigte 1907/1908 die Kette für den Bad Kissinger Oberbürgermeister.
Simon Rosenau starb am 25. November 1920 und wurde im jüdischen Friedhof in Bad
Kissingen beigesetzt (Foto des Grabsteines rechts oben). Sein Sohn Philipp Rosenau
erhielt am 25. August 1917 den Titel eines Königlich Bayerischer
Hoflieferanten. Er starb am 29. November 1927.
Simon Hermann Rosenau, ein Cousin Simon Rosenau's übernahm das Juweliergeschäft und Wohnhaus mit Kurbetrieb in der Kurhausstrasse 10.
Auch in München besaß Simon Hermann Rosenau ein Juweliergeschäft und Wohnhaus, wo er sich während der Herbst - und Wintermonate aufhielt.
Simon Hermann Rosenau war zweimal verheiratet. In erster Ehe mit Luise
geb. Feuchtwanger. Das Paar hatte drei Kinder: Ida Rosenau,
(geb. 4. Dezember 1893 in München), Hermann Sigmund Rosenau (geb.
3. November 1894 in München) und Felicie Rosenau (geb. 5.
September 1896 in München).
Luise Rosenau starb am 6. August 1898 in München.
In zweiter Ehe heiratete Simon Hermann Rosenau Paula geb. Feuchtwanger.
Aus dieser Ehe stammte der Sohn Arthur Oscher Rosenau (geb. 3.
Januar 1901 in München).
Bereits Ende März 1933 floh Simon Hermann Rosenau mit seiner Familie nach Paris. Nach der Besetzung Frankreichs ging ihre Flucht weiter nach
Nizza, jedoch ohne Erfolg. Am 23. Oktober 1943 wurden Simon Hermann
Rosenau und seine Frau Paula im französischen Lager Drancy interniert.
Bereits fünf Tage später wurden die Beiden mit dem 61. Konvoi nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sohn Hermann Sigmund Rosenau kam bereits
mit dem 60. Konvoi von Drancy nach Auschwitz deportiert und dort 1944 ermordet.
Heute erinnern 3 Stolpersteine in der Kurhaustrasse 10 an das Schicksal von Simon Hermann Rosenau, Paula Rosenau und Hermann Sigmund Rosenau.
Quellen: https://www.badkissingen.de/de/tourismus-kurort-bayern/kultur/veranstaltungen/bad-kissinger-stolpersteine/liste/biographien/20269.SIMON-HERMANN-ROSENAU-1861-1943-Juwelier-Kurhausstrasse-10.html
https://www.geni.com/people/Simon-Rosenau/6000000040365742858
https://www.badkissingen.de/de/stadt/rathaus/rathaus--politik/amtskette-wappen/4916.Amtskette-des-Oberbuergermeisters-der-Stadt-Bad-Kissingen.html
http://franken-wiki.de/index.php/Hoflieferanten_in_Franken
https://www.geni.com/people/Hermann-Simon-Rosenau/6000000027911742962
https://www.badkissingen.de/de/tourismus-kurort-bayern/kultur/veranstaltungen/bad-kissinger-stolpersteine/liste/biographien/20271.HERMANN-SIGMUND-ROSENAU-1894-1944-Juwelier-Kurhausstrasse-10.html
http://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Auf-der-Suche-nach-den-letzten-Spuren;art766,4006991
. |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte (1908)
der unteren Marktstraße
mit dem Textilgeschäft von Samuel
Hofmann |
 |
 |
|
Auf der Karte ist die "Untere Marktstrasse"
in Bad Kissingen zu sehen. Der Name "S. Hofmann" ist über den mit geschlossenen
Rollladen verdeckten Schaufenstern mit einiger Mühe zu erkennen
(Ausschnitt rechts). Vor dem Gebäude liegen heute die
"Stolpersteine" für Irene Müller geb. Hofmann und ihren Mann
Leopold Müller.
Informationen zu Samuel Hofmann, sein Geschäft und seine Familie siehe Quellen:
Biographie
zu Irene Müller geb. Hofmann, Textilkauffrau
http://wm.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Irene-und-Leopold-Mueller;art766,5449952 |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarten (vor 1910)
Ludwigstraße mit dem Modehaus Felix Ehrlich |

 |
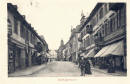

|
|
Die Karten zeigen die Ludwigstraße mit dem
Modewaren - Ausstattungsgeschäft Felix Ehrlich aus den Jahren vor 1910.
Ein Foto des Grabes von Felix Ehrlich findet sich in der Seite
zum jüdischen Friedhof Bad Kissingen.
Weitere Informationen siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Joske_Ereli
und
http://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Biografien-Buecher-Das-dritte-Reich-Flucht-und-Vertreibung-Freunde-Juden-Nationalsozialisten;art766,8460857
1841 hatte Samuel Ehrlich durch Erlass des Bayerischen Königs die
Genehmigung für einen Stoffhandel in Bad Kissingen erhalten. Er
eröffnete ein "Textilwaaren- und Damenconfectionsgeschäft" in
der Oberen Marktstraße. 1882 übergab Samuel Ehrlich das Geschäft seinem
Sohn Felix, der später sogar zum Königlich-Bayerischen Hoflieferanten
aufstieg. 1887 kaufte Felix Ehrlich ein zweistöckiges Gebäude an der
Ecke Kurhaus-/Ludwigstraße und eröffnete dort das "Handelshaus
Felix Ehrlich". 1918 starb Felix Ehrlich; daraufhin übernahmen
Ludwig Ehrlich und sein Bruder Franz das Unternehmen. 1938 musste die
Familie Ehrlich das Geschäft zu einem Schleuderpreis an einem
nichtjüdischen Geschäftsmann abgeben. |
| |
|
|
|
Foto
von 1938 vor dem Modehaus Felix Ehrlich |
 |
 |
| |
Das
Original-Foto vom 27. Juni 1938 zeigt einen gestellten Unfall anlässlich
einer Vorführung zum "Tag des Fahrrads" vor dem Modehaus Felix
Ehrlich. |
| |
|
|
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte - Partie bei der Post - mit der
Feinen Herrenschneiderei von Hermann Stern (1915) |
 |
 |
|
Die historische Ansichtskarte zeigt eine
"Partie bei der Post" (Gebäude rechts mit alten Postbussen, heute
Ludwigstraße 20
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigstraße_20_(Bad_Kissingen); im
Hintergrund das Gebäude Von-Hessing-Straße 2
https://de.wikipedia.org/wiki/Von-Hessing-Straße_2_(Bad_Kissingen)).
Am Gebäude rechts der Post ist das Geschäftsschild und die
Schaufensterauslage der 'Feinen Herrenschneiderei Hermann Stern' zu sehen (Gebäude
heute Ludwigstraße 18 mit einem Eiscafé in den Räumen). Die Karte wurde
am 13. August 1915 von Bad Kissingen nach Apolda versandt. Hermann Stern war
Kaufmann und führte zumindest eine gewisse Zeit (1915) auch eine
Herrenschneiderei. In einer Zeitschrift aus dem Jahr 1901 wirbt Hermann
Stern, "Specialhaus für Jagdbekleidung in Bad Kissingen" in einer Annonce
"An alle deutschen Jäger" für die neue Sommerkollektion für Jäger. Hermann
Stern war verheiratet mit Karoline geb. Poppermann. Das Ehepaar hatte drei
Kinder: Heinrich Stern (geb. 5. November 1870), Nanette Stern (geb. 15.
Oktober 1873, später verheiratete Holländer) und Selma (geb. 9. Juli 1876,
später verheirate Hartmann). Sohn Heinrich Stern wurde Mitinhaber eines
Modewarengeschäfts in der Ludwigstraße.
Quellen:
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/kurzbiographien/datenbank/38566.Kurzbiografien.html?detID=701
– zu Heinrich Stern
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/kurzbiographien/datenbank/38566.Kurzbiografien.html?detID=288
- zu Nanette Stern verheiratete Holländer
https://www.badkissingen.de/stadt/geschichtliches/juedisches-leben/badkissinger-stolpersteine/37080.NANETTE-HOLLAeNDER-geb.-Stern-1873---1942-Maxstrasse-24.html
https://www.biografisches-gedenkbuch-bk.de/kurzbiographien/datenbank/38566.Kurzbiografien.html?detID=228
- zu Selma Stern verheiratete Hartmann
https://www.badkissingen.de/stadt/geschichtliches/juedisches-leben/badkissinger-stolpersteine/37089.SELMA-HARTMANN-geb.-Stern-1876---1942-Hausfrau-Maxstrasse-24.html.
|
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte mit dem
Modewarengeschäft von Michael Goldstein
(um 1915-1925) |
 |
 |
|
Die historische Ansichtskarte Bad Kissingen –
Partie am Kurgarten – zeigt das Modewarengeschäft von Michael Goldstein.
Die Karte stammt aus der Zeit um 1915 bis 1925 und wurde verlegt vom
Kunstverlag Bruno Hausmann in Kassel (Cassel). Michael Goldstein war
der Inhaber eines exklusiven Modekaufhauses und führte die Auszeichnung
eines "Königlich bayerischen Hoflieferanten". Später übernahm sein Sohn
Otto Goldstein das Geschäft. Dessen Engagement auf kommunaler Ebene –
Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins, Vorstandsmitglied im Kurverein und
Inhaber noch anderer Ehrenämter führten dazu, dass er 1924 in den Bad
Kissinger Stadtrat gewählt wurde. Denunziationen Ende 1930, der Verlust
seines Amtes als Stadtrat im April 1933 in Folge des Machtantritts der
Nationalsozialisten im Januar 1933 raubten Otto Goldstein den Glauben an die
Gerechtigkeit und Zukunft. Otto Goldstein sah nach all der ihm zugefügten
Schmach keinen weiteren Ausweg mehr als den Freitod. An sein Schicksal
erinnert ein Stolperstein in Bad Kissingen am Rathausplatz 1. Michael
Goldstein fand seine letzte Ruhestätte auf dem
jüdischen Friedhof in Bad Kissingen.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Goldstein
https://www.badkissingen.de/de/stadt/geschichtliches/bad-kissinger-stolpersteine/37082.OTTO-GOLDSTEIN-1889---1933-Stadtrat-und-Textilkaufmann-Rathausplatz-1.html
http://objekte.jmberlin.de/object/jmb-obj-551219;jsessionid=B8E0F9CFA5C192DF3E4CCFF834FC248D
http://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20411/Bad%20Kissingen%20Friedhof%20R%209-9.jpg
. |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte mit dem
Bank- und Wechselgeschäft A. Löwenthal jr. (1924)
|
 |
 |
|
Die Karte wurde am 8. April 1924 von Bad
Kissingen nach Bogen bei Straubing verschickt. Die Ansichtskarte zeigt die
Ludwigsstraße mit dem Bank- und Wechselgeschäft von A. Löwenthal jr.
Die Adresse hat sich geändert: damals Ludwigstraße 4, heute Ludwigsstraße
11. Das Bank- und Wechselgeschäft gehörte Abraham Simon Löwenthal,
Spross einer alten, angesehenen und bis in die Mitte des 18. Jahrhundert
zurückgehenden jüdischen Familie Bad Kissingens. Abraham Simon Löwenthal
starb am 16 Februar 1920 im Alter von 59 Jahren. Gitta Löwenthal geb.
Haas starb 1927 im Alter von 62 Jahren. Das Ehepaar fand seine letzte
Ruhestätte zusammen auf dem jüdischen
Friedhof in Bad Kissingen. Das Ehepaar hatte drei Töchtern, von denen
sich zwei verheirateten. Die dritte Tochter Selma war von Kind an
gehbehindert, blieb ledig und führte nach dem Tod ihres Vaters Selma das
Bankgeschäft des Vaters weiter. Wie lange ist unbekannt. Bekannt ist, dass
Selma Löwenthal im April 1938, damals schon bettlägerig in das
Israelitische Kranken- und Altenheim in der Konradstraße in Würzburg verlegt
wurde. Dort war ab März 1939 auch der Bad Kissinger Arzt Sally Mayer, der
das Haus leitete und Selma Löwenthal betreute. Mit ihm, seiner Frau Irma und
anderen Kissinger Juden wurde Selma Löwenthal am 23. September 1942 nach
Theresienstadt deportiert. Von dort wurde sie am 23. Januar 1943 mit 53
Jahren ins Vernichtungslager Auschwitz geschickt und dort ermordet.
Quellen:
https://www.badkissingen.de/media/www.badkissingen.de/org/med_34156/125089_10_3_herz_und_regina_loewenthal_chronik_jued_lebens_in_kg_beck_2-22.pdf.pdf
https://www.badkissingen.de/stadt/geschichtliches/juedisches-leben/badkissinger-stolpersteine/37090.SELMA-LOeWENTHAL-1889---1943-Bankier-Ludwigstrasse-11.html
Grabstein Abraham und Gitta Löwenthal -
https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20424/Bad%20Kissingen%20Friedhof%20R%204-13.jpg
|
| |
|
|
Grußkarte
eines Kurgastes
aus der "Villa Löwenthal" (1920) |

 |
|
|
Die Karte an Frau Pastorin H. Raeder in
Horst bei Neustadt am Rübenberge (heute Horst, Stadt Garbsen) wurde aus
der "Villa Loewenthal" in der Hartmannstraße 5 in Bad
Kissingen am 27. August 1920 verschickt. Bei Frau Pastorin Raeder handelt
es sich um die Frau des damals in Horst tätigen Pastors Raeder. In der Hartmannstraße 5 wohnte
der Viehhändler Abraham Löwenthal mit seiner Frau Hannchen
geb. Oberzimmer. Vermutlich vermietete Frau Löwenthal im Haus Zimmer an Kurgäste. Bereits seit 1914 kam die älteste Tochter
Hedwig Haas mit für den Unterhalt ihrer Mutter auf (vgl. Stolperstein
https://www.badkissingen.de/de/tourismus-kurort-bayern/kultur/veranstaltungen/bad-kissinger-stolpersteine/liste/biographien/25377.HEDWIG-HAAS-1887-1942-Hausfrau-Hartmannstrasse-5.html).
Das Ehepaar hatte drei Töchter: Hedwig, Ida und Camilla. Hedwig
Haas geb. Löwenthal kam nach dem Tod ihres Mannes und der Auswanderung ihres Sohnes nach Amerika
1939 zurück nach Bad Kissingen in ihr Elternhaus, um ihre Mutter zu pflegen. Am 24. April 1942 wurde
sie in einem Sammeltransport zusammen mit 22 weiteren Kissinger Juden über Würzburg nach Krasnystaw
bei Lublin deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. Vermutlich wurde Sie in einem der benachbarten Vernichtungslager
ermordet. |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte (ca. 1925/30)
Marktplatz Bad Kissingen mit dem
Konfektionsgeschäft von Solms
Heymann |
 |
 |
|
Solms Heymann
gründete 1878 ein Konfektionsgeschäft, zunächst in der Ludwigstraße,
später am Marktplatz, Ecke Badgasse. Als Spezialitäten führte es
Herrenartikel, Wäsche, Blusen, Korsetts, Schützen, Frottierwäsche,
Handschuhe. Solms Heymann trat 1891 in die Feuerwehr ein; 1908 war er
Mitbegründer des SPD-Ortsverbandes. Solms Heymann und seine Frau Adele
geb. Baum sind nach der Deportation im Ghetto Theresienstadt umgekommen (Informationen
der "Stolpersteine"-Initiative Bad Kissingen; vgl. auch
Binder/Mence: Nachbarn der Vergangenheit S. 136-137). Vgl. oben
die Ansichtskarte von 1900 mit dem Schützenhaus, Familienpensionat von
Solms Heymann.
|
| |
|
|
Das
Geschäft Holländer-Stern
auf dem Bad Kissinger Markt |

 |

 |
|
Ansichtskarten vom Bad Kissinger
Markt (vgl. ähnliche Perspektiven oben), auf denen das Geschäft Holländer - Stern
abgebildet ist. Das Haus hat
somit eine mehrmals wechselnde Benutzung als jüdisches Geschäftshaus
erfahren. Sowohl Moses Hofmann (siehe oben) als auch das Bankgeschäft Louis Hofmann
(siehe oben) sowie nun noch Holländer - Stern betrieben hier ein
Geschäft. Zeitlich ist die linke Karte nicht datiert, da sie nicht postalisch verwendet
wurde; die rechte Karte ist aus dem Jahr 1929. Das Kaufhaus-Schild gibt
einen Einblick in die Verkaufspalette: Wäsche, Ausstattungen,
Baumwollwaren, Trikotagen, Kurzwaren und Strumpfwaren. Ganz rechts am Rand ist auch wieder das Geschäft von Solms Heymann
erkennbar (vgl. oben).
|
| |
|
|
Historische
Ansichtskarten (ca. 1925/30)
Marktplatz Bad Kissingen mit dem
Modehaus von Max Kissinger |
 |
 |
|
Familie Kissinger
hatte über viele Jahre und mehrere Generationen eine Maßschneiderei am
Marktplatz 18 (rechts Ausschnittvergrößerung der Postkarte). Letzte
Inhaber waren Albert mit seinem Sohn Ernst. Ihnen gelang die Emigration
nach Palästina, wo Ernst Kissinger mit seiner Frau Oda wieder eine
Schneiderei aufbaute (Binder/Mence: Nachbarn der Vergangenheit S.
139).
|
| |
|
|
|
Postkarte an Max Kissinger
(1915) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte
aus Würzburg wurde an Max Kissinger am 9. November 1915 verschickt
(liebevolle Anrede: "Liebes Mäxchen")
|
| |
|
|
Briefumschlag
der Herren- und
Damen-Schneiderei Max Kissinger (1915) |
 |
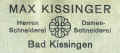 |
| Der
Brief wurde von der Herren- und Damen-Schneiderei Max Kissinger am 23.
Juni 1915 nach Berlin geschickt. |
| |
|
|
|
Postkarte an
Ernst Kissinger (1915) |
 |
 |
|
Die
Ansichtskarte aus Würzburg wurde an Ernst Kissinger gleichfalls am 9.
November 1915 verschickt (dieselbe Absenderin wie oben)
|
| |
|
|
Überschwemmter
Marktplatz in
Bad Kissingen mit dem Geschäft von
Max Kissinger (1909)
(erhalten von Elizabeth Levy,
levyliz[et]smile.net.il)
|
 |
 |
|
Das Foto wurde während einer
Überschwemmung der Stadt im Jahr 1909 aufgenommen (auf Karte angegebene
Quelle: Josef Bötsch, Bad Kissingen) |
| |
|
|
Der
Marktplatz mit dem Geschäft
von Nathan Hamburger (um 1915/20) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte aus der Zeit um 1915/20 (Verlag Ottmar Zieher, München)
zeigt den Bad Kissinger Marktplatz mit Marktständen und Geschäften:
rechts oberhalb ist die Aufschrift auf dem Geschäftshaus von Nathan
Hamburger erkennbar. Die Karte wurde postalisch nicht verwendet.
Das Ehepaar Nathan Hamburger und Pauline geb. Wimmelsbacher betrieb eine Metzgerei in Bad Kissingen. Bei den Wahlen zur Kultusverwaltung
der Israelitischen Kultusgemeinde Bad Kissingen im April 1919 wurden der Metzger Nathan Hamburger und der Kaufmann
Salomon Leuthold als Ersatzleute bestimmt. In den Statuten der der
Israelitischen Cultusgemeinde zu Bad Kissingen von 1888 wurde festgelegt, dass sich die Kultusverwaltung aus
sieben Mitgliedern zusammensetzt: dem Vorstand, dem Gemeindekassierer, dem
Schul- und Stiftungspfleger, zwei Beisitzern und zwei Ersatzleuten.
(vgl. das Buch "Jüdisches Leben in Bad Kissingen" von Hans Jürgen Beck
und Rudolf Walter S. 27-28).
Felizi Hamburger - eine Tochter von Nathan und Pauline Hamburger - war mit Eugen Weill verheiratet. Sie wohnten in München
in der Albinistrasse. Beide schafften es noch im März 1940 in die USA zu
emigrieren vgl. Quelle. |
| |
|
|
Ansichtskarte
mit dem Bankgeschäft
Louis Hofmann (1929) |
 |
 |
| |
Die
Ansichtskarte aus Bad Kissingen wurde von Bad Kissingen nach
Berlin-Siemensstadt am
6. August 1929 verschickt. Am Treppenaufgang ist das Hinweisschild auf das
Bankgeschäft
(Geschäfts- und Wohnhaus) von Louis Hofmann erkennbar. |
| |
|
|
Grußkarte
des Velociped-Clubs in Bad Kissingen
mit Unterschrift von Armand Wittekind (1919) |
 |

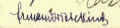 |
|
Die Grußkarte des Velociped-Club Bad Kissingen von einem
Clubabend wurde innerorts am 20. Februar 1919 versandt. Die Karte enthält
die Unterschrift von Armand Wittekind.
Der Velociped-Club Bad Kissingen wurde am 8.Mai 1888 gegründet und wurde in der Gründungszeit noch sehr kritisch beäugt.
Es gab viele Zweifler, die die Gegend für das Radfahren ungeeignet hielten. Doch schon mit dem ersten bereits im Gründungsjahr
ausgeführten Radrennen gelang es dem Verein das Interesse der Öffentlichkeit für sich gewinnen. Noch mehr Beachtung fand der
Verein durch den Bau einer Rennstrecke im Sommer 1889 mit den dort veranstalteten Rad-Rennen.
Armand Wittekind war Mitglied im Velociped-Club ( Fahrradverein) Bad Kissingen, wie seine Unterschrift auf der von Clubmitgliedern
unterschriebenen Grußkarte bezeugt. Er gehörte auch der im Mai 1919 gegründeten Bad Kissinger Volkswehr an, der noch mehr jüdische
Männer angehörten: Ludwig Ehrlich, Siegmund Federlein, Otto Goldstein, Samuel Hoffmann und Hartwig Heymann.
Armand Hugo Wittekind (geb. 5. Mai 1890 in Bad Kissingen als Sohn
von Arthur Wittekind und Therese geb. Reinstein) war in
Bad Kissingen als Antiquar tätig. Er zog 1925 nach Berlin und heiratete 1928
Charlotte geb. Danziger. Um 1937 war sein Wohnsitz Paris/Frankreich.
Im Sterbeeintrag ist Genf in der Schweiz als Wohnsitz angegeben. Armand Wittekind starb am 5. Dezember 1966 in Bad Kissingen.
Im jüdischen Friedhof Bad Kissingen
finden sich die Gräber von Therese Wittekind geb. Reinstein (1861-1907)
und anderer Personen mit Familiennamen Wittekind.
Quellen: Auskunft Stadtarchiv Bad Kissingen – Frau E. Bartetzko
Zeitungsartikel - Kissinger Saale-Zeitung vom 4.Februar 1896: Bannerweihe des Velociped-Clubs Bad Kissingen
Hans-Jürgen Beck/Rudolf Walter: Jüdisches Leben in Bad Kissingen. S.
51. |
| |
|
|
|
Briefumschlag der Glencairn Mainreef Gold Mining Company aus Johannesburg an Louis
Hofmann in Bad Kissingen (1913) |
|
 |

 |
 |
|
Es handelt sich um einen Briefumschlag der Glencairn Mainreef Gold Mining Company
aus Johannesburg an Louis Hofmann in Bad Kissingen. Der Brief
wurde am 12. Februar 1913 an Louis Hofmann geschickt. Louis Hofmann führte in Bad Kissingen ein Bankgeschäft. Am 17. März 1933 wurde der herzkranke und unter
Bluthochdruck leidende Bankier in "Schutzhaft" genommen, zusammen mit einigen anderen jüdischen Männern
von Bad Kissingen. Selbst ein Bericht mit dem Hinweis auf die "Nichthaftfähigkeit" von Louis Hofmann bewirkte nur
eine Umverlegung vom Gendarmiegebäude in die Haftzelle des Theresienkrankenhauses. Am 7. April erlitt Louis Hofmann
dort einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am folgenden Tag starb. An das tragische Schicksal von
Louis Hofmann und seiner Frau Lina geb. Thalheimer erinnern
heute zwei Stolpersteine in der Unteren Marktstraße 2. Louis Hofmann liegt begraben auf dem jüdischen Friedhof in Bad
Kissingen (Foto rechts oben).
Quellen: https://www.badkissingen.de/de/tourismus-kurort-bayern/kultur/veranstaltungen/bad-kissinger-stolpersteine/liste/biographien/18732.LOUIS-HOFMANN-1871-1933-Untere-Marktstrasse-2.html |
| |
|
|
| |
|
|
Rechnungen der
Firma Max Kissinger
(1913 und 1914) und weitere Anzeigen
(erhalten von Elizabeth Levy,
levyliz[et]smile.net.il) |
 |
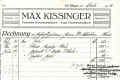 |
| |
|
|
 |
 |
 |
|
Anzeigen aus der "Saale-Zeitung"
vom Dezember 1879: A. Regensburger Witwe (links), Max Kissinger (Mitte)
und "Bayerischer Frauenverein" mit dem Namen von Jeanette
Kissinger. |
Ansichtskarte
der Villa Gleissner
(Geschwister Federlein, 1924) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte
der Villa Gleissner (Besitzer Geschwister Federlein, Im
Rosenviertel, Rosenstraße 2, wurde am 8. Juli 1924 nach Köln an Herrn Adolf
Mondschein verschickt. Zusammen mit zahlreichen Kissinger Bürgern
riefen auch Siegmund Federlein und Nathan Bretzfelder 1918/19 zur
Gründung einer demokratischen Vereinigung in Bad Kissingen auf. Ein
knappes halbes Jahr danach formierte sich im Mai 1919 in Bad Kissingen
eine Einwohner-/Volkswehr, der auch Siegmund Federlein angehörte (Quelle:
Hans Jürgen Beck / Rudolf Walter: Jüdisches Leben in Bad Kissingen S.
51). Der Empfänger der Karte - Adolf Mondschein in Köln - wurde 1941 nach
Riga deportiert (Quelle
NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln).
|
| |
|
|
Ansichtskarte
der Villa Holländer,
versandt nach Nürnberg (1937) |
 |
 |
|
Die Ansichtskarte der Villa Holländer
wurde am 13. September 1937 nach Nürnberg versandt. Die Villa Holländer war ein Kurhaus und eine Zeit lang auch das Domizil der
Arztpraxis von Dr. Sally Mayer. Besitzer und Betreiber des Kurhauses Villa Holländer waren
Nathan Bretzfelder und seine Frau Klara Bretzfelder geb.
Goldstein.
Nathan Bretzfelder war über viele Jahre (von 1919 bis
April 1933) Stadtrat in Bad Kissingen, bis er im Zuge der sogenannten
"Gleichschaltung" des Bad Kissinger Stadtrats gemeinsam mit Otto Goldstein und den Stadträten der SPD, DDP, dem Bürgerblock
u.a. den Stadtrat verlassen musste. In seiner Funktion als Stadtrat versuchte er bereits seit den
1920er Jahren antisemitischen
Tendenzen, dem Wachsen und Wirken, auch den öffentlichen Aufmärschen der Bad Kissinger NSDAP entgegenzuwirken, da
dies dem Kurbetrieb und dem Ansehen der Stadt, auch international, Schaden zufügen würde. Am 14. März 1938
wurde in einer die Konzessionsvergabe die jüdischen Kurheime betreffenden Stadtratssitzung
allen bis auf vier jüdischen Fremdenheimen die Konzession entzogen, darunter auch dem Kurhaus Holländer.
Irma Bretzfelder (geb. 21. Oktober 1895 als Tochter von Nathan und Klara Bretzfelder) heiratete am 26. März 1923 den am
7. Juni 1889 in Mayen geborenen Dr. Sally Mayer, der als praktischer Arzt und Badearzt zuerst in der Villa Holländer,
später in der Kurhausstraße praktizierte. Mit der zunehmenden Diskriminierung verlor Dr. Sally Mayer im März 1938 seine Approbation
und durfte nur noch als "Krankenbehandler" für jüdische Patienten in Bad Kissingen und Umgebung tätig sein.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde er
in Schutzhaft genommen und über Würzburg in das KZ Dachau gebracht. Ihm wurde zur Auflage gemacht, Deutschland zu verlassen. Der Versuch
der Emigration schlug jedoch fehl. Ab März 1939 übernahm Dr. Sally Mayer als Nachfolger von Dr. Bernhard Gutmann die Leitung des Kranken-
und Altersheims der Israelitischen Kranken– und Pfründnerhausstiftung in Würzburg. Mit Beginn der Deportationstransporte 1941 gehörte auch
die ärztliche und psychologische Betreuung der am Würzburger Bahnhof und der Deportationssammelstelle auf ihren Abtransport wartenden
Juden aus ganz Mainfranken zu seinen Aufgaben. Am 23. September 1942 begleiteten Dr. Sally Mayer und seine Frau Irma auf eigenen
Wunsch eine von ihm betreute Gruppe überwiegend alter und hilfloser Menschen
in das Ghetto Theresienstadt, um auch dort noch ärztlich tätig
zu sein mit Unterstützung seiner Frau Irma als Krankenschwester. Am 19. Oktober 1944 wurden
Dr. Sally und Irma Mayer nach Auschwitz deportiert und ermordet. Sowohl in
Bad Kissingen als auch in Würzburg erinnern Stolpersteine an das
Schicksal von Dr. Sally Mayer und seine Ehefrau Irma geb.
Bretzfelder.
(Weitere Informationen zu Leben und Wirken von Dr. Sally Mayer und seiner Ehefrau
Irma
finden sich im Heft zur dritten Stolpersteinverlegung vom 22. September 2010 in Bad Kissingen und dem nachfolgenden Link:)
https://www.badkissingen.de/de/stadt/geschichtliches/bad-kissinger-stolpersteine/37086.SALLY-MAYER-1889--Arzt-Kurhausstrasse-12.html
https://www.badkissingen.de/de/stadt/geschichtliches/bad-kissinger-stolpersteine/37064.IRMA-MAYER-1895--geb.-Bretzfelder-Hausfrau-Kurhausstrasse-12.html
http://www.stolpersteine-wuerzburg.de/wer_opfer_lang.php?quelle=wer_paten.php&opferid=190
Als Absenderinnen der Karte zeichnen
- Mathilde Neumeyer verheirate Zeiller, geb. am 1. Juli 1869 in Forchheim, wohnhaft in Nürnberg, Knauerstraße 25,
am 10. September 1942 von Nürnberg nach Theresienstadt deportiert und dort am 4. März 1943 zu Tode
gekommen.
- Rosa Goldschmidt, geb. am 8. Januar 1880, wohnte in Nürnberg in der Kraußstraße
8, seit 29. März 1938 in München, am 20. November 1941 deportiert von München nach Kowno,
wo sie am 25. November 1941 ermordet wurde.
- Betty Priester verheiratete Zeiller, geb. am 21. Mai 1863 in Forchheim, wohnhaft in Nürnberg, Knauerstraße 25,
am 10. September 1942 von Nürnberg nach Theresienstadt deportiert und dort am 11. Februar 1943 zu Tode gekommen.
Quellen: Hans Jürgen Beck / Rudolf Walter: Jüdisches Leben in Bad Kissingen.
Heft Bad Kissinger Stolpersteine – 3. Stolpersteinverlegung,
22. September 2010.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sally_Mayer
https://www.jewishgen.org/yizkor/nuremberg/nur005.html
https://www.jewishgen.org/yizkor/nuremberg/nur009.html
https://www.geni.com/people/Betty-Priester/6000000035976627847
https://www.geni.com/people/Mathilde-Neumeyer/6000000035976027408. |
| |
|
|
| |
|
|
|