|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zur Seite über die jüdische Geschichte in
Tübingen / Geschichte der Synagoge in Tübingen
Tübingen (Universitäts-
und Kreisstadt, Baden-Württemberg)
Texte zur jüdischen Geschichte der Stadt
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Tübingen wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Es konnten noch nicht alle Texte abgeschrieben und
gegebenenfalls kommentiert werden. Zum Lesen in diesem Fall bitte die Textabbildung
anklicken.
Übersicht:
Allgemeine
Beitrage und Mitteilungen
Artikel über die jüdische Geschichte in Wankheim und die Entstehung der
jüdischen Gemeinde in Tübingen (1915)
 Artikel in der
Zeitschrift "Das jüdische Echo" vom 8. April 1915: "Aus der
Geschichte der württembergischen Judenheit Artikel in der
Zeitschrift "Das jüdische Echo" vom 8. April 1915: "Aus der
Geschichte der württembergischen Judenheit
Entstehung der Gemeinde Tübingen.
Die israelitische Gemeinde Wankheim,*)
aus der die israelitische Gemeinde Tübingen hervorgegangen ist,
datiert seit etwa anno 1775, in welcher Zeit Israeliten aus
Braunsbach, dem Schwarzwald und
namentlich Hohenzollern (wo die Juden unter gar vielen kleinen und
kleinlichen Bedrückungen zu seufzen hatten, wie zum Beispiel nur der älteste
Sohn gegen ein festgesetztes Entgelt heiraten durfte, während die Jüngeren
erst mit dem Eintritt in das, ich glaube 35. Lebensjahr mit dieser Erlaubnis
beglückt wurden) von dem damaligen Grundherrn Wankheims, Freiherrn von
Saint-Andre die Genehmigung zur Niederlassung erhielten. Ihnen folgten bald
weitere Familien nach, bis sich eine kleine, arme, dürftige Gemeinde
bildete.
Arm und dürftig deshalb, weil sie mit Lasten und Abgaben in überreichem Maße
gesegnet war; außerdem musste jedes Familienoberhaupt dem Gutsherrn jährlich
12 fl. Schutzgeld zahlen. Nichtsdestoweniger wurde, obwohl von keiner Seite
irgendein Zuschuss gewährt wurde, in einem gemieteten Lokal ein Betsaal
hergerichtet und ein Vorsänger angestellt, der auch den Kindern
Religionsunterricht zu erteilen hatte.
Für den Begräbnisplatz sorgte der
Gutsherr, dem aber für jeden Sterbefall eine Gebühr zu entrichten war, und
zwar für einen Erwachsenen 2 fl., für ein Kind 1 fl. Erst im Jahre 1845 ging
der Friedhof an die israelitische Gemeinde über.
Gemäß dem Erlass von 1828 und 1832 wurde die Gemeinde
Wankheim (-Tübingen-Dußlingen) dem
Rabbinat Mühringen unterstellt.
Nunmehr begnügte sie sich nicht mehr mit dem Betsaal, der an hohen Festtagen
so wie so die Anzahl der Beter nicht fassen konnte (unter welchem Übel zum
Beispiel die jetzige Tübinger Synagoge gewiss nicht leidet) und machte es
mit großen Opfern und Kollekte möglich, an den Bau eines Gotteshauses zu
gehen, das auch im Jahre 1835 durch den damals zuständigen Rabbiner,
späteren Kirchenrat Herrn Dr. Wassermann eingeweiht wurde.
Nachdem sich durch die 1848er Revolution die namentlich uns Juden
einengenden Fesseln etwas gelockert hatten, verzogen viele Familien nach
Tübingen, Reutlingen, Nürtingen,
Stuttgart, Regensburg und so kam
es, dass die Gemeinde Wankheim bis auf einige Familien herabsank.
Die Stadt Tübingen, deren Pflaster seit der Universitätsgründung
(1477) von keines Juden Fuß mehr entweiht war, öffnete ihnen seine Tore
ebenfalls erst nach dem Sturmjahr 1848, und zwar erhielt als erster
Zuzugsrecht Herr Leopold Hirsch (Vater des jetzt noch in Tübingen lebenden
Herrn Gustav Hirsch, der in seiner 48jährigen Tätigkeit als
Gemeindevorsteher sich um das Gemeindeleben sehr verdient gemacht hat), dem
erst nach mehr als zehnjähriger Pause weitere jüdische Familien aus Wankheim
nachfolgten.
Im Jahre 1882 stellte sich, nach vielen Anstrengungen der Kirche gegenüber
der Oberkirchenbehörde, an denen besagter Herr G. Hirsch hervorragenden
Anteil nahm, die Gemeinde auf eigene Füße durch den Bau einer Synagoge, zu
der Utensilien aus dem Gotteshaus der Muttergemeinde verwendet wurden, mit
Zweigfilialen in Reutlingen und neuerdings auch
Rottenburg, welch ersterer ein
dem eben beschriebenen analoger Werdegang zu prophezeien sein dürfte.
Als Lehrer haben seitdem in Tübingen gewirkt: Thalmann, Ehrlich,
Kann, Marx, Strauß, Gideon, Adler, Pollak, Lehrmann. Kuno Lehrmann."
*) Das Dörfchen Wankheim liegt eine Stunde Wegs von Tübingen entfernt. |
In Tübingen darf immer noch kein Jude wohnen (1850)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1850: "Tübingen, im
November (1850). Ich befinde mich hier im Württemberger Land, in welchem
in diesem Augenblicke wenigstens noch die deutschen Grundrechte geltend
sind, in welchem, was noch viel mehr sagen will, die Duldung und
Gleichberechtigung seit langer Zeit schöne Triumphe gefeiert, tief
gewurzelt hat. Und gerade in Tübingen werde ich daran erinnert, dass der
gerühmte Geist der Neuzeit noch lange Zeit nicht überall im deutschen
Vaterland zur Herrschaft gelangt ist, dass nicht bloß im großen 'Vaterland des Deutschen', sondern in kleinem Lande dicht
nebeneinander der verschiedenste Geist sich betätigt. Wie nahe ist
Stuttgart der Universitätsstadt Tübingen – und welch anderer Geist
wehet an beiden Orten! In Stuttgart kaum eine Spur von Religionshass noch,
und in Tübingen – darf noch heute kein Jude wohnen. Er darf gesetzlich
wohl, aber faktisch darf er es nicht wagen, ich glaube, die Stadt stünde
auf. Nein, in einem nahen Dorfe müssen sie wohnen (sc. Wankheim), und so
beschwerlich dies für Beide ist, für die Juden und die Tübinger, es
muss so sein. Welch dichte Finsternis herrscht hier in den Köpfen des
Volkes in dieser Beziehung noch, auf welche Hindernisse stößt die
Besserung noch, als ob noch Jahrhunderte dazu gehören möchten. Sie liegt
Tübingen im gesegneten Württemberg wie eine Insel des Religionshasses
– aber schade, dass es nicht einmal die einzige Insel da ist. Ein Stück
Spanien und Neapel mitten in Deutschland." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1850: "Tübingen, im
November (1850). Ich befinde mich hier im Württemberger Land, in welchem
in diesem Augenblicke wenigstens noch die deutschen Grundrechte geltend
sind, in welchem, was noch viel mehr sagen will, die Duldung und
Gleichberechtigung seit langer Zeit schöne Triumphe gefeiert, tief
gewurzelt hat. Und gerade in Tübingen werde ich daran erinnert, dass der
gerühmte Geist der Neuzeit noch lange Zeit nicht überall im deutschen
Vaterland zur Herrschaft gelangt ist, dass nicht bloß im großen 'Vaterland des Deutschen', sondern in kleinem Lande dicht
nebeneinander der verschiedenste Geist sich betätigt. Wie nahe ist
Stuttgart der Universitätsstadt Tübingen – und welch anderer Geist
wehet an beiden Orten! In Stuttgart kaum eine Spur von Religionshass noch,
und in Tübingen – darf noch heute kein Jude wohnen. Er darf gesetzlich
wohl, aber faktisch darf er es nicht wagen, ich glaube, die Stadt stünde
auf. Nein, in einem nahen Dorfe müssen sie wohnen (sc. Wankheim), und so
beschwerlich dies für Beide ist, für die Juden und die Tübinger, es
muss so sein. Welch dichte Finsternis herrscht hier in den Köpfen des
Volkes in dieser Beziehung noch, auf welche Hindernisse stößt die
Besserung noch, als ob noch Jahrhunderte dazu gehören möchten. Sie liegt
Tübingen im gesegneten Württemberg wie eine Insel des Religionshasses
– aber schade, dass es nicht einmal die einzige Insel da ist. Ein Stück
Spanien und Neapel mitten in Deutschland." |
Der Stadtrat muss einem jüdischen
Mann das Bürgerrecht verleihen (1852)
Anmerkung: Es ging um die Niederlassung des Wankheimer Synagogenvorstehers
Leopold Hirsch, der 1859 die Firma Leopold Hirsch, Herrenkonfektion, in der
Kronenstraße 6 in Tübingen begründete. Sein Sohn war Gustav Hirsch (geb. 1848 in
Wankheim, gest. 1933 in Tübingen), der später Mitglied des Tübinger
Bürgervereins und zugleich dessen Schriftführer und Kassier war.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September 1852: "Der
demokratische Stadtrat von Tübingen wurde von der königlichen Regierung
gezwungen, einem Israeliten das Bürgerrecht zu verleihen, jetzt
verweigert derselbe die Bürgeraufnahme dessen Kindern. Solche Humanitätsbeweise
liberaler Stadträte hat Württemberg vielseitig aufzuweisen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September 1852: "Der
demokratische Stadtrat von Tübingen wurde von der königlichen Regierung
gezwungen, einem Israeliten das Bürgerrecht zu verleihen, jetzt
verweigert derselbe die Bürgeraufnahme dessen Kindern. Solche Humanitätsbeweise
liberaler Stadträte hat Württemberg vielseitig aufzuweisen." |
Einladungen zum Universitätsjubiläum an Vertreter des Israelitischen Oberrates
und des Württembergischen Rabbinervereins (1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1927: "Stuttgart. Tübinger
Universitätsjubiläum. Auf Einladung des Senates der Universität Tübingen
haben als Vertreter des Israelitischen Oberrates Regierungsrat Dr.
Nördlinger und als Vertreter des Württembergischen Rabbinervereins
Stadtrabbiner Dr. Rieger an den Festlichkeiten als Ehrengäste teilgenommen." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. August 1927: "Stuttgart. Tübinger
Universitätsjubiläum. Auf Einladung des Senates der Universität Tübingen
haben als Vertreter des Israelitischen Oberrates Regierungsrat Dr.
Nördlinger und als Vertreter des Württembergischen Rabbinervereins
Stadtrabbiner Dr. Rieger an den Festlichkeiten als Ehrengäste teilgenommen." |
Vortrag vor der Ortsgruppe des Württembergischen Frauentierschutzvereins über
das Schächten (1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1931: |
Auf Antrag der Nationalsozialisten soll "Juden und Fremdrassigen" der
Zutritt zum städtischen Freibad verboten werden (1933)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1933: |
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1893 /
1934
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893: "Universitätsstadt
Tübingen. Die hiesige israelitische Religionslehrer-, Vorbeter-
& Schächterstelle soll durch einen tüchtigen, geprüften, militärfreien,
ledigen Mann zum 15. Mai dieses Jahres besetzt werden. Bewerber wollen
sich sofort zur Einleitung des Weiteren unter Beischluss von Zeugnissen
wenden an das Israelitische Kirchenvorsteheramt." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1893: "Universitätsstadt
Tübingen. Die hiesige israelitische Religionslehrer-, Vorbeter-
& Schächterstelle soll durch einen tüchtigen, geprüften, militärfreien,
ledigen Mann zum 15. Mai dieses Jahres besetzt werden. Bewerber wollen
sich sofort zur Einleitung des Weiteren unter Beischluss von Zeugnissen
wenden an das Israelitische Kirchenvorsteheramt." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1934: "Wir suchen
a) für die Israelitische Religionsgemeinde Tübingen zu sofortigem
Antritt möglichst einen auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums (BBG) zur Ruhe gesetzten Vorbeter und Religionslehrer
(liberal). Gewährt wird eine Zulage, durch die die vollen Bezüge eines
Beamten der zuständigen Besoldungsgruppe abzüglich der besonderen württembergischen
Kürzung erreicht werden… Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1934: "Wir suchen
a) für die Israelitische Religionsgemeinde Tübingen zu sofortigem
Antritt möglichst einen auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums (BBG) zur Ruhe gesetzten Vorbeter und Religionslehrer
(liberal). Gewährt wird eine Zulage, durch die die vollen Bezüge eines
Beamten der zuständigen Besoldungsgruppe abzüglich der besonderen württembergischen
Kürzung erreicht werden…
Meldungen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes und beglaubigten
Zeugnisabschriften bis zum 28. Juni einzureichen beim Oberrat der
Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, Stuttgart, Königstraße
82." |
Spendenaufruf des Lehrers Ad. Ehrlich (1891)
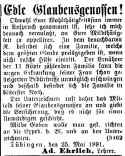 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Edle
Glaubensgenossen! Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Mai 1891: "Edle
Glaubensgenossen!
Obwohl Euer Wohltätigkeitssinn immer in Anspruch
genommen ist, sehe ich mich dennoch veranlasst, an Eure Mildtätigkeit zu
appellieren. In dem benachbarten R. befindet sich eine Familie, welche dem
größten Elende preisgegeben ist, wenn nicht rasche Hilfe eintritt. Der
Ernährer der 11 Köpfe zählenden Familie kann die wegen Erkrankung
seiner Frau schon gesteigerten Bedürfnisse unmöglich erschwingen und
deshalb befindet sich die Familie in bitterster Not.
Der Unterzeichnete ruft daher das Mitleid seiner Glaubensgenossen an und
gibt die Versicherung, dass es nicht für einen Unwürdigen geschieht.
Milde Gaben wolle man gefälligst richten an die Expedition dieses Blattes
und an den Unterzeichneten.
Tübingen, den 25. Mai 1891. Ad. Ehrlich, Lehrer." |
Zum Tod von Lehrer Leopold Polack (1923, Lehrer
in Tübingen 1914-1923)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923:
"Tübingen, 16. Juli (1923). Am Freitag wurde auf dem Friedhof
Wankheim (nicht: Werkheim) (bei Tübingen) der Lehrer der
Tübinger Gemeinde, L. Pollak, zu Grabe getragen. Ein echter Jehudi ist
mit ihm gestorben, der in vierzigjähriger Tätigkeit, kurze Zeit in bayrischen
Gemeinden, dann 26 Jahre in Olnhausen
(bei Heilbronn) und zuletzt neun Jahre in Tübingen das Banner des
toratreuen Judens hochgehalten und Generationen in diesem Geiste erzogen
hat. Was er am letzten Orte seiner Wirksamkeit in anders gesinnter
Umgebung für Schechita und Religionsunterricht getan hat, kann nicht
genug gerühmt werden; selbst in den kranken Tagen hat er seine Schüler
in seinem Hause mit der Lehre Gottes bekannt gemacht. Seine Beerdigung
legte durch die übergroße Beteiligung noch einmal Zeugnis für seine
Leistungen ab; kurz, wegen des nahenden Sabbats, sprachen der
Bezirksrabbiner Herr Dr. Schweizer (Horb),
als Vertreter des Kirchenvorsteheramtes der israelitischen Gemeinde
Tübingen Herr Rechtsanwalt Dr. Katz, im Auftrage der Nachbargemeinde Hechingen
Herr Lehrer Schmalzbach, als Vertreter des württembergischen Lehrerverbandes
Herr Lehrer Rothschild, Esslingen.
Herr Rabbiner Posner widmete dem Verstorbenen kurz vor Schabbat-Eingang
warme Worte der tiefsten Verehrung und Hochschätzung. Als die letzten Schollen
das Grab deckten, zog fast der Monat Aw ein und die Kinder kehrte
ohne Aw (= Vater) an die leere Stätte ihres Elternhauses zurück.
Möge Gott ihnen und der betrübten Witwe beistehen. Seine Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923:
"Tübingen, 16. Juli (1923). Am Freitag wurde auf dem Friedhof
Wankheim (nicht: Werkheim) (bei Tübingen) der Lehrer der
Tübinger Gemeinde, L. Pollak, zu Grabe getragen. Ein echter Jehudi ist
mit ihm gestorben, der in vierzigjähriger Tätigkeit, kurze Zeit in bayrischen
Gemeinden, dann 26 Jahre in Olnhausen
(bei Heilbronn) und zuletzt neun Jahre in Tübingen das Banner des
toratreuen Judens hochgehalten und Generationen in diesem Geiste erzogen
hat. Was er am letzten Orte seiner Wirksamkeit in anders gesinnter
Umgebung für Schechita und Religionsunterricht getan hat, kann nicht
genug gerühmt werden; selbst in den kranken Tagen hat er seine Schüler
in seinem Hause mit der Lehre Gottes bekannt gemacht. Seine Beerdigung
legte durch die übergroße Beteiligung noch einmal Zeugnis für seine
Leistungen ab; kurz, wegen des nahenden Sabbats, sprachen der
Bezirksrabbiner Herr Dr. Schweizer (Horb),
als Vertreter des Kirchenvorsteheramtes der israelitischen Gemeinde
Tübingen Herr Rechtsanwalt Dr. Katz, im Auftrage der Nachbargemeinde Hechingen
Herr Lehrer Schmalzbach, als Vertreter des württembergischen Lehrerverbandes
Herr Lehrer Rothschild, Esslingen.
Herr Rabbiner Posner widmete dem Verstorbenen kurz vor Schabbat-Eingang
warme Worte der tiefsten Verehrung und Hochschätzung. Als die letzten Schollen
das Grab deckten, zog fast der Monat Aw ein und die Kinder kehrte
ohne Aw (= Vater) an die leere Stätte ihres Elternhauses zurück.
Möge Gott ihnen und der betrübten Witwe beistehen. Seine Seele
sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
| |
 Traueranzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923: "Statt
besonderer Anzeige! Am 28. Tammus verschied nach längerem, in großer
Geduld ertragenem Leiden, mein lieber Gatte, unser fürsorglicher guter
Vater, Schwiegervater, Bruder und Schwager, der Lehrer und Vorsänger Leopold
Pollak im noch nicht vollendeten 65. Lebensjahre. Traueranzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juli 1923: "Statt
besonderer Anzeige! Am 28. Tammus verschied nach längerem, in großer
Geduld ertragenem Leiden, mein lieber Gatte, unser fürsorglicher guter
Vater, Schwiegervater, Bruder und Schwager, der Lehrer und Vorsänger Leopold
Pollak im noch nicht vollendeten 65. Lebensjahre.
Pauline Pollak geb. Heidelberger. Tübingen, im Aw 5683 - Juli 1923.
Die Beerdigung hat bereits stattgefunden." |
Entlassungsfeier der Religionsschüler in der Synagoge
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. April 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. April 1928: |
Religionsoberlehrer
Wochenmark hat sein Doktorexamen abgelegt (1933)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1933: |
Ergänzender Hinweis: In der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1932 findet sich ein Artikel von
Religionsoberlehrer Wochenmark zum Thema "Weshalb Luther ein Judenfeind
wurde":
https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pagetext/4907494?query=Tübingen
Religionsoberlehrer Dr. Wochenmark bietet einen hebräischen Sprachkurs an
(1933)
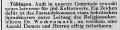 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1933: |
Religionsoberlehrer Dr. Josef Wochenmark besteht die pädagogische
Staatsprüfung (1934)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1934: |
Hauptlehrer a.D. Zivi ist Nachfolger für
Religionsoberlehrer Dr. Wochenmark - Vortrag von Lucie Levi über Henriette Herz
und ihren Kreis (1935)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1935: "Tübingen.
Religions-Oberlehrer Dr. Wochenmark hat in Hauptlehrer a. D. Zivi
einen Nachfolger gefunden, der für die Wahrung jüdischer Belange ebenso
fleißig eintritt. Auf Anregung der Gemeinde findet jeden zweiten
Sabbath-Ausgang ein Bibelabend statt, an dem sich die Gemeinde fast
vollzählig beteiligt. Auch Reutlinger Gäste nehmen an ihm teil. Die Frauen
der Gemeinde halten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft über Werke moderner
jüdischer Dramatiker zusammengeschlossen. - Sehr dankbar wurde ein
wertvoller Vortrag von Frau Lucie Levi (Stuttgart) über Henriette Herz und
ihren Kreis aufgenommen. All das zeigt, dass auch in Tübingen reges
jüdisches Leben pulsiert und wach gehalten wird." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1935: "Tübingen.
Religions-Oberlehrer Dr. Wochenmark hat in Hauptlehrer a. D. Zivi
einen Nachfolger gefunden, der für die Wahrung jüdischer Belange ebenso
fleißig eintritt. Auf Anregung der Gemeinde findet jeden zweiten
Sabbath-Ausgang ein Bibelabend statt, an dem sich die Gemeinde fast
vollzählig beteiligt. Auch Reutlinger Gäste nehmen an ihm teil. Die Frauen
der Gemeinde halten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft über Werke moderner
jüdischer Dramatiker zusammengeschlossen. - Sehr dankbar wurde ein
wertvoller Vortrag von Frau Lucie Levi (Stuttgart) über Henriette Herz und
ihren Kreis aufgenommen. All das zeigt, dass auch in Tübingen reges
jüdisches Leben pulsiert und wach gehalten wird." |
Berichte aus
dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben
Neuwahl in
das Vorsteheramt (1927)
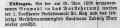 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1927: |
Jahresversammlung
der Ortsgruppe des Centralvereins (1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1927: |
Vortrag mit Lehrer Spier aus Haigerloch zu "Judentum und
Friedensidee" (1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. März 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. März 1927: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über Moses Mendelssohn (1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1928: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Familie und Politik"
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1928: |
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Central-Vereins
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Mai 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Mai 1928: |
Vortragsabend
mit Oberlehrer Wochenmark über Walter Rathenau (1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1928: |
Mendelssohn-Gedenkfeier
in der Gemeinde (1929)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1929: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1929: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Gegenwartsfragen der
jüdischen Frau" (1929)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1929: "Tübingen. Am 20. Oktober
hielt die erste Vorsitzende des württembergischen hohenzollerischen
Landesverbandes des jüdischen Frauenbundes, Frau Else Bergmann,
Laupheim, im Frauenverein
Tübingen-Reutlingen einen Vortrag über Gegenwartsfragen der jüdischen Frau.
Sie behandelte die Fragen der Erziehung, Berufswahl, Berufsbildung und
Berufstätigkeit des jüdischen Mädchens und wies besonders auf die
Notwendigkeit hin, den jüdischen Mädchen eine gründliche Berufsausbildung
angedeihen zu lassen, da die wirtschaftlichen Verhältnisse selbst von der
verheiraten verheirateten Frau häufig mit Betätigung im Berufe des Mannes
erfordern und die Verheiratungsmöglichkeit sehr erschwert ist. Namentlich
empfahl die Rednerin die Ausbildung und berufliche Betätigung in der
Hauswirtschaft. Zu gemeindepolitischen Fragen übergehend, stellte die
Rednerin die Forderung des passiven Wahlrechts für die Frau in den
Gemeindevorsteherämtern und schilderte ihre Bedeutung für die religiöse neue
Belebung des Judentums. Sie unterstützte diese Ansicht durch Verlesung der
Schlussworte einer Ansprache des Rabbiners Dr. Baeck auf der Berliner
Jubiläumstagung des jüdischen Frauenbundes, worin gerade die religiöse
Bedeutung der jüdischen Frauenbewegung gekennzeichnet wird. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1929: "Tübingen. Am 20. Oktober
hielt die erste Vorsitzende des württembergischen hohenzollerischen
Landesverbandes des jüdischen Frauenbundes, Frau Else Bergmann,
Laupheim, im Frauenverein
Tübingen-Reutlingen einen Vortrag über Gegenwartsfragen der jüdischen Frau.
Sie behandelte die Fragen der Erziehung, Berufswahl, Berufsbildung und
Berufstätigkeit des jüdischen Mädchens und wies besonders auf die
Notwendigkeit hin, den jüdischen Mädchen eine gründliche Berufsausbildung
angedeihen zu lassen, da die wirtschaftlichen Verhältnisse selbst von der
verheiraten verheirateten Frau häufig mit Betätigung im Berufe des Mannes
erfordern und die Verheiratungsmöglichkeit sehr erschwert ist. Namentlich
empfahl die Rednerin die Ausbildung und berufliche Betätigung in der
Hauswirtschaft. Zu gemeindepolitischen Fragen übergehend, stellte die
Rednerin die Forderung des passiven Wahlrechts für die Frau in den
Gemeindevorsteherämtern und schilderte ihre Bedeutung für die religiöse neue
Belebung des Judentums. Sie unterstützte diese Ansicht durch Verlesung der
Schlussworte einer Ansprache des Rabbiners Dr. Baeck auf der Berliner
Jubiläumstagung des jüdischen Frauenbundes, worin gerade die religiöse
Bedeutung der jüdischen Frauenbewegung gekennzeichnet wird.
Die Versammlung nahm die vortrefflichen, mit Begeisterung vorgetragenen
Ausführungen mit großem Beifall auf. Besonders interessant gestaltete sich
dieser Vortragsabend dadurch, dass das Mitglied der Landesversammlung
Rechtsanwalt Dr. Hayum das Wort ergriff und in klarer und
instruktiver Weise die Frage des passiven Frauenwahlrecht für die
Kirchenvorsteherämter und ihre bisherige Behandlung auf den Tagungen der
Landesversammlung beleuchtete. Zum Schluss dankte die Vorsitzende des
Frauenvereins, Frau Karoline Löwenstein, der Referentin mit
herzlichen Worten." |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein "Über die neuen Lebensformen der
Frau" (1930)
|
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 26.
Januar hielt Frau Jella Lepman, Stuttgart, im Frauenverein
Tübingen-Reutlingen einen Vortrag 'Über die neuen Lebensformen der Frau'.
Sie beleuchtete in interessanten Ausführungen die neuen Aufgaben, welche die
Frau in den Lebenskreisen von Natur, Familie, Beruf und Öffentlichkeit zu
erfüllen hat. Stärkere Betätigung in allen ihren Lebenskreisen sei
notwendig, wobei aber ihr Leben und Wirken in der Familie Mittelpunkt
bleiben müsse. Dem Vortrag schloss sich eine Aussprache an, an der sich
stud. jur. H. Erlanger und Oberlehrer Wochenmark beteiligten." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 26.
Januar hielt Frau Jella Lepman, Stuttgart, im Frauenverein
Tübingen-Reutlingen einen Vortrag 'Über die neuen Lebensformen der Frau'.
Sie beleuchtete in interessanten Ausführungen die neuen Aufgaben, welche die
Frau in den Lebenskreisen von Natur, Familie, Beruf und Öffentlichkeit zu
erfüllen hat. Stärkere Betätigung in allen ihren Lebenskreisen sei
notwendig, wobei aber ihr Leben und Wirken in der Familie Mittelpunkt
bleiben müsse. Dem Vortrag schloss sich eine Aussprache an, an der sich
stud. jur. H. Erlanger und Oberlehrer Wochenmark beteiligten."
|
Purimfeier auf Einladung des Synagogenchors (1930)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 8. März
trafen sich die Gemeindemitglieder auf Einladung des Synagogenchors im
Sängerkranzsaal des Museums zu einer gemütlichen Purimfeier. Nach
einem von stud. iur. Walter Erlanger verfassten und von Frl. Ilse
Löwenstein vorgetragenen Prolog und einem von Frl. Stern
gespielten Musikstück von Chopin konnte die Vorsitzende, Frl. Weil
die zahlreich Erschienenen willkommen heilten. Ein Tanz 'Die Puppe', von
Frl. Lore Hirsch schloss sich an. Darauf lud die vorzügliche Musik zum Tanze
ein, dem von jung und alt bis fast vor Mitternacht gehuldigt wurde. Nun tat
sich das Nachtkabarett mit seinem vorzüglichen Konferenzier Rechtsanwalt Dr.
Heinz Hayum auf. Frl. Schäfer führte einen spanischen Tanz
vor, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. so dass sie eine Dreingabe
geben musste. Die einzelnen Tänze wurden von Frau Paula Marx am
Flügel begleitet. Drei glänzend gespielte Sketches, die in den Hauptrollen
von Frl. cand. phil. Moses und den Herren Ludwig, Lothar, Viktor
und Egon Marx, in den Nebenrollen von Frl. Pollack, Frl. Stern
und Herrn Löwenstein gespielt wurden, beschlossen das Kabarett.
Natürlich fehlte auch nicht der lokale Teil, der von Ludwig Marx
verfasst und von Frl. Hayum ausgezeichnet vorgetragen wurde. Der
Beifall zeigte, dass der Synagogenchor den Gemeindemitgliedern einige
gemütliche Stunden geboten hatte. Rechtsanwalt Dr. Katz und
Religionsoberlehrer Wochenmark sprachen noch zum Schluss den Dank der
Anwesenden aus." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1930: "Tübingen. Am 8. März
trafen sich die Gemeindemitglieder auf Einladung des Synagogenchors im
Sängerkranzsaal des Museums zu einer gemütlichen Purimfeier. Nach
einem von stud. iur. Walter Erlanger verfassten und von Frl. Ilse
Löwenstein vorgetragenen Prolog und einem von Frl. Stern
gespielten Musikstück von Chopin konnte die Vorsitzende, Frl. Weil
die zahlreich Erschienenen willkommen heilten. Ein Tanz 'Die Puppe', von
Frl. Lore Hirsch schloss sich an. Darauf lud die vorzügliche Musik zum Tanze
ein, dem von jung und alt bis fast vor Mitternacht gehuldigt wurde. Nun tat
sich das Nachtkabarett mit seinem vorzüglichen Konferenzier Rechtsanwalt Dr.
Heinz Hayum auf. Frl. Schäfer führte einen spanischen Tanz
vor, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. so dass sie eine Dreingabe
geben musste. Die einzelnen Tänze wurden von Frau Paula Marx am
Flügel begleitet. Drei glänzend gespielte Sketches, die in den Hauptrollen
von Frl. cand. phil. Moses und den Herren Ludwig, Lothar, Viktor
und Egon Marx, in den Nebenrollen von Frl. Pollack, Frl. Stern
und Herrn Löwenstein gespielt wurden, beschlossen das Kabarett.
Natürlich fehlte auch nicht der lokale Teil, der von Ludwig Marx
verfasst und von Frl. Hayum ausgezeichnet vorgetragen wurde. Der
Beifall zeigte, dass der Synagogenchor den Gemeindemitgliedern einige
gemütliche Stunden geboten hatte. Rechtsanwalt Dr. Katz und
Religionsoberlehrer Wochenmark sprachen noch zum Schluss den Dank der
Anwesenden aus." |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die Bedeutung des Sabbats und
seine Geschichte" (1930)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1930: "Tübingen. Am 6. Mai
sprach Oberlehrer Wochenmark im 'Israelitischen Frauenverein
Tübingen-Reutlingen über 'Die Bedeutung des Sabbats und seine Geschichte'.
Er bezeichnete nach Hermann Cohen den Sabbat als den Schutzengel des
Judentums und zeigte, wie der Sabbat in der Vergangenheit tatsächlich für
die Juden ein Schutzengel gewesen. dass aber dieser Schutzengel in der
Gegenwart die Judenheit zu verlassen droht. Jüdischer Optimismus lässt aber
hoffen, wenigstens die wichtigsten Einrichtungen des Sabbats, seine
häusliche Feier und den öffentlichen Sabbatgottesdienst mit ihren
versittlichenden und erzieherischen Wirkungen neu beleben zu können. Denn
die Geschichte des Sabbats und des Sonntags zeigen, dass dieser den Sabbat
nicht ersetzen kann, dass vielmehr bis auf den heutigen Tag von
nichtjüdischer Seite erstrebt wird, die Ideen des Sabbats im Sonntag zu
verwirklichen. In der Diskussion führte stud. jur. Erlanger aus, dass die
bestehende Form des Sabbatgottesdienstes das Gemüt nicht mehr zu erfassen
imstande sei, und dass eine Reform des Gottesdienstes die Voraussetzung
dafür bilde, dass die Jugend mit größerer Teilnahme sich ihm zuwende." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1930: "Tübingen. Am 6. Mai
sprach Oberlehrer Wochenmark im 'Israelitischen Frauenverein
Tübingen-Reutlingen über 'Die Bedeutung des Sabbats und seine Geschichte'.
Er bezeichnete nach Hermann Cohen den Sabbat als den Schutzengel des
Judentums und zeigte, wie der Sabbat in der Vergangenheit tatsächlich für
die Juden ein Schutzengel gewesen. dass aber dieser Schutzengel in der
Gegenwart die Judenheit zu verlassen droht. Jüdischer Optimismus lässt aber
hoffen, wenigstens die wichtigsten Einrichtungen des Sabbats, seine
häusliche Feier und den öffentlichen Sabbatgottesdienst mit ihren
versittlichenden und erzieherischen Wirkungen neu beleben zu können. Denn
die Geschichte des Sabbats und des Sonntags zeigen, dass dieser den Sabbat
nicht ersetzen kann, dass vielmehr bis auf den heutigen Tag von
nichtjüdischer Seite erstrebt wird, die Ideen des Sabbats im Sonntag zu
verwirklichen. In der Diskussion führte stud. jur. Erlanger aus, dass die
bestehende Form des Sabbatgottesdienstes das Gemüt nicht mehr zu erfassen
imstande sei, und dass eine Reform des Gottesdienstes die Voraussetzung
dafür bilde, dass die Jugend mit größerer Teilnahme sich ihm zuwende." |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Selbständigkeit als Ziel der
Erziehung" (1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Januar 1931: |
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe des Central-Vereins (1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932:
Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die Mischehe im
Judentum" (1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1932: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über "Die jüdische Frau"
(1933)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1933: |
Vortrag im Israelitischen Frauenverein über eine
Palästina-Reise (1934)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. April 1934: "Tübingen. Am 18. März sprach Dr.
Heinz Hayum auf Veranlassung des Jüd. Frauenvereins in ausgezeichneter Weise
über die Eindrücke, die er auf einer Palästina-Reise gewonnen hatte. In
anschaulicher Schilderung entwarf der Redner ein Bild von Land und Leuten.
Er behandelte besonders das Problem der jüdischen Siedlung und zeigte durch
sachliche Kennzeichnung der klimatischen, wirtschaftlichen, politischen,
kulturellen und religiösen Verhältnisse die Schwierigkeiten auf, die der
nach Palästina auswandernde deutsche Jude berücksichtigen muss. Der Redner
betonte, dass für die Besiedlung des Landes nur derjenige in Frage kommen
dürfe, der seine ganze Lebenskraft für die Zukunft des jüdischen Volkes
einsetzen wolle. Die zahlreichen Anwesenden dankten für das Referat mit
lebhaftem Beifall." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. April 1934: "Tübingen. Am 18. März sprach Dr.
Heinz Hayum auf Veranlassung des Jüd. Frauenvereins in ausgezeichneter Weise
über die Eindrücke, die er auf einer Palästina-Reise gewonnen hatte. In
anschaulicher Schilderung entwarf der Redner ein Bild von Land und Leuten.
Er behandelte besonders das Problem der jüdischen Siedlung und zeigte durch
sachliche Kennzeichnung der klimatischen, wirtschaftlichen, politischen,
kulturellen und religiösen Verhältnisse die Schwierigkeiten auf, die der
nach Palästina auswandernde deutsche Jude berücksichtigen muss. Der Redner
betonte, dass für die Besiedlung des Landes nur derjenige in Frage kommen
dürfe, der seine ganze Lebenskraft für die Zukunft des jüdischen Volkes
einsetzen wolle. Die zahlreichen Anwesenden dankten für das Referat mit
lebhaftem Beifall." |
Vortrag mit Syndikus Dr. Julius Weil über den Central-Verein (1934)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1934: |
Vortrag
zum Purimfest mit Heinrich Frankfurter über Erez Israel sowie
Kinder-Purim-Feier (1935)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. April 1935: "Tübingen. Am Purimfest hielt
Heinrich Frankfurter einen sehr instruktiven Lichtbildervortrag über Erez
Israel, der sehr dankbar aufgenommen wurde. — Die Verunstaltung einer
Kinder-Purimfeier, die Hauptlehrer Zivi zu danken ist, war für unsere
Gemeinde etwas völlig Neues. Das Fest, bei dem so viel Schönes und Heiteres
geboten wurde, wurde durch die hervorragende Gastfreundschaft von Familie
Bernheim ermöglicht, der deshalb auch besonderer Dank gebührt." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. April 1935: "Tübingen. Am Purimfest hielt
Heinrich Frankfurter einen sehr instruktiven Lichtbildervortrag über Erez
Israel, der sehr dankbar aufgenommen wurde. — Die Verunstaltung einer
Kinder-Purimfeier, die Hauptlehrer Zivi zu danken ist, war für unsere
Gemeinde etwas völlig Neues. Das Fest, bei dem so viel Schönes und Heiteres
geboten wurde, wurde durch die hervorragende Gastfreundschaft von Familie
Bernheim ermöglicht, der deshalb auch besonderer Dank gebührt." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Dr. Hayum wird zum Obmann des Bürgerausschusses gewählt (1911)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar
1911: "Stuttgart. In Laupheim wurde Direktor Julius Hirsch in den
Bürgerausschuss, dem er schon bisher als Obmann angehörte,
wiedergewählt und in Tübingen Rechtsanwalt Dr. Hayum zum Obmann des
Bürgerausschusses gewählt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 20. Januar
1911: "Stuttgart. In Laupheim wurde Direktor Julius Hirsch in den
Bürgerausschuss, dem er schon bisher als Obmann angehörte,
wiedergewählt und in Tübingen Rechtsanwalt Dr. Hayum zum Obmann des
Bürgerausschusses gewählt." |
Gustav Hirsch wird zum israelitischen Kirchenvorsteher
wiedergewählt (1912)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1912: "Bei der am 29. vorigen Monats in Tübingen
vorgenommenen Wahl eines Kirchenvorstehers wurde das austretende Mitglied,
Herr Gustav Hirsch, mit allen abgegebenen Stimmen wiedergewählt.
Derselbe gehört seit 36 Jahren ununterbrochen dem Kollegium
an". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1912: "Bei der am 29. vorigen Monats in Tübingen
vorgenommenen Wahl eines Kirchenvorstehers wurde das austretende Mitglied,
Herr Gustav Hirsch, mit allen abgegebenen Stimmen wiedergewählt.
Derselbe gehört seit 36 Jahren ununterbrochen dem Kollegium
an". |
Stiftung der Söhne und Töchter des ehemaligen Lehrers
Maier Jacobi für die Tübinger Synagoge (1926)
Anmerkung: es handelt sich um Maier Jacobi (geb. 20.1.1827 in Aufhausen), der
21 Jahre lang Lehrer in Haigerloch war, anschließend 1878 mit seiner Familie
nach Tübingen zog, wo er als Kaufmann tätig war und am 19. Januar 1901
verstorben ist. Er war verheiratet mit Friederike geb. Hirsch aus Haigerloch
(geb. 9. April 1838 in Haigerloch, gest. 3. Juni 1925 in Tübingen). Die Tochter
Johanna (geb. 17. September 1861 in Haigerloch, gest. 5. Oktober 1845 in
England) heiratete am 8. Juli 1885 den Kaufmann Josef Hilb aus Haigerloch (geb.
18. Dezember 1851 in Haigerloch, gest. 13. Januar 1900 in
Ludwigsburg).
Quelle: J. Hahn: Jüdisches Leben in Ludwigsburg S. 406. L. Zapf: Die Tübinger
Juden S. 135-138.
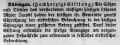 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. April 1926: "Tübingen. (Hochherzige
Stiftung). Die Söhne und Töchter des verstorbenen einstigen hiesigen
Lehrers Maier Jacobi haben der hiesigen israelitischen Gemeinde zwecks
Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in der hiesigen Synagoge einen
größeren Betrag gestiftet. Dank dieser Stiftung erstrahlte die hiesige
Synagoge am vergangenen Pessachfeste zum erstenmale in festlicher
elektrischer Beleuchtung". Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. April 1926: "Tübingen. (Hochherzige
Stiftung). Die Söhne und Töchter des verstorbenen einstigen hiesigen
Lehrers Maier Jacobi haben der hiesigen israelitischen Gemeinde zwecks
Einrichtung der elektrischen Beleuchtung in der hiesigen Synagoge einen
größeren Betrag gestiftet. Dank dieser Stiftung erstrahlte die hiesige
Synagoge am vergangenen Pessachfeste zum erstenmale in festlicher
elektrischer Beleuchtung". |
60. Geburtstag von Rechtsanwalt Dr. Hayum
(1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1927: |
75. Geburtstag von Adolf Dessauer (1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1927: |
80. Geburtstag von Fanny Liebmann, Witwe von Max Liebmann
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Juli 1928: |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1928: |
Zum Tod von Lenchen Dessauer geb. Halle (1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1928: "Tübingen. Am Vortage des
Versöhnungsfestes wurde Frau Lenchen Dessauer geb. Halle unter großer
Beteiligung aus allen Kreisen der Bevölkerung Tübingens und der Umgegend auf
dem israelitischen Waldfriedhof bei Wankheim
zur letzten Ruhe gebettet. Die Verstorbene, eine ebenso kluge wie
bescheidene Frau, war als feingebildete hilfsbereite Persönlichkeit überall
hoch geachtet. In ihrer letztwilligen Verfügung hatte sie gewünscht, dass
die übliche Grabrede bei ihr nicht gehalten werde. Die schlichte Schilderung
ihres Lebens und ein deutsches Gebet brachten dafür dir Gefühle der
Verehrung und Dankbarkeit, die ihre Angehörigen wie ihre vielen Tübinger und
Stuttgarter Freunde für die Entschlafene hegten, zu ergreifendem Ausdruck." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1928: "Tübingen. Am Vortage des
Versöhnungsfestes wurde Frau Lenchen Dessauer geb. Halle unter großer
Beteiligung aus allen Kreisen der Bevölkerung Tübingens und der Umgegend auf
dem israelitischen Waldfriedhof bei Wankheim
zur letzten Ruhe gebettet. Die Verstorbene, eine ebenso kluge wie
bescheidene Frau, war als feingebildete hilfsbereite Persönlichkeit überall
hoch geachtet. In ihrer letztwilligen Verfügung hatte sie gewünscht, dass
die übliche Grabrede bei ihr nicht gehalten werde. Die schlichte Schilderung
ihres Lebens und ein deutsches Gebet brachten dafür dir Gefühle der
Verehrung und Dankbarkeit, die ihre Angehörigen wie ihre vielen Tübinger und
Stuttgarter Freunde für die Entschlafene hegten, zu ergreifendem Ausdruck." |
80. Geburtstag von Gustav Hirsch (1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Tübingen. Am 28.
Oktober dieses Jahres feiert Gustav Hirsch, das älteste Mitglied
unserer Gemeinde, den 80. Geburtstag. Gustav Hirsch, dessen Eltern als die
erste jüdische Familie im Jahre 1852 von
Wankheim nach Tübingen zogen, wurde im Jahre 1877 zum Vorsteher und 1878
zum ehrenamtlichen Gemeindepfleger der Gemeinde Wankheim-Tübingen gewählt
und bekleidete beide Ämter ununterbrochen, auch nachdem 1882 Wankheim in
eine Filial- und Tübingen in die Hauptgemeinde umgewandelt wurde, bis zum
Jahre 1925, wo das hohe Lebensalter ihn zwang, sich von der öffentlichen
Tätigkeit zurückzuziehen. Gustav Hirsch hat sich um die jüdische Gemeinde
Tübingen große Verdienste erworben. Er hat ihr seine Fähigkeiten und seine
Arbeitskraft jahrzehntelang in selbstloser Weise zur Verfügung gestellt. An
der Umwandlung der ursprünglichen Filialgemeinde Tübingen in die
Hauptgemeinde im Jahre 1882 sowie an dem in demselben Jahre erfolgten Bau
der Synagoge in Tübingen hatte er den hervorragendsten Anteil. So verkörpert
Gustav Hirsch ein halbes Jahrhundert Tübinger Gemeindegeschichte, und sein
80. Geburtstag wird nicht nur für ihn und seine Familie, sondern auch für
die ganze Gemeinde ein Freudentag sein. Mögen dem Jubilar noch viele
gesegnete Jahre beschieden sein." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Tübingen. Am 28.
Oktober dieses Jahres feiert Gustav Hirsch, das älteste Mitglied
unserer Gemeinde, den 80. Geburtstag. Gustav Hirsch, dessen Eltern als die
erste jüdische Familie im Jahre 1852 von
Wankheim nach Tübingen zogen, wurde im Jahre 1877 zum Vorsteher und 1878
zum ehrenamtlichen Gemeindepfleger der Gemeinde Wankheim-Tübingen gewählt
und bekleidete beide Ämter ununterbrochen, auch nachdem 1882 Wankheim in
eine Filial- und Tübingen in die Hauptgemeinde umgewandelt wurde, bis zum
Jahre 1925, wo das hohe Lebensalter ihn zwang, sich von der öffentlichen
Tätigkeit zurückzuziehen. Gustav Hirsch hat sich um die jüdische Gemeinde
Tübingen große Verdienste erworben. Er hat ihr seine Fähigkeiten und seine
Arbeitskraft jahrzehntelang in selbstloser Weise zur Verfügung gestellt. An
der Umwandlung der ursprünglichen Filialgemeinde Tübingen in die
Hauptgemeinde im Jahre 1882 sowie an dem in demselben Jahre erfolgten Bau
der Synagoge in Tübingen hatte er den hervorragendsten Anteil. So verkörpert
Gustav Hirsch ein halbes Jahrhundert Tübinger Gemeindegeschichte, und sein
80. Geburtstag wird nicht nur für ihn und seine Familie, sondern auch für
die ganze Gemeinde ein Freudentag sein. Mögen dem Jubilar noch viele
gesegnete Jahre beschieden sein." |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1928: "Tübingen. Der
Rentier Gustav Hirsch konnte hier am 28. Oktober in ungebrochener
Kraft seinen 8O. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist in Wankheim geboren.
Seine Eltern zogen 1852 von dort als die ersten Juden nach Tübingen. 1877
wurde Gustav Hirsch hier zum Vorsteher und im Jahre daraus zum
ehrenamtlichen Gemeindepfleger gewählt. Bis 1925 hat er diese beiden
Ehrenämter in vorbildlicher Treue verwaltet und sich selbstlos allen
Aufgaben seiner Gemeinde gewidmet. Oberlehrer Wochenmark beglückwünschte den
Jubilar an seinem Ehrentage und überreichte ihm die Ehrenurkunde, in welcher
der Oberrat die wertvolle Lebensarbeit des Jubilars dankbar anerkennt." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1928: "Tübingen. Der
Rentier Gustav Hirsch konnte hier am 28. Oktober in ungebrochener
Kraft seinen 8O. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist in Wankheim geboren.
Seine Eltern zogen 1852 von dort als die ersten Juden nach Tübingen. 1877
wurde Gustav Hirsch hier zum Vorsteher und im Jahre daraus zum
ehrenamtlichen Gemeindepfleger gewählt. Bis 1925 hat er diese beiden
Ehrenämter in vorbildlicher Treue verwaltet und sich selbstlos allen
Aufgaben seiner Gemeinde gewidmet. Oberlehrer Wochenmark beglückwünschte den
Jubilar an seinem Ehrentage und überreichte ihm die Ehrenurkunde, in welcher
der Oberrat die wertvolle Lebensarbeit des Jubilars dankbar anerkennt." |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Unter
vielfachen Ehrungen beging unser ältestes männliches Gemeindemitglied
Gustav Hirsch am 28. Oktober seinen 8O. Geburtstag. Am Sabbath, den 27.,
würdigte Oberlehrer Wochenmark in der gottesdienstlichen Ansprache
die Verdienste des Jubilars um das religiöse Leben der Gemeinde. Der
Vorsitzende des Vorsteheramts, Rechtsanwalt Dr. Katz, überbrachte mit einer
Abordnung des Vorsteheramts dem Jubilar eine Ehrengabe der Gemeinde und
übermittelte ihm in einer längeren Ansprache die Glückwünsche und den Dank
der Gemeinde für jahrzehntelange treue Dienste. Der Israelitische Oberrat in
Stuttgart würdigte in einem herzlich gehaltenen Schreiben die Tätigkeit des
Jubilars im Dienste der Gemeinde Tübingen. Der Bürger- und Verkehrsverein
Tübingen, dessen Kassier der Jubilar von 1891 bis 1924 war, ehrte ihn durch
eine schöne Blumenspende und eine herzliche Zuschrift. Unter den vielen
Glückwunschschreiben befand sich auch ein solches des hiesigen
Oberbürgermeisters und Landtagsabgeordneten Scheef." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Unter
vielfachen Ehrungen beging unser ältestes männliches Gemeindemitglied
Gustav Hirsch am 28. Oktober seinen 8O. Geburtstag. Am Sabbath, den 27.,
würdigte Oberlehrer Wochenmark in der gottesdienstlichen Ansprache
die Verdienste des Jubilars um das religiöse Leben der Gemeinde. Der
Vorsitzende des Vorsteheramts, Rechtsanwalt Dr. Katz, überbrachte mit einer
Abordnung des Vorsteheramts dem Jubilar eine Ehrengabe der Gemeinde und
übermittelte ihm in einer längeren Ansprache die Glückwünsche und den Dank
der Gemeinde für jahrzehntelange treue Dienste. Der Israelitische Oberrat in
Stuttgart würdigte in einem herzlich gehaltenen Schreiben die Tätigkeit des
Jubilars im Dienste der Gemeinde Tübingen. Der Bürger- und Verkehrsverein
Tübingen, dessen Kassier der Jubilar von 1891 bis 1924 war, ehrte ihn durch
eine schöne Blumenspende und eine herzliche Zuschrift. Unter den vielen
Glückwunschschreiben befand sich auch ein solches des hiesigen
Oberbürgermeisters und Landtagsabgeordneten Scheef." |
Rechtsanwalt Dr. Hayum wurde in den Gemeinderat der Stadt gewählt
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Dezember 1928: |
25-jähriges Bestehen der "Tübinger Chronik" unter Verleger Albert
Weil (1929)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1929: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Januar 1929: |
Der Verlag der "Tübinger Chronik" (Albert Weil)
geht in den Besitz von Dr. Höhn in Ulm über
(1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1931: |
Silberne Hochzeit von Jakob Oppenheimer und Karoline geb. Seemann
(1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Januar 1931: |
60. Geburtstag von Bankier Siegmund Weil
(1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Oktober 1931: "Tübingen. Am 2. Oktober
durfte unser Gemeindemitglied Bankier Siegmund Weil seinen 60.
Geburtstag begehen. Zwar hatte sich der Jubilar durch eine Reise jeder
Ehrung entzogen; die 'Tübinger Chronik' widmete ihm jedoch einen ehrenden
Glückwunschartikel, in dem es u. a. heißt: 'Als tüchtiger, hervorragender
Geschäftsmann erfreut sich Siegmund Weil hohen Ansehens in weiten Kreisen,
wo man ihm unbedingtes Vertrauen entgegenbringt, was sich namentlich in der
letzten Zeit der Geld- und Wirtschaftskrise gezeigt hat. Gewerbe und Handel
nehmen freudigen Anteil an dem 60. Geburtstag Siegmund Weils, dessen Bank
für sie eine Lebensfrage ist. Trotz aller Vorsicht und Umsicht. die ein
Bankier bei seinen Geldaktionen walten lassen muss, lässt sich Siegmund Weil
doch auch von sozial-menschlichen Gesichtspunkten leiten, wie überhaupt sein
und seiner Gemahlin stets offenes Herz für Wohltätigkeit rühmlichst
anerkannt werden muss.' Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Oktober 1931: "Tübingen. Am 2. Oktober
durfte unser Gemeindemitglied Bankier Siegmund Weil seinen 60.
Geburtstag begehen. Zwar hatte sich der Jubilar durch eine Reise jeder
Ehrung entzogen; die 'Tübinger Chronik' widmete ihm jedoch einen ehrenden
Glückwunschartikel, in dem es u. a. heißt: 'Als tüchtiger, hervorragender
Geschäftsmann erfreut sich Siegmund Weil hohen Ansehens in weiten Kreisen,
wo man ihm unbedingtes Vertrauen entgegenbringt, was sich namentlich in der
letzten Zeit der Geld- und Wirtschaftskrise gezeigt hat. Gewerbe und Handel
nehmen freudigen Anteil an dem 60. Geburtstag Siegmund Weils, dessen Bank
für sie eine Lebensfrage ist. Trotz aller Vorsicht und Umsicht. die ein
Bankier bei seinen Geldaktionen walten lassen muss, lässt sich Siegmund Weil
doch auch von sozial-menschlichen Gesichtspunkten leiten, wie überhaupt sein
und seiner Gemahlin stets offenes Herz für Wohltätigkeit rühmlichst
anerkannt werden muss.'
Mit vielen wünschen auch wir dem Jubilar noch viele Jahre in Gesundheit und
Schaffensfreude zum Wohle seiner Familie und der Gesamtheit!" |
70. Geburtstag von Johanna Hilb geb. Jacobi und gleichfalls 70. Geburtstag von
Emma Seemann geb. Fleischmann (1931)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Dezember 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Dezember 1931: |
70. Geburtstag von Albert Weil (1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Februar 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Februar 1932: |
Zum Tod von Synagogenverwalter Elias Wassermann (1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1932: |
Silberne Hochzeit von Leopold Hirsch und Johanna geb. Rothschild
(1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1932: "Tübingen. Am 15.
Oktober feierten Leopold Hirsch und seine Ehefrau Johanna geb.
Rothschild unter freudiger Anteilnahme der ganzen Gemeinde das Fest der
Silbernen Hochzeit. Die allgemeine Wertschätzung, die das Jubelpaar
genießt — Leopold Hirsch wurde vor kurzem zum Mitglied des Vorsteheramts
gewählt und die Jubilarin versieht seit Jahren in vorbildlicher Weise das
Amt einer Schatzmeisterin des Synagogenchor-Vereins — kam auch dadurch zu
besonderem Ausdruck, dass es beim Gottesdienst durch eine Ansprache des
Religionsoberlehrers Wochenmark und durch den Gesang des
Synagogenchores geehrt wurde. Mögen dem Jubelpaar noch viele Jahre
beglückender Gemeinsamkeit im Kreise seiner Kinder vergönnt sein!" Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. November 1932: "Tübingen. Am 15.
Oktober feierten Leopold Hirsch und seine Ehefrau Johanna geb.
Rothschild unter freudiger Anteilnahme der ganzen Gemeinde das Fest der
Silbernen Hochzeit. Die allgemeine Wertschätzung, die das Jubelpaar
genießt — Leopold Hirsch wurde vor kurzem zum Mitglied des Vorsteheramts
gewählt und die Jubilarin versieht seit Jahren in vorbildlicher Weise das
Amt einer Schatzmeisterin des Synagogenchor-Vereins — kam auch dadurch zu
besonderem Ausdruck, dass es beim Gottesdienst durch eine Ansprache des
Religionsoberlehrers Wochenmark und durch den Gesang des
Synagogenchores geehrt wurde. Mögen dem Jubelpaar noch viele Jahre
beglückender Gemeinsamkeit im Kreise seiner Kinder vergönnt sein!" |
80. Geburtstag von Adolf Dessauer (1932)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Juni 1932: |
Zum Tod von Gustav Hirsch (1933)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1933: "Tübingen. Am 16. September
verschied das älteste Mitglied unserer Gemeinde. Gustav Hirsch, im
84. Lebensjahre. Hirsch war eine in allen Kreisen hoch geachtete
Persönlichkeit. Besondere Verdienste hat er sich um die Gemeinde
Tübingen erworben. Von 1876 - 1924 war er ununterbrochen Vorsteher und
Gemeindepfleger zuerst der Gemeinde Wankheim und seit 1882 der Gemeinde
Tübingen, deren eifriger Mitbegründer er war. Seiner Tatkraft hat die
hiesige» Gemeinde hauptsächlich ihre schöne Synagoge zu verdanken. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1933: "Tübingen. Am 16. September
verschied das älteste Mitglied unserer Gemeinde. Gustav Hirsch, im
84. Lebensjahre. Hirsch war eine in allen Kreisen hoch geachtete
Persönlichkeit. Besondere Verdienste hat er sich um die Gemeinde
Tübingen erworben. Von 1876 - 1924 war er ununterbrochen Vorsteher und
Gemeindepfleger zuerst der Gemeinde Wankheim und seit 1882 der Gemeinde
Tübingen, deren eifriger Mitbegründer er war. Seiner Tatkraft hat die
hiesige» Gemeinde hauptsächlich ihre schöne Synagoge zu verdanken.
Bei der Beerdigung Gustav Hirschs kam noch einmal die Liebe und Verehrung
zum Ausdruck, die der Entschlafene überall genoss. Oberlehrer Dr.
Wochenmark und Vorsteher Dr. Katz rühmten die hohen Verdienste
des Verstorbenen mit trefflichen Worten. Auch Bezirksrabbiner Dr.
Schweizer widmete dem verdienten Manne dankbar«» Abschiedsworte. Sein
Andenken wird stets in hohen Ehren gehalten werden." |
Zum Tod von Emma Seemann geb. Fleischmann (1934)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1934: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. März 1934: |
75.
Geburtstag von Salomo Spiro (1934)
 Artikel
in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1934: "Tübingen. Am 15.
Juli beging unser Gemeindemitglied Salomo Spiro aus Reutlingen in
voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar, der sich in allen
Kreisen der Bevölkerung wegen seines ehrenhaften Charakters und
bescheidenen Wesens hoher Achtung erfreut, hat sich um die Gemeinde
besonders dadurch verdient gemacht, dass er seit langen Jahren an den
Hohen Feiertagen das Ehrenamt des Hilfsvorbeters versieht. Das
Vorsteheramt hat Salomo Spiro herzliche Glückwünsche und besonderen Dank
für die der Gemeinde geleisteten trefflichen Dienste zum Ausdruck
gebracht. - Auch wir entbieten dem Jubilar unsere besten
Wünsche!" Artikel
in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1934: "Tübingen. Am 15.
Juli beging unser Gemeindemitglied Salomo Spiro aus Reutlingen in
voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar, der sich in allen
Kreisen der Bevölkerung wegen seines ehrenhaften Charakters und
bescheidenen Wesens hoher Achtung erfreut, hat sich um die Gemeinde
besonders dadurch verdient gemacht, dass er seit langen Jahren an den
Hohen Feiertagen das Ehrenamt des Hilfsvorbeters versieht. Das
Vorsteheramt hat Salomo Spiro herzliche Glückwünsche und besonderen Dank
für die der Gemeinde geleisteten trefflichen Dienste zum Ausdruck
gebracht. - Auch wir entbieten dem Jubilar unsere besten
Wünsche!" |
Berichte
zu jüdischen Studierenden und Professoren
Bericht über die Prüfung jüdischer Studierender an der Universität (1836)
Der Bericht erschien in "Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische
Theologie" 1836 Heft 1 S. 192-195:
eingestellt als pdf-Datei
Aus dem Semesterprogramm der Universität (1846)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. April 1846: "2. April.
An unserer Landesuniversität werden nächstes Sommerhalbjahr unter
Anderem folgende Vorlesungen gehalten: Geschichte der hebräischen
Nationalliteratur, alttestamentliche Interpretations-Übungen, Erklärung
des Deutero-Jesaja und ausgewählter Psalmen, arabische, aramäische, Zend-
und neupersische Sprache. Die Hochschule besuchen gegenwärtig 9
Israeliten. Die israelitischen Studierenden dort bilden schon seit
mehreren Jahren einen Verein, der die besseren jüdischen Tagblätter, und
sonstige, auf diesem Gebiet erscheinende Schriften liest." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. April 1846: "2. April.
An unserer Landesuniversität werden nächstes Sommerhalbjahr unter
Anderem folgende Vorlesungen gehalten: Geschichte der hebräischen
Nationalliteratur, alttestamentliche Interpretations-Übungen, Erklärung
des Deutero-Jesaja und ausgewählter Psalmen, arabische, aramäische, Zend-
und neupersische Sprache. Die Hochschule besuchen gegenwärtig 9
Israeliten. Die israelitischen Studierenden dort bilden schon seit
mehreren Jahren einen Verein, der die besseren jüdischen Tagblätter, und
sonstige, auf diesem Gebiet erscheinende Schriften liest." |
Bericht über die jüdischen
Studierenden (1852)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November 1852: "Die
Hochschule in Tübingen ist gegenwärtig stark von Israeliten
frequentiert, doch interessieren sich dieselben weniger für das Judentum,
als die früheren. Die Promotion aus den Jahren 1837 bis 1842 hat jüngst
eine Zusammenkunft gehabt, bei der besonders die Tagesfragen des Judentums
zur Sprache kamen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die gelehrten
Israeliten von Beruf in Württemberg sich lebhaft an der Gestaltung der
Synagoge beteiligen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November 1852: "Die
Hochschule in Tübingen ist gegenwärtig stark von Israeliten
frequentiert, doch interessieren sich dieselben weniger für das Judentum,
als die früheren. Die Promotion aus den Jahren 1837 bis 1842 hat jüngst
eine Zusammenkunft gehabt, bei der besonders die Tagesfragen des Judentums
zur Sprache kamen. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, dass die gelehrten
Israeliten von Beruf in Württemberg sich lebhaft an der Gestaltung der
Synagoge beteiligen." |
Lehrer Alexander Elsässer
(Jebenhausen) weist auf
Besprechungen einer Schrift von Professor Dr. Leopold Pfeiffer hin (1859)
Anmerkung: Dr. jur. Leopold Pfeiffer (geb. 25. Oktober 1821 in Weikersheim,
gest. 4. November 1881 in Tübingen), war seit 1851 bis zu seinem Tod
1881 Rechtslehrer (außerordentlicher Professor) an der Universität Tübingen
(im Bereich Zivilprozess und Strafprozess in Verbindung mit Strafrecht;
veröffentlichte wichtige rechtswissenschaftliche Arbeiten; wohnte in Tübingen
am Hirschauer Tor, Neckarhalde 27). War seit 1860 verheiratet mit Jeanette geb.
Ezechiels (geb. 28. Juli 1829 in Rotterdam, gest. 20. März 1915 in Tübingen).
Leopold und Jeanette Pfeiffer wurden im israelitischen
Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart beigesetzt; ihre Gräber sind erhalten.
Literatur: Joachim Hahn: Pragfriedhof Stuttgart, israelitischer Teil S. 167;
Lilli Zapf: Die Tübinger Juden. 1978² S. 31ff.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. September 1859: "Jebenhausen,
im September (1859). Schon früher haben wir auf die Schrift von Professor
Dr. Leopold Pfeiffer in Tübingen: 'Das gemeine deutsche
Strafrecht der Gegenwart, 1. Abteilung, Tübingen, Laupp, XIX. u. 415 S.
gr. 8' aufmerksam gemacht, den Fachmännern das Urteil über dieselbe
überlassend; wir sind jetzt in der Lage, auf gewichtige anerkennende
Urteile über diese juridisch bedeutende Schrift hinzuweisen. Gersdorfs
Repertorium in dem ersten Hefte, die Jahrbücher der deutschen
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung von Dr. H. Z. Schletter V. Band
2. Heft, Erlangen, bringen letztere, S. 124 von Geheimjustizrat Dr.
Krug rühmliche Kritiken über dieses Werk. Dr. Julius Friedrich Heinrich
Abegg stellt in seiner neulichst erschienenen Schrift: 'Die
Berechtigung der deutschen Strafrechtswissenschaft der Gegenwart' das
Werk Pfeiffers dem von Wächters rühmlich an die Seite, rühmt die
scharfsinnige Auffassung und stellt dem II. positiven teil ein günstiges
Prognostikon. - Herr Professor Dr. Pfeiffer hat sei seiner Lehr- und
literarischen Tätigkeit sein Herz für jüdische Literatur und
israelitisches Leben offen behalten und folgt mit besonders warmem
Interesse den Kundgebungen des jüdischen Literaturvereins, dessen
Mitglied er ist. Auch Nichtjuristen werden in seinem neuesten Werke seine
philosophische und juridisch-historische Durchbildung leicht erkennen; der
positive 2. Teil seines Werkes, der demnächst erscheint, dürfte Epoche
in der deutschen Strafrechtsliteratur machen und werden wir seinerzeit
wieder in diesen Spalten darüber Bericht erstatten. A. Elsässer." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 26. September 1859: "Jebenhausen,
im September (1859). Schon früher haben wir auf die Schrift von Professor
Dr. Leopold Pfeiffer in Tübingen: 'Das gemeine deutsche
Strafrecht der Gegenwart, 1. Abteilung, Tübingen, Laupp, XIX. u. 415 S.
gr. 8' aufmerksam gemacht, den Fachmännern das Urteil über dieselbe
überlassend; wir sind jetzt in der Lage, auf gewichtige anerkennende
Urteile über diese juridisch bedeutende Schrift hinzuweisen. Gersdorfs
Repertorium in dem ersten Hefte, die Jahrbücher der deutschen
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung von Dr. H. Z. Schletter V. Band
2. Heft, Erlangen, bringen letztere, S. 124 von Geheimjustizrat Dr.
Krug rühmliche Kritiken über dieses Werk. Dr. Julius Friedrich Heinrich
Abegg stellt in seiner neulichst erschienenen Schrift: 'Die
Berechtigung der deutschen Strafrechtswissenschaft der Gegenwart' das
Werk Pfeiffers dem von Wächters rühmlich an die Seite, rühmt die
scharfsinnige Auffassung und stellt dem II. positiven teil ein günstiges
Prognostikon. - Herr Professor Dr. Pfeiffer hat sei seiner Lehr- und
literarischen Tätigkeit sein Herz für jüdische Literatur und
israelitisches Leben offen behalten und folgt mit besonders warmem
Interesse den Kundgebungen des jüdischen Literaturvereins, dessen
Mitglied er ist. Auch Nichtjuristen werden in seinem neuesten Werke seine
philosophische und juridisch-historische Durchbildung leicht erkennen; der
positive 2. Teil seines Werkes, der demnächst erscheint, dürfte Epoche
in der deutschen Strafrechtsliteratur machen und werden wir seinerzeit
wieder in diesen Spalten darüber Bericht erstatten. A. Elsässer."
|
Antrittsrede von Prof. Dr. Gundelfinger (1874)
Anmerkung: es handelt sich um Prof. Dr. Sigmund Gundelfinger (geb. 1846 in
Kirchberg an der Jagst, gest. 1910 in Darmstadt): war seit 1869 Privatdezent an
der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen, seit 1874
außerordentlicher Professor der Mathematik; 1879 wurde er an die Technische
Hochschule in Darmstadt berufen. War zu seiner Zeit einer der bedeutendsten
Mathematiker Deutschlands.
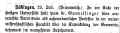 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. August 1874: "Tübingen, 23. Juli (1874).
In der Aula der hiesigen Universität hielt heute Dr. Gundelfinger seine
akademische Antrittsrede als außerordentlicher Professor in der
naturwissenschaftlichen Fakultät über die Entwicklung der Geometrie,
besonders im 19. Jahrhundert."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. August 1874: "Tübingen, 23. Juli (1874).
In der Aula der hiesigen Universität hielt heute Dr. Gundelfinger seine
akademische Antrittsrede als außerordentlicher Professor in der
naturwissenschaftlichen Fakultät über die Entwicklung der Geometrie,
besonders im 19. Jahrhundert." |
Ehrendoktorate der Universität für
jüdische Forscher (1877)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1877: "Tübingen,
9. August (1877). Wie bekannt, feiert in diesen Tagen die hiesige
Universität ihr 400jähriges Jubelfest. Wie es Sitte ist, wurde bei
dieser Gelegenheit eine Anzahl ausgezeichneter Männer zu Ehrendoktoren
kreiert. Hierzu gehörten diesmal auch zwei Israeliten: Professor
Ferdinand Cohn (Botaniker) in Breslau und Bernstein (als Naturforscher und
populär-naturwissenschaftlicher Schriftsteller) in Berlin. Der von
einigen Judenfeinden schon mehrere Male wiederholte Vorwurf, dass die
Juden auf naturwissenschaftlichem Gebiete nichts leisteten ist hierdurch
abermals widerlegt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. August 1877: "Tübingen,
9. August (1877). Wie bekannt, feiert in diesen Tagen die hiesige
Universität ihr 400jähriges Jubelfest. Wie es Sitte ist, wurde bei
dieser Gelegenheit eine Anzahl ausgezeichneter Männer zu Ehrendoktoren
kreiert. Hierzu gehörten diesmal auch zwei Israeliten: Professor
Ferdinand Cohn (Botaniker) in Breslau und Bernstein (als Naturforscher und
populär-naturwissenschaftlicher Schriftsteller) in Berlin. Der von
einigen Judenfeinden schon mehrere Male wiederholte Vorwurf, dass die
Juden auf naturwissenschaftlichem Gebiete nichts leisteten ist hierdurch
abermals widerlegt." |
Duell zwischen jüdischem und
nichtjüdischem Studenten mit tödlichem Ausgang (1880)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November 1880: "Tübingen,
15. November (1880). Die abscheuliche Anstachelung der niedrigsten
Leidenschaften gegen die Juden in Deutschland bringen immer traurigere Früchte
hervor. Kaum dass die Kunde von dem Duell in Hanau sich verbreitet hat,
und es ist von hier aus von einem gleichen Vorfall zu berichten. Die
Duellanten waren der Student Karl Grimm aus Brück in Brandenburg und
Tykociner aus Warschau. Der Erstere hatte sich eine Provokation des
Letzteren, der Jude ist, zu Schulden kommen lassen. Beim Duell schoss
Tykociner den Grimm mitten ins Herz. Tykociner wurde, nachdem er sich
freiwillig dem Gerichte gestellt hatte, gegen eine Kaution von 2.000 Mark
auf freien Fuß gelassen, aber bald hernach wieder verhaftet." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. November 1880: "Tübingen,
15. November (1880). Die abscheuliche Anstachelung der niedrigsten
Leidenschaften gegen die Juden in Deutschland bringen immer traurigere Früchte
hervor. Kaum dass die Kunde von dem Duell in Hanau sich verbreitet hat,
und es ist von hier aus von einem gleichen Vorfall zu berichten. Die
Duellanten waren der Student Karl Grimm aus Brück in Brandenburg und
Tykociner aus Warschau. Der Erstere hatte sich eine Provokation des
Letzteren, der Jude ist, zu Schulden kommen lassen. Beim Duell schoss
Tykociner den Grimm mitten ins Herz. Tykociner wurde, nachdem er sich
freiwillig dem Gerichte gestellt hatte, gegen eine Kaution von 2.000 Mark
auf freien Fuß gelassen, aber bald hernach wieder verhaftet." |
Zum Tod von Prof. Dr. Leopold
Pfeiffer (1821-1881)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1881: "Tübingen, 4.
November (1881). Prof. Dr. Pfeiffer hier wurde heute Morgen nach 9 Uhr im
Lesezimmer des Museums vom Schlage gerührt und war sofort tot. Der so jäh
aus dem Leben Geschiedene gehörte der juristischen Fakultät seit einer
Reihe von Jahren als außerordentlicher Professor an. Am vorigen Montag
wurde der Verstorbene auf dem israelitischen Friedhofe in Stuttgart vom
Bahnhofe aus beerdigt. Es hatten sich zu der ernsten Feier u.a.
Ministerialdirektor Dr. v. Silcher, Landesgerichtsdirektor von Firnhaber,
Staatsanwalt Schönhardt und jüngere Justizbeamte, welche Schüler des
Verstorbenen waren, eingefunden. Die gesamte israelitische Oberkirchenbehörde
war im Leichengefolge und Kirchenrat Rabbiner Dr. Wassermann hielt die
Grabrede, in welcher er darauf hinwies, wie eifrig der Verstorbene
bestrebt gewesen sei, seiner Religion Achtung zu verschaffen, wie er aber
auch jede andere Religion hochgehalten habe. Aus der Lebensskizze, die der
Redner entwarf, entnehmen wir, dass Pfeiffer am 25. Oktober 1821 in
Weikersheim geboren wurde. Das Studium der Jurisprudenz, welches er erwählt,
absolvierte er an den Universitäten Berlin und Tübingen, 1861
verheiratete er sich. An der Landesuniversität war er als Privatdozent,
später außerordentlicher Professor viele Jahre tätig. Hebräisch Gebet
und Segen schloss die Feier, welche auf Wunsch des Dahingeschiedenen ohne
jeglichen Pomp gehalten war. Er war ein Freund und Wohltäter vieler
Studenten an der Landesuniversität. Die Familie ist reich und kinderlos.
Merkwürdig ist, dass Prof. Pfeiffer am gleichen Tag wie sein Vater der
Kommerzienrat vor 44 Jahren gestorben und am gleichen Tag wie seine Mutter
vor 47 Jahren beerdigt worden ist. Seligen
Andenkens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1881: "Tübingen, 4.
November (1881). Prof. Dr. Pfeiffer hier wurde heute Morgen nach 9 Uhr im
Lesezimmer des Museums vom Schlage gerührt und war sofort tot. Der so jäh
aus dem Leben Geschiedene gehörte der juristischen Fakultät seit einer
Reihe von Jahren als außerordentlicher Professor an. Am vorigen Montag
wurde der Verstorbene auf dem israelitischen Friedhofe in Stuttgart vom
Bahnhofe aus beerdigt. Es hatten sich zu der ernsten Feier u.a.
Ministerialdirektor Dr. v. Silcher, Landesgerichtsdirektor von Firnhaber,
Staatsanwalt Schönhardt und jüngere Justizbeamte, welche Schüler des
Verstorbenen waren, eingefunden. Die gesamte israelitische Oberkirchenbehörde
war im Leichengefolge und Kirchenrat Rabbiner Dr. Wassermann hielt die
Grabrede, in welcher er darauf hinwies, wie eifrig der Verstorbene
bestrebt gewesen sei, seiner Religion Achtung zu verschaffen, wie er aber
auch jede andere Religion hochgehalten habe. Aus der Lebensskizze, die der
Redner entwarf, entnehmen wir, dass Pfeiffer am 25. Oktober 1821 in
Weikersheim geboren wurde. Das Studium der Jurisprudenz, welches er erwählt,
absolvierte er an den Universitäten Berlin und Tübingen, 1861
verheiratete er sich. An der Landesuniversität war er als Privatdozent,
später außerordentlicher Professor viele Jahre tätig. Hebräisch Gebet
und Segen schloss die Feier, welche auf Wunsch des Dahingeschiedenen ohne
jeglichen Pomp gehalten war. Er war ein Freund und Wohltäter vieler
Studenten an der Landesuniversität. Die Familie ist reich und kinderlos.
Merkwürdig ist, dass Prof. Pfeiffer am gleichen Tag wie sein Vater der
Kommerzienrat vor 44 Jahren gestorben und am gleichen Tag wie seine Mutter
vor 47 Jahren beerdigt worden ist. Seligen
Andenkens." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1881: "Aus Württemberg,
12. November (1881). Am 4. dieses Monats starb in Tübingen im Lesezimmer
des Museums unerwartet schnell, vom Schlage gerührt, Prof. Dr. jur.
Leopold Pfeiffer, der einzige akademische Lehrer jüdischen Glaubens in Württemberg,
der mehrere Jahrzehnte lang an dieser Hochschule gewirkt hat. Seiner
Majestät unser König ließ sogleich nach der Todesnachricht der Fakultät
sowohl als der Familie seine Teilnahme bezeigen. Am 7. November fand die
Überführung der Leiche nach Stuttgart statt. Ein fast endloser Zug von
Leidtragenden, darunter sämtliche Professoren der Universität und sämtliche
studentische Korporationen, gab dem Dahingeschiedenen das Ehrengeleite bis
zum Bahnhofe. Die Militärkapelle spiele den 'Wal'schen Trauermarsch
und den Choral: 'Süß und ruhig ist der Schlummer.' Der Verstorbene,
welcher sich neben seiner erfolgreichen Wirksamkeit als akademischer
Lehrer in seinem privaten Leben namentlich durch einen seltenen Grad von
Mildtätigkeit, auszeichnete, war in Tübingen eine sehr populäre Persönlichkeit.
Die Beerdigung fand in Stuttgart statt. Die Leiche wurde vom Bahnhof aus
mit einer langen Wagenreihe nach dem israelitischen Kirchhofe gebracht und
auf Wunsch des Verstorbenen ohne größere Feier zur Erde bestattet.
Rabbiner Dr. Wassermann hielt die Grabrede. Unter der Verstammlung
bemerkte man Ministerialdirektor Dr. Silcher, Oberlandesgerichtsdirektor
Firnhaber, viele Juristen und Beamte, die Mitglieder der Israelitischen
Oberkirchenbehörde, die Mitglieder der Familie Kaulla und anderer
hervorragender israelitischer Familien. Pfeifer war am 21. Oktober 1821 in
Weikersheim geboren und erreichte somit das 60. Lebensjahr. Der 4. und 7.
November, sein Todes und Begräbnistag, waren längst Trauertage in seiner
Familie, denn am 4. November vor 41 Jahren starb sein Vater, am 7.
November vor 47 Jahren wurde seine Mutter begraben. Seine Ausbildung
erhielt Dr. Pfeiffer auf den Gymnasien in Mannheim, in Stuttgart und auf
den Universitäten in Tübingen und Berlin. Für seine Glaubensgenossen
zeigte Dr. Pfeiffer stets das regeste Interesse und beteiligte sich bei
allen Angelegenheiten der sich erst neu gebildeten israelitischen Gemeinde
Tübingen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. November 1881: "Aus Württemberg,
12. November (1881). Am 4. dieses Monats starb in Tübingen im Lesezimmer
des Museums unerwartet schnell, vom Schlage gerührt, Prof. Dr. jur.
Leopold Pfeiffer, der einzige akademische Lehrer jüdischen Glaubens in Württemberg,
der mehrere Jahrzehnte lang an dieser Hochschule gewirkt hat. Seiner
Majestät unser König ließ sogleich nach der Todesnachricht der Fakultät
sowohl als der Familie seine Teilnahme bezeigen. Am 7. November fand die
Überführung der Leiche nach Stuttgart statt. Ein fast endloser Zug von
Leidtragenden, darunter sämtliche Professoren der Universität und sämtliche
studentische Korporationen, gab dem Dahingeschiedenen das Ehrengeleite bis
zum Bahnhofe. Die Militärkapelle spiele den 'Wal'schen Trauermarsch
und den Choral: 'Süß und ruhig ist der Schlummer.' Der Verstorbene,
welcher sich neben seiner erfolgreichen Wirksamkeit als akademischer
Lehrer in seinem privaten Leben namentlich durch einen seltenen Grad von
Mildtätigkeit, auszeichnete, war in Tübingen eine sehr populäre Persönlichkeit.
Die Beerdigung fand in Stuttgart statt. Die Leiche wurde vom Bahnhof aus
mit einer langen Wagenreihe nach dem israelitischen Kirchhofe gebracht und
auf Wunsch des Verstorbenen ohne größere Feier zur Erde bestattet.
Rabbiner Dr. Wassermann hielt die Grabrede. Unter der Verstammlung
bemerkte man Ministerialdirektor Dr. Silcher, Oberlandesgerichtsdirektor
Firnhaber, viele Juristen und Beamte, die Mitglieder der Israelitischen
Oberkirchenbehörde, die Mitglieder der Familie Kaulla und anderer
hervorragender israelitischer Familien. Pfeifer war am 21. Oktober 1821 in
Weikersheim geboren und erreichte somit das 60. Lebensjahr. Der 4. und 7.
November, sein Todes und Begräbnistag, waren längst Trauertage in seiner
Familie, denn am 4. November vor 41 Jahren starb sein Vater, am 7.
November vor 47 Jahren wurde seine Mutter begraben. Seine Ausbildung
erhielt Dr. Pfeiffer auf den Gymnasien in Mannheim, in Stuttgart und auf
den Universitäten in Tübingen und Berlin. Für seine Glaubensgenossen
zeigte Dr. Pfeiffer stets das regeste Interesse und beteiligte sich bei
allen Angelegenheiten der sich erst neu gebildeten israelitischen Gemeinde
Tübingen." |
Prof. von
Martitz spricht sich für Juden als
"gute Deutsche" aus (1886)
Anmerkung: die Links bei den Personennamen führen zu Wikipedia-Artikeln.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juli
1886: "Tübingen, 20. Juni (1886). Wenn man Gelegenheit gehabt
hat, zu hören, wie ein Treitschke (sc. Heinrich
von Treitschke) und in früheren Jahren ein Ad. Wagner (ca. Adolph Wagner) (wir bemerken gerne , dass Wagner in neuerer Zeit sich
immer mehr das Vergnügen versagt, in seinen Vorlesungen Antisemitik zu
treiben, und dass er sich einen gewissen Grad von Objektivität anzueignen
bestrebt ist) von dem Katheder herab vor einem gläubigen Auditorium ihr
Anathema gegen die jüdische Rasse schleuderten und wie sie uns Juden das
deutsche Bürgerrecht absprachen, so berührt es doppelt angenehm, von
einer ähnlichen Stelle aus gerade das Gegenteil zu vernehmen. In seiner
Vorlesung über 'Allgemeines Staatsrecht und Politik' kam vor einiger Zeit
der hiesige Professor Dr. von Martitz (sc. Ferdinand
von Martitz) auf die Frage zu sprechen: Sind die
Juden Deutsche oder bilden sie eine eigene Nation? Mit aller
Entschiedenheit vertrat er seine Ansicht, dass die Juden ebenso gute
Deutsche wie die Anhänger jeder anderen Konfession in Deutschland sind,
und dass die Behauptung des Gegenteils eine tendenziöse Einstellung sei,
die leider bei dem steigenden Nationalitätsprinzipe unserer Zeit in
unserem Jahrhundert zum dritten Mal wiederkehren. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juli
1886: "Tübingen, 20. Juni (1886). Wenn man Gelegenheit gehabt
hat, zu hören, wie ein Treitschke (sc. Heinrich
von Treitschke) und in früheren Jahren ein Ad. Wagner (ca. Adolph Wagner) (wir bemerken gerne , dass Wagner in neuerer Zeit sich
immer mehr das Vergnügen versagt, in seinen Vorlesungen Antisemitik zu
treiben, und dass er sich einen gewissen Grad von Objektivität anzueignen
bestrebt ist) von dem Katheder herab vor einem gläubigen Auditorium ihr
Anathema gegen die jüdische Rasse schleuderten und wie sie uns Juden das
deutsche Bürgerrecht absprachen, so berührt es doppelt angenehm, von
einer ähnlichen Stelle aus gerade das Gegenteil zu vernehmen. In seiner
Vorlesung über 'Allgemeines Staatsrecht und Politik' kam vor einiger Zeit
der hiesige Professor Dr. von Martitz (sc. Ferdinand
von Martitz) auf die Frage zu sprechen: Sind die
Juden Deutsche oder bilden sie eine eigene Nation? Mit aller
Entschiedenheit vertrat er seine Ansicht, dass die Juden ebenso gute
Deutsche wie die Anhänger jeder anderen Konfession in Deutschland sind,
und dass die Behauptung des Gegenteils eine tendenziöse Einstellung sei,
die leider bei dem steigenden Nationalitätsprinzipe unserer Zeit in
unserem Jahrhundert zum dritten Mal wiederkehren.
Wir wünschen nur, dass die anwesenden Zuhörer von dieser Äußerung
ebenso Notiz genommen hätten, wie dies bei gegenteiligen über diesen
Gegenstand der fall ist und war, und in ihrem künftigen Berufe als Beamte
etc. von der Berechtigung unseres Verlangens, als jüdische Deutsche und
nicht als deutsche Juden behandelt zu werden, überzeugt sein
möchten." |
Erneuerung des Doktor-Diploms für
Gustav Weyl und Jacob Auerbach (1887)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Februar 1887: "Die
Universität Tübingen hat den Herren Gustav Weyl in Heidelberg und Jacob
Auerbach in Frankfurt am Main das ihnen vor 50 Jahren erteilte
Doktordiplom erneuert." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Februar 1887: "Die
Universität Tübingen hat den Herren Gustav Weyl in Heidelberg und Jacob
Auerbach in Frankfurt am Main das ihnen vor 50 Jahren erteilte
Doktordiplom erneuert." |
Antijüdische Beschlüsse der Satisfaktion gebenden Korporationen der
Studentenschaft (1904)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Februar 1904: "In Tübingen
hat die Studentenschaft in einer Vertreterversammlung sämtlicher
Satisfaktion gebender Korporationen den Beschluss gefasst, keinem Angehörigen
einer jüdischen Verbindung mehr Satisfaktion zu geben. Schon vor einiger
Zeit war eine Bitte an das Universitätsamt gerichtet worden, eine jüdische
Verbindung nicht zu genehmigen. Das Universitätsamt hatte sich aber dahin
ausgesprochen, der etwaigen Gründung einer solche nichts in den Weg zu
legen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Februar 1904: "In Tübingen
hat die Studentenschaft in einer Vertreterversammlung sämtlicher
Satisfaktion gebender Korporationen den Beschluss gefasst, keinem Angehörigen
einer jüdischen Verbindung mehr Satisfaktion zu geben. Schon vor einiger
Zeit war eine Bitte an das Universitätsamt gerichtet worden, eine jüdische
Verbindung nicht zu genehmigen. Das Universitätsamt hatte sich aber dahin
ausgesprochen, der etwaigen Gründung einer solche nichts in den Weg zu
legen." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1904: "Tübingen.
Die hiesige Studentenschaft hat in einer Vertreterversammlung sämtlicher
Satisfaktion gebenden Korporationen den Beschluss gefasst, keinem
Angehörigen einer jüdischen Verbindung mehr Satisfaktion zu geben. Da
die Zahl der Juden auf hiesige Hochschule in letzter Zeit bedeutend
zugenommen hat, sodass man dem Entstehen einer jüdischen Verbindung hier
entgegensehen konnte, war schon vor einiger Zeit eine Bitte an das
Universitätsamt gerichtet worden, eine solche Korporation nicht zu
genehmigen. Das Universitätsamt hatte sich aber dahin ausgesprochen, der
etwaigen Gründung einer jüdischen Verbindung nichts in den Weg zu
legen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1904: "Tübingen.
Die hiesige Studentenschaft hat in einer Vertreterversammlung sämtlicher
Satisfaktion gebenden Korporationen den Beschluss gefasst, keinem
Angehörigen einer jüdischen Verbindung mehr Satisfaktion zu geben. Da
die Zahl der Juden auf hiesige Hochschule in letzter Zeit bedeutend
zugenommen hat, sodass man dem Entstehen einer jüdischen Verbindung hier
entgegensehen konnte, war schon vor einiger Zeit eine Bitte an das
Universitätsamt gerichtet worden, eine solche Korporation nicht zu
genehmigen. Das Universitätsamt hatte sich aber dahin ausgesprochen, der
etwaigen Gründung einer jüdischen Verbindung nichts in den Weg zu
legen." |
Auszeichnung für den Jurastudenten W. Tennenbaum (1910)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Dezember 1910: "Stud.
jur. W. Tennenbaum, Sohn des bekannten Stuttgarter Kantors, erhielt bei
der jüngsten Preisverteilung in der juristischen Fakultät in Tübingen
den ersten Preis mit goldener Medaille zuerkannt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Dezember 1910: "Stud.
jur. W. Tennenbaum, Sohn des bekannten Stuttgarter Kantors, erhielt bei
der jüngsten Preisverteilung in der juristischen Fakultät in Tübingen
den ersten Preis mit goldener Medaille zuerkannt." |
Im Wintersemester 1927/28 waren zehn jüdische Studierende an der Universität
immatrikuliert (1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Mai 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Mai 1928: |
Weitere Berichte aus der
Universität
Vortrag von Prof. Sellin - nicht frei von antisemitischen
Äußerungen - über neue Ausgrabungen in Palästina (1928)
Zu Prof. Dr. Ernst Sellin siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Sellin
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Am 29.
Oktober dieses Jahres sprach Professor Sellin aus Berlin im vollbesetzten
großen Saal der Alten Aula über seine Ausgrabungen auf der Stätte des alten
Sichem. Er schilderte zunächst die große Bedeutung Palästinas für den
Theologen. Er erzählte von den Schwierigkeiten der Ausgrabungen und wie es
ihm dennoch gelang, an drei Stätten, in Taanach, in der Ebene Jesreel, in
Jericho und in Sichem zwar wenige, aber wertvolle Funde zu machen. Am
schwierigsten gestalteten sich für ihn durch den Weltkrieg die im Jahre 1913
begonnenen Ausgrabungen bei Sichem, dieser 'ungekrönten Königin von
Palästina'. Durch die zufälligen Funde von Bronzegegenständen aus einem
Hügel bei dem Dorfe Pallata in der Nähe von Nablus, die ein Fellache bei
einem Hausbau 1908 gemacht hatte, kamen Prof. Sellin und seine Gehilfen, die
Ingenieure Tiersch und Höllscher, auf die richtige Spur bei ihrer Suche nach
dem alten Sichem. 1913 begann die Grabung, die 1914 aus Geldmangel
unterbrochen werden musste. Um begüterte Juden für das Werk zu
interessieren, hatte Prof. Sellin in der 'Neuen Freien Presse' und im
'Berliner Tageblatt' Berichte über die Ausgrabungen veröffentlicht.
Unterstützung hat er, jedoch nur vom deutschen Kaiser erhalten, der die
Arbeit zur Hälfte finanzierte. Kurz vor Kriegsausbruch befand er sich aus
dem Wege nach Palästina, musste aber bei Kriegsausbruch unter großen
Schwierigkeiten wieder nach Deutschland zurück. 1923 begab er sich nochmals
nach Palästina und begann die Ausgrabungen 1926 wieder aufs neue, die noch
weiter fortgesetzt werden sollen. Aufgedeckt sind bereits ein Mauerrest mit
Tor im Norden aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. und der Rest einer jüngeren
Mauer mit Tor im Osten aus dem 13. Jahrhundert v. Chr., ferner ein
heidnischer Tempel mit Altar und Mazebah und ein Palast. Außerdem wurden
Krüge, Vasen, Siegel, Skarabäen, Götterbilder und ein Goldschmuck aus der
kanaanitischen Zeit gefunden. Sehr gering seien die Funde aus
altisraelitischer Zeit. Das erklärte Professor Sellin, der zwar die Hoffnung
auf solche Funde nicht aufgibt, damit, dass das israelitische Volk keinen
Sinn für das Schöne hatte. Auch sonst war der Vortrag nicht frei von
antisemitischen Äußerungen." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. November 1928: "Tübingen. Am 29.
Oktober dieses Jahres sprach Professor Sellin aus Berlin im vollbesetzten
großen Saal der Alten Aula über seine Ausgrabungen auf der Stätte des alten
Sichem. Er schilderte zunächst die große Bedeutung Palästinas für den
Theologen. Er erzählte von den Schwierigkeiten der Ausgrabungen und wie es
ihm dennoch gelang, an drei Stätten, in Taanach, in der Ebene Jesreel, in
Jericho und in Sichem zwar wenige, aber wertvolle Funde zu machen. Am
schwierigsten gestalteten sich für ihn durch den Weltkrieg die im Jahre 1913
begonnenen Ausgrabungen bei Sichem, dieser 'ungekrönten Königin von
Palästina'. Durch die zufälligen Funde von Bronzegegenständen aus einem
Hügel bei dem Dorfe Pallata in der Nähe von Nablus, die ein Fellache bei
einem Hausbau 1908 gemacht hatte, kamen Prof. Sellin und seine Gehilfen, die
Ingenieure Tiersch und Höllscher, auf die richtige Spur bei ihrer Suche nach
dem alten Sichem. 1913 begann die Grabung, die 1914 aus Geldmangel
unterbrochen werden musste. Um begüterte Juden für das Werk zu
interessieren, hatte Prof. Sellin in der 'Neuen Freien Presse' und im
'Berliner Tageblatt' Berichte über die Ausgrabungen veröffentlicht.
Unterstützung hat er, jedoch nur vom deutschen Kaiser erhalten, der die
Arbeit zur Hälfte finanzierte. Kurz vor Kriegsausbruch befand er sich aus
dem Wege nach Palästina, musste aber bei Kriegsausbruch unter großen
Schwierigkeiten wieder nach Deutschland zurück. 1923 begab er sich nochmals
nach Palästina und begann die Ausgrabungen 1926 wieder aufs neue, die noch
weiter fortgesetzt werden sollen. Aufgedeckt sind bereits ein Mauerrest mit
Tor im Norden aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. und der Rest einer jüngeren
Mauer mit Tor im Osten aus dem 13. Jahrhundert v. Chr., ferner ein
heidnischer Tempel mit Altar und Mazebah und ein Palast. Außerdem wurden
Krüge, Vasen, Siegel, Skarabäen, Götterbilder und ein Goldschmuck aus der
kanaanitischen Zeit gefunden. Sehr gering seien die Funde aus
altisraelitischer Zeit. Das erklärte Professor Sellin, der zwar die Hoffnung
auf solche Funde nicht aufgibt, damit, dass das israelitische Volk keinen
Sinn für das Schöne hatte. Auch sonst war der Vortrag nicht frei von
antisemitischen Äußerungen." |
Antrittsvorlesung von Prof. Gerhard Kittel
(1926)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Dezember 1926:
Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Dezember 1926: |
 |
Erinnerungen an Ereignisse bei der 400-Jahrfeier der Universität (1877;
Berichte von 1927)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1927: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. September 1927: |
| |
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1927: "Tübingen. Noch eine
Erinnerung an das Jubiläum der Universität Tübingen im Jahre 1877. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1927: "Tübingen. Noch eine
Erinnerung an das Jubiläum der Universität Tübingen im Jahre 1877.
Die damals sehr starke Finkenschaft organisierte sich zum Fest und schuf
eine eigene Vertretung. In diesen Vertreterausschuss wurde der jüdische
stud. jur. Albert Mayer aus Ulm, der nachmalige Landtags-Abgeordnete der
Stadt Ulm gewählt, wo er sehr bald als geistiges Haupt der Organisation
anerkannt wurde. Beim großen Kommers im Reithaus nahm er außer der Reihe der
offiziellen Toaste das Wort und sprach das Beste, was an diesem Abend
gesprochen wurde. Beim Fest in Bebenhausen, wo die Studentenschaft in den 4
Seiten des Kreuzgangs untergebracht war, wurde ihm das Präsidium desjenigen
Gangs übertragen, in dem die Finkenschaft untergebracht war. In dieser
Eigenschaft begrüßte er den König bei dessen Rundgang und die Umgebung des
Königs war darüber einig, dass von den Gästen hier das Beste gesprochen
worden war. Kein Mensch hat damals daran Anstoß genommen, dass es ein
Student jüdischen Glaubens war. —" |
Letzte Semesterzusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft für rabbinische Texte
(1928)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. August 1928: |
Vortrag von Privatdozent Rengstorf über "Moderne Kräfte und Bewegungen im
Judentum" (1933)
 Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen
Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1933: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen
Gemeinden
Württembergs" vom 16. Februar 1933: |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Jüdische Haushälterin sucht eine Stelle (1867)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Januar 1867: "Ein sehr tüchtiges Frauenzimmer,
Israelitin, von angenehmen Äußer, der die besten Zeugnisse ihrer
bisherigen Herrschaften zur Seite stehen, wünscht als Haushälterin bei
einem ältlichen Herrn plaziert zu werden. Dieselbe ist im Koch sehr
tüchtig. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 8. Januar 1867: "Ein sehr tüchtiges Frauenzimmer,
Israelitin, von angenehmen Äußer, der die besten Zeugnisse ihrer
bisherigen Herrschaften zur Seite stehen, wünscht als Haushälterin bei
einem ältlichen Herrn plaziert zu werden. Dieselbe ist im Koch sehr
tüchtig.
Adressen beliebe man A.D.B. poste restante nach Tübingen (Württemberg)
zu richten." |
Anzeige von Kaufmann M. Jacobi (1885)
Anmerkung: es handelt sich um Maier Jacobi (geb. 20.1.1827 in Aufhausen), der
21 Jahre lang Lehrer in Haigerloch war, anschließend 1878 mit seiner Familie
nach Tübingen zog, wo er als Kaufmann tätig war und am 19. Januar 1901
verstorben ist. Er war verheiratet mit Friederike geb. Hirsch aus Haigerloch
(geb. 9. April 1838 in Haigerloch, gest. 3. Juni 1925 in Tübingen). Die Tochter
Johanna (geb. 17. September 1861 in Haigerloch, gest. 5. Oktober 1845 in
England) heiratete am 8. Juli 1885 den Kaufmann Josef Hilb aus Haigerloch (geb.
18. Dezember 1851 in Haigerloch, gest. 13. Januar 1900 in Ludwigsburg).
Quelle: J. Hahn: Jüdisches Leben in Ludwigsburg S. 406. L. Zapf: Die Tübinger
Juden S. 135-138.
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Oktober 1885: "Tübingen. Eine Wärterin
(Israelitin), welche in einem Krankenhause als Aushilfswärterin tätig
war, sucht eine passende Stellung, entweder in einem Krankenhause, oder
als Privatanwärterin in einer Gemeinde gegen Wartegeld oder bei einer
Privatperson. Zeugnisse stehen zu Gebot. Nähere Auskunft erteilt M.
Jacobi, Kaufmann". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 13. Oktober 1885: "Tübingen. Eine Wärterin
(Israelitin), welche in einem Krankenhause als Aushilfswärterin tätig
war, sucht eine passende Stellung, entweder in einem Krankenhause, oder
als Privatanwärterin in einer Gemeinde gegen Wartegeld oder bei einer
Privatperson. Zeugnisse stehen zu Gebot. Nähere Auskunft erteilt M.
Jacobi, Kaufmann". |
Anzeige des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes Leopold
Hirsch (1916)
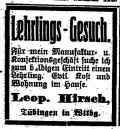 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1916: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juni 1916:
"Lehrlings-Gesuch.
Für mein Manufaktur- und Konfektionsgeschäft suche ich zum baldigen
Eintritt einen Lehrling. Eventuelle Kost und Wohnung im Hause.
Leopold Hirsch,
Tübingen in Württemberg." |
Verlobungs- und Hochzeitsanzeigen von Dr. Siegfried
Koppel und Edith geb. Hayum (1924)
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 31. Januar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 31. Januar 1924:
"Statt Karten! Edith Hayum - Dr. med. Siegfried Koppel.
Verlobte.
Tübingen - Köln am Rhein. Venloer Straße
324". |
| |
 Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 27. März 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 27. März 1924:
"Dr. med. Siegfried Koppel - Edith Koppel geb. Hayum.
Vermählte.
Köln am Rhein-Ehrenfeld, Venloer Straße 324 - Tübingen." |
Hochzeitsanzeige von Dr. Heinz Oppenheim und Dr. Dorothee geb. Hayum
(1935)
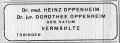 Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. September 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. September 1935: |
Sonstiges
Aus einem Abschnitt der Zeitschrift
"Der Israelit" über eine obskure, in Tübingen erschienene
christliche Schrift (1841)
 Der
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"
vom 14. März 1841 wird nicht ausgeschrieben; bei Interesse bitte
anklicken. Der
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit des 19. Jahrhunderts"
vom 14. März 1841 wird nicht ausgeschrieben; bei Interesse bitte
anklicken. |
Postkarte
an Lenchen Dessauer in Tübingen (1900)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries; auch die
Erläuterungen sind von P.K. Müller)
Vgl. oben die Artikel zum 75. Geburtstag von Adolf Dessauer (1927), zum Tod
von Lenchen Dessauer (1928) und zum 80. Geburtstag von Adolf Dessauer sowie ein
Grabsteinfoto des Paares im jüdischen Friedhof
Wankheim.
 |
 |
 |
Die
Postkarte an Lenchen Dessauer (Adresse Gebrüder Dessauer in
Tübingen, Uhlandstraße) wurde aus Ulm am 19. August 1900 verschickt. Die
Empfängerin Lenchen Dessauer geb. Halle ist am 26. März 1857 in Hockenheim
geboren. Sie war verheiratet mit Adolf Dessauer (geb. 20. Mai 1852 in Wankheim).
Das Ehepaar hatte fünf Kinder:
- Ernst Nathan Dessauer, geb. 20. Januar 1882, Buchhändler in Hamburg, am
25. Oktober 1941 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 12.
Januar 1942 umgekommen ist.
- Anne Dessauer verheiratete Erlanger, geb. 29. Mai 1883, am
10. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und dort zu Tode gekommen.
- Julie Dessauer verheiratete Berger, geb. am 29. Mai
1883, am 14. Dezember 1942 von der Gestapo Berlin mit dem 25. Osttransport
in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet.
- Erich Dessauer, geb. 13. November 1887, Rechtsanwalt in Stuttgart in Stuttgart, am
17. Juni 1943 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, am 28. September
1944 in das Vernichtungslager Auschwitz und dort ermordet.
- Lucie Dessauer verheiratete Levi, geb. 1. Februar 1894, 1939 ausgewandert nach Palästina.
Lenchen Dessauer starb am 21. September 1928 in Tübingen, Adolf Dessauer am
30. November 1939 gleichfalls in Tübingen. Die beiden wurden im jüdischen Friedhof in
Wankheim beigesetzt.
Adolf Dessauer war von Beruf Optiker und Graveur und in den Jahren von 1900
bis 1914 Vorsteher der Synagogengemeinde.
Text der Karte: "Ulm, den 19. August 1900 / Meine liebe Freundin !
/ Besten Dank ! für Ihre Mühe, das Paket kam / heute früh frisch und wohlbehalten an und ließen
/ wir uns gleich davon gut schmecken. ja meine / liebe Frau Dessauer mit Carl änderte sich die Sache und
/ wurde so in letzter Stunde beordert, daß /Er nicht einrücken müßte, weil es ist sehr streng
/ dort, kam Er nicht zum Schreiben seither entschuldigen / Sie daher. Empfangen Sie ! mit Ihrer lieben Familie
/ die herzlichsten Grüße von uns Allen. Ihre ergeben L.W."
Quellen: https://www.geni.com/people/Lina-Dessauer/6000000023858993250
http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?sel=wnk&function=Ins&jahrv=1928
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/JIFVVDT6ZDF64L3MLTVVRUVTZ6Z5ODSS |
Gründung eines liberalen jüdischen Landesverbandes in
Tübingen (1913)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt"
vom 10. Januar 1913: Tübingen, 7. Januar (1913). Hier fand gestern
eine zahlreich besuchte Versammlung statt, die der Gründung eines liberalen
jüdischen Landesverbandes galt. Den Vorsitz führte Dr. Karl Ries-
Stuttgart. Das Hauptreferat erstattete Rabbiner Dr. Tänzer -
Göppingen. Nach längerer Debatte wurde einstimmig die Gründung des
Landesvereins beschlossen. Zum Vorsitzenden wurde Landgerichtsrat Dr.
Stern - Stuttgart gewählt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen
Familienblatt"
vom 10. Januar 1913: Tübingen, 7. Januar (1913). Hier fand gestern
eine zahlreich besuchte Versammlung statt, die der Gründung eines liberalen
jüdischen Landesverbandes galt. Den Vorsitz führte Dr. Karl Ries-
Stuttgart. Das Hauptreferat erstattete Rabbiner Dr. Tänzer -
Göppingen. Nach längerer Debatte wurde einstimmig die Gründung des
Landesvereins beschlossen. Zum Vorsitzenden wurde Landgerichtsrat Dr.
Stern - Stuttgart gewählt."
|
Prof. Dr. Nägele verhält sich
für den Schwäbisch Albverein judenfreundlich (1930)
 Artikel
in der Zeitschrift des Central-Vereins (CV-Zeitung") vom 21. November
1930: "Vorbildliche Neutralität. Artikel
in der Zeitschrift des Central-Vereins (CV-Zeitung") vom 21. November
1930: "Vorbildliche Neutralität.
Der Vaterländische Schwäbische Albverein hat aus Ersparnisgründen den
Druck seines Blattes einer Tübinger Druckerei übertragen, deren Inhaber
Jude ist. Einige Mitglieder
des Vereins sind deshalb aus dem Verein ausgetreten. Der Vorsitzende,
Prof. Dr. Nägele (Tübingen), geht in nr. 11 der Blätter des
Schwäbischen Albvereins in einem Artikel 'An unsere Mitglieder' auf
den Vorfall ein. Er schreibt unter anderem:
'… Von zehn Druckereien zwischen Tübingen, Stuttgart und Göppingen
liefen, teils verlangt, teils unverlangt, Angebote ein. Weitaus das
billigste war das der 'Tübinger Chronik' (Besitzer A. Weil). Ein auf
Grund reicher Erfahrung abgefasster Vertrag sichert den Verein vor
jeglicher Mehrforderung. Wie groß die Ersparnisse sein werden und worin
sie bestehen, braucht hier nicht ausgeführt zu werden. Da schreiben nun
die Nationalsozialisten: 'Wir sind dagegen, dass eine jüdische
Druckerei das Blatt druckt, zu dessen Herstellung unsere Beiträge
verwendet werden', ja sie fordert die Parteigenossen mit der Lösung: 'Keinen Pfennig einer jüdischen Firma!' bereits zum allgemeinen
Austritt auf!
Ist das der Anfang des Kampfes gegen 'Rom und Juda' auf schwäbischem
Boden? Wir wissen nicht, wie viele unserer Mitglieder zu der erwähnten
Partei gehören, deren Wahlsieg am 14. September die ganze Welt
überrascht hat, aber wir können nicht glauben, dass ein echter
Albvereinsfreund, auch wenn er zu den Nationalsoziallisten gehört, dass
überhaupt jemand, der die 42jährige Geschichte des Albvereins kennt und
seine Leistungen genießt, deswegen, weil etwa der zwanzigste Teil des
Jahresaufwandes durch die Druckereimaschinen eines israelitischen
Besitzers geht, in der hier getroffenen Sparmaßnahme einen Grund erkennt,
einem Verein den Rücken zu kehren, der jeder Politik fern steht, keine
Weltanschauung verletzt und sich anerkanntermaßen im Sinne der Heimat-
und Vaterlandsliebe, des sozialen Ausgleichs und der Volksgemeinschaft in
gemeinnütziger, meist ehrenamtlicher Weise betätigt, und das alles
zunächst auf schwäbischem Boden, dann aber auch als Glied des
Reichsverbandes deutscher Gebirgs- und Wandervereine.
Gegen diesen Versuch, den Vereinsfrieden und die Vereinsarbeit durch den
Angriff auf eine ganz nebensächliche Maßnahme zu stören, erhebt die
Vereinsleitung entrüstet Einspruch. Nicht der Besitzer der
Druckmaschinen, sondern die Vereinsleitung und mit ihr all die getreuen
Mitglieder entscheiden über den Geist unseres vaterländischen Vereins…" |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. November 1930: "Stuttgart. Die
Nationalsozialisten haben ihre Parteigenossen zum Austritt aus dem weit
verbreiteten Schwäbischen Albverein aufgefordert, weil die
Vereinsleitung, aus Sparsamkeitsgründen, den Druck ihrer Blätter für
1931 einer Firma übertrug, deren jüdischer Inhaber von zehn Angeboten
das niedrigste gemacht hatte. Der Schwäbische Albverein wendet sich gegen
eine solche Hetze und bittet seine Mitglieder, welchen Glaubens sie auch
sein mögen, sich von keinerlei gehässigen Verleumdungen dieser Art irre
machen zu lassen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. November 1930: "Stuttgart. Die
Nationalsozialisten haben ihre Parteigenossen zum Austritt aus dem weit
verbreiteten Schwäbischen Albverein aufgefordert, weil die
Vereinsleitung, aus Sparsamkeitsgründen, den Druck ihrer Blätter für
1931 einer Firma übertrug, deren jüdischer Inhaber von zehn Angeboten
das niedrigste gemacht hatte. Der Schwäbische Albverein wendet sich gegen
eine solche Hetze und bittet seine Mitglieder, welchen Glaubens sie auch
sein mögen, sich von keinerlei gehässigen Verleumdungen dieser Art irre
machen zu lassen." |
Hässlicher Antijudaismus im
benachbarten Derendingen wird nur milde bestraft (1931)
 Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 14. August 1931: "15 Mark
Geldstrafe. 'Wenn das Judenblut vom Messer spritzt...' Artikel
in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins") vom 14. August 1931: "15 Mark
Geldstrafe. 'Wenn das Judenblut vom Messer spritzt...'
Unter den gewiss nicht zarten Marschgesängen der nationalsozialistischen
Liederbücher zum Gebrauche ihrer Landsknechtstruppen finden man ein Lied
nicht: Sogar die Parteileitung scheint sich des strafbaren Charakters
dieses Liedes bewusst zu sein! Trotzdem wird es gesungen, obwohl es
unverhüllte Morddrohung bedeutet. Denn der zweite Vers des schönen
Liedes lautet folgendermaßen: '
Wenn der Sturmsoldat zu Felde zieht,
Dann hat er frohen Mut!
Und wenn das Judenblut vom Messer spritzt,
Dann geht's noch mal so gut!'
Gegen Mitglieder der SA-Abteilung, die vor kurzem, dieses Lied singend,
durch Derendingen (Württemberg) hindurchmarschierten, ist Strafantrag
gestellt worden. Nicht nur auf Grund des § 130 Strafgesetzbuch, für
dessen Anwendung dieser Schulfall einer Aufreizung zum Klassenhass gewiss
genügend Handhabe bot, sondern vor allem auf Grund des § 2,
Ziffer 2 der Notverordnung schien eine strenge Verurteilung geboten
und sicher zu sein.
Was aber tat das zuständige Schöffengericht? Weder der Staatsanwalt noch
der Amtsrichter hielten es für notwendig, die Notverordnung auch nur zu
erwähnen. Das Gericht hat lediglich groben Unfug angenommen und demgemäss
gegen einige der Angeklagten Geldstrafen in Höhe von 15 Mark (fünfzehn!)
verhängt. Zumindest ist die Annahme 'groben Unfugs' beim Absingen solcher
Lieder ein staatsgefährlicher Irrtum, und so lächerliche Geldstrafen
wirken geradezu wie eine Prämie für die erfolgreiche Aufreizung zum
politischen Mord. Ka." |
| Kennkarten
aus der NS-Zeit |
| |
Am 23. Juli 1938 wurde
durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von
Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht
eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen
Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"
galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste
Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.
Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv
zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:
Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:
Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.
Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |
| |
Kennkarten
zu Personen,
die in Tübingen geboren sind |
 |
 |
|
| |
KK (Mainz 1939) für Lina
Mayer geb. Degginger (geb. 3. Dezember
1883 in Tübingen), emigrierte 1939 in die USA (gest. 25. August 1965
in
Chicago; war verheiratet mit dem Weinhändler Albert Mayer
aus
Oppenheim (6. April 1879 - 23. April
1964). |
KK (Mainz 1939) für Karl
Weil (geb. 18. Juni 1879 in Tübingen), Bankier,
wohnhaft in Mainz und Ludwigsburg, 1940 nach Jugoslawien emigriert,
1943 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert, ermordet
|
|
|