|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"
Vevey (Kanton
Waadt - Canton de Vaud, VD,
Schweiz)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(erstellt unter Mitarbeit von
Louis Bloch)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Vevey bestand eine jüdische
Gemeinde seit 1905, nachdem im Zusammenhang mit der Industrialisierung der Stadt
und ihrer Umgebung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche
jüdische Familien / Personen zugezogen waren (vgl. unten Anzeige von J.
Woog-Picard von 1865). Bis um 1900 gab es kein organisiertes
Gemeindeleben. Nach einem Bericht von 1905 (siehe unten) wurden damals auch an den hohen
Feiertagen noch keine jüdischen Gottesdienste in der Stadt abgehalten. 1905
schlossen sich die meisten jüdischen Familien zusammen, um eine jüdische
Gemeinde in der Stadt unter dem Namen "Communauté Israélite du
district de Vevey" ("Israelitische Gemeinde des Distrikts
Vevey"; seit der Fusion mit Montreux
1954: "Communauté Israélite Vevey-Montreux", CIVM) zu gründen.
Die jüdische Gemeinde in Vevey wurde nach Avenches,
Yverdon und
Lausanne die
vierte auf Waadtländer Boden gegründete Gemeinde.
Die jüdischen Familien in Vevey stammten in den ersten Jahrzehnten vor allem
aus dem Elsass (Familien Levy, Bloch, Dreyfus und Picard).
An Einrichtungen konnte die Gemeinde vor allem für einen Betsaal
(Synagoge, siehe unten) und einen
Schulraum für den Religionsunterricht der Kinder sorgen. Die Toten der
Gemeinde wurden zunächst in Lausanne, seit 1908 auf dem damals
neu eröffneten Friedhof von Tour de Peilz
beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde wurde ein Gemeindebeamter
angestellt, der als Lehrer, Kantor und Schochet tätig war. Von vornherein
bestand eine enge Verbindung mit der kleinen jüdischen Gemeinde in Montreux.
An jüdischen Vereinen bestand ein Talmud-Thora-Verein, gegründet von
dem 1922 verstorbenen Jacques Sirmann (siehe Bericht zu seinem Tod unten).
Gemeindeverwaltung: erster Gemeindepräsident war Eduard Bloch-Blum. Er war dies auch noch um
1920, 15 Jahre nach Gründung der Gemeinde. Jules Levy war damals stellvertretender
Gemeindevorsteher beziehungsweise Vizepräsident. Als Gemeindesekretär war um
1920 Armand Bickard tätig, als Beisitzer Isidor Levy. Als Gemeindebeamter (Lehrer,
Kantor, Schochet) war Abraham Halevy-Wassersprung angestellt. 1922 wird
als Religionslehrer ein Herr Bondy genannt. 1932 bis 1969 war
Gemeindepräsident der Apotheker Dr. Jean-Jacques Bloch. Auf ihn folgte
von 1969 bis 1973 Dr. Simon Ascher (Institut Ascher in
Bex). Ab 1973 setzte sich der neue Vorstand
wie folgt zusammen: Präsident: von 1973 bis 1983 Pierre Dürheim;
Vizepräsident Sigmund (Sigi) Toman; Sekretär Mathias Treidel, Kassier Werner
Fink; Louis Bloch (Friedhof, ab 1974 Kassier); Charles Urbach (Verwalter Berges
du Léman). 1983 übernahm Sigmund (Sigi) Toman das Präsidium (gest. 2008
in Vevey,
Wikipedia-Artikel). In den 1970er-Jahren war Joseph Bache Vorbeter (Vater
von Dani Bache, der später Rabbiner in
La Chaux-de-Fonds war).
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich wie
folgt: 1918/21 92 jüdische Einwohner (26 Mitglieder), in den
1960er-Jahren etwa 50 Mitglieder (ca. 100 Personen), um 2000 gemeinsam
mit Montreux ca. 20 Familien beziehungsweise 30 Mitglieder (50 Personen).
Die Gemeinde gehörte dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) an,
der kurz nach der Gründung der Gemeinde Vevey als Dachverband gegründet worden
war. Der SIG hielt 1961 und 2002 Delegiertenversammlungen in Vevey ab.
Große Herausforderungen brachte die Zeit des Zweiten Weltkrieges für
die kleine Gemeinde. Sie musste sich um etwa zwanzig Flüchtlingslager in der
Region kümmern (Verteilung von Nahrung, Kleidern und Geld). 1949 wurde ein
Flüchtlingszentrum in dem in erhöhter Lage in Vevey liegenden Haus "Les
Berges du Léman" (ehemaliges Parkhotel Mooser, bis 1948 psychiatrische
Klinik) eingerichtet. Die Einweihung des Flüchtlingszentrums war im März
1949.
1954 wurde - nach dem Wegzug beziehungsweise Tod der letzten
Heimbewohnern - das Haus "Berges du Léman" zu einem Altersheim
umgebaut, in dem nun auch das Gemeindezentrum (Synagoge) der jüdischen Gemeinde
Vevey eingerichtet wurde (siehe unten). Die Finanzierung erfolgte teilweise
über deutsche Reparationszahlungen an die Claims Conference, vermittelt durch
den Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF). Das Heim wurde seit
1978 durch Mosche Anidjar geleitet, der zugleich Vizepräsident der jüdischen
Gemeinde Vevey-Montreux war. Um 2000 lebten etwa 60 Pensionäre in diesem Haus,
davon ein Drittel jüdisch.
Seit den 1970er-Jahren ist die Zahl der Gemeindemitglieder unter anderem durch
den Wegzug der Industrie aus Vevey in andere Städte zurückgegangen.
Die Gemeinde bestand als selbständige Gemeinde bis 2008. In diesem Jahr wurde
auf Grund jeweiliger Gemeindebeschlüsse (in Vevey bei einer Generalversammlung
am 5. November 2007 im Hotel Lausanne Palace) die
"Israelitische Gemeinde Lausanne und des Kantons Waadt" (Communauté
Israélite de Lausanne et du Canton be Vaude; CILV)
gebildet. Die Jüdische Gemeinde Vevey ist seitdem eine lokale Sektion der
CILV.
Berichte aus
den ersten Jahrzehnten der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Es soll eine Gemeinde gebildet und ein Betraum
eingerichtet werden (1905)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12.
Mai 1905: "Vevey. Obwohl es hier mehrere Minjonim Juden gibt,
so findet doch nicht einmal an den hohen Festtagen Gottesdienst statt,
und die Jugend wächst fast ganz ohne Religionsunterricht auf. Von
verschiedenen Seiten wird nun gewünscht, dass diese unangenehmen
Verhältnisse geändert werden und die hier wohnenden Juden sich
zusammenschließen, um eine Gemeinde zu bilden, einen Beamten anzustellen
und ein Betlokal zu mieten. Neuerdings hat diese Angelegenheit durch
persönliche Aufmunterung und materielle Unterstützung des bekannten
christlichen Herrn Konsul Nölding aus Hamburg kräftige Anregung
erhalten. Dieser Herr, welcher in Vevey öfter weilt, hat den hiesigen
Kirchen verschiedene Spenden zukommen lassen und hat gleichzeitig in echt
toleranter Weise auch den Juden eine ansehnliche Summe zugewiesen. Dabei
war er nicht wenig erstaunt, dass eine eigentliche jüdische Gemeinde und
Gottesdienst nicht besteht. Daraufhin nahm er mit einem hiesigen Juden
Rücksprache und versprach, falls die Gemeinde die Absicht hätte, einen
Gottesdienst zu veranstalten, die versprochene Summe zu erhöhen und
alljährlich einen Beitrag von 100 Fr. beizusteuern. Es ist zu hoffen,
dass nunmehr, nachdem selbst von christlicher Seite der Anstoß gegeben
wurde, bald eine jüdische Gemeinde zu Vevey entstehe und dieselbe von
beteiligter Seite diejenige Förderung erhalte, welche die Wichtigkeit und
Heiligkeit der Sache erfordert." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12.
Mai 1905: "Vevey. Obwohl es hier mehrere Minjonim Juden gibt,
so findet doch nicht einmal an den hohen Festtagen Gottesdienst statt,
und die Jugend wächst fast ganz ohne Religionsunterricht auf. Von
verschiedenen Seiten wird nun gewünscht, dass diese unangenehmen
Verhältnisse geändert werden und die hier wohnenden Juden sich
zusammenschließen, um eine Gemeinde zu bilden, einen Beamten anzustellen
und ein Betlokal zu mieten. Neuerdings hat diese Angelegenheit durch
persönliche Aufmunterung und materielle Unterstützung des bekannten
christlichen Herrn Konsul Nölding aus Hamburg kräftige Anregung
erhalten. Dieser Herr, welcher in Vevey öfter weilt, hat den hiesigen
Kirchen verschiedene Spenden zukommen lassen und hat gleichzeitig in echt
toleranter Weise auch den Juden eine ansehnliche Summe zugewiesen. Dabei
war er nicht wenig erstaunt, dass eine eigentliche jüdische Gemeinde und
Gottesdienst nicht besteht. Daraufhin nahm er mit einem hiesigen Juden
Rücksprache und versprach, falls die Gemeinde die Absicht hätte, einen
Gottesdienst zu veranstalten, die versprochene Summe zu erhöhen und
alljährlich einen Beitrag von 100 Fr. beizusteuern. Es ist zu hoffen,
dass nunmehr, nachdem selbst von christlicher Seite der Anstoß gegeben
wurde, bald eine jüdische Gemeinde zu Vevey entstehe und dieselbe von
beteiligter Seite diejenige Förderung erhalte, welche die Wichtigkeit und
Heiligkeit der Sache erfordert." |
Gemeindebeschreibungen 1918 / 1921
 Gemeindebeschreibung
im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1918 S. 261:
"Vevey. Für den Bezirk Vevey besteht in Vevey eine jüdische
Gemeinde mit dem Namen: Communauté Israélite du district de Vevey. Die
Gemeinde wurde 1905 gegründet und zählt 26 Mitglieder mit ca. 92
jüdischen Seelen. Gemeindebeschreibung
im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1918 S. 261:
"Vevey. Für den Bezirk Vevey besteht in Vevey eine jüdische
Gemeinde mit dem Namen: Communauté Israélite du district de Vevey. Die
Gemeinde wurde 1905 gegründet und zählt 26 Mitglieder mit ca. 92
jüdischen Seelen.
Vorstand: Ed. Bloch-Blum, Präsident; J. Schnitzler,
Vizepräsident; Jules Levy, Sekretär: Armand Bickard, Kassier; Isidor
Levy, Beisitzer.
Beamter: Abr. Halevy-Wassersprung.
Institutionen: Die Synagoge befindet sich Quai Pedonnet 14. - Die
jüdische Gemeinde besitzt den ganzen Anbau des Hotel Angleterre. Die
Synagoge (Betsaal) befindet sich im ersten Stock; ein Gemeindesaal nebst
der Schule sind im zweiten Stockwerk untergebracht. - Der Friedhof,
gegründet 1908 befindet sich à la Tour de Peilz. Die
Gemeinde hat einen Betsaal eröffnet in Montreux, um ihren Mitgliedern,
die daselbst wohnen, Gelegenheit zu geben, den Gottesdienst besuchen zu
können." |
| |
 Gemeindebeschreibung
im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1921 S.
184-185: Gemeindebeschreibung
im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" Jahrgang 1921 S.
184-185:
Derselbe Text wie 1918. |
Statistik der jüdischen Einwohner 1917
 Artikel im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" von 1917 S. 220: Es
werden angegeben an jüdischen Einwohnern:
Artikel im "Jüdischen Jahrbuch der Schweiz" von 1917 S. 220: Es
werden angegeben an jüdischen Einwohnern:
"Kanton Zürich: Zürich 5212, Winterthur 133, Bülach
24;
Baselstadt 2452;
Genf 2236;
Kanton Bern: Bern 1062, Biel 413, Delsberg 75, Burgdorf 50, Langental
32, Laufen 27, Thun 27;
Kanton Waadt: Lausanne 989, Vevey 127,
Yverdon 102, Montreux 96, Avenches 74, Nyon 64, Morges 40, Mondon 32,
Cossonay 24". |
Berichte zu einzelnen Personen aus der
Gemeinde
Zum Tod von Reine Levy geb. Bernard und Einweihung des
jüdischen Friedhofes (1908)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1908: "Vevey,
21. Juli (1908). Hier starb nach nur zweijähriger glücklicher Ehe eine
edle und wackere, von allen, die sie kannten, geliebte und hochgeachtete
Frau, Frau Reine Levy geb. Bernard. Als Lehrer und Freund des trauernden
Gatten, Herrn Henri Levy, war trotz der weiten Entfernung Herr Rabbiner
Dr. Cohn aus Basel erschienen, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu
erweisen und die Schmerzgebeugten in ihrem schweren Leide zu trösten. Mit
diesem Todesfall wurde der neue Friedhof der jüdischen Gemeinde in Vevey eingeweiht,
für den der Gönner der jüdischen Gemeinde von Vevey, ein Nichtjude,
Herr Konsul Nölting von Hamburg bereitwillig die Mittel hergegeben. Am
Grabe sprachen außer Herrn Rabbiner Dr. Cohn noch Herr Bloch im Namen der
Gemeinde Vevey und Herr Kantor Lehmann von
Lausanne als Freund der
Familie Worte der Trauer und des
Nachrufs." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1908: "Vevey,
21. Juli (1908). Hier starb nach nur zweijähriger glücklicher Ehe eine
edle und wackere, von allen, die sie kannten, geliebte und hochgeachtete
Frau, Frau Reine Levy geb. Bernard. Als Lehrer und Freund des trauernden
Gatten, Herrn Henri Levy, war trotz der weiten Entfernung Herr Rabbiner
Dr. Cohn aus Basel erschienen, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu
erweisen und die Schmerzgebeugten in ihrem schweren Leide zu trösten. Mit
diesem Todesfall wurde der neue Friedhof der jüdischen Gemeinde in Vevey eingeweiht,
für den der Gönner der jüdischen Gemeinde von Vevey, ein Nichtjude,
Herr Konsul Nölting von Hamburg bereitwillig die Mittel hergegeben. Am
Grabe sprachen außer Herrn Rabbiner Dr. Cohn noch Herr Bloch im Namen der
Gemeinde Vevey und Herr Kantor Lehmann von
Lausanne als Freund der
Familie Worte der Trauer und des
Nachrufs." |
Vermächtnisse des 1916 verstorbenen Tobias Markus
(1917)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Februar
1917: "Der am 22. Dezember in Vevey (Schweiz) verstorbene Tobias
Markus, ein Schwager des Bildhauers Beer - Florenz, durch den er
Herzls erste Verbindung mit Prof. Hermann Vambery herstellte, hat dem
Jüdischen Nationalfonds sein Mobiliar und seine Bibliothek hinterlassen,
die einen Wert von wenigstens 50.000 Frs. repräsentieren
dürften." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. Februar
1917: "Der am 22. Dezember in Vevey (Schweiz) verstorbene Tobias
Markus, ein Schwager des Bildhauers Beer - Florenz, durch den er
Herzls erste Verbindung mit Prof. Hermann Vambery herstellte, hat dem
Jüdischen Nationalfonds sein Mobiliar und seine Bibliothek hinterlassen,
die einen Wert von wenigstens 50.000 Frs. repräsentieren
dürften." |
Zum Tod von Jacques Sirmann und dessen Beisetzung in
Lausanne (1922)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1922: "Vevey,
1. Januar (1922). Auf dem jüdischen
Friedhof in Lausanne wurde der Familiengrabstein des hier
unvergesslichen und in allen Kreisen geschätzten Jacques Sirmann - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - errichtet. Der so jung
Verblichene hat Großes und Nützliches fürs Judentum und seine
Nebenmenschen gewirkt. Erst nach seinem Tode erfuhr man, wie er als
liebevoller Freund aller Leidenden und treuer Ratgeber aller Bedrückten
oft 10 bis 15.000 Franken im Stillen geliehen, um ihnen zu einem Broterwerb
zu verhelfen. Als während des Krieges die Jomkippurkerzen trotz schwerem
Gelde fast nicht zu bekommen waren, da ließ der Verblichene es sich nicht
nehmen, trotz großer Unkosten eine Koste dieser Kerzen zu verschaffen,
die er dem Religionslehrer Bondy in Vevey übermittelte, um sie während
der hohen Feiertage zur Verherrlichung des Gottesdienstes anzuzünden.
Nach der üblichen Zeremonie seitens des Herrn Kantor Lehmann in
Lausanne,
nahm Herr Th. Grumbach aus Vevey das Wort, der es verstand, in einer
herzlichen Ansprache treuen Gedenkens ein wahres Lebensbild des so früh
Entrissenen und alles Nützliche, was er als Mitgründer der
Kultusgemeinde Vevey und des hier zustande kommenden Talmud
Thora-Vereins gewirkt hat, zu schildern." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1922: "Vevey,
1. Januar (1922). Auf dem jüdischen
Friedhof in Lausanne wurde der Familiengrabstein des hier
unvergesslichen und in allen Kreisen geschätzten Jacques Sirmann - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - errichtet. Der so jung
Verblichene hat Großes und Nützliches fürs Judentum und seine
Nebenmenschen gewirkt. Erst nach seinem Tode erfuhr man, wie er als
liebevoller Freund aller Leidenden und treuer Ratgeber aller Bedrückten
oft 10 bis 15.000 Franken im Stillen geliehen, um ihnen zu einem Broterwerb
zu verhelfen. Als während des Krieges die Jomkippurkerzen trotz schwerem
Gelde fast nicht zu bekommen waren, da ließ der Verblichene es sich nicht
nehmen, trotz großer Unkosten eine Koste dieser Kerzen zu verschaffen,
die er dem Religionslehrer Bondy in Vevey übermittelte, um sie während
der hohen Feiertage zur Verherrlichung des Gottesdienstes anzuzünden.
Nach der üblichen Zeremonie seitens des Herrn Kantor Lehmann in
Lausanne,
nahm Herr Th. Grumbach aus Vevey das Wort, der es verstand, in einer
herzlichen Ansprache treuen Gedenkens ein wahres Lebensbild des so früh
Entrissenen und alles Nützliche, was er als Mitgründer der
Kultusgemeinde Vevey und des hier zustande kommenden Talmud
Thora-Vereins gewirkt hat, zu schildern." |
Hinweis auf den in Vevey verstorbenen Rabbiner und
Schriftsteller Schlomo Friedrich Rülf (1896-1976)
Schlomo
(Salomon) Friedrich Rülf (geb. 13. Mai 1896 in Braunschweig, gest.
13. August 1976 in Vevey) war seit 1926 Distriktsrabbiner in
Bamberg, seit
1929 Rabbiner in Saarbrücken. 1935 emigrierte er mit seiner Familie nach
Palästina, wo er - vor allem in Nahariya - als Lehrer und ehrenamtlicher
Rabbiner tätig war.
siehe Wikipedia-Artikel
zu Schlomo Rülf.
Zum Gedenken an seine Verdienste wurde die
Friedrich-Schlomo-Rülf-Medaille benannt, die die Christlich-Jüdische
Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes (CJAS) vergibt. |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und
Privatpersonen
Anzeige von J. Woog-Picard (1865)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai
1865:"In Besorgung der Küche und sonstiger häuslicher Arbeiten,
findet ein darin erfahrenes junges Mädchen sofortige Aufnahme in der
Familie des Unterzeichneten. Offerten ohne Aufgabe von Referenzen finden
keine Berücksichtigung. Jährliches Gehalt 250-300 Francs und Geschenke.
- Vevey (Schweiz), Mai 1865. J. Woog-Picard." Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai
1865:"In Besorgung der Küche und sonstiger häuslicher Arbeiten,
findet ein darin erfahrenes junges Mädchen sofortige Aufnahme in der
Familie des Unterzeichneten. Offerten ohne Aufgabe von Referenzen finden
keine Berücksichtigung. Jährliches Gehalt 250-300 Francs und Geschenke.
- Vevey (Schweiz), Mai 1865. J. Woog-Picard." |
Zur Geschichte der Synagogen (Beträume)
1905 konnte im Zusammenhang mit der Gründung der Gemeinde
ein Gemeindezentrum in einem Anbau des Hotel Angleterre direkt an der
Seepromenade eingerichtet werden. Der Betsaal (Synagoge), der mit maurischen
Elementen gestaltet wurde, befand sich seitdem im ersten Stock des Anbaus; ein Gemeindesaal
sowie die Schule wurden im zweiten Stockwerk untergebracht.
Die Gemeinde eröffnete zusätzlich zu dem Betsaal in Vevey einen Betsaal in Montreux,
um ihren dortigen Mitgliedern Gelegenheit zu geben, Gottesdienste vor Ort
besuchen zu können.
1946 wurde der Betsaal im Hotel Angleterre aufgegeben, da das Hotel
abgebrochen wurde. Bis 1954 wurde ein für die Gottesdienste der Gemeinde
ein Saal in der Rue du Simplon gemietet.
Von 1954 bis 2008 war Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens die Synagoge
im Alters- und Pflegeheim "Les Berges du Léman". Sie wurde in
einem durch den Architekten André Nobs 1954 erstellten Anbau eingerichtet.
Diese Synagoge erlangte Berühmtheit durch die 1966 von der Künstlerin
Régine Heim geb. Ryfka Frajdenraich (1907-2002; Ehefrau des
VSJF-Präsidenten Otto Heim) gestaltete Glaswand (siehe Abbildungen mit
Erläuterungen unten).
Die Bewohner des Heimes sorgten bis zuletzt für den zu den Gottesdiensten
erforderlichen Minjan. 2008 wurde das Heim "Les Berges du Léman"
vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund an die Stiftung Claire Magnin
verkauft, die das Haus weiterhin als Seniorenheim betreibt (Fondation Claire
Magnin: Résidence les Berges du Léman). In der ehemaligen Synagoge wurde
ein Speisesaal eingerichtet.
Adressen/Standorte der Synagoge (Beträume):
- 1905 bis 1946: Quai
Pedonnet 14
- 1946 bis 1954: Rue du Simpon
- 1954 bis 2008: im Alters- und Pflegeheim "Les Berges du Léman" 3
Boulevard Henri-Plumhof
Fotos
|
Die Glasfenster in der Synagoge Vevey
(Abbildungen erhalten von Louis Bloch) |
|
|
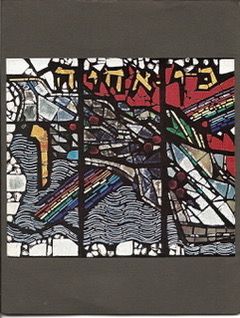 |
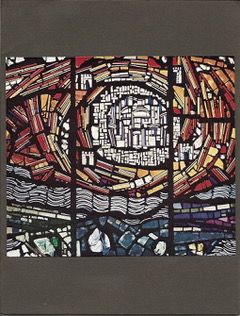 |
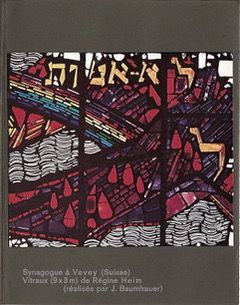 |
| Zur Symbolik der
farbigen Fenster der Synagoge "Les Berges du Leman" in Vevey: Der
Regenbogen, der die drei Fenster verbindet, ist das Zeichen des Bundes
zwischen G"tt und seinem Volk Israel. Aus der unteren Mitte zwischen großen
Blöcken ergebt sich in weiter Ausbreitung der Lebensbaum, der in seinen
Zweigen auf der einen Seite blutige Tränen und auf der anderen Seite
Granatäpfel zeigt. Zwischen dem Regenbogen und dem Lebensbaum bildet sich
ein großes Auge. In seiner Pupille liegt die heilige Stadt Jerusalem. Wie
zwei Säulen erscheinen die Buchstaben Lamed (im hebräischen Zahlenwert 30)
und Waf (= 6), die das Symbol für die 36 Gerechten bilden, die nach der
Legende, solange sie im Verborgenen in der Welt vorhanden sind, diese vor
der Zerstörung bewahren. Die Wasser des Jordans umspülen Bild und Aussage.
In goldenen Buchstaben krönen das Bild die Worte des Psalmisten (118,17): "Lo
amut, ki ächejä" - "Nicht sterben werde ich, sondern ich werde leben".
|
| |
|
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Mark Elikan: Israelitische Gemeinde Lausanne.
Factsheet des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. 2009. Online
zugänglich. |
 | Presseartikel in der Zeitschrift "Tachles" -
www.tachles.ch:
Artikel von Brigitte Sion "Zeit zum Abschiednehmen". In: Tachles
vom 3. Mai 2002.
Artikel von Olivier Kahn: "Schulterschluss von zwei Gemeinden".
In: Tachles vom 13. September 2007.
Artikel von Gisela Blau: "Einzigartige Lage" (zum Verkauf des
Heimes Les Berges du Léman). In: Tachles vom 18. Dezember 2008.
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
diese Links sind noch nicht aktiviert
|