|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Wiesbaden
Wiesbaden (Hessen)
Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt im 19./20. Jahrhundert
Berichte zu den Rabbinern der Israelitischen Kultusgemeinde im 19./20.
Jahrhundert
Berichte zu den Rabbinern der
"Altisraelitischen Kultusgemeinde" siehe Seite
zur "Altisraelitischen Kultusgemeinde"
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Wiesbaden wurden in jüdischen Periodika
gefunden.
Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Die Texte wurden dankenswerterweise von Susanne Reber (Mannheim) abgeschrieben
und mit Anmerkungen versehen.
Übersicht:
Übersicht über die Rabbiner in Wiesbaden im 19./20. Jahrhundert
Rabbiner der
Israelitischen Kultusgemeinde
 | 1769 bis 1790 Rabbiner Abraham Tendlau (gest. 1790
in Wiesbaden), war 1760 aus Tennenlohe (heute: Stadt Erlangen) nach
Wiesbaden gekommen. |
 | 1790 bis 1829 Rabbiner Heyum Tendlau (gest. 1829 in
Wiesbaden). |
 | 1832 bis 1838: Rabbiner Dr. Abraham Geiger (geb.
1810 in Frankfurt am Main, gest. 1874 in Berlin): studierte in Heidelberg,
Bonn und Marburg; war seit 1832 Rabbiner in Wiesbaden; seit 1838 zweiter
Rabbiner in Breslau, seit 1844 erster Rabbiner ebd.; 1863 Rabbiner in
Frankfurt am Main, 1870 Rabbiner an der Neuen Synagoge in Berlin;
maßgeblich tätig bei der Eröffnung der "Hochschule für die
Wissenschaft des Judentums" 1872 in Berlin. |
 | 1843 bis 1844: Rabbiner Dr. Benjamin Höchstätter
(geb. 1811 in Binswangen, gest. 1888
in Frankfurt am Main): studierte in München; 1833 Lehrer und Prediger in
Heddernheim, 1838 Lehrer und Prediger in Wiesbaden, 1843 provisorisch zum
Bezirksrabbiner für Wiesbaden eingesetzt; 1844 Lehrer und Rabbinatsverweser
in Bad Schwalbach (Langenschwalbach), 1848 Bezirksrabbiner ebd.; 1851
Verlegung des Bezirksrabbinats nach Bad Ems; 1883 in den Ruhestand nach
Frankfurt am Main. |
 | 1844 bis 1884: Rabbiner Dr. Samuel Süskind (geb.
1811 in Kirchheimbolanden,
gest. 1894 in Frankfurt am Main): studierte in München; 1843
Bezirksrabbiner in Weilburg a. d. Lahn,
1844 Bezirksrabbiner in Wiesbaden. |
 | 1884 bis 1908: Rabbiner Dr. Michael Silberstein
(geb. 1834 in Witzenhausen, gest.
1910 in Wiesbaden): studierte in Berlin, Kassel und Breslau: 1858 Leiter
einer Religionsschule in Pleszew (Pleschen), Provinz Posen; 1860
Religionslehrer und Prediger bei der Kreissynagoge in Lyck, Ostpreußen;
1868 Bezirksrabbiner in Buttenhausen, 1874 Bezirksrabbiner in Mühringen,
seit 1884 Bezirksrabbiner in Wiesbaden. |
 | 1908 bis 1918: Rabbiner Dr. Adolf Kober (geb. 1879
in Beuthen, Oberschlesien, gest. 1958 in New York): studierte in Breslau;
1906 bis 1908 Hilfsrabbiner und Religionslehrer in Köln; 1908 bis 1918
Bezirksrabbiner in Wiesbaden; 1918 bis 1939 Rabbiner der Synagogengemeinde
in Köln; 1939 in die USA emigriert; gründete in New York eine
Gemeinde für deutsche Emigranten. |
 | 1918 bis 1938: Rabbiner Dr. Paul Pinchas Lazarus (geb.
1888 in Duisburg-Hamborn, gest. 1951 in Haifa): studierte in Breslau, Marburg
und Erlangen; 1914 zweiter Rabbiner in Essen, 1916 bis 1918 Feldrabbiner;
1918 bis 1938 Bezirks- und Stadtrabbiner in Wiesbaden; 1939 Emigration nach
Haifa, Palästina, wo er Rabbiner einer Einwandergemeinde wurde. An Rabbiner
Dr. Lazarus erinnert in Wiesbaden die "Paul-Lazarus-Straße". |
 | 1939: Rabbiner Dr. Bruno Finkelscherer (geb. 1906 in
München, verschollen 1943 im KZ Auschwitz): studierte in Breslau; 1930
Rabbiner in Göttingen, 1933 Religionslehrer und Rabbinatsassistent in
München, 1939 Rabbiner in Wiesbaden, 1940 bis 1942 Rabbiner in München,
1943 nach Auschwitz deportiert. |
 | 1940 bis 1942: Rabbiner Hansjörg Hanff (geb. 1915
in Stettin, verschollen 1942 nach Deportation in Osteuropa): studierte in
Berlin; 1939 bis 1940 Lehrer im jüdischen Waisenhaus Berlin-Pankow, 1940
Rabbinerexamen, anschließend Rabbiner in Wiesbaden; im Mai 1942
deportiert. |
Rabbiner der orthodoxen Partei
/ israelitischen Religionsgesellschaft beziehungsweise ab 1879 der Altisraelitischen
Kultusgemeinde in Wiesbaden
 | 1830 bis 1853: Rabbiner Samuel Ickstädter (geb.
1806 in Igstadt, gest. 1863 in Hamburg): war zunächst als Talmudlehrer in
Wiesbaden tätig, bewarb sich um 1830 um das Wiesbadener Rabbinat; wird von
der orthodoxen Partei als legitimer Rabbiner anstatt des gewählter Abraham
Geiger angesehen; war in der Folgezeit die Wohnsitz in Wiesbaden zu
Amtshandlungen befugt in den Gemeinden Bierstadt, Biebrich und Schierstein
sowie in allen Gemeinden der Ämter Hochheim und Königstein sowie in
Hattersheim; war halboffizieller orthodoxer Rabbiner für den
Rabbinatsbezirk Wiesbaden; seine Wiesbadener Separatsynagoge wird im Februar
1852 gerichtlich verboten; seit 1853 Stiftsrabbiner an der Lob-Schaul-Klaus
in Hamburg. |
 | 1869 bis 1925 / 1936: Rabbiner Dr. Leo Lipman Kahn
(geb. 1842 in Sulzburg, gest. 1936 in
Wiesbaden): studierte in Berlin und Würzburg; zunächst Rabbinatsassistent
in Berlin; gründete 1869 die Altisraelitische Kultusgemeinde in Wiesbaden
und war bis 1925 deren Rabbiner und Religionslehrer; blieb auch nach seinem
Ruhestand 1925 in Wiesbaden. |
 | 1925 bis 1938: Rabbiner Dr. Jonas Ansbacher (geb.
1879 in Nürnberg, gest. 1967 in London): studierte in Erlangen, Zürich und
Gießen: 1906 Rabbiner in Labischin, Posen, 1911 Rabbiner der orthodoxen
Gemeinde Adass Jeschurun in Heilbronn, 1920/22 bis 1925 Rabbiner der orthodoxen
Israelitischen Religionsgesellschaft in Stuttgart, 1925 bis 1938 Rabbiner
der Altisraelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden; nach dem Novemberpogrom
1938 im KZ Buchenwald interniert, 1939 nach England emigriert; 1941 bis 1955
Rabbiner in Hampstead, London. |
Berichte
zu den Rabbinern der Israelitischen Kultusgemeinde
Neue
Rabbinatseinteilung sowie Aufteilung der Zuständigkeit zwischen Rabbiner Dr.
Höchstädter und Rabbiner Igstädter (1843)
Anmerkung: 1843 wurde eine Einteilung in vier Rabbinatsbezirke vorgenommen:
Wiesbaden, Diez, Weilburg und Langenschwalbach
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
August 1843: "Wiesbaden, im August (1843). Vor einigen
Tagen hat unsere hohe Landesregierung die Rabbinats-Bezirks-Einteilung
geordnet, und die Theologen für dieselben bestimmt. Nämlich: 1) die
jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken Wiesbaden,
Rüdesheim,
Eltville,
Hochheim,
Höchst,
Königstein und
Idstein sind hinsichtlich der
Konfirmation, Religions-Schul-Visitation und zur Hälfte auch der
Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen, hinsichtlich der anderen
Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbiner Igstädter; 2)
Diez,
Limburg, Hadamar,
Montabaur, Wallmerod,
Selters und
Hachenburg dem Dr.
Wormser; 3) Weilburg,
Runkel, Mennerod (gemeint:
Rennerod),
Herborn und
Usingen dem Dr.
Süßkind; 4) Langenschwalbach,
Wehen, Nastätten,
St. Goarshausen,
Nassau und
Braubach dem vormaligen Landrabbinen S. Wormser mit einem Substituten
für die jährlichen Konfirmationen und Schulvisitationen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.
August 1843: "Wiesbaden, im August (1843). Vor einigen
Tagen hat unsere hohe Landesregierung die Rabbinats-Bezirks-Einteilung
geordnet, und die Theologen für dieselben bestimmt. Nämlich: 1) die
jüdischen Gemeinden in den Amtsbezirken Wiesbaden,
Rüdesheim,
Eltville,
Hochheim,
Höchst,
Königstein und
Idstein sind hinsichtlich der
Konfirmation, Religions-Schul-Visitation und zur Hälfte auch der
Kopulationen dem Dr. Höchstädter übertragen, hinsichtlich der anderen
Hälfte der Kopulationen dem früheren Privatrabbiner Igstädter; 2)
Diez,
Limburg, Hadamar,
Montabaur, Wallmerod,
Selters und
Hachenburg dem Dr.
Wormser; 3) Weilburg,
Runkel, Mennerod (gemeint:
Rennerod),
Herborn und
Usingen dem Dr.
Süßkind; 4) Langenschwalbach,
Wehen, Nastätten,
St. Goarshausen,
Nassau und
Braubach dem vormaligen Landrabbinen S. Wormser mit einem Substituten
für die jährlichen Konfirmationen und Schulvisitationen". |
70.
Geburtstag von Rabbiner Dr. Samuel Süskind (1882)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar
1882: "Der 'Rheinische Kurier' schreibt aus Wiesbaden: Am
verflossenen Dienstag, 20. des Monats, beging Herr Bezirksrabbiner Dr.
Süskind seinen 70. Geburtstag. Die hiesige israelitische Kultusgemeinde nahm
hiervon Veranlassung, demselben den Tribut ihrer Achtung und Wertschätzung
darzubringen. Der Vorstand, Herr David Fay, überreichte ihm, wie wir höre,
namens der Gemeinde, eine nicht unansehnliche Gratifikation und begleitete
die Übergabe derselben mit einer sinnreichen Ansprache. Der
Synagogen-Gesang-Verein überraschte ihn schon am Vorabende durch ein
gelungenes Ständchen. Der Präsident desselben, Herr B. Straus, richtete
Worte der Anerkennung und Liebe an den Jubilar, die von dem überraschten und
sichtlich geehrten Herrn Rabbiner durch eine alle Anwesenden ergreifende
Improvisation erwidert wurden und die Vereinsmitglieder am Schlusse zu einem
lebhaften Hoch begeisterten. Viele Mitglieder der israelitischen Gemeinde
fanden sich bei Herrn Süskind ein, sprachen ihm ihre Glückwünsche aus und
überhäuften ihn mit den verschiedenartigsten Aufmerksamkeiten. Obgleich die
Kunde von dem bevorstehenden 70. Geburtstage nur wenig in die Öffentlichkeit
gedrungen war, so lief doch des Tages über von Nah und Fern, vom In- und
Auslande eine große Anzahl von Telegrammen und Beglückwünschungsschreiben
seiner Kollegen, Freunde und Verehrer ein, die beredtes Zeugnis ablegten von
der allgemeinen Achtung, die er nach außen hin genießt und von dem
bedeutenden Rufe, dessen er sich weithin erfreut." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. Januar
1882: "Der 'Rheinische Kurier' schreibt aus Wiesbaden: Am
verflossenen Dienstag, 20. des Monats, beging Herr Bezirksrabbiner Dr.
Süskind seinen 70. Geburtstag. Die hiesige israelitische Kultusgemeinde nahm
hiervon Veranlassung, demselben den Tribut ihrer Achtung und Wertschätzung
darzubringen. Der Vorstand, Herr David Fay, überreichte ihm, wie wir höre,
namens der Gemeinde, eine nicht unansehnliche Gratifikation und begleitete
die Übergabe derselben mit einer sinnreichen Ansprache. Der
Synagogen-Gesang-Verein überraschte ihn schon am Vorabende durch ein
gelungenes Ständchen. Der Präsident desselben, Herr B. Straus, richtete
Worte der Anerkennung und Liebe an den Jubilar, die von dem überraschten und
sichtlich geehrten Herrn Rabbiner durch eine alle Anwesenden ergreifende
Improvisation erwidert wurden und die Vereinsmitglieder am Schlusse zu einem
lebhaften Hoch begeisterten. Viele Mitglieder der israelitischen Gemeinde
fanden sich bei Herrn Süskind ein, sprachen ihm ihre Glückwünsche aus und
überhäuften ihn mit den verschiedenartigsten Aufmerksamkeiten. Obgleich die
Kunde von dem bevorstehenden 70. Geburtstage nur wenig in die Öffentlichkeit
gedrungen war, so lief doch des Tages über von Nah und Fern, vom In- und
Auslande eine große Anzahl von Telegrammen und Beglückwünschungsschreiben
seiner Kollegen, Freunde und Verehrer ein, die beredtes Zeugnis ablegten von
der allgemeinen Achtung, die er nach außen hin genießt und von dem
bedeutenden Rufe, dessen er sich weithin erfreut."
Anmerkung: - Rabbiner Dr. Süskind:
https://www.bbkl.de/index.php/frontend/lexicon/S/Su/suesskind-samuel-71078
|
Rabbiner
Dr. Samuel Süskind darf in den Ruhestand mit fast vollem Gehalt (1883)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni
1883: "Bonn, 27. Mai (Notizen). Das 'Wiesbadener
Tagblatt' berichtet: In einer vom Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
am Sonntagvormittag berufenen und zahlreich besuchten Gemeindeversammlung
wurde beschlossen, den nun seit ca. 40 Jahren in hiesiger Gemeinde als
Prediger und Seelsorger wirkenden, von königl. Regierung auch als
Bezirksrabbiner angestellten, wegen seiner großen Gelehrsamkeit und
vorzüglichen Rednergabe in weiten Kreisen bekannten Herrn Rabbiner Dr. S.
Süskind vom Herbst laufenden Jahres ab mit fast vollem Gehalt in den
wohlverdienten Ruhestand zu versetzen." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni
1883: "Bonn, 27. Mai (Notizen). Das 'Wiesbadener
Tagblatt' berichtet: In einer vom Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
am Sonntagvormittag berufenen und zahlreich besuchten Gemeindeversammlung
wurde beschlossen, den nun seit ca. 40 Jahren in hiesiger Gemeinde als
Prediger und Seelsorger wirkenden, von königl. Regierung auch als
Bezirksrabbiner angestellten, wegen seiner großen Gelehrsamkeit und
vorzüglichen Rednergabe in weiten Kreisen bekannten Herrn Rabbiner Dr. S.
Süskind vom Herbst laufenden Jahres ab mit fast vollem Gehalt in den
wohlverdienten Ruhestand zu versetzen."
Anmerkung: - Wiesbadener Tagblatt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesbadener_Tagblatt |
Ausschreibung
der Rabbiner-Stelle (1883)
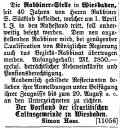 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. August
1883: "Die Rabbiner-Stelle in Wiesbaden, seit 40 Jahren
von Herrn Rabbiner S. Süskind bekleidet, welcher am 1. April laufenden
Jahres in den Ruhestand tritt, soll anderweitig besetzt werden. Dem neu
anzustellenden Rabbiner wird, bei genügender Qualifikation von Königlicher
Regierung auch das Bezirksrabbinat übertragen werden. Anfangsgehalt: Mk.
2.850, -, exklusive beträchtlicher Nebeneinkünfte und Pensionsberechtigung. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. August
1883: "Die Rabbiner-Stelle in Wiesbaden, seit 40 Jahren
von Herrn Rabbiner S. Süskind bekleidet, welcher am 1. April laufenden
Jahres in den Ruhestand tritt, soll anderweitig besetzt werden. Dem neu
anzustellenden Rabbiner wird, bei genügender Qualifikation von Königlicher
Regierung auch das Bezirksrabbinat übertragen werden. Anfangsgehalt: Mk.
2.850, -, exklusive beträchtlicher Nebeneinkünfte und Pensionsberechtigung.
Akademisch gebildete Reflektanten belieben ihre Anmeldungen unter Beifügung
ihrer Zeugnisse bis zum 20. August laufenden Jahres an den Unterzeichneten
zu richten
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde zu Wiesbaden.
Simon Hess." |
Rabbiner
Dr. Michael Silberstein wird vor seinem Wechsel nach Wiesbaden in Mühringen
verabschiedet (1884)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. Mai 1884: "Am 4. Mai fand in
Mühringen eine solenne
Abschiedsfeier für den zum Rabbiner nach Wiesbaden berufenen Dr.
M. Silberstein daselbst statt, an der sich außer den Deputierten der
israelitischen Bezirksgemeinden auch sehr viele christliche Notabilitäten
(katholische Geistliche, Lehrer, Beamte, Ärzte und Private) und die
bürgerlichen Kollegien beteiligten. Unter den vielen Rednern waren auch der
Pfarrer Maier in Mühringen und Schulinspektor Dr. Menz von Bieringen
(gemeint: Bieringen, heute Stadt Rottenburg am Neckar). Dem Scheidenden,
der sich durch seine Leistungen auf der Kanzel wie durch seine Wirksamkeit
für das religiöse Wohl der ihm unterstellten Gemeinden die vollste
Sympathien derselben erworben und erhalten hat, wurde ein sehr wertvolles
Geschenk überreicht." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 20. Mai 1884: "Am 4. Mai fand in
Mühringen eine solenne
Abschiedsfeier für den zum Rabbiner nach Wiesbaden berufenen Dr.
M. Silberstein daselbst statt, an der sich außer den Deputierten der
israelitischen Bezirksgemeinden auch sehr viele christliche Notabilitäten
(katholische Geistliche, Lehrer, Beamte, Ärzte und Private) und die
bürgerlichen Kollegien beteiligten. Unter den vielen Rednern waren auch der
Pfarrer Maier in Mühringen und Schulinspektor Dr. Menz von Bieringen
(gemeint: Bieringen, heute Stadt Rottenburg am Neckar). Dem Scheidenden,
der sich durch seine Leistungen auf der Kanzel wie durch seine Wirksamkeit
für das religiöse Wohl der ihm unterstellten Gemeinden die vollste
Sympathien derselben erworben und erhalten hat, wurde ein sehr wertvolles
Geschenk überreicht."
Anmerkungen: - Solenn: festlich, feierlich
- Rabbiner Dr. Michael Silberstein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |
Amtseinführung
von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1884)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni
1884: "Wiesbaden, 19. Mai. Der 'Rheinische Kurier'
berichtet: Zu der auf Samstag den 17. des Monats festgesetzten Feier der
Einführung des Herrn Dr. Silberstein in sein Amt als Bezirksrabbiner hatte
sich die Synagoge mit Andächtigen dicht gefüllt. Kurz nach 9 Uhr betraten
die Herren Landrat Graf von Matuschka, Herr Dr. Silberstein sowie die Herren
Vorsteher der Gemeinde, die Synagoge. Nach dem Absingen eines Psalmes
seitens des Gesangvereins ergriff der Herr Landrat das Wort, um im Auftrage
Königlicher Regierung der Gemeinde ihren neuen Seelsorger vorzustellen, der
gestern bereits von ihm als solcher auf treue Dienstführung verpflichtet
worden sei. Indem er besonders darauf hinwies, dass diese Form der
Vorstellung gewählt wurde, um der Gemeinde die Wichtigkeit und hohe
Bedeutung dieses Aktes zu vergegenwärtigen, hofft er, dass die letztere
ihrem Geistlichen mit Vertrauen und Wohlwollen entgegenkomme, forderte den
Vorstand auf, denselben in seinem schwierigen Amte gewissenhaft zu
unterstützen und beglückwünschte Herrn Dr. Silberstein zu seinem neuen Amte.
- Letzterer begann hierauf seine neue Wirksamkeit, indem er die Kanzel
betrat und mit hinreißender Beredsamkeit vorgetragenen Rede schilderte er
die Aufgaben und Pflichten eines Seelsorgers und entwarf ein umfassendes
Bild von dem schweren, aber auch schönen und edlen Berufe eines
Seelenhirten, sowie von den Pflichten der Gemeindeglieder, welche ihn in
seinem Amte durch vertrauensvolle Mitwirkung unterstützen müssen, da nur
unter gegenseitiger eifriger Wirksamkeit ein blühendes Gemeindewesen
gedeihen könne. - Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den der Herr
Rabbiner, der eine bedeutende Rednergabe besitzt, wohl auf jeden einzelnen
der Zuhörer hervorrief. Tief ergriffen lauschte jeder der herrlichen,
einstündigen Predigt und wir können der Gemeinde zu einem so vorzüglichen
Kanzelredner nur herzlichst Glück wünschen. Wie wir hören, wird Herr Dr.
Silberstein, auf Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die Predigt durch Druck
vervielfältigen lassen. Zum Schluss trug der Synagogen-Gesangverein, der in
anerkennenswerter Weise durch seinen schönen Gesang wesentlich zur Erhöhung
der Feier beitrug, ein Quartett aus 'Elias' vor." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Juni
1884: "Wiesbaden, 19. Mai. Der 'Rheinische Kurier'
berichtet: Zu der auf Samstag den 17. des Monats festgesetzten Feier der
Einführung des Herrn Dr. Silberstein in sein Amt als Bezirksrabbiner hatte
sich die Synagoge mit Andächtigen dicht gefüllt. Kurz nach 9 Uhr betraten
die Herren Landrat Graf von Matuschka, Herr Dr. Silberstein sowie die Herren
Vorsteher der Gemeinde, die Synagoge. Nach dem Absingen eines Psalmes
seitens des Gesangvereins ergriff der Herr Landrat das Wort, um im Auftrage
Königlicher Regierung der Gemeinde ihren neuen Seelsorger vorzustellen, der
gestern bereits von ihm als solcher auf treue Dienstführung verpflichtet
worden sei. Indem er besonders darauf hinwies, dass diese Form der
Vorstellung gewählt wurde, um der Gemeinde die Wichtigkeit und hohe
Bedeutung dieses Aktes zu vergegenwärtigen, hofft er, dass die letztere
ihrem Geistlichen mit Vertrauen und Wohlwollen entgegenkomme, forderte den
Vorstand auf, denselben in seinem schwierigen Amte gewissenhaft zu
unterstützen und beglückwünschte Herrn Dr. Silberstein zu seinem neuen Amte.
- Letzterer begann hierauf seine neue Wirksamkeit, indem er die Kanzel
betrat und mit hinreißender Beredsamkeit vorgetragenen Rede schilderte er
die Aufgaben und Pflichten eines Seelsorgers und entwarf ein umfassendes
Bild von dem schweren, aber auch schönen und edlen Berufe eines
Seelenhirten, sowie von den Pflichten der Gemeindeglieder, welche ihn in
seinem Amte durch vertrauensvolle Mitwirkung unterstützen müssen, da nur
unter gegenseitiger eifriger Wirksamkeit ein blühendes Gemeindewesen
gedeihen könne. - Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den der Herr
Rabbiner, der eine bedeutende Rednergabe besitzt, wohl auf jeden einzelnen
der Zuhörer hervorrief. Tief ergriffen lauschte jeder der herrlichen,
einstündigen Predigt und wir können der Gemeinde zu einem so vorzüglichen
Kanzelredner nur herzlichst Glück wünschen. Wie wir hören, wird Herr Dr.
Silberstein, auf Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die Predigt durch Druck
vervielfältigen lassen. Zum Schluss trug der Synagogen-Gesangverein, der in
anerkennenswerter Weise durch seinen schönen Gesang wesentlich zur Erhöhung
der Feier beitrug, ein Quartett aus 'Elias' vor."
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Silberstein:https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein
- Graf von Matuschka:
https://de.wikipedia.org/wiki/Guido_von_Matuschka-Greiffenclau
- Synagogen-Gesangverein: Vgl.
Artikel von 1913
- Elias:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elias_(Mendelssohn) |
Die
Antrittspredigt von Rabbiner Dr. Michael Silberstein wird veröffentlicht
(1884/85)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. April 1885: "Je weniger gegenwärtig die jüdische
Homiletik in der Literatur eine gedeihliche Pflege findet, desto eher fühlen
wir uns verpflichtet, die einzeln erschienenen Predigten an dieser Stelle
aufzuführen. 'Das geistliche Amt – Ein Hirtenamt', Antrittspredigt des
Dr. M. Silberstein als Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden
(Wiesbaden, Rodrian, 1884)." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 14. April 1885: "Je weniger gegenwärtig die jüdische
Homiletik in der Literatur eine gedeihliche Pflege findet, desto eher fühlen
wir uns verpflichtet, die einzeln erschienenen Predigten an dieser Stelle
aufzuführen. 'Das geistliche Amt – Ein Hirtenamt', Antrittspredigt des
Dr. M. Silberstein als Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden
(Wiesbaden, Rodrian, 1884)."
Anmerkung: - Homiletik:
https://de.wikipedia.org/wiki/Homiletik |
80.
Geburtstag von Rabbiner Dr. Samuel Süskind (1892 in Frankfurt)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar
1892: "Frankfurt a. M., 28. Dez. Herr Rabbiner S. Süskind
aus Wiesbaden feierte jüngst hier
seinen 80. Geburtstag. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde sowie
der des 'Synagogen-Gesangvereins' entsandten je 3 Mitglieder, welche dem
Jubilar die Ehrengeschenke namens der Gemeinde, respektive der
Vereinsmitglieder überreichten. Herr Vorsteher S. Heß hielt eine Ansprache,
welche einen tiefen Eindruck sowohl auf den Jubilar als auch alle Anwesenden
ausübte. Er hob unter anderem hervor, nachdem er seine Glückwünsche
ausgesprochen hatte, dass sich die israelitische Kultusgemeinde, wenngleich
der Jubilar nicht mehr in ihrer Mitte stehe und wirke, noch aufs Innigste
mit ihm verbunden fühlte. Sein 40jähriges Wirken könne man nur vergleichen
mit einer 40jährigen, glücklich durchlebten Ehegemeinschaft, in der man
gemeinsam Leid und Freud getragen; ein Gut lerne man dann erst schätzen,
wenn man es verloren habe. Er habe sich die Liebe und Wertschätzung seiner
ehemaligen Gemeinde in hohem Maße erworben und sich ein bleibendes Andenken
in den Herzen seiner früheren Gemeindeangehörigen gesetzt. - Aufs Tiefste
bewegt, ergriff nun Herr Rabbiner Süskind das Wort. Waren die Anwesenden von
der seltenen Geistes- und Körperfrische des 80jährigen Jubelgreises geradezu
überrascht, so waren sie von dem Inhalte seiner im kräftigsten Tone
vorgetragenen Rede tatsächlich zu Tränen gerührt. Zunächst sprach er seien
Dank aus für die Beweise der Liebe und Freundschaft, die ihm teure Gemeinde
entgegenbringe. Die ihm erwiesenen Ehren übersteigen seine kühnsten
Erwartungen und erfüllten ihn mit Stolz. In allgemeinen Zügen schilderte er
alsdann die Zustände, wie sie früher bestanden, als er vor etwa einem halben
Jahrhundert seine Stelle angetreten, dass damals die Gemeinde kaum 30
Mitglieder zählte, und bei seinem Weggange auf mehrere Hundert angewachsen
sei. Desweiteren brachte er Reminiszenzen aus der langen Zeit seiner
hiesigen amtlichen Wirksamkeit, die für die Zuhörerschaft des Interessanten
viel enthielten. Lobend hob er hervor, dass ihm stets das größte Vertrauen
entgegengebracht worden sei. Gerne und willig haben seine frühesten
Gemeindemitglieder, wovon heute vielleicht kein einziges mehr am Leben sei,
die von ihm als zeitgemäß erachteten Reformen angenommen, was seinem
Amtsvorgänger, dem israelitischen Rabbiner Dr. Geiger – später Rabbiner in
Berlin – nicht gelingen wollte, und namentlich gereiche es ihm zur
Befriedigung, dass der damals von ihm eingeführte Gottesdienst bis heute
noch unverändert beibehalten worden sei. Zur Deputation des
'Synagogen-Gesangvereins' gewendet, bemerkte er, dass er es sich zur Ehre
anrechne, Ehrenpräsident dieses Vereins zu sein, bei dessen Gründung er
mitgewirkt und der stets eine erhebende und erfolgreiche Wirksamkeit
entfaltet habe. Der Verein habe zur Hebung des Gottesdienstes wesentlich
beigetragen, das Ansehen der Kultusgemeinde auch nach außen hin gefördert
und sich auch in den Dienst der Kunst gestellt. Zum Schluss bat er Süskind
die Herren, den Mitgliedern der Kultusgemeinde und des
'Synagogen-Gesangvereins' seinen Dank und seinen Gruß zu übermitteln. Der
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde hat sich selbst geehrt, indem er
den Beweis lieferte, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen
wollte, seinem einstigen würdigen Rabbiner auch durch ein äußerliches
Zeichen seiner Dankbarkeit und Verehrung selbst da noch zu geben, wo er
längst schon in dem wohlverdienten Ruhestand, räumlich von ihm getrennt,
lebt. Dem Herrn Dr. Süskind ist aber dieser Ausdruck der Verehrung seitens
des Vorstandes, dem sich auch noch ein sichtbares Dankeszeichen des
'Synagogen-Gesangvereins' würdig anreihte, eine erhebende Rückerinnerung an
seine 40jährige Amtstätigkeit."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. Januar
1892: "Frankfurt a. M., 28. Dez. Herr Rabbiner S. Süskind
aus Wiesbaden feierte jüngst hier
seinen 80. Geburtstag. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde sowie
der des 'Synagogen-Gesangvereins' entsandten je 3 Mitglieder, welche dem
Jubilar die Ehrengeschenke namens der Gemeinde, respektive der
Vereinsmitglieder überreichten. Herr Vorsteher S. Heß hielt eine Ansprache,
welche einen tiefen Eindruck sowohl auf den Jubilar als auch alle Anwesenden
ausübte. Er hob unter anderem hervor, nachdem er seine Glückwünsche
ausgesprochen hatte, dass sich die israelitische Kultusgemeinde, wenngleich
der Jubilar nicht mehr in ihrer Mitte stehe und wirke, noch aufs Innigste
mit ihm verbunden fühlte. Sein 40jähriges Wirken könne man nur vergleichen
mit einer 40jährigen, glücklich durchlebten Ehegemeinschaft, in der man
gemeinsam Leid und Freud getragen; ein Gut lerne man dann erst schätzen,
wenn man es verloren habe. Er habe sich die Liebe und Wertschätzung seiner
ehemaligen Gemeinde in hohem Maße erworben und sich ein bleibendes Andenken
in den Herzen seiner früheren Gemeindeangehörigen gesetzt. - Aufs Tiefste
bewegt, ergriff nun Herr Rabbiner Süskind das Wort. Waren die Anwesenden von
der seltenen Geistes- und Körperfrische des 80jährigen Jubelgreises geradezu
überrascht, so waren sie von dem Inhalte seiner im kräftigsten Tone
vorgetragenen Rede tatsächlich zu Tränen gerührt. Zunächst sprach er seien
Dank aus für die Beweise der Liebe und Freundschaft, die ihm teure Gemeinde
entgegenbringe. Die ihm erwiesenen Ehren übersteigen seine kühnsten
Erwartungen und erfüllten ihn mit Stolz. In allgemeinen Zügen schilderte er
alsdann die Zustände, wie sie früher bestanden, als er vor etwa einem halben
Jahrhundert seine Stelle angetreten, dass damals die Gemeinde kaum 30
Mitglieder zählte, und bei seinem Weggange auf mehrere Hundert angewachsen
sei. Desweiteren brachte er Reminiszenzen aus der langen Zeit seiner
hiesigen amtlichen Wirksamkeit, die für die Zuhörerschaft des Interessanten
viel enthielten. Lobend hob er hervor, dass ihm stets das größte Vertrauen
entgegengebracht worden sei. Gerne und willig haben seine frühesten
Gemeindemitglieder, wovon heute vielleicht kein einziges mehr am Leben sei,
die von ihm als zeitgemäß erachteten Reformen angenommen, was seinem
Amtsvorgänger, dem israelitischen Rabbiner Dr. Geiger – später Rabbiner in
Berlin – nicht gelingen wollte, und namentlich gereiche es ihm zur
Befriedigung, dass der damals von ihm eingeführte Gottesdienst bis heute
noch unverändert beibehalten worden sei. Zur Deputation des
'Synagogen-Gesangvereins' gewendet, bemerkte er, dass er es sich zur Ehre
anrechne, Ehrenpräsident dieses Vereins zu sein, bei dessen Gründung er
mitgewirkt und der stets eine erhebende und erfolgreiche Wirksamkeit
entfaltet habe. Der Verein habe zur Hebung des Gottesdienstes wesentlich
beigetragen, das Ansehen der Kultusgemeinde auch nach außen hin gefördert
und sich auch in den Dienst der Kunst gestellt. Zum Schluss bat er Süskind
die Herren, den Mitgliedern der Kultusgemeinde und des
'Synagogen-Gesangvereins' seinen Dank und seinen Gruß zu übermitteln. Der
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde hat sich selbst geehrt, indem er
den Beweis lieferte, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen
wollte, seinem einstigen würdigen Rabbiner auch durch ein äußerliches
Zeichen seiner Dankbarkeit und Verehrung selbst da noch zu geben, wo er
längst schon in dem wohlverdienten Ruhestand, räumlich von ihm getrennt,
lebt. Dem Herrn Dr. Süskind ist aber dieser Ausdruck der Verehrung seitens
des Vorstandes, dem sich auch noch ein sichtbares Dankeszeichen des
'Synagogen-Gesangvereins' würdig anreihte, eine erhebende Rückerinnerung an
seine 40jährige Amtstätigkeit."
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Geiger:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Geiger
https://wiesbaden.deutscher-koordinierungsrat.de/gcjz-wiesbaden-Abraham-Geiger-Rabbiner-in-Wiesbaden-2012
https://www.lagis-hessen.de/pnd/11933304X
Synagogen-Gesangverein: vgl.
Artikel von 1913 |
Bezirksrabbiner Dr.
Michael Silberstein ist zur Enthüllung des Kaiser
Friedrich-Denkmals geladen (1897)
Rabbiner
Dr. Michael Silberstein ist zur Einweihung des neuen Kurhauses eingeladen (1907)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 24. Mai 1907: "Wiesbaden. Zu den aus Anlass der
Einweihung des neuen Kurhauses veranlassten Festlichkeiten empfing neben den
Spitzen der Behörden als Ehrengast der Stadt Wiesbaden auch Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Silberstein eine Einladung. Er erhielt seinen Platz
neben den Spitzen der evangelischen und katholischen Geistlichkeit.
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 24. Mai 1907: "Wiesbaden. Zu den aus Anlass der
Einweihung des neuen Kurhauses veranlassten Festlichkeiten empfing neben den
Spitzen der Behörden als Ehrengast der Stadt Wiesbaden auch Herrn
Bezirksrabbiner Dr. Silberstein eine Einladung. Er erhielt seinen Platz
neben den Spitzen der evangelischen und katholischen Geistlichkeit.
Anmerkungen: - Kurhaus Wiesbaden:
https://kurhaus.wiesbaden.de/index.php
- Rabbiner Dr. Silberstein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |
Abschiedsfeier
für Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1908)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 18. September 1908: "Wiesbaden. Am 13. des Monats weilten
hier die Herren Rabb. Dr. Landau –
Weilburg und Dr. Weingarten – Ems
zu einer Abschiedsfeier des am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden greisen
Rabbiners und Gelehrten Herrn Dr. Silberstein. Herr Dr. Landau
feierte seinen Kollegen als Gelehrten und Verfasser religiös-pädagogischer
Schriften und Herr Dr. Weingarten hob in seiner Ansprache die
Kollegialität seines Freundes hervor. Beiden dankte Herr Dr. Silberstein
und versprach weiterhin Freundschaft seinen Amtsgenossen zu bewahren.
Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 18. September 1908: "Wiesbaden. Am 13. des Monats weilten
hier die Herren Rabb. Dr. Landau –
Weilburg und Dr. Weingarten – Ems
zu einer Abschiedsfeier des am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden greisen
Rabbiners und Gelehrten Herrn Dr. Silberstein. Herr Dr. Landau
feierte seinen Kollegen als Gelehrten und Verfasser religiös-pädagogischer
Schriften und Herr Dr. Weingarten hob in seiner Ansprache die
Kollegialität seines Freundes hervor. Beiden dankte Herr Dr. Silberstein
und versprach weiterhin Freundschaft seinen Amtsgenossen zu bewahren.
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Landau: Emil Elias Landau (1842 in
Klasno-Wielitzka, Galizien – 1924 in Weilburg)
- Rabbiner Dr. Weingarten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Laser_Weingarten
- Rabbiner Dr. Silberstein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Silberstein |
Abschiedspredigt
von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1908)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.
Oktober 1908: "Wiesbaden, 2. Oktober. Am zweiten Neujahrstage
hielt der Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. M. Silberstein hier, da er
mit diesem Tage aus seinem Amt schied, das er im Allgemeinen fast 50 Jahre,
davon 25 Jahre in der hiesigen 'israelitischen Kultusgemeinde', verwaltet,
seine Abschiedspredigt, nach der ihm von den Mitgliedern des Vorstandes, wie
auch aus der Mitte der Gemeinde zahlreiche Aufmerksamkeiten erwiesen wurden.
Schon gelegentlich seines 70. Geburtstages, 1904, wurde der Jubilar von der
Gemeinde in ehrendster Weise gefeiert und von dieser durch mancherlei
Beweise der Verehrung erfreut. Die Gemeinde selbst widmete ihm damals einen
großen silbernen Tafelaufsatz und die ihm unterstellten jüdischen
Religionslehrer ein Gedenkblatt mit ihren Fotografien. Der bis zuletzt in
voller geistiger und körperlicher Frische seines Amtes Waltende ist in
Witzenhausen (Hessen) geboren. Seine
akademischen Studien absolvierte er an der Berliner Universität (1855 bis
1858). Seine akademische Laufbahn begann er in Altpreußen, wo er von 1858
bis 1858 wirkte, von da bis 1884 amtierte er in Württemberg, von wo er, ohne
dass eine Bewerbung seinerseits erfolgte – er war insbesondere durch seine
(1882) am Grabe Berthold Auerbachs,
zu dem er freundschaftliche Beziehungen hatte, gehaltene Rede weiteren
Kreisen bekannt geworden – hierher berufen wurde. Hier, wie auch in seinen
früheren Wirkungsstätten, entfaltete er eine erfolgreiche literarische
Tätigkeit. Hier hat er auch auf humanistischem Gebiet segensreich gewirkt,
wovon insbesondere der 'Waisen-Unterstützungsfonds' zeugt. Seiner Anregung
verdankt auch die Gemeindebibliothek ihre Begründung, die zu den
ansehnlichsten dieser Art zählt. Vor zwei Jahren wurde Dr. Silberstein durch
Verleihung des Roten Adlerordens ausgezeichnet. Möge ihm die wohlverdiente
Muße noch lange beschieden sein." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.
Oktober 1908: "Wiesbaden, 2. Oktober. Am zweiten Neujahrstage
hielt der Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. M. Silberstein hier, da er
mit diesem Tage aus seinem Amt schied, das er im Allgemeinen fast 50 Jahre,
davon 25 Jahre in der hiesigen 'israelitischen Kultusgemeinde', verwaltet,
seine Abschiedspredigt, nach der ihm von den Mitgliedern des Vorstandes, wie
auch aus der Mitte der Gemeinde zahlreiche Aufmerksamkeiten erwiesen wurden.
Schon gelegentlich seines 70. Geburtstages, 1904, wurde der Jubilar von der
Gemeinde in ehrendster Weise gefeiert und von dieser durch mancherlei
Beweise der Verehrung erfreut. Die Gemeinde selbst widmete ihm damals einen
großen silbernen Tafelaufsatz und die ihm unterstellten jüdischen
Religionslehrer ein Gedenkblatt mit ihren Fotografien. Der bis zuletzt in
voller geistiger und körperlicher Frische seines Amtes Waltende ist in
Witzenhausen (Hessen) geboren. Seine
akademischen Studien absolvierte er an der Berliner Universität (1855 bis
1858). Seine akademische Laufbahn begann er in Altpreußen, wo er von 1858
bis 1858 wirkte, von da bis 1884 amtierte er in Württemberg, von wo er, ohne
dass eine Bewerbung seinerseits erfolgte – er war insbesondere durch seine
(1882) am Grabe Berthold Auerbachs,
zu dem er freundschaftliche Beziehungen hatte, gehaltene Rede weiteren
Kreisen bekannt geworden – hierher berufen wurde. Hier, wie auch in seinen
früheren Wirkungsstätten, entfaltete er eine erfolgreiche literarische
Tätigkeit. Hier hat er auch auf humanistischem Gebiet segensreich gewirkt,
wovon insbesondere der 'Waisen-Unterstützungsfonds' zeugt. Seiner Anregung
verdankt auch die Gemeindebibliothek ihre Begründung, die zu den
ansehnlichsten dieser Art zählt. Vor zwei Jahren wurde Dr. Silberstein durch
Verleihung des Roten Adlerordens ausgezeichnet. Möge ihm die wohlverdiente
Muße noch lange beschieden sein."
Anmerkungen: - Neujahrstage:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana
- Altpreußen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Altpreu%C3%9Fen
- Berthold Auerbach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Auerbach
https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0763
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/deutsch/dichter/bertholdauerbach
- Roter Adlerorden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Adlerorden
|
Wahl
von Rabbiner Dr. Adolf Kober zum Stadt- und Bezirksrabbiner in Wiesbaden (1908)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. Juni 1908: "Wiesbaden. Dr. Adolf Kober aus
Breslau, bisher stellvertretender Rabbiner der jüdischen Gemeinde in
Köln, wurde zum hiesigen Stadt- und Bezirksrabbiner
gewählt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 26. Juni 1908: "Wiesbaden. Dr. Adolf Kober aus
Breslau, bisher stellvertretender Rabbiner der jüdischen Gemeinde in
Köln, wurde zum hiesigen Stadt- und Bezirksrabbiner
gewählt."
Anmerkung: - Rabbiner Dr. Adolf Kohler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Kober |
Amtseinführung
von Rabbiner Dr. Adolf Kober (1908)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1908: "Wiesbaden, 9. Oktober. Der neugewählte
Rabbiner unserer Gemeinde, Dr. Adolf Kober, wurde gelegentlich
des gestrigen Gottesdienstes in der Synagoge von Polizeipräsident von
Schenck in sein Amt eingeführt, nachdem er vorgestern bereits durch diesen
als Bezirksrabbiner vereidigt worden ist. Die Polizeipräsident wies in einer
kurzen Ansprache darauf hin, wie die Gemeinde und jedes einzelne Glied Dr.
Kober als Kultusdiener und Lehrer zu achten und zu ehren, ihm zu helfen
habe, in seinem Amte mit Rat und Tat und dem Rabbiner selbst legte er ans
Herz, das Vertrauen, das ihm die Gemeinde durch seine Berufung erwiesen, zu
rechtfertigen, indem er mit Freude und Gewissenhaftigkeit seines Amtes
walte. Wenn er das tue, so könne er auch des Schutzes und Beistandes der
staatlichen Behörden gewiss sein. So, schloss der Polizeipräsident, möge er
allezeit sein Amt führen zur eigenen Befriedigung und zum Segen der
Gemeinde. Ein Segenswort für die Letzteren war es auch, mit dem Dr. Kober
seine Antrittspredigt begann, die allgemeinen Beifall gefunden hat. Der
Gottesdienst wurde durch den 'Synagogen-Gesangverein' verherrlicht, der
unter anderem vor Beginn der Predigt die Beethoven’sche Hymne 'Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre' sang. - Die Städtische Schuldeputation hat an
den scheidenden Bezirksrabbiner Dr. Silberstein das folgende Schreiben
gerichtet: 'Wiesbaden, 2. Oktober 1908. Die Schuldeputation hat in der
gestrigen Sitzung mit Bedauern von ihrem Ausscheiden Kenntnis genommen und
mich beauftragt, Ihnen innigen Dank für Ihre Teilnahme an den im Interesse
unserer Volks- und Mittelschulen gepflogenen Beratungen und zugleich die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu Ihrem fünfzigjährigen
Dienstjubiläum und zu der nunmehr für Sie anbrechenden wohlverdienten
Ruhezeit auszusprechen. Möge Ihr Lebensabend recht heiter sein!'"
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1908: "Wiesbaden, 9. Oktober. Der neugewählte
Rabbiner unserer Gemeinde, Dr. Adolf Kober, wurde gelegentlich
des gestrigen Gottesdienstes in der Synagoge von Polizeipräsident von
Schenck in sein Amt eingeführt, nachdem er vorgestern bereits durch diesen
als Bezirksrabbiner vereidigt worden ist. Die Polizeipräsident wies in einer
kurzen Ansprache darauf hin, wie die Gemeinde und jedes einzelne Glied Dr.
Kober als Kultusdiener und Lehrer zu achten und zu ehren, ihm zu helfen
habe, in seinem Amte mit Rat und Tat und dem Rabbiner selbst legte er ans
Herz, das Vertrauen, das ihm die Gemeinde durch seine Berufung erwiesen, zu
rechtfertigen, indem er mit Freude und Gewissenhaftigkeit seines Amtes
walte. Wenn er das tue, so könne er auch des Schutzes und Beistandes der
staatlichen Behörden gewiss sein. So, schloss der Polizeipräsident, möge er
allezeit sein Amt führen zur eigenen Befriedigung und zum Segen der
Gemeinde. Ein Segenswort für die Letzteren war es auch, mit dem Dr. Kober
seine Antrittspredigt begann, die allgemeinen Beifall gefunden hat. Der
Gottesdienst wurde durch den 'Synagogen-Gesangverein' verherrlicht, der
unter anderem vor Beginn der Predigt die Beethoven’sche Hymne 'Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre' sang. - Die Städtische Schuldeputation hat an
den scheidenden Bezirksrabbiner Dr. Silberstein das folgende Schreiben
gerichtet: 'Wiesbaden, 2. Oktober 1908. Die Schuldeputation hat in der
gestrigen Sitzung mit Bedauern von ihrem Ausscheiden Kenntnis genommen und
mich beauftragt, Ihnen innigen Dank für Ihre Teilnahme an den im Interesse
unserer Volks- und Mittelschulen gepflogenen Beratungen und zugleich die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu Ihrem fünfzigjährigen
Dienstjubiläum und zu der nunmehr für Sie anbrechenden wohlverdienten
Ruhezeit auszusprechen. Möge Ihr Lebensabend recht heiter sein!'"
Anmerkungen: - Polizeipräsident von Schenck:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Schenck
https://www.lagis-hessen.de/pnd/1170603378
Synagogen-Gesangverein: vgl.
Artikel von 1913 Gesangsstück:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Himmel_rühmen |
Zum
Tod von Rabbiner Dr. Michael Silberstein (1910)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Oktober
1910: "Wiesbaden, 20. Oktober. Am Abend des Versöhnungstages
entschlief in Folge einer Arterienverkalkung im 76. Jahr seines Lebens der
seit nunmehr seit zwei Jahren emeritierte Stadt- und Bezirksrabbiner Dr.
Michael Silberstein. Als Sohn eines Lehrers am 1. November 1834 in
Witzenhausen Bezirk Eschwege,
geboren, wurde er Verewigte zunächst zum Kaufmannsstande bestimmt. Sein
ideales Streben aber ließ ihn in dem Berufe nicht die wahre Befriedigung
finden, sodass es ihm gestatte wurde, im Jahre 1850 die eben erst begründete
Bildungsanstalt für jüdische Lehrer in Hannover zu besuchen, welche er nach
dreijährigem Besuche mit einem geradezu glänzenden Zeugnis verließ. Sein
rastloser Bildungsdrang führte ihn nach zwei Jahren schon nach Berlin, wo er
bis zum Jahre 1858 theologischen und philosophischen Studien oblag. Die
Veitel Ephraimsche Stiftung war die Stätte, an der er sich zum Rabbiner
heranbildete und die Universität der Born seiner profanen Bildung. Sein
Vorbild und Lehrer war der Altmeister Dr. Michael Sachs seligen Andenkens,
dessen Bild in seinem Arbeitszimmer an hervorragender Stelle zu sehen ist,
und der Oberrabbiner Aub. Leopold Ranke weckte und förderte seinen Sinn für
Geschichte. Als der Verblichene im Jahr 1858 seine Studien mit gutem Erfolge
beendet hatte, nahm er seine erste Stellung als Lehrer in Pleschen an, wurde
aber schon nach kaum anderthalb Jahren als Rabbiner nach Lyck (Ostpreußen)
berufen. Hier wusste er durch sein mannhaftes Auftreten in der
Öffentlichkeit unserer Glaubensgenossenschaft Anerkennung und Beachtung zu
verschaffen . Nach achtjähriger segensreicher Wirksamkeit siedelte er dann
1868 nach Württemberg über. Im Jahre 1874 wurde er nach
Mühringen im Schwarzwald versetzt, wo
er bis 1885 wirkte. 1869 berief die württembergische Regierung eine
Delegiertenversammlung zwecks Beratung eines Verfassungsentwurfes für die
israelitische Glaubensgemeinschaft. Silberstein als geistliches Mitglied
dieser Kommission, trat damals mit einem längeren Exposé vor das Plenum und
hatte die Genugtuung, dass seine Vorschläge fast sämtlich angenommen wurden.
Die Hochachtung und Wertschätzung, die sich der Verblichene durch sein
mannhaftes würdiges Auftreten sowohl wie durch den Glanz seiner Beredsamkeit
erwarb, erreichte durch seine Rede am Grabe Berthold Auerbachs (vgl.
Nordstetten) ihren Höhepunkt.
Damals wurde Dr. Silberstein in der breitesten Öffentlichkeit bekannt, und
als der Rabbinatssitz in Wiesbaden vakant wurde, berief man den gefeierten
Mann in unsere Bäderstadt. Hier wirkte er in einer ununterbrochenen fast
25jährigen Tätigkeit für das Wohl der Juden Wiesbadens, derer seines Bezirks
wie auch der jüdischen und außerjüdischen Allgemeinheit. Wiesbaden hat sich
in den letzten Jahren zur Großstadt entwickelt und die jüdische Gemeinde ist
auf dem besten Weg, eine Großgemeinde zu werden. Wenn die Institutionen mit
der Entwicklung gleichen Schritt gehalten haben, so ist die ein
Hauptverdienst des Entschlafenen. Ihm ist zu danken: Die Gründung des
Israelitischen Unterstützungsvereins, des Israelitischen Waisenfonds, der
Gemeindebibliothek usw. Besondere Fürsorge widmete er den Bestrebungen der
Alliance und des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Hier hat er vor
einigen Jahren eine größerer Stiftung zwecks Unterstützung jüdischer
Studierender, die Dr. Michael und Rebekka Silberstein-Stiftung errichtet und
sich dadurch unsterblich gemacht. Die Haupttätigkeit des Entschlafenen war
der jüdischen Schule und deren Lehrer gewidmet. Hier zeigte er so recht sein
Können und sein Herz. Auch als geistreicher Schriftsteller ist der
Entschlafene weit bekannt geworden.Seine Schriften beziehen sich auf das
Gesamtgebiet des jüdischen Wissens, Lebens und Unterrichtes. In seinen
Bestrebungen wurde Dr. Silberstein durch seine Gemahlin wacker unterstützt
und gefördert. Sie ist im Tode um kaum fünf Wochen vorausgegangen. Die
beiden Gatten führten eine geradezu ideale Ehe in ihrem gemeinsamen Schaffen
und Streben. Der hohen Bedeutung Dr. Silbersteins entsprach seine
Wertschätzung, welche gelegentlich seines 70. Geburtstages so recht zum
Ausdruck kam. Vorstände, Korporationen sowie auch viele Private wetteiferten
damals in Darbringung von Ovationen. Seine Majestät verlieh ihm den Roten
Adlerorden IV. Klasse. Die am Sonntag, 16. Oktober, stattgehabte Beerdigung
gab abermals den Beweis, der großen Wertschätzung für den Verblichenen. Die
Kultusgemeinde ließ es sich nicht nehmen, die Leiche ihres Seelsorgers
nochmals an die Stätte seiner Wirksamkeit zu führen. Eine stattliche
Versammlung, bei der auch die staatlichen und kommunalen Behörden
vollständig vertreten Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Oktober
1910: "Wiesbaden, 20. Oktober. Am Abend des Versöhnungstages
entschlief in Folge einer Arterienverkalkung im 76. Jahr seines Lebens der
seit nunmehr seit zwei Jahren emeritierte Stadt- und Bezirksrabbiner Dr.
Michael Silberstein. Als Sohn eines Lehrers am 1. November 1834 in
Witzenhausen Bezirk Eschwege,
geboren, wurde er Verewigte zunächst zum Kaufmannsstande bestimmt. Sein
ideales Streben aber ließ ihn in dem Berufe nicht die wahre Befriedigung
finden, sodass es ihm gestatte wurde, im Jahre 1850 die eben erst begründete
Bildungsanstalt für jüdische Lehrer in Hannover zu besuchen, welche er nach
dreijährigem Besuche mit einem geradezu glänzenden Zeugnis verließ. Sein
rastloser Bildungsdrang führte ihn nach zwei Jahren schon nach Berlin, wo er
bis zum Jahre 1858 theologischen und philosophischen Studien oblag. Die
Veitel Ephraimsche Stiftung war die Stätte, an der er sich zum Rabbiner
heranbildete und die Universität der Born seiner profanen Bildung. Sein
Vorbild und Lehrer war der Altmeister Dr. Michael Sachs seligen Andenkens,
dessen Bild in seinem Arbeitszimmer an hervorragender Stelle zu sehen ist,
und der Oberrabbiner Aub. Leopold Ranke weckte und förderte seinen Sinn für
Geschichte. Als der Verblichene im Jahr 1858 seine Studien mit gutem Erfolge
beendet hatte, nahm er seine erste Stellung als Lehrer in Pleschen an, wurde
aber schon nach kaum anderthalb Jahren als Rabbiner nach Lyck (Ostpreußen)
berufen. Hier wusste er durch sein mannhaftes Auftreten in der
Öffentlichkeit unserer Glaubensgenossenschaft Anerkennung und Beachtung zu
verschaffen . Nach achtjähriger segensreicher Wirksamkeit siedelte er dann
1868 nach Württemberg über. Im Jahre 1874 wurde er nach
Mühringen im Schwarzwald versetzt, wo
er bis 1885 wirkte. 1869 berief die württembergische Regierung eine
Delegiertenversammlung zwecks Beratung eines Verfassungsentwurfes für die
israelitische Glaubensgemeinschaft. Silberstein als geistliches Mitglied
dieser Kommission, trat damals mit einem längeren Exposé vor das Plenum und
hatte die Genugtuung, dass seine Vorschläge fast sämtlich angenommen wurden.
Die Hochachtung und Wertschätzung, die sich der Verblichene durch sein
mannhaftes würdiges Auftreten sowohl wie durch den Glanz seiner Beredsamkeit
erwarb, erreichte durch seine Rede am Grabe Berthold Auerbachs (vgl.
Nordstetten) ihren Höhepunkt.
Damals wurde Dr. Silberstein in der breitesten Öffentlichkeit bekannt, und
als der Rabbinatssitz in Wiesbaden vakant wurde, berief man den gefeierten
Mann in unsere Bäderstadt. Hier wirkte er in einer ununterbrochenen fast
25jährigen Tätigkeit für das Wohl der Juden Wiesbadens, derer seines Bezirks
wie auch der jüdischen und außerjüdischen Allgemeinheit. Wiesbaden hat sich
in den letzten Jahren zur Großstadt entwickelt und die jüdische Gemeinde ist
auf dem besten Weg, eine Großgemeinde zu werden. Wenn die Institutionen mit
der Entwicklung gleichen Schritt gehalten haben, so ist die ein
Hauptverdienst des Entschlafenen. Ihm ist zu danken: Die Gründung des
Israelitischen Unterstützungsvereins, des Israelitischen Waisenfonds, der
Gemeindebibliothek usw. Besondere Fürsorge widmete er den Bestrebungen der
Alliance und des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Hier hat er vor
einigen Jahren eine größerer Stiftung zwecks Unterstützung jüdischer
Studierender, die Dr. Michael und Rebekka Silberstein-Stiftung errichtet und
sich dadurch unsterblich gemacht. Die Haupttätigkeit des Entschlafenen war
der jüdischen Schule und deren Lehrer gewidmet. Hier zeigte er so recht sein
Können und sein Herz. Auch als geistreicher Schriftsteller ist der
Entschlafene weit bekannt geworden.Seine Schriften beziehen sich auf das
Gesamtgebiet des jüdischen Wissens, Lebens und Unterrichtes. In seinen
Bestrebungen wurde Dr. Silberstein durch seine Gemahlin wacker unterstützt
und gefördert. Sie ist im Tode um kaum fünf Wochen vorausgegangen. Die
beiden Gatten führten eine geradezu ideale Ehe in ihrem gemeinsamen Schaffen
und Streben. Der hohen Bedeutung Dr. Silbersteins entsprach seine
Wertschätzung, welche gelegentlich seines 70. Geburtstages so recht zum
Ausdruck kam. Vorstände, Korporationen sowie auch viele Private wetteiferten
damals in Darbringung von Ovationen. Seine Majestät verlieh ihm den Roten
Adlerorden IV. Klasse. Die am Sonntag, 16. Oktober, stattgehabte Beerdigung
gab abermals den Beweis, der großen Wertschätzung für den Verblichenen. Die
Kultusgemeinde ließ es sich nicht nehmen, die Leiche ihres Seelsorgers
nochmals an die Stätte seiner Wirksamkeit zu führen. Eine stattliche
Versammlung, bei der auch die staatlichen und kommunalen Behörden
vollständig vertreten
Anmerkungen: - Versöhnungstag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippur
- Veitel Ephraimsche Stiftung:
https://ephraim-veitel-stiftung.de/
- Dr. Michael Sachs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Sachs_(Rabbiner)
- Oberrabbiner Aub:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Aub vgl.
Artikel von 1866 vgl.
Artikel von 1880
- Leopold Ranke:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Ranke
- Pleschen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Pleschen
- Lyck:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Lyck
- Berthold Auerbach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Auerbach
https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:bio-0763
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/deutsch/dichter/bertholdauerbach
- Alliance:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alliance_Isra%C3%A9lite_Universelle
- Deutsch-israelitischer Gemeindebund:
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Israelitischer_Gemeindebund
- Israelitischer Unterstützungsverein:
vgl. Artikel von 1886
Israelitischer Waisenfonds: vgl.
Artikel von 1889
- Roter Adlerorden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Adlerorden
- Stätte seiner Wirksamkeit:
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/planen/staedtebauliche-projekte/realisierte-projekte/geschichte.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Synagoge_(Wiesbaden)
http://www.ca-wallau.com/synagoge-wiesbaden.htm |
| |
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Oktober
1910: "Wiesbaden. Im 76. Lebensjahre verschied hier der
Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Michael Silberstein." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Oktober
1910: "Wiesbaden. Im 76. Lebensjahre verschied hier der
Stadt- und Bezirksrabbiner Dr. Michael Silberstein." |
Berichte
zu den Lehrern und weiteren Kultusbeamten der Israelitischen Kultusgemeinde
Lehrer
Emanuel Traub empfiehlt seine private Schülerpension (1877)
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1877: "Knaben, die eine der
hiesigen höheren Lehranstalten als höhere Bürgerschule, Realgymnasium, Gelehrtengymnasium
etc. besuchen wollen, finden bei dem Unterzeichneten liebevolle Aufnahme,
Kost, Verpflegung und Beaufsichtigung der Schularbeiten gegen billiges
Honorar. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 11. September 1877: "Knaben, die eine der
hiesigen höheren Lehranstalten als höhere Bürgerschule, Realgymnasium, Gelehrtengymnasium
etc. besuchen wollen, finden bei dem Unterzeichneten liebevolle Aufnahme,
Kost, Verpflegung und Beaufsichtigung der Schularbeiten gegen billiges
Honorar.
Em. Traub, Lehrer der israelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden."
|
Oberkantor
und Lehrer Emanuel Traub und seine Frau feiern silberne Hochzeit (1890)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
11. Juli 1890: "In Wiesbaden feierte am 14. Juni der Kantor
der israelitischen Gemeinde, Herr Traub, das Fest der silbernen
Hochzeit. Dem Jubilar war erst unlängst vom Vorstand der Kultusgemeinde
in Anbetracht seiner zwanzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit als
Religionslehrer und Kantor der Titel Oberkantor verliehen
worden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom
11. Juli 1890: "In Wiesbaden feierte am 14. Juni der Kantor
der israelitischen Gemeinde, Herr Traub, das Fest der silbernen
Hochzeit. Dem Jubilar war erst unlängst vom Vorstand der Kultusgemeinde
in Anbetracht seiner zwanzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit als
Religionslehrer und Kantor der Titel Oberkantor verliehen
worden." |
Verschärfte
Bestimmungen für das Schächten und ihre Auswirkungen für Wiesbaden und
Biebrich (1890)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Oktober 1890: "Wiesbaden, 14. Oktober. Bekanntlich hat
die Königliche Regierung für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden -
'zwecks Vermeidung ungebührlicher Tierquälerei beim Schächten' – unter den
30. Oktober des Jahres die Polizeiverordnung erlassen, wonach, 'um
denjenigen Personen, welche das Schächtereigewerbe betreiben, sowie
denjenigen, welche die Approbation eines Rabbiners zum Schächten glaubhaft
nachweisen', das Schächten gestattet ist. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Oktober 1890: "Wiesbaden, 14. Oktober. Bekanntlich hat
die Königliche Regierung für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden -
'zwecks Vermeidung ungebührlicher Tierquälerei beim Schächten' – unter den
30. Oktober des Jahres die Polizeiverordnung erlassen, wonach, 'um
denjenigen Personen, welche das Schächtereigewerbe betreiben, sowie
denjenigen, welche die Approbation eines Rabbiners zum Schächten glaubhaft
nachweisen', das Schächten gestattet ist.
Gestützt auf diese Verordnung, hatte der Rabbiner der Reformgemeinde dahier,
Herr Dr. Silberstein, der zugleich Bezirksrabbiner ist, Herrn Jaffa
- Schächter und Fleischbeschauer - der orthodoxen Gemeinde, denunziert,
als derselbe in der Gemeinde Biebrich
schächtete, ohne vom Ersteren dazu autorisiert zu sein. Unstreitbar war
dabei Herr Dr. Silberstein von der seltsamen Ansicht ausgegangen, dass der
Ausdruck 'ein Rabbiner' in genannter Verordnung nur auf ihn selbst sich
beziehen könne, als ob außer ihm kein Rabbiner weiter existiere, denn, dass
Herr Jaffa von mehreren Rabbinern – mindestens jedoch von einem – Kabala
(Erlaubnis) besitze, musste dem Herrn Bezirksrabbiner bekannt sein.
Heute hatte nun das Schöffengericht Urteil zu sprechen. Nachdem der als
Zeuge geladene Rabbiner der altisraelitischen Kultusgemeinde, Herr Dr. Kahn,
die Erklärung abgegeben, dass er bereits vor 15 Jahren dem Angeklagten die
Approbation zum Schächten erteilt habe, ferner, dass weder er selbst als
Rabbiner der autonomen, ebenso wie die Reformgemeinde, mit den Rechten einer
Synagogengemeinde versehenen altisraelischen Gemeinde, noch auch Herr Dr.
Silberstein irgendeiner kirchlichen Oberaufsicht unterworfen sei, wurde auf
sofortigen Antrag des Herrn Amtsanwalts selbst, nach kurzer Beratung, der
Angeklagte freigesprochen. Bemerkenswert scheint noch, dass die Richter ein
Lächeln nicht unterdrücken konnten, als der Angeklagte seine Verwunderung
darüber aussprach, dass Herr Dr. Silberstein gerade den Fall in Biebrich zur
Anzeige gebracht habe, da ja dessen eigene Gemeinde in Wiesbaden selbst fast
ausnahmslos nicht durch die ihm, sondern durch die dem Herrn Dr. Kahn
unterstellten Schächter ihren Fleischbedarf decke."
Anmerkung: - Rabbiner Dr. Kahn vgl.
Artikel von 1909 zu Kahns 40-jährigem Amtsjubiläum |
25-jähriges Dienstjubiläum von Oberkantor Emanuel Traub
(1895)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Mai 1895: "Wiesbaden, 17. Mai. Vorgestern feierte Herr
Oberkantor Emanuel Traub sein 25jähriges Dienstjubiläum als Kantor und
Lehrer des israelitischen Bühl, Baden und
ein herzliches Glückwunschschreiben des Sängerchors des hiesigen
Lehrervereins. Um 11 Uhr begab sich eine Deputation des Vorstandes der
israelitischen Kultusgemeinde zu dem Jubilar, um ihn zu seinem Ehrentage zu
beglückwünschen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein hielt in bekannter,
formvollendeter Weise eine Ansprache, in welcher er die Mühen und Kämpfe
eines Religionslehrers und Kultusbeamten schilderte und sodann die Treue und
Gewissenhaftigkeit, mit welcher Lehrer Traub seinem Lehrerberuf obliegen und
den Zauber seiner schönen Stimme, womit er die Herzen der Andächtigen beim
Gottesdienst erbaut habe, hervorhob. Der 1. Vorsitzende des
Gemeindevorstandes, Herr Stadtverordneter Simon Heß, begrüßte hierauf den
Jubilar namens des Vorstandes. Hierauf überreichte Herr Vorsteher Bernhard
Liebmann mit Worten des Glückwunsches das Ehrengeschenk des Vorstandes
namens der Gemeinde, bestehend aus einem Geldbetrage in prächtigem Etui mit
Widmung. Eine Deputation, bestehend aus den Herren Saly Baer und S.
Morgenthau, welch Letzterer in herzlichsten Worten die Glückwünsche des
'Synagogen-Gesangvereins' aussprach, überreichte das Diplom für die
Ehrenmitgliedschaft. Hieran schloss sich eine Deputation der Herren Moritz
Baum, Saly Hamburger, Louis Rosenthal und Benedikt Straus. Der Letztere
beglückwünschte den Jubilar namens einer großen Zahl von Gemeindemitgliedern
und überreichte ihm ein kostbares Ehrengeschenk. Herr Traub ergriff hierauf
das Wort, um einen kurzen Rückblick auf die zurückgelegten 25 Jahre seiner
hiesigen Tätigkeit zu werfen. Als er vor 25 Jahren hierher gekommen, habe er
mit jugendlicher Kraft seine Tätigkeit begonnen, heute beginne der Schnee
des Alters sich auf sein Haupt niederzusenken, aber so lange Gott ihm Kraft
und Gesundheit verleihe, werde er bestrebt sein, sein Amt mit Eifer und
Gewissenhaftigkeit auszuführen. Wir schließen mit dem Wunsche, das dies noch
recht viele Jahre der Fall sein möge." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 24. Mai 1895: "Wiesbaden, 17. Mai. Vorgestern feierte Herr
Oberkantor Emanuel Traub sein 25jähriges Dienstjubiläum als Kantor und
Lehrer des israelitischen Bühl, Baden und
ein herzliches Glückwunschschreiben des Sängerchors des hiesigen
Lehrervereins. Um 11 Uhr begab sich eine Deputation des Vorstandes der
israelitischen Kultusgemeinde zu dem Jubilar, um ihn zu seinem Ehrentage zu
beglückwünschen. Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein hielt in bekannter,
formvollendeter Weise eine Ansprache, in welcher er die Mühen und Kämpfe
eines Religionslehrers und Kultusbeamten schilderte und sodann die Treue und
Gewissenhaftigkeit, mit welcher Lehrer Traub seinem Lehrerberuf obliegen und
den Zauber seiner schönen Stimme, womit er die Herzen der Andächtigen beim
Gottesdienst erbaut habe, hervorhob. Der 1. Vorsitzende des
Gemeindevorstandes, Herr Stadtverordneter Simon Heß, begrüßte hierauf den
Jubilar namens des Vorstandes. Hierauf überreichte Herr Vorsteher Bernhard
Liebmann mit Worten des Glückwunsches das Ehrengeschenk des Vorstandes
namens der Gemeinde, bestehend aus einem Geldbetrage in prächtigem Etui mit
Widmung. Eine Deputation, bestehend aus den Herren Saly Baer und S.
Morgenthau, welch Letzterer in herzlichsten Worten die Glückwünsche des
'Synagogen-Gesangvereins' aussprach, überreichte das Diplom für die
Ehrenmitgliedschaft. Hieran schloss sich eine Deputation der Herren Moritz
Baum, Saly Hamburger, Louis Rosenthal und Benedikt Straus. Der Letztere
beglückwünschte den Jubilar namens einer großen Zahl von Gemeindemitgliedern
und überreichte ihm ein kostbares Ehrengeschenk. Herr Traub ergriff hierauf
das Wort, um einen kurzen Rückblick auf die zurückgelegten 25 Jahre seiner
hiesigen Tätigkeit zu werfen. Als er vor 25 Jahren hierher gekommen, habe er
mit jugendlicher Kraft seine Tätigkeit begonnen, heute beginne der Schnee
des Alters sich auf sein Haupt niederzusenken, aber so lange Gott ihm Kraft
und Gesundheit verleihe, werde er bestrebt sein, sein Amt mit Eifer und
Gewissenhaftigkeit auszuführen. Wir schließen mit dem Wunsche, das dies noch
recht viele Jahre der Fall sein möge."
Anmerkung: - Synagogen-Gesangverein: vgl.
Artikel von 1913 |
Unter
den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch Lehrer Benno Rosenstock in
Wiesbaden (1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."
|
Lehrer Hermann Stern ist
ab 1938 als Lehrer in Wiesbaden tätig
Anmerkung: Hermann Stern ist am 17. Februar 1893 in
Gilserberg geboren. Er war verheiratet mit
Irma geb. Katz, die am 19. Mai 1897 in
Erdmannrode geboren ist. Hermann Stern war zunächst Lehrer in
Niedenstein, seit Juni 1928 in
Gudensberg, wo er die Nachfolge des
langjährigen Lehrers B. Perlstein in der jüdischen Schule übernahm. Die Tochter
Ruth ist noch in Niedenstein 1923
geboren. Am 1. Mai 1934 wurde Hermann in Gudensberg vom Dienst suspendiert. Die
Familie zog nach Bad Wildungen,
wo Hermann von Januar 1935 bis August 1938 als Rabbiner tätig war. Dann
verlegte die Familie ihren Wohnsitz nach Wiesbaden in die Rüdesheimer Str. 18.
Hier unterrichtete Hermann an der jüdischen Schule. Die Familie plante nach
Palästina auszuwandern, hatte 1939 alle Papiere zusammen, aber dennoch kam es
nicht zur Auswanderung. Hermann Stern wurde zusammen mit seiner Ehefrau am 1.
September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, am 4. Oktober 1944 nach
Auschwitz und am 19. Dezember 1944 nach Dachau gebracht, wo er ermordet wurde.
Für Hermann, Irma und Ruth Stern liegen in
Gudensberg in der Hinteren Gasse 21 sowie in Wiesbaden "Stolpersteine" vor
dem Haus Rüdesheimer Straße 18. Vgl. Liste über
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Gudensberg und
https://www.am-spiegelgasse.de/index.php/stolpersteine/ .
Sonstiges
Über einen 1761 in Wiesbaden gestorbenen Mohel und sein
Mohel-Buch (Beitrag von 1911)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 21. April 1911: "Das Register eines Mohels aus der ersten Hälfte
des XVIII. Jahrhunderts Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 21. April 1911: "Das Register eines Mohels aus der ersten Hälfte
des XVIII. Jahrhunderts
Von Dr. J. M. Salkind
Als ich vor einiger Zeit auf dem Bücherkarren eines Antiquars herumstöberte
– eine Schwäche, die allen Buchfreunden eigen ist , stieß ich auf ein
Bändchen, das zwei Handschriften enthielt: Glossen und Novellen zum Talmud
und Schulchan Aruch und schien kaum 30 Jahre alt zu sein. Nach der
Handschrift zu urteilen hatte das Manuskript einen litauischen
Talmud-Chochom zu seinem Verfasser. Man konnte auch leicht merken, dass es
nicht zu gleicher Zeit mit dem anderen Manuskript gebunden war. Das Bändchen
hatte auf seinem Rücken den Eindruck 'J. Hiffelsheimer', was der Name seines
ursprünglichen Eigentümers zu sein scheint. Diesen Namen merkte ich auch auf
einem Blatt des Bändchens, obwohl er von einem späteren Besitzer, einem
bekannten Bibliophilen in London, der verarmte und seine wertvolle
Bibliothek zu verkaufen gezwungen war, ausgefraßt war. Den Wohnort des J.
Hiffelsheimer konnte ich nicht mehr entziffern.
Das andre Manuskript zu dessen Beschreibung diese Zeilen dienen sollen, ist
auf ganz altem Papier und in der Handschrift der Juden in Deutschland im 16.
und 17. Jahrhundert geschrieben. Bietet sein Inhalt kein Interesse für den
Talmudisten,wie es bei dem ersten Manuskript der Fall ist, so hat es doch
gewissermaßen ein historisches Interesse, das für die Genealogie der
jüdischen Familien in der Umgebung von
Frankfurt a. M. sehr wichtig sein kann. Es sind nämlich die Eintragungen
eines Mohels, der in Wiesbaden gelebt zu haben scheint und die Mitzwath
Miloh zu seinem Lieblingsgebot gemacht hatte.
Wer der Mohel war, konnte ich unmöglich ermitteln. Sein Name scheint Chajim
gewesen zu sein, was daraus zu ersehen ist, dass er nach jeder 68.
Beschneidung – der Zahlenwert seines Namens Chajim – Gott dankt für die
Gnade, die Er ihm erwiesen hat. Er war im Jahre 1684 (5744) in einem Dorfe (Ikla)
in der Nähe von Bamberg oder
Ansbach geboren und scheint später in
Mannheim und Wiesbaden gelebt zu
haben. Er heiratete zweimal und scheint im Jahre 1761 (5521) in Wiesbaden
gestorben zu sein. Der Beginn seiner Tätigkeit fällt in das Jahr 1718
(5478), wo er die erste Operation mit Hilfe des Mohels Rabbi Jösli aus Ikla
unternimmt und schließt im Jahre 1761. Im zweiten Jahre seiner Praxis sehen
wir ihn schon so geübt in seinem Berufe, dass er einen andren, Rabbi Simon
aus Heizfeld (= Heidingsfeld), in
denselben einweiht. Die Zwischenräume zwischen einer Brith-Miloh und der
anderen sind in den ersten Jahren seiner Praxis noch recht groß, er scheint
aber bald sich einen solchen Ruf als Mohel erworben zu haben, dass er weit
und breit von den vornehmen Leuten gesucht wird. Sein Tätigkeitsgebiet
erstreckt sich über Wiesbaden, Mannheim,
Heidelberg,
Worms,
Bamberg, Limburg an der Lahn (die er
mit Lohn punktiert), Bingen,
Biebrich und die sie umgebenden Dörfer,
in denen kleine jüdische Gemeinde vorhanden waren. Am meisten kommt jedoch
Wiesbaden in Betracht. Seine Tätigkeit schließt am 20. Ab 5521, bei welcher
Gelegenheit Rabbi Abraham, der Sohn des damaligen Frankfurter Rabbiners
Rabbi Hirsch, der in Wiesbaden zur Kur war, als Sandek fungierte.
Das Manuskript enthält 46 Seiten, auf denen 140 Brith-Milohs verzeichnet
sind. Die Eintragungen sind stereotypisch nach der benannten Formel: 'Gam
malti ufor ati etc.'
Als Einleitung haben sie ein Dankgebet in dem bekannten Stil jener Zeit, das
auch in veränderter Form nach der 68. und 136. Beschneidung zu finden ist.
Da dieses jedoch am Schlusse fehlt, so darf man annehmen, dass der Schreiber
kurz nach der letzten von ihm vorgenommenen Operation verschieden war. In
den letzten Eintragungen kommen bereits häufig Familiennamen vor, ein
Zeichen der heranbrechenden neuen Zeit.
Dieses Mohelregister hat auch einiges Interessantes für die
Moralitätsstatistik. Unter den 140 Fälle befindet sich auch die Eintragung
der Brith-Miloh eines illegitimen Knabens, der 1746 in
Schierstein bei Wiesbaden geboren
wurde. 'Seine Mutter, die verheiratete R. R. erklärte, dass sein Vater R. N.
, der Wormser Bass-Sänger sei.' Der Schreiber bemerkt, dass er gezwungen war
(al pi hahechrach), den Knaben zu beschneiden, er schließt jedoch die
Eintragung mit der gewöhnlichen Formel: 'Jigdal letauroh ulchupoh
ulmaassim tauwim. Amen.'
Von den 46 Seiten des Registers gehören vier einer Familien-Megillah,
die der Schreiber nach der in den hinterlassenen Schriften seines Vaters
gefundenen Aufzeichnung abgefasst hatte. Er begründet die Abfassung der
Megillah durch ein Zitat aus dem Sohar in Schemoth, nachdem jeder
verpflichtet sei, die Wunder, die Gott ihm erweist, öffentlich bekannt zu
machen. Dies beweist, nebenbei bemerkt, dass der Schreiber mehr als ein
gewöhnlicher Lamdon, und dass man zu jener Zeit auch in
Frankfurt und seiner Umgebung im
Sohar zuhause gewesen war. Es handelt sich darum, dass der Schreiber, als er
sechs Jahre alt war, eines Morgens erwachte und dass er die Tür verriegelt
fand, so öffnete er das Fenster, durch welches er hinausgehen wollte, ohne
daran zu denken, dass es achtzehn Ellen vom Boden hoch war (das Haus, in dem
er wohnte, hieß 'der Turm') und dass sich unten ein Zaun mit Stacheln und
scharfen Spitzen befand. Er fiel auf das Steinpflaster, er blieb aber
unversehrt und stand bald auf, als ob nichts geschehen wäre. Die
erschreckten Eltern eilten herbei und bestrichen seinen Körper mit dem Blut
eines Ziegenbockes, was sich aber als überflüssig erwies, da er während des
Falls in einer solchen Position blieb, dass er auch nicht die geringste
Fraktion erlitt. Sein Vater führte hierauf ein Familienpurim ein, das für
alle seine Nachkommen obligatorisch gemacht ist. Am 8. Tamus sollten sie
fasten und am neunten sich, wie am Purim, belustigen und ein Festmahl
veranstalten, zu dem Talmidei chachomim geladen sein sollen und den Armen
Geschenke schicken.
Diese Familienmegillahs und Purims sind in der jüdischen Geschichte wohl
bekannt und waren sowohl in Europa als in Afrika recht populär. Sie hatten
ihren Ursprung im Mittelalter und reichen bis in die neueste Zeit. Die 'Jewreiskaja
Starina' veröffentlichte unlängst eine derartige Megillah, die ein
russischer Jude, der von den polnischen Insurgenten im Jahre 1863 auf eine
höchst merkwürdige Weise vom Tode gerettet wurde, niedergeschrieben und
seinen Kindern hinterlassen hatte. Die im Manuskript enthaltene Megillah hat
jedoch ein besonderes Interesse für den Historiker, durch die Bekanntmachung
eines Umstandes, der, wie ich glaube, nicht allgemein bekannt ist. Der
Schreiber erzählt nämlich, dass die Regierung (haseroroh), als sie von
seiner sonderbaren Errettung erfahren hatte, sofort schickte, um die damals
in solchen Fällen übliche Steuer 'Frasch' einzufordern, die darin bestand,
dass man dem Betreffenden entweder ein Stück Fleisch ausschnitt oder Geld im
Werte desselben nahm. Die Existenz einer derartigen Steuer scheint mehr für
China zu passen als für ein deutsches Land am Ende es siebzehnten
Jahrhunderts, so schwarz auch die Zustände damals ausgesehen haben und so
groß auch der Judenhass damals war. Es ist jedoch klar, dass wir es hier mit
einer Tatsache zu tun haben."
Anmerkungen: - Mohel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mohel
- Talmud:
https://de.wikipedia.org/wiki/Talmud
- Schulchan Aruch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch
- Talmud-Chochom:
https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/talmid-chacham/
- Mitzwath Miloh: Gebot, einen jüdischen männlichen Säugling am achten Tag
zu beschneiden
- Brith-Miloh:
https://de.wikipedia.org/wiki/Brit_Mila
- Ab:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aw_(Monat)
- Sandek:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandak
- Megillah:
https://de.wikipedia.org/wiki/Megilla_(Mischna)
- Sohar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zohar
- Schemoth:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schemot_(Sidra)
- Lamdon: Talmudkundig
- Achtzehn Ellen: Ca. 9 Meter
https://de.wikipedia.org/wiki/Elle_(Einheit)
- Fraktion: Gemeint ist Fraktur
- Purim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Purim
- Tamus:
https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/tamus/
- Talmidei chachomim: Pluralform Toragelehrten
https://en.wikipedia.org/wiki/Talmid_Chakham
- Jewreiskaja Starina:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jewreiskaja_starina
- Insurgent:
https://de.wikipedia.org/wiki/Insurgent |
Generalversammlung der Vereins israelitischer Lehrer im ehemaligen
Herzogtum Nassau (1912)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Januar 1912: "Wiesbaden, 28. Dezember. Der Verein
israelitischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau hielt am 22. des
vorigen Monats hier seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Lehrer
Nußbaum – Wiesbaden bedauerte, dass das preußische Schulgesetz von 1906 an
den nassauischen Grenzen Halt gemacht habe. Der Verein stehe durchaus auf
dem Boden der paritätischen Volksschuhe, die auch jüdische Lehrkräfte
beschäftige, er trete für die jüdische Volksschule ein, solange Nassau die
paritätische Volksschule fehle. Rabbiner Dr. Kober – Wiesbaden betonte, dass
es nicht im Sinne des Gesetzgebers gelegen habe, bei der nassauischen
Simultanschule die jüdischen Religionslehrer von der Lehrtätigkeit
auszuschließen . Zur Verhandlung stand das Thema: Die Fürsorge für die
jüdische schulentlassene Jugend. Aus den Leitsätzen des Referenten Lehrer
Thalheimer - Wallau seiner folgende Punkte
erwähnt: Da die Vergangenheit lehrt, dass ein planmäßiger
Fortbildungsunterricht der jüdischen Religion auf dem Lande nicht
durchführbar ist, sollen anstatt dessen anziehende Vorträge, in der Regel
während der Wintermonate, stattfinden. Hierfür ist die Beteiligung der
entsprechenden jüdischen Vereine und Verbände in den Großstädten, mit ihrer
Intelligenz und Kapitalkraft erforderlich. Bei diesen Vorträgen sollen
biblische, nachbiblische und kulturgeschichtliche Stoffe einschließlich der
jüdischen Feste mit Hilfe der Errungenschaften der Neuzeit auf dem Gebiete
der Kunst und Wissenschaft, wie Lichtbilder, Kinematograph, Tonbild,
Grammophon und dergleichen mehr, erläutert und die ethischen Begriffe aus
diesen Stoffgebieten herausgeschält werden. Die Schaffung einer guten
Bücherei ist zur Fortbildung auf dem sittlich-religiösen Gebiete für die
schulentwachsene Jugend unerlässliche Bedingung. Auf sozialpädagogischem
Gebiete vermag der jüdische Lehrer auf dem Lande auf die schulentlassene
Jugend durch Erweckung von Lust und Liebe an den Bodenkultur und Heimarbeit
segensreich zu wirken. Durch solche eine sittlich-religiöse und
sozialpädagogische Fortbildung der schulentlassenen Jugend auf dem Lande
wird in derselben eine Lebensanschauung erzeugt, die vorzugsweise in einer
edlen Gesinnung und Liebe zur Heimat beredten Ausdruck findet, Vorurteile
mildert und Gegensätze ausgleicht. Der Co-Referent, Lehrer Capell –
Wiesbaden, führte in seinen Leitsätzen unter anderem aus: Die Jugendgruppen
oder -vereine erstrecken ihre Wirksamkeit auf die männliche und weibliche
Jugend bis zum 30. Lebensjahre. Durch Vorträge und Kurse,
Freitagabendveranstaltungen und Unterhaltungsabende wie auch durch
turnerische, sportliche und gesangliche Betätigung gebe man der Jugend hier
Gelegenheit ihre Anlagen und Fähigkeiten zur Geltung zu bringen, eine
wirtschaftlich sichergestellte Zukunft, wenn auch in bescheidenem Rahmen,
gewähren, wie Handwerk und Bodenkultur. Auch die weibliche Jugend sei
bereit, einen Beruf zu ergreifen, der geeignet ist, möglicherweise ihr
Unabhängigkeit zu verschaffen. In der Diskussion wurde noch festgestellt,
dass der Abschluss aller sozialpolitischen Tätigkeit der Jugend die Gründung
einer Bodenerwerbsgenossenschaft sein müsse, damit auch Lust und Liebe zur
Bodenkultur unter den Volksgenossen geweckt werde. Nur hierdurch werde der
Jude bodenständig und überwinde die Antipathie der christlichen
Landbevölkerung." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 5. Januar 1912: "Wiesbaden, 28. Dezember. Der Verein
israelitischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau hielt am 22. des
vorigen Monats hier seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Lehrer
Nußbaum – Wiesbaden bedauerte, dass das preußische Schulgesetz von 1906 an
den nassauischen Grenzen Halt gemacht habe. Der Verein stehe durchaus auf
dem Boden der paritätischen Volksschuhe, die auch jüdische Lehrkräfte
beschäftige, er trete für die jüdische Volksschule ein, solange Nassau die
paritätische Volksschule fehle. Rabbiner Dr. Kober – Wiesbaden betonte, dass
es nicht im Sinne des Gesetzgebers gelegen habe, bei der nassauischen
Simultanschule die jüdischen Religionslehrer von der Lehrtätigkeit
auszuschließen . Zur Verhandlung stand das Thema: Die Fürsorge für die
jüdische schulentlassene Jugend. Aus den Leitsätzen des Referenten Lehrer
Thalheimer - Wallau seiner folgende Punkte
erwähnt: Da die Vergangenheit lehrt, dass ein planmäßiger
Fortbildungsunterricht der jüdischen Religion auf dem Lande nicht
durchführbar ist, sollen anstatt dessen anziehende Vorträge, in der Regel
während der Wintermonate, stattfinden. Hierfür ist die Beteiligung der
entsprechenden jüdischen Vereine und Verbände in den Großstädten, mit ihrer
Intelligenz und Kapitalkraft erforderlich. Bei diesen Vorträgen sollen
biblische, nachbiblische und kulturgeschichtliche Stoffe einschließlich der
jüdischen Feste mit Hilfe der Errungenschaften der Neuzeit auf dem Gebiete
der Kunst und Wissenschaft, wie Lichtbilder, Kinematograph, Tonbild,
Grammophon und dergleichen mehr, erläutert und die ethischen Begriffe aus
diesen Stoffgebieten herausgeschält werden. Die Schaffung einer guten
Bücherei ist zur Fortbildung auf dem sittlich-religiösen Gebiete für die
schulentwachsene Jugend unerlässliche Bedingung. Auf sozialpädagogischem
Gebiete vermag der jüdische Lehrer auf dem Lande auf die schulentlassene
Jugend durch Erweckung von Lust und Liebe an den Bodenkultur und Heimarbeit
segensreich zu wirken. Durch solche eine sittlich-religiöse und
sozialpädagogische Fortbildung der schulentlassenen Jugend auf dem Lande
wird in derselben eine Lebensanschauung erzeugt, die vorzugsweise in einer
edlen Gesinnung und Liebe zur Heimat beredten Ausdruck findet, Vorurteile
mildert und Gegensätze ausgleicht. Der Co-Referent, Lehrer Capell –
Wiesbaden, führte in seinen Leitsätzen unter anderem aus: Die Jugendgruppen
oder -vereine erstrecken ihre Wirksamkeit auf die männliche und weibliche
Jugend bis zum 30. Lebensjahre. Durch Vorträge und Kurse,
Freitagabendveranstaltungen und Unterhaltungsabende wie auch durch
turnerische, sportliche und gesangliche Betätigung gebe man der Jugend hier
Gelegenheit ihre Anlagen und Fähigkeiten zur Geltung zu bringen, eine
wirtschaftlich sichergestellte Zukunft, wenn auch in bescheidenem Rahmen,
gewähren, wie Handwerk und Bodenkultur. Auch die weibliche Jugend sei
bereit, einen Beruf zu ergreifen, der geeignet ist, möglicherweise ihr
Unabhängigkeit zu verschaffen. In der Diskussion wurde noch festgestellt,
dass der Abschluss aller sozialpolitischen Tätigkeit der Jugend die Gründung
einer Bodenerwerbsgenossenschaft sein müsse, damit auch Lust und Liebe zur
Bodenkultur unter den Volksgenossen geweckt werde. Nur hierdurch werde der
Jude bodenständig und überwinde die Antipathie der christlichen
Landbevölkerung."
Anmerkungen: - Rabbiner Dr. Kober:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Kober
https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/kober-adolf.php
- Simultanschule:
https://de.wikipedia.org/wiki/Simultanschule
- Lichtbild:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbild
- Kinematograph:https://de.wikipedia.org/wiki/Kinematograph
- Tonbild:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonbild
- Grammophon:
https://de.wikipedia.org/wiki/Grammophon
- Lehrer Capell:
https://www.wiesbaden.de/microsite/stadtlexikon/a-z/capell-familie.php
" |
|