|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Waldeck-Frankenberg"
Eimelrod (Gemeinde
Willingen (Upland), Kreis Waldeck-Frankenberg)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(erstellt unter Mitarbeit von Alf Seippel, Dortmund)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Eimelrod bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis 1938.
Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. Die
Entstehung der Gemeinde beziehungsweise der Synagoge wird etwa 1780
datiert.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1830 34 jüdische Einwohner, 1871 10 (3,3 % von insgesamt 307
Einwohnern), 1895 15 (3,7 % von 401), 1905 15 (3,6 % von 417).
An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule
(Religionsschule),
ein rituelles Bad und ein Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war vermutlich zu keiner Zeit
ein eigener Lehrer in der Gemeinde. Den Religionsunterricht der Kinder wird ein
auswärtiger Lehrer mit übernommen haben; die Vorbeterdienste wurden
ehrenamtlich durch Gemeindeglieder besorgt. Die Gemeinde gehörte zum
Provinzialrabbinat in Marburg.
Im Ersten Weltkrieg wurde von den jüdischen Kriegsteilnehmern der
Unteroffizier (im Infanterieregiment Nr. 30) Max Schild mit dem Eisernen
Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet (Dr. Bloch's Wochenschrift vom 13.8.1915 S. 611;
Israelitisches Familienblatt vom 15.7.1915). Julius Schild erhielt
gleichfalls das Eiserne Kreuz 2. Klasse (Jüdische Volkszeitung vom 9.8.1918 Nr.
32 unter "Unsere Helden"; Israelitisches Familienblatt vom 25.7.1918). Max
und Julius waren Söhne des Eimelroder Gastwirtes Leopold Schild. Letzterer
feierte am 5. April 1934 seinen 70. Geburtstag (Israelitisches Familienblatt vom
29.3.1934).
Um 1924 gehörten zur jüdischen Gemeinde 20 Personen (4,1 % von insgesamt
486 Einwohnern). 1932 war Gemeindevorsteher Julius Schild.
1933 lebten 14 jüdische Personen in Eimelrod (2,9 % von insgesamt 484
Einwohnern). In
den folgenden Jahren ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Eine der Familien (mit
drei Personen) verzog 1935 nach Korbach, eine andere Familie (mit vier Personen)
emigrierte 1937 nach Argentinien. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Synagoge zerstört (s.u.). 1939 wurden noch zwei
jüdische Einwohner gezählt, die 1941 deportiert wurden (über das
"Sammellager" in Wrexen).
Von den in Eimelrod geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Lieselotte Cossen (1929),
Marianne Anneliese Cossen (1927), Lieselotte Ria Cossen (1929), Max Cossen
(1899), Paula Cossen geb. Meijer (Meyer; 1900), Dina Kratzenstein geb.
Straus (1867), Julius Schild (1894), Leopold Schild (1864), Max Schild (1891),
Rosa Schild geb. Meyer (1891), Siegfried Schild (1890), Johanna Sternfeld geb.
Straus (1875), Bernhard Straus (1890), Friedel Straus (1925), Hermann Straus
(1890), Hugo Straus (1891), Irmgard Straus (1921), Julius Straus (1881).
Hinweis: Alf Seippel (Dortmund)
erforscht die Geschichte und die Schicksale der jüdischen Einwohner von
Eimelrod. Im April 2011 hat er einen Zwischenstand seiner Recherchen an dieser
Stelle veröffentlich, einsehbar
über eine pdf-Datei. Im September 2016 erschien sein Buch über die
jüdische Gemeinde Eimelrod: siehe unten im Literaturverzeichnis. Weitere, ergänzende Hinweise bitte direkt Alf
Seippel mitteilen: E-Mail (SFDzV.Seippel[et]t-online.de).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Allgemeines
Beitrag "Die Juden in Waldeck" (erschien
1929)
Anmerkung: Beitrag zur Geschichte der Juden in Bad
Arolsen, Bad Wildungen, Korbach,
Landau, Mengeringhausen,
Rhoden, Sachsenhausen,
Züschen sowie Eimelrod und Höringhausen.
Der Bericht erschien auch im "Israelitischen Familienblatt" vom 11. April 1929.
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 12. April 1929: "Die Juden in
Waldeck. (Zum Ende des ehemaligen Fürstentums).
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 12. April 1929: "Die Juden in
Waldeck. (Zum Ende des ehemaligen Fürstentums).
Wir entnehmen dem 'Israelitischen Familienblatt' nachstehenden
interessanten Artikel: Am 1. April fand in Arolsen
die feierliche Vereinigung des Freistaates Waldeck mit Preußen statt. Das
kleine Ländchen wird ein Bestandteil der Provinz Hessen-Nassau. Waldeck
zählt unter seinen 58.000 Einwohnern etwa 550 Juden. Aus dem Kreise der
Waldecker Juden der weiteren Welt bekannt geworden ist der Dichter
Heinrich Stieglitz. Seine Werke sind heute vergessen. Seine Frau
Charlotte aber entriss seinen Namen der Vergessenheit. Um ihn der
Schwermut seines Gemüts, das unter seiner dichterischen Schwäche litt,
zu entreißen, und in der Hoffnung, dass ein starker Schmerz heilend und
kräftigend auf sein Gemüt einwirken werde, gab sie sich den Freitod.
Diese Tat, die das damalige 'Junge Deutschland' aufwählte, wurde von
Gutzkow, dem Verfasser des 'Uriel Akosta', behandelt in seinem Roman: 'Walpurg,
die Zweiflerin'.
Die Anzahl der waldeckischen Juden hat sich seit der Freizügigkeit stetig
verringert. Sie wanderten aus, da sie anderwärts bessere
Verdienstmöglichkeiten hatten und nicht so sehr die Zurücksetzung
merkten wie in diesem engen Bezirk, auch durch Bildungsmöglichkeiten
entschädigt wurden. Das religiöse Leben war in Waldeck bis auf einige
Ausnahmen nie sehr rege. In der Hauptstadt Arolsen
konnte es sogar geschehen, dass vor hundert Jahren fast die ganze Gemeinde
dem Taufwasser zum Opfer fiel. Die Nachkommen der damaligen Juden gehören
heute zu den ersten Familien des Landes. Etwas regeres Leben blüht heute
in den beiden Gemeinden Wildungen
und Korbach, wo je ein Lehrer amtiert. Arolsen,
Mengeringhausen, Rhoden
und Sachsenhausen sind kleine
Gemeinden, die infolge ihrer geringen Seelenzahl nur mit großer Mühe
sabbatlichen Gottesdienst abhalten können. Religionsunterricht wird in
diesen Gemeinden nicht erteilt; falsche Sparsamkeit lässt es nicht zu.
Dieser Mangel an Verantwortungsgefühl ist wohl auch die Ursache, dass der
Korbacher Jakob Wittgenstein bei
seinem Tode 1890 sein gesamtes Vermögen von 600.000 Mark seiner
Vaterstadt vermachte, aber der Synagogengemeinde nur einige tausend Mark,
und ihr nicht einmal den geringsten Einfluss auf die Verwaltung des
errichteten Altersheims gestattete. Auch von dieser Familie sind einige
Glieder in der Welt, wenn auch getauft, zu Ansehen gelangt. Soll doch der
erste Bundespräsident von Österreich, Hainisch, von dieser
Familie abstammen. Ferner ist ein Wittgenstein der Begründer der
österreichischen Erzindustrie. Ein anderer, namens Paul, war, trotzdem er
nur den linken Arm hatte, ein so hervorragender Pianist, dass sogar
Richard Strauß für ihn Partituren schrieb. In Sachsenhausen
hat ein nach Amerika ausgewanderter Jude Bloch ein Schwesternheim
errichtet, aber die jüdische Gemeinde übergangen. Welchen Segen hätten
diese beiden Gemeinden mit diesen Legaten für alle Religionen stiften
können!
Die beiden Gemeinden Eimelrod und Höringhausen,
die zu dem nunmehrigen preußischen Verwaltungsgebiet Waldeck kommen,
gehörten bisher zu Hessen-Nassau. In beiden, besonders in
letzterer, |
 herrschte
stets ein reges religiöses Leben. Beide bedürfen dringend der Hilfe,
damit ihre Synagogen nicht ganz zerfallen. Eimelrod hat deshalb vom
Landesverband einen sehr reichen Zuschuss erhalten. Weshalb Höringhausen
nicht bedacht wurde, fragt sich dort jeder. Vielleicht hat der
Landesverband doch noch ein Einsehen und hilft der
Gemeinde. herrschte
stets ein reges religiöses Leben. Beide bedürfen dringend der Hilfe,
damit ihre Synagogen nicht ganz zerfallen. Eimelrod hat deshalb vom
Landesverband einen sehr reichen Zuschuss erhalten. Weshalb Höringhausen
nicht bedacht wurde, fragt sich dort jeder. Vielleicht hat der
Landesverband doch noch ein Einsehen und hilft der
Gemeinde.
Über die Geschichte der Juden in Waldeck ist wenig bekannt. Die meisten
Nachrichten schlummern noch zerstreut in den Archiven. In früheren Zeiten
durften nur in den Orten Züschen und Landau
Juden wohnen. Die Hauptstadt besteht erst seit zwei Jahrhunderten. Sie ist
die Geburtsstadt des erwähnten Dichters Stieglitz, sowie der berühmten
Ärzte Marcus und Stieglitz. Auch die Nachkommen des Marcus gehören heute
dem Christentums an. In Korbach muss es
schon früh Juden gegeben haben. Darauf weist der Name eines alten Adelsgeschlechts
namens 'Judenhertzog'. 1480 erklärte das 'Freigericht unter der
Windmühle' zu Korbach einen Juden zu
Frankfurt, den Juden dieser Stadt und der Umgebung in die Acht. Sie
sollten mit ihm 'weder essen noch trinken, weder mit ihm gehen noch
stehen, weder mit ihm sprechen noch singen, nicht mit ihm kaufen noch
verkaufen, wuchern oder suchen, keinerlei Verhandlungen mit ihm haben,
weder heimlich noch offenbar, auch nicht mit ihm in die Schule, in die
Synagoge oder Tempel, überhaupt nicht mit ihm in ein Haus gehen.' Ebenso
tat der Freigraf zu Landau alle Juden zu Gelnhausen
in die Acht, 'nach rechtem altem Herkommen der kaiserlichen freien
heiligen und heimlichen Gerichte', weil sie ungehorsam gewesen
wären.
Auch früher schon waren die Juden mit den Femgerichten in Berührung
gekommen. 1738 durften sie nur in Züschen,
und etwas später auch in Arolsen
wohnen. 1788 war aber der Widerstand gegen die Juden so stark geworden,
dass der Fürst den Landständen versprechen musste, einem Juden nicht
eher einen neuen Schutzbrief zu geben, bis die Judenschaft im Lande bis
auf 20 ausgestorben sei. Auch der Judeneid kommt in dieser Zeit in Waldeck
vor. Trotz aller Beschränkungen haben sich die Juden doch in anderen
Orten Wohnrecht erhalten. An den Freiheitskriegen nahmen sie teil. Nachdem
schon 1804 der Leibzoll aufgehoben war, folgte 1814 das sogenannte
Organisationsedikt. In diesem wurden ihnen alle Rechte der übrigen
Staatsbürger zugebilligt. Als sie aber in Korbach
das Bürgerrecht verlangten, erhob sich seitens der Stadt und der
Bürgerschaft ein heftiger Widerstand. Der Fürst Georg Heinrich, ein
vorurteilsloser, gerecht denkender Herr, setzte aber ihre Aufnahme zu
Bürgern durch. Dieser Fürst gab ihnen auch im Jahre 1834 das
Judengesetz, das den etwas merkwürdig anmutenden Titel führt: 'Gesetz
über die Gemeinheiten der Juden'. Es gilt auch heute noch, denn es war in
Waldeck Regierungsgrundsatz, die Juden unbehelligt zu lassen, wenn auch
sie von der Regierung nichts verlangten. Das Gesetz ist aber von Segen
gewesen. Der Austritt aus der Gemeinde ist nur mit einem gleichzeitigen
Austritt aus der Religion möglich. Sonst muss jeder Waldecker Jude einer
Synagogengemeinde angehören. Ein Versuch der jüdischen Gemeinde Korbach,
der Regierung die Lasten der Lehrerbesoldung aufzubürden, scheiterte, da
die Regierung damals sogar mit militärischer Exekution
drohte.
Es ist daher den beiden Gemeinden nicht zu verdenken, wenn sie auf den
Anschluss an Preußen allerlei Hoffnungen setzen und hoffen, dass die
Lasten, die sie bisher allein getragen, etwas erleichtert werden. Mögen
sie in ihren Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Max Gottlieb."
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige von Johanna Strauss (1912)
Anmerkung (Angabe von A. Seippel): Vermutlich handelt es sich um Johanna
Straus, geb. 17.2.1893 in Eimelrod, verheiratet seit 28.12.1920 in Kamen mit
Arthur Reinberg (zwei Söhne). Diese Familie ist nach Chile emigriert und hat
dadurch die Zeit der Shoa überlebt.
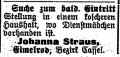 Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 11. Oktober 1912: Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 11. Oktober 1912:
"Suche zum baldigen Eintritt Stellung in einem koscheren Haushalt, wo
Dienstmädchen vorhanden ist.
Johanna Straus, Eimelrod, Bezirk Kassel". |
Anzeige von J. Straus II (1912)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juli 1912: "Wer liefert Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 18. Juli 1912: "Wer liefert
koscheren Käselab.
Offerten erbittet
J. Straus II, Eimelrod,
Kreis Frankenberg.
" |
Anzeige von Louis Straus (1913)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. April 1913: "Zum sofortigen
Eintritt suche für meinen frauenlosen Haushalt mit zwei kleinen Kindern von
zwei Monaten eine ältere Person, zur Führung des Haushaltes und
Pflege der Kinder, etwas Hausarbeit muss mit übernommen werden. Es wollen
sich nur Damen melden, die Liebe zu Kindern haben. Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. April 1913: "Zum sofortigen
Eintritt suche für meinen frauenlosen Haushalt mit zwei kleinen Kindern von
zwei Monaten eine ältere Person, zur Führung des Haushaltes und
Pflege der Kinder, etwas Hausarbeit muss mit übernommen werden. Es wollen
sich nur Damen melden, die Liebe zu Kindern haben.
Offerten mit Gehaltsansprüchen und Referenzen erbeten an
Louis Strauss
Eimelrod, Waldeck. " |
Recha Straus wirbt für ihre Pension
(1930)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. April 1930: "Sommerfrische Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 24. April 1930: "Sommerfrische
in waldreichen Gegend. Gute Verpflegung. Pensionspreis pro Tag 4,50 Mark.
Frau Recha Straus,
Eimelrod (Waldeck),
Bezirk Kassel. Bahnstation." |
| |
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1930: "Sommerfrische Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juli 1930: "Sommerfrische
in waldreicher Gegend. Gute Verpflegung
Pensionspreis pro Tag 4,50 Mark, koscher.
Frau Recha Strauss
Eimelrod (Waldeck)
Bezirk Kassel. Bahnstation. " |
| |
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juli 1930: "Nehme für Juli
August September Familie von 4-5 Personen in Pension. Waldreiche
Höhenlage. Vier Mahlzeiten. Reichliche Verpflegung. Pensionspreis 4.50 Mark.
Bahnstation. Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 17. Juli 1930: "Nehme für Juli
August September Familie von 4-5 Personen in Pension. Waldreiche
Höhenlage. Vier Mahlzeiten. Reichliche Verpflegung. Pensionspreis 4.50 Mark.
Bahnstation.
Frau Louis Straus, Eimelrod." |
| |
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 14. August 1930: "Höhenluftkurort
Eimelrod Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 14. August 1930: "Höhenluftkurort
Eimelrod
(Edertalsperre Waldeck)
Pension Recha Strauss
Gute Verpflegung - mäßige Preise - rituell." |
Zur Geschichte der Synagoge
In Eimelrod war eine alte, sehr kleine Synagoge vorhanden. Sie
wurde möglicherweise um 1780 erstellt und hatte 24 Plätze für Männer, 16
für Frauen. Bis zuletzt gab es kein elektrisches Licht im Gebäude; die
Beleuchtung erfolgte durch Stalllaternen. 1910 stand eine Renovierung der
Synagoge an, wofür die jüdische Gemeinden Spenden sammelte. In welchem Umfang
eine Renovierung erfolgte, wird nicht mitgeteilt.
Die Synagoge soll renoviert
werden - Spendenaufruf (1910)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Aufruf! Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Aufruf!
Eine kleine Gemeinde im Hessenlande, deren Mitgliederzahl auf ein Minimum
zusammengeschrumpft ist, hat als einziges Andenken an vergangene schöne
Zeiten sich ein Heiligtum bewahrt. Doch gar arg ist das Gotteshaus im Laufe
der Jahrzehnte verfallen und eine Reparatur von Grund auf tut dringend not
wenn es nicht ganz dem Untergang geweiht sein soll. Die vier Mitglieder
unserer kleinen Gemeinde tun ihr möglichstes, die Synagoge zu erhalten, doch
die Renovierungskosten werden allzu groß sein und so bauen sie denn auf das
religiöse Gefühl der Glaubensgenossen, wenn sie in diesem Aufruf um Förderer
des gottgefälligen Werkes bitten. Spenden, worüber an dieser Stelle dankend
quittiert werden soll, nimmt entgegen Eimelrod, Bezirk Kassel. Der
Vorsteher: J. Strauss." |
Dank an die Spender für
die Renovierung der Synagoge (1910)
 Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Für die uns zur
Renovierung unserer Synagoge übersandten Spenden sagen herzlichen Dank.
Es gingen ein von Albert David, Metternich
bei Koblenz Mark 3.05, J . Andorn, Gehaus
3, Hermann Frankenthal, Vöhl 3, J. Berglo,
Langenfeld (Rheinland) 3, Framhel, Berlin, Ludwigstraße 2.05, Sally Nochem,
Scharfenort 5, Isak M. Katzenstein,
Frankenau 10, P.L. und S.L., Lubschau (Oberschlesien) 2.25. Anzeige
im "Israelitischen Familienblatt" vom 1. September 1910: "Für die uns zur
Renovierung unserer Synagoge übersandten Spenden sagen herzlichen Dank.
Es gingen ein von Albert David, Metternich
bei Koblenz Mark 3.05, J . Andorn, Gehaus
3, Hermann Frankenthal, Vöhl 3, J. Berglo,
Langenfeld (Rheinland) 3, Framhel, Berlin, Ludwigstraße 2.05, Sally Nochem,
Scharfenort 5, Isak M. Katzenstein,
Frankenau 10, P.L. und S.L., Lubschau (Oberschlesien) 2.25.
Im Auftrage der hiesigen vier Familien: J. Straus I, Eimelrod." |
Auch nachdem die Zahl der jüdischen
Einwohner nach 1933 schnell zurückgegangen ist, fanden nach Angaben bei
Arnsberg noch bis 1938 gelegentlich Gottesdienste in der Synagoge statt.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge völlig zerstört. Die
Brandruine wurde 1939 abgebrochen.
Adresse/Standort der Synagoge: an
der Hauptstraße
Fotos
Die Synagoge in Eimelrod
(Foto erhalten von Alf Seippel) |
 |
 |
| |
Die Synagoge steht rechts
des
abgebildeten Hauses |
Ausschnittvergrößerung
des Fotos links |
| |
|
|
| Ähnliche Synagoge in
Padberg |
 |
| |
Die Synagoge in Eimelrod
sah (nach Angaben von Dr. Alf Seippel) sehr ähnlich aus
wie die
erhaltene (restaurierte) Fachwerksynagoge im etwa 30 km Luftlinie
entfernten westfälischen Padberg; oben: die Synagoge in Padberg -
Foto
aus dem Wikipedia-Artikel
zur Synagoge Padberg |
| |
|
|
Standort der Synagoge
(Fotos von Alf Seippel) |
 |
 |
| |
Luftaufnahme (1986) von Eimelrod mit
Eintragung des Standortes
der Synagoge (X) |
Synagogenstandort (O),
Häuser, die auf
dem obigen historischen Foto zu sehen
sind (X) und das Schild'sche Haus (Y) |
| |
|
|
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 152. |
 | Keine Artikel zu Eimelrod in Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 bzw. in dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994 bzw. dies. Neubearbeitung der
beiden Bände 2007. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S.
222. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 364-365. |
 |  Alf
Seippel: "Sie können hier nicht mehr leben" - Leben und
Schicksale jüdischer Familien aus Eimelrod im hessisch-waldeckischen Upland.
Handbuch mit Buchdeckel. DIN A 4 im Hochformat. 370 S. mit Abb. Erschienen
im September 2016 im Selbstverlag. 32 €. Bestellungen direkt beim Autor Mail:
alf.seippel[et]t-online.de. Alf
Seippel: "Sie können hier nicht mehr leben" - Leben und
Schicksale jüdischer Familien aus Eimelrod im hessisch-waldeckischen Upland.
Handbuch mit Buchdeckel. DIN A 4 im Hochformat. 370 S. mit Abb. Erschienen
im September 2016 im Selbstverlag. 32 €. Bestellungen direkt beim Autor Mail:
alf.seippel[et]t-online.de.
Aus dem Buch: Inhaltsverzeichnis
(S. 6-7); Einleitung
(S. 8-11); "Liste
verfolgter Juden aus Eimelrod" (S.
353-356). |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Eimelrod (now
part of Willingen) Hesse-Nassau. Established in 1780, this small jewish
community numbered 34 in 1830 and 20 (4 % of the total) in 1925. The last two
Jews were deported in 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|