|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"
Hofheim in
Unterfranken (Kreis Haßberge)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Hofheim bestand eine kleine jüdische Gemeinde in
Verbindung mit der Nachbargemeinde Lendershausen in der Zeit von ca. 1880 bis 1942.
Erst nach 1860 konnten Juden in der Stadt sich niederlassen. Durch Zuzug einiger Familien
aus Lendershausen und anderen Orten entwickelte sich die
Zahl der jüdischen
Einwohner wie folgt: 1867 7 jüdische Einwohner (0,7 % von insgesamt 942
Einwohnern), 1871 24 (2,4 % von insgesamt 986), 1880 39 (4,1 % von 948), 1890 47
(5,4 % von 875), 1900 39 (4,1 % von 939), 1910 59 (6,0 % von 985), 1925 54 (5,0
% von 1.087). Die jüdischen Haushaltsvorstände waren vor allem als
Viehhändler und im Einzelhandel tätig, dazu war eine Fabrik in jüdischem
Besitz.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde seit 1920 einen Betsaal
(Synagoge, s.u.),
einen Schulraum und ein rituelles Bad in einem zu einem jüdischen
Gemeindezentrum umgebauten Haus in der Stadtmitte. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war
- gemeinsam mit der Nachbargemeinde Lendershausen - ein
Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Erster jüdischer
Lehrer Hofheims war zugleich der letzte jüdische Lehrer der Gemeinde
Lendershausen (vermutlich seit 1878 und insgesamt 40 Jahre lang): Baruch Wolf.
Einige Jahre war er Lehrer der vereinigten jüdischen Gemeinde
Lendershausen - Hofheim. Ihm folgten 1921 Justin Fränkel (1924 nach
Erlangen) und ab dem 15. Mai 1924 Simon Blumenthal.
Im Ersten Weltkrieg fielen fünf jüdische Männer an den Fronten (von
damals knapp 60 jüdischen Einwohnern!): Gefreiter Julius Fleischmann (geb.
12.3.1890 in Hofheim, gef. 7.6.1917), Max Reus (geb. 7.8.1890 in Lendershausen,
gef. 7.12.1914), Julius Rosenbach (geb. 14.4.1895 in
Schweinshaupten, gef.
28.7.1916), Offz.St. Moritz Schuster (geb. 25.7.1885 in Hofheim, gef.
17.10.1915) und Jakob Strauß (geb. 26.5.1884 in Hofheim, gef. 30.7.1916). Ihre Namen stehen auf dem
Kriegerdenkmal an der Stadtkirche.
Um 1924 gehörten 50 Personen zur jüdischen Gemeinde (4,2 % von
insgesamt etwa 1.200 Einwohnern). Damals waren die Vorsteher der Gemeinde Moses
Reus, Josef Oppenheimer und Theodor Levor. Als Religionslehrer, Kantor und Schochet
wirkte der bereits genannte Simon Blumenthal. Er unterrichtete an der
Religionsschule der Gemeinde vier Kinder (auch 1931/32: vier Kinder). 1932
waren die Vorsteher der Gemeinde Max Fein (1. Vors.), Joseph Oppenheimer (2.
Vors.) und Theodor Levor (3. Vors.). An jüdischen Vereinen gab es die Chevras
Bikur Cholim (Vorsitzender Josef Oppenheimer, Zweck und Arbeitsgebiete:
Unterstützung Hilfsbedürftiger und Bestattungswesen) sowie den Israelitischen
Frauenverein (Vorsitzende Rita Schloß, Zweck und Arbeitsgebiete:
Unterstützung Hilfsbedürftiger und Bestattungswesen).
Das Verhältnis zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern der
Stadt war insgesamt gut. Seit 1929 gerieten die jüdischen Einwohner
Hofheims und anderer Orte der Umgebung im Zusammenhang mit einem angeblichen
'Ritualmord' von Manau im Kreis Hofheim in eine äußerst schwierige
Situation, die von den Nationalsozialisten schamlos durch eine seitdem
betriebene hässliche antijüdische Propaganda ausgenützt wurde. Die Atmosphäre für die jüdischen Einwohner der Stadt und
Umgebung wurde zunehmend vergiftet.
1933 lebten noch 43 jüdische Personen in der Stadt. In den folgenden
Jahren wurden sie in zunehmendem Maße aus dem Geschäftsleben der Stadt
verdrängt. Seit 1936 mied die Bevölkerung Käufe in jüdischen Geschäften.
1934 wurden auf Grund des immer noch unaufgeklärten Mordes von Manau und
des erneuerten Vorwurfes eines Ritualmordes mehrere jüdische
Männer in Hofheim und Umgebung (vgl. z.B. auch Ermershausen,
Schweinshaupten)
verhaftet und erst nach einigen Monaten wieder freigelassen. Auf Grund
der immer schwieriger werdenden Situation und der Folgen des wirtschaftlichen
Boykotts verließen bis 1940 alle jüdischen Einwohner die Stadt. 16 konnten emigrieren, darunter
sechs nach England, fünf in die USA, fünf nach Luxemburg. 28 verzogen in
andere deutsche Orte (u.a. neun nach Bamberg, sechs nach Würzburg).
Von den in Hofheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; letzte Abgleichung der
Angaben mit dem Gedenkbuch am 2.10.2024): Julie Adler geb. Sacki
(1878), Lina Gidel Altmann geb. Eisenheimer (1865), Max Fein (1880), Recha Fein
geb. Reis (1884), Ludwig Fleischmann (1886), Simon Siegfried Fleischmann (1881),
Babette Frankenberger geb. Goldmann (1858), Clara Frankenberger (1898), Lina Friedmann (1878), Moses Friedmann (1887), Selig Friedmann (1885), Martin Hahn (1919),
Bertha Lion geb. Fleischmann (1892), Pauline Mayer geb. Stern (1876), Simon
Mayer (1875), Johanna Oppenheimer (1867), Friederile Frieda Rosenbach (1889),
Isack Rosenbach (1858), Sara Rosenbach geb. Thormann (1864), Regina Schönthal geb.
Schuster (1894), Heinz Jakob Sündermann (1930), Irma Sündermann geb. Fleischmann (1894), Babette
(Bertha) Strauß geb. Silbermann (1872), Fanny Hanni Strauss geb. Strauss (1881), Theodor Vandewart
(1878).
Anmerkung: ein Großteil der oben genannten Personen lebte nur zeitweise in
Hofheim; die Nachweise bei Yad Vashem sind teilweise unsicher, da zur
Angabe "Hofheim" meist keine Näherbestimmung erfolgt, ob
"Hofheim in Unterfranken" oder "Hofheim im Taunus" gemeint
ist, wo auch eine jüdische Gemeinde bestand.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle der
Religionslehrers/Vorbeters/Schochet 1921 / 1924
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:
"Infolge Rücktritt des bisherigen Lehrers soll die hiesige
Religionslehrerstelle nebst Vorbeter- und Schächterdienst neu besetzt
werden. Das feste Gehalt regelt sich nach derzeitigen Gehaltsansprüchen
bei freier Wohnung. Auf größeren ständigen Nebenverdienst,
hauptsächlich für musikalisch ausgebildete Herren ist sicher zu rechnen.
Meldungen mit oder ohne Gehaltsansprüche sind zu richten an den Vorstand
der Israeltischen Kultusgemeinde Hofheim - Lendershausen
(Unterfranken)." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1921:
"Infolge Rücktritt des bisherigen Lehrers soll die hiesige
Religionslehrerstelle nebst Vorbeter- und Schächterdienst neu besetzt
werden. Das feste Gehalt regelt sich nach derzeitigen Gehaltsansprüchen
bei freier Wohnung. Auf größeren ständigen Nebenverdienst,
hauptsächlich für musikalisch ausgebildete Herren ist sicher zu rechnen.
Meldungen mit oder ohne Gehaltsansprüche sind zu richten an den Vorstand
der Israeltischen Kultusgemeinde Hofheim - Lendershausen
(Unterfranken)." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1924:
"Infolge Berufung unseres Herrn Lehrers in einen größeren
Wirkungskreis ist die hiesige Lehrer-, Kantor und Schochetstelle
bis 15.3. oder 1.4.1924 neu zu besetzen. Gehalt nach Gruppe VII der
Satzungen des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Bewerber mit
seminaristischer Vorbildung wollen ihre Zeugnisse umgehend an den
unterzeichneten Kultusvorstand einschicken. Nur verheiratete Bewerber oder
solche mit eigener Haushaltführung erwünscht. Geräumige Dienstwohnung mit
großem Garten vorhanden. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde,
Hofheim in Unterfranken, gezeichnet M. Reus, Kultusvorstand." Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1924:
"Infolge Berufung unseres Herrn Lehrers in einen größeren
Wirkungskreis ist die hiesige Lehrer-, Kantor und Schochetstelle
bis 15.3. oder 1.4.1924 neu zu besetzen. Gehalt nach Gruppe VII der
Satzungen des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Bewerber mit
seminaristischer Vorbildung wollen ihre Zeugnisse umgehend an den
unterzeichneten Kultusvorstand einschicken. Nur verheiratete Bewerber oder
solche mit eigener Haushaltführung erwünscht. Geräumige Dienstwohnung mit
großem Garten vorhanden. Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde,
Hofheim in Unterfranken, gezeichnet M. Reus, Kultusvorstand." |
Zum Tod des Lehrers Baruch Wolf 1930:
letzter jüdischer Lehrer in Lendershausen - zeitweise gemeinsamer Lehrer in
Hofheim und Lendershausen und damit erster jüdischer Lehrer in Hofheim
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1930:
"Lendershausen-Hofheim in Unterfranken, 1. August (1930). Einen
unersetzlichen Verlust hat nicht nur unsere Gemeinde sondern ganz
Israel, insbesondere aber die gesamte jüdische Lehrerschaft in dem
Heimgange unseres langjährigen Lehrers a.D. Baruch Wolf im 80.
Lebensjahre erlitten. - Schon im zartesten Kindesalter das Torastudium im
Elternhause pflegend, ging der teure Entschlafene aus der Schule großer
Lehrer der damaligen Zeit, des Rabbi Isak Gutmann - seligen Andenkens -
in Heidingsfeld, des Rabbi Eleasar Ottensoser - seligen Andenkens
- in Höchberg und des Rabbi Seligmann Bär Bamberger - seligen
Andenkens - in Würzburg als Toragelehrter hervor. Mit einem
umfangreichen Wissen schon ausgestattet, suchte er dasselbe auch während
seiner 50jährigen Berufstätigkeit und auch noch nach seiner
Pensionierung dem Grundsatze - Tag und Nacht in ihr zu wachsen -
entsprechend immer noch zu bereichern und sich zu vervollkommnen. Seine
peinliche Gewissenhaftigkeit in der Ausübung der Gebote und
Berufspflichten, seine echte Gottesfurcht, Bescheidenheit, Gottvertrauen,
Friedensliebe und Wohltätigkeitssinn trugen im während seiner
40jährigen aktiven Tätigkeit die Hochachtung nicht nur der jüdischen
Gemeinde und seiner Amtsbrüder, sondern auch - wie die Bestattung zeigte
- der hiesigen Gesamtbevölkerung ein. Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim
aus Burgpreppach würdigte an der Bahre die große Toragelehrsamkeit, die
Frömmigkeit, das menschenfreundliche Wesen und die Verdienste des
Heimgegangenen auf dem Gebiete der Schule und Synagoge. Dann sprachen Herr
Rabbiner Dr. Michalski aus Karlsruhe als Verwandter und früherer
Bezirksrabbiner in Burgpreppach,
Lehrer Blumenthal in
Hofheim namens des
Israelitischen Lehrervereins in Bayern, zu dessen Mitbegründern Baruch
Wolf vor 50 Jahren gehörte, ein Vertreter des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann S. Schuster aus
Hofheim als Schüler und ein Vertreter
des hiesigen Turnvereins, der mit umflorter Fahne erschienen war. - Möge
das Verdienst des teuren ein rechter Fürsprecher vor dem König
voller Gnade sein für seine hochbetagte Gattin. Das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1930:
"Lendershausen-Hofheim in Unterfranken, 1. August (1930). Einen
unersetzlichen Verlust hat nicht nur unsere Gemeinde sondern ganz
Israel, insbesondere aber die gesamte jüdische Lehrerschaft in dem
Heimgange unseres langjährigen Lehrers a.D. Baruch Wolf im 80.
Lebensjahre erlitten. - Schon im zartesten Kindesalter das Torastudium im
Elternhause pflegend, ging der teure Entschlafene aus der Schule großer
Lehrer der damaligen Zeit, des Rabbi Isak Gutmann - seligen Andenkens -
in Heidingsfeld, des Rabbi Eleasar Ottensoser - seligen Andenkens
- in Höchberg und des Rabbi Seligmann Bär Bamberger - seligen
Andenkens - in Würzburg als Toragelehrter hervor. Mit einem
umfangreichen Wissen schon ausgestattet, suchte er dasselbe auch während
seiner 50jährigen Berufstätigkeit und auch noch nach seiner
Pensionierung dem Grundsatze - Tag und Nacht in ihr zu wachsen -
entsprechend immer noch zu bereichern und sich zu vervollkommnen. Seine
peinliche Gewissenhaftigkeit in der Ausübung der Gebote und
Berufspflichten, seine echte Gottesfurcht, Bescheidenheit, Gottvertrauen,
Friedensliebe und Wohltätigkeitssinn trugen im während seiner
40jährigen aktiven Tätigkeit die Hochachtung nicht nur der jüdischen
Gemeinde und seiner Amtsbrüder, sondern auch - wie die Bestattung zeigte
- der hiesigen Gesamtbevölkerung ein. Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim
aus Burgpreppach würdigte an der Bahre die große Toragelehrsamkeit, die
Frömmigkeit, das menschenfreundliche Wesen und die Verdienste des
Heimgegangenen auf dem Gebiete der Schule und Synagoge. Dann sprachen Herr
Rabbiner Dr. Michalski aus Karlsruhe als Verwandter und früherer
Bezirksrabbiner in Burgpreppach,
Lehrer Blumenthal in
Hofheim namens des
Israelitischen Lehrervereins in Bayern, zu dessen Mitbegründern Baruch
Wolf vor 50 Jahren gehörte, ein Vertreter des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann S. Schuster aus
Hofheim als Schüler und ein Vertreter
des hiesigen Turnvereins, der mit umflorter Fahne erschienen war. - Möge
das Verdienst des teuren ein rechter Fürsprecher vor dem König
voller Gnade sein für seine hochbetagte Gattin. Das Andenken an
den Gerechten ist zum Segen." |
| |
 Bericht
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1930: "Hofheim - Lendershausen (Unterfranken). Unser
hochverehrter Lehrer Baruch Wolf in Lendershausen ist im nahezu 80.
Lebensjahr verschieden. Baruch Wolf ist noch aus den alten
Vorbereitungsschulen für den Lehrerberuf aus der Schule eines Rabbi
Eleasar Ottensooser (Höchberg) und
Rabbi Seligmann Bar Bamberger
(Würzburg) hervorgegangen, nachdem er zuvor noch zu Füßen des damaligen
bedeutendsten Toragelehrten Rabbi Isak Gutmann (Heidingsfeld) gesessen und
so neben einem umfangreichen Fachwissen einen großen Schatz an Torawissen
in sich vereinigte. Während seiner vierzigjährigen Tätigkeit hat er
sich nicht nur in der ursprünglichen, nunmehr fast aufgelösten
Kultusgemeinde Lendershausen und späteren Gemeinde Hofheim -
Lendershausen die größte Hochachtung erworben, sondern auch das
Vertrauen der hiesigen Gesamtbevölkerung besessen. Ehrende Worte widmete
dem Entschlafenen Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim namens der
Kultusgemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden; Herr Rabbiner Dr. Michalski (Karlsruhe) sprach
als Verwandter am Grabe; der Amtsnachfolger Lehrer Blumenthal (Hofheim)
als Vertreter des israelitischen Lehrervereins Bayern, Oberlehrer Gräf
namens des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann Schuster (Hofheim) im
Namen der Schüler und des Vorstandes des Turnvereins Lendershausen,
dessen langjähriges, treues Mitglied der Verewigte gewesen ist. Die
hiesige Kultusgemeinde wird das Andenken des Entschlafenen stets in Ehren
halten. - seligen Andenkens -." Bericht
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.
September 1930: "Hofheim - Lendershausen (Unterfranken). Unser
hochverehrter Lehrer Baruch Wolf in Lendershausen ist im nahezu 80.
Lebensjahr verschieden. Baruch Wolf ist noch aus den alten
Vorbereitungsschulen für den Lehrerberuf aus der Schule eines Rabbi
Eleasar Ottensooser (Höchberg) und
Rabbi Seligmann Bar Bamberger
(Würzburg) hervorgegangen, nachdem er zuvor noch zu Füßen des damaligen
bedeutendsten Toragelehrten Rabbi Isak Gutmann (Heidingsfeld) gesessen und
so neben einem umfangreichen Fachwissen einen großen Schatz an Torawissen
in sich vereinigte. Während seiner vierzigjährigen Tätigkeit hat er
sich nicht nur in der ursprünglichen, nunmehr fast aufgelösten
Kultusgemeinde Lendershausen und späteren Gemeinde Hofheim -
Lendershausen die größte Hochachtung erworben, sondern auch das
Vertrauen der hiesigen Gesamtbevölkerung besessen. Ehrende Worte widmete
dem Entschlafenen Herr Bezirksrabbiner Dr. Ephraim namens der
Kultusgemeinde, des Rabbinatsbezirks und des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden; Herr Rabbiner Dr. Michalski (Karlsruhe) sprach
als Verwandter am Grabe; der Amtsnachfolger Lehrer Blumenthal (Hofheim)
als Vertreter des israelitischen Lehrervereins Bayern, Oberlehrer Gräf
namens des Bezirkslehrervereins Hofheim, Kaufmann Schuster (Hofheim) im
Namen der Schüler und des Vorstandes des Turnvereins Lendershausen,
dessen langjähriges, treues Mitglied der Verewigte gewesen ist. Die
hiesige Kultusgemeinde wird das Andenken des Entschlafenen stets in Ehren
halten. - seligen Andenkens -." |
Lehrer Justin Fränkel wechselt nach
Erlangen, Lehrer Simon Blumenthal kommt nach Hofheim (1924)
Anmerkung: Justin Fränkel (geb. 28. Oktober 1896 in Obbach) wuchs mit
seiner jüngeren Schwester Berta in der Familie des Viehhändlers und Metzgers
Mendel Fränkel und seiner Frau Fanny geb. Grünbaum in
Obbach auf. Er besuchte ab 1911 die
Israelitische Präparandenschule in
Höchberg. Ab 1914 bis 1919 machte er eine Ausbildung an der
Israelitischen Lehrerbildungsanstalt ILBA in
Würzburg, unterbrochen durch seine Zeit als Kriegsteilnehmer im Ersten
Weltkrieg. Nach Abschluss der Ausbildung war Justin Fränkel von 1921 bis 1924
Lehrer in Hofheim, anschließend am Mädchengymnasium in Erlangen. Ab 1923 war er
mit Frieda geb. Blatt aus Obbach verheiratet; 1924 wurde sein Sohn Ernst
geboren, 1927 die Tochter Edith (Schwarz). Justin prägte als Religionslehrer und
Kantor die noch junge Kultusgemeinde Erlangen und engagierte sich im
Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, auch als Schriftführer
der Ortsgruppe (1932). In der NS-Zeit kam es im September 1934 zu Misshandlungen
durch einen SA-Mann. 1936, nach dem verfolgungsbedingten Berufsverbot, zog
Justin nach Bamberg und arbeitete dort an einer jüdischen Sonderklasse der
Volksschule. Im April 1937 wurde er verhaftet im Zusammenhang der
Ritualmordlegende zu Manau, Kreis Haßberge; danach, im November 1937, ging er
wieder zurück nach Erlangen. Justin Fränkel konnte im Juli 1938 in die USA
emigrieren. Seine Mutter Fanny und seine Schwester Berta wurden nach der
Deportation ermordet. Justin Frankel starb 1984 mit 87 Jahren in Cincinnati,
betrauert von seiner Frau Frieda, den Kindern Ernst und Edith, Enkeln und
Urenkeln.
 Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März
1924: Mitteilung
in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März
1924:
"Justin Fränkel in Hofheim erhielt ab 1. April die
Religionslehrerstelle in Erlangen.
Simon Blumenthal in Rimpar kommt am
15. Mai nach Hofheim." |
Über Lehrer Simon Blumenthal (ab 1924
Lehrer in Hofheim)
Anmerkung: Lehrer Simon Blumenthal ist
am 1. April 1872 in der Hansestadt Lübeck geboren. Er stammte aus einer
kinderreichen Lehrerfamilie. Sein Vater Lazarus Blumenthal unterrichtete von
1872 bis 1905 in Laudenbach bei
Karlstadt. Simon studierte, wohl nach der damals üblichen Berufsvorbereitung an
einer Präparandenanstalt, an der Isr.
Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Examen 1891). Seit etwa 1899 unterstützte
er seinen Schwiegervater Simon Buttenwieser als Lehrer in
Rimpar. Im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst in
einem bayerischen Infanterie-Ersatzbataillon (1916): Ab Juli 1917 war er wieder
als Lehrer in Rimpar. Zum 15. Mai 1924
wechselte er nach Hofheim. 1930 bildete sich
auf seine Initiative eine Bezirkskonferenz jüdischer Lehrer für
Burgpreppach-Hofheim, die auch
für die Fortbildung der Kultusbeamten in den umliegenden Gemeinden zuständig
war. Ab Ende 1933 lebte Simon Blumenthal mit seiner Frau und seinen Töchtern
Zartella (1927-2005) und Henriette (1932- ) im Ruhestand in Würzburg, zeitweise
zusammen mit seiner Schwester Nanni Blumenthal. Simon Blumenthal und seine
Familie emigrierten im August 1939 nach London. Von Oktober 1939 bis Januar 1941
war Simon als Feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert.
Lehrer Simon Blumenthal begründet eine
Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim für Lehrer (1930)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
April 1930: "Vor einigen Wochen hat Lehrer Blumenthal (Hofheim) die
Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim ins Leben gerufen. Wir begrüßen
den Zusammenschluss der Kollegen in diesem Bezirke und hoffen, dass auch
hier fruchtbringende Arbeit für Beruf und Judentum geleistet wird." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.
April 1930: "Vor einigen Wochen hat Lehrer Blumenthal (Hofheim) die
Bezirkskonferenz Burgpreppach-Hofheim ins Leben gerufen. Wir begrüßen
den Zusammenschluss der Kollegen in diesem Bezirke und hoffen, dass auch
hier fruchtbringende Arbeit für Beruf und Judentum geleistet wird." |
| |
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1930: "Aus dem Bezirksrabbinat Burgpreppach. Hofheim in
Unterfranken, 30. April. Dank der Bemühungen des Herrn Bezirksrabbiners
Dr. Ephraim und der finanziellen Mithilfe des Verbandes Israelitischer
Gemeinden Bayerns konnten nach jahrelangen Unterbrechungen seit Ende
September 1939, ähnlich wie in anderen Rabbinatsbezirken,
Fortbildungskurse für die Kultusbeamten eingerichtet werden, die trotz
der schlechten Verkehrsverhältnisse, besonders im Winter, in
sechswöchentlichen Abschnitten stattfanden. Das Arbeitsgebiet erstreckt
sich auf Bibel, Talmud, pädagogische Vorträge usw. Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Mai
1930: "Aus dem Bezirksrabbinat Burgpreppach. Hofheim in
Unterfranken, 30. April. Dank der Bemühungen des Herrn Bezirksrabbiners
Dr. Ephraim und der finanziellen Mithilfe des Verbandes Israelitischer
Gemeinden Bayerns konnten nach jahrelangen Unterbrechungen seit Ende
September 1939, ähnlich wie in anderen Rabbinatsbezirken,
Fortbildungskurse für die Kultusbeamten eingerichtet werden, die trotz
der schlechten Verkehrsverhältnisse, besonders im Winter, in
sechswöchentlichen Abschnitten stattfanden. Das Arbeitsgebiet erstreckt
sich auf Bibel, Talmud, pädagogische Vorträge usw.
Nun haben sich vor kurzem die an den Fortbildungskursen beteiligten Lehrer
zu einer Bezirkskonferenz des Israelitischen Lehrervereins
zusammengeschlossen, deren Beratungen in Verbindung mit den
Fortbildungskursen von jetzt an in vierwöchentlichen Abschnitten
stattfinden sollen." |
Aus
der Geschichte der jüdischen Gemeinde - die Ritualmordlegende von Manau
(Beitrag von Christiane Kolbet, Quelle: HaGalil.com)
|
März 1929 im unterfränkischen
Manau: Der viereinhalbjährige Karl Keßler kehrt nicht vom Spielen zurück.
Eine Suchaktion wird gestartet. Nach bangen Stunden macht man einen
grausigen Fund: Der Leichnam des Kindes wird mit durchschnittener Kehle im
Wald entdeckt. Das Entsetzen im Dorf ist groß. Wer mordet einen
unschuldigen Knaben? Diese Frage lässt im Dorf niemanden mehr schlafen.
Da findet
die Gernerbäuerin in ihren Schränken ein zerfleddertes Buch: "Ein
Bericht von den zwölf Jüdischen Stämmen, was ein jeder Stamm dem Herrn
Christo zum Schmach getan haben soll und was sie dieß den heutigen Tag
dafür leiden müssen." Von den Nachkommen des Stammes Dan hieß es
in diesem Büchlein, dass sie keine Ruhe fänden, wenn sie nicht "mit
der Christen Blut ihren stinkenden Leichnam wieder salben und
schmieren". Bereits einen Tag später wissen alle in Manau über den
Stamm Dan Bescheid. Die Polizei geht in ihren Ermittlungen von einem
"Lustmord" an dem viereinhalbjährigen Jungen aus, doch für die
Manauer steht fest, dass es sich bei dem Vergehen um einen "jüdischen
Ritualmord" handeln muss. Wahllos beginnen sie jüdische Bürger der
Umgebung der Tat zu bezichtigen. Geschürt wird ihre Paranoia vom
damaligen Gauleiter der NSDAP in Unterfranken, dem Zahnarzt Dr. Otto
Hellmuth aus Marktbreit. Er war nur wenige Tage nach der Tat persönlich
nach Manau gereist, um sich am Fundort der Leiche und mit Hilfe der
ortsansässigen Bevölkerung und des Bürgermeisters ein eigenes Bild von
den Vorkommnissen zu machen. Noch im März verfasst Hellmuth für den
"Stürmer" einen Artikel über den Mord von Manau und er lässt
keinen Zweifel daran, wen er für die Mörder des Jungen hält. Am 1.
April 1929, dem Ostermontag, lädt die NSDAP in Hofheim, dem Nachbarort
von Manau, zu einer Versammlung über die "Blutmorde der Juden"
ein. Der Andrang ist riesig. In drei Sälen gleichzeitig hetzen die Nazis
und ihr unterfränkischer Gauleiter gegen die Juden und rufen offen zu Tätlichkeiten
gegen die Minderheit auf. Ähnliche Veranstaltungen folgen in Ortschaften
im weiteren Umkreis. Zudem lässt Otto Hellmuth auf eigene Kosten ein
vierseitiges Flugblatt und eine Postkarte mit dem Konterfei des ermordeten
Karl Keßler drucken und in der Manauer Gegend verteilen. Die Juden in der
Region wehren sich gegen die Hetze: In Zeitungsartikeln, ganzseitigen
Anzeigen und in öffentlichen Veranstaltungen versuchen sie den absurden
Vorwürfen entgegenzutreten. Im "Boten vom Haßgau" bezieht die
Bayerische Rabbinerkonferenz dezidiert Stellung zur Mär vom Ritualmord.
Auch das katholische "Fränkische Volksblatt", das in Würzburg
erscheint, und dessen Chefredakteur Heinrich Leier Geistlicher ist,
verweist den angeblichen Ritualmord in das Reich der Phantasie. Doch der
Erfolg der Aufklärungsaktionen bleibt dürftig. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil es der Polizei nicht gelingt, den Mörder des Jungen zu
finden. 1930 wird an der Stelle, an der die Kinderleiche gefunden wurde,
ein Gedenkstein enthüllt. Der Platz wird zur Pilgerstätte der immer stärker
werdenden NSDAP. Vier Jahre nach dem Mord ist die Saat der Nazis
aufgegangen. Nun hat der Gauleiter von Unterfranken Otto Hellmuth freie
Hand, um gegen die vermeintlichen Mörder des Karl Keßler vorgehen zu können:
1934 werden jüdische Bürger unter der Beschuldigung, den viereinhalb-jährigen
Jungen geschlachtet und sein Blut zu rituellen Zwecken verwendet zu haben,
verhaftet und von der Gestapo verhört. Begleitet wird die
Verhaftungsaktion von einer einschlägigen "Ritualmord"-Sondernummer
des "Stürmer". Die Ermittlungen im Manauer Mordfall zeitigen
wieder keine Ergebnisse. Doch Otto Hellmuth gibt nicht auf: 1937 kommt es
wieder zu Verhaftungen. Sieben Personen werden diesmal festgenommen und im
Würzburger Gestapogefängnis inhaftiert. Unter ihnen sind der Lehrer und
Schächter Emanuel Levi aus Burgpreppach, der bereits 1929 und 1934 der
Tat verdächtigt wurde, sein Sohn Simon, der Erlanger Lehrer Justin Fränkel,
und der Mazzenbäcker von Burgpreppach, Julius Neuberger. Monatelang
werden sie festgehalten und immer wieder verhört. Am Ende einer der
zahllosen Vernehmungen droht der über siebzigjährige Emanuel Levi offen
mit Selbstmord. Und obwohl Belastungszeugen mit abenteuerlichen
Behauptungen in Erscheinung treten und die Willkür der Nazis schon damals
keine Grenzen mehr kennt, müssen die Beschuldigten nach monatelangen
ergebnislosen Ermittlungen, und dank des Geschicks von Anwälten wie
Thomas Dehler, freigelassen werden. Justin Fränkel und Simon Neuberger
nutzen in der folgenden Zeit die wiedergewonnene Freiheit dazu,
Deutschland zu verlassen. Viele der anderen Verdächtigten werden 1942 von
den Deportationen erfasst, so auch der Lehrer Manuel Levi, der 1941 im
Alter von 77 Jahren nach Riga verschleppt und dort ermordet wird. Noch
kurz vor der Kapitulation im Frühjahr 1945 halten die Nazis im Wald von
Manau eine Gedenkveranstaltung" für den ermordeten Knaben ab. Bald
danach wird der Gauleiter von Unterfranken, Otto Hellmuth, wegen einer
Reihe von Vergehen als Kriegsverbrecher gesucht, gefasst und zum Tode
verurteilt. Doch die Nachkriegszeit meint es gut mit dem Zahnarzt: Zu
lebenslanger Haft begnadigt, wird er bereits 1955 aus dem Gefängnis
entlassen und erhält eine Entschädigung für seine
"Kriegsgefangenschaft". 1958 lässt er sich im Schwäbischen
nieder und praktiziert wieder als Zahnarzt. Er stirbt 1968. In Manau aber
gibt es noch heute Menschen, die ernsthaft glauben, dass Karl Keßler das
Opfer eines "jüdischen Ritualmordes" wurde.
|
|
|
| Verschiedene Berichte in
jüdischen Periodika April/Mai 1929: |
|
 |
 |
 |
| "Die Ritualmordhetze in Franken. Ein Bericht in
Ausschnitten" - Darstellung in der
"Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 1. Mai 1929 |
| |
|
|
 |
 |
 |
"Ritualmordlüge in
Bayern" - Artikel in der
"Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung"
vom 15. April 1929 |
"Noch keine
Aufklärung des Manauer
Mordfalles" - Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 18. April 1929. |
"Der Manauer Mord" -
Artikel in der
Zeitschrift "Der Israelit" vom
24. April 1929. |
| |
|
|
 |
 |
 |
"Große Protestkundgebung
in Würzburg" -
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 10. Mai 1929 |
"Der
bayerische Kultusminister Goldenberger
gegen die Manauer Ritualmordhetze" - Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 15. Mai 1929 |
"Die
Ritualmordhetze in Bayern" - Artikel
in der Zeitschrift "Der
Israelit"
vom 16. Mai 1929 |
| |
|
| |
|
|
|
Siehe weitere Beiträge:
- Der Ritualmord von Manau und seine Instrumentalisierung durch die
unterfränkische NSDAP. In: Ullrich Wagner (Hrsg.): "Denn das Sterben des
Menschen hört nie auf …".
Aspekte jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart (= Schriften des
Stadtarchivs Würzburg. Band 11), Ferdinand Schöningh, Würzburg 1997, S.
169–182. |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Unter den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch
Lehrer Max Strauß (aus Hofheim stammend, gefallen 1914)
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg
gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß
von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim
stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach
am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;
Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in
Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der
Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,
wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."
|
Zum Tod von Moses Reus 1926
In der kurzen Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hofheim spielte Moses
Reus (1858-1927) eine besondere Rolle. Er war von 1917 bis 1927 Vorsteher der
Gemeinde und war u.a. als Kassier des Rabbinatsbezirkes Burgpreppach sowie als
Mitglied in der Vorstandschaft und als Kassier im Bund gesetzestreuer
israelitischer Gemeinden Bayerns tätig.
Auch gehörte er sieben Jahre lang dem Stadtrat von Hofheim an.
Rechts Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1922.
Als
Mitglied in der Vorstandschaft und als Kassier im Bund gesetzestreuer
israelitischer Gemeinden Bayerns unterzeichnet Moses Reus in
Hofheim.
Die Anzeige wird nicht ausgeschrieben, da sie zur Geschichte der Gemeinde
Hofheim keine Informationen enthält. |
 |
| |
|
|
 |
 |
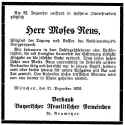 |
Oben links Artikel in der "Bayerischen
Israelitischen Gemeindezeitung" am 7. Januar 1927: "Hofheim
in Unterfranken. Am 25. Dezember (1925) verschied in Hofheim der
Kaufmann Moses Reus, der seit Gründung des Verbandes Bayerischer
Israelitischer Gemeinden dessen Tagung als Mitglied angehörte und lange
Jahre hindurch das Vorsteheramt in seiner Gemeinde bekleidet hat. Mit ihm
verliert die unterfränkische Judenheit eine ihrer markantesten
Persönlichkeiten. Trotz seiner vorgerückten Jahre war der
Dahingeschiedene unermüdliche im Interesse seiner Gemeinde, wie im
Interesse des Verbandes tätig, für den er stets mit voller Hingabe
eingetreten ist. Als Kassier des Rabbinatsbezirks Burgpreppach hat er die
Geschäfte des Bezirks in musterhafter Weise geführt. Auch im Kuratorium
der früheren Bürgerschule Burgpreppach war er bis zuletzt tätig. Sein
Andenken wird bei allen, die ihn kannten, stets in hohen Ehren gehalten
werden."
Nachruf der Gemeinde (Mitte, aus der Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 7. Januar 1927: "Nachruf. Tief erschüttert
beklagen wir den allzu frühen Heimgang unseres Vorstandes Herrn Moses
Reus, welcher für unsere Gemeinde einen fühlbaren unersetzlichen Verlust
bedeutet. Von unermüdlicher Willenskraft beseelt, mit klug Umsicht,
weitausschauendem Blicke, Geradheit und Uneigennützigkeit hat er zehn
Jahre hindurch unser Gemeindewesen nutzbringend geleitet. Sein Name ist
mit der Gründung der noch jungen Kultusgemeinde Hofheim unlösbar
verknüpft, und sein Andenken wird in unserer Mitte niemals verlöschen.
Die israelitischen Kultusgemeinde Hofheim."
Nachruf des Verbandes (rechts): "Am 25. Dezember verstarb in
Hofheim (Unterfranken) plötzlich Herr Moses Reus, Mitglied der Tagung und
Kassier des Rabbinatsbezirks Burgpreppach. Wir betrauern in dem
Dahingeschiedenen eine Persönlichkeit, die mit strengster Lauterkeit der
Gesinnung eifrigste Hingabe an die jüdische Sache verband. Trotz seiner
hohen Jahre war Moses Reus unermüdlich im Interesse unseres Verbandes
tätig und hat nicht nur in seinem Bezirk, sondern weit über diesen
hinaus für unsere Aufgaben mit Rat und Tat gewirkt. Das Andenken dieses
trefflichen Mannes wir von uns immer in Ehren gehalten werden.
München, den 31. Dezember 1926. Verband Bayerischer Israelitischer
Gemeinden. Dr. Neumeyer."
|
 |
 |
Links:
Ausführlicher Artikel in der "Bayerischen Israelitischen
Gemeindezeitung" vom 8. März 1927 |
| |
| Nachfolgeregelung für Moses
Reus im Amt des Kassiers für den Bezirksausschuss (Anzeige in der
"Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 9. Februar
1927: |
 "Bekanntmachung
des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Betr. Bestellung eines
Kassiers für den Bezirksausschuss Burgpreppach. Hierdurch geben wir
bekannt, dass an Stelle des verstorbenen Herrn Moses Reus Herr Max Rein
in Hofheim zum Kassier des Bezirksausschusses Burgpreppach gewählt worden
ist. München, 18. Januar 1927. Dr. Neumeyer." "Bekanntmachung
des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Betr. Bestellung eines
Kassiers für den Bezirksausschuss Burgpreppach. Hierdurch geben wir
bekannt, dass an Stelle des verstorbenen Herrn Moses Reus Herr Max Rein
in Hofheim zum Kassier des Bezirksausschusses Burgpreppach gewählt worden
ist. München, 18. Januar 1927. Dr. Neumeyer." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes J. Schuster
(1901)
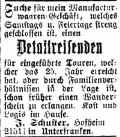 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1901:
"Suche für mein Manufakturwaren-Geschäft, welches Samstags und
Feiertage streng geschlossen ist, einen
Detailreisenden
für
eingeführte Touren, welcher das 25. Jahre erreicht hat, oder durch
Familienverhältnisse in der Lage ist, schon früher einen Wanderschein zu
erlangen. Kost und Logis im Hause.
J. Schuster, Hofheim in Unterfranken." |
Dokument zum Geschäft von Juda Schuster in Hofheim (1922)
(Quelle: aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim /
Ries; die Kommentierung auf Grund der Recherchen von P. K. Müller)
Postkarte von J. Schuster,
versandt
nach Merseberg (1922) |
 |
 |
|
Geschäftskarte von J. Schuster aus Hofheim, versandt nach Merseburg am 18. August
1922; der Inhalt ist geschäftlicher Natur. Zum Absender und seiner
Familie: Juda Schuster (geb. 27. August 1852 in Sterbfritz,
hatte 1900 die bayrische Staatsangehörigkeit erhalten) war verheiratet mit
Ricka geb. Stern (geb. am 24. Dezember 1860. Das Ehepaar hatte drei
Kinder: Moritz, Siegmund und Regina.
- Moritz Schuster (geb. 25. Juli 1885 in Hofheim) ist im Ersten
Weltkrieg gefallen am 17. Oktober 1915 in Arras (vgl. oben in der Liste
der Gefallenen aus Hofheim). Sein Name steht auch auf dem Denkmal für die Kriegsopfer der jüdischen Gemeinde auf dem
jüdischen Friedhof Kleinsteinach.
- Siegmund Schuster (geb. am 2. April 1889) war verheiratet mit Selma
geb. Klein (geb. 1. November 1895 in Mitterteich; weitere
Informationen siehe Biografie
unter Selma Klein). Ab Juli 1921 wohnte das Ehepaar in Hofheim. Hier erblickte 1922 ihre Tochter Ruth das Licht der Welt.
1933 oder 1934 emigrierte das Ehepaar nach Großbritannien, später in die USA. 1944 wohnten Siegmund und
Selma Schuster in Wimbledon bei London. Ihre Tochter Ruth lebte damals schon in den USA, wohin ihr die
Eltern später folgten. Siegmund Schusters Name findet sich auch auf dem Grabstein der Eltern auf dem
jüdischen Friedhof in Kleinsteinach. Er starb am 21. Mai
1953 in Chicago; seine Frau Selma im Februar 1986 in Saint Petersburg
(Florida).
- Regina Schuster (geb. am 16. September 1894) war verheiratet mit Julius
Schönthal. Dieser war Mitinhaber und
der kaufmännische Leiter der Korbmöbelfabrik in Hofheim und der Bamberger Niederlassung. Als diesen ihren
Hauptsitz von Hofheim nach Bamberg verlegte, zog das Ehepaar Schönthal mit. Im Zuge der Reichspogromnacht
wurde Julius Schönthal festgenommen und ins Landgerichtsgefängnis Bamberg eingeliefert, aber auf Grund seiner Verdienste als Frontkämpfer und einer Kriegsverletzung wieder entlassen. Am 27. November 1941
wurde das Ehepaar
von Bamberg nach Riga deportiert. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist dort ab dem 3. Dezember 1941 das Lager Riga - Jungfernhof. Über ihr weiteres Schicksal und die Umstände ihrer Ermordung ist nichts bekannt.
Detailliertere Informationen, auch über das Schicksal ihrer Kinder Martin
(geb. 1920 in Hofheim) und Ludwig (geb. 1922 in Hofheim) finden sich im Gedenkbuch der Jüdischen Bürger Bambergs
S. 337-338.
Juda Schuster starb am 18. September 1928. Seine Frau Ricka am 9. März 1936.
Sie wurden beigesetzt im jüdischen Friedhof in
Kleinsteinach. |
Anzeigen des Manufaktur- und Modewarengeschäftes Gebrüder Reuß (1901 / 1902)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1901: "Mädchenlehrstelle-Gesuch Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1901: "Mädchenlehrstelle-Gesuch
für ein 15-jähriges Mädchen, von guter Figur, das schon
Geschäftskenntnisse besitzt. Porzellan- und Kurzwaren bevorzugt. Näheres
bei
Gebrüder Reuß, Hofheim, Bayern." |
| |
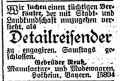 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1902: "Wir
suchen einen tüchtigen Verkäufer, der mit Stadt- und Landkundschaft
umzugehen versteht, als Detailreisender zu engagieren. Samstags
geschlossen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1902: "Wir
suchen einen tüchtigen Verkäufer, der mit Stadt- und Landkundschaft
umzugehen versteht, als Detailreisender zu engagieren. Samstags
geschlossen.
Gebrüder Reuß, Manufaktur- und Modewaren, Hofheim,
Bayern." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst wurden die Gottesdienste in Lendershausen besucht.
Ein eigener Betsaal (Synagoge) konnte 1920 in einem von der jüdischen
Gemeinde Hofheim erworbenen Haus in der Kirchgasse 11 eingerichtet werden. Darin
wurden die aus der aufgegebenen Synagoge Lendershausen gebrachten Ritualien
eingestellt Im selben Gebäude befand sich auch der Raum für die
jüdische Schule. Im Keller wurde eine Mikwe eingerichtet.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung des Betsaales mit den
wertvollen Ritualien aus der Synagoge Lendershausen vernichtet oder gestohlen.
Das Gebäude blieb erhalten und wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Der Raum der
ehemaligen Mikwe wurde zur Waschküche und Abstellkammer, das Tauchbecken
zugeschüttet.
Eine Gedenk- oder Hinweistafel konnte bislang nicht an der ehemaligen
Synagoge angebracht werden, eine solche befindet sich an einer Mauer hinter dem
Rathaus der Stadt mit der Inschrift: "In Hofheim bestand eine Jüdische
Kultusgemeinde mit Synagoge, deren Inneneinrichtung am 10. November 1938 durch
die damaligen Machthaber zerstört wurde. Zur Erinnerung und
Mahnung".
Adresse/Standort der Synagoge: Kirchgasse 11
Fotos
Historische Aufnahmen
(Quelle Fotos links: Pinkas Hakehillot
s. Lit. S. 458; Foto rechts von Theodor
Harburger, Aufnahmedatum um
1929; Quelle: Central Archives for the
History of
the Jewish People, Jerusalem;
veröffentlicht in Th.
Harburger: "Die
Inventarisation jüdischer Kunst- und
Kulturdenkmäler in Bayern.
1998
Bd. 1 S. 297) |
 |
 |
| |
Das ehemalige jüdische
Gemeindezentrum |
Chanukkaleuchter
aus der Synagoge Lendershausen. Nach
Auflösung der jüdischen Gemeinde in
Lendershausen kamen die
Ritualien, u.a. dieser Leuchter, prächtige
Messingleuchter und
eine Ampel in den Betsaal nach Hofheim. |
| |
| |
| |
|
|
Das ehemalige
Synagogengebäude 2007 |
 |
 |
| |
Im
Gebäude fanden sich neben dem Betsaal auch ein Raum für den
Religionsunterricht
sowie im Keller das rituelle Bad |
| |
|
Die Gedenktafel für die
ehemalige Synagoge |
 |
 |
| |
Die Tafel ist an
einer Mauer hinter der Kirche angebracht |
| |
|
Gefallenendenkmal
an der
Kirche |
 |
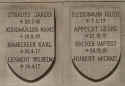 |
| |
Gefallenendenkmal |
Auf den abgebildeten Tafeln sind die
Namen von
Jakob Strauß und Julius Fleischmann genannt, auf den
anderen
Tafeln die Namen der drei anderen Gefallenen (s.o.) |
| |
| |
|
|
| |
|
|
Historische Karte mit einem
jüdischen Geschäft
(aus der Sammlung von
Aribert Elpelt, Website
http://heimat-unterfranken.de.tl/ |
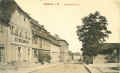 |
 |
|
| |
Die
Landgerichtsstraße in Hofheim mit dem Geschäft von B. Friedmann |
|
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte
|
Mai/September
2024: In Hofheim
sollen Stolpersteine verlegt werden |
Artikel in "Fränkischer Tag" am 1. Mai 2024:
"Gedenken. Vorbereitungen für die Hofheimer Stolpersteine.
Hofheim i. UFr. – Die Stadt will an Bürger erinnern, die während des
Nationalsozialismus vertrieben und ermordet wurden. Das hatte der Verein
'Stolpersteine Haßberge' angeregt; der Stadtrat von Hofheim hat das nun
einstimmig beschlossen. Der Verein Stolpersteine Haßberge möchte nun am
Donnerstag, 2. Mai, über den weiteren Fortgang informieren. Treffpunkt ist
Maya’s Unverpacktladen und Café um 18 Uhr. Die ersten sechs Gedenksteine für
Mitglieder der Familien Stern, Sündermann und Rosenberg sollen am Sonntag,
29. September, verlegt werden, und zwar vor den Anwesen Marktplatz 4, Obere
Torstraße 2 und Hauptstraße 2.
Ein Koffer aus Stein. Bereits am 14. Juni, einem Freitag, wird im
Rahmen einer Feierstunde eine Skulptur enthüllt, die an die Deportierten und
Vertriebenen jüdischen Bürger Hofheims erinnern soll. Es handelt sich um
einen Koffer aus Stein, dessen Pendant Teil einer Gepäckstückansammlung am
Würzburger Hauptbahnhof ist (www.denkort-deportationen.de)
Die Feier beginnt um 14 Uhr am Marktplatz und endet gegen 14.45 vor dem
alten Bahnhof, wo das Mahnmal durch Bürgermeister Alexander Bergmann
enthüllt wird. Der Verein Stolpersteine Haßberge sorgt für das künstlerische
Begleitprogramm.
Gesucht: Fotos und Erinnerungsstücke. Über beide Veranstaltungen, die
Enthüllung am 14. Juni und die Stolpersteinverlegung am 29. September
informiert der Verein am heutigen Donnerstag. Wer sich hier noch engagieren
möchte oder einfach neugierig ist, ist eingeladen. Außerdem bittet der
Verein: Wer noch über Fotografien oder anderes Material verfügt, das
Aufschluss über die Opfer der Naziherrschaft und ihr Leben in Hofheim geben
kann, wird gebeten, dies zur Verfügung zu stellen."
Link zum Artikel
Vgl. Artikel von Ralf Hein in der "Main-Post" vom 26. April 2024: "Verlegung
von Stolpersteinen in Hofheim: Die Termine in der Übersicht..."
Link zum Artikel |
| Zur Verlegung der "Stolpersteine" am 29.
September 2024 siehe Artikel von Rebecca Vogt in der "Main-Post" vom 2.
September 2024: "Erste Stolpersteine für Opfer der NS-Zeit in Hofheim. An
diese sechs Menschen sollen sie erinnern..."
Link zum Artikel |
Weiterer Artikel von Rainer Dehmer in der
"Main-Post" vom 13. September 2024: "HOFHEIM. Die ersten Stolpersteine in
Hofheim werden verlegt.
Am Sonntag, 29. September, werden vor den Häusern Hauptstraße 2, Obere
Torstraße 2 und Marktplatz 6 für Sara und Isaak Rosenbach, Irma, David und
Heinz Sündermann sowie für Sali Stern Stolpersteine verlegt. Beginn ist um
14 Uhr vor dem Anwesen Hauptstraße 2. Das teilt der Verein Stolpersteine
Haßberge in einem Schreiben mit, dem folgende Informationen entnommen sind.
Sara und Isaak Rosenbach wurden 1942 in Theresienstadt ermordet. David
Sündermann starb 1941 in Berlin, seine Frau Irma und ihr Sohn Heinz wurden
1942 im Ghetto Warschau ermordet. Sali Stern floh 1934 nach Luxemburg und
nahm sich 1939 angesichts der drohenden Deportation das Leben. Die Opfer
waren zwischen 12 und 64 Jahre alt. Nach der Verlegung (etwa um 14.45 Uhr)
sind alle Interessierten zu einem Empfang bei Kaffee und Kuchen im
Katholischen Pfarrsaal eingeladen.
Kunstprojekt zum Gedenken
Die Hofheimer Künstlerin Jannina Hector hat, inspiriert durch diese
fragmentarischen Erinnerungen, mit dem Wissen um die Schrecken und
Unmenschlichkeit des Holocaust und ihrer Verbundenheit mit der Region eine
Serie von Drucken in besonderem Format geschaffen. Die Motive nehmen Bezug
auf die Berufe der Opfer, ihre jüdische Kultur und Religion, ihre fränkische
Heimat. Zu besichtigen sind diese Drucke noch bis zum 27. September in der
Remise des Rathauses von Hofheim (montags bis donnerstags von 8 bis 12 und
von 13 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr). Im Anschluss an die Verlegung
der Stolpersteine, beim Empfang im Katholischen Pfarrsaal, wird dieses
Kunstprojekt als einheitlich Ganzes verschwinden. Die bedruckten Bahnen
werden zerschnitten, die Gäste der Gedenkfeier können die Einzelteile als
Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen. 'So werden auch die
künstlerischen Zeugnisse unserer Gedenkfeier nur noch fragmentarisch
verstreut in der Welt zu finden sein', heißt es in der Mitteilung."
Link zum Artikel |
| |
Juni 2024:
Aufstellung eines Denkmales -
Koffer aus Stein - zur Erinnerung an die Deportation der Hofheimer Juden
Anmerkung: Ein identischer Koffer aus Hofheim steht in Würzburg, siehe
https://denkort-deportationen.de/ |
Informationen in der Website
https://stolpersteine-hassberge.de/chronik.html vom 14. Juni 2024: "14.
6. 2024: In Hofheim i. UFr. wird ein steinerner Rucksack aufgestellt, der
Teil des partizipativen Mahnmals DenkOrt Deportationen ist. Vor dem
Würzburger Hauptbahnhof, von wo aus zwischen 1941 und 1943 die meisten
Transporte aus dem damaligen Gau Mainfranken in die Vernichtungslager und
ins KZ Theresienstadt abgingen, stehen Gepäckstücke aus Stein, Metall,
Keramik. Jedes dieser Gepäckstücke trägt den Namen einer Gemeinde in
Unterfranken; ein Duplikat des jeweiligen Gepäckstücks steht in der
Herkunftsgemeinde der Opfer.
Bürgermeister Bergmann enthüllte das Denkmal; unser Verein sorgte für die
Gestaltung der Feier. Künstlerische Höhepunkte waren die musikalische
Begleitung durch den Saxophonisten Anton Mangold und die eindrucksvolle
Gehwegkalligrafie der Hofheimer Künstlerin Melina Müller: Zwischen
Marktplatz und dem ehemaligen Bahnhof, wo der Rucksack seinen Platz gefunden
hat, wurden die Gehwege mit den Namen jüdischer Bürger bemalt, die einst in
Hofheim lebten.
Die Veranstaltung wurde unterstützt von Rotary Club Haßfurt und Lions Club
Haßberge." |
| |
|
September 2024:
Verlegung der "Stolpersteine" in
Hofheim |
Informationen in der Website
https://stolpersteine-hassberge.de vom September 2024: "Erste
Stolpersteine in Hofheim i.UFr. Am Sonntag, dem 29. September 2024, werden
vor den Häusern Hauptstraße 2, Obere Torstraße 2 und Marktplatz 6 für Sara
und Isaak Rosenbach, Irma, David und Heinz Sündermann sowie für Sali Stern
Stolpersteine verlegt. Beginn ist um 14 Uhr vor dem Anwesen Hauptstraße 2.
Sara und Isaak Rosenbach wurden 1942 in Theresienstadt ermordet.
David Sündermann starb 1941 in Berlin, seine Frau Irma und Sohn Heinz wurden
1942 im Ghetto Warschau ermordet.
Sali Stern floh 1934 nach Luxemburg und nahm sich 1939 angesichts der
drohenden Deportation das Leben.
Nach der Verlegung (etwa 14:45 Uhr) sind alle Interessierten zu einem
Empfang bei Kaffee und Kuchen im Katholischen Pfarrsaal eingeladen.
Die Hofheimer Künstlerin Jannina Hector hat anlässlich der
Stolpersteinverlegung eine Serie von grafischen Drucken geschaffen.
Es sind kaum noch Zeugnisse von den Menschen vorhanden, derer wir gedenken –
ihr Leben, ihre Kultur, ihr Alltag sind fast völlig vergessen. Nur ihr
Verbleib ist bekannt: Sie wurden ausgegrenzt, beraubt, misshandelt,
vertrieben, ermordet.
Jannina Hector hat, inspiriert durch diese fragmentarischen Erinnerungen,
mit dem Wissen um die Schrecken und Unmenschlichkeit des Holocaust und ihrer
Verbundenheit mit der Region eine Serie von Drucken in besonderem Format
geschaffen. Zu besichtigen sind diese Drucke vom 5. bis 27. September in der
Remise des Rathauses von Hofheim (Mo bis Do 8–12 und 13–16 Uhr, Fr 8–12
Uhr). Im Anschluss an die Verlegung der Stolpersteine wird dieses
Kunstprojekt als Ganzes verschwinden. Die Gäste der Gedenkfeier können Teile
davon als Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen, sodass auch die
Zeugnisse unserer Gedenkfeier nur fragmentarisch verstreut in der Welt zu
finden sein werden."
Flyer zur
Verlegung der Stolpersteine (pdf-Datei) |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 67. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 320. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 458-459. |
 | Kordula Kappner: Die jüdischen Bürger in Hofheim.
In: Chronik der Stadt Hofheim und ihrer Stadtteile. Hg. vom 'Arbeitskreis
Hofheimer Stadtgeschichte' - Leitung Hans Reuscher. 1993 S. 111-114. |
 | dies.: "Oppenheimer Wein ist giftig". Vom
Judentörle zum Faschingswagen - kleiner Abriss der Geschichte der
jüdischen Bürger in Hofheim. In: "Main-Post" vom 3. Juni
2011. Link
zum Artikel - auch eingestellt als
pdf-Datei. |


Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Hofheim Lower Franconia. The
Jewish community grew from seven in 1867 to 59 in 1910 (total 985) and numbered
43 in 1933. The Jews were mostly cattle traders and shopkeepers. In 1934 the
Nazis revived a blood libel from 1929, arresting some Jews. All the Jews left by
1940, 16 of them emigrating from Germany.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|