|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge
in Pflaumloch
Pflaumloch (Gemeinde
Riesbürg, Ostalbkreis)
Texte/Berichte/Dokumente zur jüdischen Geschichte des Ortes
Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit
Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Pflaumloch wurden in jüdischen Periodika
gefunden, dazu finden sich einige ergänzende Dokumente sonstiger Provenienz. Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.
Übersicht:
Allgemeine
Gemeindebeschreibungen
Reisebericht:
von Nördlingen nach Pflaumloch (1848)
Anmerkung: die hebräischen Begriffe/Zitate sind auf Grund der damals verwendeten
Schriftart, kaum zu lesen.
 Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 4. Januar 1848: "Eine
Reise in das württembergische Unterland. Von Ulm. Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 4. Januar 1848: "Eine
Reise in das württembergische Unterland. Von Ulm.
'Drunten, im Unterland, da ist's halt fein...' Württembergisches Volkslied.
Nördlingen, die Stadt mit ihren
industriösen und aufgeklärten Einwohnern, von denen man es kaum vermuten
könnte, dass ihre Vorfahren zweimalige, harte und blutige Verfolgung der
Juden sich zu Schulden kommen lassen, und dass sie 100 Jahre nach der
letzten Judenvertreibung, als beim Ausgang des 16. Jahrhunderts, innerhalb
zweier Jahre 38, sage acht und dreißig Juden, die in der Zeitschrift 'das
Ries' nach Namen, Alter und Stand angegeben sind, wo ihr angebliches
Verbrechen, sowohl als ihre vorgebliche |
 Verteidigung
umständlich erzählt werden, verbrannt haben, hatte ich eben verlassen, als
man die Straßen breiter angelegt und besser gebahnt fand, was die Nähe der
württembergischen Grenze vermuten ließ. - Zwei sehr anständig gekleidete
junge Männer, anscheinend bloß lustwandelnd, kamen des Weges. 'Also, dabei
bleibt's, der Rabbiner, der am nächsten Sabbat bei uns predigen wird soll
entscheiden, wer von uns beiden den ... richtiger aufgefasst hat! Waren die
Nachklänge eines, wie aus den lebhaften Bewegungen der beiden Männer zu
schließen war, mit vielem Eifer geführten Gespräches, welche meine
wahrscheinlich unerwünschte Daherkunft ein Ende machte. Ich gestehe es
gerne, dass es mir leid tat, durch mich ein Gespräch über diwrei Tora
(Toraworte) unterbrochen zu sehen, und Veranlassung geworden zu sein, dass
das ... für den Augenblick aufgehört hatte. Verteidigung
umständlich erzählt werden, verbrannt haben, hatte ich eben verlassen, als
man die Straßen breiter angelegt und besser gebahnt fand, was die Nähe der
württembergischen Grenze vermuten ließ. - Zwei sehr anständig gekleidete
junge Männer, anscheinend bloß lustwandelnd, kamen des Weges. 'Also, dabei
bleibt's, der Rabbiner, der am nächsten Sabbat bei uns predigen wird soll
entscheiden, wer von uns beiden den ... richtiger aufgefasst hat! Waren die
Nachklänge eines, wie aus den lebhaften Bewegungen der beiden Männer zu
schließen war, mit vielem Eifer geführten Gespräches, welche meine
wahrscheinlich unerwünschte Daherkunft ein Ende machte. Ich gestehe es
gerne, dass es mir leid tat, durch mich ein Gespräch über diwrei Tora
(Toraworte) unterbrochen zu sehen, und Veranlassung geworden zu sein, dass
das ... für den Augenblick aufgehört hatte.
Diesen Männern nahe gekommen, fragte ich sie, wie das, etwa eine halbe Meile
von uns noch entfernte, am Fuße eines sanften Hügel so schön gelegene Dorf
hieße, und welches Gebäude das sei, dessen stolzes Dach über alle anderen
Gebäude des Dorfes sich erhebe? - 'Das ist Pflaumloch, das Gebäude ist die
neue Synagoge', antworteten mir diese Leute mit sichtlichem Wohlgefallen,
was mich vermuten ließ, dass sie selbst aus Pflaumloch seien. - Nachdem ich
Ihnen gedankt hatte, bat ich um Entschuldigung, sie in ihrem Gespräch
unterbrochen zu haben, und forderte sie auf, den Faden wieder aufzufassen,
damit durch dafür und dawider der über allen Zweifel erhabene Sinn der, wie
es scheint, dunklen Stelle, des oft rätselhaften ... erörtert werde, und es
eine Autoritätsentscheidung nicht bedürfe. - 'Ach', sagte der etwas ältere
der jungen Leute, 'unser Streit dauert schon seit mehreren Stunden, ohne
dass es mir gelingen will, meinen Freund zu veranlassen, zu einer einfachen
Erklärung seine Einwilligung zu geben, weil sein unerschöpflicher
Scharfsinn, überall nur diesem die Entscheidung einstellen will.' - Der
Jüngere, ein lebhafter, scharfsinniger Geist, dem aber das kalte, ruhige
Zerlegen eines Satzes nach allen seinen Bestandteilen nicht zusagte, begann
die Konversation von Neuem, der andere verschanzte sich hinter einer
gesunden Logik; und die Sache blieb auch jetzt unentschieden. Durch einige
hingeworfen Bemerkungen von meiner Seite erfuhren die Leute, dass ich auch
so ein Stück rabbinischer Literat sei, und wollten mich mit in den Streit
ziehen. was ich aber darum ablehnte, weil mir der Scharfsinn des Einen, und
die sichere Logik des anderen abgeht. - Indessen freute es mich aufrichtig,
gleich beim Eintritt in das Königreich Württemberg, solch eine Konversation
angehört zu haben.
In Pflaumloch angekommen, sah ich, dass so schön das Dorf aus der Ferne sich
darstellt, es in Wirklichkeit doch noch schöner ist.
Es wohnen hier zwischen 60 und 70 wohlhabende sehr gebildete Familien. Herr
Lehrer Löwenstein, ein Mann von allgemeiner Bildung, vorzüglicher
Talmudist, und von edlem Charakter, wirkt in der Schule zum Segen und in
influiert vorteilhaft auf die Gemeinde.
Eine andere merkwürdige Persönlichkeit lernte ich hier kennen, es ist die
des rüstigen und heiteren Greises, Rabbi Ensle Mosesstein. Er hatte
in seiner frühen Jugend die Schule zu Fürth
besucht; später und bis vor etwa 20 Jahren Handel getrieben, seitdem aber
bloß dem heiligen Studium sich gewidmet. Er ist solch ein
ausgezeichneter..., denn er, in Hinsicht seiner talmudischen Wissenschaften,
der ersten Rabbinen des vorigen und jetzigen Jahrhunderts zur Seite gestellt
werden kann. Dabei ist ..., denn es ist sozusagen .... Er genießt aber auch
von allen Einwohnern des Ortes und der Umgegend eine wahrhaft
patriarchalische Verehrung, und man hört den Namen 'Rabbi Ensle Pflaumloch'
nie anders als mit dem Ausdruck: ... oder einer andern ähnlichen Beifügung,
aussprechen.
Diese Hochachtung einem unabhängig in keinerlei amtlichen Verhältnissen
lebenden Manne gegenüber, gereicht sicherlich beiden Teilen zu gleicher,
hohen Ehre. Die hiesigen wohlhabenden Familien, Ellinger, Friedmann,
Lebrecht, Pflaum und Nördlinger, zählen nicht nur ordnungsmäßig, gebildete
Kaufleute, Ärzte und Rechtsgelehrten, sondern auch tüchtige Talmudisten und
gründliche Kenner der hebräischen Sprache in ihrer Mitte.
Die Juden in Pflaumloch waren es auch, die im Jahre 1796 einen Haufen
Marodeurs, die auf eigene Faust hin das Dorf brandschatzen wollten, aus
demselben vertrieben (M.s.v. Pahl's schwäb. Chronik).
Gleich oberhalb Pflaumloch endet die kreisförmige Ebene des Rieses und
verengt sich zu einem schmalen, anmutigen Tal, an dessen rechter Seite die
Straße sich hinzieht.
|
 Links
dieser Straße und zwar hart an derselben, erhebt sich - eine halbe Meile
oberhalb Pflaumlochs - ein mäßig hoher Berg, auf dessen Spitze die Ruine
eines im Dreißigjährigen Kriege zerstören Schlosses, 'Flochberg'
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Flochberg, allwo Kaiser Heinrich IV.
einige Zeit Hoflager gehalten und einmal eine sechsmonatliche Belagerung
ausgehalten..." Links
dieser Straße und zwar hart an derselben, erhebt sich - eine halbe Meile
oberhalb Pflaumlochs - ein mäßig hoher Berg, auf dessen Spitze die Ruine
eines im Dreißigjährigen Kriege zerstören Schlosses, 'Flochberg'
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Flochberg, allwo Kaiser Heinrich IV.
einige Zeit Hoflager gehalten und einmal eine sechsmonatliche Belagerung
ausgehalten..."
|
Aus
der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1879 /
1889 / 1894 / 1899 / 1900
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1879: "Zu Anfang
April dieses Jahres sucht die hiesige Gemeinde bei einem Gehalt von Mark
800-900 jährlich und freier Dienstwohnung einen Chasan (Vorbeter) und
Schochet und Religionslehrer. Verheiratete erhalten den Vorzug. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1879: "Zu Anfang
April dieses Jahres sucht die hiesige Gemeinde bei einem Gehalt von Mark
800-900 jährlich und freier Dienstwohnung einen Chasan (Vorbeter) und
Schochet und Religionslehrer. Verheiratete erhalten den Vorzug.
Bewerber
wollen sich, unter Beifügung von Zeugnissen über ihre bisherige Tätigkeit
an unterfertigte Stelle wenden.
Pflaumloch (Württemberg), im März 1879. Israelitisches
Kirchenvorsteheramt: Moritz Jung." |
| |
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1889: "Die Stelle
eines Religionslehrers, Vorsängers und Schächters in hiesiger Gemeinde
soll bis zum 1. bis 15. März dieses Jahres besetzt werden. Der Gehalt ist
auf Mark 800 nebst freier Wohnung fixiert. Bewerber wollen ihre Zeugnisse
oder beglaubigte Abschrift an das israelitische Vorsteheramt portofrei
einsenden. Deutsche werden bevorzugt. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar 1889: "Die Stelle
eines Religionslehrers, Vorsängers und Schächters in hiesiger Gemeinde
soll bis zum 1. bis 15. März dieses Jahres besetzt werden. Der Gehalt ist
auf Mark 800 nebst freier Wohnung fixiert. Bewerber wollen ihre Zeugnisse
oder beglaubigte Abschrift an das israelitische Vorsteheramt portofrei
einsenden. Deutsche werden bevorzugt.
Pflaumloch (Württemberg), im Januar 1889. Israelitisches
Kirchenvorsteheramt. M. Jung." |
| |
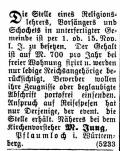 Anzeige
in "Der Israelit" vom 12. Oktober 1894: "Die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schochets in unterfertigter Gemeinde ist
per 1. oder 15. November laufenden Jahres zu besetzen. Der Gehalt ist auf
Mark 700 pro Jahr bei freier Wohnung fixiert und werden nur ledige
Reichsangehörige berücksichtigt. Bewerber wollen ihre Zeugnisse oder
beglaubigte Abschrift portofrei einsenden. Anspruch auf Reisespesen hat nur
Derjenige, der eventuell die Stelle erhält. Näheres bei dem Kirchenvorsteher
M. Jung, Anzeige
in "Der Israelit" vom 12. Oktober 1894: "Die Stelle eines
Religionslehrers, Vorsängers und Schochets in unterfertigter Gemeinde ist
per 1. oder 15. November laufenden Jahres zu besetzen. Der Gehalt ist auf
Mark 700 pro Jahr bei freier Wohnung fixiert und werden nur ledige
Reichsangehörige berücksichtigt. Bewerber wollen ihre Zeugnisse oder
beglaubigte Abschrift portofrei einsenden. Anspruch auf Reisespesen hat nur
Derjenige, der eventuell die Stelle erhält. Näheres bei dem Kirchenvorsteher
M. Jung,
Pflaumloch in Württemberg." |
| |
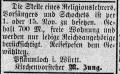 Anzeige in
der Zeitschrift "Jeschurun" vom 12. Oktober 1894: "Die Stelle
eines Religionslehrers, Vorsängers und Schochets ist per 1. oder 15.
November zu besetzen. Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und werden nur ledige
Reichsangehörige berücksichtigt. Reisespesen dem Gewählten. Anzeige in
der Zeitschrift "Jeschurun" vom 12. Oktober 1894: "Die Stelle
eines Religionslehrers, Vorsängers und Schochets ist per 1. oder 15.
November zu besetzen. Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und werden nur ledige
Reichsangehörige berücksichtigt. Reisespesen dem Gewählten.
Pflaumloch in Württemberg. Kirchenvorsteher M. Jung." |
| |
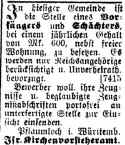 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899: "In hiesiger
Gemeinde ist die Stelle eines Vorsängers und Schächters, bei einem jährlichen
Gehalt von Mark 600, nebst freier Wohnung, zu besetzen. Es werden nur
Reichsangehörige berücksichtigt und Unverheiratete bevorzugt. Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1899: "In hiesiger
Gemeinde ist die Stelle eines Vorsängers und Schächters, bei einem jährlichen
Gehalt von Mark 600, nebst freier Wohnung, zu besetzen. Es werden nur
Reichsangehörige berücksichtigt und Unverheiratete bevorzugt.
Bewerber wollen ihre Zeugnisse und beglaubigte Zeugnisabschriften
portofrei an unterfertigte Stelle zur Einsicht einsenden.
Pflaumloch
in Württemberg. Israelitisches Kirchenvorsteheramt." |
|
|
 Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1900: "In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines Schächters
und Vorbeters bei einem jährlichen Gehalt von 600 Mark,
Nebenverdienst ca. 200 Mark, und freier Wohnung vakant.
Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 19. Januar 1900: "In hiesiger Gemeinde ist die Stelle eines Schächters
und Vorbeters bei einem jährlichen Gehalt von 600 Mark,
Nebenverdienst ca. 200 Mark, und freier Wohnung vakant.
Nur unverheiratete Bewerber wollen ihre beglaubigten Zeugnisse oder
Zeugnisabschriften portofrei an unterfertigte Stelle zur Einsicht
einsehen.
Pflaumloch in Württemberg, den 10. Januar 1900. Israelitisches
Kirchenvorsteheramt." |
Lehrer
Samuel Rödelsheimer wird vorübergehend Lehrer in Pflaumloch (1866)
Anmerkung: Samuel Rödelsheimer (geb. 12. September 1816 in Unterschwandorf)
war von 1836 bis 1866) Lehrer in Buchau. Nach seiner unten geschilderten
Verabschiedung wurde er auf eigenen Wunsch nach
Pflaumloch versetzt. Seit 1867 wurde er - auch auf Wunsch der Gemeinde Buchau -
wieder nach Buchau zurückversetzt. Er starb am 4.
Februar 1899 in Stuttgart. Unklar ist, wie lange genau Lehrer Rödelsheimer -
möglicherweise auf Dienstaushilfe für Lehrer Samuel Löwenstein - in
Pflaumloch war.
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. März 1866:
"Aus Württemberg, vom Federsee, 20. Februar (1866). Ein Akt schöner
Anerkennung, als Kundgebung der Dankbarkeit gegen einen scheidenden Lehrer
hat vor einigen Tagen in Buchau stattgefunden, der es verdient, in
weiteren Kreisen bekannt zu werden. Der Unterlehrer Rödelsheimer an der
israelitischen Volksschule, der 30 Jahre an derselben wirkte, wurde auf
sein Ersuchen als Schullehrer nach Pflaumloch befördert; dessen Abschied
von Buchau war ein kleines Volksfest, insofern sich die ganze Gemeinde
dabei beteiligt; aber auch allgemeines Bedauern gab sich unter allen
Bewohnern Buchaus ohne Unterschied der Konfession über das Scheiden des
wackeren, bescheidenen Volkslehrers kund. Herr Rabbiner Weinmann hat in
Anerkennung der Verdienste des Scheidenden um Schule und Gotteshaus, eine
Subskription eröffnet, die so reichlich ausfiel, dass dem Scheidenden ein
kostbarer silberner Pokal und 12 Karolin in Gold bei der Abschiedsfeier
als Andenken überreicht werden könnten, die der Herr Rabbiner mit einer
passenden Ansprache dem scheidenden Lehrer im Namen der Gemeinde
aushändigte. - Auch bei Sabbatgottesdienste würdigte der Rabbiner in
einer schwungvollen Predigt das Wirken des Lehrers, der in den 30 Jahren
seiner Tätigkeit als Erzieher ein ganzes Menschengeschlecht erzogen, und
zeichnete die Wichtigkeit und Würdigkeit des Lehramts. - Überhaupt hat
Herr Rabbiner Weimann schon mehrere Male sich als Freund der Lehrer
bewiesen, was ihm bei seinem weiteren Streben für angemessene Reform des
gottesdienstlichen Kultus, durch Einführung von Orgel, Chorgesang und des
neuen Stuttgarter Gebet- und Gesangbuches zur Ehre gereicht. Nicht minder
verdient die Gemeinde Buchau den Dank aller Gutgesinnten dafür, dass sie
in ihrem scheidenden Lehrer den ganzen Stand der Volkslehrer ehrte. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. März 1866:
"Aus Württemberg, vom Federsee, 20. Februar (1866). Ein Akt schöner
Anerkennung, als Kundgebung der Dankbarkeit gegen einen scheidenden Lehrer
hat vor einigen Tagen in Buchau stattgefunden, der es verdient, in
weiteren Kreisen bekannt zu werden. Der Unterlehrer Rödelsheimer an der
israelitischen Volksschule, der 30 Jahre an derselben wirkte, wurde auf
sein Ersuchen als Schullehrer nach Pflaumloch befördert; dessen Abschied
von Buchau war ein kleines Volksfest, insofern sich die ganze Gemeinde
dabei beteiligt; aber auch allgemeines Bedauern gab sich unter allen
Bewohnern Buchaus ohne Unterschied der Konfession über das Scheiden des
wackeren, bescheidenen Volkslehrers kund. Herr Rabbiner Weinmann hat in
Anerkennung der Verdienste des Scheidenden um Schule und Gotteshaus, eine
Subskription eröffnet, die so reichlich ausfiel, dass dem Scheidenden ein
kostbarer silberner Pokal und 12 Karolin in Gold bei der Abschiedsfeier
als Andenken überreicht werden könnten, die der Herr Rabbiner mit einer
passenden Ansprache dem scheidenden Lehrer im Namen der Gemeinde
aushändigte. - Auch bei Sabbatgottesdienste würdigte der Rabbiner in
einer schwungvollen Predigt das Wirken des Lehrers, der in den 30 Jahren
seiner Tätigkeit als Erzieher ein ganzes Menschengeschlecht erzogen, und
zeichnete die Wichtigkeit und Würdigkeit des Lehramts. - Überhaupt hat
Herr Rabbiner Weimann schon mehrere Male sich als Freund der Lehrer
bewiesen, was ihm bei seinem weiteren Streben für angemessene Reform des
gottesdienstlichen Kultus, durch Einführung von Orgel, Chorgesang und des
neuen Stuttgarter Gebet- und Gesangbuches zur Ehre gereicht. Nicht minder
verdient die Gemeinde Buchau den Dank aller Gutgesinnten dafür, dass sie
in ihrem scheidenden Lehrer den ganzen Stand der Volkslehrer ehrte.
In Herrn Gerstel, einem Jünger Sulzers, hat Buchau einen
tüchtigen Kantor gefunden, der sowohl durch tüchtige musikalische
Bildung, durch schöne Stimmmittel, wie durch Kenntnis der heiligen
Sprache alle Eigenschaften eines Chasan und Chordirigenten in sich
vereinigt. - Ein jüdisches Blatt, 'Mainzer Israelit', lässt den Stifter
der Kogitanten-Sekte einen getauften Juden sein. Herr Eduard Löwenthal
ist Jude, Sohn des ersten Lehrers an der israelitischen Volksschule in
Buchau und erhielt von seinen Eltern eine streng jüdische Erziehung;
besonders war die erst kürzlich verstorbene Mutter ein echt frommes,
jüdisches Herz und von väterlicher Seite wurde er in den Grundsätzen
des Judentums unterrichtet und erzogen. Herr Dr. Eduard Löwenthal ist
nicht getauft." |
Über Lehrer Salomon Löwenstein: Lehrer in Pflaumloch
von 1827 bis 1867:
Auszeichnung des Lehrers Salomon Löwenstein nach
vierzigjährigem Dienst (1867)
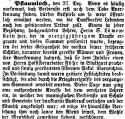 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Januar 1867: "Pflaumloch,
den 27. Dezember 1867. Wenn es häufig vorkommt, dass Verdienste erst nach
dem Tode Anerkennung finden, dürfen Beispiele umso mehr öffentlich erwähnt
werden, wo die Dankbarkeit Lebenden noch den gebührenden Tribut zollt.
Einem in jeder Beziehung hoch geachteten Lehrer, Herrn S. Löwenstein
hier, der in vierzigjährigem Dienste ergraute und diesen Sommer
pensioniert wurde, bezeugten bei dieser Gelegenheit die meisten seiner früheren
Schüler, darunter bereits gereifte Männer und Frauen, ihre Anerkennung
dadurch, dass sie dem Jubilar einen von Herrn Hofsilberarbeiter Föhr in
Stuttgart prachtvoll und sinnig gearbeiteten silbernen Pokal überreichten.
In Verbindung damit waren größere Festlichkeiten beabsichtigt, die aber
durch die Kriegsereignisse des vergangenen Sommers vereitelt wurden.
Dieser Tage nun ging eine entsprechende Adresse bei dem verehrten Lehrer
ein, in welcher der mannigfachen Verdienste um Schule und Gemeinde der
dankbarste Ausdruck verliehen und der Wunsch angeknüpft war: es möge die
himmlische Vorsehung ihm noch lange den Abend seines, dem Wohle der
Menschheit geweihten Lebens, verschönern." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Januar 1867: "Pflaumloch,
den 27. Dezember 1867. Wenn es häufig vorkommt, dass Verdienste erst nach
dem Tode Anerkennung finden, dürfen Beispiele umso mehr öffentlich erwähnt
werden, wo die Dankbarkeit Lebenden noch den gebührenden Tribut zollt.
Einem in jeder Beziehung hoch geachteten Lehrer, Herrn S. Löwenstein
hier, der in vierzigjährigem Dienste ergraute und diesen Sommer
pensioniert wurde, bezeugten bei dieser Gelegenheit die meisten seiner früheren
Schüler, darunter bereits gereifte Männer und Frauen, ihre Anerkennung
dadurch, dass sie dem Jubilar einen von Herrn Hofsilberarbeiter Föhr in
Stuttgart prachtvoll und sinnig gearbeiteten silbernen Pokal überreichten.
In Verbindung damit waren größere Festlichkeiten beabsichtigt, die aber
durch die Kriegsereignisse des vergangenen Sommers vereitelt wurden.
Dieser Tage nun ging eine entsprechende Adresse bei dem verehrten Lehrer
ein, in welcher der mannigfachen Verdienste um Schule und Gemeinde der
dankbarste Ausdruck verliehen und der Wunsch angeknüpft war: es möge die
himmlische Vorsehung ihm noch lange den Abend seines, dem Wohle der
Menschheit geweihten Lebens, verschönern." |
Schreiben des Lehrers Salomon
Löwenstein als Dank für die Auszeichnung an seine Schüler (1867)
 Artikel
in der Zeitschrift "Chananja" vom 15. März 1867: "(hebräisch und
deutsch: 'Den Kelch des Heils erheb ich! Artikel
in der Zeitschrift "Chananja" vom 15. März 1867: "(hebräisch und
deutsch: 'Den Kelch des Heils erheb ich!
Von Alexander Elsässer.
2. Eine ähnliche Auszeichnung ist dem Lehrer und Vorsänger Salomon Löwenstein
in Pflaumloch zuteil geworden und wir teilen ohne Kommentar das
Dankschreiben des würdigen emeritierten Lehrers an seine Schüler mit,
der für eine Ehrengabe dankt, die Empfänger,
wie Geber rühmlich auszeichnet. Unter den Gebern befinden sich vier in
Amt und Ehren stehende Rechtsgelehrte, ein gefeierter Arzt und viele
Notabilitäten des Finanz- und Gewerbestandes.
P.P. Schon vor mehreren Monaten wurde mir durch meinen ehrenwerten Freund,
Herrn Oberkirchenvorsteher Elias Pflaum in Stuttgart, mit einem schätzbaren
Schreiben namens einer großen Anzahl meiner früheren Schüler und Schülerinnen
ein höchst wertvoller und kunstreich gearbeiteter Pokal übersandt, den
mir dieselben, nachdem ich nach mehr als 40jähriger Amtstätigkeit in
Pension trat, als Zeichen ihrer Liebe und Hochachtung gewidmet.
Sie haben in diesem Schreiben bemerkt, dass meine lieben Schüler die
Absicht hatten, sich hier persönlich einzufinden, was aber die
Kriegsereignisse vereitelten und dass eine Adresse nachfolgen werde. Diese
Adresse wurde mir nun vor einigen Tagen durch das bestellte Komitee, die
Herren S. Ellinger, Alexander Pflaum und Rechtskonsulent Nördlinger in
Stuttgart, mit dem Verzeichnisse aller meiner lieben Schüler, die sich an
diesem schönen Werke der Liebe beteiligt haben, übersandt. Schon der
Inhalt dieser Adresse, die auch äußerlich ein Meisterstück der
Kalligraphie ist, wäre mir, ohne den so wertvollen Pokal, eine Quelle höchster
Freude, eine Labung meiner alten Lebenstage. Nicht sowohl das edle Metall
und die überaus prachtvolle Arbeit, die mit dem Bilde unseres
unsterblichen Moses Mendelssohn geziert ist, als vielmehr die edle
Gesinnung und die Liebe, die sich in allen dem ausspricht, sowie der
Beweis, dass Sie den Wert der Herzens- und Geistesbildung, zu der ich die
Grundsteine gelegt, so hoch zu schätzen wissen, das ist's was mir
dieses Andenken so unschätzbar wert und lieb macht. Jene Tage, in welchen
Sie als munteres, blühendes Kind unter der Schar so vieler Schüler sich
bei mir einfanden und des Unterrichts mit Aufmerksamkeit und Liebe
lauschten, wo ich mich so oft der Fortschritte freute, die ich gewahrte,
jene schöne Zeit, vergegenwärtige ich mir oft im Geiste und labe mich an
der Erinnerung. Eine persönliche Begrüßung der würdigen Männer und
ehrsamen Frauen, die ich mit Stolz meine Schüler nenne, hätte mir zur höchsten
Freude gereicht.
Sie haben den kindlichen Sinn sich bewahrt und indem Sie durch denselben
mich, Ihren Jugendlehrer, so hoch ehren, haben Sie zugleich Ihrem Herzen
das schönste Ehrendenkmal gesetzt. Nehmen Sie meinen tief gefühlten Dank
in Liebe an und seien Sie versichert, dass nie aufhören wir Sie zu lieben
und hochzuschätzen und für Ihr und der lieben Ihrigen Wohlergehen Gott
anzuflehen.
Ihr treuer Freund und Lehrer S. Löwenstein, Musterlehrer. Pflaumloch, im
Jänner 1867." |
Über
den Lehrer Nathanael Forchheimer (1867 bis 1875 Lehrer in Pflaumloch;, geb. 1842
in Niederstetten, gest. 1931 in Heilbronn)
Anmerkung: Lehrer Nathan(ael)
Forchheimer (geb. 10. Oktober 1842 in Niederstetten)
war nach seinen Studien im Lehrerseminar Esslingen
(1860-1862) zunächst unständiger Lehrer in Laudenbach,
Pflaumloch, Kappel
(1867), danach ständiger Lehrer in Pflaumloch
(1867-1875) und in Ernsbach (1875-1896). 1896 wechselte er nach Buttenhausen,
wo er bis 1908 blieb. 1914 lebte er in St.
Ludwig/Elsass, zuletzt in Heilbronn, wo
er am 8. Dezember 1931 starb und im dortigen jüdischen
Friedhof beigesetzt wurde.
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1927: "Ernsbach.
Am 10. Oktober vollendet das älteste Mitglied der israelitischen
Lehrerschaft Württembergs, Lehrer a.D. Forchheimer in Heilbronn, wo er
bei seinen Kindern seinen Ruhestand verbringt, das 85.
Lebensjahr.
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 1. Oktober 1927: "Ernsbach.
Am 10. Oktober vollendet das älteste Mitglied der israelitischen
Lehrerschaft Württembergs, Lehrer a.D. Forchheimer in Heilbronn, wo er
bei seinen Kindern seinen Ruhestand verbringt, das 85.
Lebensjahr.
Lehrer Forchheimer ist 1842 in Niederstetten geboren und hat seine
Ausbildung im Lehrerseminar in Esslingen
erhalten. Nach unständiger Verwendung in den Gemeinden Laudenbach,
Pflaumloch und Kappel bei Buchau
kehrte Forchheimer in der Mitte der 60er-Jahre wieder als ständiger
Lehrer nach Pflaumloch zurück, wo er über 1 Jahrzehnte wirkte. 21
Jahre, von 1875 bis 1896 war er dann in Ernsbach
tätig und ein weiteres Jahrzehnt in Buttenhausen.
Im Jahre 1907 zwang ein schweres Augenleiden den sonst noch rüstigen und
arbeitsfrohen Mann in den Ruhestand zu treten.
Forchheimer war Lehrer mit allen Fasern seines Herzens; die Schule war ihm
das Höchste, und mancher, der aus seiner Schule hervorgegangen ist, blieb
mit dem einstigen Lehrer auch späterhin in Treue verbunden. Er ist noch
der einzige Überlebende unter den Lehrern, die einst im Jahre 1862 den
'Verein israelitischer Lehrer und Vorsänger in Württemberg' begründet
hatten. Äußerlich ist der so pflichttreue bescheidene Mann wenig
in die Öffentlichkeit getreten; umso tiefer und wertvoller war sein
stilles Wirken in seinen Gemeinden. Die Oberschulbehörde hat seine
Verdienste des öfteren besonders anerkannt.
Der Verein israelitischer Lehrer in Württemberg und mit ihm gewiss auch
alle, die Forchheimer als Mensch und Lehrer kennen, freuen sich mit dem
Hochbetagten und wünschen ihm noch eine lange Reihe glücklicher
Jahre.
A. Adelsheimer, Schriftführer des Vereins israelitischer Lehrer
Württembergs." |
| |
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1927:"Ernsbach.
Berichtigung. In dem Bericht des Vereins israelitischer Lehrer in der
letzten Nummer der Gemeindezeitung muss es anstatt Horchheimer, Lehrer
a.D. Forchheimer heißen". Anmerkung: wurde in
der Abschrift oben berücksichtigt.
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 16. Oktober 1927:"Ernsbach.
Berichtigung. In dem Bericht des Vereins israelitischer Lehrer in der
letzten Nummer der Gemeindezeitung muss es anstatt Horchheimer, Lehrer
a.D. Forchheimer heißen". Anmerkung: wurde in
der Abschrift oben berücksichtigt. |
Der jüdische Lehrer aus Unterdeufstetten wechselt nach Pflaumloch (1876)
 Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:
"Unterdeufstetten. Oberamt Crailsheim, Württemberg, den 26.
März 1876. Da unser bisheriger Lehrer nach der größeren israelitischen
Gemeinde Pflaumloch berufen worden, so ist die hiesige Stelle als Religionslehrer,
Kantor und Schächter sofort wieder zu besetzen. Fester Gehalt 550
Mark nebst üblichen Emolumenten, freier Wohnung und Heizung. Das
Schächteramt wird extra bezahlt und dürfte mehr als 100 Mark
abwerfen. Anzeige
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:
"Unterdeufstetten. Oberamt Crailsheim, Württemberg, den 26.
März 1876. Da unser bisheriger Lehrer nach der größeren israelitischen
Gemeinde Pflaumloch berufen worden, so ist die hiesige Stelle als Religionslehrer,
Kantor und Schächter sofort wieder zu besetzen. Fester Gehalt 550
Mark nebst üblichen Emolumenten, freier Wohnung und Heizung. Das
Schächteramt wird extra bezahlt und dürfte mehr als 100 Mark
abwerfen.
Da nur einige Schüler vorhanden sind, so könnte in der eine Stunde von
hier entfernten bayerischen Stadt Dinkelsbühl
durch Privat-Religionsunterricht noch ein schöner Nebenverdienst erzielt
werden. Geeignete Bewerber, welche sich über ihre Fähigkeiten und
religiös-sittliches Betragen auszuweisen vermögen und bei unserem
Bezirksrabbiner in Religionsfächern und Schächterfunktion einer Prüfung
unterwerfen können, haben Aussicht, wie schon mehrere Vorgänger, eine
bleibende Stätte und ihr Glück in Württemberg zu finden. Hierauf
Reflektierende wollen sich unter Vorlegung ihrer Zeugnisse direkt wenden
an den
israelitischen Vorstand Ballenberger." |
40-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer Bernhard Klein in Gießen (1928, Lehrer in
Pflaumloch von 1883 bis 1888)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
März 1928: "Gießen,
5. März (1928). Am 10. März sind es 40 Jahre, dass Herr Bernhard Klein
als Lehrer, Kantor und Schochet in unserer Gemeinde wirkt. Klein ist ein
Lehrersohn auf Veitshöchheim,
besuchte die Präpanderie in Höchberg
und das Seminar in Würzburg. 1883 fand
er seine erste Anstellung in Pflaumloch, Württemberg. 1888 kam er
als Kultusbeamter an unsere Religionsgesellschaft, die 1923 die Rechte
einer öffentlichen Körperschaft erhielt. In dieser langen Zeit bewährte
sich der Jubilar als ein pflichttreuer Beamter, der die Jugend zu wahrer Treue
(sc. zu ihrer Religion) begeisterte und durch sein klangvolles Organ den
Gottesdienst verherrlichte. Möge ihm ein recht schöner Lebensabend
beschieden sein." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8.
März 1928: "Gießen,
5. März (1928). Am 10. März sind es 40 Jahre, dass Herr Bernhard Klein
als Lehrer, Kantor und Schochet in unserer Gemeinde wirkt. Klein ist ein
Lehrersohn auf Veitshöchheim,
besuchte die Präpanderie in Höchberg
und das Seminar in Würzburg. 1883 fand
er seine erste Anstellung in Pflaumloch, Württemberg. 1888 kam er
als Kultusbeamter an unsere Religionsgesellschaft, die 1923 die Rechte
einer öffentlichen Körperschaft erhielt. In dieser langen Zeit bewährte
sich der Jubilar als ein pflichttreuer Beamter, der die Jugend zu wahrer Treue
(sc. zu ihrer Religion) begeisterte und durch sein klangvolles Organ den
Gottesdienst verherrlichte. Möge ihm ein recht schöner Lebensabend
beschieden sein." |
Über Lehrer Bernhard Klein
(Bericht von 1932)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1932: "Gießen, 30. Oktober
(1932). Nach 49jähriger Dienstzeit, 5 Jahre in Pflaumloch in Württemberg
(d.h. 1883-1888) und 44 Jahre in der hiesigen israelitischen
Religionsgesellschaft, trat Herr Lehrer Bernhard Klein vor einigen Monaten
in den wohlverdienten Ruhestand. Am vergangenen Samstag fand in der
hiesigen Synagoge ein Abschiedsgottesdienst mit Festpredigt statt. Herr
Provinzialrabbiner Dr. Hirschfeld schilderte die Tätigkeit unseres
Kultusbeamten, der Lehrer, Kantor und Schochet war. Mit Liebe, Sorgfalt
und pädagogischem Geschick brachte Herr Klein den Kindern die religiösen
Lehren und Pflichten des wahren Judentums bei. In Andacht und Ehrfurcht
lauschten die Synagogenbesucher seinen erbauenden und klangvollen
kantoralen Leistungen. Auf dem Gebiete des Schächtens war er ein Meister,
der seinesgleichen sucht. Sowohl von Seiten des Rabbinats als auch von
Seiten hoher christlicher Beamtenstellen fanden hier seine Leistungen
reiche Anerkennung. Für all das dankte ihm Dr. Hirschfeld im Namen der
Gemeinde und wünschte ihm einen ruhigen, angenehmen und langen
Lebensabend in unserer Mitte. Sein Nachfolger, Herr Lehrer Erich Neumann
aus Kassel, wie Herr Lehrer Klein, ein Schüler des Würzburger Seminars,
trat vor den hohen Feiertagen die vakante Stelle an." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1932: "Gießen, 30. Oktober
(1932). Nach 49jähriger Dienstzeit, 5 Jahre in Pflaumloch in Württemberg
(d.h. 1883-1888) und 44 Jahre in der hiesigen israelitischen
Religionsgesellschaft, trat Herr Lehrer Bernhard Klein vor einigen Monaten
in den wohlverdienten Ruhestand. Am vergangenen Samstag fand in der
hiesigen Synagoge ein Abschiedsgottesdienst mit Festpredigt statt. Herr
Provinzialrabbiner Dr. Hirschfeld schilderte die Tätigkeit unseres
Kultusbeamten, der Lehrer, Kantor und Schochet war. Mit Liebe, Sorgfalt
und pädagogischem Geschick brachte Herr Klein den Kindern die religiösen
Lehren und Pflichten des wahren Judentums bei. In Andacht und Ehrfurcht
lauschten die Synagogenbesucher seinen erbauenden und klangvollen
kantoralen Leistungen. Auf dem Gebiete des Schächtens war er ein Meister,
der seinesgleichen sucht. Sowohl von Seiten des Rabbinats als auch von
Seiten hoher christlicher Beamtenstellen fanden hier seine Leistungen
reiche Anerkennung. Für all das dankte ihm Dr. Hirschfeld im Namen der
Gemeinde und wünschte ihm einen ruhigen, angenehmen und langen
Lebensabend in unserer Mitte. Sein Nachfolger, Herr Lehrer Erich Neumann
aus Kassel, wie Herr Lehrer Klein, ein Schüler des Würzburger Seminars,
trat vor den hohen Feiertagen die vakante Stelle an." |
Über einzelne
Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde
("Kirchenvorsteher")
Über den Vorsteher Elias Pflaum - Anerkennung für Elias Pflaum (1843)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Aus dem
Jagstkreise im Königreich Württemberg, im März 1843. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Aus dem
Jagstkreise im Königreich Württemberg, im März 1843.
Unter dem 6. Februar dieses Jahres ist dem Kirchenvorsteher Elias Pflaum
zu Pflaumloch, wegen seiner Verdienste um die dortige Gemeinde, von Seite
der Königlichen Israelitischen Oberkirchenbehörde zu Stuttgart 'eine
Anerkennung seiner löblichen und gemeinnützigen Bemühungen und
anerkennenswerten Bestrebungen für wohltätige Anstalten, für
Verbesserungen aller Art, wie für bürgerliche und kirchliche
Fortschritte der israelitischen Glaubensgenossen in seinem Kreise etc.'
geworden.
Diese Veröffentlichung diene sowohl der Gemeinde Pflaumloch zum Sporn,
fortzuschreiten auf der von ihr betretenen Bahn der Eintracht und Ordnung,
als auch zur Aufmunterung für andere Gemeinden und Kirchenvorsteher, und
damit sie recht ans Licht stelle die Wohltat, welche die Höchste Königlich
Württembergische Staatsregierung den Staatsangehörigen Israelitischer
Konfession mit der Kreierung der alles rein israelitische Interesse überwachsenden
Königlichen Israelitischen Oberkirchenbehörde erwiesen hat. S." |
Weitere Auszeichnung für den Gemeindevorsteher Elias Pflaum (1847)
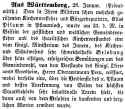 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. März 1847: "Aus Württemberg,
28. Januar (1847). Dem in Ihren Blättern schon mehrfach gerühmten
Kirchenvorsteher und Bürgerdeputierten, Elias Pflaum in Pflaumloch, wurde
am 23. dieses Monats in Beisein der geistlichen und weltlichen
Gemeindevorsteher und des israelitischen Kirchenvorstandes eine vom königlichen
Ministerium des Innern, des Kirchen- und Schulwesens sehr schmeichelhafte
Belobung über seine eifrigen, erfolgreichen Bemühungen um das
Gemeindewohl, von dem Vorstande des königlichen Oberamts Neresheim, Herrn
Oberamtmann Peru, eröffnet, wobei derselbe eine, über die Verdienste des
Herrn Pflaum und dessen Anerkennung von Seiten der höchsten Staatsbehörde
sehr inhaltsvolle Anrede hielt, die dann auch von dem Belobten in
dankenden und herzlichen Worten erwidert wurde." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. März 1847: "Aus Württemberg,
28. Januar (1847). Dem in Ihren Blättern schon mehrfach gerühmten
Kirchenvorsteher und Bürgerdeputierten, Elias Pflaum in Pflaumloch, wurde
am 23. dieses Monats in Beisein der geistlichen und weltlichen
Gemeindevorsteher und des israelitischen Kirchenvorstandes eine vom königlichen
Ministerium des Innern, des Kirchen- und Schulwesens sehr schmeichelhafte
Belobung über seine eifrigen, erfolgreichen Bemühungen um das
Gemeindewohl, von dem Vorstande des königlichen Oberamts Neresheim, Herrn
Oberamtmann Peru, eröffnet, wobei derselbe eine, über die Verdienste des
Herrn Pflaum und dessen Anerkennung von Seiten der höchsten Staatsbehörde
sehr inhaltsvolle Anrede hielt, die dann auch von dem Belobten in
dankenden und herzlichen Worten erwidert wurde." |
Auszeichnung für den Gemeindevorsteher Elias
Pflaum (1847)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. März 1847: "In anderen
Gegenden des Landes, wo die Rabbinen aus Grundsatz oder Gewohnheit stabil
bleiben, wirken Lehrer und Vorsteher vereint für Hebung der jüdischen
Kirche und Schule, für Patriotismus und Religion. So ist Pflaumloch im
Ries eine Gemeinde, die in jeder Beziehung alles Lob verdient, in der das
Kirchenvorsteheramt viel Schönes schon erzielt hat. Diese Gemeinde hat
auch in ihrem Kirchenvorsteher Elias Pflaum die schönste Anerkennung von
Seiten des königlichen Ministeriums des Innern gefunden. Dasselbe
erteilte an die königliche israelitische Oberkirchenbehörde folgenden
hohen Erlass: 'Auf den Bericht des königlichen Oberamts vom 20. Februar
dieses Jahres, betreffend die Verdienste des israelitischen
Kirchenvorstehers Elias Pflaum in Pflaumloch um die dortige Gemeinde hat
man höhern Orts Vortrag erstattet und wird hiermit der Auftrag erteilt,
dem israelitischen Kirchenvorsteher Elias Pflaum in Pflaumloch das
Wohlgefallen des Ministeriums an seinen eifrigen und erfolgreichen Bemühungen
um das Wohl der Gemeinde und zunächst der israelitischen Kirchengemeinde
zu erkennen zu geben. Auch soll aus höchstem Auftrag hiervon nicht nur
dem israelitischen Kirchenvorsteheramt Pflaumloch, sondern auch durch das
königliche Oberamt Neresheim den geistlichen und weltlichen Behörden der
Gesamtgemeinden Kenntnis gegeben werden. Das königliche Oberamt wolle
hiernach das Geeignete erlassen. Stuttgart, den 15. Oktober 1846.' Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. März 1847: "In anderen
Gegenden des Landes, wo die Rabbinen aus Grundsatz oder Gewohnheit stabil
bleiben, wirken Lehrer und Vorsteher vereint für Hebung der jüdischen
Kirche und Schule, für Patriotismus und Religion. So ist Pflaumloch im
Ries eine Gemeinde, die in jeder Beziehung alles Lob verdient, in der das
Kirchenvorsteheramt viel Schönes schon erzielt hat. Diese Gemeinde hat
auch in ihrem Kirchenvorsteher Elias Pflaum die schönste Anerkennung von
Seiten des königlichen Ministeriums des Innern gefunden. Dasselbe
erteilte an die königliche israelitische Oberkirchenbehörde folgenden
hohen Erlass: 'Auf den Bericht des königlichen Oberamts vom 20. Februar
dieses Jahres, betreffend die Verdienste des israelitischen
Kirchenvorstehers Elias Pflaum in Pflaumloch um die dortige Gemeinde hat
man höhern Orts Vortrag erstattet und wird hiermit der Auftrag erteilt,
dem israelitischen Kirchenvorsteher Elias Pflaum in Pflaumloch das
Wohlgefallen des Ministeriums an seinen eifrigen und erfolgreichen Bemühungen
um das Wohl der Gemeinde und zunächst der israelitischen Kirchengemeinde
zu erkennen zu geben. Auch soll aus höchstem Auftrag hiervon nicht nur
dem israelitischen Kirchenvorsteheramt Pflaumloch, sondern auch durch das
königliche Oberamt Neresheim den geistlichen und weltlichen Behörden der
Gesamtgemeinden Kenntnis gegeben werden. Das königliche Oberamt wolle
hiernach das Geeignete erlassen. Stuttgart, den 15. Oktober 1846.'
Am Sabbat, den 23. Januar 1847 eröffnete Herr Oberamtmann Prer diesen
Erlass den Behörden der Gemeinde Pflaumloch in Anwesenheit des
evangelischen und katholischen Geistlichen – der Rabbiner war abgehalten
dabei zu erscheinen -. Der würdige Oberamtmann setzte in einem längeren
Vortrage die Verdienste des Belobten auseinander und setzt, infolge höchsten
Auftrags der Belobung noch zu, dass eine spätere weitere öffentliche
Auszeichnung nach Umständen und auf weitere Anregung durch die Staats-
und Kirchenbehörden in Aussicht gestellt wurde. Besonders ermunterte er
den Belobten, in seinem edeln Wirken fortzufahren, indem dieser Akt ein
Beweis sei, wie sehr die obersten Behörden bereitwillig sind, aller Einflüsterungen
ungeachtet die wahren Verdienste herauszufinden und anzuerkennen. Darauf
dankte Elias Pflaum in einem längeren Vortrag und Lehrer Löwenstein
sprach im Namen der ganzen Gemeinde, dass die Belobung des Pflaum eine
wohlverdiente sei, dass derselbe besonders auch das Wohl der Schule fördern
helfe, es möge der Belobte auch weiter in seinem Wirken fortfahren, damit
die vorbehaltene weitere Anerkennung recht bald folge.
Anfang dieses Monats wurde auch der israelitische Kirchenpfleger David
Friedmann in Pflaumloch durch einen hohen Erlass wegen der treuen und
ausgezeichneten Führung seines Amtes belobt."
|
| |
 Artikel
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Aus
dem Jagstkreise im Königreich Württemberg, im März 1843. Artikel
in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Aus
dem Jagstkreise im Königreich Württemberg, im März 1843.
Unter dem 6. Februar dieses Jahres ist dem Kirchenvorsteher Elias Pflaum zu
Pflaumloch, wegen seiner Verdienste um die dortige Gemeinde, von Seite der
königlichen israelitischen Oberkirchenbehörde zu Stuttgart 'eine Anerkennung
seiner löblichen und gemeinnützigen Bemühungen und anerkennenswerten
Bestrebungen für wohltätige Anstalten, für Verbesserungen aller Art, wie für
bürgerliche und kirchliche Fortschritte der israelitischen Glaubensgenossen
in seinem Kreise etc.' geworden.
Diese Veröffentlichung diene sowohl der Gemeinde Pflaumloch zum Sporn, um
fortzuschreiten auf der von ihr betretenen Bahn der Eintracht und
Ordnung, als auch zur Aufmunterung für andere Gemeinden und
Kirchenvorsteher, und damit sie recht ans Licht stelle die Wohltat, welche
die Höchste Königliche Württembergische Staatsregierung den
Staatsangehörigen Israelitischer Konfession mit der Kreierung der alles rein
israelitische Interesse überwachenden Königlichen Israelitischen
Oberkirchenbehörde erwiesen hat. Sch." |
Zum Tod des Vorstehers Alexander Stern (1891)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1891: "Pflaumloch (für
Pflaumbach) bei Nördlingen. Die hiesige Gemeinde, einst so blühend und
bedeutend – hier existierten noch vor 40 Jahren viele Personen, bei denen Tora und
Größe vereint waren – ist leider nun so reduziert, dass die Zahl
der Mitglieder kaum der Zehnerminjan
erreicht und die Beitragenden an den Fingern einer Hand gezählt werden können
(Anmerkung: wie Mönchsdeggingen und Ederheim in Bayern, wo bis vor Kurzem
Gemeinden existierten). – Wie schade ist es um die prachtvolle und geräumige,
doch leer stehend Synagoge – wie
verschwindet der Glanz! Wer hätte bei ihrer Erbauung vor 40 Jahren
gedacht, dass eine Zeit kommen könnte, wo man die religiösen
Institutionen nicht mehr benützen wird? Und doch ist dieser traurige
Moment sehr nahe gerückt und bald kann man kaum mehr von unserer
Filialgemeinde sagen: und noch kommt die Zehnzahl, zumal vorige Woche nach langem,
schweren Leiden der Vorstand unserer Gemeinde Herr Alexander Stern im 67.
Lebensjahr verschied. Nicht bloß die trauernde Familie empfindet diesen
Schicksalsschlag, sondern ebenso die kleine Gemeinde. Der Verblichene war
ein Biedermann in des Wortes strengster Bedeutung, und wie sehr er sich
der allgemeinen Wertschätzung erfreute, zeugte die große Beteiligung
beim Leichenbegängnisse von Seiten der Nachbargemeinden Oberdorf und
Nördlingen.
Herr Bezirksrabbiner Dr. Grün kam zu Ehren
des Toten und schilderte in kurzen markigen Worten die Tugenden des
Heimgegangenen, die er den Hinterbliebenen als leuchtendes Vorbild zur
Nachahmung empfahl, ebenso richtete er an die Anwesenden die dringende
Mahnung zur Versöhnlichkeit und Friedfertigkeit. – Vorsänger Horwitz
hielt darauf die Trauerrede, in welcher er das Lebensbild des Verstorbenen
zeichnete und besonders dessen religiösen Sinn, die Opferwilligkeit gegen
seine Angehörigen und seine Pflichttreue als Vorsteher hervorhob. Möge
der Allmächtige die trauernden Hinterbliebenen stärken und aufrichten. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. März 1891: "Pflaumloch (für
Pflaumbach) bei Nördlingen. Die hiesige Gemeinde, einst so blühend und
bedeutend – hier existierten noch vor 40 Jahren viele Personen, bei denen Tora und
Größe vereint waren – ist leider nun so reduziert, dass die Zahl
der Mitglieder kaum der Zehnerminjan
erreicht und die Beitragenden an den Fingern einer Hand gezählt werden können
(Anmerkung: wie Mönchsdeggingen und Ederheim in Bayern, wo bis vor Kurzem
Gemeinden existierten). – Wie schade ist es um die prachtvolle und geräumige,
doch leer stehend Synagoge – wie
verschwindet der Glanz! Wer hätte bei ihrer Erbauung vor 40 Jahren
gedacht, dass eine Zeit kommen könnte, wo man die religiösen
Institutionen nicht mehr benützen wird? Und doch ist dieser traurige
Moment sehr nahe gerückt und bald kann man kaum mehr von unserer
Filialgemeinde sagen: und noch kommt die Zehnzahl, zumal vorige Woche nach langem,
schweren Leiden der Vorstand unserer Gemeinde Herr Alexander Stern im 67.
Lebensjahr verschied. Nicht bloß die trauernde Familie empfindet diesen
Schicksalsschlag, sondern ebenso die kleine Gemeinde. Der Verblichene war
ein Biedermann in des Wortes strengster Bedeutung, und wie sehr er sich
der allgemeinen Wertschätzung erfreute, zeugte die große Beteiligung
beim Leichenbegängnisse von Seiten der Nachbargemeinden Oberdorf und
Nördlingen.
Herr Bezirksrabbiner Dr. Grün kam zu Ehren
des Toten und schilderte in kurzen markigen Worten die Tugenden des
Heimgegangenen, die er den Hinterbliebenen als leuchtendes Vorbild zur
Nachahmung empfahl, ebenso richtete er an die Anwesenden die dringende
Mahnung zur Versöhnlichkeit und Friedfertigkeit. – Vorsänger Horwitz
hielt darauf die Trauerrede, in welcher er das Lebensbild des Verstorbenen
zeichnete und besonders dessen religiösen Sinn, die Opferwilligkeit gegen
seine Angehörigen und seine Pflichttreue als Vorsteher hervorhob. Möge
der Allmächtige die trauernden Hinterbliebenen stärken und aufrichten. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |
Über den
Gemeindepfleger Markus Ettlinger
Markus Ettlinger wurde zum "Bürgermeister"
ernannt
(1846)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "Württemberg.
Marcus Ettlinger aus Pflaumloch in Württemberg ist zum
Bürgermeister mit Stimmenmehrheit gewählt worden. Ein Zeugnis dafür,
dass auch unter dem Landvolke die Vorurteile gegen Juden allmählich
schwinden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Orient" vom 17. Dezember 1845: "Württemberg.
Marcus Ettlinger aus Pflaumloch in Württemberg ist zum
Bürgermeister mit Stimmenmehrheit gewählt worden. Ein Zeugnis dafür,
dass auch unter dem Landvolke die Vorurteile gegen Juden allmählich
schwinden." |
|
|
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Januar 1846: "Pflaumloch,
26. Dezember. (Württemberg.) (Privatmitteilung). Die hiesige Stadtkommune
hat den Israeliten Markus Ettlinger zu ihrem Bürgermeister erwählt. Es
ist dies seit Erlassung der die Juden zu Gemeindeämtern für wahlfähig
erklärenden Gesetze von 1828 und respektive 1833 in unserm Lande der
erste derartige Fall, was einerseits das Schwinden des Vorurteils gegen
die Juden auch unter unseren Landbewohnern, andererseits aber auch den
Ungrund der hier und da laut gewordenen Besorgnis beweist, als ob infolge
der gesetzlichen Aufhebung der bürgerlichen Unfähigkeit der Juden bald
alle Gemeindeämter von Juden besetzt sein würden. – Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Januar 1846: "Pflaumloch,
26. Dezember. (Württemberg.) (Privatmitteilung). Die hiesige Stadtkommune
hat den Israeliten Markus Ettlinger zu ihrem Bürgermeister erwählt. Es
ist dies seit Erlassung der die Juden zu Gemeindeämtern für wahlfähig
erklärenden Gesetze von 1828 und respektive 1833 in unserm Lande der
erste derartige Fall, was einerseits das Schwinden des Vorurteils gegen
die Juden auch unter unseren Landbewohnern, andererseits aber auch den
Ungrund der hier und da laut gewordenen Besorgnis beweist, als ob infolge
der gesetzlichen Aufhebung der bürgerlichen Unfähigkeit der Juden bald
alle Gemeindeämter von Juden besetzt sein würden. –
Hiergegen
bemerkt das Frankfurter Journal, dass es nicht der erste Fall sei, denn im
Dorfe Unterschwandorf, Oberamts Nagold, war mehrere Jahre lang bis an
seinen Tod ein Israelit, namens Dessauer, Schultheiß einer Bevölkerung,
die fast zu gleichen Teilen aus Protestanten, Katholiken und Juden
bestand, und die dort recht einträchtlich beisammen wohnten." |
Korrektur der Meldung aus Pflaumloch - den
"Bürgermeister" betreffend (1846)
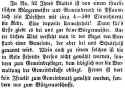 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. September 1846: "In No.
32 Ihres Blattes ist von einem israelitischen Bürgermeister und
Gemeinderat in Pflaumloch (ein Dörfchen von circa 4-500 Einwohnern) die
Rede. Eine doppelte Unwahrheit! Denn fürs Erste gibt es bei uns gar keine
Bürgermeister. Unter diesem Titel versteht man in der Regel den Vorstand
einer Gemeinde, der aber bei uns Schultheiß genannt wird. Allein auch zu
einem solchen ist die in Rede stehende Person nicht gewählt worden,
sondern zum Gemeindepfleger, dem lediglich nur die Verwaltung der
Gemeindekasse obliegt. Ferner ist dort kein Israelit zum Gemeinderat gewählt
worden, sondern nur zum Bürgerausschusse." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. September 1846: "In No.
32 Ihres Blattes ist von einem israelitischen Bürgermeister und
Gemeinderat in Pflaumloch (ein Dörfchen von circa 4-500 Einwohnern) die
Rede. Eine doppelte Unwahrheit! Denn fürs Erste gibt es bei uns gar keine
Bürgermeister. Unter diesem Titel versteht man in der Regel den Vorstand
einer Gemeinde, der aber bei uns Schultheiß genannt wird. Allein auch zu
einem solchen ist die in Rede stehende Person nicht gewählt worden,
sondern zum Gemeindepfleger, dem lediglich nur die Verwaltung der
Gemeindekasse obliegt. Ferner ist dort kein Israelit zum Gemeinderat gewählt
worden, sondern nur zum Bürgerausschusse." |
Zur vorbildlichen Ortsreinlichkeit und den Baumsatz in Pflaumloch unter dem
Gemeindepfleger Markus Ellinger (1846)
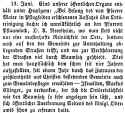 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juli 1846: "13. Juni.
Eins unserer öffentlichen Organe enthält unter Heutigem: 'Bei Lesung
des von Pfarrer Maier in Pflugfelden erschienenen Aufsatzes über
Ortsreinigung dachte ich unwillkürlich an den Pfarrort Pflaumloch,
Oberamt Neresheim, wo man stets nicht nur eine musterhafte Reinlichkeit im
Orte, sondern auch auf den der Gemeinde zur Unterhaltung obliegenden Straußen
trifft, und wo zur Verschönerung der Straßen viel durch Baumsatz
geschieht. Dies hat man hauptsächlich dem schon seit vier Jahren
aufgestellten, seit einem Jahr durch das Zutrauen der größtenteils aus
Christen bestehenden Gemeinde auch zum Gemeindepfleger erwählten –
Israeliten, Markus Ellinger, zu verdanken, der sich die Ortsreinlichkeit
wie den Baumsatz so sehr angelegen sein lässt, und sich öffentlicher
Anerkennung seitens des königlichen Oberamts schon zu erfreuen hatte." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Juli 1846: "13. Juni.
Eins unserer öffentlichen Organe enthält unter Heutigem: 'Bei Lesung
des von Pfarrer Maier in Pflugfelden erschienenen Aufsatzes über
Ortsreinigung dachte ich unwillkürlich an den Pfarrort Pflaumloch,
Oberamt Neresheim, wo man stets nicht nur eine musterhafte Reinlichkeit im
Orte, sondern auch auf den der Gemeinde zur Unterhaltung obliegenden Straußen
trifft, und wo zur Verschönerung der Straßen viel durch Baumsatz
geschieht. Dies hat man hauptsächlich dem schon seit vier Jahren
aufgestellten, seit einem Jahr durch das Zutrauen der größtenteils aus
Christen bestehenden Gemeinde auch zum Gemeindepfleger erwählten –
Israeliten, Markus Ellinger, zu verdanken, der sich die Ortsreinlichkeit
wie den Baumsatz so sehr angelegen sein lässt, und sich öffentlicher
Anerkennung seitens des königlichen Oberamts schon zu erfreuen hatte." |
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Einweihung
des Gefallenendenkmals für die Gefallenen der Gemeinde (1928)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. September 1928: "Pflaumloch. Am 29. Juli fand hier die feierliche Einweihung des
Gefallenendenkmals für die Krieger der protestantischen und katholischen Konfession statt. Der Boden, auf dem das Denkmal steht, ist das an den
israelitischen Friedhof angrenzende, dem
Israelitischen Oberrat gehörende Areal, dass dieser der Ortsgemeinde Pflaumloch in entgegenkommender Weise unentgeltlich zu diesem Zwecke abgetreten hatte.
Der Platz, der von zwölf hochgewachsenen Linden malerisch umrahmt ist, bildet nunmehr einen ungemein stimmungsvollen Eingang zu den stillen Totenreich in der christlichen und jüdischen Gemeinde. Einen Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaft zu der Feier einzuladen, hatte man
allerdings vergessen." Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. September 1928: "Pflaumloch. Am 29. Juli fand hier die feierliche Einweihung des
Gefallenendenkmals für die Krieger der protestantischen und katholischen Konfession statt. Der Boden, auf dem das Denkmal steht, ist das an den
israelitischen Friedhof angrenzende, dem
Israelitischen Oberrat gehörende Areal, dass dieser der Ortsgemeinde Pflaumloch in entgegenkommender Weise unentgeltlich zu diesem Zwecke abgetreten hatte.
Der Platz, der von zwölf hochgewachsenen Linden malerisch umrahmt ist, bildet nunmehr einen ungemein stimmungsvollen Eingang zu den stillen Totenreich in der christlichen und jüdischen Gemeinde. Einen Vertreter der israelitischen Religionsgemeinschaft zu der Feier einzuladen, hatte man
allerdings vergessen." |
Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Auszeichnung für den Jurastudenten Salomon Pflaum in
Tübingen (1837)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Dezember 1837: "Tübingen,
27. November (1837). Die juristische Fakultät hat den diesjährigen
Preis, nachdem die von ihr gestellte Frage mehrere Jahre wegen nicht genügender
Arbeiten wiederholt worden, einem jungen Israeliten, Salomon Pflaum aus
Pflaumloch im Württembergischen, erteilt, und zwar, da die Frage
gelautet: 'In welchen Hauptmaterien weicht die peinliche Gerichtsordnung
Karls V. von der Bamberger Halsgerichtsordnung ab? Worauf berufen die Gründe
dieser Abweichung, und welche Resultate gewählt die Untersuchung für die
Auslegung der peinlichen Gerichtsordnung Karls V.?' wurde ihm der Preis
mit folgendem ehrenden Urteile der Fakultät zuerkannt: 'Abgesehen von
einigen minder bedeutenden Mängeln, zeichnet sich diese Abhandlung nach
dem Urteile der Fakultät durch gründliches Quellenstudium und überhaupt
durch tüchtige Kenntnisse im Strafrechte und Strafprozesse, durch ein
gutes Urteil sowohl in der Darlegung der historischen und legislativen Gründe
usw., sowie durch eine lobenswerte systematische Anordnung und durch eine
gute Schreibart aus' usw. Möge diese öffentliche Anerkennung dem jungen Manne zur höchsten
Aufmunterung gereichen. Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. Dezember 1837: "Tübingen,
27. November (1837). Die juristische Fakultät hat den diesjährigen
Preis, nachdem die von ihr gestellte Frage mehrere Jahre wegen nicht genügender
Arbeiten wiederholt worden, einem jungen Israeliten, Salomon Pflaum aus
Pflaumloch im Württembergischen, erteilt, und zwar, da die Frage
gelautet: 'In welchen Hauptmaterien weicht die peinliche Gerichtsordnung
Karls V. von der Bamberger Halsgerichtsordnung ab? Worauf berufen die Gründe
dieser Abweichung, und welche Resultate gewählt die Untersuchung für die
Auslegung der peinlichen Gerichtsordnung Karls V.?' wurde ihm der Preis
mit folgendem ehrenden Urteile der Fakultät zuerkannt: 'Abgesehen von
einigen minder bedeutenden Mängeln, zeichnet sich diese Abhandlung nach
dem Urteile der Fakultät durch gründliches Quellenstudium und überhaupt
durch tüchtige Kenntnisse im Strafrechte und Strafprozesse, durch ein
gutes Urteil sowohl in der Darlegung der historischen und legislativen Gründe
usw., sowie durch eine lobenswerte systematische Anordnung und durch eine
gute Schreibart aus' usw. Möge diese öffentliche Anerkennung dem jungen Manne zur höchsten
Aufmunterung gereichen.
Anmerkung: "Der Korrespondent ersucht uns, über die Erziehung des Herrn
Pflaum Folgendes hinzuzufügen, weil sich so manche Betrachtung daran knüpfen
lasse: 'S. Pflaum wurde von seinem seligen Vater, der allen seinen
Kindern eine echt religiöse und zeitgemäße Erziehung gab, da in unserem
gesegneten Vaterlande (Württemberg) dem Israeliten der Eintritt in jeden
Zweig des Staatsdienstes offen steht, zum Studium der Rechtswissenschaft
bestimmt, besuchte aber bis zum 15. Jahr die israelitische Schule, die
unter dem Lehrer S. Löwenstein sehr Rühmliches leistet, wo er nicht nur
in allen Elementargegenständen und Realien, sondern auch im Hebräischen
sich tüchtige Kenntnisse erwarb, sodass er sogar mit Mischna und Talmud
recht genau bekannt wurde. Selbst bei dem Besuche der lateinischen Schule
setzte er, nach seines Vaters Willen, das hebräische Studium fort, und
vermöge dieser kräftigen Vorübung zu Sprachstudien, legte er seine
Gymnasialkarriere, obgleich er erst mit fünfzehn Jahren sie begann,
schnell zurück. Er bezog sodann die Münchner Universität, von wo er die
ausgezeichnetsten Zeugnisse mitbrachte, und sodann die Universität zu Tübingen.
Sein Beispiel vermag also die israelitischen Eltern sehr wohl zu
belehrten, dass ihre Kinder, wenn sie auch dem Studium gewidmet werden,
durch die frühere Erlernung des Hebräischen nur an Geisteskraft, an
Scharfsinn und Ernst vorbereitet und entwickelt werden, ja dass die frühere
Erlernung des Hebräischen selbst den besten Prüfstein abgibt, ob ein
Kind zu ernsteren Studien befähigt sei – abgesehen von allem religiösen
Einflusse." |
Salomon Pflaum wird Oberjustiz-Prokurator (1842)
 Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. März 1842: "In Folge höchsten
Dekrets vom 27. Januar dieses Jahres wurde die erledigte
Oberjustiz-Prokurator-Stelle bei dem Königlichen Gerichtshofe des
Jagstkreises, dem Referendar I. Klasse Salomon Pflaum aus Pflaumloch gnädigst
übertragen." Artikel in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. März 1842: "In Folge höchsten
Dekrets vom 27. Januar dieses Jahres wurde die erledigte
Oberjustiz-Prokurator-Stelle bei dem Königlichen Gerichtshofe des
Jagstkreises, dem Referendar I. Klasse Salomon Pflaum aus Pflaumloch gnädigst
übertragen." |
Auszeichnung für Kommerzienrat Alexander von
Pflaum (1888)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. November 1888: "Man
schreibt uns aus dem Württembergischen Ries: Zwei unserer Landsleute sind
mit hohen Auszeichnungen bedacht worden. Herr Kommerzienrat Alexander von
Pflaum, Königlich Sächsischer Generalkonsul in Stuttgart, erhielt vom König
Humbert von Italien das Komturkreuz der italienischen Krone. Der
Dekorierte ist in Pflaumloch geboren. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. November 1888: "Man
schreibt uns aus dem Württembergischen Ries: Zwei unserer Landsleute sind
mit hohen Auszeichnungen bedacht worden. Herr Kommerzienrat Alexander von
Pflaum, Königlich Sächsischer Generalkonsul in Stuttgart, erhielt vom König
Humbert von Italien das Komturkreuz der italienischen Krone. Der
Dekorierte ist in Pflaumloch geboren.
Herr Carl Maison, Landtagsabgeordneter in München, wurde von Seiner Königlichen
Hoheit dem Prinzregenten Luitpold von Bayern zum königlich-bayrischen
Kommerzienrat in Anerkennung seiner Verdienste um die königlich-bayrische
Kunstgewerbeausstellung ernannt; er ist geboren in Oberdorf und Sohn des
seligen Maison, Frankfurter Lehrers daselbst." |
Die Geschichte des Säbels des Studenten Siegfried Chajes von Pflaumloch in der
Verbindung Schlappinia (1921)
Anmerkung: in der Erzählung werden Namen verfremdet. Es gab weder eine
schlagende Verbindung Schlappinia noch einen Siegfried Chajes von Pflaumloch.
Aber wie beim Namen "Petz von Gerlichingen" = "Götz von Berlichingen" deutlich
wird, könnte die Erzählung von einem jüdischen Studenten in einer antijüdisch
gesinnten Verbindung durchaus einen historischen Hintergrund haben.
 Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 5. August 1921: "Feuilleton.
Der Judenspeer. Von Moror. Artikel
in "Das jüdische Echo" vom 5. August 1921: "Feuilleton.
Der Judenspeer. Von Moror.
Die schlagende Verbindung im R.P.C. (Reichs-Panierträger-Konvent)
Schlappinia besaß früher neben anderen Trophäen einen prachtvollen
krummen Säbel mit massiv silbernem Korb. Auf diesem waren die Worte
eingeprägt: 'Einer hochverehrlichen Schlappinia in dankbarster Erinnerung
an gütig gewährten Waffenschutz ehrerbietigst gewidmet von Siegfried Chajes
von Pflaumloch stud iur. et. philos. Sommersemester 1893'. Sonst
unterschied sich die schimmernde Wehr in nichts von anderen Ehrensäbeln.
Auch hatte unser des Rechts und Philosophie beflissener Siegfried sein
neidliches Schwert tadellos geschwungen. Groß und kräftig gebaut, hatte er
seinem schmächtigen Gegner schon nach dem dritten Gange mit einer
bewundernswerten Außenquart die Hälfte des linken Ohres und der Nase
abgehauen, und, was ihn noch mehr ehrte, er war gestanden wie eine Eiche und
hatte beim Nähen nicht einmal gemuckt. Gegen die Honorigkeit des
Kompaukanten Chajes wäre somit nicht das Geringste einzuwenden gewesen, wenn
ja - wenn seine Wiege eben nicht in Pflaumloch gestanden hätte. Es
gibt historische Fakta, die man, wenn man sie nicht leugnen kann, am
klügsten verschweigt. Hätte Siegfried Chajes den Schlappinern seine Herkunft
aus Pflaumloch vorenthalten, statt sie Ihnen noch dazu in Silber!
einzuprägen, so hätte seine Dedikation wahrscheinlich kein anderes Schicksal
gehabt wie andere Dedikationen. Die Jungen Füchse, die mit ehrfürchtigem
Blicke die stummen Zeugen heldischer Vorzeit an |
 den
Wänden ihrer Kneipe mustern, hätten sich dann niemals den Kopf darüber
zerbrochen, was für ein Landsmann wohl der Tapfere gewesen ist. Der mit
seinem Familiennamen Chajes hieß. Sie hätten es sich entweder an
seinem völkisch einwandfreien Vornamen genügen lassen und den Familiennamen
gar nicht weiter beachtet oder aber sie hätten vielleicht gedacht, Chajes
sei ein alter wendischer Name oder sogar ein keltischer Name,
und das hätte sie nicht abgehalten, den Kerl, der ihn trug, für ebenso
bierehrlich zu halten, wie andere Kerle, die bei den Schlappinern Waffen
belegt hatten, und für einen 'noblen Hund' obendrein. Denn - nicht wahr?
Alle können wir schließlich nicht von Hermann dem Cherusker abstammen.
Das wäre entschieden zu viel verlangt. Einige von uns stammen vielleicht
sogar von den Legionäre des Varus ab, die jener besiegt hat. Aber - versuche
einmal einer, Ihnen das nachzuweisen! Hingegen wenn man hört:
Siegfried Chajes von Pflaumloch, da ist natürlich niemand so blau,
sich weiß machen zu lassen, man habe es mit einem schwäbischen
Rittergeschlecht zu tun wie bei 'Petz von Gerlichingen' (gemeint:
Götz von Berlichingen), 'Fuchs von Cossmannshausen' oder 'Wolf
von Wunnenstein'. Vielmehr weiß jedermann sofort Bescheid was es mit
Name und Art für eine Bewandtnis hat. Siegfried Chajes hatte es somit
lediglich sich selbst zuzuschreiben, wenn sein der Schlappinia gewidmeter
Ehrensäbel niemals anders genannt wurde, als: 'Der Judenspeer'. den
Wänden ihrer Kneipe mustern, hätten sich dann niemals den Kopf darüber
zerbrochen, was für ein Landsmann wohl der Tapfere gewesen ist. Der mit
seinem Familiennamen Chajes hieß. Sie hätten es sich entweder an
seinem völkisch einwandfreien Vornamen genügen lassen und den Familiennamen
gar nicht weiter beachtet oder aber sie hätten vielleicht gedacht, Chajes
sei ein alter wendischer Name oder sogar ein keltischer Name,
und das hätte sie nicht abgehalten, den Kerl, der ihn trug, für ebenso
bierehrlich zu halten, wie andere Kerle, die bei den Schlappinern Waffen
belegt hatten, und für einen 'noblen Hund' obendrein. Denn - nicht wahr?
Alle können wir schließlich nicht von Hermann dem Cherusker abstammen.
Das wäre entschieden zu viel verlangt. Einige von uns stammen vielleicht
sogar von den Legionäre des Varus ab, die jener besiegt hat. Aber - versuche
einmal einer, Ihnen das nachzuweisen! Hingegen wenn man hört:
Siegfried Chajes von Pflaumloch, da ist natürlich niemand so blau,
sich weiß machen zu lassen, man habe es mit einem schwäbischen
Rittergeschlecht zu tun wie bei 'Petz von Gerlichingen' (gemeint:
Götz von Berlichingen), 'Fuchs von Cossmannshausen' oder 'Wolf
von Wunnenstein'. Vielmehr weiß jedermann sofort Bescheid was es mit
Name und Art für eine Bewandtnis hat. Siegfried Chajes hatte es somit
lediglich sich selbst zuzuschreiben, wenn sein der Schlappinia gewidmeter
Ehrensäbel niemals anders genannt wurde, als: 'Der Judenspeer'.
Die Schlappiner renommierten nicht wenig mit ihrem Judenspeer. Er bildete
die Hauptattraktion ihrer Kneipe. Jeder Keilfuchs musste ihn sehen und
bewundern, und mit der Zeit knüpfte sich an ihn ein Kranz der
abenteuerlichsten und zugleich infamsten Legenden. Der eiserne Käfig des
Lechburger Stadtmuseums, in dem im Jahre 1349 drei Juden an den Füßen
aufgehängt wurden - und 'lebeten noch am vierten Tag' heißt es in der
Lechburger Stadtchronik - konnte kein größeres Kuriosum darstellen, als der
Judenspeer der Schlappinia.
Viele Jahre hindurch hing der Judenspeer immer an dem gleichen Fleck, wo man
ihn hingehängt hatte, nachdem er von dem Lehrbuben des Juweliers Salomon
Feibeles abgegeben worden war. Bekanntlich wurde aber auf dem vorherigen
Seniorenkonvent des R.P.C., dem ein jüdisches Schandmaul dafür den
Spitznamen 'Risches-Ponim-Convent' angehängt hat, der offizielle Beschluss
gefasst, Juden und Judenstämmlingen in Zukunft wieder Satisfaktion noch
Waffenschutz zu gewähren. Für die nächst Beteiligten war die praktische
Bedeutung dieses Beschlusses nicht. Die Mehrzahl hat es schon vorher
eingesehen dass Ihnen die Pflege feudal aristokratische Hoheiten noch
weniger anstehen, Als den freien Nachkommen höriger Bauern und den
aufgeklärten Enkeln bornierter Pfahlbürger und hatte sich selbst davon
abgewendet. Für den Judenspeer aber wurde die neue Richtung im R.P.C.
verhängnisvoll. Eines schönen Tages wurde er unter großer Zeremonie aus den
heiligen Hallen der Schlappinia hier entfernt. Ein krasser Fuchs, der beim
'Landesvater' nachgeklappt hatte - die Schlappiner lassen sich durch die
Judenrepublik in ihren Traditionen nicht beirren - musste ihn von der Wand
abnehmen, die Widmung dreimal anspucken und dann die Klinge zerbrechen.
Nachdem das Ärgernisses des Judenspeers auf diese Weise beseitigt war, erhob
sich die schwierige Frage: was mit dem silbernen Korb anfangen? Denn für
einen Spucknapf war er denn doch zu schade. Der J.C. zerbrach sich mehrere
Stunden den Kopf darüber. Schließlich beschloss man, alles dem
Erstchargierten, stud. phil. Waldemar Holzbock zu überlassen. Holzbock war
aber hatte den geistreichen Einfall, Hakenkreuze daraus machen zu lassen und
mit deren Anfertigung Salomon Feibeles zu beauftragen. Man war zwar im R.P.C
. übereingekommen, sämtliche jüdischen Geschäftsleute zu boykottieren.
Allein weißt doch: und Holzbock hatte nun einmal unseren Salomon Feibeles,
den er wegen seiner Liberalen Kreditgewährung wert schätzt in sein Herz
geschlossen. So erhielt denn der Verfertiger das Judenspeers den ehrenvollen
Auftrag, aus dem silbernen Korb desselben 100 Hakenkreuze zu schmieden. Denn
dank der Munifizenz des Spenders reichte das edle Material des Korbes hin,
die ganze Aktivitas der Schlappinia mit diesem Schmuck zu versehen. Salomon
Feibeles trug kein Bedenken, den Auftrag anzunehmen. Sein Prinzip war:
'Geschäft ist Geschäft und
|
 Ordre
ist Ordre'. So führte er denn auch dieses Geschäft und diese
Ordre mit der gleichen Promptheit und Kulanz aus, die seine Kundschaft an
ihm gewohnt ist. Ordre
ist Ordre'. So führte er denn auch dieses Geschäft und diese
Ordre mit der gleichen Promptheit und Kulanz aus, die seine Kundschaft an
ihm gewohnt ist.
Der Umstand, dass Holzbock die Kreuze nicht sofort bezahlte,
beunruhigte Feibeles zunächst nicht weiter. Er kannte die Traditionen der
Schlappiner in dieser Hinsicht und hatte seinen Preis entsprechend
kalkuliert. Als er aber auf die erste briefliche Mahnung nicht einmal eine
Antwort mit der üblichen Vertröstung auf den nächsten Monatswechsel erhielt,
wurde er unruhig und wandte sich an die Verbindung selbst. Die aber schrieb
kühl zurück, sie habe Hakenkreuze bei ihm wieder bestellt noch von
ihm geliefert erhalten und müsse daher die Bezahlung seiner Rechnung
entschieden ablehnen. Die Angelegenheit gehe ausschließlich den stud. phil.
Waldemar Holzbock an, der übrigens vor kurzem verschiedener
Unregelmäßigkeiten halber c.i. dimittiert worden und seither verschwunden
sei.
Salomon Feibeles war natürlich wütend und beschloss, die Sache sofort einem
tüchtigen Rechtsanwalt zu übergeben. Aber wem sollte er sein Vertrauen
schenken? Ein Nichtjude würde ja zweifellos bei den Richtern mehr
Eindruck machen. Aber wer garantierte, dass der der Versuchung würde
widerstehen können, antisemitische Witze zu reißen, wenn die Gelegenheit
aufdringlich dazu einlud? Bei einem Juden war man gegen diese Gefahr
natürlich gesichert, aber dafür bestand bei ihm wiederum die andere, dass er
vielleicht durch taktlose Ausfälle auf den antisemitischen Gegner den ganzen
Prozess verdarb. Fürwahr ein schwieriges Problem! Nach einer schlaflos
verbrachten Nacht fand Salomon Feibeles in dessen den vortrefflichen Ausweg,
die Sache einem jüdischen Anwalt mit gerichtsnotorisch deutsch-völkischer
Gesinnung zu übertragen.
So ist es gekommen, dass der Justizrat Siegfried Chajes, Mitglied der
deutschen Volkspartei, das Mandat erhielt, auf das er ohnedies ein
natürliches Prioritätsrecht besaß. Er rechtfertigte das von Salomon Feibes
in ihn gesetzte Vertrauen voll und ganz. Er führte die Sache mit solcher
Diskretion, dass seine persönlichen Beziehungen zu ihr von niemandem bemerkt
worden wären, wenn der Gegenanwalt, obwohl ein Parteifreund Siegfried, nicht
immer wieder mit deutlicher Spitze darauf hingewiesen hätte. Die vornehme
Zurückhaltung, mit welcher der Angegriffene auf diese Anzapfungen reagierte,
verfehlte nicht, am Richtertisch den vorzüglichsten Eindruck zu machen.
Justizrat Chaies erzielte denn auch den Erfolg, dass das Landgericht seinen
lichtvollen Ausführungen folgend das Geschäft den ganzen Umständen nach als
im Namen der Schlappinia Jahr geschlossen ansah, so dass Feibes in
erster Instanz glatt gewann. In zweiter verlor er dann allerdings
genauso glatt eben so glatt, weil das Berufungsgericht einen Verstoß gegen
die guten Sitten darin erblickte, wenn ein Jude die Anfertigung von
Hakenkreuzen übernimmt und demgemäß den ganzen Handel für nichtig erachtete.
Gegenwärtig beschäftigt die Sache Feibeles gegen Schlappinia das
Reichsgericht. Überflüssig zu sagen, dass man ihrem endgültigen Ausgang
allenthalben mit fieberhafter Spannung entgegen sieht, besonders aber im
bayerischen Staatsministerium der Justiz, wo ein dichterisch begabter
Referent den Fall für den Staatskonkurs zu bearbeiten beabsichtigt."
|
Zum 100. Geburtstag der aus Pflaumloch stammenden Sophie Stern geb. Nördlinger
(1927)
 Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September
1927: "Schopfloch bei Dinkelsbühl. Am 25. Juli konnte Frau Sophie
Stern geb. Nördlinger, im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel die
Feier ihres 100. Geburtstages begehen. Die Jubilarin ist in Pflaumloch
(Württemberg) geboren und lebt seit 24 Jahren hier. Trotz ihres hohen
Alters ist sie körperlich und geistig gesund, dabei lebhaft und
humorvoll. Telegramme, Briefe und Ehrengeschenke traten in sehr großer
Zahl ein; auch der Reichspräsident Exzellenz von Hindenburg sandte
Glückwunsch und Ehrengeschenk. Unter den zahlreichen Personen, welche
persönlich ihre Glückwünsche darbrachten, waren der 1. Bürgermeister
des Ortes, der Kultusvorstand, Bezirksrabbiner Dr. Kroner (Oberdorf-Bopfingen) als Beauftragter des Israelitischen Oberrates von
Württemberg und Distriktsrabbiner Dr. Munk aus Ansbach. Der Verband
Bayerischer Israelitischer Gemeinden übersandte Glückwunschschreiben und
Ehrengabe. M.R." Artikel
in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 19. September
1927: "Schopfloch bei Dinkelsbühl. Am 25. Juli konnte Frau Sophie
Stern geb. Nördlinger, im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel die
Feier ihres 100. Geburtstages begehen. Die Jubilarin ist in Pflaumloch
(Württemberg) geboren und lebt seit 24 Jahren hier. Trotz ihres hohen
Alters ist sie körperlich und geistig gesund, dabei lebhaft und
humorvoll. Telegramme, Briefe und Ehrengeschenke traten in sehr großer
Zahl ein; auch der Reichspräsident Exzellenz von Hindenburg sandte
Glückwunsch und Ehrengeschenk. Unter den zahlreichen Personen, welche
persönlich ihre Glückwünsche darbrachten, waren der 1. Bürgermeister
des Ortes, der Kultusvorstand, Bezirksrabbiner Dr. Kroner (Oberdorf-Bopfingen) als Beauftragter des Israelitischen Oberrates von
Württemberg und Distriktsrabbiner Dr. Munk aus Ansbach. Der Verband
Bayerischer Israelitischer Gemeinden übersandte Glückwunschschreiben und
Ehrengabe. M.R." |
Zum Tod der 100-jährigen, in Pflaumloch geborenen Sophie Stern geb. Nördlinger
(1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,
15. Januar (1928). In Schopfloch
starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch
Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Januar 1928: "Mönchsroth,
15. Januar (1928). In Schopfloch
starb im Alter von 100 Jahren und 5 Monaten Frau Sophie Stern geb. in Pflaumloch
Württemberg. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des
Lebens." |
Über
jüdische Finanzleute des 19. Jahrhunderts - über Elias Pflaum und Alexander
von Pflaum und ihre Familien (1930)
 Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Februar 1930: "Jüdische Finanzleute des letzten Jahrhunderts.
Von Felix Sontheimer.
Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden
Württembergs" vom 15. Februar 1930: "Jüdische Finanzleute des letzten Jahrhunderts.
Von Felix Sontheimer.
Anlässlich eines kürzlich in der Tagespresse erwähnten Stuttgarter Bankjubiläums wurde auf die bekannte
Familie Pflaum hingewiesen, die im württembergischen Wirtschaftsleben des vorigen Jahrhunderts bis in den Beginn des jetzigen
hinein eine bedeutende Rolle gespielt hat. Bevor Elias Pflaum, der im Jahre 1810 in Pflaumloch geboren wurde, 1855 sein Bankgeschäft in Stuttgart
errichtete, hatte er bereits seit Jahren in seinem Heimatort Handels- und Geldgeschäfte erfolgreich betrieben:
den Meisterbrief der Handelsinnung hatte er im Jahre 1841 vom Oberamt Neresheim zugestellt erhalten. Beim Verlassen seiner Heimatgemeinde wurden die Verdienste von Elias Pflaum gefeiert, der 17 Jahre als Mitglied des
Israelitischen Kirchenvorsteheramts und als Mitglied teils des Bürgerausschusses, teils des Gemeinderats amtiert hatte.
Die gewissenhafte, unparteiische und uneigennützige Erfüllung seiner Pflichten wurde besonders betont. Nicht ohne tiefe Rührung ist er aus seinem Geburtsort geschieden,
um seinen Kindern eine bessere Ausbildung und schönere Existenz sichern zu können. Schon seinerzeit bestand in der Gemeinde, die Dank der
ersprießlichen, vom Oberamt, dem Ministerium und der Oberkirchenbehörde vielfach anerkannten Tätigkeit von Elias
Pflaum musterhaft geführt worden war, die Befürchtung, dass sie durch das
Wegziehen einige Familien ihre Last nicht mehr tragen könnte. Elias
Pflaum wurde in Pflaumloch sowohl als in Stuttgart von seiner im Jahr 1817 geborenen Frauen
Nanette geborene Gutmann, tatkräftig unterstützt . Es wurden ihr besondere Welt- und Geschäftskenntnisse nachgerühmt. Der 1862 durch königliche Entschließung
zum Oberkirchenvorsteher ernannte Elias Pflaum ist im Jahre 1876 seiner vier Jahre vorher verschiedenen Frau im Tode gefolgt.
Kirchenrat von Maier und Kirchenrat Dr. Wassermann hoben in ihren Gedächtnisreden die echte Frömmigkeit, den redlichen Bürgersinn und die Bedeutung und Stellung hervor, die beide in der kurzen Zeit ihres Wirkens in Stuttgart sich erworben haben.
In einer Zeit, in der die Aneignung eines über das gewöhnliche Maß der Schulkenntnisse hinausgehenden Wissens dem Israeliten erschwert war und vielfach nicht einmal wünschenswert erschien,
ließ das Ehepaar Elias und Nanette Pflaum seinen Söhnen eine sorgfältige Erziehung angedeihen, die ihre Früchte getragen hat. Anfangs der sechziger Jahre ist der Sohn Alexander, der nachmalige Geheime Kommerzienrat und königlich sächsische Generalkonsul
Alexander von Pflaum (geboren 1839), in das väterliche Geschäft eingetreten und hat sich in diesem und später in der
an dessen Stelle errichteten Firma Pflaum & Co., in der er von seinem Bruder Moritz unterstützt wurde, und die im Jahre 1881 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist, als ein genialer, hochangesehener, weit über die Grenzen des Vaterlandes bekannter Finanzmann erwiesen.
Alexander von Pflaum hat eine führende Stellung eingenommen; er führte den Vorsitz in der Verwaltung von elf Aktiengesellschaften, war gleichzeitig tätiges und mitarbeitendes Mitglied des
Aufsichtsrats von 16 anderen in- und ausländischen Gesellschaften, Mitglied der
'Stuttgarter Handelskammer', der 'Zentralstelle für Gewerbe und Handel', des
'Deutschen Handelstags', des Vorstands des 'Hansabundes', und des
'Deutschen Flottenvereins', des 'Deutschen Börsenausschusses' und des Börsenehrengerichts
u.a. Er war ein echter, vornehmer, königlicher Kaufmann, der die Interessen seines Standes, seines Landes und des Reichs wahrgenommen
hat. In seinem Weitblick ist er schon frühzeitig für die Vereinheitlichung der deutschen Eisenbahnen eingetreten. Eine stattliche Anzahl Handel und gewerbetreibender Glaubensgenossen hat Alexander von Pflaum ihr emporsteigen zu verdanken. Mit fast unfehlbaren Kennerblick hat er Anfängern Mittel zur Selbständigmachung zur Verfügung gestellt, und nur in den seltensten fällen hat seine finanzielle Hilfeleistungen nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt. Er ist stets seinem Glauben treu geblieben; der israelitischen Behörde hat er 35 Jahre lang angehört.
Mit unvergleichlicher Energie hat Alexander von Pflaum ein körperliches Leiden zu überwinden gesucht. Er ist
am 15. Dezember 1911 einer heimtückischen Krankheit zum Opfer gefallen. Trotz des in seiner Bescheidenheit geäußerten Wunsches,
es möge an seiner Bahre nicht viel von ihm geredet werden, wurden die großen, unvergesslichen Verdienste des Mannes von
aus nah und fern herbeigeeilten Leidtragenden gerühmt. Auch hat der biedere Vertreter der Heimatgemeinde
Pflaumloch nicht gefehlt, deren Ehrenbürger Geheimrat von Pflaum gewesen war und der er bis zu seinem Tode Treue gehalten hat. Einige Jahre vorher hatte er der Gemeinde
als Stiftung das Gemeindehaus übergeben, das seitherige Gotteshaus der aufgelösten israelitischen Gemeinde,
das Elias und Marcus Pflaum, Alexanders Vater und Onkel, miterbaut und im Dezember 1846 eingeweiht hatten.
Die in Württemberg ausgestorbene Familie Pflaum und ihr Wirken gehören zur Geschichte unseres Heimatlandes; sie sind
ein Stück des württembergischen Vaterlandes geworden." |
Über die Auflösung
der jüdischen Gemeinde
Einladung
zum Zuzug nach Pflaumloch (1885)
 Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1885: "Mainz, 6. Oktober
(1885). Israelitische Familien, die genötigt sind, oder denen es wünschenswert
erscheint, ihren gegenwärtigen Wohnort mit einem anderen zu vertauschen,
wollen wir auf den Ort Pflaumloch (Jagstkreis, Oberamt Neresheim)
aufmerksam machen. Daselbst befand sich vor wenigen Jahren noch eine große
israelitische Gemeinde, die jedoch durch Fortzug vieler Familien an Zahl
abgenommen hat. Noch heute ist die israelitische Gemeinde zu Pflaumloch
gut situiert, hat ein schönes Schulhaus, einen schönen Friedhof, eine
prachtvolle Synagoge und sonstige Gemeindeinstitutionen. Bahnverbindung,
gute Gegend und namentlich die Wohlfeilheit der Wohnung ermöglichen es,
dass sich arbeitsliebende und einigermaßen leistungsfähige Handwerker,
z.B. Schneider, mit Leichtigkeit daselbst eine Existenz zu gründen vermögen.
Von der israelitischen Gemeinde hätten sie keinerlei Lasten oder Steuern
zu tagen; es könnte vielmehr, wenn notwendig, Unterstützung aus dem
nicht unbedeutenden Stiftungsfonds geleistet werden. Nähere Auskunft wird
der Pfleger des israelitischen Kirchenvorsteheramts, Herr J. Oberdorfer,
gern erteilen. Bemerken wollen wir noch, dass man für Reisekosten für
eventuelle Einwanderer keine Verbindlichkeiten übernimmt, ebenso wenig für
deren Unterhalt nach geschehener Ansiedlung und dass endlich nur solche
berücksichtigt werden, die sich durch Heimatzeugnisse und guten Leumund
legitimieren können." Artikel in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1885: "Mainz, 6. Oktober
(1885). Israelitische Familien, die genötigt sind, oder denen es wünschenswert
erscheint, ihren gegenwärtigen Wohnort mit einem anderen zu vertauschen,
wollen wir auf den Ort Pflaumloch (Jagstkreis, Oberamt Neresheim)
aufmerksam machen. Daselbst befand sich vor wenigen Jahren noch eine große
israelitische Gemeinde, die jedoch durch Fortzug vieler Familien an Zahl
abgenommen hat. Noch heute ist die israelitische Gemeinde zu Pflaumloch
gut situiert, hat ein schönes Schulhaus, einen schönen Friedhof, eine
prachtvolle Synagoge und sonstige Gemeindeinstitutionen. Bahnverbindung,
gute Gegend und namentlich die Wohlfeilheit der Wohnung ermöglichen es,
dass sich arbeitsliebende und einigermaßen leistungsfähige Handwerker,
z.B. Schneider, mit Leichtigkeit daselbst eine Existenz zu gründen vermögen.
Von der israelitischen Gemeinde hätten sie keinerlei Lasten oder Steuern
zu tagen; es könnte vielmehr, wenn notwendig, Unterstützung aus dem
nicht unbedeutenden Stiftungsfonds geleistet werden. Nähere Auskunft wird
der Pfleger des israelitischen Kirchenvorsteheramts, Herr J. Oberdorfer,
gern erteilen. Bemerken wollen wir noch, dass man für Reisekosten für
eventuelle Einwanderer keine Verbindlichkeiten übernimmt, ebenso wenig für
deren Unterhalt nach geschehener Ansiedlung und dass endlich nur solche
berücksichtigt werden, die sich durch Heimatzeugnisse und guten Leumund
legitimieren können." |
Zur Auflösung der Gemeinde (1904)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. September 1904:
"Neresheim
(Württemberg). Die israelitische Gemeinde Pflaumloch, die in den
1870er-Jahren noch über 100 Angehörige zählte, geht nun vollends
schnell der Auflösung entgegen. Im Laufe des Sommers sind mehrere
Familien nach Nördlingen weggezogen und in den letzten Tagen hat auch der
letzte Pflaumlocher Israelit sein Anwesen verkauft, um nach Nürnberg zu
übersiedeln. Für die politische Gemeinde bedeutet der Wegzug der
steuerkräftigen Israeliten einen nicht unbedeutenden finanziellen
Verlust. Was aus der schönen geräumigen Synagoge werden soll, die im
Jahre 1846 um 20.000 Gulden erbaut wurde und die in letzter Zeit nur noch
zwei Israeliten als Andachtsstätte gedient hat, ist noch nicht bestimmt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. September 1904:
"Neresheim
(Württemberg). Die israelitische Gemeinde Pflaumloch, die in den
1870er-Jahren noch über 100 Angehörige zählte, geht nun vollends
schnell der Auflösung entgegen. Im Laufe des Sommers sind mehrere
Familien nach Nördlingen weggezogen und in den letzten Tagen hat auch der
letzte Pflaumlocher Israelit sein Anwesen verkauft, um nach Nürnberg zu
übersiedeln. Für die politische Gemeinde bedeutet der Wegzug der
steuerkräftigen Israeliten einen nicht unbedeutenden finanziellen
Verlust. Was aus der schönen geräumigen Synagoge werden soll, die im
Jahre 1846 um 20.000 Gulden erbaut wurde und die in letzter Zeit nur noch
zwei Israeliten als Andachtsstätte gedient hat, ist noch nicht bestimmt." |
Weiterer Bericht zur Auflösung der Gemeinde (1904)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904: "Stuttgart, 24.
August (1904). Zu den Orten in Württemberg, welche bis in die vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts den Israeliten zur Niederlassung reserviert
waren und aus denen auch nach dem die kirchlichen Verhältnisse der Juden
regelnden Gesetz von 1828 ein Wegzug sehr erschwert war, gehört das Dorf
Pflaumloch im Oberamt Neresheim. Bis in die siebziger Jahre hatte in dem
etwa 450 Einwohner zählenden Dörfchen die israelitische Gemeinde noch
mehr als 100 Angehörige, 1880 waren es noch 47 Mitglieder. Seitdem hat
die Zahl rasch abgenommen und vor einigen Tagen hat, wie dem 'Staatanzeiger' geschrieben wird, der letzte in Pflaumloch ansässige
Israelit sein Anwesen verkauft, um nach Nürnberg überzusiedeln, nachdem
erst im Laufe dieses Sommers mehrere jüdische Familien nach Nördlingen
gezogen sind. Die im Jahre 1846 gebaute neue Synagoge steht jetzt völlig
vereinsamt da. Für die politische Gemeinde Pflaumloch bedeutet der Wegzug
der Israeliten einen ziemlichen Verlust an Steuerkraft. In ähnlicher
Weise wie hier, verändert sich in den anderen dörflichen und kleinstädtischen
Gemeinden, die ehemals als Judenniederlassungen dienten, das Verhältnis.
Die israelitischen Gemeinden draußen auf dem lande schrumpften stark
zusammen, während in den größeren Städten seit Mitte des vorigen
Jahrhunderts eine ziemlich erhebliche Zunahme stattgefunden hat, die aber
in letzter Zeit vielfach in einen Rückgang sich verwandelt hat.
Eigentlich hat seit 1895 nur Stuttgart eine Zunahme zu verzeichnen. Im
ganzen Lande ist die Gesamtzahl der Israeliten von 13.331 Köpfen im Jahre
1880 auf 11.916 bei der letzten Zählung zurückgegangen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904: "Stuttgart, 24.
August (1904). Zu den Orten in Württemberg, welche bis in die vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts den Israeliten zur Niederlassung reserviert
waren und aus denen auch nach dem die kirchlichen Verhältnisse der Juden
regelnden Gesetz von 1828 ein Wegzug sehr erschwert war, gehört das Dorf
Pflaumloch im Oberamt Neresheim. Bis in die siebziger Jahre hatte in dem
etwa 450 Einwohner zählenden Dörfchen die israelitische Gemeinde noch
mehr als 100 Angehörige, 1880 waren es noch 47 Mitglieder. Seitdem hat
die Zahl rasch abgenommen und vor einigen Tagen hat, wie dem 'Staatanzeiger' geschrieben wird, der letzte in Pflaumloch ansässige
Israelit sein Anwesen verkauft, um nach Nürnberg überzusiedeln, nachdem
erst im Laufe dieses Sommers mehrere jüdische Familien nach Nördlingen
gezogen sind. Die im Jahre 1846 gebaute neue Synagoge steht jetzt völlig
vereinsamt da. Für die politische Gemeinde Pflaumloch bedeutet der Wegzug
der Israeliten einen ziemlichen Verlust an Steuerkraft. In ähnlicher
Weise wie hier, verändert sich in den anderen dörflichen und kleinstädtischen
Gemeinden, die ehemals als Judenniederlassungen dienten, das Verhältnis.
Die israelitischen Gemeinden draußen auf dem lande schrumpften stark
zusammen, während in den größeren Städten seit Mitte des vorigen
Jahrhunderts eine ziemlich erhebliche Zunahme stattgefunden hat, die aber
in letzter Zeit vielfach in einen Rückgang sich verwandelt hat.
Eigentlich hat seit 1895 nur Stuttgart eine Zunahme zu verzeichnen. Im
ganzen Lande ist die Gesamtzahl der Israeliten von 13.331 Köpfen im Jahre
1880 auf 11.916 bei der letzten Zählung zurückgegangen." |
| |
 Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 1. September 1904: Derselbe
Bericht wie oben.
Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 1. September 1904: Derselbe
Bericht wie oben. |
Tod der letzten jüdischen Einwohnerin (1907)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. November 1907: "Pflaumloch.
Nunmehr ist durch den Tod der letzten jüdischen Einwohnerin Pflaumloch
ohne Juden. Der Friedhof wird von der israelitischen Oberkirchenbehörde
weiter erhalten werden." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. November 1907: "Pflaumloch.
Nunmehr ist durch den Tod der letzten jüdischen Einwohnerin Pflaumloch
ohne Juden. Der Friedhof wird von der israelitischen Oberkirchenbehörde
weiter erhalten werden." |
| |
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Pflaumloch, 1.
November. Die letzte israelitische Einwohnerin unseres Ortes ist in diesen
Tagen gestorben. Vor 40 Jahren gab es in Pflaumloch noch über 150
Israeliten, vor 30 Jahren noch etwa 100. Vor zwei Jahren ist die
israelitische Kultusgemeinde aufgelöst worden." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Pflaumloch, 1.
November. Die letzte israelitische Einwohnerin unseres Ortes ist in diesen
Tagen gestorben. Vor 40 Jahren gab es in Pflaumloch noch über 150
Israeliten, vor 30 Jahren noch etwa 100. Vor zwei Jahren ist die
israelitische Kultusgemeinde aufgelöst worden." |
| |
 Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. November 1907: "Pflaumloch. (Die
letzte Jüdin). Durch den dieser Tage erfolgten Tod der letzten
israelitischen Einwohnerin Pflaumlochs, scheidet unser Ort aus der Reihe der
israelitischen Gemeinden vollends aus. Der
israelitische Friedhof samt Leichenhaus bleibt im Besitz der
israelitischen Oberkirchenbehörde, da einzelne Familien sich das
Besetzungsrecht auf dem heimatlichen Friedhof vorbehalten haben." Artikel
in "Israelitisches Familienblatt" vom 7. November 1907: "Pflaumloch. (Die
letzte Jüdin). Durch den dieser Tage erfolgten Tod der letzten
israelitischen Einwohnerin Pflaumlochs, scheidet unser Ort aus der Reihe der
israelitischen Gemeinden vollends aus. Der
israelitische Friedhof samt Leichenhaus bleibt im Besitz der
israelitischen Oberkirchenbehörde, da einzelne Familien sich das
Besetzungsrecht auf dem heimatlichen Friedhof vorbehalten haben." |
| |
 Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 8. November 1907: Bericht wie oben. Artikel
in "Jüdische Rundschau" vom 8. November 1907: Bericht wie oben.
|
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und einzelner Personen
Anzeige von Gemeindevorsteher Moritz Jung
(1879)
 Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1879: "Gesucht per sofort
nach Regensburg eine Haushälterin, mosaischer Konfession, welche in allen
Zweigen der Haushaltung tüchtig, einen soliden Lebenswandel nachzuweisen
und besonders Liebe zu Kindern hat. Gute Behandlung wird zugesichert.
Bewerberinnen, welche auf diesen erstgemeinten Antrag eingehen wollen,
belieben ihre Adresse nebst etwaigen Ansprüchen sogleich einzusenden an
Moritz Jung, in Pflaumloch bei Nördlingen." Anzeige in
der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1879: "Gesucht per sofort
nach Regensburg eine Haushälterin, mosaischer Konfession, welche in allen
Zweigen der Haushaltung tüchtig, einen soliden Lebenswandel nachzuweisen
und besonders Liebe zu Kindern hat. Gute Behandlung wird zugesichert.
Bewerberinnen, welche auf diesen erstgemeinten Antrag eingehen wollen,
belieben ihre Adresse nebst etwaigen Ansprüchen sogleich einzusenden an
Moritz Jung, in Pflaumloch bei Nördlingen." |
Anzeige der Metzgerei mit Viehhandel Leopold Siegbert
(1900)
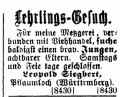 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1900: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1900: "Lehrlings-Gesuch.
Für meine Metzgerei, verbunden mit Viehhandel, suche baldigst
einen braven Jungen, achtbarer Eltern. Samstags und Feiertage
geschlossen.
Leopold Siegbert, Pflaumloch
(Württemberg)." |
Weitere Dokumente
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries;
Erläuterungen gleichfalls durch Peter Karl Müller)
Über
den Großbrand Pflaumlochs
von 1802 |
 |
 |
| |
Die Darstellung
ist aus der Ortsgeschichte von Eugen Stäbler (1903-1987) entnommen:
"Pflaumloch im Ries", erschienen 1956. S. 63-64.
Neuauflage ist zu beziehen über die Gemeindeverwaltung
Riesbürg. |
| |
|
|
|
Unterpfands-Urkunde
für ein Darlehen von Löw Salomon (1813) |
|
|
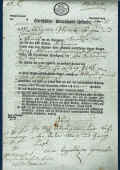 |
 |
 |
|
Es handelt sich um eine Unterpfands-Urkunde für ein
Darlehen von Löw Salomon um das Jahr 1813. Das Vordruck-Formular für eine gerichtliche
Unterpfands-Urkunde wurde in diesem Fall verwendet für ein Darlehen an Matthäus Meyer, Bürger und Metzger in Pflaumloch und seine Ehefrau
Katharine (?) über 50 Gulden von Löw Salomon, "zu ihrem ehelich gesellschaftlichen Nutzen, nemlich Abzahlung eines Güterschillings".
Als Unterpfand verdingt wurde ein 1/2 Morgen Acker.
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Morgen_(Einheit) |
| |
|
|
Apothekerrechnung
an die Israelitische
Gemeinde Pflaumloch (1842) |
 |
 |
|
Es handelt sich dabei um eine Rechnung des Apothekers
Joh. Chr. Heinr. Wolf aus Nördlingen an die Jüdische Gemeinde in Pflaumloch über
zwei Mixturen für Sandel Kronheimer aus Pflaumloch. Sandel Kronheimer
(geb. 4. Juli 1768, gest. 11. Oktober 1842) war der Sohn von Israel und Blümle Kronheimer in Pflaumloch.
Er war in zweiter Ehe verheiratet mit Breindel Hechinger (geb. 6. Juli 1781,
gest. 8. Dezember 1834), Tochter von Moses und Marianne Hechinger aus Kleinerdlingen.
Sandel Kronheimer wurde in Pflaumloch begraben. Seine Frau - weil vor 1840 verstorben
- wurde in Wallerstein beigesetzt. Die Rechnung ist knapp zwei Monate nach dem Todestag von Sandel Kronheimer datiert.
|
| |
|
|
Brief
an das
Schultheißenamt Pflaumloch (1847) |
 |
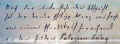 |
|
Es handelt sich um einen Brief an das Schultheissenamt Pflaumloch.
Die Vorderseite trägt einen 2-Zeiler Stempel Aalen vom 26.F ebruar 1847.
Der Brief wurde 2 mal verwendet. In dieser Zeit war dies nicht ungewöhnlich.
In der Sache geht es um eine Forderung des Bauern Philipp Merz aus Forst bei Aalen um eine noch ausstehende Restschuld des
jüdischen Pferdehändlers Salomon Jung, resultierend aus einem
Pferdekauf, bei dem Philipp Merz bereits 187 Gulden erhalten hat und nun noch ausstehende 5 Gulden 24
einfordert. Das 2 Foto gibt lediglich Rückschluss
auf den Pferdekauf, den Verkäufer und den Käufer. |
| |
|
|
Dokument
zu Joseph Steiner,
früher Josef Isaak (1853) |
 |
|
Es handelt sich bei dem Dokument (Schreiben)
um eine Art Urkunde, in welcher der Handelsmann Joseph Steiner beurkundet, dass er gegenüber einem Bürger aus Zipplingen keinerlei
Schuldansprüche mehr besitzt. Hingewiesen wird darauf (unten), dass der Handelsmann "Joseph Steiner" aus Pflaumloch früher den Namen "Josef Isaak" führte.
Nach den Recherchen von Rolf Hofmann (HarburgProject) ist Joseph Steiner
am 3. Mai 1789 als Sohn des Isac Joseph (Steiner) und seiner Frau Radel
geboren. Er heiratete am 27. Oktober 1807 Lea Elkan, geboren in Mönchsroth am 5. März 1788, die Tochter von Simon Loew Elkan und seiner Frau
Fradel. Joseph Steiner starb am 21. Dezember 1865 und wurde in Pflaumloch neben seiner Frau Lea beerdigt, die bereits 7 Jahre früher, am 25. November 1858 gestorben war.
Sein Vater "Isac Joseph" heiratete 1781 in Pflaumloch als "Saekel Joseph". Er wurde 1738 geboren und starb 1830. Sein Grab befindet sich auf dem
Wallersteiner jüdischen Friedhof, da Pflaumloch erst ab 1840 seinen eigenen jüdischen Friedhof hatte. |
| |
|
|
|
Geschäftsbriefe
aus der Familie Pflaum (1854) |
|
 |
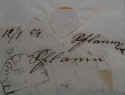 |
 |
| Geschäftliche Mitteilung von H.&S. Pflaum aus Pflaumloch vom
12. April 1854 nach Ingolstadt. Auf dem Umschlag finden sich Poststempel von Nördlingen,
Donauwörth und Ingolstadt, die den Postweg des Briefes dokumentieren. bei
den beiden abgekürzten Vornamen aus der Familie Pflaum handelt es sich
nach Angaben von Peter Karl Müller möglicherweise um Hayum Pflaum
(1784-1872, verheiratet seit 1812 mit Lena geb. Lebrecht) und Salomon David
Pflaum (geb. 1789, seit 1798 in Frankreich, möglicherweise wieder nach
Pflaumloch zurückgekehrt, gest. 1866 in München). |
| |
|
|
| |
 |
 |
| Rechnung
von H. & S. Pflaum an Friedrich Goetz in Oberdorf vom 8. August 1854;
zu den Herren Pflaum siehe Angaben oben. |
| |
|
|
| |
|
|
Jahrzeitstiftung
für das
Israelitische Hospital in Fürth
durch Rechtskonsulent Nördlinger
für David Nördlinger (1871)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim / Ries) |
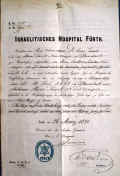 |
 |
|
Es handelt sich bei dem Schreiben um einen Vordruck, der dann nur mit den fehlenden Daten und Informationen vervollständigt werden musste.
Die nachfolgend kursiv und fettgedruckten Wörter und Buchstaben sind der
Vordruck |
|
Israelitisches Hospital Fürth.
Nachdem der Herr Oberrabbiner Dr. Loewi dahier die von Herrn David Nördlinger in Pflaumloch
zum Hospitalfond legirten, von Herrn Rechtsconsulenten Nördlinger als Testamentsvollstrecker übersendeten zweihundert Gulden
einbezahlt hat, so wird demselben hiermit bezeugt, daß das Hospital die Verpflichtung übernommen hat, am Jahrzeittage
des am 6.September 1870,
das ist : 10. Elul 5630 in Pflaumloch verstorbenen Herrn David Nördlinger
alljährlich in der Hospitalsynagoge die ritualmäßigen Gebete sagen zu laßen und
eine Jahrzeitkerze zu brennen.
Die Kerze muß eine Wachskerze sein, die Person welche Mischna und Kadischvorträgt, erhält aus den Zinsen der Stiftung zwey Gulden.
Fürth, am 26. Maerz 1871
Vorstand der Isr. Kultus - Gemeinde.
Der zur Zeit Vorsitzende - ???
Kassier - ???
Rückseite: Das seit mehr als hundert Jahren bestehende, 1846 mit einem Aufwand von 30000 fl neu gebaute und 1864 mit einem Aufwand von 12000 fl bedeutend
vergrößerte Israelitische Hospital Fürth besteht aus einer Pfründner - und einer Kranken - Anstalt.
In der Ersteren finden hülfsbedürftige gesunde Personen auf Lebensdauer vollständige Verpflegung, in der Letzteren werden Kranke entsprechend
ärztlich behandelt und verpflegt.
Die Verwaltung des Hospitals wird vom Vorstand der Israelitischen Kultus-Gemeinde und der Israelit. Armenkommission geführt und mittels täglicher
Besichtigung durch einen Krankenpfleger überwacht. Zur Handhabung der Hausordnung ist ein eigener Verwalter mit dem nöthigen Wärter - und
Dienst - Personal angestellt.
Die ärztliche Behandlung der Kranken besorgt der Hospitalarzt und der Hospitalwundarzt.
Der Fond des Hospitals ist im Kapitalstock unangreifbar und als eine nur für jüdische Glaubensgenossen bestimmte Stiftung im Sinne des Tit. IV. §. 9. Abs. 4.
der Verfassungs - Urkunde anerkannt.
In der Haussynagoge wird täglich Gottesdienst gehalten, an welchem sämmtliche im Hospital befindliche Pfründner und Kranke -- soweit es ihre Gesundheit
erlaubt -- unter Aufsicht eines Armenpflegers Theil nehmen.
In der Synagoge befinden sich Tafeln, auf denen die Namen der Wohlthäter des Hospitals verzeichnet sind.
Dort läßt auch das Hospital für das Selenheil seiner verstorbenen Wohlthäter die ritualmäßigen Gebete abhalten und die Jahrzeitlichter brennen.
------------------------------------------------
Druck von J. Sommer in Fürth. |
| |
| |
|
|
Amtsbrief
mit Nennung von
Abraham Lauchheimer in Pflaumloch (1875) |
 |
 |
|
Es handelt sich um einen Amtsbrief
vom 16. Dezember 1875 mit der Bitte um Zustellung eines Auszugs der
Verlassenschaftsteilung Moritz Fink an Abraham Lauchheimer in
Pflaumloch. Abraham Lauchheimer ist am 11. Mai 1811 in Pflaumloch
geboren als Sohn des Lippmann Lauchheimer (aus Pflaumloch) und der Maria
geb. Guttmann (bzw. Marie geb. Gutmann; aus Aufhausen). Er war seit dem
16. August 1847 verheiratet mit Fanni, die am 9. September 1825
geboren ist als Tochter des Gumper Hauser in Buttenwiesen und seiner Frau
Lea. Abraham und Fanni Lauchheimer hatten vier Kinder: Nanni (geb.
11. Juli 1848), Gustav (geb. 19. August 1851), Ida (geb. 20.
Juni 1857) und Louis (geb. 21. November
1859). |
| |
|
|
|
Rechnung
der Gebrüder Schühlein (1889) |
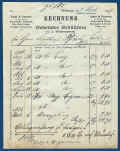 |
 |
|
Die Rechnung der Gebrüder Schühlein wurde vom 2. November 1889 für Schultheiß Petsch Erben in
Pflaumloch ausgestellt. Schiele Schühlein wurde am 27. September 1813 in Pflaumloch
geboren als Sohn von Hirsch Schühlein und Babette geb. Herrmann. Er heiratete am 11. Februar 1842 in Pflaumloch
Augusta
Dörzbacher geb. Golus aus Jebenhausen.
Schiele Schühlein starb am 4. März 1878 in Nördlingen. Seine Frau Augusta Schühlein
war bereits 30. Januar 1864 in Pflaumloch gestorben. Beide wurden im jüdischen Friedhof in
Pflaumloch beigesetzt. Schiele Schühlein war Pferdehändler und seit 1845 auch Inhaber der Gastwirtschaft zum Rössle in Pflaumloch.
Ab 1864, dem Sterbejahr seiner Frau, lebte Schiele Schühlein in Nördlingen und war Mitbegründer der israelitischen
Gemeinde Nördlingens. Zusammen mit seinem Bruder Moritz Schühlein gehörte ihm eine
Spirituosen-Fabrik .
Der Briefkopf der Rechnung dokumentiert die Produktenpalette der Gebrüder Schühlein, zu der
Essig und Liköre in allen Sorten, Branntwein, Weingeist, Arac, Rum, Cognac,
Zwetschgen- und Kirschwasser, viele Sorten von Wein, Champagner und Punschessenz, aber auch ein Lager in Zigarren gehörte.
Quelle: http://www.alemannia-judaica.de/noerdlingen_familienblaetter.htm
http://www.alemannia-judaica.de/images/Noerdlingen/FS-SCHUEHLEIN-SCHIELE.pdf
. |
Rechnung
von Metzgermeister Leopold Siegbert
für Mathilde Rosenfeld (1889) |
 |
 |
 |
Es handelt sich um eine
Rechnung des Metzgermeisters Leopold Siegbert für Mathilde
Rosenfeld. Diese Rechnung wurde auffallenderweise ausgestellt am Tag Ihrer
Beerdigung, dem 20. Februar 1889. Dahinter steht möglicherweise der Gedanke, dass
ein Verstorbener/eine Verstorbene erst nach Begleichung von offenen
Rechnungen beerdigt werden sollte. Rechts der Grabstein für Mathilde
Rosenfeld im jüdischen Friedhof in Pflaumloch.
Leopold (Löw) Siegbert (geb. 8. Februar 1839 in Altenmuhr bei
Gunzenhausen als Sohn des Schumachers Simon Bär Siegbert und der Jeanette
geb. Hirschinger) war von Beruf Metzger, zuerst in Pflaumloch, später in Nördlingen.
Er heiratete am 3. Mai 1866 Ida geb. Mayer (geb. 7. August 1840 in Weimersheim bei Weissenburg).
Das Ehepaar hatte sieben Kinder. Leopold Siegbert starb am 21. Juli 1918 in Nördlingen. Seine Frau Ida Siegbert starb bereits
am 2. Januar 1908 in Nördlingen. Beide wurden beigesetzt im jüdischen Friedhof in Nördlingen.
Sohn Julius Siegbert und seine Frau Sofie geb. Aufhäuser wurden am 2. April 1942
von Nördlingen über München in den Osten deportiert. Beide gelten als verschollen in Piaski.
Magdalena Mathilde (Madle) Rosenfeld war ledig und starb im Alter von 72 Jahren in Pflaumloch.
Als Todestag wird der 18. Februar 1889 genannt. Der Tag ihrer Beerdigung
im jüdischen Friedhof Pflaumloch war der 20. Februar 1889.
Quellen: http://www.alemannia-judaica.de/images/Noerdlingen/FS-SIEGBERT-LEOPOLD.pdf
http://www.alemannia-judaica.de/images/Noerdlingen/FS-SIEGBERT-JULIUS.pdf
http://www.alemannia-judaica.de/noerdlingen_friedhof.htm
Belegungsliste - Gesamt-Dokumentation zu allen im jüdischen Friedhof Nördlingen beigesetzten Personen von Rolf Hofmann sowie Plan zu den erhaltenen Gräbern im jüdischen Friedhof Nördlingen von Rolf Hofmann
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24368&sprungId=3904197&letztesLimit=suchen |
| |
|
|
Über
die Lederfabrik der aus Pflaumloch
stammenden Familie Lebrecht in Ulm
(ohne Jahr)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries) |
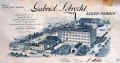 |
|
|
Die Firma hatte ihren Ursprung in
Pflaumloch und nahm ihren weiteren Aufschwung später in Ulm. Gabriel
Lebrecht (geb. 21. August 1802) gründete 1827 eine Firma in Pflaumloch
und spezialisierte sich im Laufe der Jahre immer mehr auf den Handel mit
Leder. Um 1860 zogen Gabriel Lebrecht mit Frau Bertha und sein Bruder
Heinrich, der mit Gabriel zusammen die Lederhandlung führte, nach Ulm.
Ende der 1890er-Jahre wurde von den Söhnen Gustav, Oskar und Wilhelm
Lebrecht auf dem Areal zwischen der Wieland- und Thalfingerstraße eine
Lederfabrik erbaut, die in den folgenden Jahren immer mehr vergrößert
wurde.
Weiteres siehe: Zeugnisse zur Geschichte der Juden in Ulm. Erinnerungen
und Dokumente. Hrsg. vom Stadtarchiv Ulm. Ulm 1991: darin Bericht von
Richard Lebrecht (geb. 1909 in Ulm). |
| |
|
|
Mitteilung der Stadtdirektion Stuttgart
an das Schultheißenamt Pflaumloch über die
Ausstellung eines Reisepasses für Jenny Horwitz (1920)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries)
|
 |
 |
|
Die Mitteilung der Stadtdirektion Stuttgart
über die Ausstellung eines Reisepasses für Jenny Horwitz wurde vom 3. April
1920 an das Schultheißenamt Pflaumloch geschickt.
Jenny Horwitz wurde am 1. September 1889 in Pflaumloch geboren. Ihre Eltern
waren der israelitische Religionslehrer Wolf Horwitz und seine Frau
Hannchen
geb. Weill. 1928 heiratete Jenny Horwitz den am 4. Juni 1897 in
Herne/Westfalen geborenen Alfred Scherer. Dieser führte in Wiesbaden in der
Kirchgasse ein Zigarrengeschäft. Nach der Heirat zog das Ehepaar in die
Adelheidstraße 82 und lebten dort bis zu ihrer Deportation am 10. Juni 1942
nach Lublin in Polen. Bereits am 26. Juni 1942 wurde Alfred Scherer in
Majdanek ermordet. Wo und wann Jenny Horwitz zu Tode kam ist nicht bekannt.
Vermutlich wurde Sie noch 1942 in Sobibor ermordet. An das Schicksal von
Alfred und Jenny Scherer erinnern heute zwei Stolpersteine in der
Adelheidstraße 82 in Wiesbaden. Jennys Vater Wolf Horwitz zog nach seiner
Tätigkeit in Pflaumloch mit seiner Familie nach
Stuttgart-Bad Cannstatt, wo
er bis zu seinem Tod 1905 seiner Tätigkeit als Schochet und Synagogendiener
in der israelitischen Gemeinde nachkam.
Quellen: -
https://www.am-spiegelgasse.de/wp-content/downloads/erinnerungsblaetter/EB-Scherer.pdf
-
Zum Tod von Synagogendiener Wolf Horwitz in Cannstatt (1905; interner Link)
-
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Jenny_Scherer_geb._Horwitz,_Adelheidstr._82_(Wiesbaden).jpg
-
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Alfred_Scherer,_Adelheidstr._82_(Wiesbaden).jpg
|
| |
|
|
Grabstein
aus der Familie Lebrecht
im jüdischen Friedhof in Pflaumloch
(Foto: Peter Karl Müller,
Aufnahme vom 15. April 2007) |
 |
 |
| |
Grabstein für
Löw Lebrecht, dem Namensgeber und Gründer der Lederfabrik
Lebrecht.
Löw lebte sein ganzes Leben in Pflaumloch und starb dort 1844 im Alter
von fast 84 Jahren. |
| |
|
|
|